Thomas Bernhard: Auf der Erde und in der Hölle
MIT SECHSUNDZWANZIG JAHREN
Sechsundzwanzig Jahre
der Wälder, des Ruhms und der Armut,
sechsundzwanzig Neujahrstage und keinen Freund
und den Tod
und immer wieder die Sonne
und kein Paar wasserdichte Schuhe gegen die
aaaaaErschütterungen der Erde.
Sechsundzwanzig Jahre
wie im Traum, ein schlecht gesungener Choral
unter dem Wind im April,
und kein Haus und keine Mutter
und keine Vorstellung von Gott, dem Vater, der aus den Taglöhnern spricht.
Sechsundzwanzig Jahre
unter Biersäufern, Heiligen, Mördern und Irren,
in der Stadt und in angeschwollenen Dörfern,
täglich erschaffen und täglich ausgespieen,
von Weihnacht zu Weihnacht schwankend,
kein Schuster, kein Gastwirt, kein Bettler,
ohne Gitarre und ohne Bibel,
im Oktober krank vor Heimweh,
im August todkrank vor Blumen.
Sechsundzwanzig Jahre,
die niemand erlebt hat,
kein Kind, kein Grab und keinen
Totengräber, mit dem ich reden könnte an einem Biertisch.
Sechsundzwanzig Jahre
in einer einzigen Ungerechtigkeit gegen alle,
versoffen unter den Mostfässern meines Vaters,
in faulen Tälern
verspielt und verlassen mit Gelächter,
nichts als Schnee und Finsternis
und die tiefen Spuren der Väter,
in denen meine tödliche Seele zurückstapft.
„Auf der Erde und in der Hölle“
− Thomas Bernhard als Lyriker. −
Auf der Erde und in der Hölle: von diesem Titel eines Gedichtbandes, den ich 1957 in einer Tübinger Buchhandlung sah, ging sofort so etwas wie ein Sog aus; er bezeichnete fast übertrieben genau das Lebensgefühl des Zwanzigjährigen, der ich damals war. Blutrot hob sich dieser Titel von einem tiefschwarzen Buchumschlag ab, der aus abwaschbarem Kunststoff war. Und blutrot stand da zuoberst der Name des Titelhelden, der Dichtername Thomas Bernhard. Im Innern des Gedichtbandes fand sich eine biographische Notiz, aus der hervorging, daß dieser Thomas Bernhard kaum älter war als sein jüngster Leser und einer „Salzburger Bauern- und Schmalzhändlerfamilie“ entstammte. Auch ein Dichterlob war dem Band bereits beigefügt: „Diese Gedichte sind vielleicht die größte Entdeckung, die ich in den letzten zehn Jahren in unserer Literatur gemacht habe.“ Eigentlich wäre mir damals ein von einem Carl Zuckmayer derart Gepriesener sofort suspekt gewesen, doch der eigene Blick in Bernhards Gedichtband erweckte dann eine geradezu blinde Begeisterung, die mich nicht nur Zuckmayer rasch vergessen ließ, sondern offenbar auch das kritische Instrumentarium für Lyriklektüre, das ich mir schon erworben zu haben glaubte. Ich schwärmte nur noch – von Thomas Bernhard. Ausgerechnet die Redakteurin einer kommunistischen Zeitschrift (die heute noch vergessener ist als der Kommunismus) ließ sich von meiner Bernhard-Schwärmerei anstecken und räumte mir in Geist und Tat Platz für eine Rezension ein – die erste, die in Deutschland über ihn geschrieben wurde, wie mir Thomas Bernhard später versicherte. Von einer Buchkritik im üblichen Sinne hatte diese freilich wenig an sich, vielmehr lieferte ich etwas zwischen Hymnus und Klage: „Seit Trakl hat Österreich, von Christine Lavant abgesehen, keine so originalen Lyriker mehr erlebt wie Bernhard… Jeder neue Satz von ihm hat die Macht, einen buchstäblich umzuwerfen, so elementar und stets neu tritt er vor einen hin… Hier hat die Dichtung wieder einen wie Rimbaud vergewaltigt, hat einen vom Leben Besessenen gezwungen, eben diesem Leben um ihretwillen zu entsagen.“ Und so weiter und so weiter im überspanntesten Ton, der sich denken läßt, der aber nichts als ein Echo auf Thomas Bernhards poetische Überspanntheiten war, auf die faszinierende Feierlichkeit, mit der dieser Jungdichter sein Unglück zelebrierte.
Es versetzte meiner Bernhard-Begeisterung auch keinen Dämpfer, als dann Ingeborg Bachmann, der ich den Band Auf der Erde und in der Hölle geschickt hatte, um auch sie mit meiner Begeisterung anzustecken, eher kühl zurückschrieb: „Er – Bernhard – ist schon da, – ganz in dem Trieb, die Gedichte zu schreiben, und noch nicht in den Gedichten selber.“ Daß dieselbe Ingeborg Bachmann wenige Jahre später in einem „Versuch“, der Fragment blieb, Thomas Bernhard über Beckett und neben Kafka stellte, und daß Thomas Bernhard selbst später in seinem Roman Auslöschung Ingeborg Bachmann so huldigte wie er keinem Dichter und keiner Dichterin je zuvor gehuldigt hat, ist eine ganz andere Geschichte.
Den meisten Thomas-Bernhard-Bewunderern dürfte heute der Lyriker Thomas Bernhard – und damit Thomas Bernhards Eintritt in die Literatur – unbekannt sein, obwohl Bernhard selbst 1981 noch einmal einen Band Gedichte, den er 1959/60 geschrieben und der seine lyrische Phase beendet hatte, unter dem Titel Ave Vergil in der Bibliothek Suhrkamp erscheinen ließ – und zwar mit der Begründung, nirgendwo sonst ließe sich so gut die „Verfassung“ studieren, in welcher er sich gegen Ende der fünfziger Jahre befunden habe: „In dieser Zeit, nach dem Abschluß des Mozarteums, beschäftigten mich neben meinen Theaterstudien vor allem die Schriften Eliots (The Waste Land), Pounds, Eluards, sowie César Vallejo und die Spanier Alberti und Jorge Guillén.“ Man sieht Bernhards Gedichten diese Beschäftigung erstaunlicherweise überhaupt nicht an, es sei denn, man verstünde den durchgehend erhöhten Ton und das kaum je gebremste Pathos in diesen Gedichten als Reflex auf die genannten Autoren, die ja, so unterschiedlich ihre lyrischen Schreibweisen auch waren, zumindest die Prämisse des entschieden anderen Sprechens miteinander verband. Was von ihnen allen den Lyriker Thomas Bernhard aber gründlich unterscheidet, das ist der Ort seiner Gedichte, der nur ganz ausnahmsweise einmal die Stadt, also der Ort der kulturellen Vermittlung und der Moderne, sondern zumeist das Land ist – und damit der Ort der kulturellen Vereinzelung und der Antimoderne. Land ist bei Bernhard auffallenderweise nie identisch mit Natur, sondern mit den ihr Ausgelieferten und von ihr Zugrundegerichteten, den vielen Versoffenen, Verkrüppelten, Verrohten, Verrückten, die nicht nur Bernhards Prosa, sondern auch schon seine Lyrik bevölkern, auch wenn sie dort noch nicht die von ihm Bloßgestellten, sondern eher die schaudernd Angerufenen sind („Mit den Verbrechern und mit den Ungeschützten / werde ich eine neue Heimat gründen“).
„Die Natur ist von Natur aus verbrecherisch“, heißt es in einer frühen Bernhard-Erzählung. Und in „Wittgensteins Neffe“ erklärt der Erzähler: „Tatsächlich liebe ich alles, nur nicht die Natur.“ Auch noch im Gespräch mit André Müller von 1979 bekannte Bernhard: „Die Natur interessiert mich überhaupt nicht.“ Tatsächlich ist Natur in Thomas Bernhards Werk nie angeschaute Natur, sondern – und in stets zunehmendem Maße – abgewehrte Natur. In seiner frühen Lyrik geschieht diese Abwehr aber noch nicht forciert aggressiv, sondern unter Schmerzen und Schuldgefühlen. Der junge Thomas Bernhard rühmt noch die „geliebte Bauernerde“, doch fühlt er sich ihrer und auch seiner eigenen bäuerlichen Vorfahren nicht sicher:
Ich bin unwürdig dieser Felder und Furchen,
aaaaaunwürdig dieses Himmels, der seine wilden Zeichen
in mein Gedächtnis für ein neues Jahrtausend schreibt,
aaaaaunwürdig dieser Wälder, deren Schauer
mit den Gewittern der Städte hereinbricht in mein Altern.
…
Ich bin unwürdig dieses Grases, das meine Glieder kühlt,
aaaaader Baumstämme, die der Norden
in ihr grausames Gebrechen treibt mit dem Regen
aaaaaund den Schatten der Burschen,
die dem Most ihr Novemberopfer darbringen
aaaaaunter den schwarzen Hügeln, die meine Vergänglichkeit tragen.
…
Unwürdig bin ich der Amsel, unwürdig dem Knarren des Mühlrads,
unwürdig treib ich mein Spiel an den Ufern des Flusses,
aaaaader von den Dörfern nichts wissen will.
Ich bin unwürdig dieser Seelen, die in Wolken und Büschen
aaaaazueinander sprechen von der blühenden Erde,
von des sterbenden Himmels Musik…
…
Entsprechend endet das Gedicht über den Urgroßvater, der ein Schmalzhändler war, mit den Zeilen:
Er würde mir kein Stück Speck geben
für meine Verzweiflungen.
Es gibt in diesen frühen Gedichten Thomas Bernhards durchaus noch Bäume, Blüten, Wiesen, Äcker, Vögel und sogar „die Poesie des Schweins“, doch werden die Naturerscheinungen bereits mehr rhetorisch eingesetzt als wirklich erkannt und gesehen. Das Gefühl, daß sich die Natur ihm entzieht – „Die Wiesen schicken mein Leben / zurück in die Städte“ −, löst im Dichter immerhin noch Klage aus: „Was werde ich tun, / wenn keine Botschaft mehr kommt aus den Gräsern?“ Die Stadt – zumal die Hauptstadt seiner Heimat („eine Verstorbene an der Donau“) – bietet dem jungen Dichter nur das Bild von Erbärmlichkeit und Fäulnis, von Tod. Einzig sein Gelächter – „Gelächter der Hölle“ – läßt ihn dort „die Menschenfalle, in die ich gelaufen war, / vergessen“, – wenigstens für Augenblicke. Denn in Wahrheit ist dieses Höllengelächter noch keineswegs wie beim späteren Thomas Bernhard, bei dem es dann zum hauptsächlichen Abwehr- und Ausdrucksmittel wird, beliebig von ihm produzierbar und einsetzbar. So daß in der fürchterlichen Leere, in die er sich hier wie dort, auf dem Land wie in der Stadt, gestoßen sieht, nur ein Rettungsmittel bleibt gegen die Vernichtungsgefühle, die ihn heimsuchen, ein scheinbar altbewährtes Rettungsmittel: Gott.
Der junge Thomas Bernhard, der seinem ersten Gedichtband nicht von ungefähr ein Motto des vom Renouveau catholique herkommenden Dichters Charles Péguy vorangestellt hat, ist nicht nur dort, sondern auch in den beiden folgenden Gedichtbänden In hora mortis und Unter dem Eisen des Mondes (beide 1958) überraschend schnell mit Gott bei der Hand, wenn Furcht und Zittern sich bei ihm einstellen, – und fast ebenso schnell mit des Christengottes bisher bestem Gelehrtenkopf auf Erden, mit Pascal („ich, der Metzgersohn, / sitze mit meinem PASCAL im Schlachthaus…“). Dessen Ansprüchen dürfte Thomas Bernhard allerdings nicht ganz genügt haben, wandte Pascal sich doch ebenso gegen jene, die den Menschen preisen, wie gegen jene, die ihn verdammen oder die ihn zu zerstreuen trachten, und ließ nur jene gelten, „die stöhnend suchen“; Thomas Bernhard aber wurde, trotz starken Stöhnens, dann doch mehr und mehr zum Verächter des Menschen als zum Sucher.
Der junge Thomas Bernhard legt sowohl in der hadernden Hiobsrolle wie in der erlösungssüchtigen Identifizierung mit Jesus noch eine religiöse Inbrunst an den Tag, von der allenfalls die Allmachtsphantasien, die durch sie auch in Gang gesetzt werden, ins spätere Werk des Dichters Eingang fanden, wenn auch unter sehr anderen und sicher nicht mehr christlichen Vorzeichen. Doch in den „Neun Psalmen“ aus seinem Debütbuch tritt der junge Dichtersmann noch ungebrochen als Gottesmann, ja Gottschöpfer auf den Plan:
Ich werde an den Rand gehn,
an den Rand der Erde
und die Ewigkeit schmecken.
Ich werde die Hände anfüllen mit Erde
und meine Wörter sprechen,
die Wörter, die zu Stein werden auf meiner Zunge,
um Gott wieder aufzubauen,
den großen Gott,
den alleinigen Gott.
Wer Psalmen schreibt, redet Gott an – und nicht die Menschen. Wer Psalmen schreibt und erkennen muß, daß er mit ihnen Gott doch nicht vergegenwärtigen kann, weil Gott, wie Simone Weil es einmal ausgedrückt hat, „nur in der Form der Abwesenheit anwesend sein kann“, der müßte sich, meint man, wieder an den Menschen wenden. Nicht so Thomas Bernhard, der sich nach der vergeblichen Himmelfahrt seiner poetischen Psalmen bekanntlich lieber auf die Höllenfahrt seiner Prosa und Dramatik verlegte – und mit der Gottsuche auch die Menschensuche einstellte: Man versteht freilich auch sein späteres Werk – sein Hauptwerk – nicht wirklich, wenn man es nicht unter den eschatologischen Vorzeichen sieht, die Bernhards frühe Lyrik so unübersehbar bestimmen. Sowenig wie man es wirklich begreifen kann ohne Kenntnis seiner frühen TBC-Erkrankung oder ohne Kenntnis dessen, was der junge Thomas Bernhard zwei Jahre lang in Salzburg war, nämlich Gerichtsreporter, und was er eigentlich werden wollte, nämlich Sänger. Er ist beides in einem übertragenen Sinne doch noch geworden, nämlich ein Ankläger und ein Artist, einer, der sich sozusagen ein festes Klagen- und Anklagen-Repertoire erarbeitete, in dem es gerade noch kleinere Varianten, aber nie mehr Novitäten gab, und das durch die Virtuosität bestach, mit der hier große Qualen in perfekte Koloraturen verwandelt wurden.
War der Artist Thomas Bernhard vielleicht der schlimmste Feind des Schriftstellers Thomas Bernhard? Wenn man die Entwicklung vom Lyriker Bernhard zum Prosa- und Theaterautor aufmerksam verfolgt, so stellt man leider fest, wie sich die existentielle und radikale Verzweiflung, die den jungen Thomas Bernhard zum Gedichteschreiben zwang, später bei ihm mehr und mehr in eine selbstgefällige, ja auftrumpfende Verzweiflung und schließlich sogar in reine Verzweiflungsroutine abschwächte. Das gilt ganz sicher noch nicht für die frühe Prosa der Erzählungen („Amras“, „Ungenach“, „Watten“) oder der ersten Romane (Frost, Verstörung und Kalkwerk), aber doch für fast alle Theaterstücke und für die meiste spätere Prosa, die nicht mehr einen Prozeß durchmacht, wie er nur durch geduldiges Sicheinlassen auf die Wirklichkeit – oder das Erleben der Wirklichkeit gewährleistet wäre, sondern die quasi jongliert – eben artistisch jongliert – mit dem von vornherein Fix-und-fertig-Gewußten, also dem Vorgefaßten – und eben deshalb Falschen.
Es kann dieser Prosa sozusagen nichts mehr zustoßen, weil sie sich gar nicht mehr auf Welt einläßt oder sich der Welt öffnet – und deshalb auch dem Leser keine Räume mehr zu öffnen oder den Blick zur Weltoffenheit zu weiten vermag. Statt eine Vision zu vermitteln, wie das die Gedichte doch wenigstens noch wollen, legt sie fest und verengt den Blick; statt unauffällig und hartnäckig Zusammenhänge zu stiften, insistiert sie auf dem Vereinzelten. Ihre unbestreitbare Wirkung erzielt sie nur noch durch ihre rasante Repetitionsrhetorik und Übertreibungsmanie (die dann oft doch nur zur Übertreibungsmasche wird), durch das, was Peter Handke einmal ihre „Suggestionssuada“ genannt hat. Und natürlich durch Bernhards Wut und seinen Zorn, die zwar auch in den Gedichten schon vorhanden, aber noch sehr kontrolliert sind.
Der Zorn war es bezeichnenderweise, den sich Thomas Bernhard zum Thema wählte, als ihn 1965 Hans-Geert Falkenberg um einen Beitrag für seine Anthologie Die sieben Todsünden bat. „Der Zorn ist die dauernde Inthronisation aller Ursprünge“, schrieb Thomas Bernhard damals, „er ist die größte aller Naturgewalten, die allermächtigste, die uns immer wieder und die uns einmal für immer vernichten wird.“ In dieser Formulierung war der Zorn durchaus noch allumfassend, also auch gegen sich selbst, gegen den Zornigen, gerichtet. Später verkam auch Bernhards großer Zorn zunehmend zur zänkischen, sich selbst verschonenden Misanthropie, er war nicht mehr gerechter Zorn, sondern selbstgerechter Zorn oder auch nur blinder Haß (Haß ist immer blind); „in Haß und Verachtung auch verliebt zu sein“, gestand Bernhard noch 1987 Asta Scheib. Man muß froh darüber sein, daß die politischen Konstellationen, in die Thomas Bernhard hineingeboren wurde, so andere waren also etwa zu Zeiten des nicht weniger hassenden und zornigen Céline, der, nachdem ihm sein gerechter Zorn abhanden gekommen war, zum antisemitischen Pamphletisten pervertierte. Bei Thomas Bernhard war wenigstens die Richtung seiner Gegnerschaft meist die richtige, wenn es mit der Zeit auch ermüdete, wie wahllos Bernhard alle Welt auf die Nazirolle festlegte.
Wer mit Peter Handke voraussetzt, daß gute Literatur „aus dem Erleben der Dinge und der Gerechtigkeit diesem Erlebnis gegenüber“ resultiert, der muß auch einräumen, daß Thomas Bernhards Schreibtisch sicher kein „Ort des Gerechtwerdens“ (Handke) war, sondern einer des Gerichts, der Aburteilung. Eine Voraussetzung für jedes Gerechtwerden wären Ruhe und Abstand, das was Rilke „heilige Langsamkeit“ nannte oder Robert Walser „ein fortwährendes Ansichhalten“. Doch der Autor, der verkündete, wir alle hätten „nur ein Anrecht auf das Unrecht“, war für Langsamkeit und Abstand nicht geschaffen. Nicht zufällig sein Stifter-Haß. Und sosehr er auch selber auf den größtmöglichen Abstand zu den Menschen bedacht war, sowenig verließ ihn doch auch in der Isolierung die Hast, ja Überhastung, gegen die er in seinen Büchern seine Repetitionsmaschinerie in Gang setzte.
Diese Überhastung, dieses Manische belastet auch bereits Bernhards Gedichte, von denen nur ganz selten eines sein sicheres Maß findet, die meisten aber etwas Überlaufendes, eben Maßloses an sich haben, ein Eindruck, der sich durch den Hang zur Übertreibung und zum Superlativischen, der ebenfalls schon der Lyrik Bernhards eignet, noch verstärkt. „Dies ist das Laster meines Gehirns, das von Millionen Vokabeln zerstört ist“, heißt es in einem Paris-Gedicht – und in einem andern Gedicht ist die Rede von den „Klagen meines Fleisches, das / durch zehntausend und mehr Messer gegangen ist“; zehntausend Messer hätten es zur Not auch getan.
Nicht nur solche Maßlosigkeit erinnert in schlechtem Sinne an expressionistische Lyrik, sondern etwa auch die Sucht nach Genitivmetaphern wie „Musik meiner Gebrechen“, „Riffe des Traums“, „Gelächter der Sterne“, „Hölle meines Blutes“, „Messer der Schwermut“ oder sogar „Kriegsschiffe meiner Verzweiflungen“, die Bernhards Lyrik auch einen Zug ins Epigonale geben. Es ist nötig, sich vor Augen zu halten, daß fünf Jahre vor Bernhards Auf der Erde und in der Hölle Ingeborg Bachmanns Gedichtband Die gestundete Zeit und ein Jahr davor, 1956, ihre Anrufung des großen Bären und daß bereits 1952 Paul Celans erster Gedichtband Mohn und Gedächtnis erschienen waren; gemessen an diesen beiden Dichtern, aber auch an der zu Unrecht immer noch weit weniger bekannten Christine Lavant (für die sich, zu seiner Ehre sei’s gesagt, Thomas Bernhard selbst noch einsetzte, indem er 1987 eine Auswahl ihrer Gedichte in der Bibliothek Suhrkamp herausgab), nimmt sich der Lyriker Thomas Bernhard ziemlich unoriginell aus. Seiner Lyrik fehlt sowohl Celans so absichts- wie bedeutungsvolles Dunkel, das Hermetische also, wie Ingeborg Bachmanns zum Parlando gebändigte vollkommen sinnliche Verzückung – und ebenso auch Christine Lavants bäuerlich-religiöse Elementargewalt.
Das Beste der Bernhard-Gedichte ist, so paradox es klingt, vielleicht gerade das, was als ihre Schwäche, als ihre Hilf- und Ratlosigkeit ins Auge springt. Später kam Bernhard diese große leidenschaftliche Ratlosigkeit mehr und mehr abhanden, was auch an dem viel zu raschen Erfolg gelegen haben mag, der ihn ereilte, und den er zwar verachtete, dem er aber doch auf den Leim ging, weil er die Verurteilungs- und Vernichtungslitaneien und die Abservierattitüden, die ihn bewirkt hatten, beliebig zu reproduzieren bereit war. Weil er ein Manierist wurde.
Am Befund der klugen Ingeborg Bachmann ist also wohl nicht zu rütteln: „Er ist schon ganz da, – ganz in dem Trieb, die Gedichte zu schreiben, und noch nicht in den Gedichten selber.“ Eine Ausnahme bilden allenfalls Bernhards letzte, nicht mehr in Buchform oder vielmehr nur in Anthologien und Zeitschriften erschienenen Gedichte. Als mir Thomas Bernhard 1964 einige dieser Gedichte für meine Anthologie Aussichten gab, die ich damals vorbereitete, glaubte er vermutlich selber nicht mehr an den Lyriker Thomas Bernhard. Doch gerade weil das wohl so war, hätte er zu diesem Zeitpunkt schwerlich noch Gedichte aus der Hand gegeben, derer er sich geniert hätte. Tatsächlich können einige seiner lyrischen Nachzügler noch am ehesten so etwas wie Haltbarkeit für sich beanspruchen, haben sie sich doch ebenso freigemacht vom suggestiven Poetisieren der Wirklichkeit wie vom Posieren mit der eigenen Leidensfähigkeit und der Stilisierung zum Schmerzensmann.
Daß Schmerz, realer Schmerz, auch ihr Auslöser und ihr Lehrmeister war, zeigt das knappste von ihnen, das durch eine Kargheit rührt, die bäuerlicher Sprachscham zu entstammen scheint; „Schmerz“ ist es auch überschrieben:
Ein Frauensarg,
aaaaawas ist das für ein Schweigen?
Ein Kindersarg,
aaaaawas ist das für ein Lohn?
Was ist denn das im Vorhaus?
aaaaaWas ist das in den Zweigen?
Was ist das für den Vater?
aaaaaWas ist das für den Sohn?
Peter Hamm, Die Zeit, 26.4.1991
Sören Heim: Die „großen“ Essays anderswo, VII: Thomas Bernhard als Lyriker
THOMAS BERNHARD LIVE
„Es ist alles eine Frage der Zeit,
und diese Frage erschreckt uns nicht mehr,
seit wir wissen, daß wir am Ende sind
und das Leben vor uns keinen Sinn mehr hat.“
Den Mund
an die dunkle Scheibe gepreßt
antwortet der sich selber totsagt
antwortet auf Fragen
die nicht gestellt werden
weiß keine Antwort
Als verschwinde
kaum aufgegangen der Mond
hinter den Wolken
Dieses Rauschen im Kopf
bevor sich das Bild einstellt
Ein Gesicht
von unsichtbarer Hand
aus dem Dunkel geholt
fällt ins Dunkel zurück
löst sich auf
wie Tabletten
„… das weiße, trübe Getränk…
wir wollten nicht mehr,
nicht mehr sein,
nichts mehr sein…“
Ich höre die Stimme
die sich einschließt
in schwarzen Büchern
wie die Menschen
von denen sie redet
im Turm von Amras
im Kalkwerk
Der nichts mehr hören will
redet und redet
findet immer noch neue Sätze
für das was zu sagen ist
in einem Satz
„Es ist alles lächerlich,
wenn man an den Tod denk“
Warum lacht denn hier niemand
warum versinken alle
schweigend
in ihren Sesseln und warten
wie hypnotisiert
daß es hell wird?
Als würden die Vorhänge
zurückgezogen
im Sterbezimmer
Doch die Sonne
ist nur ein Scheinwerfer
die schöne Landschaft
ein Einfall des Regisseurs
Schalt endlich den Fernseher aus
Ich kann das nicht mehr mitansehen
wie einer sich öffentlich
hinrichtet
Jürgen Peter Stössel
VERWIRRENDE KINDHEIT
für Thomas Bernhard
Blut, Eiter, plötzliches Niedersacken
der Pferde beim Fleischhauer
Särge, offen –
„Schau!“ sagt die Großmutter
Liebe zum Großvater mütterlicherseits
Er ist die Figur. Man ist allein.
Man ist allein.
Man ist allein.
Man ist immer allein
und wenn man Bücher schreibt
ist man noch mehr allein
Jürgen Völkert-Marten
Zum 15. Todestag – Cornelius Hell: Gott vernichten. Die bislang unbekannte Zensur seines ersten Lyrikbandes wirft ein neues Licht auf Bernhards Verhältnis zur Religion.
Zum 30. Todestag – Archivaufnahmen und Lesungen von und mit Thomas Bernhard
Die Lange Nacht über Thomas Bernhard
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Yossi Sucary: Dem Urteil der Anderen entkommen
die taz, 9.2.2021
Willi Winkler: Ohne Bernhard geht es nicht
Süddeutsche Zeitung, 9.2.2021
Deborah Ryszka: Der Letzte seiner Art
achgut.com, 9.2.2021
Gerrit Bartels: Meister im Demütigen
Der Tagesspiegel, 8.2.2021
Nikolai E. Bersarin: „Die Ursache bin ich“ – Thomas Bernhard zum 90. Geburtstag
bersarin.wordpress.com, 9.2.2021
Matthias Greuling: „Geh her da, Thomas Bernhard“
Wiener Zeitung, 9.2.2021
Felix Müller: „Kein Kritiker hat meine Bücher je verstanden“
Berliner Morgenpost, 9.2.2021
Bernhard Judex: Meister der Irritation
literaturkritik.de, Februar 2021
Marc Thill: Thomas Bernhard, ein Meister der Negation
Luxemburger Wort, 9.2.2021
Die Furche: Zum 90er von Thomas Bernhard
Thomas Bernhard auf perlentaucher.de
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv 1 & 2 +
Internet Archive + Kalliope + KLG + IMDb +
Hommage + Gespräche mit André Müller 1 & 2 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA
Nachruf auf Thomas Bernhard: Tumba
Thomas Bernhard im Gespräch mit Janko von Musulin, 1967.
Ferry Radax: Thomas Bernhard / Drei Tage Hamburg 6. Juni 1970.
Keine Antworten : Thomas Bernhard: Auf der Erde und in der Hölle”
Trackbacks/Pingbacks
- Thomas Bernhard: Auf der Erde und in der Hölle - […] Klick voraus […]


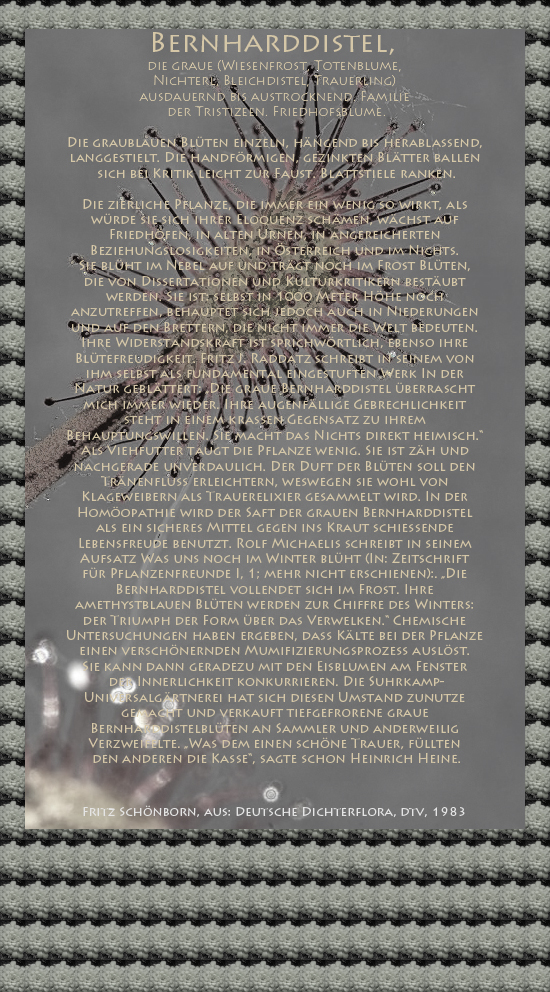
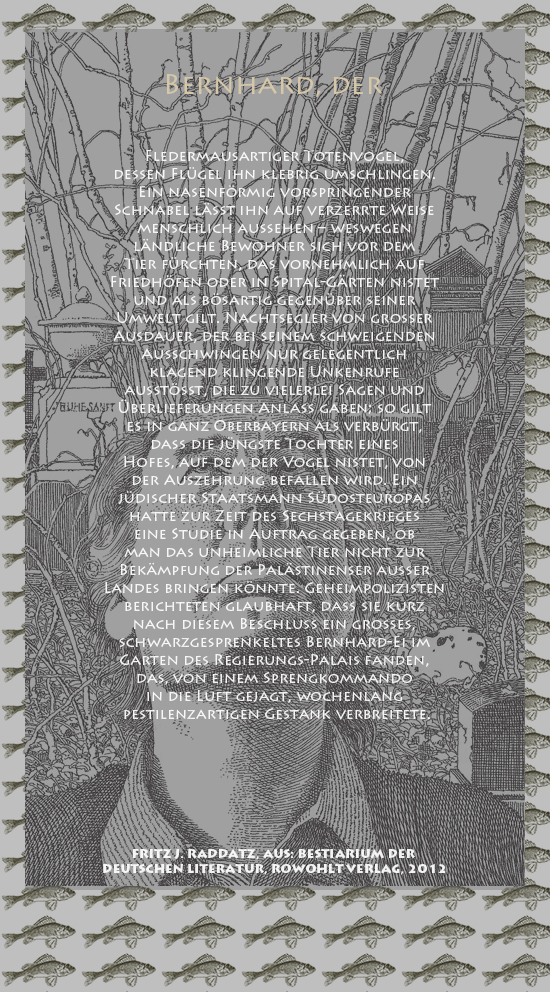












Schreibe einen Kommentar