Thomas Kling: Das brennende Archiv
FILM UND MÜNDLICHE MITTEILUNG
ein heimatgedicht? die andere rheinseite:
ich seh das wie im film; in alter schreib-
weise. letterngehetzt. schreib mir 45
zeilen! ich schrieb fünfundvierzig.
danach? gingen wir in den ratinger hof;
wir waren hofgänger (mündliche mitteilung).
und sahen:
die sound-
sovielten, die üblichen, bilder pro sekunde:
von lichtpfeilen getroffener sebastian. die ton-
spuren nicht zu löschen. ich hatte die kürzel
tk
Thomas Kling: Herz
Mehr als ein Jahr habe ich lesend im Brennenden Archiv von Thomas Kling verbracht, einen Monat verbringe ich nun lesend und schreibend mit dem Brennenden Archiv, eine Lektüre, so beglückend, daß sie schwermütig macht. Hellwach wird man dabei und darf zugleich in jenen eigentümlichen Schwebezustand gleiten, den man als Folge langer, mit intensiven Gesprächen verbrachter Nächte kennt – ein Zustand, in dem man nichts beweisen will und einem nichts bewiesen werden muß, weil man noch im Rausch gefangen ist: Der eigene Körper hat sich verwandelt, in einen Echoraum fremder wie vertrauter Stimmen.
Im Brennenden Archiv lese ich, betrachte ich das Porträt eines Fährtenlesers, eines Fährtenlegers, der in seinem Leser immer einen verwandten Fährtenleser sah. Thomas Kling las und legte Fährten mit Vergnügen. Die Vorstellung, jemand könnte dabei etwas anderes als allergrößtes Vergnügen empfinden, war ihm fremd.
Seinem Gegenüber, seinem Leser gab er mit jedem Wort, jedem Blick, jeder Geste zu verstehen, mit wem man es zu tun hatte – und zugleich war er darauf bedacht, daß man ihm so leicht nicht auf die Schliche kam. Thomas Kling, der sich im Großteil seines Werks als Meister des Verzichts auf die erste Person zu erkennen gibt, legte manche Fährte so diskret, als handelte es sich um ein natürliches Zeichen, das es bei einer Alpenwanderung zu entziffern gilt.
Nicht, daß ich dem Mißverständnis Vorschub leisten wollte, man müsse, um das Werk von Thomas Kling mit Gewinn zu lesen, den Dichter erlebt, ihn gehört, gar kennengelernt haben. Es verhält sich genau umgekehrt: Was mich bei der Zusammenschau dieser Gedichte, Übertragungen, Essays, Selbstaussagen und Bilder überwältigt, ja, was mich, je intensiver ich mich der Lektüre hingebe, zunehmend sprachlos macht, ist die Präsenz des Menschen Themas Kling jenseits des Dichterbildes, mit dessen Hilfe er sich in der Öffentlichkeit gegen Zugriffe gewappnet hat: „herz – brennendes archiv!“
Fährten- und Zeichenlesen mit Thomas Kling, im Naturraum wie in der Kulturgeschichte: Überlebenstechnik und Entdecker-Euphorie.
Er konnte sanfter Lehrer, gewiefter Expeditionsleiter, Berggeist sein.
Und Finten – ja, auch Finten legte Thomas Kling wie kein zweiter.
Der Gedanke an Archive, insbesondere an Schriftstellerarchive, bereitete ihm Unbehagen, wie er mir deutlich zu verstehen gab, als wir uns im Februar 1988 kennenlernten und zum ersten Mal einen Nachmittag lang zusammensaßen, im Café Anzengruber, Thomas Klings damaligem Stammkaffeehaus in Wien. Seltsame Skepsis, schien mir, für jemanden, der in Bibliotheken und im gut sortierten Antiquariatsbuchhandel zu Hause war, wo Randanstreichungen und eingelegte Briefe hochwillkommene Anlässe sind, um den Schriftraum über den Satzspiegel hinauswachsen zu lassen.
Den Kontakt zwischen uns hatte Friederike Mayröcker hergestellt. Ich war in jenen Monaten damit befaßt, ihre Manuskripte und Arbeitsmaterialien aus knapp fünf Jahrzehnten zu sichten und zu ordnen – spannender, anregender hätte ich meine Zeit nicht verbringen, mehr nicht über und für das Schreiben lernen können, etwa beim Studium der Materialmetamorphosen in den Fassungen des 1966 erschienenen Tod durch Musen. Dieser Gedichtband war ein Grundbuch sowohl für Thomas Kling als auch für mich, ohne jede Furcht und in grenzenlosem Vertrauen auf die Sprache werden hier die Möglichkeiten der Poesie erkundet, wie bereits das Eröffnungsgedicht vorführt, indem es mit einem Sportpalastredenzitat endet: „(goebbels : ,..wollt ihr den totalen krieg..!‘ – J A A A)“, unkommentiert, ohne Gesinnungseinbettung. Was seinerzeit in der bundesrepublikanischen Literatur undenkbar gewesen wäre, zumal im Gedicht, hat Thomas Kling in den achtziger Jahren womöglich genauso wie ich als Nagelprobe auf die Kraft der Dichtung wahrgenommen: Die Frage nach dem Umgang mit vergifteter Sprache – kein „mann aus reit (rheinland)“, keine Flughunde ohne Friederike Mayröckers Tod durch Musen.
Meinen Wunsch, die Suche nach der richtigen Dosierung von Sprachgift anhand einzelner Textzeugen nachzuvollziehen, verstand er gleichwohl nicht.
Wenige Monate nach unserer ersten Begegnung dann, Anfang Juni 1988, schrieb Thomas Kling in Wien für Friederike Mayröcker das Widmungsgedicht „Hofhaltender Flügel“ – als Folge des Abtrags von Manuskript- und Materialbergen, der legendäre ,unsichtbare‘ Bösendorfer in Mayröckers Wohnung wieder zum Vorschein gekommen war.
Auch der Archivierung eigener Manuskripte und Vorarbeiten konnte Thomas Kling nichts abgewinnen, erinnere ich mich, ja, in seiner späteren Bemerkung, er hebe doch nicht jedes Zettelchen auf, schwang grundsätzliches Mißtrauen mit – aber wem oder was gegenüber? Demjenigen, den die Genese einer Arbeit ebenso in Bann schlägt wie das abgeschlossene Werk? Der historischen Schichtung gegenüber, diesem Resonanzraum, der durch das bloße Zusammentragen von Ausgangsmaterial und verschiedenen Fassungen wie von allein entsteht?
Um so erstaunlicher war es, nach seinem Tod, zu sehen, welche Fülle an Material der Fintenleger Thomas Kling aufbewahrt, gesammelt hatte, von seinen frühesten, Anfang der siebziger Jahre entstandenen Gedichten an: Notizbücher, Sprachinstallationspartituren, Korrespondenzen, aus der Rheinischen Post ausgeschnittene Belege seiner Filmkritiken („ich hatte die kürzel / tk“) und seine Manuskripte, bis zu vierzig Fassungen, bis zum letzten Tag. Ein beachtliches Archiv, auch wenn sich natürlich kaum beurteilen läßt, was jenseits der Reise- und Umzugsverluste („ca. 14 Ende nov. / anfang dez. verlustig gegangen“, notiert er 1989 auf einer Liste mit Titeln neuerer Gedichte) sowie der Widmungshandschriften, die er ihren Adressaten geschenkt hat, fehlt.
Er, der Literaturarchive als Textgräber verspottete, hatte achtsam dafür gesorgt, daß sich vor unseren Augen – historische Schichtung und Spurenkunde – ein lebendiges Bild entfalten kann, daß wir hellwach in einen eigentümlichen Schwebezustand geraten.
Denn jedes Archiv will ja nichts anderes, als seinen Nutzer jenseits der vorgegebenen Systematik zu Entdeckungen anzustiften, zur blitzhaften Verknüpfung weit auseinanderliegender Bestände. Will ihn zum Fährtenleser machen.
Und bei manchem Fund zieht sich – ohne daß die Schwelle zur Indiskretion übertreten würde – das Herz des Finders zusammen: wenn ihm zum Beispiel die „Mitteilungen der Sektion Düsseldorf e.V. im Deutschen Alpenverein“ in die Hände fallen, Der Berg, die Ausgabe vom September 1974. Darin ein Tourenbericht mit der Überschrift „unsere erste eifelfahrt“, in konsequenter Kleinschreibung, was die Redaktion zu einer ausführlichen Anmerkung veranlaßt hat:
Diesen ersten Bericht unserer neuen, ganz jungen Jugendgruppe haben wir original wiedergegeben, spricht doch aus der ,modernen‘ Schriftweise der Wunsch der Jugend, auch im ,BERG‘ ganz ,in‘ zu sein.
Ja, der Name des Tourenberichterstatters lautet: Thomas Kling, und es dürfte sich um seine allererste Veröffentlichung handeln. Die Redaktion merkt weiter an, die Jugendgruppe habe die Eifelhütte inzwischen bereits mehrfach aufgesucht, „um sich für die augenblickliche Kletterfahrt in die Schobergruppe Kondition zu holen“. Auf ebendiese Bergwandertour wird Thomas Kling 1997 in einem Kommentar zu „wolkenstein. mobilisierun‘“ hinweisen: Die „wolkensteinschen (süd)tirollocations“ habe er schon seit Mitte der siebziger Jahre „vom klettern“ gekannt. Eine Schrift des siebzehnjährigen, eine andere des vierzigjährigen Thomas Kling – anrührende wie herzzusammenziehende Fährte – blitzhafte Verknüpfung weit auseinanderliegender Bestände.
Weit auseinanderliegende Bestände haben nun Ute Langanky und Norbert Wehr zusammengetragen – und es blitzt! Das brennende Archiv soll ganz entschieden nicht sämtliche verstreut publizierten Arbeiten Thomas Klings versammeln, gar die unveröffentlichten Texte aus dem Nachlaß erfassen. Die beiden Herausgeber verstehen sich als Arrangeure, sie sind ins Kling-Archiv gestiegen und offerieren uns eine kluge, feinste Beziehungsspuren sichtbar machende Komposition, die vorführt, wie der Schriftraum über den Satzspiegel hinauswachsen kann.
So stellt Das brennende Archiv selbst für Leser, die Thomas Klings Veröffentlichungen in Zeitschriften und Sammelbänden über die Jahre hinweg verfolgt haben, eine Überraschung dar. Hier zeigt sich, zumal für Menschen, die ihn nicht persönlich kannten, eine Facette seiner Dichterfigur, die zu Lebzeiten des Dichters kaum beachtet wurde: ein Kling der Zuschreibung, der euphorischen Nachbarschaftswahrnehmung, der Eloge.
Wer sich an den Schluß des 1986 in erprobung herzstärkender mittel veröffentlichten Gedichts „zuleiberücken“ erinnert, an Klings damals unter Schreibenden wie eine feststehende Redensart kursierende Formulierung: „WANN ENDLICH GEWÖHNEN SICH / DIESE DICHTERIDIOTEN IHRE ABGETAUTEN / VEREISUNGSMETAFFERN AB“ – der wird sich die Augen reiben, wenn er im 2002 geschriebenen Lob auf Tomas Venclova einen Satz wie diesen liest:
Die Zeit ist ihm eine wichtige Metapher, ebenso nördliche Kälte- und Vereisungsmetaphern.
Aber hat Thomas Kling tatsächlich bereits 1992 nicht nur seine Wachsamkeit, sein Mißtrauen gegenüber den Sprachen herausgestrichen, wie jeder Kling-Leser und -Nichtleser es erwarten konnte, sondern im anschließenden Satz das Wort ,Liebe‘ verwendet, von der Liebe zur Sprache und der Neugier sprechend, die „trotz vielem, und mich selbst immer wieder verblüffend, noch vorhanden“ sei? Ja, hat er. Und 1994 bereits einem Kollegen, einem lebenden, jüngeren Dichter, nämlich Oswald Egger, attestiert, „ein liebevoller, also nicht-zynischer, Konnaisseur“ zu sein? Ja, auch das – und ich habe es damals nicht gehört, habe das Wort ,Liebe‘ bei Thomas Kling einfach überlesen, entdecke es erst jetzt, da mir in der Zusammenschau deutlich wird, wie liebevoll er seinerseits über von ihm geliebte Dichter spricht.
„Wir schätzen und lieben sie“, schreibt er über Inger Christensen, „weil sie eine einfühlsame, zuzeiten ekstatische Beobachterin ist“, bemerkt an Robert Frosts Gedichten, „mit welch liebevollen Detail-Beobachtungen sie aufwarten“, erinnert an „eine wunderschöne, zarte, eine anthropomorphe Beschreibung des Düsseldorfer Hofgartens“ von Heinrich Heine, bei der Lektüre Andrea Zanzottos bewundert er, wie der Dichter „Antikenverwaltung und Medienkritik“ „martialisch und zart verknüpft“.
Nicht, daß er darüber seinen Scharfblick verlöre, aber einen so aufmerksam entspannt fremde Text- und Bildweiten erkundenden Thomas Kling hat man noch nicht gelesen. Der Blick des jungen Künstlers – er ist nicht alt geworden, lassen wir also den Unsinn beiseite, den ,frühen‘ gegen einen ,späten‘ Kling auszuspielen –, der Blick des jungen Künstlers unter dem festverleimten, dabei doch äußerst zerbrechlichen Wespenhut hervor fixiert seinen Betrachter, als wolle er ihn nicht entwischen lassen – und lädt ihn zugleich zum Flanieren ein. Flanieren im Bild, Flanieren in der Textlandschaft, die mit dem Brennenden Archiv vor seinen scharfen Augen ausgebreitet wird. Flanieren: als aufmerksame, bei jedem Schritt für unverhoffte Entdeckungen und Verknüpfungen offene Fährtensuche verstanden.
Allein diese Bilder, diese Bildersprache über die Jahre hinweg: Im Mai 1985 präsentiert er sich als Wespenbanner, der seine Arbeit erfolgreich erledigt hat – das aufgebrochene, entvölkerte Wespennest in seinen Händen dient ihm als Beweis, ist die Trophäe. Als Hut getragen allerdings reicht es in eine andere Sphäre, macht es den Insektenvernichter insektenähnlich, zeigt seine Wespennähe an. Ein Jahrzehnt später ist aus dem Wespennest ein Schamanenhut geworden, und wieder changiert das Bild: Einerseits betrachten wir Thomas Kling in einer Selbstinzenierung als Schamane, der den Geist erlegter Tiere einfängt und Tiersprache in Menschensprache übersetzen kann, andererseits das Porträt eines Ethnologen, der vorführt, wie man sich einen historischen Schamanen vorzustellen hat. Doch Vorsicht – er, der uns nicht entwischen lassen will, entwischt uns, sobald wir glauben, wir hätten die Figur auf diesen Photographien festgemacht. Denn der Schamanen-Kling erprobt mit seinen kombinierten Übungen in reenactment und Method acting nicht nur Dichterbilder, sondern deutet auf einen anderen rheinländischen Schamanendarsteller, auf den als Mayröcker-Verwandten gekennzeichneten, gänzlich in Hirtenfilz gehüllten, einen mit ihm eingesperrten Kojoten besprechenden Joseph Beuys.
Vor dem Hintergrund solcher abrupten Referenz- und Rollenwechsel kann man sich lebhaft vorstellen, daß die Mitglieder der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Mai 2001 entgeistert reagierten, als Thomas Kling sich mit seinem „Bericht“ als neues Mitglied präsentierte. Kaum einer seiner Texte gibt sich beim ersten Lesen so unverstellt auskunftsfreudig wie diese anderthalb Seiten. ,Klassische‘ Kling-Topoi werden aufgegriffen, die Bedeutung des Großvaters für die eigene Lektüre-Sozialisation, die Dichterlesung als Auftritt, das Verhältnis zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit – mit jedem Wiederlesen jedoch wirkt die vermeintliche Selbstauskunft rätselhafter.
So klingt es zwar auf Anhieb einleuchtend, wenn er die Kleinschreibung in seinen Gedichten aus der frühen Lektüre Stefan Georges herleitet – die von George gepflegte konsequente Kleinschreibung allerdings hat Thomas Kling bereits zwei Jahre zuvor mit seinem Band Fernhandel zugunsten einer gemäßigten Kleinschreibung aufgegeben. Zunehmend dürfen dabei zum Beispiel Namen und Orte ihren Großbuchstaben behalten, eine Gepflogenheit, auf die man etwa im Werk des von Kling verehrten H.C. Artmann stößt, dem Büchner-Preisträger des Jahres 2000. Könnte es sein, daß Thomas Kling Artmanns Namen an dieser Stelle nicht erwähnt, weil er weiß, daß unter seinen Zuhörern auch Klaus Reichert sitzt, zu diesem Zeitpunkt Vizepräsident der Akademie, Artmann-Kenner und Herausgeber des legendären Sammelbandes – „Sie müssen mir gerade den Amerikanismus verzeihen“ – The Best of H.C. Artmann? Bei Thomas Kling war jedes Wort adressiert, auch das nicht gesagte. Er war im Spielen über Bande ebenso versiert, wie er Namen zu übergehen wußte – sei es, daß er jemanden mit Nichtbeachtung strafte, sei es, daß er mit demonstrativem Schweigen seine Hochachtung aussprach.
Aber wer spricht hier überhaupt, wer gibt, in diesem rhetorischen Spiel um Terraingewinne und -verluste, über sich selber Auskunft? Zur Irritation der Akademiemitglieder läßt Thomas Kling am Ende seinen „Bericht“ in den Wort für Wort zitierten Schlußabsatz von Kafkas „Bericht für eine Akademie“ münden, er überblendet seine eigenen Sätze mit einer jedem Schulkind bekannten Schimpansenrede, nimmt die Rolle des von den Menschen herangezogenen Affen ein, steht plötzlich da als Rotpeter-Darsteller. Womit alles zuvor Gesagte in ein anderes, grelles Licht getaucht wird: Was eben noch aufrichtige Selbstvergewisserung war, könnte genausogut bloße Bildungsvorführung gewesen sein, Vorführung der Akademiemitglieder durch jemanden, der den Bildungsbeflissenen spielt und doch zugeben muß, daß er „viel Fernsehen kukke“. „Kucke“, mit ,k‘ geschrieben, ja. Könnte, wohlgemerkt – denn zugleich bleibt klar, daß Thomas Kling von seinen Worten: nichts zurückzunehmen hat.
Wenn er Rotpeterworte spricht, Sätze einer schriftfernen Existenz zitiert, mag mancher Zuhörer sich an einen anderen Satz erinnern, den Kafkas Affe einem Sensationsreporter, im Grunde aber jedem schriftkundigen Menschen hinterherruft:
Dem Kerl sollte jedes Fingerchen seiner schreibenden Hand einzeln weggeknallt werden.
Wer also hat seinen Auftritt vor der Akademie, wenn Thomas Kling sich als neues Mitglied vorstellt? Ein Trickster?
Rotpeter – im Rotwelschen übrigens bedeutet ,rot‘: falsch, untreu, betrügerisch, gaunerisch. Rotwelsch ist doppeltes, verdecktes Sprechen. Und ,eine schlaue Pfote haben‘ heißt: gut schreiben können. – Der Dichter spricht mit schlauer Pfote, und er muß sich dazu kein Affenfell überziehen.
Fährtenlesen mit Thomas Kling: allergrößtes Vergnügen. Vergnügt und – zugegeben – nahezu ungeschützt will ich hier eine Spur aufnehmen, deren Verlauf mich anfangs aus dem Brennenden Archiv hinausleitet, so weit, daß es kaum mehr am Horizont erkennbar ist. Und doch führt sie ins Herz, in einen unbeleuchteten Bereich des Brennenden Archivs.
Als er im Dezember 2004 Gisbert Jänickes Neuübersetzung des finnischen Nationalepos Kalewala bespricht, nutzt Thomas Kling die Gelegenheit, um auf seine eigenen, jahrzehntelangen Studien zum Schamanismus zurückzugreifen. Mit der Lönnrot-Lektüre wird aber nicht lediglich die gesamte Bibliothek im Kopf noch einmal wie zu einem Panorama aufgespannt, sie lenkt auch in die nähere Zukunft, von der Rezension in ein Gedicht, und weiter noch, in eine Sphäre, die weitab des euphorischen Kalewala-Lobes liegt.
Thomas Kling eröffnet seine Hymne, die zu gleichen Teilen dem Epos, dessen Übertragung wie den Finnen selbst zu gelten scheint, indem er die Beerdigung eines Bärenschädels im Jahre 1662 schildert, und es liegt nahe, von Klings Kurzeinführung in den Bärenkult auf den „Bärengesang“ zu schließen, jenes Gedicht, das er seiner im Januar 2005 verstorbenen Mutter Heidi Kling gewidmet hat: Ein Bärengesang ist Bärenbeschwörung und Abbitte zugleich, ins Fell des erlegten Bären gehüllt spricht der Schamane Tierworte, die sich an die Menschen richten.
Im zweiunddreißigsten Lied des Kalewala, das tatsächlich in einen Bärengesang – hier: Bärenbeschwichtigung – mündet, wird, wo in früheren Übersetzungen von einem „Faulbaumberg“ die Rede ist, bei Jänicke ein „Ahlkirschberg“erwähnt, der sich im Nachrufgedicht von Thomas Kling in eine „ahlbeerkirsche“ verwandelt. Wenn dann das sechsundvierzigste Lied aus der Schilderung einer Bärenjagd samt sich anschließendem Bärenfest besteht, scheint die Quelle dieser Totenklage weitgehend erschlossen. – Würde der zweite Teil des „Bärengesangs“ nicht mit den mißtrauisch machenden, in drei Punkte mündenden Worten „Dieser ostjakische“ eröffnet: Denn mit den im westlichen Sibirien beheimateten Ostjaken, wie die drei Volksstämme der Chanten früher genannt wurden, hat Lönnrots Sammlung altfinnischer Gesänge nichts zu tun.
Im Kalewala steigt, anders als in Thomas Klings Widmungsgedicht und in der Mythologie der Chanten, auch keine aus dem Haus ihres Himmelsvaters ausbüxende Bärin zur Erde herab, wo sie, als höchste Gottheit verehrt, nicht genannt werden darf, sondern stets umschrieben oder eben („…“) verschwiegen werden muß. Der Name der Bärin ist tabu.
„dies / die zusammenlegbare nachricht“ heißt es nach den drei Auslassungs- oder Stillepunkten im „Bärengesang“ – wer nun gewillt ist, dieses Gedicht als Werkzeug aufzufassen, dem Fährtenleger Thomas Kling in die schamanistische, die ethnographische, die philologische Bibliothek zu folgen und die Nachricht anseinanderzufalten, gerät mitten in einen – nur aus Perspektive des Außenstehenden, versteht sich – bizarren, 1906 im Anzeiger der finnischugrischen Forschungen ausgetragenen Streit zwischen den beiden Ostjaken-Spezialisten Serafim Keropowitsch Patkanow und Kustaa Fredrik Karjalainen, in dem es unter anderem darum geht, ob Patkanow in seinem Werk Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie ein schwerer Transkriptions- und Übersetzungsfehler unterlaufen sei, indem er an einer Stelle eine „zweiflügelige geflügelte nachricht“ setzt, wo es richtig „zweimal zusammengedrehte (d.h. aus zwei streifen bestehende), zusammenlegbare nachricht“ heißen müsse.
In seiner Entgegnung hält sich Patkanow – er sei von Haus aus Ökonom, kein Linguist – nicht mit Rechtfertigungen auf, sondern verweist auf die Schwelle zwischen Sprachklang und Schrift, entschuldigt sich gewissermaßen für sein Ohr, und zieht im selben Satz, wie unter Forschern üblich, die Kompetenz seiner Kritiker in Zweifel. Es geht um Feinheiten, um die „allzu großen lautfeinheiten, welche die finnländischen linguisten in den finnisch-ugrischen sprachen und bes. in dem ostjakischen entdeckt zu haben scheinen“, die Patkanow nicht hören will, weil er in Frage stellt, daß sie „auch wirklich einen reellen wert für die sprachkunde besitzen“. Er folgt der gewohnten Praxis, Feinheiten in Spitzfindigkeiten umzudeuten – für solche hat Patkanow, als Ökonom, nichts übrig, und er gibt zu bedenken, ob die behaupteten Feinheiten „nicht zum teil individuell sind, d.h. durch das hörorgan der aufzeichner und durch die sprechorgane der sprachmeister beeinflusst worden sind“. Ein schlimmer Vorwurf gegenüber den Sängern wie den Sammlern: Die kennen zu viele Nuancen!
Mit Patkanows Verweis auf die komplexe, mitunter heikle Beziehung zwischen dem „Hörorgan des Aufzeichners“ und dem „Sprechorgan des Sprachmeisters“ wird der Leser nun aus den Tiefen historischer Ostjakenforscherkämpfe in die Gegenwart zurückkatapultiert, mitten hinein in die Arbeit von Thomas Kling.
Erst einmal, ganz konkret, in das Nachrufgedicht: Wenn hier der „Ahlkirschberg“ des Kalewala scheinbar unvermittelt „Der ahlbeerkirsche zusammen- / legbare nachricht“ wird, dann handelt es sich, so der Verdacht des Fährtenlesers, kaum um einen Lese-, Abschreibfehler Thomas Klings, sondern um die beiläufige, trickreiche Inszenierung eines Patkanowschen Hör-, Aufzeichnungs-, Transkriptions- und Übersetzungsfehlers. Der Dichter ahmt den unpräzisen, den arglosen Sammler von Gesängen nach.
Hier der Sänger, Memorizer, Künder, nein, Körperspeicher einer mündlichen Tradition – und dort der Sammler, Ethnologe, darum bemüht, das Gehörte so akribisch und fachkundig wie möglich aufzuzeichnen, um den Rest der Welt am Reichtum fremder Kulturen teilhaben zu lassen: Unversehens ist der „Bärengesang“ vor dem Hintergrund dieser Pole als Selbstbefragung, als Frage nach der eigenen Position lesbar. Hier jener Thomas Kling, dessen emphatisches Dichterbild das Aufbewahren von Notizzetteln, das Archivieren ebenso verbot wie die offene Nähe zu Akademiemitgliedern, Philologen, und dort der nicht weniger emphatische Stimmensammler und -verstärker Thomas Kling, dessen Liebe („ich will nur Kenntnisse verbreiten“) der Vermittlung entlegener Quellen und verwischter Zusammenhänge galt.
Denn selbstverständlich war auch Thomas Kling ein Sammler, der in die Landschaften hineinhorchte wie in die unterschiedlichen Milieus, der auf Schlösser-Alt-Bierdeckeln Düsseldorfer Kneipenformulierungen notierte, mit Ethnologenohr und -hand aus der Welt reiner Mündlichkeit transkribierte, „vom Knoche-Aaz, vom Dokter kapott geschriebe“ (Tünn Heinen), „des isch isa sproch it (kein) / mittl hoach ditsch“ (Herbert), der aufmerkte, wenn ein Grabbe aus der vertrauten Sprache fiel und klagte: „Ek will Platt küren!“
Elias Lönnrot oder finnischer Recke sein, Kustaa Fredrik Karjalainen oder Bärensänger – so läßt sich das Spannungsfeld skizzieren, auf dem Thomas Kling sich zeitlebens bewegte, und die stärkere Anziehungskraft mal des einen, mal des anderen Pols konnte zu einer Zerreißprobe werden.
Was aber soll dies alles, um auf die Widmung des „Bärengesangs“ zurückzukommen, mit Heidi Kling zu tun haben? Stellt die ins Bild gesetzte Zerreißprobe des Stimmensammler-Sängers lediglich eine Doppelbelichtung jener anderen Zerreißprobe dar, der sich der sterbende Sohn ausgesetzt sieht, wenn er um seine verstorbene Mutter klagt?
Nein, meine ich, den fährtenlegenden, über Bande spielenden Thomas Kling imaginierend – es gibt, auch wenn ich deren Stichhaltigkeit nicht beweisen kann, noch eine weitere Spur. Sie führt in die Biographie und damit, wie immer bei Kling, in die Kulturgeschichte zurück.
Aus seinen Selbstaussagen weiß man, wie wichtig ihm seine Chorerfahrung war, wie wichtig auch, daß er schon im Schülertheater auf der Bühne gestanden hatte. Seine Vorstellung vom Gedicht als Schriftspeicher und Partitur, seine Stimmbildung, seine Lust am Auftritt, ja, seine offensive Furchtlosigkeit: Momente, ohne die der Dichter wie die Dichterfigur Thomas Kling nicht zu denken wäre. Mag sein, er war, was man als Naturtalent bezeichnet, mag sein, schon das Kind Thomas Kling mußte keinen Gedanken daran verschwenden, ob sich Lampenfieber gekonnt in Auftrittsenergie umwandeln lasse – gleichwohl gab es in seinem Leben jemanden, der ihm das Vertrauen in die eigene Stimme, in die eigene körperliche Präsenz vorlebte: seine Mutter, Heidi Kling.
Heidi Kling bewegte sich in jenen heute weitgehend vergessenen Kabarett- und Liedermacherkreisen, die Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre für einen neuen, schärferen, politischen Ton auf der Kleinkunstbühne ebenso wie für eine Wiederbelebung verschütteter Volksliedtraditionen standen. Eines der Zentren dieser Bewegung war Düsseldorf – und Heidi Kling unter den Mitwirkenden, als Hanns Dieter Hüschs frühes Programm Carmina Urana ins Hörspielschallplattenformat übertragen wurde.
Als Grundbuch des damaligen Aufbruchs, ja, als Gründungsmanifest kann die von Wolfgang Steinitz zusammengetragene Sammlung Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten gelten, 1954 und 1962 im Akademie-Verlag in Ost-Berlin erschienen. Hier, beim Namen Steinitz, läßt sich die ostjakische Fährte wieder aufnehmen: Denn Wolfgang Steinitz sammelte nicht nur Volkslieder, sondern auch Bärengesänge. In den dreißiger Jahren lebte er eine Zeitlang unter Chanten, lauschte ihnen ihre Gesänge ab, transkribierte, übersetzte, trug das Material für seine Ostjakologischen Arbeiten zusammen – ein Standardwerk.
Ganz gleich, ob Fährte oder Finte – im Rückblick lesen sich einige Merkmale des eng mit Steinitz verbundenen Folk-Revivals verblüffenderweise wie eine Blaupause des dichterischen und essayistischen Programms von Thomas Kling: Die Entdeckung des Barock im engen Zusammenspiel mit zielsicher gesetzten tages- und kulturpolitischen Kommentaren, die Bergung eines aus der Mündlichkeit herkommenden Dichtungsschatzes, der jenseits nationalistischer Indienstnahme als kulturhistorische Quelle fruchtbar gemacht werden soll, und, nicht zu vergessen, die – gelegentliche Anzüglichkeit nicht scheuende – Drastik, mit deren Hilfe die Aufmerksamkeit einer womöglich abschweifenden Zuhörerschaft punktgenau zurückgewonnen wird.
In den sechziger Jahren traf man sich alljährlich zum Song-Festival auf Burg Waldeck, wo nicht nur die rheinische Szene um Dieter Süverkrüp und Hanns Dieter Hüsch auftrat, sondern, mit seiner aus dem Wiener Aktionismus geborenen „first vienna working group: motion“, 1969 auch Joe Berger, den Thomas Kling Anfang der neunziger Jahre als einen seiner „ältesten Gewährsleute in Wien“ bezeichnet hat. – Spuren einer, wie gesagt, selbst verschütteten Tradition, deren Freilegung mittlerweile wenigstens in ersten Ansätzen begonnen hat.
Daß Thomas Kling, als er Mitte der achtziger Jahre die Bühne als Dichter betrat, darauf verzichtete, sich auf diesen Traditionsstrang zu berufen, kann man ihm nicht verdenken. Mit der ursprünglich widerständigen, seinerzeit längst auf Zupfgeigenhansel– und Fernseh-Blödelbardentum-Niveau herabgesunkenen Szene war im Post-Punk-Zeitalter wahrlich kein literarisches oder politisches Aufsehen zu erregen.
Das hätte ich mir von Thomas Kling, der seine eigenen Traditionslinien immer wieder neu zu ziehen wußte, für die Zukunft gewünscht: Eine Beleuchtung mündlicher Traditionen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, und mir scheint, in Gedichten wie „Bärengesang“ oder „Working Song“ war, ebenso wie in der begonnenen Erkundung untergründiger Geschichtsbewegungen in seiner Heimatstadt Düsseldorf, bereits eine Fährte gelegt. Gewünscht hätte ich mir eine von Thomas Kling zusammengestellte und kommentierte Sammlung schamanistischer Gesänge. Eine Anthologie von Gedichten aus dem und über den Ersten Weltkrieg darüber haben wir gesprochen, Ansätze waren womöglich gemacht, der ideale Erscheinungstermin: 2014.
Er werde sich damit abfinden müssen, daß er für den Rest seines Lebens keine hundert Meter mehr gehen könne, ohne außer Atem zu geraten, meinte Thomas Kling im September 2004, in einer euphorischen Ruhephase seiner Krebserkrankung. Spaziergänge durch die Neusser Felder waren Vergangenheit. Alpenwanderungen ohnehin. Was blieb, waren Schreittänze, Pavanen auf dem weißen Papier.
Schriftbewegungen, die am Lebensende weit zurückverwiesen, auf das Jahr 1985 und einen Aufenthalt in Wien. Wenige Tage nach dem Tod von Reinhard Priessnitz am 5. November, hat Thomas Kling erzählt, sei er, mit Friederike Mayröcker im Rundfunkstudio sitzend, in der traurigen Lage gewesen, als einer der ersten dem verstorbenen Freund und Vorbild einen Nachruf zu widmen. Worte, die wenig später zu einem Widmungsgedicht führten, in dem von „zum schweign gebrachtn landschaftn“ die Rede ist: „entstellter / hergekrächzter code“ und „kehliges röcheln“ heißt es in diesem Porträt des sterbenden Dichters im Krankenhaus, und sein Titel lautet, in Klammern und in Anführung, in doppelte Hilfszeichen gesetzt, um zu fassen, was nicht zu fassen ist: „(,penzinger schreittanz‘)“.
Marcel Beyer, Nachwort
Das brennende Archiv
menschen gedenken eines menschen.
herz – brennendes archiv!
es ist erinnerung der engel;
erinnerung an alte gaben.
die formel tod, die überfahrt –
die wir zu übersetzen haben.
Am 1. April 2011 ist es sechs Jahre her, daß Thomas Kling, 47jährig, nach schwerer Krankheit starb. Die Bibliothek, die brennt, ein im Oktober 2005 erschienenes Schreibheft-Dossier, versammelte Gedenkblätter der Freunde Kurt Aebli, Marcel Beyer, Franz Josef Czernin, Bodo Hell, Norbert Hummelt, Friederike Mayröcker, Oskar Pastior, Ferdinand Schmatz und Peter Waterhouse, ferner kritische Würdigungen von Sebastian Kiefer und Gerd Schäfer.
Das brennende Archiv knüpft daran an, indem es ausschließlich Thomas Kling selbst zu Wort kommen läßt (mit Ausnahme eines bisher unveröffentlichten frühen Gedichts von Reinhard Priessnitz). Es verzichtet auf Beiträge über sein Werk, empfiehlt statt dessen zur Lektüre ein Kling gewidmetes text+kritik-Heft, Hubert Winkels’ Buch Der Stimmen Ordnung sowie Das Gellen der Tinte, einen Band, der Aufsätze eines wissenschaftlichen Kolloquiums enthält, das unter Beteiligung von Frieder von Ammon, Heinrich Detering, Erk Grimm, Hermann Korte, Daniela Strigl, Peer Trilcke u.a. im Februar 2010 auf der Raketenstation Hombroich stattfand.
Die Gedichte (unter ihnen einige den Künstlerfreunden zugeeignete Gemäldegedichte), Rezensionen, Essays, Gespräche, Briefe, Handschriften und Photos, die wir zusammengetragen haben, sind entweder unveröffentlicht oder können als nahezu unbekannt gelten. Letztere sind verstreut und zum Teil entlegen in literarischen Zeitschriften, Zeitungen, Anthologien, Kunstkatalogen oder im Rundfunk publiziert worden und haben keinen Eingang in Klings selbständige Bücher gefunden.
Bei unveröffentlichten Gedichten, die als Manuskript vorliegen, haben wir auf redaktionelle Korrekturen verzichtet, etwa beim Gedicht „Blutglasanalyse“ (korrekt: Blutgasanalyse). Es gibt in diesem Fall keinen Hinweis darauf, daß es sich nicht um eine bewußte Verschreibung handelt.
Unsere Auswahl geht chronologisch vor, weicht von der Chronologie aber ab, wo es sinnvolle, beziehungsreiche Verlinkungen gibt. Sie eröffnet mit einer Collage aus dem Jahr 1980 und endet mit einem Ende März 2005 entstandenen Gedicht, das von Kling selbst auf den 15. Mai 2005 vordatiert wurde. „Wurzeln & Heimat“, der Titel der frühen Collage, benennt ein Auswahlkriterium, einen roten Faden unserer Auswahl: Klings lebenslange Verwurzelung im Rheinland, in Düsseldorf, Köln und in Hombroich nahe Neuss.
Dank für Rat und Tat bei unserer Arbeit schulden wir Marcel Beyer, Ulrike Janssen, Tobias Lehmkuhl, Alena Scharfschwert, dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf, der Stiftung Museum Insel Hombroich sowie der Kunststiftung NRW.
Norbert Wehr und Ute Langanky Februar 2011
P.S. Das hiermit als Taschenbuch vorliegende Dossier aus Schreibheft 76 weicht geringfügig von der ursprünglichen Fassung ab. Verzichtet haben wir auf einige Photos. Ergänzt haben wir das Gedicht „di lesung des armen poeten / The Poor Poet’s Reading“, die Texte über Franz Köllges sowie die Rezensionen über Bücher von Tomas Venclova, Gunnar Ekelöf und Inger Christensen.
Erinnerung an Thomas Kling
– Die literarische Zeitschrift Schreibheft veröffentlicht in ihrer Ausgabe Nummer 76 unter dem Titel Das brennende Archiv bislang Unveröffentlichtes oder zu Lebzeiten des Lyrikers Thomas Kling nur entlegen Publiziertes. –
Sprachhaus Buchkammer, aus denen Flammen schlagen, aus denen fremde Aschenseiten auferstehen, wie Projektile atmende kurzlebige durchsichtige Sprachen. Das sind geschwinde Schatten dicht flammender Membran, Flammengliedmaßen, die sich strecken. Fallender Schnee. Schrift ist durch einen Schneesturm waten ich höre mein keuchen, stimme im Stiemen, im Brausen das angegriffene Ohr mit dem das hören, erst erschrieben werden muss, polternde Asche johlender Schnee, der durch die Nacht fällt. Die Mitbrüder kopieren, der Kopist bin ich…
So kennt man Thomas Kling aus seinen bekannten Gedichtbänden – hier eine akustische Probebohrung aus dem 1999 veröffentlichten Fernhandel mit CD. Durch posthume Publikationen wie das Schreibheft wird Thomas Kling erneut eine Stimme verliehen und die Erinnerung an ihn wachgehalten. Denn Kling sei unter den Lyrikern für ihn noch immer der wichtigste seiner Generation, sagt Norbert Wehr. Als nächste Veröffentlichung in einem Verlag könnte sich Wehr ein Hörbuch vorstellen, es warten noch reichlich unaufgearbeitete Mitschnitte von Lesungen im Hombroicher Archiv.
Im Fall Thomas Kling fast ein Muss, solch ein eigenständiges Hörbuch, denn seine Auftritte und Sprachinstallationen sind legendär. Nicht „Performances“ – vom Showeffekt grenzte sich Kling stets ab. Ihm war das Schürfen nach sprechendem Material in Tiefenschichten wichtiger. Um anschließend mit dem zutage Geförderten „Sprach-Räume mit Stimme gestalten“, wie er selbst einmal seine Liveauftritte beschrieb. Der ausgebildete Historiker Kling suchte im Sprachmaterial nach den Restablagerungen der Geschichte, ihren untilgbaren Rückständen. Dichten – das hieß für ihn spracharchäologische Arbeit, das Graben im Gelände.
… sind schwer einsehbare Räume, Schauplätze: die Aschenplätze der Geschichte CNN Verdun. Es öffnen zeigen Landschaften ihre Körper den geöffneten Körpern: Sie öffnen sich dem Vergessen. Diese Körperlandschaft zeigt sich: Wände spitzen schroffen Querverschneidung; zeigt sich, wenn die Zunge sichtbar als Organbank wird, als Bilderclaim. Als Sprachbank zeigt die Körperin sich kunstvoll tranchiert und lässt die Zunge sich als Zunge auf der Zunge zergehn – geht das klar? CNN Verdun in Kehlgräbenn und Sprachdepots. Bebildert. Sonnenuntergänge pittoresk wie Bibliotheksbrände! Hängt eben von der Belichtung ab…
In einem 2001 im Band Botenstoffe abgedruckten Gespräch sagte Thomas Kling, dass er seine Aufmerksamkeit jedem geografischen Geschichtsraum zuwende, egal, ob es sich um das Rheinland, in dem er geboren wurde und aufwuchs, oder um eine andere Region als deutsches Thema handele. Ihn interessiere jede Land- oder Stadtschaft „als eine riesen summende Insektengesellschaft, wo man die einzelnen Stimmen dann herauspräparieren muss.“ Nicht nur als Historiker, sondern überhaupt als geschichtsinteressierter Zeitgenosse beschäftigte sich Thomas Kling mit Manhattan ebenso wie mit altösterreichischen Themen, „mit Vielvölkerstaatsgeschichte sozusagen“, wie er erklärte. Und das bleibt global ein nach wie vor heißes und zu durchleuchtendes Thema.
Thomas Kling, der seine ersten Gedicht-Kassiber in die bundesdeutsche Literaturlandschaft in der Zeit der Neuen Subjektivität schickte, grenzte sich von dieser sich ins Innere und private zurückziehenden Literatur von Anfang an ab. Ihn interessierte vielmehr das Brodelnde und Schäumende an der Sprache, ihre unauflösbare Verschränktheit mit der bundesdeutschen Herkunft und Gegenwart, ihre subversive Komplexität und Mehrschichtigkeit. Auch sprachtechnisch ließ ihn jeglicher damals angesagte Mainstream oder gar Bildungskanon kalt. Kling ließ sich lieber von einem wie Oswald Wolkenstein etwas über Sprache erzählen, der in seinen Texten „bis zu einem halben Dutzend verschiedener Sprachen miteinander komprimiert“ habe. Kling interessierten Konrad Bayer, Jean Paul oder Paul Celan und dessen Interesse an Spracharchäologie. Oder Johann Michael Moscherosch, Quirinus Kuhlmann, Kaspar Stieler, die den „konspirativen, zusammenatmenden Austausch“ – so Kling – von Jargon und Slang zu schätzen wussten. Denn hier sprachen die „Hebräischreste, Jiddischreste“, eben „Schattenreste“ noch immer. Alle diese Dichter waren Thomas Kling Brüder im Geiste einer intellektuellen Widerständigkeit und Eigensinnigkeit.
Der aus einer Stadt der Werbeagenturen, wie er selbst sagte, stammende Thomas Kling verwendete auch aus medientechnischer Sicht das „Polylinguale“ und Gleichzeitige der verschiedenen Sprachschichten. Schon allein deshalb müsse man eigentlich, wie er mal forderte, „heute das 1879 ausgestorbene Tasmanisch wieder erfinden“.
Die im Schreibheft veröffentlichte Kling-Sammlung Das brennende Archiv hält also im wahrsten Sinn des Wortes ein arbeitendes, noch immer kräftig glühendes Material bereit. Denn „draußen“ arbeitet weiter „das zerschrappte, die verplemperten Sprachen“, wie es dort heißt. Und dafür braucht es nach wie vor die „Augenverstärkung“, so der Titel des Klingschen Gedichts von 1985. Unter diesem, in einer Fußnote, hatte Kling damals in Düsseldorf noch notiert:
dass ich den ununterbrochenen und in steigendem Maße heftiger auf mich einknallenden Sprachen nur mehr mit der Papierschere gegenüberzutreten mich in der Lage sehe… nach dem Anlesen, beispielsweise eines Zeitschriftenartikels, dito Postwurfsendung, schnibbel ich bereits darin herum, schneide aus, ganzes oder passagenweise, manchmal genügt schon eine mich backpfeifende (Bilt)unterzeile; MUSS ALLES RAUS AUS DEM ZUSAMMENHANG… die kenn kein Verfallsdatum, die sprachen Materialarchive…
Viel erfährt man im Schreibheft über Thomas Klings Arbeitsweisen anhand solcherlei Notizen, anhand auch von Faksimiles selbstgefertigter Collagen und Gedichtüberarbeitungen. Auch das ist das Heft: eine optische Fundgrube. Abgebildet auf mehreren Seiten finden sich handschriftliche Vorfassungen des Gedichtzyklus „Vogelherd. Mikrobucolica“, den Kling später in seinen Gedichtband morsch aufnahm. Ein einziger Tonmitschnitt gibt es übrigens vom „Vogelherd“ – auch dieser Schatz wartet im Archiv, um gehoben zu werden. Umso erfreulicher, das dieses Thomas Kling gewidmete Schreibheft im Suhrkamp-Verlag 2012 als Taschenbuch erscheinen und damit noch mehr Leser gewinnen wird.
Im Titel Das brennende Archiv stecken viele Anklänge: sie reichen von Thomas Klings Gedicht „brennstabm“ bis zur brennenden Bibliothek Umberto Ecos, von brennender, arbeitender, erhitzter Sprache bis zum etymologischen Schmelztiegel.
Weit vor seinem Tod, im Jahr 1997, hatte Thomas Kling ein Gedicht geschrieben, in dem er noch einen anderen Gedanken hinzufügte:
Menschen gedenken eines Menschen. Herz – brennendes Archiv!… die Formel Tod, die Überfahrt – die wir zu übersetzen haben.
Auf die Frage „Was fehlt mit Thomas Kling?“ antwortet der Herausgeber des aktuellen Schreibhefts, Norbert Wehr: Es fehlt schmerzlich ein Dichter, der so dezidiert wie Kling an historischen Stoffen arbeitete. Es fehlt die Unbedingtheit und Frechheit von einem, der noch immer den Anspruch hatte, Avantgarde zu sein. Der an der Entwicklung von Dichtung und Sprache arbeitete. Der stets versuchte, die Mittel zu reflektieren und an einer bestimmten Tradition weiterzuarbeiten. Jemand wie Kling, der all das dezidiert tat, überzeugend. Bei vielen Autoren der Nachfolgegeneration sehe Wehr große Intelligenz und Begabungen. Aber er wisse oft nicht, warum sie schreiben und was sie umtreibe – ihm seien ihre Stoffe fremd. Doch einer wie Kling, der als Nachkriegskind immer an historischen Stoffen und Motiven brennend interessiert war – eine solch vergleichbare Option ist nicht zu entdecken.
Bei vielen Autoren fehle ganz einfach der Geschmack im Mund – und den hatte der Kling.
Cornelia Jentzsch, Deutschlandfunk, 8.8.2011
Weitere Beiträge zu diesem Hörbuch:
Das brennende Archiv
rollingstone.de, 3.8.2012
Konstantin Ames: Der Dichter als Businesspunk
signaturen-magazin.de
WOLKENBÄNDER
für Thomas Kling
über fasan rebhuhn und birkhahn
streckt der himmel seine
hände aus
das kollern des federviehs bleibt einsam stehen
die autobahn macht dieses
hintergrundgeräusch
am horizont warten
zur untätigkeit verdammte mühlen
auf bessere zeiten der
himmel weiß noch nicht wann
die kommen und wieder streckt er
seine hände aus diesmal
über die alte raketenstation bei neuss
findlinge steckt er in die abgeernteten äcker und
wolkenbänder legt er um
die köpfe von birke und kiefer
unter denen fasan
rebhuhn und birkhahn huschen
Sabine Schiffner
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest Oh Nacht [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Hommage + Symposion +
DAS&D + Dissertation + KLG + IMDb + PIA + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


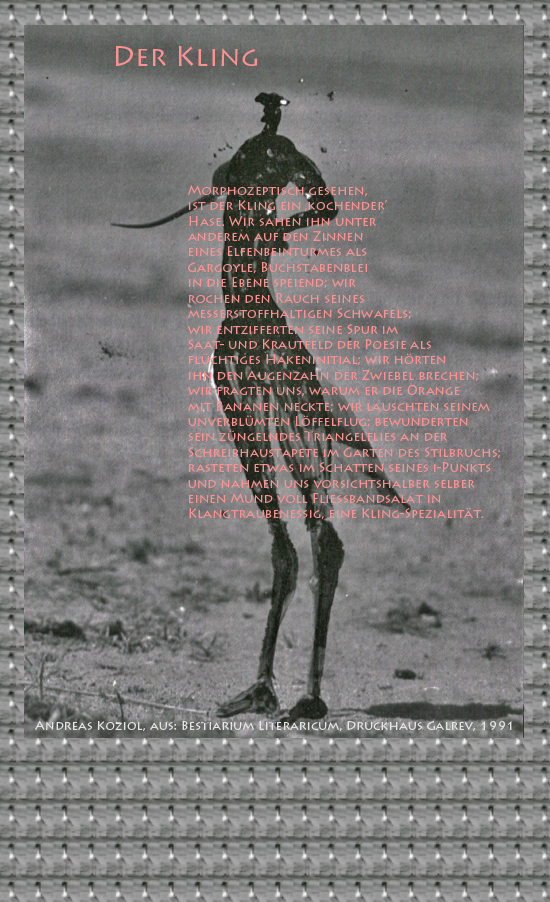












Schreibe einen Kommentar