Thomas Kling: Fernhandel
RAKETENSTATION 2
das unterbundene herrische gequatsche die elektronik
aaaaahierorts
weggeflext. ach kabelenden bloße stümpfe wie gereckt
aaaaavon
hart gesottenen märtyrern. vieladeriges geschläuch
aaaaasteht roh
aus turm und bunkerwand inmitten quatschender
aaaaabotanik.
dort setzt das namensummen anders ein die codes sind irgend
wie gewechselt. rhizom-rhizömchen die sich miteinander
unterhalten. Sieh hier das netzteil, angeregt: mit eigenen augn
staunender linné: – „roger! frau flora übernimmt das regiment!“ – „hier
brehm jawoll verstann!“ das kommt mir alles nicht geheuer
vor wir wechseln die kanäle die leitung zirpst sie lispelt vor
sich hin da setzt die elsterknarre ein. höhnische statements
von lautbewohnten splitterwällen schwellen sprungbereiter
sounds gezirp und sprachkanüle schulter arme hände der
wiese, von wiesenschulter nacken kopf sind jetzt die stumpen
sprachstümpfe kurz an- kurz abgebunden in den bodenwellen.
sprache zugegaffert steht wie angewurzelt da. ununterbrochne
vanitas. stabverlegung ununterbrochen. luft-bodendinger
gleiten, stürzen so ins milde ab, jenseits, ins heitere düsseldorf.
Inhalt
Mit den legendären Gedichtbüchern erprobung herzstärkender mittel und geschmacksverstärker legte der gelehrte Dichter Thomas Kling die Grundsteine seines inzwischen vielbändigen Werkes: u.a. brennstabm, nacht. sicht. gerät., morsch.
Die Virtuosität dieser poetischen Partituren ist längst stil- und schulbildend geworden. Schrift und Sprachklang, „text und ohr“ verbinden sich zu Sinnesereignissen: „gedicht ist nun einmal: schädelmagie.“
In Fernhandel schickt Thomas Kling den Leser auf Sprach- und Geschichtsreisen, ins „sprachhaus“ und „beinhaus“, das Banale und das Grauen zwischen „laufsteg“ und „laufgraben“ vereint. Mit Thomas Kling bewegt sich der Leser auf ethnographischen oder archäologischen Erkundungen – immer „voll stoff schwappend“.
In Fernhandel begleiten wir den Autor und ‚Dolmetsch‘ Thomas Kling beim Blättern in „familienherbarien“, vor Gemälden und bei der übersetzenden Lektüre von Catull und Ovid, Trakl, Pound, Platen oder dem spätmittelalterlichen Minnesänger und Reisenden Oswald von Wolkenstein.
Fernhandel eröffnen und beschließen die beiden großen bewegenden Zyklen „Der erste Weltkrieg“ und „spleen. Drostemonolog“.
Thomas Klings Gedichte muß man hören. Dem Band liegt eine CD bei, auf der Thomas Kling seine Gedichte selber liest.
DuMont, Ankündigung
Im Gefälschten liegt das Wahre
− Neue Gedichte von Thomas Kling. −
Man lasse sich nur nicht irreführen von einer harmlosen Überschrift: Fernhandel heisst es, fast etwas treuherzig, über Thomas Klings neustem Gedichtband, was den Gedanken an einen Warenaustausch über grosse Distanzen nahelegt. Tatsächlich überbrücken Thomas Klings Gedichte grosse Entfernungen, vor allem solche der Zeit: Von der jüngsten Zeitgeschichte reichen die Motive bis in die Antike zurück und streifen mythologische Bezirke. Mag dabei auch ein Austausch von Waren stattfinden, so wird dieser Handel über eine Währung abgewickelt, die vom Grauen der abendländischen Geschichte geprägt worden ist. Die „aschenplätze der geschichte“ hat der Lyriker aufgesucht; seine Gedichte sind erbarmungslos realistische Reportagen von den Schauplätzen des Schreckens. „Verdun“ heisst ein Angelpunkt dieser Topographie; ein anderer wird „in den blutigen / textgärten des vielnamigen Homer“ auch literarisch kenntlich gemacht.
Metamorphosen
Mit ausdrücklichem Bezug auf Ovid ist mitunter auch von Metamorphosen die Rede: Ein Gedichtzyklus handelt von Actaeon, dem das kurze Glück widerfuhr, die unbekleidete Göttin Diana beim Bade zu überraschen. Worauf ihn das ungleich dauerhaftere Unglück ereilte, von Diana in einen Hirsch verwandelt und alsbald von seinen eigenen Jagdhunden in Stücke gerissen zu werden. Thomas Kling wendet das blutige Geschehen mit einem subtilen Zeilenfall zur programmatischen Metapher: „gebisse, risse / gehen durch den Actaeon; die beinah stumme männer- / gurgel“. Zu einem Röcheln allenfalls noch, doch nicht mehr zum Sprechen taugt eine solcherart auch typographisch durchtrennte Gurgel. Salopp und lapidar notiert das Schlussgedicht des Zyklus: „rasant führt das zu sprachverlust“.
So ist mit dem entstellten, blutig zugerichteten Körper auch das Sprechen gefährdet. Führt die in den Gedichten vielfach variierte Metamorphose auch nicht immer zu „gesprächsunterbrechung“ oder „totalbildausfall“, so bleibt die Sprache doch nie vollends verschont. Und heisst es in einem Gedicht: „die codes sind irgend / wie gewechselt“, so gilt das für die durchtrennte Gurgel Actaeons ebenso wie für das „schrei-, / schreibchaos“ der Droste im abschliessenden Zyklus „Drostemonolog“; es gilt für die „männermünder wortentleert“ auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs wie für das „stummgemachte fleisch“ des Heiligen, der in der „Ambrosianischen Litanei 2“ den Kopf „in kniehöhe“ hält.
Indessen spiegeln sich die Phänomene einer sprachlichen Metamorphose, die zum Sprachverlust tendiert, auch in der Entwicklung von Thomas Klings Lyrik: von den „sprachamputaten“ der frühesten bis zur „bildernoth“ der jüngsten Gedichte. Mit den erodierten Schriftbildern und Klangfiguren seiner früheren Gedichtbände indessen war Thomas Kling an eine Grenze gelangt; geblieben ist davon gerade noch die mittlerweile werktypische, gelegentlich auch etwas spleenig und verschroben anmutende Elision bei Nasalendungen („turmofn“, „ofnwärme“, „bürstn“, „sorgnfaltn“ usw.). Im übrigen aber sind Klings Gedichte narrativer geworden, und häufiger als früher widerstehen sie den narzisstischen Versuchungen der selbstreferentiellen Spiegelungen. Sie sind gesättigt mit Schicksal und Geschichte. Noch immer aber bewegt sich der Lyriker im Grenzraum zwischen Verständigung und Sprachstörung; dieses Spannungsfeld erweist sich weiterhin als fruchtbarster Fokus seiner Gedichte, gleichzeitig droht von dieser Seite her auch der Sog einer routinierten Geläufigkeit. So pedantisch, freilich auch so beredt trägt der Lyriker bisweilen die Klage vom angeblichen „sprachverlust“ vor, dass man seine Elegien mit Vorteil auch gegen den Strich lesen sollte.
Von geschundenen, von versehrten und verstümmelten Körpern ist viel die Rede in Fernhandel. Aufkommendes Pathos aber wird fortwährend stilistisch gebrochen. Ein Memento mori wird in flapsigem Ton beschrieben: „dem tut kein fuss noch schwanz mehr weh“ heisst es vom Knochenmann im Gedicht „Tessiner Beinhaus“. Schneidend kalte Bilder von bisweilen zynischer Präzision fassen das Grauen an der Westfront im Ersten Weltkrieg: „von männern gemachte menschnfontänen“ haben sich als (imaginierte?) Erinnerungsfetzen ins Gedächtnis eingeätzt. Die hinterbliebenen Witwen betreten die Szenerie gerade noch als ein radikal reduziertes Pars pro toto: „trockengefallene hinterbliebenenlippe mundtote frauenlippe nicht im bild die / einstürzende fallende lippe der verlobten gerodete zunge kahlschlag der blick“. Und immer wieder spuken in einer zeitlichen Verwerfung die Kameras, Scheinwerfer und Kommentare von CNN über die historischen Schauplätze in Verdun.
Der Hinweis auf die mediale Aufbereitung lenkt schliesslich die Aufmerksamkeit auf das ebenso suggestive wie verwegene Sprachspiel dieser Lyrik. Thomas Klings Gedichte schrecken vor drastischen Mitteln nicht zurück, um das „unbewohnbare erinnern“, um die „nachrichten von verlorenen“ wieder ins Bewusstsein zu heben. Sie machen sich den Zynismus, den sie brandmarken, zu eigen. In parodistischer Absicht freilich, denn es gilt, das an den Zynismus verlorene sprachliche Terrain zurückzugewinnen. So wäre zuletzt auch die Klage über den Sprachverlust nicht Ausdruck von Resignation, sondern ein Zeichen des Widerstands, und «Fernhandel» wäre eine Metapher für den wie auch immer vergeblichen oder aussichtslosen Versuch, jenen mit sprachlichen Mitteln die Würde zurückzugeben, die zweifach Opfer geworden waren: zunächst durch Waffengewalt und danach durch die Brutalität einer verhunzten Sprache. Das schlichte Benennen der Dinge soll diese Rückgewinnung leisten – und sei es in Prägungen, die einer eiskalten Diktion nachempfunden sind: „witwennamen höchstens gerodete tranchierte familiennamen“.
Damit freilich wird noch kein „Verduntwen“ wieder lebendig, und keiner Witwe wird über die Leerstelle des Familiennamens hinweggeholfen: Der Tod, der Verlust oder ein nacktes Entsetzen erhalten aber immerhin sprachlich ein Gesicht oder eine Gestalt. Es ist eine gnadenlose Gestalt, gewiss; daran aber kann man sich, im Gegensatz zum Verschwiegenen oder Unsagbaren, reiben, mitunter auch wundreiben. Thomas Kling bewegt sich in diesen unzimperlichen Gedichten häufig und notgedrungen an den Rändern sowohl der Sprache wie des guten Geschmacks. Der Preis für diese Grenzgänge ist hoch: denn mitunter entsteht der Eindruck, die drastischen Bildmotive würden Kling allzu leicht und begleitet von einem behaglichen Schaudern aus der Feder fliessen. Gelegentlich fordert er dem Leser eine archäologische Leistung ab: unter dem Wort- und Bildergeschiebe und hinter den bisweilen ins Anekdotische abschweifenden Erzählgedichten lässt sich manchmal nur mit Mühe ein Gedankengang nachvollziehen oder aus dem ästhetischen auch ein intellektueller Mehrwert ablesen.
Eigene Wege
Thomas Kling steht zwar nicht isoliert in der gegenwärtigen lyrischen Landschaft, und seine Auffassung vom Gedicht ist nicht ganz ausgefallen: „gedicht ist nun einmal: schädelmagie“. Einige seiner literarischen Motive teilt er mit Durs Grünbein, und thematische Überschneidungen ergeben sich mit Raoul Schrotts jüngstem Gedichtband Tropen. Sprachlich indessen geht Thomas Kling eigene Wege; bewusst begibt er sich ins unwegsame Gelände und kultiviert mitunter auch seinen Hang zum Enigmatischen: „gedicht ist immer ahnenstrecke. fotostrecke, angereichert und, / ganz klar: gefälscht. wodurch die ahnenstrecke wahr wird erst.“ Das klingt nur beim ersten Hören nach einem vernünftigen Syllogismus; schaut man genauer hin, meint man von einer Tautologie zum Narren gehalten zu werden; zuletzt aber streckt man die hermeneutischen Waffen vor einer Poetik, die das Gefälschte zum Wahren erklärt. Indessen ist die paradoxe Denkfigur kognitiv weniger fruchtbar, als man vielleicht meinen könnte. Der Gedanke wird auf dem Altar der Pointe geopfert. Was bleibt, ist ein vielsagender Vers, der dann doch zu wenig sagt. Das trifft zwar nicht auf alle Gedichte in diesem Band zu, aber wohl doch auf zu viele.
Roman Bucheli, Neue Zürcher Zeitung, 12.10.1999
Eine Reihe, die aus der Reihe fällt…
Vor mir liegen 5 Bücher (plus eine „Zugabe“) mit außergewöhnlicher Ausstrahlung: Es sind Bücher, die bereits durch ihre ausgesuchte Aufmachung – mit weißem, blauem, rotem, gelbem und grünem Leineneinband, Lesebändchen, im Schuber) sehr gute lyrische Qualität suggerieren. Diese hochwertigen Buchobjekte sind offenbarer Ausdruck eines verlegerischen Selbstbewusstseins, das fest überzeugt zu sein scheint, eine in jeder Hinsicht anspruchsvolle lyrische Idee auf dem Buchmarkt durchsetzen zu können, das im Prospekt ganz bescheiden von „moderner Lyrik internationaler Autoren“ verspricht…
(04) Christian Dörings Wechsel von Suhrkamp zu DuMont wird wohl den Ausschlag gegeben haben, den 4. Band, Fernhandel tituliert, an den Sprachlaboranten Thomas Kling zu vergeben, der zu den auffälligen lyrischen Erscheinungen der 90er Jahre zu rechnen ist. Kling hat ja vorher bei Suhrkamp regelmäßig Lyrikbände veröffentlicht. Spekulieren wir nicht, sondern wenden uns dem Buch zu. Und siehe da: Thomas Kling erstaunt mich mit neuen Formen, die ich so bislang von ihm nicht unbedingt kannte. Die seit langem bekannte, immer wieder auf ihre Haltbarkeit erprobte typische „Klingform“ ist auch darin präsent (wenn auch nicht so extrem), aber die langzeiligen Dreizeiler auf den ersten Seiten und am Ende sind schon etwas so bei Kling noch nicht Gelesenes. Und dass (und wie!) er sich u.a. mit dem letzten mittelalterlichen Minnesänger Oswald von Wolkenstein beschäftigt, macht diesen (unnahbaren?) Kling auf einmal verblüffend zugänglich – auch sprachlich: Da sieht man, wie kongenial nachzuempfinden dieser hypersensible Typ in der Lage ist. Prosahafte Simultancollagen, extrem rhetorische attributive Kombinationen zu Bildern aus dem 1. Weltkrieg — kühle Elegien? Thomas Kling lesen heißt sich die volle lyrische Dröhnung geben: Diese antikisierende, assozative, dichte, hommagierende, intensive, kritische, lautmalende Art zu dichten, Wort zu Wort zu setzen, cool, selbstgewiss, kompromisslos („es tut mir leid: gedicht ist nun einmal: schädelmagie2), lässt mich zum einen nicht los und beeinflusst mein weiteres Tagesprogramm enorm, von der Nacht ganz zu schweigen. Diese forcierte Lyrik empfinde ich wie eine bewusstseinserweiternde Droge (die übrigens wohl nicht jedermanns Sache ist). Die dem 102 Seiten starken Band beiliegende CD mit den vom Autor gelesenen Gedichten sind natürlich eine erfreuliche Bereicherung. Hören Sie selbst:…
Theo Breuer, titel-magazin.de
Thomas Kling Fernhandel
Es ist sicher keine lange Zeit, wenn man zwei Jahre auf einen umfangreicheren Gedichtband eines Lyrikers warten muss. Bei Thomas Kling kommt es einem lange vor, denn, während die meisten seiner Berufsgenossen in allzu bekannten Erlebniskanälen weiter wurschteln, besitzt jedes Kling-Buch Ereignis-Charakter. Einfach weil man wissen möchte, wohin sich seine Dichtung mittlerweile wendet. Die Neuerscheinung Fernhandel ist nicht nur in einem anderen Verlag erschienen als die Vorgänger, sondern – dies vorweg – sie scheint wiederum ein ganz eigenes Kapitel im Werk des Ausnahme-Lyrikers Kling einzuleiten. All das, wofür man ihn kennt: die Sprachstückelungen, quasi „autistisches Lyren“, Worte aus dem logischen Urschlamm beschädigt und zerscherbt herausgestoßen – all das ist mit dem neuen Buch Vergangenheit.
Denn mit Fernhandel verliert das lyrische Sprechen Klings seinen spektakulären, letztlich aber auch auf Effekt angelegten Duktus – die Sprache tritt zurück hinter das überaus komplexe Feld der Inhalte, Verweise und Bezüge. Seinen in Catull-Versen umgedichteten Anfangs-Stoßseufzer „o unberührte beschützerin, mach, daß es / hundert jahre und mehr, ja, daß dauernd es bleibe“ kann man durchaus als programmatisch für diese neue Werkreihe ansehen – Kling tritt mit Fernhandel tatsächlich in so etwas wie seine „klassische“ Phase ein.
Gleich zu Beginn verblüfft er mit einem Zyklus „Der erste Weltkrieg“, der nicht weiter kontextualisiert wird, aber natürlich im Hinblick auf das aktuelle Kriegsgeschehen, das jüngst vergangene Kosovo-Scharmützel zu lesen ist. Kling enthebt sich gleichwohl jeden Kommentars auf die Zeitgeschichte, das ist auch gar nicht nötig. Verschiedenste Motive aus der Historie, der Geschichte der Literatur und der Medien (Fotografie) werden zu einem faszinierenden Konglomerat verschmolzen. Insbesondere der erste Part dieses Zyklus „Die Modefarben 1914“ lässt den unauflöslichen Konnex mit unserer eigenen, soeben durchlebten Geschichte spüren, zeigt sich in diesem Text doch, wie der 1. Weltkrieg sich bereits im Rahmen der Alltagskultur und Mode vorankündigte bzw. sich auch zugleich darin verbarg: „zur frühlingssaison natürlich / von marne gar nicht / die rede. ab herbst war dann / das kleine schwarz natürlich / angesagt.“ Und wie der Krieg ausbricht, so erschüttert sich auch der Text im Vollzug, tritt heraus aus dem plaudernden Ton und dem Raum, den es selbst aufgespannt hat, mischt Sprachen, Soziolekte und Gegenstandsbereiche in einer Weise, die unmissverständlich bedeutet, dass Sprechen über den ersten Weltkrieg heute immer auch Sprechen über das Kriegsführen insgesamt ist.
Krieg ist ohnehin eine Sache der Sprache, der Beinhäuser und ebenso von „CNN Verdun“: damals war das schnelle Bild im Grunde schon dabei, heute auch, am Ende ist „totalbildausfall“, für den die Sprecherin sich entschuldigt. Alle Kriege, auch vergangene, finden heute statt, der Kosovo-Krieg ist Substrat einer europäischen Kriegsgeschichte: das Gedicht vermittelt ein Bild davon, jedes Bild ist wie eine Fotografie, so wie Fotografien aus den „familienherbarien“ (Fotoalben) Teile dieses Weltkriegszyklus ausgelöst haben.
Der Fotografie kommt denn auch zentrale Bedeutung in diesem Lyrikband zu: sie ist technisch präsent, ihr Funktionswandel als gesellschaftsbildendes und -bedingendes Instrument – getreu des mediengeschichtlichen Verständnisses etwa Friedrich Kittlers – ist überall mit eingeflossen. Die Gedichte selbst sind so eng daran gekoppelt, dass bisweilen die sprechende „fig. 1“ sie als fiktive „Bildunterschriften“ für nicht vorhandene, sondern zu assoziierende Illustrationen ausweist. Der Lyrikband transzendiert somit seine Letternbeschränktheit und wird zu einem Geschichts- und Bilderbuch, das die anvisierten Ereignisse allerdings gut verklausuliert. Sowieso werden sie zu Material, ebenso wie Alltagsszenen, soziale Sprech-Inseln und immer wieder Literatur. Zeitlich und sachlich heterogene Bereiche werden amalgamiert zu einem dichten Knäuel; dem steten Bildbeschuss, dem wir heute ausgesetzt sind, nähert sich Kling durch Konzentration, durch Verzahnung der Motive. Hier stehen sie eben nicht wie in unserer Wahrnehmung unvermittelt und kantenhart nebeneinander: als „Realitätscollage“, sondern die deutende Verdichtung weist ihnen Sinnbezüge zu, Referenzen, stellt verborgene Zusammenhänge her. Tatsächlich lässt das so etwas wie einen „Kosmos“ entstehen, wo man sich längst der (vermeintlichen) Unausweichlichkeit des medialen/sinnlichen Chaos gefügt hat. Die Dinge „durch denken“ – das ist es wohl, was Klings poetische Sorache vermittelt: sie ist Zeugnis und Beleg dessen, dass es geht, dass man sich nicht mit tatenloser Ohnmacht, nicht mit Fatalismus bescheiden muss angesichts der fulminanten Veränderungen in allen Bereichen. Nein, man kann selber sortieren, selektieren, historisieren – so wie es immer möglich war. Es liegt allein an einem selbst, ob man sich diesem sicher sehr komplizierten Prozess aussetzen mag.
So wie soziale Milieus, individuelle Erinnerungen und historische Epochen Kling zu formbarem Stoff geraten, so spielt natürlich die Dichtungsgeschichte eine gewichtige Rolle. Kling versteht sich ja als „Dolmetsch“ zwischen den Zeiten, das belegt schon die erwähnte Eingangsübersetzung der Catull-Verse, welche die Alltagseingebundenheit des lateinischen Originals nachdrücklich unterstreicht. In solchen Nachdichtungen oder auch in lyrischen „Zwiegesprächen“ reealisiert Kling poetische Referenzen zu Oswald von Wolkenstein, Graf August von Platen oder Giacomo Leopardi. Über Heiner Müller steuert er eine hintergründige „Anekdote“ bei, die sich auf ein Treffen im Belgischen Viertel Kölns bezieht:
es ist die
rede hier von Normal-Müller, auch
Totenmüller zubenannt; dem lilienroten
volkslied, das aufging tief im osten
weißer als eingeschriebenes papier.
Nüchterner und zugleich eindringlicher lässt sich wohl die literarische und intellektuelle Physiognomie dieses wichtigsten Dramatikers deutscher Zunge nach 1945 kaum zusammen fassen.
Überhaupt ist das die Stärke des „neuen Kling“: das Reduzierte, Verdichtete, Komplexe seiner Sprache. Zwar tauchen durchaus wunderschöne neologe Konstellationen auf: „dinner-arie“, „lorbeer-ode“, „synapsnslang“, aber grundsätzlich nimmt die Sprache sich zurück, ist übergegangen in ein Stadium manisch-mimischen Memorierens und Referierens. Sie ist „sinn-süchtig“, reißt Interpretationen und Sozio-Referenzen an sich, gliedert das magnetisch Erfasste zu neuen Komplexen.
Sie ist deutungsmächtig – jetzt dachte man schon, die Welt kann man eh nicht verstehen, aber nun kann man sie immerhin lesen.
Enno Stahl, satt.org
das aus unseren sprachen und orten gekickte
− Thomas Klings Gedächtniskunst als universales Supplement und Gegenrede des nationalen Gedenkwesens. −
Es ist, als werde der Zuruf nun aufgenommen, der vom Anfang des Jahrhunderts herüberdringt, als werde sie endlich gehört, jene Totenglocke von den galizischen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, die in Gedichtform „die Geister der Helden“ grüßt, „die wilde Klage / Ihrer zerbrochenen Münder“ aufnimmt und einer leeren Zukunft ohne Nachkommen, Erinnerung und Gedächtnis übergibt:
Die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz,
Die ungeborenen Enkel.
Der Stab Georg Trakls, dessen letztes Gedicht „Grodek“ den Opfern der Schlacht bei Grodek gilt, nun, am Ende des Jahrhunderts, wird er aufgenommen. Thomas Kling greift auf die legendären Ursprünge der Dichtung als Mnemotechnik, als Gedächtniskunst, zurück und rettet getilgte Erinnerung. Das Traklgedicht des 42jährigen Rheinländers benennt die Ursache des Bruchs:
… traklzeit, und später. ,s braune laub prallt
auf die totnstille
von jenseits kreischts. ,s rangiergeräusch wie
zarter rauch, vom wind gebracht – zentral verschiebebahnhof
kledering.
Das ist, unfeierlich, sparsam und ungemein präzise, die Darstellung einer Katastrophe, deren Jammer vom Gekreisch der nächsten übertönt und vom braunen Laubvorhang des Dritten Reichs verschluckt wird. Nun steht einer am Grab und reaktiviert das gesellschaftlich ruhende, aber keineswegs gelöschte Andenken der „Niemandstoten“, das hinter der Bewältigung des Zweiten Weltkriegs und des Völkermords an den Juden zurücktrat. Nun wird die nichtrealisierte Trauer nachgeholt:
die liegen irgendwo im osten, in polen irgendwo, es stützn mit den
totn schultern sich die steine, auf denen keine steinchen liegen
Das ist ein Hinweis auf den orientalischen Brauch, den Toten zum Zeichen des Gedenkens Steinchen auf den Grabstein zu legen.
Thomas Klings Gedichtsteinchen sind Attacken auf das heroische, steinern monumentale und inhaltsleere Mahn- und Denkmalwesen. Der 42jährige Rheinländer rückt die in Ritualen erstarrte Gedenkkultur in Gegenlicht einer Lyriksprache, der ihre Allgemeinheit, Anonymität, vor allem aber die Formelhaftigkeit offizieller Erinnerungssprache gründlich ausgetrieben wurde. Sie ist Rede, funkelnd gescheite und gebildete Kunstrede, ein zu einem zwischentonreichen Musikinstrument umgebauter Jargon. Mit ihrem unverwechselbaren Tonfall und den lebendigen Ausdrucksgebärden gewinnt sie eine geradezu mimische Qualität, ja das mangelnde Talent für ehernes Vokabular und Weihestunden hat eine prononciert rheinische Note. Klings brüderlicher Gewährsmann ist Archilochos, der ästhetische Rebell der antiken Heroik.
Das ist die Ausstattung, mit der Klings Gedächtniskunst die Geschichtsbühne betritt. Er folgt der lokalen Bindung des Gedächtnisses und besucht in der schützenden Begleitung Mnemosynes, der Mutter der Musen, das „aus unseren sprachen und orten gekickte“, wie er sagt, die Gräber der Gefallenen des Ersten Weltkriegs und das imaginäre Mausoleum der Kunst, Totentanzdarstellungen in Berlin und Mailand, Beinhäuser im Tessin und die „Sprachhäuser“ vergessener Dichter. Zu ihnen gehören der große Moderne der römischen Lyrik, Catull, der die Mächtigen seiner Zeit verspottete, der Sänger Oswald von Wolkenstein, der den Schritt in die Erlebnislyrik vollzog, der Neapolitaner Leopardi mit seinem Meisterwerk. dem Gedicht „L’infinito“, der politisch belastete, seiner Bedeutung benommene Ezra Pound und vor allem, im nüchternen, aber auf sachliche Weise innigen Finale des Bandes, der Zusammenschluß mit Annette von Droste-Hülshoff.
Der rheinische Besucher hält keine Andachten, er wirkt vielmehr, mit seiner Sprache als Kippgewicht, in die kulturelle Gegenwart und greift ein in die Regulierung dessen, was kollektiv erinnert und was in Latenzräume des Gedächtnisses verschoben wird. Es sind die Störfälle in der Tradierungskette, die ihn interessieren, und, im Falle Leopardis, die Darstellung dessen, was uneinholbar ist, undarstellbar und unvergeßlich. Mit dem Gedächtniswerk Thomas Klings gewinnt die Lyrik alte Bastionen des Ausdrucks zurück, das Heroische und Erhabene, das er einer gründlichen rhetorisch-pathetischen Entziehungskur unterzieht. So rettet er sie.
Sibylle Cramer, manuskripte, Heft 147, 2000
Zungenschlag
– Die Energie der Zeichen: Kling, Beil und andere. –
Als Raoul Schrott in seinen Tropen Soldatisches auf alpinen Gletschern der Jahre 1916–1918 in Verse brachte, meinte die Neue Zürcher Zeitung spitz, der Weltkrieg sei wohl eine Art Pflichtprogramm des Lyrikers geworden. Das mag übertrieben sein, sicher aber ist, wer das Genre der Gegenwartslyrik erschlossen und so aufbereitet hat, dass es unumgänglich werden konnte – es war Thomas Kling, der vielzüngige Sinnzersplitterer, der akrobatische Durchmischer von Slang und hehrer Topik, Bild und Ton, Lautpoesie und absoluter Metapher. „Gemäldegedicht, Schruns“ zum Beispiel, gute zehn Jahre alt, auf einen jung am Pasubio Gefallenen, war so ein wirksames Klingsches Kleinod (in: brennstabm, Suhrkamp 1991). Die neue Gedichtsammlung hebt, als wollte Kling seinen Nachahmern zeigen, wie es richtig geht, mit dem gewichtigen Gedichtkranz „Der Erste Weltkrieg“ an. Nicht das Schlachtgetümmel selbst, nicht militärische Planspiele und taktisches Eroberungskalkül sind gemeint, schon gar nicht Schützengrabensentiment, sondern der Kataklysmus einer Kultur – der Erste Weltkrieg, nicht der Zweite als Epochenzäsur, so wie es jüngst auch die Historiker, auch ein Sebastian Haffner, wieder aufzeigten. Das Ende ist bei Kling zugleich ein Anfang: Verdun und Langemarck waren nicht nur Zivilisationswunden, sondern zugleich Katalysatoren der (künstlerischen) Moderne. Und vor allem: Der Krieg war zum ersten Mal kein bloßer, ideologisch überhöhter, politischer Schachzug – er war eine Scheinrealität, eine Inszenierung, nämlich eine mediale. Real war einzig der politisch hirnlose Stellungskrieg, das Ausbluten einer Generation, die das neue Europa hätte schaffen müssen, in den Schützengräben und – das Trauma in den Köpfen.
Kling lässt den eigenen Großvater als Zeugen auftreten. Und weil dieser ein lesender Großvater war, lebte er mit jenem Frühexpressionismus, der die Eruptionen der Schlachtfelder vorwegnahm und sekundierte: „alles beinahe aus erster Hand“, kann daher der Enkel sagen. Das großväterliche Gedächtnis ist die Wachstafel, in der das Jahrviert Brandspuren hinterlassen hat. Historische Wahrheit wird aus der transportierten Erfahrung, wenn diese mit der dokumentierbaren historischen Bewegung dialektisch vernetzt wird. „Die Modefarben 1914“, das sommerlich heitere, geschichtsvergessene und politikabstinente Farbenspiel der Laufstege, das ist die erste historische Sphäre, die Kling mit den Erinnerungstrümmern im Schädel des Großvaters konfrontiert. Saisonfarben werden zu Seismographen:
ciel
ist der verdrehte himmel.
blue pills und stahlparkett.
zur frühjahrssaison natürlich
von marne gar noch nicht
die rede. ab herbst war dann
das kleine schwarz natürlich
angesagt.
kleines schwarz.
schwarztöne, die allgemeiner wurden;
besagte zunahmen, zunahmen in dem maße wie die herzgruben und
-töne schwächer, dann weg- und abgeschaltet wurden. und
die listen (,ciel‘) sprach überlagert von namen und
abersprachn.
Die Farben jenes Vorkriegssommers wussten mehr von dem, was kommt, als die Menschen, die sie trugen. Als poetologisches Programm gesagt:
Die Bilder ablauschen, der Versuch, das Visuelle mit dem Gehörinstrumentarium zu belichten, ist natürlich wichtig, genau wie umgekehrt, gespiegelt, die Bildwelt aus dem Geräusch herausgenommen wird, aus dem Geräusch, das Welt vollzieht. („Botenstoffe“)
Kein synästhetisches Ungefähr miteinander verschmolzener Dimensionen, sondern konstruktionsklare Überlagerung der Parameter.
Karl Kraus’ Die letzten Tage der Menschheit leihen dem Ganzen das Motto. Doch für Klings Bodenproben sind der Erste Weltkrieg, seine Ästhetik, sein Ethos, seine Erlebnisstruktur weit mehr als nur eine Schöpfung der Presse – er ist ein Produkt der Nachwelt, die aus Bildern im Kopf und auf Papier sich eine Weltepoche ausmalt.
die modefarben von 1914 waren
Blumenfeld (Berlin/New York) zufolge
waren diesem sprachen-fotograf zufolge
ziemlich zuerst:
nil
ein grün natürlich, anorientalisiertes abend-
land, das großbürgertum hinter schweren
portièren.
„sprachen-fotograf“ – der Gruß an den Modefotografen Blumenfeld ist natürlich zugleich eine Adresse des Dichters an sich selbst. Die Wechselwirkung von Bild, Bilddokument, Erinnerungsbild und Wort, erinnertem Wort und erinnerndem Wort, das ist selbstredend auch Thomas Klings Hauptoperationsgebiet. Als offene Textur – die „bodnprobn“ aus der Geologie der Sprachen, der Geschichte, der Biographien und immer wieder: dem Slang – kann das Gedicht mit all den Überlagerungen und Durchdringungen des Materials paradoxerweise wieder mimetisch werden. Wie die kulturellen Wertsysteme im Sturmfeuer sich auffächerten, ausfransten, zerstoben, so die Systeme der Grammatik und kulturellen Perzeptionsmuster in der Nachschöpfung. Die Tonlagen und semantischen Dimensionen explodieren, der Rhythmus der Worte bringt die Dinge ins Fließen, die Silben entfalten ein Eigenleben, das eingeschliffene Bezüge aufspaltet, Verschüttetes freilegt.
gesprächsunterbrechung durch
unrhythmischn historiker. zerstreut
wirkt dieses durchgesuppte sprecherchen und
bammelmann, fidel wie die erhängtenleiche,
mit seinem:
„nix nil, nix tango, ohne ciel oder unter freiem
himmel, oder-oder, oder nich mehr so jetzt. Spr-
rache, über projektile, blue pills, blaue bohnen wohin
man tritt, das is sprache! oder
was andres.
Stimmen, Laute, Bildtrümmer und Silbenspiel schaffen eine „rhythmische historia“, wie es am Ende des Einleitungstextes heißt. „historia“ – Geschichts-Wiederholung durch semantische Explosion, der Weltkrieg als lautrhythmische Hererophonie. Das Theoretisieren über das Ganze und Wahre überlässt das Gedicht hintersinnig den Besserwissern: „entschuldigen / möchten wir uns für den // totalbildausfall.“ Das totale Bild, sprich: das kohärente Panorama, ist überholt. Ein hundertgliedriges Netzwerk, das zwischen Bild, Klang und Sinn überraschende, entlegene oder auch banale und witzelnde Assoziationsbrücken schafft, tritt an seine Stelle. Zu guter Letzt wird in die Interaktion Bild-Schrift-Geschichte noch die Natur – und damit natürlich der Topos vom „Buch der Natur“ – einbezogen und, verblüffend genug, der vielzüngige Kling glänzt auch im so oft totgesagten naturpoetischen Fach. Nachgerade das Gegenteil jener „Modelle der Geschichtslosigkeit, bei biedermeierlich-angestrengtem Formstreben (Förmchenbacken)“, wie er mit einer gängigen Fama der „Naturlyrik“ und ihrer neuesten Konjunktur nachsagt – im Band Botenstoffe, der Klings gesammelte poetologische „bodnprobn“ in Prosa enthält, manchmal geistreich-verplaudert, manchmal funkensprühend, inbegriffen anrührende autobiographische Streiflichter und vor allem zungengewandte Liebeserklärungen an H.C. Artmann, Reinhard Priessnitz, Hugo Ball, von denen er sich selbst herschreibt – und sie der Gegenwart als Vademecum verordnet: Plädoyers für die Rettung avancierter Spracharbeit im Zeitalter der Beliebigkeit.
Dies Mosaik aus Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff, nach rechts und links und über das Ganze hin seine Kraft verströmt, dies Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte Maximum in der Energie der Zeichen.
So pries Nietzsche einst selbstverliebt die Horazischen Oden – Kling nannte es eine „für mich akzeptable Charakteristik von Moderne überhaupt“. Wie aber schafft einer große Form, der Gedichte als „hochkomplexe (,vielzüngige‘, polylinguale) Sprachsysteme“ versteht, in denen „Reaktionsfähigkeit“ hoch im Kurs steht? Wo keine Sekunde vergeht ohne Assoziationssprung, hält man schwer den Atem durch. Das weiß Kling natürlich auch und geht ab von seinem früheren Ehrgeiz, die Sinnvervielfältigung der Worte jederzeit zu maximieren. Der in den neuen Band mit hineingenommene Zyklus „Bildprogramme“ von 1993 ist noch ganz in der kurzatmigen, hektisch brillierenden Art des früheren Kling gemacht. Er steht jetzt im neuen Band wie ein Exemplar aussterbender Gattungen. Die neue Kling-Spezies ist sichtbar geglättet, großbogiger phrasiert in der Diktion, Schönes, Gediegenes, Erzählendes wird nicht mehr sogleich zerklüftet und gesplittet. Ganze Strophen grundiert Kling jetzt manchmal mit einem einzigen Bedeutungsspektrum. Das Schwarz als Saisonfarbe, das zum Schwarz der Herzen und der Hirne wird, zur Verdunkelung des Himmels („ciel“) und zuletzt zum Tod, ist eines dieser Spektren, die über eine ganze Seite reichen. Manchmal hält er, ganz ungewöhnlich für den atemlosen Sprachinstallateur Kling, einen Anschauungssraum gleich über mehrere Strophen bei.
Wie Kling das macht, die Farben aus dem Modefotohandbuch der Saison 1914 als Start- und Ziellinie von Exkursionen in die Wortfelder, Tonlagen, Etymologien zu nehmen, dabei mehr und mehr historische Sinnsplitter aufzulesen und zum Schluss beim Großvater, der ruhrkrank aus dem Feld heimkehrt, zu landen, das alles ist auf einer Höhe der Wortakrobatik, die ihresgleichen heute nicht hat. Wie überhaupt schon die Idee einer solchen Ouvertüre bezaubert, die von den modischen Accessoires bei Kriegsausbruch an das ,Medium‘ des Dichters in Sachen Krieg, den Großvater, heranführt. Dessen unscheinbare Hinterlassenschaften, seine Seh-Erfahrungen, seine „pflanzenstudien, strunkbesichtigung, während beschuß stattfindet. / dauerbeschuß von heulenden, vorüberheulenden bildern“, seine gerade in ihrer Banalität so symptomatischen Feldpostalien – „anbei meine type ich bin etwas schmaler geworden steht mir aber / besser wie geht es dir“ – all diese Dinge werden dem dichtenden Enkel zu Sonden, die historische Gewebeschichten ausloten helfen. Die Coda des Zyklus führt nach Wien und in die Gegenwart: auf den jüdischen Friedhof, wo keiner mehr die Grabmäler mit Erinnerungssteinchen bedeckt.
Alles, was der neue Band sonst noch versammelt, seien es merkwürdig harmlose Gelegenheitsarbeiten wie die auf, mit und für Oswald von Wolkenstein – eigentlich für Kling ein Urbild für den Weltreisenden in Sachen Polylingua –, auf Heiner Müller („der als zigarrenasche, fein strukturiert, / sich niederlegt auf kühle junge morgenblüte“[!?]), oder hochinspirierte und – gottlob – auch wieder kapriziös humorgesättigte Stücke wie das auf Platen, es wird doch alles blass vor dem Glanz und der Größe des Entwurfs des Weltkriegs-Zyklus. Selbst der lange Zyklus „Spleen. Drostemonolog“, der die Droste – wieder einmal, ihr Ruhm besteht nur aus solchen Rettungsversuchen – den germanistischen Etikettierern („Natulyrik“) entreißen will. Da ist viel vergebliche Liebesmüh’, und öfters dreht sich Klings hochtourige Wortverdichtungsmaschine hier um sich selbst. Was nicht heißt, dass nicht funkelnde und blitzende Verse herauskommen, nur weiß man nicht recht, warum es einer Droste-Hülshoff als Aufhänger dazu bedurfte. So entzünden sich die „Daguerrotypie“ überschriebenen Droste-Gedichte kaum, wie die Titel es versprechen, am Konterfei der Dichterin, sondern an den Eigenarten des Lichtbild-Mediums und seines Verhältnisses zum dichterischen Wort. Dasselbe gilt für die „Kartographie“-Gedichte des Zyklus, mit denen vorgeblich Lebenswege der Droste nachgezogen werden sollen.
Das fotografische Material selbst ist diesmal, ein bisschen schade ist das schon, weggelassen worden. Zum Ausgleich nähert sich Kling jetzt in Strophen, die mit „fig. 2“, „fig. 4“ oder auch „Mailand. Ambrosianische Litanei“ überschrieben sind, der regelrechten Bildbeschreibung. Und statt Abbildungen noch ein akustisches Schmankerl: Hinten in der Klappe ist eine CD eingeklebt. Der Meister spricht darauf, eine gute Dreiviertelstunde lang, und wie. Das heißt, er spricht gar nicht, Silben werden zu liebkosten Perlen, Verschlusslaute zu Tropfen, denen man nachhorcht, bis sie zerschellen. Kling hat seine Sprechwerkzeuge, von Natur aus eher schwach in Modulationen, sogar mit einem kleinen Formationsproblem bei Zischlauten, geschult, bis sie die Worte wie ein Griffel in die Luft ritzen können. Die CD, anfangs vielleicht (wie der Supermarktkarton außenherum) kaum mehr als ein Werbegag, ist aufs höchste geschäftsschädigend: Wer einmal das „ciel“ von ihm ins Ohr gehaucht bekam („wieweit reichen meine ehren“), wer sich einmal den „unrhythmischn historiker“ vorholpern ließ, wer einmal vorgeführt bekam, dass Satzzeichen und Zeilenbrüche durchpulste Partner der klingenden Worte sein können, wer einmalleibhaft erfahren hat, wieviel, wie himmlisch viel Zeit eine durchkomponierte Verspartitur benötigt, der ist für einen erheblichen Teil sonstiger Dinge, die gegenwärtig unter dem Titel „Lyrik“ laufen, verloren.
Sebastian Kiefer, neue deutsche literatur, Heft 539, September/Oktober 2001
Fernhandel
Thomas Kling wohnt zur Zeit symbolträchtig auf der Raketenstation Hombroich in der Nähe von Neuss, seine Gedichte sind „das Gegenwärtigste“, wenn es eine Steigerung von Gegenwart gibt.
Im Lyrikband Fernhandel zieht sich ähnlich einer Autobahn, auf der die möglichsten und unmöglichsten Dinge transportiert werden, das Textband radikal gerade und steigungs-unbarmherzig durch das Gelände. Dabei sind es Themen und Materialien aus dem Ersten Weltkrieg, Archivbilder, Hintergrundstrahlungen oder Kartographien, Findlinge und Daguerreotypen, die durch die Zeit transportiert werden, bis sie eine für die Gegenwart brauchbare Lesart angenommen haben. Im Vortrag des Autors, der per CD mitgeliefert wird, entpuppen sich die Gedichte als durchaus les- und hörbare Geschichten, die freilich immer mit sogenannten Hörfehlern, Schräglagen der Semantik oder zwiespältigen Zuordnungen der Wortfelder aufwarten.
Ähnlich wie in Raoul Schrotts Gedichtband Tropen liefert auch bei Thomas Kling der Erste Weltkrieg das entscheidende Material, das nach lyrischer Zurüstung in der Garderobe auf den Laufsteg der Gegenwartstrends geschickt wird. Der Schrecken des Urmaterials wird dabei zu scheinbar erträglichen Portionen ummunitioniert, ehe sich herausstellt, daß das Klingsche Material dadurch noch viel schärfer geworden ist als die ursprünglichen Texte aus Briefen und Ansichtskarten von der Front. Fernhandel kennt keine Grenzen und Genieren einmal in Gang gebracht, vermag ihn auch niemand mehr zu stoppen, womit er dem realen Fernhandel, wie er durch die WTO betrieben wird, ziemlich nahekommt. Der Fernhandel Klings ist letztlich universell, weil er nicht nur in der Zeit, sondern mit den Zeiten handelt. Lyrik kann also auch raketenhaft schnell und interkontinental sein.
Helmuth Schönauer, aus Helmuth Schönauer: Tagebuch eines Bibliothekars, Bd. II, 1999–2003, Sisyphus, 2015
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Nicolai Kobus: Das Röcheln der Archive
literaturkritik.de, Februar 2000
Günter Metken: ziemlich mahlermäßige installation
Süddeutsche Zeitung 13.10.1999
Cornelia Jentzsch: Restnachrichten. Sprachattacken
Frankfurter Rundschau, 13.10.1999
Burkhard Müller: Kleidsames Hechtgrau mit schlammgelben Sprengseln
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.11.1999
Michael Braun: Das Bildbeil erhoben: Kopfjägermaterial und Schädelmagie
Basler Zeitung, 10.12.1999
Guido Graf: Das Projektil bin ich
die tageszeitung, 14.1.2000
Rüdiger Görner: nacht. sicht. gerät. morsch
Die Presse, 25.3.2000
Heinrich Detering: Das lyrische Hammerklavier. Notizen zur Lage der Poesie
Merkur, Heft 644, Dezember 2002
Mit beiden Ohren im Jemölsch
− Am 1. April starb Thomas Kling mit 47 Jahren. Journalist und Schriftstellerkollege Bernd Imgrund erinnert sich an Begegnungen mit einem der wichtigsten Lyriker seiner Generation, der auch die Kölner Literaturszene aufmischte. −
Herbst 1987, Maschinenhalle vom Stollwerck. Ein Wahnsinniger, wer ist das? Flucht, tobt, reißt alle Plakate von den Wänden, „ein elender Scheiß das hier alles!“ Ah, der Dichter.
Die Bühne dann, später: ein ebenerdiges Karree, wie ein Boxring. Thomas Kling, 30 Jahre, Wespenpullover, zart, nervös, gefährlich, setzt zu einem Gedicht an. Bricht ab und hält dem Nächstbesten das Mikrofon unter die Nase. „Na los, und jetzt Sie! Was, sie können kein Gedicht auswendig?“ So hat er das damals immer gemacht, erstens: „Sie“ sagen, wo alle duzen, Siezen als Waffe und Rüstung. Und zweitens: Frontal auf das Publikum zum aufgezwungener Dialog, Provokation, na klar, Rotwein und Piano waren gestern. „Sie sollten jetzt applaudieren, auch wenn Sie bezahlt haben.“ Immer noch das Mikrofon unter den Nasen, da inszeniert einer, terrorisiert einer, Dichterlesung? Dafür haben wir bezahlt? Jetzt unterbricht er auch noch des armen Tropfs Liebesrezitation, läßt ihn im Ring stehen wie einen Ausgezählten. Und trägt schließlich doch noch was von sich selbst vor.
„Müssen es wirklich diese Gedichte sein, Herr Imgrund?“ Karl Otto Conrady, der große Kölner Germanistikprofessor, war einigermaßen perplex. Ein Oberseminar „Lyrik“ hatte er angeboten, freie Referatwahl für die Studenten und zum Antesten drei fotokopierte Seiten aus der erprobung herzstärkender mittel bekommen, Klings erstem Gedichtband. „Steht der überhaupt in der Seminarbibliothek?“ fragte KOC. Stand er nicht. Dafür aber, in der nächsten Ausgabe von Conradys erfolgreichem Großen deutschen Gedichtbuch, einer Abteilung mit Kling-Gedichten. (Conrady brach nie ein Zacken aus der Krone, selbst wenn er sich korrigieren musste – deshalb fanden wir den auch alle so gut.)
Ja, es mussten diese Gedichte sein – unbedingt! Denn beim Lesen war etwas geschehen, das selbst ein lyrikbegeisterter Jungmann Gedichten nicht zugetraut hätte: Sie nagelten fest und rissen gleichzeitig vom Hocker. Den ganzen Band gelesen, die Wespen-Gedichte (ihr gesenkter / stierkopf – auf limogläsern, tassenrändern), die Ratinger-Hof-Gedichte (reißende iris, rasierte muschi, dezibelschübe, das lichtzerhackn die die / zertanzer in ihren ,stiefel-muß-sterm‘- / stiefeln). Und alles noch mal von vorn. Alleine im Zimmer, aber eine Stimmung wie beim Open-Air-Konzert deiner Lieblingsband: Heut kann dich keiner. Heute ist alles drin. Heut gehst du nackt durch die Stadt und frisst rohe Zwiebeln dazu.
Im selben Jahr, im Winter, im Café Schmitz. Ich hatte Thomas Kling angerufen, wegen des Referats. Höllenrespekt, Muffensausen, aber auch die Neugier: Mal sehen, wie der sich in 1:1 Situationen verhält. Er ist vor mir da, trägt eine Baskenmütze, bestellt sich Kaffee und Wodka. Wieder diese Show, wieder diese Tarnung, und schnell der sichere Eindruck: der Typ hat ein zwinkerndes Auge, echte Wut, echte Verzweiflung, echten Humor. Dass ich über seine Gedichte kein einziges Wort verlieren würde in dem Seminar. Nur Sprachsülze aus Zeitungen, Werbung, Politikerdeutsch zitieren, und zum Abschluss eine Kassette von ihm einlegen. Deshalb dann später, nachts unterm Eigelsteintor: Das Klackern hoher Absätze, Gröhlen tiefer Stimmen, und Kling liest, was ich ihm vorlege. Man hört es noch raus aus der Aufnahme, das Feuerzeuglicht da im Dunkeln. Und noch später, in der STATION, Krachladen an der Zülpicher: „Ihnen ist da etwas umgefallen, ich heb das schnell auf, wenn es recht ist“, zu dem pseudocoolen BWLer, der einen Stuhl umgeschmissen hatte. Arroganz natürlich, Hohn auch. Aber wer’s kann, trifft die Richtigen.
Immer diese Zuschreibungen. Punkattitüde, Hochgeschwindigkeitslyrik, dichterische Klangkörper, Happening, Performance. Alles nicht falsch, aber hilfloses Nachgeplapper. Thomas Kling war, Ende der 80er Jahre, zu neu für die meisten, als dass sie gemerkt hätten: Da schreibt einer – im Gepäck die komplette Lyrikgeschichte – Gegenwartsgedichte. Da hat einer die Sprachen (die „Codes“), die Atmosphären seiner Zeit studiert, veredelt natürlich, aber mit beiden Ohren mitten im Jemölsch. Das da ist ein politisches, ein Anti-Kriegs-Gedicht (aber nicht von Erich Fried, siehe etwa „di zerstörtn. ein gesang“ aus brennstabm); das da ist ein Landschaftsgedicht (aber nicht von 1950, nehmen wir „brief. probe in der eifel“ aus geschmacksverstärker, mit dem wundervollen Schlussvers du siehst: „hier geht man früh zu bett, pia‟); und das da ist ein Liebesgedicht (mit Beton statt grüner Wiese, Liebe in Versen, Sex in Worten, z.B. aus der erprobung das unbetitelte
DEIN SCHNEERUSSIGES GESICHT über
stadtvierteln erinnerten gegenden
lässt den wald von birnam in mich
vorrücken , erlebte greuel‛ macbeth
,sind schwächer als das graun der
einbildung‛ deine entgrünten augen
durch mich durch dein potemkinscher
blick in den blonden neon dezember
daß ich die augen schließen muß
und der beton kriegt flügel fliegt
geradewegs in mich rein dein
äußerst schneerußiges gesicht lady)
’87 ff. Freunde geworden, häufig getroffen, zuhause, im Schmitz, in der Station, in Frankfurt (Buchmesse ’92, im Römer, wo er, schon sehr früh, Hofdichter Grünbein abblitzen ließ; und wo Moderatorin Marx ihm mit Ulla Hahn kam – großer Spaß), in Berlin, Literarisches Colloquium und ein Wannsee-Café, getrunken, geredet, in Hombroich die Lesungen, später nicht aus dem Sinn, aus den Augen verloren, jetzt ist er tot. Thomas Kling…
für Bernd:
zunächst X, hinge-
pflatschte SPRACHSÜLZE,
schlagn si die zei-
tung auf ,oder jem. um di
ohrn’; dann sülz, oder
am kölsch nippes, nippend
also: ein gedicht, möglicher-
weise, im bestn fall: mög-
lichst voll auf die sülze
(Minutengedicht aus dem Café Schmitz Okt. ’87, unveröffentlicht)
Bernd Imgrund, StadtRevue, Mai 2005
Lippenlesen, Ohrenbelichtung
− Hans Jürgen Balmes im Gespräch mit Thomas Kling (Januar 2000). −
Hans Jürgen Balmes: Dem neuen Gedichtband Fernhandel ist eine CD beigegeben. Das ist eine Zugabe und notwendige Ergänzung, die die Frage nach dem Verhältnis von Mündlichkeit und Schrift in deinem Werk neu stellt. Denn wenn man beides zusammen hat, die Schrift und den Ton, merkt man erst recht, daß diese Gedichte keine Partitur sind, die einfach der Ergänzung durch die Stimme bedarf. Auf der anderen Seite wird man darauf gestoßen, wie sehr diese Gedichte geschriebene Texte sind, die sich auf die Ebene des Gesprochenen und des Gehörten zubewegen.
Kling: Ja, mit der CD, die doch die ganzen 90er Jahre schon von mir eingefordert wird. Immer wieder kam der Satz, den ich aus den 80er Jahren kenne: Jetzt, wo ich Sie gehört habe, also bei Lesungen, verstehe ich Ihre Gedichte auch viel besser. Das ist eine Sache – ich wollte es 1991 schon bei brennstabm machen. Das hat damals bei Suhrkamp nicht geklappt. Ich habe mich dann in den darauffolgenden Jahren auch verweigert und Mitwirkungen an CDs eher abgesagt. Jetzt war es mir doch wichtig, daß 1999 zum Jahrzehntabschluß mit Fernhandel auch die CD kommt, weil es einfach doch in den letzten Jahren sehr in der Luft lag. Stichwort: Hörbücher.
Bei Fernhandel, also Gedichtband und CD, zeigt sich, daß das Publikum beides parallel benutzt, und das finde ich eine wichtige Angelegenheit. Daß tatsächlich offenbar das orale Erlebnis eine Einstiegshilfe in die Lineatur des Textes ist, also keine Ergänzung, sondern es sind zwei literarische Produkte, die jeweils ihre eigene Geschichte haben, auch getrennte Geschichte.
Balmes: Zwei Zitate aus „Der Erste Weltkrieg“: „die lippe geht beim lesen mit.“ Damit ist genau das Lesen beschrieben, mit dem man schon immer über deinen Büchern saß. Das zweite Zitat scheint mir auf die Ebene zu weisen, wo du an einem Gedicht sitzt: „das angegriffene ohr mit dem das hören / erst erschrieben werden muß.“ Überraschenderweise ist das Hören also nicht der erste Moment im Produktionsprozeß. Beim Lesen der Gedichte aber ist das Hören, auch in der Rezeption vom Blatt her, immer schon vorhanden. Man instrumentiert das Gedicht mit seiner eigenen Stimme, wenn man die Stimme des Dichters nicht kennt.
Kling: Das ist aber sicherlich nicht nur die Lippe des Erzeugers oder die Lippe einer möglichen Leserschaft, sondern gemeint ist auch die Lippe der Traditionen. Daß die Tradition, aus denen man lebt und sich speist, gar nicht außen vorgelassen werden darf, weil sonst gar nichts dastehen könnte. Dieses Mitgehen der Lippe ist durchaus wie der Zeigefinger des Schülers, der Lesen lernt. Das geht dem Autor durchaus genauso, egal, wie schnell und rasant und irrsinnig er schreibt, in welcher Geschwindigkeit. Und die Leserschaft setzt sich den Text eben verlangsamt, dann aber zum Teil auch wieder in Riesenschritten, zusammen. Mir geht es nicht anders.
Balmes: Im Moment des Hörens versteckt sich ein Hinweis auf die Herkunft der Poesie, die im Band durch ein diskretes Zitat auf den Beginn der antiken Epen (das „Sag mir, o Muse“ bei Homer und Vergil) angesprochen wird: „singt neues – das alte dem hörer ins ohr.“ Andererseits stellt dieses Mitgehen der Lippe einen Rückbezug her auf das erste Sprechen im Sinn von Welterfahrung. Entwicklungspsychologisch markiert das Lallen von Lauten den Übergang aus einer unmittelbaren Körpererfahrung, und dem Bewußtsein einer solchen Erfahrung, hin zum Spracherwerb, und über ihn erschließt sich erst viel später die Erfahrung von symbolischen Zeichen und ihren Abstraktionen. Erst wer sprechen, lallen kann, kann die Sprachen als Symbol- oder Zeichensystem erfahren. Von daher hat Sprechen noch einen unmittelbar körperlichen Aspekt, und dieser direkt körperliche Aspekt wird auch in Besprechungen von deinen Lesungen immer wieder hervorgehoben. Ich hatte den Eindruck, als ginge es in deinen Gedichten darum, der Sprache, indem man die Zeichenwelten auf die erste Spracherfahrungen hin durchquert, wieder eine Körperlichkeit, eine oft durch die Geschichte verstümmelte Körperlichkeit, zu geben.
Kling: Mir ging es von Beginn an um die Hörbarmachung der Texte, also in der Performance, in der Actio der Sprache, die ja erst mal überhaupt im Gedicht selber stattfinden muß, sonst ist dem Text ja nichts abzugewinnen. Es muß alles eingeschrieben sein dem Text. Mir ging es ja seinerzeit in den Achtzigern, die wahrscheinlich das Jahrzehnt der Körpermetapher in der Dichtung gewesen sind (selbst wenn man es in der Kritik erst ab 1990 gemerkt hat), darum, daß der Dichter selber anfaßbar sein muß. Der muß mit seinem Text da stehen und wirklich als Minstrel da sein. Der muß sich ganz und gar verausgaben und nicht irgendwie so ein Howard-Hughes-Dasein wie ein Botho Strauß führen. Das ist eine Sache, die absolut von doofster Inhumanität ist.
Balmes: Die vielfältige Bedeutung von Schrift in deinem Werk. Das Gedicht „-paßbild. (polke,) ,The Copyist‘, 1982)“ (in nacht.sicht.gerät) bezieht sich auf ein Gemälde von Sigmar Polke, „The Copyist“, wo ein Mönch an seinem Pult sitzt und kopiert, aber er sitzt nicht mehr im Scriptorium oder in seiner Kammer, sondern direkt in einer Wiese. Das Bild arbeitet mit dem Topos von der Schrift der Natur, die zu Schrift auf dem Papier werden kann. Dieser Topos scheint bei dir auf eine ganz verzwickte Weise widergespiegelt und durchbrochen, zum Beispiel in einem Vers wie: „so zückt die nachtigall das blei, die schrift“, in dem die Nachtigall als ornithologischer Repräsentant der Natursprache schlechthin metaphorisch mit einem Schreibgerät ausgestattet wird. Du schreibst hin zu einem Sprechen, was vor den auf dem Papier fixierten Zeichen stattfindet, und die Dinge der Actio deines Gedichts, die vor der Schrift leben, die vor der Sprache leben, bewegen sich, wie diese Nachtigall, auf die Schrift zu.
Kling: Für mich ist das „Copyist“-Gedicht nach Sigmar Polke keine programmatische Pastorale, sondern Topos des Ausgesetztseins, also wirklich eine Draußen-Drinnen-Problematik, denn dieser Mönch aus dem Scriptorium, der seiner theologischen Pflicht nachkommt, hat einen ungeheuren Spielraum. Diese schreibenden, am Schreibpult dargestellten Apostel der karolingischen Kunst, recken ja oft ihr Ohr zum Himmel, und oben sind dann die Erzengel und die diktieren den Text, sie folgen dem Diktat. Diese theologische Auseinandersetzung passiert nun draußen, draußen ist in dem Fall Natur und Stadt, draußen ist wirklich draußen und bedeutet Nacktheit, und jetzt aber los und Geschwindigkeit. Denn diese Schreibermönche sind ja zugleich auch Zeichnermönche gewesen. Sie haben in einer cartoonesken Geschwindigkeit gleichzeitig die Illustration, die Illuminierung der Schrift vorgenommen. Man darf nicht vergessen, daß in der Zeit der St. Gallener Mönche oder Otfrieds oder der Reichenauer Mönche die Schrift dem Ohr folgt, die Schrift absolut einem Klangprimat unterliegt. Das Ohr ist also wirklich ein so wichtiges Organ, weil der Schreiber in dem Moment, wo der Text diktiert wird, sich vergegenwärtigen muß, wie er den Körper dieses Wortes aufs Papier bringt. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Das heute so oft behauptete Primat der Bilder hat damals noch nicht bestanden. Und es ist auch die Frage, ob es heute stattfindet. Der Bilderbeschuß ist ja sowieso klar. In den Werbeagenturen waren die Texter immer die ärmsten Säue. Aber selbstverständlich leben wir unter einem Textprimat, was ja die juristische Sprechweise unserer Politiker beweist.
Balmes: Diese Loslösung vom Ohr, das Abdriften in eine Abstraktheit wirkt oft beängstigend. Man weiß ja, daß die Klosterbrüder von Augustinus entsetzt waren, als der plötzlich ohne Lippenbewegung lesen konnte.
Kling: Das ist wirklich das Entsetzte. In dem Moment wird, glaube ich, die Macht des schriftgewordenen Gedankens vollkommen klar. In dem Moment haben sie gesehen, daß Augustinus schwimmen konnte.
Balmes: Fernhandel, der Titel spricht metaphorisch das polylinguale Element des Bandes an. Fernhandel im historischen Sinn, in dem die „grobkörnige Mnemosyne“ des Ersten Weltkrieges zum Reden gebracht wird – auch eine Form von Lippenlesen, aber auch in einem poetologischen Sinn, in dem du unter der Überschrift „Hintergrundstrahlung“ ganz souverän den Fernhandel der vielen Zungen deiner lyrischen Sprache in einem Kapital zusammengerückt hast, das von Catull zu Wolkenstein, von Platon zu Leopardi bis Heiner Müller reicht.
Kling: Das hat eine gewisse Entsprechung in brennstabm mit dem Kapitel „stifterfiguren, charts-gräber“, wo ich etwas Ähnliches probiert habe. Aber jetzt war wichtig, daß man eine Mischung aus Anverwandeltem, also übersetztem Text, und Porträts macht. Selbst der übersetzte Text von Leopardi ist eigentlich ein Porträt.
Balmes: Was sich jetzt im Verhältnis zu brennstabm weiter verschoben hat, ist, daß es hier eine Gesellschaft aus Künstlern und Dichtern gibt, und auch historisch weit zurückreicht.
Kling: Und Pirkheimer – der ist Humanist.
Balmes: Es stellt sich quasi ein Panorama her, von Catull über Horaz, auf den bereits du in Itinerar zu sprechen gekommen bist, bis Ezra Pound, der selber auch schwunghaft Fernhandel betrieb.
Kling: Dieser zum Teil von der Kritik als etwas sinister empfundene Gedichtband-Titel sollte als ein vorhandener Begriff, in diesem Fall aus der Geschichtswissenschaft, verstanden werden, so wie geschmacksverstärker poppolitisch. Der Titel sollte einfach unterstreichen, daß hier ganz subjektiv Traditionen eingeholt werden. Im Hauptteil von Fernhandel, dem Langgedicht „Der Erste Weltkrieg“, war mir wichtig, daß ich verschiedene Arbeitsvorgänge, die ich immer wieder verfolgt habe, in eins führe, nämlich erstens die aus den achtziger Jahren stammenden Gespräche mit den damals 85jährigen Männern und Frauen, die den Ersten Weltkrieg erlebt hatten. Ich wollte weiter gehen als das Eröffnungsgedicht von brennstabm, „die zerstörtn. ein gesang“, das erste Erste-Weltkriegs-Gedicht, und bezog mich wiederum auf Gedächtnisprotokolle von Gedächtnisprotokollen alter Menschen aus den Achtzigern. Ganz wichtige Zeugen, gar nicht inhaltlich, aber klimatisch, sind mein Großvater und meine Großmutter gewesen. Dazu kam zweitens die Auswertung von Text, also ganz privaten Texten, eben Feldpost, von Zeitschriften des Ersten Weltkriegs wie diese „Universum“-Sachen, die damals in jedem kleinbürgerlichen oder bürgerlichen Haushalt zu haben waren, bis eben hin – drittens – zu den stehenden Bildern, Fotos, und den Stummfilmen, also den bewegten Bildern, wie ich sie in dem Militärhistorischen Museum in Wien angeschaut habe. Das waren die Grundmaterialien, die ich ausgewertet und dann auf verschiedene Gebiete, auf verschiedene Texte aufgeteilt habe. Im Gedichtband stellte ich das neben die antike Schiene, die ja schon die ganzen neunziger Jahre in der Luft gelegen hat, womit ich mich eigentlich in unserer Zusammenarbeit mit dem Catull erst mal dezidiert, nicht in einem Gedichtband, aber in einem kleinen Übersetzungsband beschäftigt habe. Nachdem der Geschwindigkeitsterror der achtziger Jahre vorbei war, war es wichtig, einen weiten Atem in die Kulturgeschichte zu nehmen.
Balmes: Wiederbegegnungen mit Catull und Vergil – einmal zu Beginn des Bandes durch das versteckte Zitat und dann durch die Insekten-Gedichte, die wie eine Replik auf den Gesang von den Bienen in Vergils „Georgica“ wirken: das große Wespen-Gedicht und das Hornissen-Gedicht, die auf „Der Erste Weltkrieg“ zurückgespiegelt werden, wo eines der vielleicht schönsten Einzelkapitel der Wespe gewidmet ist. Welche Bezüge ergeben sich hier? Eine der wichtigsten Differenzen zu Vergil, der den Homerischen Vergleich der Biene mit dem Dichter kannte, markiert das Zitat: „die wespe achtet nicht des worts“, wo der Aspekt des Außersprachlichen der Wespe und der Natur, für die sie steht, deutlich in den Vordergrund rückt.
Kling: Das ist schon in dem ornithologischen Poem aus morsch, in „vogelherd. mikrobucolica“, angelegt, wo es um die Bienensprache ging. Das sind oft Dinge, die aus naturwissenschaftlichen Artikeln oder Büchern stammen, wenn man überlegt, wie kann man es zu einer Art Ernsthaftigkeit bringen. Aber diese nüchterne naturwissenschaftliche Sehweise wird lächerlich, wenn man im Juni einmal an einem Baum vorbeikommt, der richtig braust. Das relativiert einiges. Insofern ist das für mich niemals naturwissenschaftliche Coolness, wenn ich auf solche Themen komme, sondern eine Sache von emblematischer Ernsthaftigkeit, wie sie eigentlich nur das 16./17. Jahrhundert zu bieten hatte.
Balmes: Von daher ist es sicher kein Zufall, daß in der Mitte von „Der Erste Weltkrieg“ das Wespengedicht mit der Formulierung steht: „ein zeichenweißes spiel“. Eine Wespe knabbert am Uhrglas des Schreibenden herum und schafft mit diesem „zeichenweißen spiel“ ein Fenster in die bedrängend dröhnende Welt des Ersten Weltkrieges, die als „ohrenzwischenraum“ in dem Gedicht gegenwärtig wird.
Kling: Ich habe das als Antidot gegen das Pathos dieses überwältigenden Stoffes gebraucht. Das war mir sehr wichtig, und in dem Moment, wenn das „zeichenweiße spiel“ der Wespe als O-Ton hineinkommt, ist gleich diesem unerträglichen Pathos aus Metall und Feuer die Luft abgedreht. Der ganze Zyklus wird so erst möglich und erträglich. Sonst hat man’s nämlich schnell mit Schützengrabenkitsch zu tun. In dem Georg-Trakl-Gedicht, man muß sagen: in dem Georg- und Grete-Trakl-Gedicht, ging es mir darum, eine sinnliche beziehungsweise sexuelle Ebene einzuziehen, so daß man beim Lesen sich sagt: Mensch, es hat sich da um Liebende gehandelt. Also hinter dem lakonisch notierten Witwennamen auf diesem bayerischen Friedhof, stehen diese Liebende, die diese Zeit allein schon aus gesellschaftlichen Gründen nicht haben überleben können. Das Tragödienthema der Geschwisterliebe spielt sich sonst nur vor Gerichtsschranken ab, aber in diesem Fall handelte es sich um einen der bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts und seine Schwester, ein Thema, das für mich der ganzen Drogen-Farb-Symbolik Trakls, die seine Gedichte erst lesbar macht, einen Hintergrund gibt. Dieses verunmöglichte Liebespaar wollte ich ins Zentrum von „Der Erste Weltkrieg“ setzen.
Balmes: Eine poetologische Formulierung in dem Gedicht lautet: „schrift ist durch einen schneesturm waten“. Ich hatte immer das Gefühl, daß die Wespe mit ihrem „zeichenweißen spiel“ so etwas ist wie der ideale Fluchtpunkt, auf den man sich zubewegt, während man dieses gewalttätige Material langsam durchquert. Die Sortiertätigkeit der Wespe, die in mehreren Gedichten zum Thema wird, ist völlig neutral gegenüber dem Gegenstand. Sie lebt mitleidslos in der Welt. Fern von allen Gedanken an Gerechtigkeit und Schicklichkeit, unbeeindruckt tut sie ihre Arbeit.
Kling: Es ist doch beeindruckend, wenn man mal sieht, wie ein Volk von Mauerwespen an ihrem Bau arbeitet, der von einem Kind abgerissen wird, ein zweiwöchiges Werk, und eine Stunde später sind die ersten drei Waben schon wieder da. Das sind so Relativierungen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Dieser Blick auf Tod, Leben, Wiederbeginn steht niemals mit einer Coolness da, dann wäre es vollkommen unmöglich, solche Gedichte zu schreiben. Das kann ja letztendlich nur aus einer Bejahung, und wenn es auch die des Todes ist, geschehen. Aus einer großen Bejahung.
Balmes: Weshalb hier neben den Veilchenfarben Hechtgrau die Farbe ist, auf die alles zuläuft: die Farbe der Knochen, der Feldpostbriefe, ein graues Papiermache von kriegerischen Wespen nicht auch eine Art von Hommage?
Kling: Ja, in jedem Fall. Nur so darf es gelesen sein. Bei dem in der ersten Hälfte der neunziger Jahre geschriebenen „vogelherd. mikrobucolica“ kam es mir darauf an, ein längeres Gedicht in dem mir höchstmöglichen Abstraktionsgrad vorzulegen. Ein Großformat Marke Jackson Pollock, also gesteuerte Drippings. Das war ganz wichtig. Man weiß ja auch – wir haben darüber gesprochen −, welche Themen da angesprochen werden. Das sind ja alles abgesicherte Dinge. Aber bei „Der Erste Weltkrieg“ ging es mit darum, in langer Formation – das wäre die Visualität, mit der der Zyklus daherkommt: in Langzeilen, kolonnenhaft, das ist der Hinweis auf die Menschenwalze des Krieges −, aber erzählerisch vorzugehen. Insofern eine Form von äußerster Konkretheit, ohne den Stil der Metapherninszenierung aufzugeben. Diese Form von Realismus im Gedicht, also das, was einmal die Ballade gewesen ist, wieder aufzuerwecken, war mein Ziel, ein Langgedicht, das nicht schwafelt und trotzdem als erzählerisch von den Leserinnen und Lesern begriffen werden kann. In den achtziger Jahren fand sich in geschmacksverstärker der erste Zyklus: „wien. arcimboldieisches zeitalter“, in brennstabm das über mehrere Jahre hinweg entstandene „TIROLTYROL“: Beide Zyklen hatten die Form einer Petersburger Hängung: sie waren von unterschiedlichen Formaten und in einem postmodernen Ansatz, für jedes Gedicht wurde ein eigener Stil verwandt, eine andere Materialverarbeitung via Montagetechnik oder O-Ton gefunden. Das war je eine „petersburger hängun“.
Balmes: Wenn man nun „Der Erste Weltkrieg“ auf der CD hört, wird deutlich, daß die Tonlage der Lesung eine epische ist. Es gibt deutliche Unterschiede zum Vortrag der kürzeren Gedichte, wo die spezifischen Lautmöglichkeiten deiner Gedichte im Arrangement, in der Zäsur und in der Zeilenbrechung stärker herausgearbeitet sind als im epischen Gedicht, was auf lange Perioden zielt. In ihm wird durch das Ineinanderschneiden von Außen- und Innenszenen ein Erzählraum aufgespannt, einmal dem Schlachtengemälde, das als Bericht erscheint, und zum anderen das Erkunden privater und intimer Welten, besonders deutlich in dem „bleiglanz“-Text.
Kling: Das sind tatsächlich Innenschauen im Sinne von Fensterbild. Das war ein Vermeerscher Blick. Wenn ein Militärarzt geschildert wird – man darf ja nicht vergessen, daß Schilderei im alten Niederländischen, heute auch noch, die Malerei ist −, so könnte es ein Dr. Benn sein, der gerade von einem Fotografen aufgenommen wird, das heißt, er zeigt sich so, wie er sich später gerne sehen möchte, total stilisiert. Das sind Fensterbilder, die mit diesem Innen- und Außeneffekt arbeiten, Belichtungen. Wenn also das Stiefelleder glänzt, dann ist dieser Mann um Formen bemüht. Diese Formalisierung des Krieges kommt für mich im Widerschein des Lichts auf dem Stiefelleder zum Ausdruck, ohne daß es jetzt zu einem mokanten Jünger-Ton käme, das ist natürlich Voraussetzung.
Balmes: Dagegen steht in deinen Texten das Moment, in dem die Sprache auf ihr nacktes Körperinstrument zurückgeschnitten wird: die „kehlgräben“ aufgerissener Sprachkanülen. Es gibt Verse wie „seuchenklapper, totenschnarre“, wo das Verstummen im Schrei soviel Gegenwart gewinnt, daß eine dandyhafte Bemerkung über den Reflex des brennenden Paris im Rotweinglas keinen Widerhall finden kann.
Kling: Richtig. Mit dem Moment, wo der Begriff des Kehlgrabens, der aus dem Festungsbau stammt, solch eine Greifbarkeit und Körperlichkeit bekommt, soll eine Situation getroffen werden, die vor dem Schrei beziehungsweise nach dem Schrei liegt – genauso mit der Seuchenklapper aus der Pestzeit, wo immer Schuldige gesucht und gefunden werden. „kehlgräben“ und „seuchenklapper“ sind die einzigen Formen der Mitteilung, die da funktionieren. Alles andere wäre wieder dieses Flockenstieben, wäre ein einziger Schrei, dem nichts zu entnehmen ist, ein Dauerbildbeschuß, verstehst du?, das wäre wirklich Schlachtenmalerei. Das Ganze ist natürlich vorsprachlich – ein einziges Winseln und Murren und wurmhaftes, insektenhaftes Gewimmel von Lauten.
Balmes: Um noch einmal auf den Anfang unseres Gespräches zurückzukommen: Ich habe den Eindruck, daß dein Gedicht zwischen zwei Hörakte gespannt ist. Wenn das Gedicht und seine Schrift eine Art Achse bilden, dann gäbe es von der Ebene der Schrift aus den Hörprozeß des Lesenden. Er lauscht auf die Schrift. Dem geht aber ein Hörprozeß voraus, in dem der Schreibende das Gedicht erlauscht. Oder wie es in „Der Erste Weltkrieg“ heißt: „das angegriffene ohr mit dem das hören / erst erschrieben werden muß.“
Kling: Ja, das ist eigentlich die Frage, wie Welt angreift, wie etwas wie die Welt als Ungestaltes auf das Ohr des Schreibenden eintrifft, einprasselt, durchaus in einem aggressiven Angriff. In dem Moment ist der Übersetzungsprozeß bereits in vollem Gange: In diesem Ungesagten, wo von diesem „Membranprozeß“ nichts mehr erläutert wird, wo Erklärungsmodelle letztendlich dann eben doch versagen.
Balmes: Wenn dieses Ungestalte sich dann diesem Prozeß fügt, wäre zuviel gesagt – ihm entgegenkommt, wäre es dann schon die Arbeit der Metapher, deren ordnende Energien – um beim Bild eines Magnetfeldes zu bleiben –
Kling: Ja, daran habe ich auch schon gedacht
Balmes: … quasi dem Schreibenden entgegenkommen. Noch einmal das Zitat: „so zückt die nachtigall das blei, die schrift.“
Kling: Ja, das ist der Durchgangsprozeß, wo die Metapher sich dann einsetzt, wo die Metapher den Verständigungsprozeß eröffnet. Selbst als vielleicht zunächst Unverstandenes beim Leser – ja? −, wo durchaus im Gedichtganzen ein Metaphern-Beschuß stattfindet, es also vielleicht ebenso aggressiv wirkt, und sich die Anordnung im einzelnen, im Leseprozeß, im Übersetzungsprozeß des Lesers – um beim von Huchel ja sehr bekannten Metallspan-Magnetbild zu bleiben – in die einzelnen Teile zerlegen läßt. Das ist eine Frage der Geduld. Und damit ist man auch schon wieder bei einer Zeitfrage: Geschwindigkeit und Verlangsamung, die wechselseitig passiert. Vom Arbeitsprozeß bis zum Leseprozeß der Leserschaft.
Balmes: Ich habe die Empfindung, daß diese verschiedenen Geschwindigkeiten aufeinanderreiben und daß aus dieser Reibung die Absplitterungen resultieren, die man deinen Gedichten oft als Verzerrung anlastet. Im Grunde geht es doch darum, die Gewalt des Endlichen, die in der Gedichtfolge „Der Erste Weltkrieg“ so vehement anschaulich gemacht wird, nachzustellen, und das mit einer gewissen… , ja fast Verzweiflung.
Kling: Ja, es wird ja der Gewalt des Endlichen nachgestellt, um sie darstellen zu können. Das ist also auch wieder ein Geschwindigkeitsprozeß. Das ist ja ein Hase-und-Igel-Spiel, das der Autor natürlich auch immer wieder verlieren kann. Das bedeutet, der Autor darf nie vergessen, daß er einen Papierkorb hat.
Balmes: Auf eine diskrete oder versteckte Weise zieht sich auch durch diesen Band ein Hölderlin-Faden, der sehr stark mit der Muse der Erinnerung geknüpft ist. Das „zeichenweiße spiel“ in dem der „grobkörnigen Mnemosyne“ gewidmeten Gedicht evoziert natürlich Hölderlins „Mnemosyne“ mit den Versen: „Ein Zeichen sind wir, deutungslos, / Schmerzlos sind wir und haben fast / Die Sprache in der Fremde verloren.“ Deine Anrufung der Mnemosyne als grobkörnig auf Fotos Überlieferte, sucht auch nach einer in der Fremde verlorenen Sprachen und findet sie in den optischen Vorlagen. Immer wieder findet sich in deinen Büchern dieses paradoxe Lauschen auf Bilder, in Fernhandel auch in „MITSCHNITT CALVENSCHLACHT“, wo Pirkheimer uns quasi als Lippenleser ein Fresko versprachlicht.
Kling: Ja, das Bilderabhören bei den „BILDPROGRAMMEN von 1993“ stellt eine Kriegssituation von 1499 dar, aber via eines „HUMANISTISCHEN SATELLITENTELEPHONS“, an dem Willibald Pirkheimer, der Jugendfreund, Gesprächs- und Briefpartner Dürers, spricht. Durch diese Brechung fallen Bild, Text und Denken in eins. Die Bilder ablauschen, der Versuch, das Visuelle mit dem Gehörinstrumentarium zu belichten, ist natürlich wichtig, genau wie umgekehrt, gespiegelt, die Bildwelt aus dem Geräusch herausgenommen wird, aus dem Geräusch, das Welt vollzieht. Das sind ja immer Dinge, die gespiegelt werden. Mnemosyne wandert in Fernhandel als nachgestellte, gehandicapte Person, geradezu als Beckettsche Greisin, durch die Kulissen. Sie ist noch da, Mnemosyne ist noch da, wenn auch als nahezu aus therapierter Fall, aber alles immer vom Standpunkt der Hochmoderne aus gesprochen. Das ist wichtig. Die Hochmoderne muß verteidigt werden, unbedingt.
Balmes: In einer Lesung von dir oder beim Anhören von Fernhandel als Hörbuch gewinnen die Gedichte eine neue Einheit. Was vorher ein Hörprozeß des Schreibenden war, der quasi von dem Moment des Schreibens auf eine Welt vor dem Gedicht lauschte, erlebt der Hörer des Gedichts als ein Gang von der Schrift an sein Ohr. Beim Anhören der CD wird beides durch die sinnliche Präsens einer Stimme instrumentiert und enggeführt.
Kling: Ja, dieser Punkt der Wiedergabe in der Lesung, in der Performance geht eigentlich zurück auf das Hör- und Singerlebnis im Chor. Sieben Jahre Chorgesang in einer sehr guten Düsseldorfer Kantorei bis zum Stimmbruch ist eine Schulung, wo man später weiß: Ja, so sind die Klänge und die verschiedenen Stimmen, deren Polyphonie man erlebt hat. Da kommt die Dichtung her. Sie kommt aus dem Gemurmel, das im Crescendo bis in den Geburts- und Todesschrei geht und das sich immer wieder mit den Gedichten überlagert. Und dazu muß es wieder kommen. Der Zeuger muß das Geschriebene sprechen. Diese Form von Wiedergabe ist wichtig, das ist eine Schulung. Nachdem ich einige Bücher geschrieben habe, weiß ich, wie die Sache klingen wird. Da muß ich nicht mehr laut mitsprechen, ich weiß ja, wie Klang und Rhythmus funktionieren. Diese Routine kommt mir zustatten, und ich kann mich auf die Metaphern konzentrieren.
Das heißt, das Unhörbare geht in den Verschriftlichungsbereich, Lippenlesen I, und dann, wenn das Gedicht wieder das Gesprochene wird, heute CD, wird Lippenlesen II über die CD-Aufnahme zu einem nächsten Lippenlesen, Lippenlesen III, des Rezipienten. Letzteres im Live-Moment natürlich expressis verbis, wobei die vollkommene Körpersprache, also der ganze Kehlapparat, da ist. Das ist dann eine Ohrenbelichtung für alle.
Aus: Thomas Kling: Botenstoffe, DuMont Buchverlag, 2001
BÖHMEN LIEGT IN FINNLAND
für thomas kling
an den phonemen von yemen
die an jenen kinnen terzinen
bilden und schimären hin-
latrinen oder binnenthemen
denen sie abhanden schwimmen
indien bis anden abgewinnen
tieren in intermittierenden
idolatrien deren mähren an
jenen die in die ahnen von
schemen sich dehnen oder an
jäh hinsichtenden lehnen bis
hungen die von dannen finnen
Oskar Pastior
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest Oh Nacht [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Hommage + Symposion +
DAS&D + Dissertation + KLG + IMDb + PIA + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


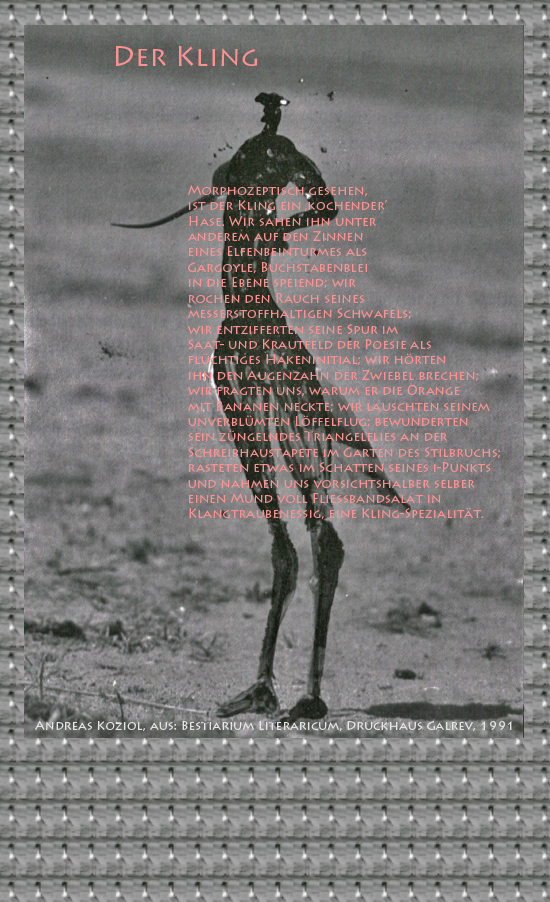












Schreibe einen Kommentar