Ulrike Draesner: berührte orte
BAYRISCH-SEELAND
aaaaa(ÖDELCHEN)
da war der golden zittrige staub: auf den wegen
den rainen die kleinen christusschädel gespalten
– auch da unten der süden, die berge, der schatten
hatten ein meer.
aaaaawir wollen schnaps brennen gehen, birnen
aaaaakehren
wieder im kirchgelb, türme tragen zwiebeln. von erde
zu träumen war stoff. großvater s. nahm die hände der frauen
die er fing
aaaaaab in gips. über die wiesen den großporigen staub
sprang manche ihm davon. millischeckerl. katzenpratzerl.
was zukam lag händisch im speicher, weiß träumende finger
kaum träumte
aaaaaer. mächtig beim kloster schimmerten durch den karfiol
die seelen des dorfs. eine sau warf ferkel in allen regenwurmfarben
und schnürlregen verband die oberen und unteren provinzen
bayrisch –
aaaaaseeland. was rutscht der friedhof am hang und die felder
verdreht ein einfacher laut wie w– w– wetterbleaml den hiasigen
hinnigen, der vierteldenseinen mir kopf ziehen die wolken über
die geodelten wege
aaaaaden liebenden staub.
Ulrike Draesner rezitiert ihr Gedicht „bayrisch-seeland (ödelchen)“.
Info
Reisen: eine Lust. Ein Abenteuer. Ein Irrsinn. Wie lange braucht man, um zu lernen, wie ein Kamel auf Fersen zum Pool zu gehen? Zu verstehen, dass „Cbrt rntl“ Cabaret oriental heißen soll? Auf welchen Wegen nähert man sich Orten, an denen es nach Schweiß riecht, nach Feuer, Mensch und tierischer Angst?
Ulrike Draesners Gedichte: Das sind immer schon Reisen, Expeditionen in die Zentren der Wahrnehmung, in die Grenzzonen des Körpers und in eine plötzlich leuchtende Außenwelt. In berührte orte wirft Draesner das sprachliche Netz nach wirklich bereisten Orten aus, fischt nach den historischen, religiösen und medialen Phantasmen von Städten wie Damaskus oder Casablanca und lässt deren Wirklichkeit die Sprache in Schwingung versetzen. Wie fängt man es ein, dieses verrückt machende süßluftige Aroma aus – nichts? Kluge Beobachtung, der Mut, sich Fremdem zu öffnen, gehören dafür ebenso zum Handwerkszeug wie der findige Umgang mit Sprache und Dichtungstradition. Auch Städte, die dem gemeinen Mitteleuropäer näher zu sein scheinen, kartografiert der Gedichtband: Mit Lessings Wald und Brechts Dänemark wird der leidigen, glückvollen Beziehung von Ort und Wort nachgeforscht. Doch wer vom Reisen spricht, darf die Bewegungslosigkeit nicht verschweigen: inmitten der berührten orte findet sich eine Hymne an den Bürodrehstuhl.
Luchterhand Literaturverlag, Ankündigung
Gedichte vom Reisen
Das Reisen und die Erkundung der Fremde stehen im Mittelpunkt von Ulrike Draesners Gedichtband berührte orte. Bei der Lektüre des in fünf Abteilungen gegliederten Gedichtbandes fasziniert Draesners sprachkritisches Vermögen und ihr niemals gefälliger Stil.
Gedichte vom Reisen künden oft von überstürztem Aufbruch, von Sehnsüchten, die in einer unbekannten Ferne Erfüllung finden könnten, aber auch von Reisen ohne Grund: ziellos und zeitlos.
In Ulrike Draesners Gedichten berührte orte liegt die Betonung auf dem ersten Wort des Titels. Nicht, dass die Städte und Landschaften, die in dieser Lyrik bereist werden, von geringer Bedeutung wären. Ihnen kommt eher die Aufgabe zu, den Vorgang des Sprechens zu erden. Denn in den sinnlichen und mitunter derb gegenständlichen Genüssen, die das Ich unterwegs erfährt, verbirgt sich einerseits ein mächtiges Verführungspotential. Andererseits droht die Sprache angesichts von Gewalt und Not aus dem Takt zu geraten.
So bedarf es dieser Erdung in Indien, Syrien, Finnland, Marokko oder in Norwegen. Vor allem aber arbeitet Draesner die im Wort „berühren“ liegende etymologische Bedeutung auf. Schließlich setzt sich nicht nur der Reisende in Bewegung.
An jedem Ort gerät er in neue Kreisläufe, beim Beobachten und Betasten kommt es zu unvorhersehbaren Berührungen und schließlich kommuniziert der Reisende in der Fremde oft mit seinem Körper. Draesner ist am Verlauf dieser unkalkulierbaren Bewegungen interessiert.
So wird das Ritual des islamischen Opferfestes im Gedicht „die kleinen heiligen der cafés“ zwar aus einer vermeintlich sicheren Augendistanz heraus beobachtet.
die kühle der zimmer
blökt den getöteten schafen nach
wo sie lagen köpfe nun auf rosten
der knaben aufgekratzter ruß – auge
und haut die taschen der lust
schwappen fort in schalen
von blut –
Doch eingehüllt von der Fremdartigkeit des Opfergeruches, von Geräuschen – „wasserpfeifen, frauengeformt“ stehen „kalt im gewühl“ – und Blicken, rutscht der Traum vom Paradies unweigerlich aus der Logik abendländischer Bestimmung.
Von einem Ritual ganz anderer Art handelt das Gedicht „hammam“. In Casablanca wird beim Besuch eines Badehauses der Akt des Säuberns zu einer neuen Körpererfahrung. Zwischen Verzückung und Befremden schwankend, durchlebt das Ich, umringt von geschäftigen Wäscherinnen, Glücksmomente und Angstzustände.
wie weich sie sind
die riesengefäße
hingegossen auf kacheln
wie hart sie sind
die handschuhe die
sauberkeit…
Wie anders jenes Gedicht mit dem Titel „revontulet“, das in die nördliche Region Finnlands führt. Angesichts der überwältigenden Farbschleifen, die das Polarlicht aussendet – „revontulet“ ist das finnische Wort für Nordlicht –, verschwimmen die räumlichen Distanzen und es scheint mehr Erdung vonnöten als bisher. Dagegen wird in „zufluchtsstätte“ Brechts Gedicht aus den Svendborger Gedichten kritisch vermessen. Heißt es dort „Das Haus hat vier Türen, daraus zu fliehn“ wird bei Draesner fast spöttisch geantwortet:
vier türen
hatte das haus, nun sind es fünf
drei verriegelt, und vor einer der schrank
mit geschirr. Wenn ich fort bin, schaltet
jemand im waschraum das licht an
und aus. ein geist, der blinkt?
Nach der Lektüre des in fünf Abteilungen gegliederten Gedichtbandes ist das Reisen fast schon ein vergessener Anlass. Denn es ist Draesners sprachkritisches Vermögen, das fasziniert. Niemals wirkt diese Sprache gefällig. Kontraktionen, Dehnungen und Brüche lassen sie selbst zu einem Ort werden, der immer wieder in Bewegung gerät.
Carola Wiemers, deutschlandfunk, 5.12.2008
Quickie und Epiphanie
– berührte orte, gedächtnisschleifen – Gedichte und Übersetzungen von Ulrike Draesner. –
Ulrike Draesner, Jahrgang 1962, ist eine poetessa docta. Sie hat Germanistik, Anglistik und Philosophie in München und Oxford studiert, über Wolfram von Eschenbachs Parzival promoviert und 1993 eine erfolgreiche literaturwissenschaftliche Assistentenkarriere abgebrochen: um zu schreiben. Sie hat aus dem Englischen und Amerikanischen übersetzt (u.a. Hilda Doolittle, Gertrude Stein, zuletzt den wunderbaren Lyrikband Wilde Iris der vielfach preisgekrönten Louise Glück). Und immer wieder hat sich Ulrike Draesner in dichtungstheoretischen Arbeiten über ihre Poetik, zumal als Lyrikerin, geäussert. Denn sie weiss, was sie tut. Bereits mit ihrem lyrischen Début gedächtnisschleifen (1995) zeigte sie sich als formwache Autorin mit einem ganz eigenen Sound:
Erst lammweisse Tage gehabt
julianische Stunden
malvengebüschelt das Herz
Akazienfedern im Haar
unter den Tieren des Waldes gewesen
bis lilienbefeuert die Brust
grünschattenmundig geschwelgt
geküsst Rinden und Samen
So beginnt das Gedicht „Sommergang“. Es bewahrt anschaulich die physisch-psychisch getränkten Naturimpressionen, die ein erlebendes Ich wie selbstverständlich vermitteln kann:
die Pfauen balzen gesehen
und schreien gehört vor Gier.
Und der Leser folgt gern den durch leichte syntaktische Drehungen intensivierten Bildern, dem Sog klanglicher Suggestionen. Das begütigende Verhältnis von sprechendem Ich und Erlebnis wird sich zunehmend radikalisieren. In ihrer Rede zur Verleihung des Hölderlin-Förderpreises 2001 fragte sie, was ein Gedicht heute sein könne:
Ein Ornament, Zeitvertreib, ein Quickie im Datengewühl, ein bisschen Gefühl? Anachronistisch, oder beschleunigt, ein Stückchen Gesang aus einer anderen Zeit?
Die eigentliche Frage aber ist, wie etwas überhaupt zu einem Gedicht werden kann: „Aber das weiss niemand.“ So gibt sie nur „Stichworte“, die heissen:
Anrufung, Körper, Fläche und Feld. Heissen Schrei, Tierlaut, ,Wunder‘, Natur und Ich, Rhythmus und Musik.
Es ist nun erstaunlich und aufregend zu sehen, wie zunehmend das Geheimnis der Genese eines Gedichts selbst Thema der Lyrik wird. Damit verschiebt sich der Akut des Schreibens von der Evokation des erlebten Augenblicks zur Sprachepiphanie. Ihre jüngste Lyrik berührte orte bewegt sich denn auch paradox zwischen einem konkreten Raum (viele Gedichte tragen am Ende Ortsangaben) und dem Raum der Poesie. Ulrike Draesner macht keine Zugeständnisse an das, was gemeinhin „Verständlichkeit“ genannt wird. Ihre Gedichte sind sinnliche Wesen, die als solche begriffen und erfahren werden wollen. Unerschrocken leitet sie radikale Expeditionen in ein Zeilenland, das seine Impulse, seine Energien zwar aus ihren biografischen Reisen bezieht (Dänemark, Nordafrika, Indien), das aber „berührt“ werden kann allein in den Verwerfungen der Textur. Es ist dann der gebaute, der optische, der klanglich-rhythmische Körper des Gedichts, der den Leser mitnimmt in seine einzige reale Fremde.
Das Versprechen, das in dieser besonderen Exotik liegt, heisst Sprachbegegnung. Exemplarisch vollzieht etwa das Gedicht „hammam“ den Übergang von einem orientalischen Bad in Casablanca („wie weich sie sind / die riesengesäße / hingegossen auf kacheln / wie hart sie sind / die handschuhe die / sauberkeit wie weich“) in die Verwandlung zur Wortwirklichkeit. Es endet:
an anderem ort, fern
wald aus arganien
fallen vokale aus dem wort hammam
h-mm-m…
hmm in einer hand die zittert
hältst du dich selbst.
So abstrakt, so hermetisch manche der Gedichte sind, so sehr Sprachfläche (einige erscheinen im Blocksatz als Vexierbild), sie bleiben existenziell wie das singende, nach Anlautung fahndende Atmen, dem sie ihren Ton verdanken.
„Salat“, ein Gesang, der initiiert wird von einem Glas eingesalzenem „süsssaurem senfgemüse“, endet:
sole. zellen in formation.
subkutan sternen – scheinen – auf den lebtag.
zellsalz membrangängig, denkt stolz: l-a-s.
grüne augen vor seechen. ,seele‘ im fenster
als glas.
Das sind sehr ernste Spiele, heiter wie beglückend geteilte Intimität. Wer sich orientieren möchte, findet im „Glossar“ einige Hinweise. „rtrn rtrn“ etwa ist das, «was aus einer ,Ritterruine‘ wird, wenn man ihr die Vokale entzieht“. Und „fulla“ heisst „Jasminblüte“ und ist der Name der arabischen Barbie.
In den Anmerkungen finden sich aber auch erzählende Erklärungen, etwa über eine „Begegnung“ mit einem Berliner Chirurgen, der im Rahmen eines Hilfsprogramms einmal in der Woche für einen Tag nach Damaskus fliegt, um dort Hände zu transplantieren. Israel habe im Sommer 2006 über Syrien Antipersonenminen in Form von Kugelschreibern abgeworfen, die explodieren, wenn man die gefederte Drucktaste betätigt. Im Gedicht erscheinen sie als ein ausgesetzter Heuschreckenschwarm:
sanft
aus
der klappe, trudelten,
trockenen ziffern gleich
schrecken aus plastik
ihre zu einem griff
gefalteten flügel transparent
die schmalen Körper,
kugelschreiber,
bei glänzender
sicht
So ist das Gedicht auch der sensible Ort der Erinnerung, wenn das scheinbar Freundliche, das Selbstverständliche, umkippt in unbegreifliche Perversion:
gesten verlässlich
weltweit: das lächeln,
die grundideen. Kinder klicken
Kugelschreiberknopf. wir
winkeln die hände dabei
nur auf unterschiedliche
weise an den körper
das fallende licht
Angelika Overath, Neue Zürcher Zeitung, 13.10.2008
Heimat und Elend
– Die gelehrte Lyrikerin Ulrike Draesner dichtet berührte orte: Es kommt darauf an, das Zauberwort zu finden mitten in der verlorenen Unschuld. –
Stille empfängt den Leser. Eine schweigende Dichterstimme: Mit dem Gedicht „eine woche, stumm“ beginnt Ulrike Draesners neuer Lyrikband berührte orte. Das Schweigen irritiert: den Hund, der Kommandos gewöhnt ist und liebevolle Ansprache, die Dichterin selbst, medizinisch zum Schweigen verurteilt. Irritiert sind natürlich auch die Leser, selbst wenn es im Gedicht Geräusche gibt – sie stammen vom verwirrten Hundetier. Der Auftakt ist programmatisch, denn berührte orte führt weit ins Fremde hinein, in die arabische Welt, nach Skandinavien und Indien. Aber beginnen muss die Reise, soll sie zu etwas führen, zuallererst mit Aufmerksamkeit. Das erzwungene, befremdende Schweigen im Eingangsgedicht erweckt erst wirkliche Wahrnehmung und damit das achtlos tausendmal Berührte zur Existenz. Ein schillernder Begriff: „berühren“. Mit zwei, drei Assoziationssprüngen ist man im weiten Feld der unberührten Natur, des Intakten und Kontaktes, des Takts und der Rührung wie des Rührmichnichtans, sogar der als Jesusgefäß verehrten „virgo intacta“. Die Unschuld der Orte und Menschen ist verloren, sie sind berührt, aber sie haben auch den Zustand der Unberührbarkeit hinter sich gelassen. Es kommt darauf an, wie es dieser Lyrik gelingt, das Zauberwort zu treffen.
So vorbereitet, kann man sich Draesners Reiselyrik widmen, ein halbes Hundert Texte, die neu und alt sind zugleich. Die Länder kennt man zum Teil aus den vorigen Gedichtbänden und Romanen, sogar Figuren begegnen wieder, dazu der souveräne Umgang mit Klangkaskaden, die doch nicht Selbstzweck werden, und die Stimmen der Tiere. Hier sind es Ziegen, Kamele, Kühe, Wespen, Spatzen, Krähen, Reiher, Schlangen, Gottesanbeterinnen.
Die Freude an Neologismen und am sinnigen Wortspiel ist wieder da, der emphatische, vorwärtsdrängende Zug in den Zeilen: tänzelnd, trippelnd, schleichend, der plötzlich von typografisch gekennzeichneten Pausen unterbrochen wird. Motivkorrespondenzen zwischen den Gedichten quer über die fünf Abteilungen hinweg liebt Draesner, ob es sich um „Strom“, „Kabel“, „Rom“, „stürzen“, „Palmen“ handelt, und dazu eine fröhlich grüßende Mayröckerei.
Insgesamt fällt auf, dass der ab und zu modisch erscheinende Jargon früherer Gedichtbände seltener auftaucht und wenn doch, gut motiviert. Erneut fügt Draesner hilfreiche Texterläuterungen an. Die sind freilich etwas beliebig, denn ähnlich erklärungsbedürftige Stellen bleiben der Findigkeit des Lesers überlassen.
Neu erscheint Bayerisches in der Lyrik, teils über den Augsburger Kollegen Brecht und dessen Heimweh im dänischen Exil vermittelt, teils direkt, ja mit schöner Forschheit – wie in „bayerisch-seeland / (ödelchen)“. Die kleine Ode spielt selbstironisch mit der „guten Landluft“, die in Bayern entsteht, wenn Gülle, die dort „Odel“ heißt, auf die Felder versprüht wird. In diesem Gedicht tummeln sich „millischeckerl, kratzenpratzerl“, „karfiol“, „schnürlregen“, „w– w– wetterbleaml“ und die „hiasigen hinnigen“: eine famose Liebeserklärung, mal derber, mal feiner Art. Nicht ganz neu, aber häufiger finden sich Witz und Humor in der Lyrik, als könnte Draesner die Wörter im Besitz ihrer Bedeutungen nicht ungestört lassen.
Lokalkolorit taucht in den indischen, maghrebinischen und nahöstlichen Gedichten ebenso auf. Zu diesem gehört die Fremde der Schriften, Wörter, Sprachen, in der dank der geheimnisvollen indogermanischen Verwandtschaft doch plötzlich Bekanntes anspringt. Bittere Reiseabenteuer, lächerliche Hilflosigkeiten, schmachvolle Niederlagen begegnen in der Lyrik; fast balladenhaft spannungsvoll manchmal, manchmal nur angedeutet. Die Krankheit, die Armut, den Krieg, die Fremde, das Sterben fasst Draesner als elende Lebenssituationen fest ins Auge, nicht nur in „indischer kuckuck, wild licht“, wobei Gefühligkeit fern, Empathie aber nah ist.
Auch den Weltinnenraum sieht Draesner als Touristin, und Sinnlichkeit heißt bei ihr, in den Wörterstrudel Erkenntnisse und Wissenspartikel-Rosinen zu wickeln.
Und dann ist da noch die Weite der Zeiten. So bildet Draesner ein Zweitausendjahr-Wörterpaar wie „mikrowelle, salome“ oder flicht frühere Sprachstufen ins heutige Deutsch. Das wirkt wie ein autobiografischer Blitz, der an ihr früheres Dasein als Mittelhochdeutsch-Forscherin erinnert. Draesners Langgedicht „damaskus, manöver“ schließlich formuliert besonders eindringlich das In- und Durcheinander der Zeiten, Völker, Dinge, Lebewesen, Kulturen, das unvermittelt nicht zu haben ist. Politik wie Militärisches sind hier integraler Bestandteil der Landschaft, der Nachrichten, eines schrecklichen Schlamassels, das kaum fassbar ist, Schönheit und Schrecken vereint.
Rolf-Bernhard Essig, Frankfurter Rundschau, 8.12.2008
berührte orte
Glichen die Erzählungen des vor neun Jahren erschienenen Prosabandes Reisen unter den Augenlidern noch Horrortrips, bricht Ulrike Draesner hier zu realen anderen Kontinenten auf: offen, spielerisch, begabt mit allen Sinnen und in einem unablässigen Austausch von Außen- und Innenwelt. Ein sich wandelndes lyrisches Ich beginnt eine Odyssee, um Verborgenes in sich selbst und in einer auf den ersten Blick fremden Welt zu erfahren. Ein Kapitel führt nach Indien, birst fast vor Körpersprache, Gerüchen und Geräuschen. Zwei andere entdecken arabische Länder. Sowohl marokkanische Städte wie Fes, Casablanca, Tanger oder das syrische Damaskus als auch Gebirgsketten und Passstraßen werden zu Schauplätzen von Welt- und Icherfahrung, beschreiben Milieus, uralte religiöse Riten und kulturelle Überlieferungen. In einer merkwürdigen Kombination aus Abstraktem und Gegenständlichem, aus Eindrücken des Sehens, Hörens, Fühlens und Schmeckens wird das Ich gleichsam durchlässig für Landschaften, Pflanzen, Tiere, Dinge, Temperaturen und vor allem frei für menschliche Begegnungen. Fast immer bedenkt die Dichterin mit den Menschen zugleich die andersartige Sprache. Das lyrische Ich wird Zeuge von Gewaltszenen. Dabei wandelt sich seine Identität, wird zum Du, zum arglosen Tier oder zum Leser, der zum Mitwisser wird. Fast heiter und gelöst wirkt da das zweite Kapitel „revontulet“, durchflutet von norwegischem und finnischem Licht. In Dänemark kommen „BB“ und „RB“ als fiktive Personen zu Wort. Ulrike Draesners erfundene Rollenrede ist kühn und wirkt doch gelassen und selbstverständlich in Sprachgestus und Melodie, dessen zweite Tonspur die Melancholie des Exilanten anklingen lässt. Die Montagetechnik verbindet Handlungselemente, wörtliche Rede und die surrealistisch anmutende Präsenz zeittypischer Dinge und deren Aura auf verschiedenen Kontinenten nahtlos und leicht miteinander. Wortschöpfungen zu so noch nie benannten Situationen und Empfindungen tummeln sich von Vers zu Vers.
Dorothea von Törne, Die Welt, 25.10.2008
Berührt und geschüttelt
Ulrike Draesner macht sich in dem Gedichtband berührte orte auf die Reise. Auf die Reise durch die Welt, durch die eigene Erfahrung und Empfinden, durch die Sprache. Kühl betrachtet sie, seziert sie, analysiert sie, eine Forschungsreise, mehr als eine Urlaubsfahrt. Doch zwischen all ihrer Distanziertheit, ihrem klaren Verstand und sprachlicher Präzision schafft Draesner es immer wieder, den Zeilen Gefühl einzuhauchen, Humor – und meditatives Schweigen.
berührte orte ist ein stilles, nachdenkliches Buch. Es schwelgt nicht in verklärten, romantischen Klischees, es führt immer wieder zurück zum Ich. Die Orte berühren, werden berührt und rühren etwas im eigenen Inneren.
Tom Böttcher, amazon.de, 4.2.2010
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Frank Milautzcki: In Wahrheit ist es ein Entpellen
fixpoetry.com, 22.6.2009
Peer Trilcke: „Weltrundreise, lyrisches Tagebuch“
Literaturen 2009, Heft 4, S. 76
„die Natur heißt es übersetzen erfinden“
– Kunstnatur in der Lyrik Ulrike Draesners. –
Wollte man das bis dato veröffentlichte lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner1 einem lyrischen Subgenre zuordnen, so würde wohl kaum einer das Label ,Naturlyrik‘ wählen, obwohl ein Naturgedicht mit dem Titel „Sommergang“ den Buchrücken ihres Debütbandes ziert. Andere Gegenstände und Themen bleiben Lesern und Kritikern vielmehr im Gedächtnis haften und werden in der Forschung fokussiert: Draesners Interesse für physische Phänomene, ihre Auseinandersetzung mit Reproduktions- und Gentechnologie, ihre Darstellung omnipräsenter Medialisierung in unserer hoch technisierten Gegenwart sowie, davon nicht unwesentlich beeinträchtigt, Subjektkonstitution und zwischenmenschliche Interaktion. Erstaunlicherweise sind jedoch alle genannten Aspekte in Draesners Lyrik verwachsen mit der ,Natur‘ – hier zunächst verstanden als das Gegebene, nicht vom Menschen Geschaffene. Dass besagte Natur im dritten Jahrtausend nicht mehr dieselbe ist wie in der Romantik und man heute eine andere Sprache für sie finden muss, impliziert die Lyrikerin schon in ihrem ersten Band gedächtnisschleifen (1995):
die Natur heißt
es übersetzen erfinden (G, S. 80)
Wie Natur durch Sprachkunst zur Kunstnatur wird, soll im Folgenden gezeigt werden.
1 Natürliches Naturerleben in Retrospektion und Imagination
Versucht man, sich einen Überblick zu verschaffen über die (zunächst im engeren Sinne verstandene) Naturmotivik, ihre Ästhetisierung und Funktionalisierung in rund 300 Gedichten aus fünf Bänden, so treten Polaritäten zutage, zwischen denen die Texte oder gar einzelne Verse flottieren: Mit graduellen Abstufungen erstreckt sich das Spektrum zwischen unberührter und berührter, bedrohlicher und bedrohter, natürlicher und kultivierter, fremder und vertrauter Natur. Betrachtet wird diese Natur mit verschiedenem Maß und variierendem Mischverhältnis an Verklärung und Abgeklärtheit, dargestellt mit unterschiedlichen Techniken künstlerischer Verfremdung.
Sieht man von den sprachlichen Darstellungsverfahren zunächst ab, so zeigt der werkübergreifende Blick auf die Textsemantik, dass eine unberührte, unkultivierte Natur ebenso wie ein vollkommen ,natürliches‘ Naturerleben nur in der als solche gekennzeichneten, von der Sprechgegenwart abgesetzten Imagination und Erinnerung existiert. Singulär aufgrund seiner bruchlosen Illusionsbildung und emphatischen Idealität sowie auch wegen seiner strophischen Gleichmäßigkeit ist das bereits erwähnte Gedicht „Sommergang“, in dem rückblickend ein zeitenthobener, altersloser Glückszustand geschildert wird, der sich einem Leben in der Natur verdankt. Genau genommen schildert dieses Gedicht eine Liebesbeziehung zur Natur. Nur hier füllt die Erinnerung das gesamte Gedicht aus, andernorts manifestiert sie sich lediglich in Bruchstücken auf der Textoberfläche. Im Debütband gedächtnisschleifen wird ,natürliches‘ Naturerleben in der Gedichtgruppe „schnabelheim“ aus der (nachträglich simulierten) Kinderperspektive präsentiert, so zum Beispiel in „Das Hühnervolk, weiß, im Regen“ (G, S. 33). Indem das Gedicht die Wahrnehmungssituation der erinnernden Erwachsenen mit derjenigen des erinnerten Kindes verschränkt, erzeugt es selbst den Kontrast zwischen nüchtern-distanzierter Naturwahrnehmung und empathisch-identifikatorischem Naturerleben des Kindes. Die Rückkehr der Erwachsenen in einen einst vertrauten, jetzt fremden Garten bewirkt die augenblickshafte Erinnerung an eine vollkommene, sommerliche Glückseligkeit zwischen Feld und Himmel, eine natürliche Geborgenheit in der Natur („grannenbekrönt unter den wolken / lag, kamilleüberflossen, / dotterblumenbestreut zwischen / Kerbel und Garbe, Augustkönigin / aller Kinder“). Jäh erfolgt der Rückfall in die verregnete, herbstliche Gegenwart.
Wie eng die Kindheitserinnerungen der Sprecherin prinzipiell mit Naturerlebnissen verbunden sind, wird besonders deutlich im Gedicht „lärchensägen “ (G, S. 36f.), einer Montage von Sinneseindrücken, in der solche, die im Gehölz beim Sägen und Fällen einer Lärche entstehen, aufgrund des kreischenden Geräuschs überblendet werden mit einem Zahnarztbesuch des Kindes, der mit dem Einsetzen einer Zahnspange endet. Beide Bilder zeigen den Versuch, Urwüchsig-Natürliches zu regulieren und zu korrigieren, wobei die Überschneidung oder gar Kongruenz der Bilder (zum Beispiel im Fließen des Harzes und des Speichels) auch sprachlich im Begriff des Kiefers beziehungsweise der Kiefer gelingt.
Da die meisten Naturerlebnisse der Kindheit dennoch überwiegend positive Erinnerungen stiften, fällt es besonders ins Auge, wenn die Natur einmal unmissverständlich als fremd und bedrohlich dargestellt wird: Im Gedicht „die umwelt, das kalben“ (G, S. 31) herrscht eine bedrückende Stimmung vor, „innere(s) alpdrücken“, verursacht durch diffuse Ängste aus der Kindheit, die sich nicht abschütteln lassen („lebenslang schwitzen kinderalpträume nach“). Sie stehen im Zusammenhang mit Naturerlebnissen in den Alpen, die auf das Kind in ihrer Größe erdrückend wirken und dem Menschen als übermächtige Natur gegenüberstehen. Anders als in „Das Hühnervolk, weiß, im Regen“ findet das bei Kindern zu erwartende natürliche, harmonische Naturerleben hier nicht statt, denn „das kind fremdelt schon wieder am stein“. Das Zentralmotiv ist die dreifach wiederholte Fügung „glühende angstwangen“, die aus der Projektion des topischen, an sich positiv konnotierten ,Alpenglühens‘ auf die Wangen entsteht und den bedrohlichen Eindruck der Alpen visualisiert. Mehrfach fällt auch die ebenfalls durch Verschiebung entstandene Wendung der ,kalbenden Berge‘, wobei das titelgebende ,Kalben‘, das sich eigentlich auf einen Gletscher bezieht, im Kontext des Gedichts die Fortpflanzung der Angst ins Erwachsenenleben und das Auseinanderbrechen einer vormaligen Einheit ausdrückt. Die ,kalbenden Berge‘ beziehungsweise Gletscher, aber auch die Setzung des Begriffs „umwelt“ im Titel, welche die Assoziation mit der Umweltkrise weckt, passen durchaus ins Bild, da die alpine Natur selbst bedroht ist („im letztblumenreservat eine hohe / giftversammlung“). Die Substitution des Naturbegriffs durch die vom Menschen geprägte und aus anthropozentrischer Perspektive definierte ,umwelt‘, die seit der öffentlichen Diskursivierung der Umweltkrisen der 1980er Jahre per se negativ konnotiert ist, deutet, Entfremdung suggerierend, auf ein Verhältnis von Mensch und Natur hin, in dem sich beide als aktives Subjekt und passives Objekt gegenüberstehen.
Noch expliziter werden menschliche Ein- und Übergriffe auf die Natur im Gedicht „Mehrstimmiger Holunder“ (G, S. 18) thematisiert. Aus der kultivierten Natur, dem Übergangsbereich von Natur und Kultur, sprechen Mensch und Natur in synästhetischer Polyphonie. Verwunderung wird laut über die Trübung des Flusses, die man sich mit dem Gestus der Selbstberuhigung durch das soeben erfolgte Mähen der Wiesen erklären kann („nach / der ersten Mahd, ist der Fluß natürlich / so milchgrün?“). Jedoch ist die Verwendung von Kunstdünger – man beachte die Gegenüberstellung von Natürlichem und Künstlichem, Natur und Kunst – kein Geheimnis („über eine Landschaft / ausgegossener Chemie-Segen / pflegt die ÜBERNATUR, blühend, / hat jeder ein Recht auf eine Seele“). Ironisch verweist die in Majuskeln gedruckte und somit als Zitat und Fremdpartikel markierte ,Übernatur‘, die im Verbund mit der komplementären ,Natur‘ dem für das christliche Mittelalter typischen Oppositionspaar von Immanenz und Transzendenz entspricht, auf den Eingriff in die Natur. Eine künstliche Steigerung der Natur – der Absicht nach eine Verbesserung, im Resultat eine Verschmutzung – bewirkt hier aber kein allmächtiger Gott, sondern der Mensch, der seiner Umwelt auch nur mehr ironischerweise eine Seele zugesteht.
Fortgeschrieben wird die implizite Kritik an der ,Kultivierung‘ der Natur bis in den Band berührte orte (2008), wo im Gedicht „heimische flora“ (BO, S. 51) das „vernichten“ und „züchten“ angeprangert werden, in „toxikographie“ (BO, S. 53) die Naturbeschreibung zur Giftschrift gerät und sich ein verstörtes „ich“ im „anthropogen gestörte(n) wuchsplatz“ zurechtfinden muss (BO, S. 57).
2 Natur-Liebe und künstliche Reproduktion
Schon in den gedächtnisschleifen deutet sich eine Weiterentwicklung der Natur-Referenzen in verschiedene Richtungen und mit unterschiedlichen Konnotationen an: Ist in den Kindheitsgedichten der Naturbezug bis hin zur gefühlten Identifikation mit der Natur noch völlig asexuell, so erscheint er im Gedicht „Sommergang“ bereits eindeutig erotisch aufgeladen. Während in diesem Liebesgedicht an die Natur noch die Beziehung zwischen Mensch und Natur im Zentrum steht, verschiebt sich die Konstellation in den Gedichten über zwischenmenschliche Liebesbeziehungen, doch wird die Identifikation der Liebenden mit der Natur fortgesetzt. Letzterer werden die Bilder zur Charakterisierung der Liebesbeziehung entnommen, etwa in einem Gedicht über Geschlechterrollen in Mann-Frau-Beziehungen, worin die Sprecherin sich selbst als „die Kastanie auf seinem Weg“ und später beide nebeneinander sitzend als „zwei weiße stumme Farne“ bezeichnet („Eher nördliche Krise“ [o.T.], G, S. 106).
Die Konzeption derartiger Vergleiche und Metaphern ist wegweisend für den Band kugelblitz (2005), in dem eine Liebe in drei Phasen („lieben“, „kriegen“, „später“) skizziert wird. Nur scheinbar ist die Natur in die Rolle einer bloßen Kulisse zurückgedrängt, tatsächlich ist sie das ,Vorbild‘ für die Liebenden. Zum Beispiel erinnert die Sprecherin an ihren einstigen Traum von schrankenloser Intimität:
aber ich
wollte die
anschmiegsame tanne.
sein („wo dieses stückchen angefangen aufgehört“, K, S. 28)
Diese sich leitmotivisch durch kugelblitz ziehende Baummetaphorik kennt man schon aus für die nacht geheuerte zellen (2001), jedoch steht der Vergleich von Menschenkörper und Baum („unser körper / bäume ineinandergesteckt: adern, nerven“, „post dolly“, Z, S. 116f.) dort im Kontext der Genforschung. Eine Verbindung von Natur/Pflanze, Mensch/Körper und Medizintechnik wird bereits in der Gedichtgruppe „verpflanzungsgebiet“ (G, S. 99–117) geschaffen. Der Titel verweist augenscheinlich auf einen Übergangsbereich zwischen Natur und Kultur, die zugehörigen vier „autopilot“-Gedichte handeln von Organtransplantation; in „pflanzstätte (autopilot IV)“ bezeichnet sich das Sprecher-Ich selbst als „pflanzstätte“, die ein fremdes Herz empfängt. Weniger technizistische als biologistische Diskurse prägen die Assoziation von Natur/Pflanze und Mensch/Körper wiederum in den Gedichten „luna matutina“ und „oxygen“ (Z, S. 30, 76f.), die natürliche Reproduktionsprozesse fokussieren und damit Pendants zu den Texten über künstliche Reproduktion darstellen. Noch einmal anders perspektiviert wird die besagte Assoziation im Gedicht „meine lieben alpen“ (Z, S. 69), das die aus einem Flugzeug betrachteten Landschaftsformationen sowohl mit technischen Utensilien als auch mit Körperteilen identifiziert und dabei erneut mit Allusion auf die Gentechnik über das Verhältnis von Mensch und Natur reflektiert.
Und schließlich klingt in den gedächtnisschleifen auch schon der Konnex von Natur und Tod als ganz wörtlich genommene organische Auflösung in der Natur an, der in für die nacht geheuerte zellen weiter ausgebaut wird. In diesem Sinne korrespondiert das letzte Gedicht des Debütbandes, „Rotten munter die riechenden Toten“, mit einer Reihe von Gedichten, die ein Hervorgehen aus und ein Vergehen in der Natur imaginieren: sei es nur am Rande und scheinbar en passant wie in „… is real killing you?“ („erde. dass wir daraus wachsen, / schrötig, komplex, hätte wer gedacht.“, Z, S. 120) oder aber obsessiv-repetitiv wie in „number 4, 26. april ’86“, dessen Refrain „wir gruben wir begruben“ (Z, S. 78ff.) den Prozess „lernen wie schnell / einer erde wird“ begleitet, bevor die Erkenntnis des Todes mit demselben zusammenfällt, sodass der Text die Auflösung und das Verstummen performativ vor Augen führt („wir sind erde, / wir sind / wir si“). Die Natur wird dabei ganz neutral als intentionslos, willkürlich und gleichgültig dargestellt:
doch die Natur erwartet vom Menschen,
daß er sie ungerührt hinnimmt, die schwarze
Leere von Anfang und Ende („Rotten munter die riechenden Toten“, G, S. 121f., hier 122).
Selbst die endgültige Auflösung in der Natur wird nicht angstvoll imaginiert; im Gegenteil, das Sprecher-Ich sehnt sich des Öfteren geradezu nach erlösender Verschmelzung mit seiner natürlichen Umwelt und gibt sich dieser Phantasie hin:
wenn es mir schlecht geht, denke ich an den
schlamm ( … ) die eigenschaften des schlamms ergreifen von mir
besitz (…) ich lade mich
selbst
in diese form. („endschwammessen“, Z, S. 106f.)
3 Kulturelle Korrosion und wildes Wuchern
Die zuletzt zitierten Verse wecken unwillkürlich die Assoziation mit Draesners zweitem Lyrikband anis-o-trop (2000), denn sie lesen sich wie dessen ursprüngliche Motivation, und selbst der in Bezug auf den amorphen Schlamm scheinbar so unpassende Form-Begriff wird dadurch zum metapoetischen Kommentar. Im Ensemble der fünf Lyrikbände fällt der Sonettzyklus sichtbar aus der Reihe: Den metrisch unregelmäßigen, reimlosen, syntaktisch stark elliptischen und strophisch je individuell arrangierten Versen im Flattersatz stehen 15 Sonette romanischen Typs gegenüber, die nicht nur semantisch, sondern auch durch die Wiederholung von Wortmaterial aus dem jeweils letzten Vers eines Sonetts im ersten des darauf folgenden miteinander verkettet sind, wobei das finale 15. Sonett aus sämtlichen Anfangszeilen der 14 anderen zusammengesetzt ist. Vom strengen Sonettkranzschema weicht Draesner durch die Entscheidung gegen jegliche Endreime und die nur partielle Wiederholung des letzten Verses sowie geringfügige Modifikationen der im letzten Sonett kombinierten Anfangsverse ab. Der Reiz dieses Konstrukts besteht im Spannungsverhältnis zwischen seiner äußeren Form und seiner inneren Formlosigkeit, seiner artifiziellen Ordnung und seiner semantischen Unordnung/Entropie, denn sämtliche 15 Sonette bündeln fragmentarische Bilder der Zer- und Ersetzung, die sich durch stetige Rekombination des Wortmaterials reduplizieren. Der ordnungslosen Ausbreitung und ,Fortpflanzung‘ des Wortmaterials und der Zeichen kulturellen Verfalls sowie wilden Wachstums mag sich der Titel anis-o-trop verdanken, dessen den Sonetten vorangestellte Bedeutungsdefinition die Schlagworte ,Richtungsvielfalt‘ und ,Doppelbrechung‘ zur metapoetologischen Aufladung offeriert.
Anfangs lesen sich diese Texte als Imagination einer ,Welt ohne uns‘,2 in der die Natur den menschlichen Lebensraum zurückerobert, indem sie die restlichen Kulturzeichen (eine unbewohnte Hotelruine, leere Treibhäuser als Zeichen des einstigen Versuchs der Kultivierung der Natur) mit Flechten überwuchert und durch Fäule, Pilze und Schimmel zersetzt. Inhaltlich wie sprachlich ist es ein (auf sprachlicher Ebene stark autoreflexiver) Kampf des Amorphen gegen jegliche Form. Gegen Mitte des Zyklus gerät diese Welt in Bewegung, als sich ein unspezifisches „W-I-R, eine reisegruppe“ formiert, bestehend aus Mensch, Medium und Maschine – die Grenzen verfließen in bizarren Versuchsanordnungen und Experimenten. Die wuchernde Natur wird wiederum eingedämmt durch Bilder einer sich verselbständigenden Technisierung, die ,Natur‘ oder ,Natürliches‘ simuliert („echte vögel durch kunstdraht ersetzt“, IX). Der unbeschreibbare, agentenlose, von verschiedener Seite ausgehende und in verschiedene Richtungen ausstrahlende Vorgang, der sich hier abspielt, scheint zunehmend außer Kontrolle zu geraten: „es, das ortlose, / einzelne ding, kindartig, neutral, monströs, ist kaum sichtbar“ (X), alles ist „unlösbar verbunden der vegetation, / in einer / anisodonten wirklichkeit aber ist es zu spät, um zu wissen.“ (X) Das konkreteste Bild für die conditio humana lautet: Man ist „eine warze aus schwachheit und schleim“ (XII, XIII), „ins kristallgrit der dinge gestreut, ein knoten aus sprache“ (XV). Mit dieser Fügung (die bereits in XIII auftaucht) endet das letzte Sonett.
Der autoreferenzielle Schlusspunkt, der den Menschen über seine Sprache definiert und zugleich die Materialität des sonettistischen „Text-Gewebes“3 ausstellt, verlangt nach einer genaueren Betrachtung des zugrunde liegenden Schreibverfahrens. Während die Literaturkritik versucht, dieses mit bildhafter Umschreibung zu (er-)fassen („Die Sprache folgt in wortschöpfenden Wirbeln einem wuchernden Nichts durch kafkaeske Räume.“),4 lassen sich doch verschiedene, unter ,Verfremdung‘ subsumierbare Techniken festmachen: Über ,konventionalisierte‘ Verfremdungsverfahren wie ungewöhnliche Metaphorisierung, Stilbrüche und Vermischung verschiedener Idiome gehen die Sonette hinaus, indem sie den Gegenstand radikal, das heißt bis zur Unkenntlichkeit, fragmentieren, dekonstruieren und dekontextualisieren. Zur Zerlegung, Verkürzung und Verschiebung kommen die Mischung von gleichermaßen schwer entschlüsselbaren Abstrakta und Konkreta sowie die oftmals lautlich motivierte Assoziation von Nicht-Zusammengehörigem. Vor allem aber wurzeln die Verständnisschwierigkeiten des Lesers in der Absenz eines Referenzgegenstandes, eines narrativen Handlungsfortgangs und/oder Kausalzusammenhangs, die sich der referenziellen Polyvalenz der meisten Textelemente verdankt.
Techniken, die in anis-o-trop radikalisiert sind, finden sich schon in den „gedächtnisschleifen“. Hier ist die Sprechsituation, das heißt die Verortung der Sprechinstanz und ihr Anliegen, jedoch noch leichter rekonstruierbar als in den späteren Bänden. Wie in anis-o-trop nimmt die (Auto-)Reflexion über Sprache, Sprachmaterial und Sprechen in der zweiten Hälfte des Debütbandes zu (besonders in „pfingstmikrophon“, G, S. 97, und in „reddn können“ [o.T.], G, S. 98). Allerdings ist der Band stilistisch – im Gegensatz zum Sonettzyklus – relativ heterogen, die syntaktische Dekomposition ist unterschiedlich weit fortgeschritten und es dominieren unterschiedliche Verfahren, am meisten wohl die bereits erwähnte Mehrfachbedeutung und Polyreferenz einzelner, in Kettensätzen aneinandergereihter Begriffe. Im Hinblick auf die Intensität und Radikalität der Verfremdung kann man anis-o-trop und den Folgeband für die nacht geheuerte zellen, der auch noch Gedichte aus den 1990er Jahren enthält, durchaus als Höhepunkte im lyrischen Werk Draesners ansehen, denn in kugelblitz lässt sich eine tendenzielle – freilich nur relative – Rückkehr zu einer fließenderen, syntaktisch vollständigeren, weniger abstrakten Sprache feststellen; und auch die Gedichte in berührte orte bestehen aus vergleichsweise längeren Sinneinheiten und weniger autonomen Splittern.
4 Ent- und Verfremdung: Restnatur im Medium
Angesichts der werkübergreifend dennoch unbestreitbaren Kontinuität ästhetischer Verfremdung drängt sich die Frage auf, ob diese mit einer erlebten Entfremdung – gemäß vorliegendem Untersuchungsinteresse speziell im Sinne einer Veränderung der ursprünglichen, natürlichen Beziehung zur Natur – zusammenhängt, indem sie realiter symptomatisch daraus hervorgeht oder idealiter eine solche signalisieren will.5 Zwar ist die Verfremdung in anis-o-trop nicht zuletzt der experimentellen Kombinatorik des Sonettkranzes geschuldet, doch scheint sie auch in der Interferenz von Natur und Kultur, von Natürlichem und Künstlichem zu gründen und Ausdruck einer dadurch verursachten Derealisation zu sein. Über diesen Konnex gibt der Blick auf den Band für die nacht geheuerte zellen Aufschluss.
Einen grundlegenden Naturbezug signalisiert die Unterteilung der Sammlung in sechs Sektionen, die trotz individueller Titel in Klammern jeweils einem Element (hier: Feuer, Metall, Wasser, Luft, Erde, Holz) zugeordnet sind, wobei sich die Sechszahl durch die Kombination verschiedener Elementenlehren ergibt: der Tetrade der abendländischen Elementenlehre (Feuer, Wasser, Erde, Luft) und der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre (Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde), die als daoistische Theorie der Naturbeschreibung dient und sich mitunter auch auf ganzheitliche medizinische Ansätze wie etwa die Akupunktur (die Draesner in den Anmerkungen des Bandes erwähnt) auswirkt. Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Gedichten und den in den Sektionstiteln genannten Elementen ist jedoch aufgrund der starken Verfremdung meist nicht unmittelbar evident.
Ein paradigmatisches Beispiel für die Transformation des Natürlichen ins Künstliche ist der dem Element Erde zugeordnete Text „er sagt, dass wir in einer röhre gehen (bukol l)“ (Z, S. 99f.), dessen Titel auf die Tradition der Bukolik verweist. Die Wahrnehmung einer ländlichen Szenerie ist medial verfremdet durch die simulierte Optik verschiedener visueller Medien („von pixeln durchwuchert“, „installiert“, „ein folienbild: zwischen glaskammern, zwei / glaskästen zwischen zwei durchsichtigen klammern“). Fragmente des Spektakels, das eine Kamera offenbar an einem Set filmt („next take“), erscheinen auch in „hinter glas“-Bildern. Man ,spielt‘ in der Landschaft, vor künstlich ausgeleuchteten Kulissen, die Technik ersetzt das Naturphänomen (Licht, Wetterleuchten). Die Requisiten des Filmsets („softbox“, „summende wanne“, „eskaladierwand“) vermengen sich mit solchen aus der Hirtendichtung („flöte“, „schäfer“, „hain“, „schafkot“) und bizarren Hybriden („tuberkeltorso“, „polyesterhand“). Als „landschaftswahn“ wird das ganze Geschehen trocken bezeichnet.
Irritation erzeugen zum einen, wie hier, die gleichzeitige Referenz auf unterschiedliche Medien und zum anderen die plötzliche Veränderung des Realitätsstatus (real vs. surreal/virtuell): so zum Beispiel in „forsythien, die knallgelb, noch blattlos, ihr würfeln“ (Z, S. 102f.), wo ein zunächst körperlich von einem Mädchen als Naturraum erlebter „seltsame(r) wald“ unvorbereitet Teil der virtuellen Welt wird und auf einem Computerbildschirm ,anzuklicken‘ ist. Öfter fungiert ein Wald – auch noch in der Sammlung kugelblitz – in Erinnerung, Traum und Wunschvorstellung als Raum für intime Begegnungen sowohl zwischen Menschen (etwa zwischen Tochter und Vater in „forsythien“ oder Liebenden in kugelblitz) als auch zwischen Mensch und Natur. Der Sehnsuchtsort entzieht sich jedoch der Realität, sodass notfalls auch mit dem medial simulierten Surrogat Vorlieb genommen werden muss, wie im Gedicht „im unterboden einer idee“ (K, S. 29), dessen Sprecherin gegenüber ihrem abwesenden Geliebten, mit dem sie in einem Haus in der Natur hätte leben wollen, resigniert konzediert, sie „nähme ein stück fabrik / mit wald im / monitor“. Und im Gedicht „monitoring“ (Z, S. 112f.), dessen Titel auf die systematische Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs verweist, in diesem Fall des Mediums und des eigenen Selbst, heißt es:
um glücklich zu sein
boote ich
abends das notebook hoch. Schwärme
unbekannter vögel
Als ,Restnatur im Medium‘ könnte man dies bezeichnen, um an Draesners eigene Wendung „Restnatur im Halbidyll“6 anzuknüpfen, die sie in ihrem gleichnamigen Essay zur Beschreibung des digitalen Zeitalters prägt: Anhand vieler Beispiele aus Informations-, Kommunikations- und Entertainment-Technologie konstatiert sie eine omnipräsente Medialisierung. Mit der (überwundenen) Idylle assoziiert sie eine Literatur, die „eine kitschig nostalgische Vorstellung von Subjekteinheit, Zentrismus und überschaubarer Welt zeigt, in der allenfalls mal ein Telefon klingelt, jedenfalls aber Menschen sich als einheitliche Ich und Dus gegenüberstehen“, ohne Bewusstsein davon, dass „nichts naturgegeben und alles gemacht ist“.7 Das Programm für die Autoren der Gegenwart lautet folglich: „Die Literatur wird der Realität der Zersplitterung (…) nur nahe kommen können, (…) wenn sie das Halbidyll eines nostalgischen oder nur verpoppten Realismus aufgibt, die Inszenierung der Restnatur fallen lässt“8 – oder aber Letztere ausreichend verfremdet, muss hinzugefügt werden.
Ganz im Sinne des maßgeblichen Theoretikers ästhetischer Verfremdung, Viktor Šklovskij, bewirkt Draesners Medialisierung von Naturphänomenen die programmatisch zur Bestimmung von Kunst als solcher geforderte ,Entautomatisierung der Wahrnehmung‘, indem sie den Wahrnehmungsprozess erschwert, verlängert und sogar thematisiert.9 Zwar verwendet Draesner eine Vielzahl traditioneller Verfahren zur Verfremdung (Collage, Montage, Deformation, Denaturierung, Dekontextualisierung, Deplacierung, Dislokation, Entstellung, Verschiebung);10 doch sind diese in ihrer Referenz deutlich vom aktuellen Zeithintergrund und der subjektiven Wahrnehmung desselben durch die Autorin geprägt. Auf die durch die exzessive Medialisierung bewirkte ,neue Unübersichtlichkeit‘ und gefühlte ,Unwirklichkeit‘ reagiert Draesner mit der Problematisierung der Abbildbarkeit ihrer Umwelt, die sie oft durch Einsatz zusätzlicher ,Wahrnehmungsinstrumente‘ veranschaulicht. Freilich geht es zugleich auch immer darum, das Sprachmaterial unter die Lupe zu nehmen und die Grenzen des Darstellungsmediums zu erproben, wobei seine Künstlichkeit zutage tritt.
Zusammenfassend kann man in Bezug auf Draesners Darstellung von ,Restnatur‘ Verfremdungen, die einer subjektiven Entfremdung geschuldet sind, unterscheiden von solchen, die Transformationen der äußeren Umwelt infolge der Lebensweise einer maximierungsorientierten Konsumgesellschaft entsprechen. Meist greift jedoch beides ineinander. Die ästhetische Verfremdung der heimatlichen Umwelt signalisiert und schafft Distanz; sie richtet sich gegen Verklärung, unkritische Identifikation und impliziert Gesellschaftskritik. Überdies sind verfremdende Naturdarstellungen freilich auch innerliterarisch motiviert als kritische Replik auf die Tradition idealisierender Naturlyrik.
Während Draesner den Menschen prinzipiell als Teil der Natur begreift, registriert sie zugleich dessen Entfremdung durch ,Kulturleistungen‘ wie die Gentechnik. Gern spricht Draesner vom „anthropotechnischen Zeitalter“,11 das mit dem Klonen die eigene Züchtbarkeit entdeckt hat. Insbesondere die Reproduktionstechnik schafft einen Übergangsbereich zwischen Natürlichem und Künstlichem. Wenig überraschend ist es daher, dass Körper und Medien bei der Interferenz von Natur und Kultur/Kunst thematisch gleichermaßen zentrale Rollen spielen. Dementsprechend verschwimmen die Grenzen zwischen Natur und Kultur/Kunst im Werk Draesners und die Dichotomie löst sich auf in einer hybriden Kunstnatur.
Evi Zemanek, aus TEXT+KRITIK: Ulrike Draesner – Heft 201, edition text + kritik, 2014
Preisverleihung des Großen Preises des Deutschen Literaturfonds 2021 an Ulrike Draesner ab 14.:43 am 11. Oktober 2021 im Literaturhaus in Leipzig
Christian Schlösser im Gespräch mit Ulrike Draesner.
(Das Gespräch wurde am 16. April 2005 in Oxford am Rande einer von Karen Leeder am New College organisierten international besetzten Fachtagung zur Lyrik des 20. Jahrhunderts geführt.)
„Als ob“
Ulrike Draesner im Interview mit sich selbst über ihr Leben als Schriftstellerin und als Professorin für literarisches Schreiben.
Auf einen Kaffee mit… Ulrike Draesner
ULRIKE DRAESNER
Ein Dichter ging im Walde
wollt dichten dort und schreiben
wollt Verse aus sich treiben
und etwas Schnitzen halt.
Wie er grad schön am Schnitzen war
sprach ihn ein Wolferl an
ob er vielleicht s’ rottkupfen sah
leck mi, sprach drauf der Mann.
Des bracht das Wolferl so in Wut
eh ich mich weiter veräppeln lass
mach i mir so recht den Spaß
und freß die Type samt mit Hut.
Gesagt gefressen, ein Elend fast gut
wobei man sagen dürfen müssen tut:
du Dichterpack bleib fein Zuhause
kennst dich im Walde eh nit aus.
Peter Wawerzinek
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Linksammlung + KLG +
IMDb + Facebook + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Anton G. Leitner interviewt die Schriftstellerin Ulrike Draesner – Werk, Wirkung, Wirklichkeit 4.1
Anton G. Leitner interviewt die Schriftstellerin Ulrike Draesner – Werk, Wirkung, Wirklichkeit 4.2


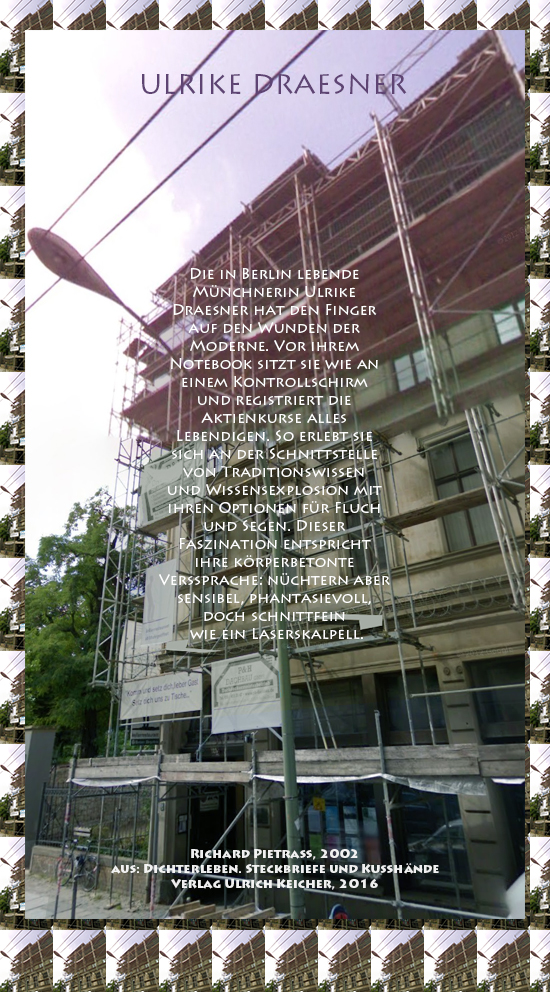

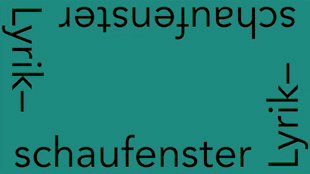
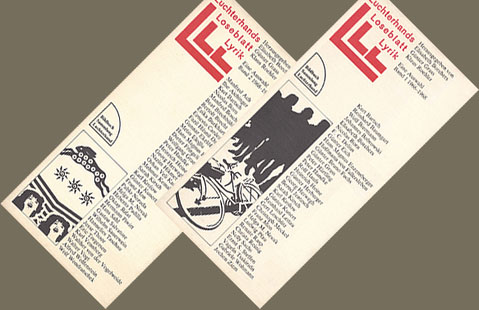


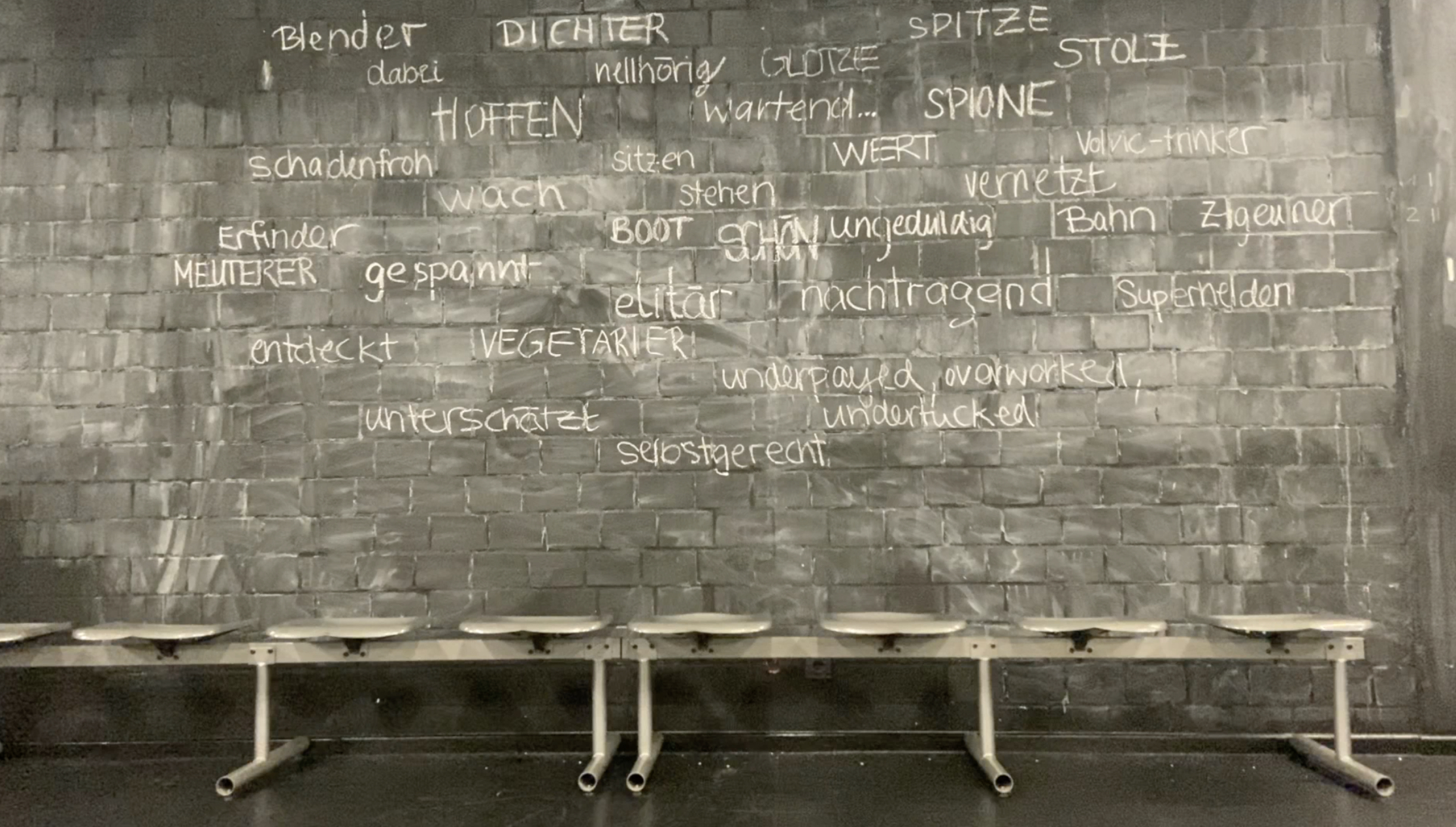
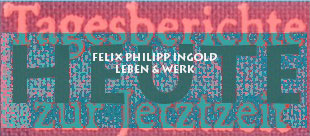
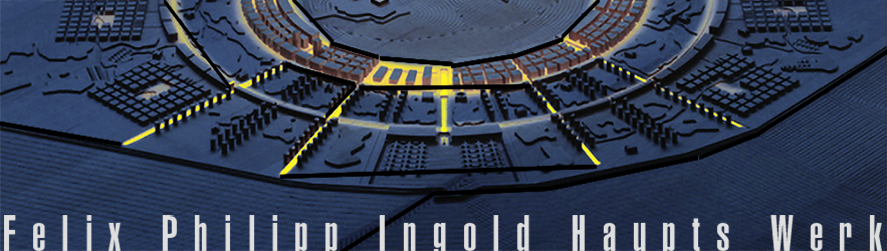
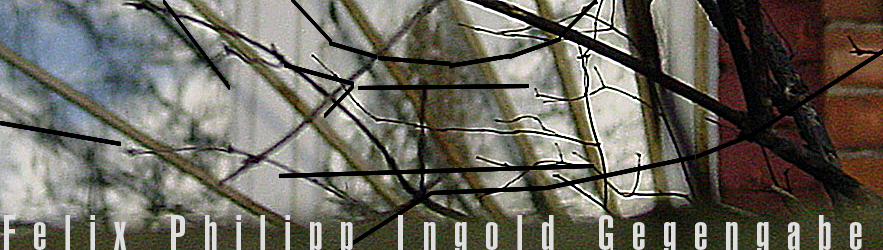
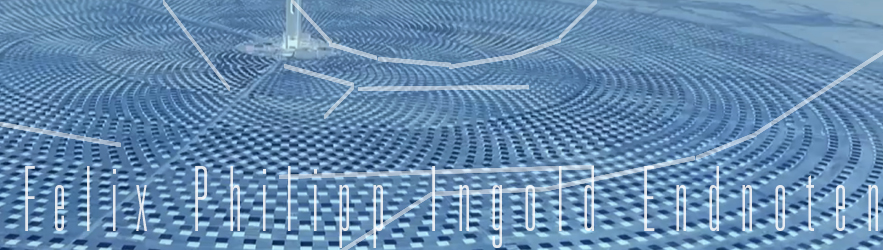

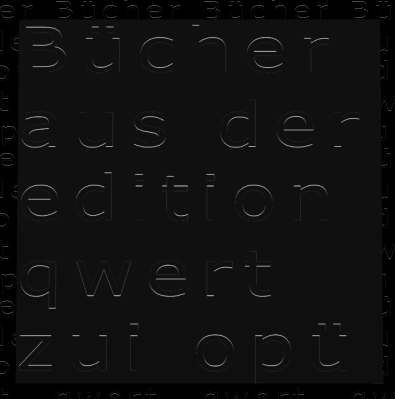
Schreibe einen Kommentar