Urs Allemann: Holder die Polder
SAPPHISCH DIE SIEBTE
Ob vom eignen Herzen erschlagen du zu
singen wes und zuckts übern Boden ob du
hinschlugst es vor Augen herauf noch schwarz und
sie es dir abschlug
von der Zunge als du sie harrten Steine
aber wes Gebrüll noch im Knochen leise
es davontrug und überm Fleisch der Geier
als es zu schneien
noch sich totstellt dass du es zu verschweigen
wär wes Aas vorm Zerrspiegel bräch das Maul wund
Blut zu sagen dass es dich zu zerreissen
rot übers Wort fuhr
Nach Klopstock, nach Hölderlin und nach 200 Jahren ohne,
sind hier wieder Oden zu lesen, in wüster Zerstückelung und doch in bester Ordnung auch: die Teile eines Sprach- wie Körpers, gestückelt und verteilt über das ganze Gedicht und von diesem zusammengehalten, vom Gedicht gebunden. Wenn die radikale Fragmentierung und Auflösung die Signatur unserer Zeit ist, erweist sich der Sinn und der Wert gebundener Rede: zu erhalten, was zutiefst und zuinnerst bedroht ist. Keine Konservation also, die am schon immer Idyllischen ansetzt, sondern im festen Fluß des sichern Metrums wird bewahrt, was wirklich gefährdet ist. „Die Oden Allemanns scheinen auf den ersten Blick jede Form des Erhabenen zu parodieren und zu persiflieren. Bei genauer Lektüre jedoch kehrt es, vielfach gebrochen, segmentiert, in den Oden-Text zurück: als Sinn, als (Liebes-)Geschichte, als Sprachphantasie, im (fast durchgehenden) Duktus des Anredens. Es läßt sich sogar behaupten, das verschüttete Erhabene gehöre zu den schönsten Geheimnissen dieser neuen, überraschenden Oden-Dichtung.“ (Heinz Schafroth in „manuskripte“)
Urs Engeler Editor, Ankündigung, 2001
Orpheus sitzt sozusagen am Laptop
− Gelungene Fusion von Bildschirmwelt und Lyrik: In seinem neuen Gedichtband belebt „Babyficker“-Autor Urs Allemann antike Strophenformen mit aktueller Welterfahrung. −
Die Tradition ist tot, es lebe die Tradition: Unter diesem Motto liesse sich ein nicht unbedeutender Teil der neueren Lyrik versammeln. Denn während das Gedicht der Moderne sich nur in Abgrenzung zur Vormoderne konstituieren konnte, lässt sich in jüngster Zeit wieder eine bewusste Anknüpfung an klassische Formen beobachten. Fast scheint es, als riefe die Zerstückelung der Gedichtkörper, treibt man sie nur genügend weit (und man hat sie weit genug getrieben), von selbst wieder die Sehnsucht nach Ganzheit hervor. Schlimm, wenn diese Sehnsucht nostalgisch wäre, nichts als eine poetischideologische Restauration. Auf Epigonen, die sich ins Gewand der strengen Form hüllen, um damit ihre schöpferische Blösse zu bedecken, sind die Liebhaberinnen und Liebhaber der Lyrik bestimmt nicht scharf. Prüfstein des ästhetischen Gelingens muss gerade beim Revival der traditionellen Formen sein, dass sie in produktive Spannung zur Gegenwart gesetzt werden. Metrum und Odenstrophe nicht als Beruhigungspille, kein Gott mit Leier, der uns durch die Vertrautheit seiner Melodien einlullt. Erst wenn Orpheus sozusagen am Laptop sitzt, ist es legitim, ihn noch immer anzurufen.
Halb Wort, halb Fleisch
Dass eine solch gegenwärtige Welterfahrung gerade durch die Konfrontation mit überlieferten Formgesetzen an Eindringlichkeit gewinnen kann, beweist Urs Allemann in seinem neuen Gedichtband „Holder die Polder“. Der Schweizer Schriftsteller und Journalist, der mit seiner „Babyficker“-Erzählung einst die Gemüter erregt hatte, legt nun ganze Odenzyklen vor – mit so genannt alkäischen, asklepiadeischen und sapphischen Strophenformen.
Wer sich die Mühe macht, Allemanns Gedichte auf ihre Konstruktionsweise hin zu untersuchen, wird feststellen, dass sie oft tatsächlich nach allen Regeln der Kunst gebaut sind. Zum Kunstwerk im emphatischen Sinn werden sie allerdings erst, weil sie kaum je künstlich sind. Man muss nicht Poetik studiert haben, um diese Lyrik zu mögen. Und das ist gut so.
Die Gedichte Allemanns sind genau durchdacht (dazu zwingt allein schon die metrische Form), aber Gedankenlyrik sind sie nirgends. Von Blässe findet sich keine Spur – müsste man die Texte mit einer Farbe bezeichnen, dann wäre es Blutrot. Eine brachiale Körperlichkeit herrscht in Allemanns Versen, zum Wort „Fleisch“ unterhält der Dichter eine innige Beziehung. Wird die Liebe besungen, dann ist sie nicht platonisch; scheint Schönheit auf, dann nicht durch Harmonie. Allemann fasst die Menschennatur elementar: als Lust, als Schrecken, als Gewalt. Nicht Winckelmann und Goethe sind seine Vermittler zu den Griechen, sondern Nietzsche und die „Penthesilea“ von Kleist. „Wir werfen / uns auf die Erde ins Unsre die Herzen die Hände / die Zähne zu schlagen“, heisst es im „Vorspiel“.
Und: „Wenn zufällig Orpheus vorbei käm / würd ich ihm was vorsingen der fleisch- / fressenden Leier ihren Anteil rüber- / schieben am Nachgefallenen“. Das Pathos ist also durchaus da, aber die „Os“ des Odentons werden bei Allemann vielfach gebrochen: durch einen spielerischen Umgang mit der Sprache („o Bikinosum! o Nudifezzelein!“); durch eine schulinkompatible Grammatik; durch den Vorsatz, den Sinn nicht auf dem Silbertablett zu servieren. Aktuell ist Allemanns antikisierende Dichtung aber auch dadurch, dass seine „Versgeburten“ am Bildschirm stattfinden. Genauer: dass er die Bildschirmwelt mit ihrem Vokabular und ihren spezifischen Schreibbedingungen in seine Texte hineinnimmt. Das „Bildschirmglas“ wird so zum Spiegel, der das poetologische Selbstporträt des Autors reflektiert. Und der Spiegel der Kritik? Er zeigt ein strahlendes Gesicht, einen lächelnden Mund, der zu einer Hymne auf diese unerhörte Odendichtung ausholt (denn die Oden sind das Zentrale, obwohl es in dem Band auch noch „Elegien“ und „Andere“ gibt). Urs Allemann erweist sich in „Holder die Polder“ als Sprachzauberer, als zungenfertiger Mixer, der einen aufregenden lyrischen Cocktail präsentiert.
Odenklüppelschwinger
Es gelingt dem jüngsten Spross der zweitausendsiebenhundert-jährigen Odendichterfamilie, aus der Fusion des Disparaten, aus alten und neuen Formen, aus Griechentum und Gegenwart, aus Leier und Laptop einen eigenständigen, starken Sound zu kreieren. Melancholisch und verspielt, kraftvoll und gebrochen, dialektal und in höchstem Hochdeutsch. Wer den „Odenklöppel“ wie Allemann zu schwingen versteht, dem schauen wir gebannt bei seinem zeitlos-unzeitgemässen Handwerk zu. Chapeau, monsieur le poète!
Philipp Gut, Tages-Anzeiger, 22.8.2001
Sprachkämpfe im Paradies
− Urs Allemann beherrscht das weiche „d“. −
Gedichte tragen in sich die Anweisung, wie sie ausgelegt sein wollen. Handeln sie vom Schreiben, soll es nichts außer ihnen geben. Ihre Kritik richtet sich dann gegen die Unfähigkeit, die eigene poetische Welt aufzubauen und abzuschotten. Für diese Kritik benötigt der Dichter eine Konstruktion, in der das Neue wie auch das Äußere Platz finden. Im Rollenspiel von Ich und Du beobachtet Urs Allemann das Entstehen seiner Gedichte. Seine Konstruktion geht auf Paul Celan zurück, dessen „Ich“, das historische Subjekt, im „Du“ eine autonome Kraft schafft, die das Schreiben übernehmen soll und dabei, im Namen des „Er“, als Herrn der Dichtung, vom „Ich“ beobachtet wird. Celan hatte dafür einen historischen Standpunkt, Allemann möchte in der Kunst bleiben und bringt die Folgen dieses Wagnisses zu Papier.
Er beginnt seinen Lyrikband „Holder die Polder“ mit einem Gedicht „Für die Leier“ und setzt ein Selbstporträt ans Ende. Beide Gedichte spielen draußen im Leben und sind ganz anders als die übrigen. Das Buch tut so seinen eigenen Prolog und den Epilog ab: Diesen fehle ein auf neue Weise dichtendes Du, das – merkwürdigerweise – die antike Odenform beherrscht. Das Ich derweil hat Ansprüche. Von der eigenen Sentimentalität, die im Selbstporträt ohne artistische Härte ausgestellt wird, spricht es ironisch: Ohne Du, so muß man das lesen, verkommt das Ich. Doch nicht jedes Du taugt zum nötigen Stil, am allerwenigsten das Du der alten Dichter. Was diese mit den herkömmlichen poetischen Vokabeln, von Herz bis Hand, anrichten können, steht im ersten Gedicht. „Die Hand die in die Brust dir greift das Herz rauszureißen fällt ab.“ Greift die Hand des Du in die Brust, wie man früher in die Saiten griff, fällt die Hand ab; bückt sich das Du, um sie aufzuheben, fällt auch noch sein Herz heraus. Davon sind beide betroffen, denn schließlich verlieren sie auch den Kopf: „Da ist euch im Sturz schon der Kopf von den Schultern geglitten.“ Ihr zerfallener Körper gilt dem sarkastisch kommentierenden Ich als geeignetes Material für die Leier des Orpheus.
Wenn zufällig Orpheus vorbeikäm
würd ich ihm was vorsingen der fleisch-
fressenden Leier ihren Anteil rüber-
schieben am Nachgefallenen.
Andere, modernere Traditionen sind nicht besser. Nicht nur die romantischen, auch die häßlichen Wörter richten sich aggressiv gegen das Du, seinen Schatz, die Liebste, auf die das Ich zählt: „Bist du der Stein Schatz / der da im Fleisch das uns frißt verblutet.“ Wie bei Celan ist „Stein“ das Wort für seine Poesie. Auf dem Spiel steht die Besonderheit des Ich, das zwar handelt, dem die Handlungen indes vom Du zukommen. In „Alkäisch die vierte“ heißt es mit Übermut im Spiel: „dem Wörterbrei / entsteigt tschau Sämi“. Das Du, vom Ich substantiell abhängig, soll konkret und klug sein.
Der Glaube an die Sprache scheint verloren, wenn das Du die Wörter entfernen, die „Worthaut“ abschaben soll. Ohne Standpunkt von außen ist es nicht leicht, dies im Ablauf eines Gedichts zu bewerkstelligen. Die Syntax, in der die Wörter ihren Sinn erhalten, muß ästhetisch erzeugt werden. Allemann läßt sein Du zu manieristischen Verfahren greifen: zu Vokalfolgen, Buchstabenabwandlungen und Satzverwerfungen, um die Sprache in Material zu verwandeln. Die 36 alkäischen, asklepiadeischen und sapphischen Oden des Gedichtbands (Allemann nimmt noch Elegien hinzu) geben dafür das strenge zerteilende metrische Raster. In ihnen ist vieles möglich. Ziel der Gedichte ist es, die neuen Wortfolgen zu interpretieren; das wäre der Sinn, den das Ich vom Du erwartet. Der Titel des Buchs, „Holder die Polder“, meint daher eine Kunst, die sich formal über die Dichtung wie auch über das alltägliche Sprechen hinwegsetzen soll. Sie will weder einen Hölderlin noch ein handfestes „Poltern“, sondern eine Welt, in der, beispielsweise, das weiche „d“ sinnvoll den Ton angibt.
AIlemann möchte die formal freigesetzte Mehrdeutigkeit wieder einfangen. Da er sich der Sprache aussetzt, ist er an ihre Möglichkeiten gebunden. Oft geschieht wenig. Wenn die ineinander geschobenen Satzteile sich ohne weiteres auch konventionell arrangieren lassen, bleibt es bei der poetologischen Behauptung. Etwa in dem Satz: „so mir / daß Flaum daß Rinde / träumts ineinander“ aus dem Gedicht „Sapphisch die erste“. Die Vereinigung von Ich und Du, von Baum und Mädchenbeinen, von „Rinde“ und „Flaum“ würde erhalten bleiben, auch wenn man es einfacher ausdrückte, etwa auf diese Weise: „So träumts mir, daß Flaum daß Rinde ineinander“. Banal wirkt das Beispiel für das Abschaben der Worthaut: „Das Wort Wunde / schluckt das Wort Wunder.“ Oft genug schlägt indes der Autor Kapital aus dem angehäuften Sinnmaterial. Zu den schönsten Gedichten zählt die Ode „Asklepiadeisch die fünfte“. Das Du ringt mit der Schlange des Paradieses.
Es ist ein sprachlicher Kampf. Die Frage, wer wem in die Ferse beißt, zielt auf die „Verse“, die die harte Fügung im Metrum zum Chiasmus nutzen: „Dich die Ferse zertritt oder die Ferse du“. Die leicht voneinander abweichenden Buchstaben gewinnen Sinn in einem überlegenen Lallen: „hinzulallen ein Gegengift“. Das Du lallt, weil es sich gegen das traditionelle Singen wendet und die Lautähnlichkeit von „g“ und „k“ nutzt. „Weggesungen und weitersinkt“ heißt es von der Schlange, die also gerade darum sinkt, weil sie weggesungen wird. In solchen Momenten hat der Dichter seine eigene Welt geschaffen. Er spricht vom Dichten und gewinnt aus der zersetzten Sprache allein einen Sinn.
Christoph König, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.2001
Schupp mir die Worthaut ab
Urs Allemann
ALKÄLISCH DIE SECHSTE
Du regnetest. Ich kroch in ein altes Buch.
Der Scheibenwischer wehte davon. Die Welt
war immer der schwarze Quader
um mich aus Stimmen gepresst der Backstein.
Ich las ja nicht. Ich wurde gelesen. Du
rannst schön an mir herunter. Wir starben nicht.
Als ich mich in den Seiten löste
gab es dich wieder. Erinnerungen.
Mein Opa kannte Wörter wie Synthesis.
Es ist nicht wahr. Er drückte den Kinderkopf
mit Fingern die mit dem Wort Finger
ich zu bezeichnen von ihm gelernt hab.
Du regnest nicht mehr. Bö, ich verstecke mich.
Schlaf du mich, Boa. Schupp mir die Worthaut ab.
Es ist nichts drunter. Das Wort Wunde
schluckt das Wort Wunder. Da. Vogelscheisse.
Im täglichen journalistischen Umgang mit der Sprache des Alltags, so hat Urs Allemann einmal gesagt, befalle ihn ein „ganz starkes Derealisierungsgefühl“. Ein sprachskeptisches Unbehagen an den Stereotypen der geläufigen Rede wirkt denn auch als Antriebsenergie in den Oden und Elegien fort, die Allemann nach langer Schreibpause in diesem Frühjahr veröffentlichte. Nach langer Suche hatte er endlich eine probate Form gefunden, die dem gefährlichen Eigensog der Sprache Widerstand bot. Er fand sie in der strengsten antiken Gedichtform überhaupt: der Ode mit ihren metrisch genau festgelegten Zahl von betonten und unbetonten Silben in den jeweils vierzeiligen Strophen.
Bis in die neunziger Jahre hinein galt ja die Anverwandlung antiker Formen als Inbegriff lyrischer Rückständigkeit. Nur wenige hatten die Worte des Dichters Ludwig Greve im Ohr, der bereits 1979 plausibel dargelegt hatte, dass das lyrische Sprechen in einer streng geregelten Form zur Präzision zwingt. „Andere“, so Greve damals, „suchen Halt in einer Gruppe oder Überzeugung, ich fand ihn in der alten, immer neu zu gewinnenden Form der Ode.“ Zu diesem Zeitpunkt schienen die Möglichkeiten der Ode längst erschöpft. Hölderlin hatte die alkäische und asklepiadeische Odenstrophe zur Vollendung geführt, im 20. Jahrhundert lieferten Dichter wie Rudolf Alexander Schröder und Josef Weinheber fast nur noch epigonale Reprisen dieser Gedichtform.
Urs Allemann erprobt nun eine motivische Erweiterung und formale Radikalisierung der antiken Form, indem er Bilder der Gewalt und Metaphern des Zerreißens und Schneidens in die Ode einführt, die dort bislang kaum Platz gefunden hatten. Hier konstituiert sich nicht eine Sprache der „ständigen Entzückung“, wie sie die traditionelle Lyriktheorie für die Ode vorsieht, sondern eine fragmentarische Sprache der Verstörung und der Glossolalie, die schmerzhafte Einschnitte an Körpern und am Sprachmaterial selbst thematisiert. Die Abfolge der Silben wird konsequent eingehalten, aber zugleich wird die Ode von innen her durch eine brüchige und assoziativ verschlungene Sprachbewegung aufgesprengt. Allemanns Oden sind von prekärer semantischer Instabilität, bewegen sich über Paradoxien, Unschärfen und Sinn-Verweigerungen vorwärts. Eine Identität der Subjekte kann es hier ebenso wenig geben wie eine sprachliche „Synthesis“.
Schon die erste Zeile der vorliegenden alkäischen Ode versucht sich in einer grotesk erscheinenden Gegenüberstellung von Geist und Natur: Ein Ich, das sich in ein altes Buch verkriecht, trifft auf ein Du, das den Regen repräsentiert. Dieses Ich bleibt zunächst genau so unbestimmt wie die Welt aus Wörtern, in die es hineinwächst. Es scheint eingeschlossen zu sein in eine monolithische Welt vor der Ausdifferenzierung der Dinge: in den schwarzen Quader, den Backstein, in den gewalttätigen Griff des Großvaters. Zugleich steht dieses Ich ganz im Zeichen von Sprache und Schrift. Das „alte Buch“ wird zum Zufluchtsort, das Ich selbst zum Gegenstand von Lektüre. Aber nie stellt sich die Einheit von Wort und Ding her, die von der Tradition gestiftete und von Kant formulierte Erfahrung der „Synthesis“ hat keine Geltung mehr. Im mühevollen Prozess des Zur-Sprache-Kommens tastet sich das Ich über Klangähnlichkeiten vorwärts: über die Homophonie von „Opa“ und „Boa“ und den feinen Unterschied von „Wunde“ und „Wunder“. Überall, wo sich hier Sprache einnistet, lauert auch Gewalt: „Schupp mir die Worthaut ab.“ Zurück bleibt der versehrte Körper, hautlos und sprachlos.
Michael Braun, Der Freitag, 8.3.2002
Kämpfen um den Sound der Ode
− Holder die Polder – Neue Lyrik von Urs Allemann. −
Noch heute folgt der Erwähnung des Namens „Urs Allemann“ oft ein betreten-irritiertes „Ist das nicht der mit dem …?“ Bleibt, bestätigend den Namen jenes Textes zu murmeln, mit dem er vor Jahren einen Skandal ausgelöst hat, dessen Folgen er heute noch spürt. Kaum rezipiert wurde die Lyrik des Wenigveröffentlichers.
„lies keine oden, mein sohn, lies die fahrpläne: / sie sind genauer“, heißt es bei Hans Magnus Enzensberger. Urs Allemann, tut sich nicht so leicht mit dem Empfehlen oder Abraten von Lektüre, auch nicht mit der Enzensbergerschen Gegenüberstellung. In puncto Genauigkeit können seine Oden mit Fahrplänen locker mithalten. Allemann spürt der antiken Metrik nach, schreibt exakte sapphische, asklepiadeische, alkäische Oden, schöpft aus der Tradition von Hölderlin und Klopstock, ohne dass die strenge Metrik zum Gerüst verkommt. Wichtiger als das handwerkliche Nachbauen ist für Allemann „der Sound der Ode“. In diesen hat er sich ausgiebig eingelesen, eingehorcht und dann versucht, ihn ins 21. Jahrhundert zu transportieren. „Eine Art Test“ sei es für ihn, „das Potenzial der Tradition auszuloten“, zu überprüfen, ob alte Formen neuen Zeiten und veränderten Existenzweisen standhalten. Diesen Test hat die Ode in Allemannscher Ausprägung bestanden.
Vielleicht liegt das daran, dass er beim Unterfangen, die alte Form „zu revitalisieren“, nicht vorgeht wie der zaghafte Passant, der seinerzeit letzte Reihe im Erste-Hilfe-Kurs gesessen hat und sich über Mund-zu-Mund-Beatmung nicht hinauswagt. Allemann wendet das radikale Repertoire des Wiederbelebungskönners an, und dort braucht es manchmal bekanntlich auch die scheinbar unsanfte Herzmassage. Was auch zum Gehalt dieser Lyrik passt, denn, um beim Fahrplan zu bleiben:
Allemanns Gedichte sind so genau wie der minutiöseste, allerdings einer, dem neben Ankunfts- und Abfahrtszeiten verpatzte Getränke im Speisewagen, blinde Passagiere, Sex am verstopften WC und Zugunglücke bereits eingeschrieben sind. „Unheimlich viel“ (und „unheimlich im wahrsten Sinn des Wortes“), das sich dem rationalen Zugriff verweigert, ist Allemanns Gedichten eigen, vieles, das beim Lesen – laut Auskunft des Autors auch beim Schreiben – verstört. Gewaltige Intensität spricht aus dieser Lyrik, und auch diese bewahrt sie davor, bloße epigonale Formspielerei zu sein. Reines Sprachspiel interessiert Allemann ohnehin nicht, das könne heute die Werbung, die er „Reklame“ nennt, ebenso gut.
Mit der großen Intensität verbunden ist eine spezielle Art des Ich. Während in seinem letzten Gedichtband „Fuzzhase“, 1988 erschienen und Allemanns erste selbstständige Veröffentlichung, „ein Macher-Ich“ am Werk gewesen sei, eines, das permanent verkünde „Ich weiß Bescheid“, rauscht in diesen neuen Gedichten ein bescheideneres und zugleich wilderes Ich. Das hat auch damit zu tun, dass für Allemann diesmal „das gesamte Gedicht Ich“ sein solle, ein Ich in allen Widersprüchen. Ein zerrissenes, fragmentarisiertes Ich, das sich krass abhebe von den gängigen Ich-Sätzen, in denen vermeintlich vom Ich gesprochen werde, tatsächlich jedoch vorgefertigte Wort-, Denk- und Gefühlshülsen reproduziert würden.
Es ist eine gleichsam raubtierhafte Sprache, die in diesen Gedichten sich anzuschleichen scheint und Witterung aufnimmt. „unübersetzbar wes Körperrauschen“, endet „Alkäisch die fünfte“, ein Gedicht, in dem sich poetologische Auskunft mischt mit aufbegehrend verkehrten Welten, die durch verschiedene Partizipformen entstehen. Aber auch ein sehr persönliches Ich geht um: Befragt nach der Funktion der Dialekt-Sprenkel in seinen neuen Gedichten lacht Allemann, der im Gespräch urbane Beschwingtheit vermittelt. Nein, auf gar keinen Fall hätte er sich damit „als Schweizer Autor outen“ wollen. Vielmehr handle es sich um ein autobiografisches Moment, also nicht um etwas Allemannisches, sondern etwas „Allemannsches“: Als Kind der schwyzerdütschen Umgebung entrissen und versetzt in das Hochdeutsch Deutschlands, ist diese Umstellung schmerzhaft hängen geblieben. Und so erscheinen dem heute wieder in der Schweiz lebenden Schriftsteller Einsprengsel wie „hörschöppis“ oder „gopvrteckl“ als früh- oder gar vorsprachliche auftauchende Segmente von Erinnertem. Außer durch das ungewohnte Metrum und die inhaltliche Dimension faszinieren Allemanns Gedichte durch intertextuelle Bezüge. Einmal verschränkt er eine frühe Ode Hölderlins mit der Elegie „Winterfreuden“ von Klopstock und transportiert das Vokabular und die beiden Ahnen – sie treten namentlich auf, Hölderlin im historischen Kosenamen „Holder“ – ins Metrum des Hinkjambus. Eine umso überzeugendere Wende, als der Hinkjambus sich inhaltlich trifft mit dem Bild des Alters, des Greises, der im ersten Vers genau dort, wo der Hinkjambus akut wird, „ausrutscht“.
Der Titel „Holder die Polder“ sei „eine sanfte, zärtliche Version“ des Holterdiepolter – auf die Rilke-Wendung „Zärtlichkeiten, ungenau“ beruft sich Allemann auch, um sich an seine spezielle Vorstellung von Genauigkeit heranzutasten. So tritt der Titel einmal in lakonischem Understatement an – und stellt zugleich einen Adonäus dar, den auffälligsten Vers der sapphischen Strophe.
Das lakonische Understatement, „der Horizont der Ironie“ wiederum steht im Widerstreit mit seltsamem Pathos, das Heinz Schafroth etwas irreführend mit dem Begriff des Erhabenen zu fassen gesucht hat. Allemann erläutert, auch für ihn sei diese Begrifflichkeit zunächst fremd und nicht verwendbar. Doch handle es sich nicht um ein verblasen klassizistisches „Erhabenes“, sondern um jenes nach Kant, bei dem das Erhabene dem Schönen entgegengesetzt sei. Von Erschütterung sei die Rede, von Leidenschaft auch im Abgründigen. In diesem Verständnis passt der Begriff dann doch. Allemanns Oden sprechen nicht das Wahre, Gute und Schöne, sondern das Wahre, Böse, Hässliche an und aus.
Und dabei sind diese Gedichte oft – lustig. Ausgerechnet die „Traurige(n) Trochäenbrösl“ etwa: „das Gedicht sei Scheisse schade“, heißt es da, und „zwei Nasen“ reimen sich auf ebenso viele Hasen, Vasen, Phasen und Asen, obwohl Urs Allemann den Reim für die Gegenwart als untauglich befunden hat und in seinem aktuellen Sonett-Projekt, wie er schildert, vom obsolet gewordenen Reim auf die Assonanz ausweicht. Die Verwendung solcher „untauglicher“ Mittel entspricht der Technik, mit der Allemann vor über zehn Jahren in „Zwei schlechte Gedichte“ den Tod und die Geige aufeinander prallen ließ – mit komischer Klugheit gewinnen diese Gedichte gerade durch ihre Offenlegung des Versagens und umgehen dieses dabei auf ziemlich unwiderstehliche Weise.
Der Band ist strukturiert durch Neunereinheiten, wobei es Allemann wichtig ist, nicht das Zyklische herauszustreichen, sondern das Vermögen, dass jedes einzelne Gedicht für sich stehen kann und können muss. Erst im Nachhinein, betont er, erfolge die Anordnung, das Arrangement, das nötig sei, aber nicht überbewertet werden dürfe. „Eine äußerliche Geste“ sei dies, „etwas wie Geschenkpapier“. Und wer wird dieses Geschenk dann auswickeln, wer soll diese Oden lesen? Der Enzensbergersche Sohn nicht, auch nicht der von Urs Allemann, der sich in befürworteter Auflehnung seine eigene Lektüren sucht. Fest steht: Wer als Kind gern mit rohem Fleisch gespielt hat und sich dann irgendwann einem Studium der Geisteswissenschaften zugewandt hat, wird diese Gedichte ins Herz schließen. So manche/r andere auch. – Wenn sie oder er auf den Band stößt: Einige Buchhandlungen, Buchhändlerinnen vor allem, weigern sich, erzählt Allemann, sein neues Buch auf Lager zu bestellen. Ausdrücklich wegen „Babyficker“.
Petra Nachbaur, Der Standard, 10.11.2001
Halb Fleisch, halb Wort
− Gedichte von Urs Allemann. −
In diesen Gedichten sitzt der Stachel der Diskrepanz. Körperlichkeit, Materialität rasselt in Ketten sublimer alter Formen, in alkäischen, asklepiadeischen, sapphischen Oden, in Elegie und Sonett. Das grandiose Missverhältnis stört die Leserseele auf, beschert ihr eine brisante lyrische Modernität. Dass ein Klassizist des 19. Jahrhunderts, der Zürcher Heinrich Leuthold etwa, seine Verse ins Korsett von Odenstrophen steckt, verwundert nicht. Hier ist die strenge Form Bekenntnis zur Tradition. Dass ein Hymniker wie Friedrich Hölderlin seine Gesänge auf Odenhöhe anstimmt, ja diese noch gewaltig zu steigern weiss, das verwundert im Nachhinein auch nicht mehr. Dafür bleibt Bewunderung. Samt seinen revolutionären Idealen überantwortet sich der Dichter einem Strom von Kultur, der vom alten griechischen Osten kommt. Mit dem Titel „Holder die Polder“ nimmt Allemann salopp nachbarlich auf ihn Bezug: „Der Fritz. Der Holder. Der Hölderle“, so heisst er ja auch in Peter Härtlings „Hölderlin“-Roman. Eine Reverenz vor der Antike ist bei Allemann aber wohl nicht gemeint. Warum also die schwierige Übung? Zum einen wirken die komplizierten Versarrangements weniger einengend, das heisst auch weniger museal, als uns unser angeschlagenes Bildungswissen glauben macht. Zum andern aber kann die geadelte Form – gerade wenn sie die Diskrepanz herausstellt – mit besonderer Deutlichkeit auf die Misere der menschlichen Existenz verweisen, auf das Los von Zerfall und Zeitlichkeit. Denn davon ist bei Allemann die Rede – bitter, witzig, böse klagend ab und zu. Mit ausschweifender Artistik werden Trümmer barocker Tiraden in die Welt geschleudert, als müssten die ausgeklügelten Rhythmen dem stinkenden Chaos ein würdiges Zeit-Mass entgegenhalten.
Kohärent ist bei Allemann nur das Metrum, an das er sich gewissenhaft hält – handle es sich um Alexandriner oder Elegien, um die in ihrer Aura sehr verschiedenen Odenstrophen. Gegen diese Wohlgefügtheit arbeiten nun aber die zerfetzte Aussage, das lädierte Motiv, das halbierte Wort. Der Inhalt arbeitet dagegen, erinnert an düstere Übermalungen klassischer Gemälde. Da heult vor dem langen Aus und Amen sexuelle Gier auf. Dort zählt jemand Sterbeäpfel am Baum, ist einer, „bist du“, vom eigenen Herzschlag erschlagen. „Des Tods ohrlose Autophonie“ aber droht alles zu verschlingen und die Sprache wegzunehmen, die nur zwischen Geburt und Ende zur Verfügung stehe. Sein ist allein in der Sprache. Nicht Vorstellbares ist wenigstens „sagbar“. Sprache weiss mehr als wir. Mehrfach wird das Schreiben als Thema gestreift. Erst in der Schrift, „in den Seiten“ kann es „dich wiedergeben“. Dieses „du“, die appellative Instanz wird auf Schritt und Tritt angerufen – als Figur zwischen dem Leser, dem lyrischen Ich und der Geliebten, eine Hilfskonstruktion, „halb Wort halb Fleisch“.
Der Spiegel spielt gewissermassen die Rolle eines Leitmotivs. Bald ist er Messer, Scherbe, Splitter, bald Bildschirm oder Bild, in das man „vornüber weg“ kippt. „Das Geräusch des zerbrechenden Spiegels“, Auslöschung, Selbstaufhebung münden dann wieder in „des Tods ohrlose Autophonie“. Solche Überlegungen mögen den barocken Grundton andeuten, auf den die komplexen Gebilde gestimmt sind, schon im „Vorspiel / Für die Leier“. Es ist als Bildgedicht gedruckt, wie es zur Zeit des Barock üblich war. Vor aller fasslichen Aussage aber geht es in diesen Gedichten um die Gegenveranstaltung zur „ohrlosen Autophonie“, es geht ums Tönen, ums Antönen und Anspielen noch und noch.
Die aufsässige Materialität, die durch die schönen Rhythmen dringt, findet ihre Vertreter oft in einem groben lyrischen Personal wie in „Alkäisch die Dreizehnte“: „bis Sterbelieder gröhlend dr Güggl bis / zum blutte Chropf im Mist / du bist giftiges Geschnupper …“ Dialekteinschüsse als scheinbar geformtes Wortmaterial tragen das Ihre bei zum Effekt: „Halb Wort halb Fleisch und luegt umenand cliclac! / . . . / zu bersten cliclac! wotschintschnurre …“ Laute wecken semantische Assoziationen gewiss, meistens aber ist das Lautgeben an sich gemeint. Anklänge, Assonanzen, Echofolgen, Tonvarianten sind der Zweck der Übung. So etwa klingt „Hinkfüssig“, das Gedicht, das „Holder“ anspricht: „… im Beindorf leer den Todtenstille du friss dein / Gefriergeflügel Chickenshit wenn das auftaut / da die Mänaden du Monade träumst Zahlen / Miss Mermaid! lang Errettung, Pa, nix Mund Nixmäär.“
Laut lesen steigert übrigens den Reiz dieser Verse. Assonanzen erkennt man dann umso deutlicher als Erweiterung der lyrischen Möglichkeiten. Diese Gedichte sind ein akustisches Ereignis. Sinnlichkeit und Artistik, Auflösung und Formung tragen einen fruchtbaren Widerstreit aus. „Geborenes lesbar“ machen heisst für diesen Autor dessen Sterblichkeit zeichnen. Es scheint aber, als müssten die ausgeklügelten Rhythmen dem stinkenden Chaos ein würdiges Zeit-Mass entgegenhalten.
Beatrice von Matt, Neue Zürcher Zeitung, 27.12.2001
Ode an die Unvollkommenheit
− Urs Allemanns Lyrikband Holder die Polder gibt Rätsel auf. −
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Lyrik muss nicht schön sein, doch sollte sie etwas zu sagen haben. Die Zeiten, in denen Gedichte noch einen Hauch von geistiger Schönheit in sich trugen, und in ihren Zeilen Melancholie, Sinnlichkeit und schöpferische Vollkommenheit zu finden sind, scheinen vorbei; heute ist Lyrik auch mal derb: in ihrer Sprache, ihren Bildern, ihren Aussagen.
Urs Allemanns Gedichtband „Holder die Polder“ ist ein Beispiel für diese andere Art von Lyrik. Er enthält eine Sammlung von Oden, Elegien und weiteren Gedichtformen. Nüchterne Namen tragen sie: „Alkäisch die erste“ bis „Alkäisch die achtzehnte“, „Asklepiadeisch die erste“ bis „Asklepiadeisch die neunte“, und das gleiche Schema findet sich bei „Sapphisch“ und „Elegisch“ wieder. Im Anhang gibt es schließlich noch eine Vielzahl weiterer Gedichte wie „Hinkfüssig“, „Elfsilbig“ oder einfach nur „Englisch“.
Allemanns Oden und Elegien ranken sich nicht um Gegenständliches, das so einfach im Titel zu benennen wäre. Es ist vielmehr seine Ausdruckskraft, die sich in Bildern und Sprache widerspiegelt: grausam, depressiv und bestimmt von einer durch und durch destruktiven Atmosphäre. Es sind Persiflagen, die jegliche Form des Erhabenen mit nur wenigen Worten zerschlagen, als wären Schönheit, Liebe und das Leben selbst filigrane Bauwerke, die den Worten Allemanns nicht standhalten können.
Immer wieder spricht der Schweizer über den Tod in den verschiedensten Formen, lässt fast in jedem Gedicht Bilder von einzelnen Körperteilen oder Organen einfließen: Menschliches Fleisch, Blut, Augen, Ohren, Lippen, oder eine Hand, „die in die Brust die greift das Herz rauszureissen“. Er spielt mit diesen Bildern, als wären sie Bausteine, die auf beliebige Art und Weise zusammengesetzt werden können, und lässt sie über den gesamten Gedichtband verteilt in immer anderen Variationen auftreten.
Die Bilder, die Allemann mit seiner Lyrik hervorruft, sind alles andere als angenehm. Sie wirken provozierend. „Ob vom eignen Herzschlag erschlagen du zu / singen wes und zuckts übern Boden ob du / hinschlugst es vor Augen herauf noch schwarz und / sie es dir abschlug“ schreibt er in „Sapphisch die siebte“. Bisweilen ist seine Lyrik von einer Thematik geprägt, die jenseits des Ästhetischen liegt. Und so wirken Allemanns Gedichte einfach anstrengend – nicht allein wegen des Bizarren, sondern vor allem, weil sie schwer fassbar sind. Sie stehen da wie ein Rätsel, das man unbedingt lösen möchte. Der Leser entwickelt Ahnungen – so lange, bis sich endlich ein Puzzleteil an das andere fügt.
Die Aussage, die sich dabei ergibt, bleibt stets die gleiche: Es gibt keine Vollkommenheit, in Allemanns Welt existiert lediglich der Wunsch nach ihr. Aber trotz allem ist das, was „Holder die Polder“ tatsächlich ausmacht, die Sprache. Sie klingt gut, obwohl sie nur unschöne Bilder hervorruft. Das ist die Stärke Allemanns. Seine Gedichte zu lesen ist deshalb so, als wenn bei einem Lied bloß die Melodie gefällt.
Katharina Iskandar, literaturkritik.de, Nr. 8 , August 2001
Lyrik will Erfahrungen und Zustände artikulieren,
die an den Rändern des Sagbaren liegen. Was an ihr berührt, ist weniger die Mitteilung, die „Aussage“, sofern so etwas überhaupt sicher festgelegt werden kann. Lyrik berührt vielmehr durch ihre Stimmung, ihre Farbe, ihre Anklänge, ihre Bewegung, ja, durch ihre Pausen und ihr Schweigen. Wer über gelungene Gedichte zu sprechen versucht, verwendet häufig, beinahe unvermeidlich das Vokabular aus anderen künstlerischen Feldern, das der Malerei oder, noch näher liegend, das der Musik. Mit diesen Bemerkungen ist schon einiges über den neuen Lyrikband des Schweizers Urs Allemann gesagt. Urs Allemann, Jahrgang 1948, veröffentlichte jetzt ein Buch mit dem an Hölderlin erinnernden, aber auch schön und sacht schwingenden Titel „Holder die Polder“, und er hat sich darin einer selten gewordenen Lyrikform zugewandt, der Odendichtung.
Ode, griechisch Gesang – das ist eine strophisch gegliederte, meist reimlose und dabei komplex organisierte Form. Neben den antiken Vorbildern wie Pindar und Horaz kennt man im deutschsprachigen Raum eigentlich heute allenfalls noch die Oden von Hölderlin und Klopstock.
Inhaltlich und formal war die Ode geprägt von Gefühlstiefe, Würde und Feierlichkeit – da könnte man von hier und heute aus fragen, ob in dieser Gattung denn jetzige Erfahrungen noch überzeugend dargestellt werden können. Urs Allemann belebt die Ode auf eigenwillige, schöpferische Weise, er haucht ihr buchstäblich und wortwörtlich Atem ein. Es kann hier wie gesagt nicht darum gehen, „Inhalte“ festzumachen, zumal es dem Autor umgekehrt gerade darum geht, Phänomene freizusetzen, ins Schwingen zu bringen. Allemann inszeniert ein Flimmern, ein Wortgestöber, das gewohnte Sinnzusammenhänge, Sicherheiten also, auflöst. In vielen Gedichten ist die Stellung von Subjekt und Objekt nicht mehr gewiss, Aktiv und Passiv vertauschen sich, es finden sich sinnliche Neologismen wie das Wort „phantatschn“, das eine glückliche Verbindung von phantasieren und berühren, betatschen, nahelegt, oder es tauchen wie nebenbei Bündel von Alliterationen auf, etwa „Weit weg weint was“. Dabei unterwirft Allemann sich allerdings den strengen Gesetzen des Metrums, und vielleicht ist es eben diese Gegensätzlichkeit – geordnete Form plus Sprachspiel, Sprachwitz, Sprachexperiment, die seinen Oden und Elegien ihre Gespanntheit gibt. Um zumindest einen Eindruck seiner Arbeit zu vermitteln, sei hier eine Strophe zitiert:
Es zu spalten und schrie sich ineinander bis
dirs vom Rumpf oder klopf einer was mir ins Wort
fiel es anders gedacht ob
ich den Keller durch Wandern Los
Das ist eine asklepiadeische Ode, ein metrisches Schema, das mit einer „schweren“ Betonung beginnt und das im Übrigen durch scharfe Zäsuren auffällt – dort, wo zwei betonte Silben aufeinandertreffen. Man kann da ein Stocken vernehmen, ein Zögern, das selbst noch einmal verstärkt, was die einzelnen Worte assoziativ anklingen lassen: Ein Zustand von Beklemmung stellt sich her, von Gewalt zwischen „dir“ und „mir“, es gilt etwas zu spalten oder im Gegenteil ineinander zu „schreien“ – in ein Ganzes? Und was fällt den vom Rumpf, wenn nicht der Kopf, und wo wird geklopft, werden Klopfzeichen ausgesandt, wer fühlt sich wie in einem „Keller“ und versucht einen Ausweg zu denken, bis ins öffnende „los“, was lossein? Noch einmal: „Es zu spalten und schrie sich ineinander bis / dirs vom Rumpf oder klopf einer was mir ins Wort / fiel es anders gedacht ob / ich den Keller durch Wandern los.“ Die fragmentarische und dabei doch oszillierende Rede artikuliert eine Erfahrung mit der Sprache und unter Subjekten; sie weiß von deren Gefährdung, und sie kann anderes denken, ihre Bewegung, ihr Wandern. Das ist ein Deutungsansatz eines Gedichts, aber erst die mehrfache Lektüre von Allemanns Oden macht deren Vielschichtigkeit und Reichtum spürbar.
Sabine Peters, Südwest Rundfunk 2, 21.6.2001
Wolfram Groddeck-Essay zu Allemanns Oden
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + ÖM
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Urs Allemann zu Gast bei Züri Littéraire im Kaufleuten.


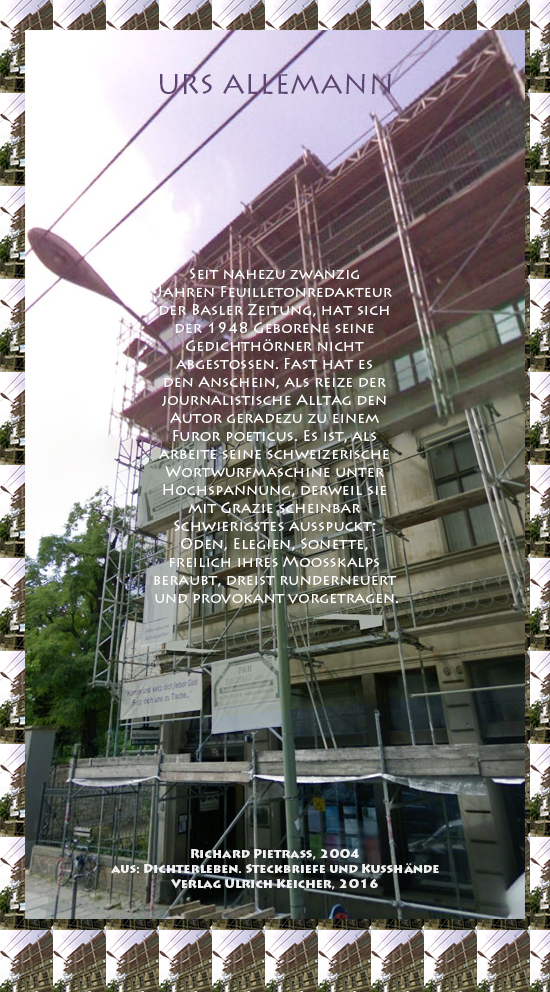












Schreibe einen Kommentar