Volker Sielaff: Glossar des Prinzen
WAS GETRENNT WAR
Was ist die Tag-Summe?
Unterm Strich: Wörter, die subtilsten.
Körper überhaupt. Ein Wort. Geist?
Das Geistige trete zurück,
werde vergessen, schaffe Platz:
dem Wippen, den Wimpern
dem Nicht-Absoluten, der Absolution?
Trennung, Träume: passé —
schreibe ich auf am Abend,
körpermüd, seelen-allein.
Der Bogen ist weit gespannt:
eine große formale und thematische Vielfalt trägt die Gedichte des neuen Bandes von Volker Sielaff. Landschaften und Orte, philosophische Zahlengedichte, Liebesgedichte und surrealistische Imaginationen – ein großer Raum poetischer Möglichkeiten wird hier durchschritten. Phantasiefiguren und Realien treffen im Glossar des Prinzen aufeinander. Sielaff versichert sich zwar der Tradition, geht jedoch auch eigensinnig ins Offene, stets der eigenen Tonspur folgend. Seine Leser werden den Sielaff-Ton durchhören und viel Neues entdecken. 100% verwunschen und 100% genau sind diese Gedichte, und auch das Alltägliche kann bei diesem Dichter surreal sein.
Luxbooks, Klappentext, 2015
List und Freude
Es ist schon eine Weile her, dass ein bedeutender deutscher Lyriker Prinzen-Lieder gesungen hat. 1887 fügte Friedrich Nietzsche seiner Schrift Die fröhliche Wissenschaft 14 grimmig-ironische „Lieder des Prinzen Vogelfrei“ hinzu, exakt so viele, wie nun auch Volker Sielaff im ersten Kapitel seines neuen Gedichtbands Glossar des Prinzen versammelt hat. Wer diesen Dichter bislang als zarten Ding-Mystiker kannte, für den birgt das Glossar des Prinzen mit seinen oft sehr klassisch und romantisch anmutenden Tonlagen einige Überraschungen. In fünf Kapiteln demonstriert Sielaff seine Lust an poetischer Verwandlung und an der Neuerfindung seiner selbst. Im Prinzen-Kapitel scheint er sich „voll Überschwang“, wie es im „siebten Lied“ heißt, von einer Formenverliebtheit mitreißen zu lassen, spielt er hier doch mit streng gereimten Drei- und Vierzeilern, Pentametern und Liedstrophen.
Es sind Strophen von einer eminenten Musikalität, die nicht nur an Nietzsches metaphysische Heiterkeit anknüpfen, sondern auch an die Liebesdichtung des persischen Mystikers Hafis, an den erotischen Realisten Brecht, an Goethes Diwan-Dichtung. Es wäre indes ein großes Missverständnis, diese „Lieder des Prinzen“ als Remake einer klassizistischen Ambition zu lesen, gar als Bekenntnis zu einem bildungstouristischen Traditionalismus. Wenn Sielaff seine Prinzen-Lieder anstimmt, ist in einer zweiten Tonspur immer ein selbstironisches Rütteln an den festen Versfüßen mitzuhören:
Du sollst von Zeit zu Zeit alles verbrennen
Was dir nicht zugehört und dir äußerlich ist.
Das Falsche nicht mit dir tragen nicht leben mit List.
Hei wie es knistert das Feuer unter den Kiefernantennen!
Sielaff benutzt den Endreim zwar als ein Kunstmittel, gleichzeitig markiert er jedoch den literaturhistorischen Abstand, der seine Gedichte von einer reinen Wohlklangs-Glückseligkeit trennt. Auffällig ist auch der schelmische Umgang mit den großen Geistern der Dichtung und Philosophie. Ob nun Goethe und Hafis oder die Philosophen Kant, Lacan oder Deleuze aufgerufen werden – sie schrumpfen rasch auf Normalmaß, und erst hinter ihrem Rücken vollziehen sich die ästhetischen Offenbarungen.
Im Gedicht „Metaphysik auf Eis“ lagert der Weltgeist im Schankraum einer Kneipe. In „Die Differenz“ zerfällt die eitle Selbstinszenierung des Meisterdenkers Lacan vor der zarten Schönheit der Kreidewolken auf einer Schultafel. Wenn Sielaff den Leser dann in „die Kunstkammer des Prinzen“ führt, gelingen ihm Gemäldegedichte von einer Wahrnehmungsgenauigkeit, wie man sie in der Gegenwartslyrik nur selten findet. Die Betrachtung eines Lucas-Cranach-Bilds wird zu einem mystischen Augenblick – zur Begegnung mit einem „hereinschwebenden Engel“. In „Kleine Seenot, nach Paul Klee“ vereinigt Sielaff schließlich alle Tugenden seiner neuen Art des Dichtens: sinnliche Anschaulichkeit und metaphysisches Geheimnis. Klees kleine Zeichnung wird zum poetischen Bild einer unerfüllten Liebe:
Man sieht sie noch in der Ferne,
im rauen Wechsel der Gezeiten:
einer auf des anderen Scheitel
ihre kleine Seenot – reiten.
Michael Braun, Der Tagesspiegel, 21.6.2015
Volker Sielaff liest und spricht mit dem Kritiker Michael Braun auf der Leipziger Buchmesse 2016.
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Stefan Schmitzer: „Prinz Talal auf seinem Pfau“
fixpoetry.com, 15.4.2015
Jan Kuhlbrodt: Nach der Zeit
signaturen-magazin.de
Gespräch mit Volker Sielaff: Das Gedicht ist eine Zumutung, die sich gegen alles Uneigentliche richte
signaturen-magazin.de
Michael Braun: Lyrik-Empfehlung 2016
lyrik-empfehlungen.de
Laudatio auf Volker Sielaff
– anlässlich der Verleihung der Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung von 1859 am 8. Mai 2015 in Marbach/N. –
Ich hatte mir zu lang zu wenig noch getraut
Doch so zu schweigen bringt ein doppelt Eisenherz
Ich war gestolpert über blinden Rauch Kommerz
Ich hatte meine Sandburg nur auf Sand gebaut.
„Ich hatte mir zu lang zu wenig noch getraut“: in den Gedichten von Volker Sielaff lesend wird uns klar, dass sich seine Gedichte in uns festgesetzt haben. Die Gedichte haben mehr oder weniger nachweislich Formen des Sprechens, des Wahrnehmens, des Verstehens überzogen. Sie haben Stellungen im Kopf eingenommen, Haltungsschäden vorgebeugt, sie haben unser Lektüreverhalten radikalisiert, die Sinne aufgemöbelt, den Verstand aufgerichtet. Sie haben alles ihrer Patina unterzogen. Und dann haben sie sich zurückgezogen – in die Lücken der Tage. Sie wurden löslich, haben sich vergessen gemacht, verschwanden, um nachzuwirken. „Ich hatte meine Sandburg nur auf Sand gebaut.“
Die ersten Zeilen, die ich von Volker Sielaff las, setzen so an:
Diese Tonne da, unter dem blauen
Himmel im Februar, ich sehe
auf sie herab und sie ist
vollgestopft bis an den Rand, so daß
absolut nichts mehr hineinpaßt
Und man hier auch nicht
Von Systemen sprechen kann, die alles
Regulieren nach Plan.
Damals war ich wie von Socken. Dieser Ton, diese überfallartige Direktheit. Denn dieses wie die folgenden Gedichte, sie alle beginnen, sie alle haben Anfänge wie bereits angebrochen. Man tritt hinzu, das Gedicht ist schon im Gange. Nicht das Gedicht tritt zu einem. Es geht jedes Mal mit Wumm ins Mittenmang. Und in jedem Gedicht geben sich das Profane und das Gewaltige, Gefühl und Müll, Erleuchtung und Blendung, Schweißnass und Eiskalt die Hand. Das schließt uns an diese Poesie sofort an.
Was diese ersten Zeilen in einer Ausgabe der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter des Jahres 1998 für den Leser so frappant macht, das ist ihre Deutschness, ihre Direktheit, ihr frisiertes Parlando, der pochende Ton – als wäre jeder Vers ein Kassiber. Dazu kommt, dass die Gedichte nur wenig Material herantragen beziehungsweise verbrauchen und sich aus allem etwas Großes machen können. Ein Deckenventilator, eine Orchidee, „dies leise Rascheln im Schlaf“, ein Nachmittagsmond, ein klappriger Lift. Alles Großmaterie, Weltmaterial, jedenfalls aus dem Mund dieses Dichters.
Aber zurück zu den Anfängen. So beginnen sie, die frühen Gedichte.
Ich lebe mitten im Winter, vergiß
das bitte nicht
oder
Alles noch wie damals der klapprige
Lift eher ein Aufzug für Zuckersäcke
Gewürze und andere Lasten denkbar
oder
Allen meinen Freunden
verschweige ich dich.
Oder auch einmal, um diese kleine Serie von Gedichtanfängen zu beenden, ein Schlußvers:
Jene Kammer da drüben ist leer; auf dem Hocker
liegt ein großer, eingepackter Rosenstrauß.
Da jedes Gedicht Ausdruck der Einzigartigkeit und Unabhängigkeit seines Urhebers ist, kann keines für alle sprechen. Doch jedes trommelt für seinen Urheber.
„In skeptischer Selbstvergewisserung fragt Sielaffs lyrisches Ich unentwegt nach der Verlässlichkeit der eigenen Wahrnehmung.“, schreibt der intime Kenner der gesamten deutschsprachigen Lyrik, Michael Braun.
Sielaffs Gedichte sind aber auch radikale Abzeichen der Unabhängigkeit. Und das sich befragende Ich darin weiß um die Anfälligkeit dessen, was man eben noch spürte, sah, dachte.
Diese Tonne da, unter dem blauen
Himmel im Februar, ich sehe
auf sie herab und sie ist…
Sie erinnern sich. Das Ich schaut auf die Tonne hinunter. Eine Mülltonne. Sie ist übervoll. Und es gibt keinen Plan, kein System für diesen Müll. Soweit das Bild in dieser ersten von insgesamt fünf Strophen. Die dritte Strophe, unsere mittlere Strophe, ist das Scharnier, das Scharnier nämlich, an dem sich die irritierend an den Beginn gesetzte, verdrießliche Hinterhofetüde sperrangelweit öffnet für ein wildes, Kraft gebündeltes, von Sinnen vollgestopftes Bild:
Und so sieht dieses Bild nun aus (bislang sahen wir ja nur den Hinterhof mit der „Tonne da“). Sielaff aber schreibt fort:
Sie ist einfach voll, und wir sollten
nicht so viel reden, denn es könnte
sein, daß dann die ganze
Geschichte hier verlorengeht.
Ich mag dich, wie du da
in der Tür stehst, dein Kleid
zurechtrückst und den ganzen
Türrahmen ausfüllst, und wieder einmal
Ist es die Sonne, die diesen sperrigen
Augenblick so hingebungsvoll
beleuchtet, als wäre noch irgendwo
Platz für Gefühle.
„… daß dann die ganze / Geschichte“ – Die Geschichte, die hier jetzt bloß nicht verloren gehen darf, eine Liebe, das viele Reden, der Türrahmen, das Kleid (er schreibt es nicht, aber wir denken, es ist ein knietiefes Blumenfeldkleid mit homöopathischen Knöpfen), dazu der blaue Februarhimmel, der sperrige Augenblick (Klammer zur müllüberquellend aufgesperrten Tonne), dazu das Licht, die Sonne, die „hingebungsvoll beleuchtet“, als wäre noch Platz für Gefühle.
Eigentlich eine Unverschämtheit, dass der damals 28jährige Dichter diese Strophen schlicht mit „Gedicht“ betitelt. Zu der Zeit, als er dieses Gedicht veröffentlicht, galt es für die deutschsprachige Lyrik nicht gerade als preiswürdig, über Gefühle zu schreiben, im Gedicht zu sprechen wie wir, eine gebrauchsnahe Syntax anzuwenden, etwaige Sprachzweifel nicht permanent zu demonstrieren. Sielaff aus der Lausitz wusste das (oder es war ihm gleich). Er schrieb hiermit, mit einem Gedicht namens „Gedicht“, sein kleines, aber grundfestes Programm. Für mich ist das ein Text von vollkommener Reife, ergreifend, blendend reduziert und direkt aus der Muckibude „skeptischer Selbstvergewisserung“. Und es ist auch eine Hommage an diese Kleidträgerin. Ein Abschied.
Starke Texte wecken in uns den Wunsch, ihr Personal zu berühren.
Das „Gedicht“ findet sich 2003, fünf Jahre später wieder in Volker Sielaffs Debütband Postkarte für Nofretete. Erschienen in der Edition Postskriptum im zu Klampen Verlag, wo er die Dichter Monika Rinck, Marion Poschmann, Christoph Meckel und Henning Ziebritzki zu Nachbarn hat. Das liegt zwölf Jahre zurück.
Es vergehen von da an neun Jahre, bis Volker Sielaff mit einem zweiten Band erscheint. Wieder ist es ein Titel, wie schon Postkarte für Nofretete, der in sich Distanz trägt, der zwinkert, der sich selbst ins Wanken schaukelt. Er lautet: Selbstporträt mit Zwerg, Anspruch versus Kleinheit, Wucht und Misswuchs, Gulliver und Liliput, James Joyce und Jonathan Swift, Selbstbefragung und Selbstverkleinerung. Mit dem Eröffnungsgedicht dieses Bandes schauen wir wieder hinab, und wir wissen nicht, wie sehr Sielaff das bewusst ist. Jedenfalls geht es so los in diesem Band:
Es ist nur dieser kleine Ausschnitt im Hof
ein Stück Aussicht, die ich habe von meinem
Fenster.
Allerdings, das Gedicht bleibt in diesem Ausschnitt ein wie gezimmerter Rahmen, es betreibt noch weniger Aufwand als sein (ihm in diesem Moment ferner) Vorgänger und findet in dem Sucher von der Größe eines Hinterhoffensters seinen Sinn: Welchen Lauf nehmen die Dinge unten, unter uns, wenn sie verwaist sind. Was gehört uns wirklich. Ein Bildnis mit Birke. Der Lauf der Dinge des Lebens mit wenigen Strichen fixiert.
Das meiste muss nicht gesagt werden. Gesehen wird alles. Das ist Sielaffs Poetik.
Sielaff wechselt mit diesem zweiten Gedichtband auch den Verlag. Er ist jetzt Luxbooks-Autor und findet sich wieder zwischen John Ashbery und Norbert Lange und vielen seiner aus dem Englischen und Amerikanischen übersetzenden Kollegen. Einem der amerikanischen Verlagskollegen widmet er später ein Gedicht – Charles Bernstein, dem schillernden Poesieaktivisten aus den USA, der geliebt wird für seine Proklamationen. Mehr als eine davon scheint Sielaff zu stärken:
Kaut nicht in dürftiger Prosa wieder, was schon in guter
Dichtung gesagt worden ist.
Der Band Selbstporträt mit Zwerg enthält etwa 60 Gedichte. Sielaff legt in ihnen dar, was ihm unentbehrlich ist. Landschaften, Stillleben, die anderen Dichter (Creeley, William, Pound), Kindheitsszenen mit Ameisenkönigin, die anderen Künste, oder naturkundliche Gedichte, die in der Zukunft nach unserer Gegenwart schaben. Das flirrendste, energievollste davon: „Letzter Mensch“:
Der letzte Mensch wird nicht gefunden werden,
nicht unter Reisig, nicht unterm Grün des Regenwaldes,
vergeblich wird die Kamera draufhalten, er ist schon
fort, sein Blasrohr im Museum, sein Lendenschurz, seine
Unschuldsmiene unter Glas.
Und dann treffen wir auf ein Kind (Sina) in diesem Band – treffen auf die Weltenspalten, die entdeckt werden zwischen Kind und Betrachter in den gemeinsamen Szenen. Eines dieser Gedichte für Sina beschreibt eine gemeinsame Reise, jede Zeile daran berührt uns. Es endet mit folgenden Zeilen, der Dichter zeigt dem Kind die Bilder, die Fotos eines gemeinsamen Ausflugs, des Besuches einer Kathedrale in Barcelona:
… wie
kam das Licht in den Körper (deinen)
durch die bemalten Glasfenster des Doms,
welche Wege geht Licht, was erzählt es,
wovon träumen wir? Ich trug dich
die Straßen auf und ab, das Licht
schaukelte in uns wie eine Flüssigkeit
in einer verschlossenen Flasche, die
erst später geöffnet werden wird, beim
Betrachten der Bilder-, in einem Sommer-,
später.
Wir begegnen hier den für Sielaff nun schon typischen, so locker hingeworfenen Selbstgesprächen mit anderen – meistens Frauen. Und wenn nicht Frauen, dann meist Sina. Sie sind die verlässlichen Sparringspartner in dem Ringen um kleine Parzellen aus Demut, Erkenntnis, Würde, Epiphanie. „Auch Blicke finden irgendwann ans Licht“ schreibt Sielaff, dessen Dichtung das Suchen besingt, die schöne Geduld. Ein Dichter wie wenige, von dem es uns nicht wundern kann, wenn ihm, „die Antworten / wie Pilze aus den Taschen fallen“.
„Blessed be all metrical rules that forbid
automatic responses, force us to have second
thoughts, free us from the fetters of Self.“
Dank sei den metrischen Regeln, sie wehren
Mechanischer Antwort, zwingen zum Nachdenken
Uns, lösen die Fesseln des Selbst.
So reimend rühmt der amerikanische Dichter W. H. Auden die Metrik. In Volker Sielaffs Lyrik spielte sie bis zu seinem aktuellen Band – Glossar des Prinzen – keine auffällige Rolle. Zwar hat jedes Gedicht seine Regeln, seinen Rhythmus, Markierungen und Tonstufen, aber wir neigen dazu, erst die gereimte Ware als metrische Verskunst anzusehen. Mit seinem dritten Gedichtband hat Sielaff sich neuen Formen und Tönen geöffnet. Etwas feuilletonistisch gesagt, der schon lange nicht mehr sanfte, nie besonnene, sondern mindestens untergründig schon immer wütende Drummer legt die Sticks beiseite, steht auf und singt und schlägt dazu auf dem Tamburin. Brachial. Was dabei zuerst herauskommt, sind eingängige Minne. Bezeichnenderweise stellt Sielaff diese an den Beginn seines Bandes, er zeigt uns also gleich als erstes, was sich geändert hat, er stellt seine Reime in die von fünf Abteilungen erste und betitelt sie mit „Die 13 Lieder des Prinzen“. Von seinem Dichterkollegen Jan Kuhlbrodt befragt zu seiner Verwendung des Reims in diesen Gedichten, lautet Sielaffs Antwort:
Ich habe dann bemerkt, dass der Reim, gerade aufgrund seiner formalen Begrenztheit, Lösungen bereithält, die manchmal auch „verrückter“ sind als jene Wege, die man mit dem freien Vers beschreiten kann. Der Endreim denkt mit.
Der Endreim denkt mit.
Jetzt sind sich der große tote Auden und der Lausitzer Dichter aus dem Dresden der Gegenwart so nahe wie nur möglich. Was aber in Sielaffs Liedern geschieht, geht über simple Koalition hinaus. Wer nach so langer Zeit aus den weiten der freien lyrischen Rede umkehrt zum End- und Binnenreim, hat Freiheiten genutzt, die unweigerlich zu Reife führen.
Sielaffs dritter Gedichtband beginnt mit einem Liebestrank, mit einem Spiegel-, einem Umkehrbild:
Oh schenk mich ein Oh lass dich nicht verdursten
Erst wenn das Glas nicht Glas ist bin ich lange fort
Erst wenn ich mich als deine Haut im Spiegel seh
Und als dein Körper durch die Spiegel geh
Erst dann wenn ich trotz Warnung mich nach dir
Umdreh Wird was mir dunkelte ein heller Ort.
„Erst wenn ich mich als deine Haut im Spiegel seh / Und als dein Körper durch die Spiegel geh“ So flirrend verschlüsselt diese Zeilen auch bleiben mögen beim Hören, ihr Ton ist klar und sie sprechen trotz des Reimes, so gerade heraus wie alle Texte unseres Dichters. Die „dreizehn Lieder des Prinzen“ nehmen die Vielfalt des Bandes voraus. Sielaff kann kein Kunstgewerbe, er wiederholt sich nicht in „Gelungenheiten“ und Geschicktem. In seinen dreizehn Liedern schlägt er wie noch nie gehört einen Kinderliederreime-Rhythmus an, der uns wiegt, der uns mit nichts betrügt. Und durch diesen Rhythmus drängen seine Motive: Sprache, Dichtung, Widerstand, die Alten Meister, Verschwendung, Truglosigkeit.
Es ist erstaunlich, zu welch formaler Strenge Sielaff in seinen jüngeren Gedichten gefunden hat. Alexandriner, Binnenreime und Strophen, Strophen über Strophen. Aber in diesen Formen, aus diesen Formen heraus begegnet uns ein Dichter, der vielseitiger geworden ist, schelmisch, wütend, komisch, verspielt, komplex.
Auf eine Nachfrage zu einem historischen Ort in einem der Gedichte antwortet er dem Fragenden flink und knapp, zielgenau. Und schiebt dann aus dem Codex aller Dichter hinterher:
„Das meiste steht in den Gedichten.“
Schauen wir also zum Abschluss in eines dieser Gedichte, „Drittes Lied“. Wir haben daraus eingangs bereits gehört:
Ich hatte mir zu lang zu wenig noch getraut,
doch so zu schweigen bringt ein doppelt Eisenherz,
ich war gestolpert über blinden Rauch Kommerz
ich hatte meine Sandburg nur auf Sand gebaut.
Fürder will ich nicht, dass ihr mich flüstern hört
das ist ein kleiner Mut, ich will euch schreien was
will nach euch werfen mein kaputt zerbrochnes Glas
ihr sollt nicht glauben dass ich hätte nicht gestört!
Ein Text nahezu ohne Interpunktion. Die zwei Strophen teilen sich lediglich zwei Satzschlusszeichen, Punkt und Ausrufung. (In einer früheren Version hieß der Text auch nicht „Drittes Lied“, sondern „Lied des Reumütigen“. Das ist ein Anhalt. Der Sprecher ist es leid, verkannt zu werden, er bereut geschwiegen zu haben, zu lange sich zu wenig angemaßt zu haben.) Das Flüstern – der Aufschrei der Kleinmütigen, es muss aufhören. „Ich will euch schreien was / will nach euch werfen mein kaputt zerbrochnes Glas“.
Das Prädikat ein „Starker Text“, hier trifft es zu. Ich würde mir aus lauter Hinknien vor solchen Destillaten mit Freude noch die Knie aufschürfen. Das Besondere liegt in den minimalen Verschiebungen. Das Glas, das schon gebrochen ist, ehe es geworfen wird. Die peristaltisch umwundenen Satzbaustellungen in dem Text („ich will euch schreien was“), dazu die anmutigen Alexandriner mit ihren durchschlagenden Mittelverszäsuren. Eine Exzellenz von Semantik, Syntax, Rhythmus.
In den vergangenen Monaten schaute Europa nach Dresden und die hochrotierenden Medien drehten ihre Satellitenschüsseln am Elbufer in den knarzenden Wind. Ich kenne in oder aus Dresden niemanden besser als hochachtungsvoll eine Kollegin sowie ein paar Dichter, die mir immer im Kopf sind, wenn ich an die Elbestadt denke. Zwei von ihnen sind heute hier unter uns, Marcel Beyer und eben Volker Sielaff.
Die Deutsche Schillerstiftung verleiht in diesem Jahr ihre Ehrengabe an den Dichter Volker Sielaff. Sie hat sich damit für eine Dichtung des Dissens, der Dissonanz, der besungenen Dysfunktion entschieden. Sie hat sich entschieden für die Sprache in ihrer bestechendsten Form, für eine Poesie, die äußerst wehrhaft und angestachelt dem gegenüber steht , was der gebürtige Dresdner Durs Grünbein in Dresden als „den Sound der Unbelehrbarkeit, der Einschwörung und Einschüchterung“ anprangert. Ich bin überzeugt, dass, wer die Lektüre der Dresdener Rosenlöcher, Beyer, Grünbein oder Sielaff verinnerlicht hat, außer Stande ist, sich in der beobachteten Weise an Bedrohung, Ausgrenzung und Selbsterniedrigung zu beteiligen. Wenig im Geheimen glaube ich, es hält schon ein einziges Gedicht unseres Dichters aus der Lausitz Stand gegen die Welle dürftiger Prosa und Parolen aus Dresden.
Fürder will ich nicht, dass ihr mich flüstern hört
das ist ein kleiner Mut, ich will euch schreien was
will nach euch werfen mein kaputt zerbrochnes Glas
ihr sollt nicht glauben dass ich hätte nicht gestört!
Ich gratuliere den Auszeichnenden wie dem Ausgezeichneten zu ihrem festen Glauben an die Poesie.
Hauke Hückstädt, Deutsche Schillerstiftung von 1859
Fakten und Vermutungen zum Autor + Facebook
Porträtgalerie: Dirk Skibas Autorenporträts
shi 詩 yan 言 kou 口
Volker Sielaff liest im Stadtmuseum Dresden ein Gedicht aus seinem Band Glossar des Prinzen.


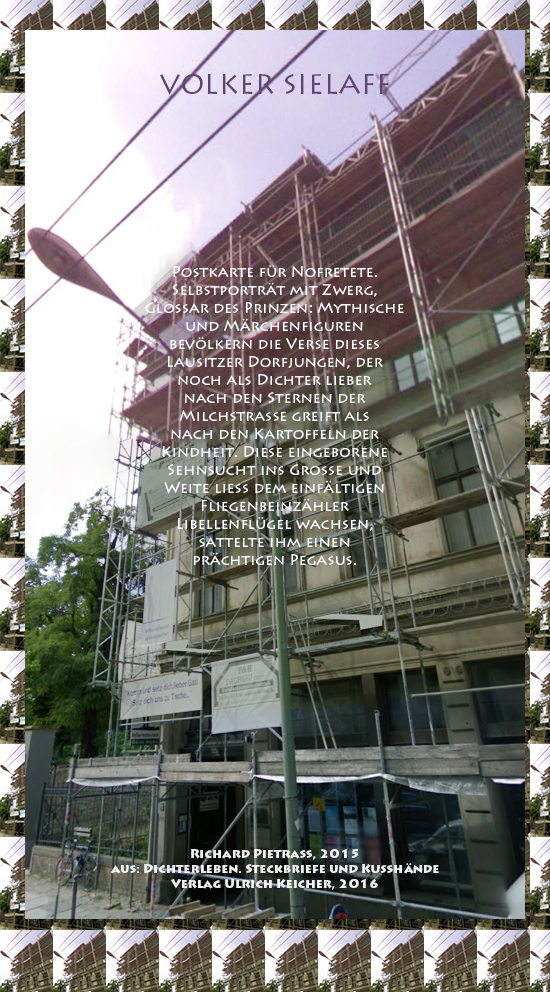












Schreibe einen Kommentar