Walter Werner: Die verführerischen Gedanken der Schmetterlinge
AUS DER BEICHTE EINES GEWISSEN SISYPHUS
Ein Elektronenauge, das saugt
und frißt meine Zukunft,
versteckt im Raum,
verdeckt von Zeit, sitzt
über meinem Kopf. Ausgefahren
ins Tageslicht. Zurückgehalten
vom Tageslicht. Die Weisheit
mit der Kennziffer Null. Etwas,
womit sich der Mensch
sein Spektrum durchlöchern,
seine Hirnschal kopieren
und sein Gefühl
besichtigen läßt.
Die neue, allerkleinste Sonne
alltäglich.
Und derweil ich
bis zur absoluten Wahrheit
noch immer den jüngsten Verzicht
und den letzten Betrug mitnehmen muß,
nimmt’s ab das Geheimnis, geht’s
aufwärts mit der angewandten Natur.
Denn niemand hält mehr dem Wunderauge
sein Auge so schuldlos hin,
und niemand verliert mehr,
der mit Verlust
einen verlustlosen Gewinn anstrebt,
denn wer gräbt noch nach Bewußtsein,
nur um vernünftig zu sein?
Dort leg ich den Stein hin.
Dort hau ich den Baum um.
Dort kaut der armselige Prophet
sein mitschuldiges Gras.
Über die Lyrik Walter Werners
1
Walter Werner hat seit 1957, als Louis Fürnberg das erste Heftchen mit Gedichten des 1922 geborenen Thüringers der Öffentlichkeit übergab, über ein Dutzend Buch-Publikationen vorzeigen können (manche mehr lokalen, z.B. mundartlichen Charakters); außerdem hat er kleinere, vor allem theoretische Arbeiten in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Auch der gründlichere Gedichte-Leser kann sich jedoch auf die Lektüre der vier zentralen Bücher Walter Werners beschränken, auf das Poem Sichtbar wird der Mensch (1960), auf die zusammenfassende Auswahl aus der frühen Lyrik in den liedern geboren (1963), auf Das unstete Holz (1970), Werners bisher reifstes Werk, mit dem eine neue Phase der Entwicklung des Dichters eröffnet wurde, und auf den ihm folgenden und bisher letzten Band Worte für Holunder (1974). – Man mag die Prosabände Die Strohhalmflöte (1965) und Grenzlandschaft / Wegstunden durchs Grabfeld (1972) hinzuziehen, die nicht nur den Zugang zu den neuen Gedichten erleichtern, sondern auch hier und da zu Reflexionen über die spezifischen Mittel und Wege der Lyrik animieren, wenn sie, was nicht zu selten geschieht, den gleichen Motiven folgen wie die Gedichte: „In Widarogeltesstat, wo die germanischen Franken im Jahre 531 die Herrschaft über das südwestliche Thüringer Reich antraten, möchte ich am liebsten geboren sein…“, Zeilen aus „Grenzlandschaft“, die man neben die des Gedichts „Im keltischen Widarogeltesstat“ legen kann: „Dunkel ist der Ort, den wir bewohnen, / ein Ruf ohne Stimme / unerklärter Kriege, / wilde Männer, krumme Sicheln / aus dem Grund der Zeit gestoßen.“ – Den für die Qualität seines Gedichts entscheidenden ,Durchbruch‘ erzielte Walter Werner in denselben Jahren, in denen auch die Lyriker der Generation von Karl Mickel bis Volker Braun ihre Eigenart auszuprägen begannen, in den Jahren 1965/66/67: Das unstete Holz dokumentiert ihn.
Nachdem der Herausgeber 1970 diesen Band durchgeblättert und erste Notizen gemacht hatte, verglich er sie mit den gelegentlichen Meinungsäußerungen über Walter Werner, die er Mitte der sechziger Jahre vor dem Bekanntwerden der neuen Arbeiten in die Zeitung gegeben hatte; er mußte mit wachsendem Staunen erkennen, daß es kaum noch Übereinstimmungen gab, es sei denn in Nebensächlichkeiten. Werner schien die spannungsreiche Entwicklungsproblematik seiner frühen Produktion endgültig auf- und weggearbeitet zu haben und schon weit in anderen, für ihn neuen Problemkreisen zu stehen. Bis zu dem Band in den liedern geboren war es ihm um die Gründung seiner poetischen Landschaft gegangen, um die Stabilisierung seiner Position als Dichter („Sichtbar wird der Mensch“), „Wir aber verhießen schon Fruchtbarkeit / den Tagen, / die noch kommen werden“, lautet eine frühe Zeile, die der Dichter auch auf sich selbst bezieht. Der Sohn einer Landarbeiterin begriff sich als einen, der noch mühselig ,aufstieg‘, er rief sich zu:
Einen Berg besteigen.
Klug zu machen die Kraft
für Höhe und Tiefe…
In dem Band Das unstete Holz wird man vergeblich nach solchen Bildern suchen. Der angestrengte Bergebesteiger von damals bekennt: „Zu stürzen bin ich bereit…“ Das ruhige und furchtlose Bekenntnis im zweiten Drittel der sechziger Jahre:
Ich kann leben. Ich kann wachsen
und warten. Meine Sprache verlieren
und wieder in ihr wohnen.
Aus solchen Zeilen spricht Selbstsicherheit, die nicht mit Selbstzufriedenheit, spricht Gleichmut – „Mein Gesicht ist Geduld“, heißt es an anderer Stelle −, der nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden darf. Offenkundig wird der Abbau einer aktivistischen Gestik, mit der sich Walter Werner vorzeiten sowohl die neue Thematik als auch die Mittel seiner Kunst erobert hatte. Es wird gesprochen nicht mehr von „den Tagen, die noch kommen werden“, sondern „von den schon alltäglichen Dingen“ – ehe Werner zu wieder anderen Abenteuern aufbricht. In den Fünfzigern wurde plakatiert: „Ich liebe der Vögel bleibende Lieder…“ In den Sechzigern zeigt sich das poetische ,Ich‘ gern als identisch mit Landschaft und Natur, zum Beispiel mit der Substanz, die im Baum arbeitet und im Frühling die Blüte sich auffalten läßt:
Im Winter
hab ich im Nest
der drahtigen Wurzeln gewohnt…
Damals hieß es voluntaristisch:
Wir rücken näher
unaufhaltsam näher an den Himmel
unsere Staffelei.
Abwärts jetzt, ins Tal hinein, und nicht mit einem Aufruf, sondern mit dem „maßlos vergnügten“ Ausruf des Schispringers:
Arme reißen den schaukelnden Horizont
ins frostige Tal.
Weite, nur Weite!
Hatte dieser Poet nicht jahrelang an der Schwierigkeit gelitten, die „kleine Welt“ der Provinz und die „große Welt“ auf einen Nenner zu bringen? Der Walter Werner der Bände Das unstete Holz und Worte für Holunder hat solche Schwierigkeiten hinter sich gelassen. Freilich, ohne sie ins Auge gefaßt zu haben, bleibt Walter Werners Entwicklung bis ins letzte Gedicht hinein nicht recht erklärbar. Um was ging es eigentlich genau? Walter Werner nennt den Bezirk Suhl, in dem er lebt, manchmal im Gespräch „Unsere autonome Gebirgsrepublik“ – freundliche Ironie, die dennoch nicht vertuschen kann, daß die geographischeAbgeschlossenheit des kleinsten Bezirkes unserer Republik nach Osten und Norden durch den Kamm des Thüringer Waldes, nach Süden und Westen durch die Grenze zur Bundesrepublik – lange von dem Lyriker Walter Werner tief und oft schmerzhaft als etwas empfunden wird, das ihn zum „Provinzlertum“ verdammt und ihn zur Kapitulation vor größeren literarischen Aufgaben verführen könnte, zur Bequemlichkeit vielleicht auch gegenüber sich selbst und einer gewissen Neigung zu Zurückgezogenheit und Enge. – „Lippenschmal: / das Versteck / der Unendlichkeit“, weiß er Indessen nach mancherlei Bemühungen, einen subtilen Widerspruch formulierend, in dem sich wiederum der handgreiflichere verbirgt, wie ihn der Titel einer seiner zahlreichen essayistisch-theoretischen Klärungsansätze benennt:
Kleine Welt – große Welt.
2
Einen zentralen Part in den Wernerschen Selbsterörterungen spielte ein Prosabuch, das dem Unsteten Holz vorausgeschickte Bändchen Die Strohhalmflöte, das die inneren Konflikte des thüringischen Poeten deutlicher zutage treten läßt als alle vorangegangenen Arbeiten und alle folgenden. Das Buch ist gleichzeitig – ein hier und da fast vertrotztes – Bekenntnis zu Werners „poetischer Provinz“ und ein Dokument des Widerstandes gegen die träge, aber mächtige Gewalt des Provinzialismus. Eine ganz überzeugende Lösung war noch nicht gefunden: Psychische und physische Ausbruchsversuche, Reisen in verschiedene Teile der Republik und ins sozialistische Ausland, die sich in Gedichten und Prosastücken auch als geistige Abenteuer niederschlagen, wechseln ab mit zeitweiliger Nachgiebigkeit gegenüber der verführerischen „Gemüt“-lichkeit des Meininger Landes. Um 1964 nahm diese Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt nahezu dramatische Züge an: eine Reise, die Werner gemeinsam mit Volker Braun und einigen anderen Kollegen durch Sibirien unternimmt und die für ihn, wie er damals dem Herausgeber versichert hatte, zu einer zwingenden Lebensnotwendigkeit geworden war, endet mit der vorzeitigen Rückkehr des Lyrikers – vorausgegangen war beispielsweise der unglückselige Versuch, mit lokalspitzenartigen Mundartdichtungen die Bevölkerung seines Heimatkreises zu erreichen, die sich Werners „hoher“ oder „eigentlicher“ Poesie noch zum großen Teil verschließt, (Die Strohhalmflöte hält für den rührenden und fragwürdigen Seitensprung Walter Werners ins Popularistische zwar eine Rechtfertigungsmelodie parat; aber sie wird durch die gleichzeitig mitgeteilten Beispiele – „Äbbes über onnern Plan“ beziehungsweise „Volksliedle“, wie es dann irreführend heißt, mit dem Kehrreim „alles für die Mensche“ −, die gleichermaßen den Verzicht auf Hoch-Sprache wie ernsthafte künstlerische Ambition bedeuten, ad absurdum geführt: das mundartliche „Gedichtebuch“ des „ehemaligen herzoglichen Oberförsters Paulus Motz“ war mit solchen volkstümelnden Mitteln schwerlich aus dem Felde zu schlagen, auf dem Gebiet der Kunst schlägt man Gleiches nicht mit Gleichem im Unterschied vielleicht zur agitatorischen und propagandistischen Publizistik in dem oder jenem Fall. Walter Werner sieht diese Verse heute als Bewegungsübungen „zur Erheiterung meiner Mentalität“; – akzeptiert!) Eine der Hauptfunktionen der Strohhalmflöte bestand darin, solche schwierige und spannungsreiche Konstellation genauer zu bestimmen, die Voraussetzungen noch einmal zu sichten, unter denen sich die literarische Arbeit Werners vollzog und vollzieht: Walter Werner bemüht sich darum, die Heimat als archimedischen Punkt seiner Poesie ins Auge zu fassen, und es ist längst nicht mehr der Blick des naiven Poeten, der unvoreingenommen über Dorf und Landschaft streift, Neben anderem ist ein merkwürdiges topographisches Bewußtsein im Spiel, das bestimmte Orte genau einzuzirkeln versucht, die beschrieben werden wollen – wie es sich schon in dem Poem „Sichtbar wird der Mensch“ angekündigt hatte:
So friedlich liegst du vor mir
auf der Karte, westliche Heimat,
Einen Finger breit ist der Raum
zwischen Werra und Main,
Mit meinen Händen decke ich dich zu,
nicht um zu vergessen, nein, um zu lieben!
In diesen Zeilen kommt jedoch auch das nicht nur ideologisch, sondern auch gefühls- und erlebnismäßig zu bewältigende Problem zeitgenössischer „Grenzziehung“ in Folge des Hitler-Krieges zum Ausdruck, in die Kindheits- und Jugendlandschaft des Dichters einschneidend, in eine Bilderwelt, die selbstverständlich in Bewußtsein und Traum des Poeten und somit als Materialreservoir seiner Poesie weiterlebt. Daß die neue Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten, an deren Markierung und Stabilisierung man selber zumindest als antikapitalistischer Ideologe mitgewirkt hat, sich selber Wunden schlagend, die bis heute schmerzen, daß sie nicht nur als „Sieg“ zu feiern ist, dem muß der Dichter des Grenzlands und der Sperrgebiete sich immer neu stellen, wenn er seine Dichtung nicht dem Selbstbetrug und fadenscheiniger Idylle aufopfern will:
Wegweiser warten und Schranken,
und tief im Gespräch hält der Weg,
der Fluß der Rede
Schilder und Zeichen,
mit denen wir leben
und auf die wir schreiben:
Wenn wir lügen,
wird die Erde teuer!
(„Im Sperrgebiet“).
In vielen seiner Arbeiten, vor allem aber seinen beschreibenden wie meditativen Prosabüchern, scheint Walter Werner die neuen und alten Grenzen immer wieder nachziehen zu wollen, die sein Leben bestimmten, die es bestimmen. Und wenn er sie überschreitet, ist es oft so, als gelte es die ungeheuerlichsten Abenteuer zu bestehen, selbst dann, wenn es sich vielleicht nur um einen Ausflug nach Leipzig-Stötteritz handelt −: die Spannung zur heimatlichen Landschaft bleibt auf solche Weise stets lebendig. Auch in der Ferne, so spürt man, orientiert sich der Dichter an der inneren Landkarte, auf der Rhön, Thüringer Wald und Werra markante Zeichen sind. Um was es Walter Werner auf diesem Wege geht, glaubt er, ehe Bobrowskis Vorbild für einige Zeit alle anderen Leitsterne verdrängt, zunächst bei Louis Fürnberg vorgebildet zu sehen, in dessen Werk freilich Böhmen die „kleine Welt“ ist, ein Land, überschwellend von kulturellen Reichtümern und literarischen Traditionen, gesegnet mit der Stadt Prag; ausgehend von solchen Literaturerlebnissen beginnt Walter Werner zu ahnen und sich alsbald Gedanken darüber zu machen, daß seine Situation nicht nur Nachteile, sondern unter Umständen auch große Vorzüge, bergen kann: „Meine literaturwissenschaftliche Kenntnis reicht nicht aus“, grübelt er schon früh, „um zu ergründen oder nachzuweisen, daß die Liebe zur engeren Heimat, insofern sie das Provinzielle bricht und hinter sich läßt, die Voraussetzung für alle große Dichtung ist.“ Unsicherheit und Selbstbewußtsein in seltsamer Mischung, der produktive Widerspruch bei Walter Werner in der Nußschale.
Aber, in der Tat, des Fragens ist in diesem Punkt nicht nur bei Walter Werner kein Ende: Heimat – wie weit reicht sie? Der Begriff ist zumindest (aber nicht nur) für die Poesie schillernd, porös und dehnbar. Recht ausgreifend wurde der Zirkel von Walter Werner in seinem frühen Poem Sichtbar wird der Mensch geschlagen. War hier nicht der ganze Raum der Republik gemeint? Wenn auch als konkrete poetische Heimat das südwestliche Thüringen stets sichtbar blieb? Daß die „kleine Welt“ im Allgemeinen in der „großen“ aufgehoben werden konnte, war in diesem speziellen Fall vor allem deshalb möglich, weil Werner die politische Emanzipation der meist sehr armen Bevölkerung seines Bezirks auch als Lebensproblem des mit ihr verbundenen Künstlers begriffen hatte; der Kampf um die Befreiung der Arbeiter und Bauern erscheint auch als Voraussetzung der Befreiung und Entfaltung des Talents Walter Werners. (Doch ist die Bemühung des Dichters um künstlerische Reife identisch mit dem Kampf des Volkes? Diese Gleichung, die dem Poem Sichtbar wird der Mensch zugrunde liegt, geht nicht ganz auf, Darin dürften die Ursachen für manche Schwächen des Poems zu suchen sein, vor allem die Indifferenz in der Bestimmung des „poetischen Helden“ des umfangreichen Gedichts – „Ich“ oder „Wir“? -; doch war wohl die bedeutende Intention des Dichters und ein daraus resultierendes Versagen in diesem Fall größerer Achtung wert, als es ein „gelungenes“ Werk mit geringerer Zielsetzung damals gewesen wäre.) Später, vor allem eben in der Strohhalmflöte, ist der Zirkel wieder enger eingestellt und will hauptsächlich das Dorf umkreisen, die Dorfwelt, in der Walter Werner bis heute lebt – der einzige Lyriker von Bedeutung in der DDR (sieht man von dem Sonderfall des Sorben Kita Lorenc ab), der kein Städter ist. „Mein Dorf, meine Welt und ich“ lautete bezeichnenderweise der Arbeitstitel der Strohhalmflöte: Was in „Sichtbar wird der Mensch“ bereits die Weite einer poetischen P r o v i n z erobert hatte, wurde gleichsam wieder zurückgenommen in eine poetische O r t s c h a f t. Doch einen Rückschritt bedeutete das Buch keineswegs, im Gegenteil: ein neuer Anfang auf höherer Stufe deutete sich an, wenn an die Stelle eines stürmischen Pathos ein nüchterner Berichtston trat, eine beflissene Sachlichkeit, eine Sprache, die gleichsam wieder mit dem Abc begann und der Beschreibung der Hand und des Handgreiflichen. Fast jedes Gedicht des dem Prosabuch vorangegangenen Lyrikbandes in den liedern geboren würde neben den reiferen Gedichten im Unsteten Holz, das der Prosa folgte, fast plump und undifferenziert wirken: Problematik bei der Auswahl.
3
Die Kritik feierte den Band Das unstete Holz (1970 erschienen, um es zu wiederholen) einstimmig als „bisherigen Höhepunkt“ der Wernerschen Produktion. Daß es sich zudem um einen Neubeginn handelte, wurde seltener wahrgenommen. „Hier ist ein langwieriger Prozeß beschlossen und gerundet“, hatte Werner Bräunig allerdings bereits 1963 über Walter Werners Poesie geschrieben. Was sollte nun folgen? Würde es Walter Werner gelingen, sein poetisches System so umzubauen, daß es funktionsfähig blieb? Mit dem Unsteten Holz wurde die Antwort auf solche besorgten Fragen gegeben. Ein Neubeginn – aber ist es nicht dieselbe Landschaft im südwestlichen Winkel unserer Republik, die Walter Werners Aufmerksamkeit nach wie vor besitzt? Die Kindheitslandschaft Walter Werners, einstens von knallbuntem „Dorfzirkus“ und exotischen Zigeunern belebt, heute immer noch flüsternd von „alten Sagen und Märchen“? Ist es nicht immer noch auch die durch Menschenhand „bewegte Landschaft“, nach der ein Bändchen von 1959 seinen Titel hatte? War 1959 des „Räumpflugs Furchenkahn“, die poetisierte Landmaschine am Werk, so heißt es 1970:
Die Kräutermutter mit der Kräuterfibel,
ihr Buch mit den sieben Siegeln.
Ihm antworten mit Kahlschlag
die Holzhauer…
Sind es nicht die alten Motive? In der Tat handelt es sich nicht um den spektakulären Bruch eines Poeten mit seiner Vergangenheit, Das Neuartige kommt hier mit dem „Pathos der Zurückhaltung“, das Werner an Fürnberg gerühmt hat. Nicht die Stoffe des Dichters sind neuartig. Aber der Besitzergreifende ist der Besitzer seiner Stoffe geworden, und folgerichtig ist der poetischen Aktivität ein neues Ziel gesetzt.
Angekündigt wurde es bereits 1965 mit dem Motto der Strohhalmflöte. Man begriff es nicht ganz, später erst leuchtete es einem ein, weshalb Walter Werner der Strohhalmflöte das Fragment von Konstantin Paustowski vorausgeschickt hatte:
Die Natur wird nur dann mit ihrer ganzen Kraft auf uns einwirken, wenn wir sie mit dem Einsatz unseres ganzen menschlichen Wesens empfinden, wenn unser Seelenzustand, unsere Liebe, unsere Freude oder unser Schmerz v o l l e Ü b e r e i n s t i m m u n g (Hervorhebung A. E.) mit ihr finden, so daß es nicht mehr möglich ist, die Morgenfrische vom Licht geliebter Augen und das gleichmäßige Rauschen des Waldes vom Nachdenken über den zurückgelegten Lebensweg zu trennen.
Wie entschieden sich Walter Werner mit diesem Programm von seinen Anfängen entfernt, wird sofort klar, wenn man im poetischen Bild seiner ersten beiden Gedichtbände (Licht in der Nacht, 1957; Dem Echo nach, 1958) die distanzierte Optik des Malergesellen wiederfindet, der Werner gewesen war, „Haus meiner Kindheit“:
Weißgekalkt die Fachwerkfronten,
Fenster, morsch im Schiebgebrech.
Moosgeflechte auf den Ziegeln
wuchsen tief ins Traufenblech.
− „Dorfzirkus“:
Graulackierte Zirkuswagen
sind am Markt zur Schau gestellt…
− „Kräutermutter“:
Vor dem Braun der Lehmfachwände
gilbt der weiße Blütenschnee…
Und in „Die Werkstatt“, präzis die Arbeits-„Landschaft“ des Lehrlings fassend, selber sorgsam ausgeführt wie eine fleißige Malerarbeit, begegnet man den Versen, die zu den stärksten des Anfängers gehören:
Fauliges Wasser im eisernen Topf,
gedunsen, mit öligem Schimmer;
zum bauchigen Henkel wuchs farbig ein Zopf,
krustig aus glasigem Flimmer.
Erst vorsichtig meldet sich in derlei starren Schildereien die Dynamik („wuchs farbig ein Zopf“, „wuchsen tief ins Traufenblech“, „gilbt der weiße Blütenschnee“), die später von so vielen Begutachtern als Charakteristikum der Wernerschen Poesie empfunden wird, zum Beispiel von Werner Bräunig, der das Dynamische vermutungsweise darauf zurückführt, daß Walter Werner die „Welt als Mitschöpfer“ erlebt.
Nach der Lektüre der Gedichte im Unsteten Holz sah man genauer, daß das Gefühl Bräunigs ihn nicht völlig irregeführt hatte. Die Dynamik seiner Gesten und Bilder ist es, die dem Dichter den Weg zur Identifikation mit seinen Objekten öffnet, wie umgekehrt solche Identifikation das Gedicht weiter dynamisiert. Ein gelungenes Beispiel bietet das „Kirmesständchen“, welches mit den Zeilen beginnt: „Ich bin aus Blech, / aus dem alten, tönenden Geschlecht…“, aus dem Blech der Trommel oder der Trompete also, das im turbulenten Zentrum des Kirmestrubels mitkreist:
Mit einer Lage selbstgebrautem Bier,
mit Besen und Bock herum um den Kirchhof,
um das gilbende Mehl im Faß,
um den Apfel im Topf, um die Zwetsche
im Glas, mein dickes Kuchengesicht,
wer wäscht es mir ab?
Es war, wie wir gesehen haben, ein langer Prozeß, der zu so schnellem Tempo des Gedichts führte und in einigen der neuen Gedichte zu einer Geschwindigkeit der Assoziationsfolge, der man nicht immer leicht folgen kann und die zuweilen auch wirklich Sprünge, Risse im Gedicht verursacht. Ehe sie Dynamik des Objekts werden konnte, mußte die dynamische Bewegung erst die Welt ins Gedicht holen, mußte sie dann – oder gleichzeitig? – zu einem Mittel werden, das „Übereinstimmung“ mit Landschaft bzw. Natur herzustellen vermochte:
Strecke den Arm aus,
die Spanne Anfang,
mit der du immer und alles beginnst,
und leg ihm deinen Arm um,
so wirst du er selber sein,
der Berg.
Hier ist es vollzogen! Indessen fehlte es auch in den früheren Bänden nicht an Wegweisern in diese Richtung, so zum Beispiel, wenn der Wunsch ausgesprochen wird: „Ich möchte eine Wolke sein / oder ein Vogel, / der in sie hineinfliegt.“ Ein kurzer Schritt bis zur fast gänzlichen „Übereinstimmung“ mit der Natur ist es von den Zeilen „Beim Anblick eines schönen Mädchens“, die emphatisch behaupten:
Ich bin in dieser Sekunde
i m Wind über den Wipfeln,
i m Vogelnest der Bäume
und i m Schwalbenflug über den Wiesen!
(Hervorhebung A. E.)
− Um zu erkennen, daß die neuen Schritte Walter Werners ihn auch in neue Probleme getragen haben, braucht man kein Philosoph zu sein, der diese Lyrik auf pantheistische Töne hin abhorcht.
4
„Der Dorfgärtner“ in der Strohhalmflöte, eins der zwischen die kleine Prosa gestreuten Gedichte, das mit Recht in den Band Das unstete Holz übernommen wurde, zeichnete das Bild eines Schöpfers, der um ein Haar mit seiner Schöpfung identisch wird / („Der Gärtner lebt wie die Pflanze“), Pflanze unter Pflanzen. Außerdem läßt es selbstverständlich an den Welten-Schöpfer denken: „Der Dorfgärtner“, der die Erde mit seinen Pflanzen belebt, der Gut und Böse scheidet, der die Sonne herbeiruft – Es werde Licht! −, er vollzieht auf seinen bunten Beeten die Weltschöpfung nach. Die von Walter Werner – in den Gedichten des Bandes Das unstete Holz – vorgeführte Verwandlung des Dichter-Ich in Berg und Baum ist nicht nur ein Kunstgriff, mit dem die Objekte direkter vor den Leser gerückt werden. Der Vorgang findet Entsprechungen im System der philosophisch-ästhetischen Anschauungen des Dichters, der gelegentlich nahe daran war, einen „Schöpfer“ zu normieren, der des „fragenden“ und „suchenden“ Bewußtseins entraten und ganz Naturlaut werden sollte. Erst Jahre nach der Erstpublikation wurde jedoch deutlich, daß Werner bereits im „Dorfgärtner“ versuchsweise ein „Ideal“ auch für sich als Dichter aufgestellt hatte:
Der Gärtner lebt wie die Pflanze
in seiner feuchtwarmen Welt,
niedergebückt schon am Morgen,
wenn die Fenster hell werden,
gräbt er dem Licht die fließenden Wege.
− Wir nannten dieses Gedicht in einer Notiz 1965 „eine kleine Schöpfungsgeschichte“; „Kleine Schöpfungsgeschichte“ nennt Walter Werner ein Reflexionsgedicht – geschrieben wie so manches von Werner als Antwort auf Äußerungen über seine Arbeit −, das im Unsteten Holz kommentierend neben den „Dorfgärtner“ gestellt ist und mit dem die pflanzenähnliche Existenz des Gärtners auch für den Poeten in Anspruch genommen wird:
Mir fallen schon Texte ein,
die benötigen nichts,
nur daß ich da bin.
In einem anderen Gedicht („Schneeglöckchen“) wird ein Votum für eine spontan sich einstellende poetische Sprache abgegeben. Das Schneeglöckchen bricht durch den Schnee, noch „verschlossene Lippe“, und „mit ihr“, mit der „Lippe“ des Schneeglöckchens läßt der Dichter seine „Sprache… geschehn“, eine Sprache, die sich nach Auskunft dieses Gedichts bewußtem Zugriff verwehrt: „Die läßt sich nicht suchen. / Man kann sie nur finden.“ Daß derartige Vorstellungen kritische Befragung hervorrufen, ist nur zu natürlich. Handelt es sich um Selbstverkennung des Poeten? Der Widerspruch in derartigen Versen besteht offenkundig darin, daß das in ihnen formulierte Programm immer „sentimentalisch“ bleiben muß, wie der Poet sich dreht und wendet, daß die Mißtrauenserklärung gegenüber dem „suchenden“ und „fragenden“ Bewußtsein immer wieder nur vom „suchenden“ und „fragenden“ Bewußtsein abgegeben werden kann, mag es auch der Suche und der Fragen müde geworden sein. Es kann nicht ausbleiben, daß in diesen Gedichten das Mißtrauen des Dichters gegen das eigene Programm mitschwingt, daß manche Zeile zu bedeuten scheinen will, man möge doch, bitte, derartige Bekenntnisse als Momente in einem Prozeß betrachten (was man auch gerne tut: der widersprüchlichen Entwicklung künstlerischer Existenzen bewußt, bei der unter Umständen das Falsche das Richtige sein kann und umgekehrt, um es einmal rational zugespitzt zu sagen). Jede Betrachtung, die das versäumt, würde in der Tat Walter Werner unrecht tun. Es genügt der Hinweis auf die Verse „Kunststück“, in denen die Identifikation mit dem Objekt sarkastisch weiter getrieben ist zu einer Vertauschung von Objekt und Autor. Der Dichter kehrt aus dem Wald in sein Zimmer zurück, zu seinem Stuhl, oder ist es der Stuhl, der zum Dichter zurückkehrt?:
Der Stuhl
spricht: Ich komm und geh
und bin’s nicht mehr!
Der Dichter – oder der Stuhl? es bleibt wahrscheinlich mit Absicht in der Schwebe – spreizt seinen „Daumen ins Licht“, Beginn einer assoziativen Metamorphose, „Ein Stammstück… Rinde, Wurzel und Blatt…“. Schließlich „erkennt“ der Dichter „in ihm / den Wald – / mein Gesicht“. Was in anderen Gedichten dieser Phase verdeckt arbeitet und in der Regel ohne Selbstironie, hier wird es als Trick, als „Kunststück“ dargeboten, was nichts anderes bedeuten kann, als daß Walter Werner inzwischen kritische Distanz zu einer poetischen Praxis gewonnen hat, der er nicht geringe Gewinne verdankt, die aber zur skurrilen Manier hätte werden können – es gibt vergleichbare und warnende Beispiele −, wenn sie allzu absolut gehandhabt worden wäre.
Schon in Das unstete Holz suchte Walter Werner mit Gedichten wie „Lämmerzeit“ oder „Im Zeichen absoluter Programmierung“, streckenweise schwer nachvollziehbaren Gedichten, tastete er nach Wegen, die bereits wieder über die gerade errungene Position hinauswiesen und die dann in Werners bisher letztem Gedichtband Worte für Holunder entschiedener gegangen wurden, ohne daß dies von der Literaturkritik und den Lyriker-Kollegen deutlich erkannt worden wäre; im allgemeinen wurde Worte für Holunder als ein Anhang oder Nachklang, womöglich sogar etwas weniger volltönender, zum Unsteten Holz begriffen, in keinem Fall, soweit dem Herausgeber bekannt, als ein Buch mit schon wieder anderen, zum Teil verblüffenden Zügen, bedingt zunächst durch die direktere Auseinandersetzung mit den besonderen Gefahren und Ängsten, die das Menschenbild spätestens seit Anfang der siebziger Jahre prüfen oder verzerren, (Dazu gehört auch für Walter Werner das Problem der möglich gewordenen gigantischen Selbstvergiftung der Erde, die mit dem Begriff „Umweltverschmutzung“ in diesem Augenblick eher verharmlost erscheint als markiert.) Vor allem mit solchen Momenten hängt es zusammen, wenn sich Walter Werners und seiner Lyrik tiefe Sorge bemächtigt hat – des „Dorfdichters“ mehr und schneidender und tiefer als manch eines anderen −, die die neuen und neuesten Gedichte dieses verantwortungsbewußten Mannes wenigstens partiell geradezu in desperaten Hohn umschlagen läßt und sporadisch in provokante – formal oft fast schnoddrig dargebotene – Skurrilitäten, (Darüber weiter unten einige Worte mehr.) Wie lange ist es eigentlich her, daß man fragte: Wie würde es sein, wenn sich Walter Werner nicht nur mit Bergen, Wäldern, Blumen identifizieren würde, sondern mit gleicher Intensität mit dem Menschenbruder etwa unter den Prüfungen der sein Wesen deformierenden konsumgesellschaftlichen Zwänge und des damit zusammenhängenden differenzierten und diffizilen Terrors (usw.), mit dem Menschen aber auch, der Widerstand dagegen leistet und weiterhin um ein Menschenbild kämpft, das dem der Negativ-Utopien unserer Zeit entgegengesetzt ist? Wie lange ist es her, daß man fragte: Was würde dann mit dieser Poesie geschehen? (Heute läßt sich die Antwort wenigstens als Palimpsest erkennen.) Wenn sich Walter Werner im Unsteten Holz den ihn umgebenden Menschen zuwendete, in durchaus gelungenen Gedichten übrigens, dann waren seine Helden in der Regel Menschen mit naturnahen, archaistisch anmutenden Berufen, die an der Peripherie selbst der dörflichen Gemeinschaft wirken, Dorfschuster, Bergschäfer oder Korbflechter, die sich, ist man geneigt zu sagen, jederzeit leicht in Pflanzenhaftes verwandeln lassen, wie es, partiell dem Korbflechter passiert:
Daß ich sitze, zufrieden
im tropfenden Gehölz.
Feucht, mein Bastelarm biegt sich
im Saftrausch, grün.
(Hinzu gesellen sich zu dieser Berufe-Serie in Worte für Holunder einige weniger periphere Zeitgenossen: der Zimmermann, der Milchfahrer, der Kleinstadt-Photograph usw.; eine ganze Galerie, von Band zu Band wachsend!)
5
Die gesellschaftliche Repräsentanz der neueren, aber auch der neuesten Gedichte Werners ist in vielen Fällen sicher nicht so offenkundig wie die früherer Arbeiten, als „die Bemühung des Dichters um künstlerische Reife“ weithin „identisch mit dem Kampf des Volkes“ war und als das Poem Sichtbar wird der Mensch auch die Züge eines Rechenschaftsberichts vor der Gesellschaft zeigte, die dem Dichter den Weg geebnet, vor den Genossen, die auf ihn gesetzt. Die Mehrzahl der Gedichte seit der Mitte der sechziger Jahre wirkt, als sei sie an Privatadressen gerichtet. Man kann – oder muß es sogar, um sie ganz verstehen zu können – diese Gedichte wie Briefe oder Postkarten lesen, die man von einem guten Bekannten erhält und in denen uns Mitteilung gemacht wird über dessen spezifische Welt, dessen Erlebnisse und Gedankengänge. (Es fragt sich, ob sehr viele Leser die Rolle eines „Empfängers von Briefen“ übernehmen wollen, die unbequemer ist als die vertraute, in der man lediglich „gut“ und „schlecht“ oder „falsch“ und „richtig“ zu sagen brauchte; übrigens scheint uns Walter Werner diesbezüglich ins Wort fallen zu wollen, wenn er einen seiner jüngsten und noch unveröffentlichten Gedicht-Versuche ausdrücklich „Briefgedicht“ nennt: ja, Briefe, ja, Privatbriefe, korrigiert er uns unbeabsichtigt, aber o f f e n e Privatbriefe:
Alle meine Briefe
tragen einen Stempel
auf der Marke,
fallen in Kästen,
fürchten sich in den Säcken
und gehen langsam
auf in den Falten.
Und: „Mein Briefgeheimnis sitzt / im trocknen Speichel / auf dem Kleberand.“) Doch möglicherweise, man erlaube uns die Spekulation, verraten uns diese Gedichte viel mehr über den Zustand unserer Gesellschaft, als es auf den ersten Blick erscheint. Sicher geben sie auf stille Art und zuweilen indirekt Auskunft über die in unserem Land so oder so sich verändernden Beziehungen der Menschen untereinander, drücken sich in ihnen Träume, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, Verzweiflungen in unserer Gesellschaft aus. Ist es ganz und gar zufällig, daß der Band Das unstete Holz in einer Zeit publiziert wurde, da in Reden und Schriften von Parteiführern und Staatsfunktionären immer häufiger die Vokabel „Vertrauen“ auftauchte? Walter Werner machte Ernst damit. Er vertraute: „Nur noch einander befragen / und nimmer sich lieben?“ Und der Frage entsprach die Aufforderung: „Der Mensch in allem deutlich!“ Das heißt paradoxerweise auch, daß Widersprüche offen bekundet werden und folglich Ungeklärtes, Undeutliches, wie zum Beispiel in dem Gedicht „Im Zeichen absoluter Programmierung“, einer komplizierten und ein wenig verworrenen Erörterung über die Aussichten der „wissenschaftlich-technischen Revolution“ einerseits unter sozialistischen, andererseits unter kapitalistischen Verhältnissen. Auch dieses Gedicht wirkt wie ein vertrauensvoller Brief, ein Brief voller Fragen, wie man ihn eigentlich nur einem Freund schicken kann. Auf welche Weise gerade solche nicht ganz gelungenen und problemübersättigten Gedichte ein Signal dafür waren, daß sich Walter Werner keineswegs resignierend in Landschaft und Natur zurückziehen, sondern weiterhin um intellektuell-ideologische Durchdringung der Weltläufte bemüht bleiben wollte, ist schon angedeutet worden. Dafür sprach (und spricht) aber auch nicht weniger der Sarkasmus, mit dem er nach wie vor provinzialistischer Heimattümelei begegnete (und begegnet). Wenn Walter Werner wirklich für einen Moment mit dem illusionären Gedanken einer „heilen Welt“ abseitiger Idylle gespielt haben sollte, dann war er selber es, der sich zurückgerufen hat, obgleich er den Weckruf (oder wie immer man es nennen will) in „Lämmerzeit“ einem „Irgendwer“ überträgt: „Irgendwer pfeift mir da schon den Hund / in den Hof, in mein h e i l e s Z u h a u se, (Hervorhebung A. E.) / auf daß ich wieder das Tote wie das Taube / und allen Glauben überwinden kann.“ Der Gedichttitel eines fast zwanzig Jahre jüngeren Autors fällt einem rasch ein, wenn man solche Haltung kennzeichnen will: „Provokation für mich.“ Volker Brauns früher Appell an sich selbst, etwas gravierend Neues im Vergleich zu der moralischen Selbstabrechnung der Generation von 1922, einer Abrechnung mit Jahren im Zeichen des Faschismus und des Krieges, die provokatorischen Selbstbeunruhigungen der Braunsehen Art, die einen bewahren wollen vor spießerhaftem und trägem Sich-Einrichten in den neuen Verhältnissen und die selbstverständlich auch „kritisch“ an die Allgemeinheit gerichtet sind. Gedichte dieser Wendung sind charakteristisch für eine bestimmte Aufbruchphase unserer zur Zeit als „Mittlere Generation“ begriffenen Lyriker, weniger für das Werk der Generationsgefährten Walter Werners; am ehesten findet man Vorformen solcher Gestik bei dem Paul Wiens der Mitte der fünfziger Jahre („Komm schneller nach im Gefühl!“). Tatsächlich erinnert der Weg Walter Werners über weite Strecken mehr an den Karl Mickels und Heinz Czechowskis, Sarah Kirschs und Volker Brauns – vor allem dank zuweilen geradezu sprunghafter Qualitätssteigerung und immer wieder überraschender Neuansätze – als an den Günther Deickes, Franz Fühmanns, Paul Wiens’ und andere, Autoren, die sich inzwischen stärker anderen Genres zugewandt haben, sieht man von Hanns Cibulka ab. So ist es kein Zufall, daß die poetische Plejade der um 1935 Geborenen neben Gerhard Wolf, den Werner seinen „eigentlichen… Regisseur“ nennt, gründlicher und häufiger um Verständnis für Walter Werners Produktion geworben hat als seine eigene; es sei auf Heinz Czechowskis Essay „Welt – unmittelbar“ (in dessen Band Spruch und Widerspruch) verwiesen, eine sympathisierende Auseinandersetzung mit der Poesie Werners und Wulf Kirstens, die dem Hallenser Czechowski auch deshalb nahestehen, weil sie mit ihm und dem Sorben Kito Lorenc innerhalb unserer neueren Lyrik so etwas wie eine besondere Gruppierung bilden, die man mit einem selbstironischen Wort Wulf Kirstens die der „Landschafter“ nennen könnte. Für einen Ausländer mag sie deutlicher erkennbar sein als für uns selbst – die wir zunächst eher die Unterschiede etwa zwischen Czechowski und Werner wahrnehmen als das Verbindende −; so spricht die Times Literary Supplement, und man ist im ersten Augenblick nicht wenig verblüfft, von den „Heimatgedichten“ Heinz Czechowskis, freilich als von Heimatgedichten hohen Ranges, „durch ein allgegenwärtiges Gefühl für die Vergangenheit vertieft“, und von „Czechowskis regionalen Ambitionen“ – charakterisierende Vokabeln, die ebenso auf Walter Werner gemünzt sein könnten, aber auch auf Kito Lorenc, der der sorbischen Lausitz verpflichtet ist, und Wulf Kirsten, für den das Vorgebirge um Freiberg zum Ausgangspunkt seiner lyrischen Expeditionen wurde.
In welchem Umfang Czechowski, Kirsten, Lorenc, Werner und einige andere der Verwandtschaft ihrer Intentionen bewußt sind, läßt sich nicht nur aus Gesprächen erfahren – es ließe sich darlegen auch anhand eines umfangreichen Briefwechsels zwischen diesen Autoren. Mit Kito Lorenc verbindet den thüringischen Lyriker außerdem der plötzliche Ausbruch ins Phantastische, Skurrile, Verspielte, bei beiden Dichtern fast gleichzeitig um 1970 und in diesem Fall allerdings ohne direkte Korrespondenz vollzogen; doch gab es in dieser Richtung die Vorleistung des 1969 gestorbenen Uwe Greßmann, die von Lorenc wie Werner zumindest beobachtet worden ist, worauf Werner sogar ausdrücklich anspielt, wenn er dem Greßmannschen „Vogel Frühling“ einen „seltsamen Gast Frühling“ folgen läßt. Mit Kito Lorenc’ spielerischer, zwischen Heiter und Böse schwingender Phantastik war Anfang der siebziger Jahre nichtsdestotrotz eine völlig neue, mit nichts anderem zu vergleichende Farbe in die Lyrik der DDR gekommen, die sich zum erstenmal in der Sportanthologie Olympische Spiele intensiv ankündigte:
An einem schönbemalten Sonntag
spielten die Metaphern gegen die Vergleiche
ein Gedicht von einem Spiel…
Von ähnlicher sprachlicher Heiterkeit und neu gewonnener thematischer Liberalität sind nun auch manche der 1974 in Worte für Holunder vorgelegten Arbeiten Walter Werners („Sie sind wie ungehörte Atemzüge, / die sich aus abgeschnittnen Zeilen stehlen, / wie unterbrochene Scheibenwischer…“, liest man in einem Gedicht über „Die vorgeschriebenen Redezeiten“); gleichzeitig signalisieren sie hier und da, mit ihrer Verbeultheit und geplanten formalen Schußlichkeit in die Nähe absurder Literaturtechniken geratend („Weg nach Volksberathes“), mancherlei moralisch-psychische Beunruhigung, die sich vorderhand nur mit Hilfe von Clownerien aus der Affäre zu ziehen vermag: zum Beispiel durch Betonung der Tapsigkeit, vielleicht sogar hier und da der Hilflosigkeit. (Gedichte dieser Art wird man vor allem in den letzten beiden Abteilungen unserer Auswahl finden.)
6
Das durchschnittliche ästhetische Niveau unserer Dichtung hat sich in der zweiten Hälfte der sechziger und in den siebziger Jahren beträchtlich erhöht; nur am Rande: auch das Publikum ist von dieser Entwicklung vor neue Probleme gestellt worden, die von ihm gleichsam neue und durchdringendere Augen erheischt, Wenn man die gegenwärtige literarische Landschaft überblickt, wird einem bald die Gefahr bewußt, Walter Werners Fortschritt möchte in fortgeschrittener Umgebung nicht recht bemerkt werden. (Die Massenmedien, doch auch Schullesebücher oder Anthologien vernachlässigen den weit von den Zentren unseres Landes lebenden Dichter nicht selten oder räumen ihm zumindest nicht immer den Platz ein, der ihm gebührt.) Walter Werners Leistung sollte jedoch schon allein deshalb mehr Aufmerksamkeit finden, weil er der einzige wichtige Lyriker der DDR ist, der seine Selbstentdeckung wie seine Entwicklung als Poet von Anfang an und entscheidend den auf Arbeiter und Bauern orientierten Förderungsmaßnahmen in unserem Lande verdankt, sieht man davon ab, daß er sie natürlich auch sich selbst verdankt, dem „schreibenden Arbeiter“ – in seinem Buch Grenzlandschaft schlüpft er nicht zufällig in die Rolle eines Waldarbeiters −, der gefunden und gefördert wurde, noch ehe es die „Bewegung schreibender Arbeiter“ gab. Im Gegensatz zu ihm hatten alle anderen bekannteren Lyriker der Jahrgänge 1920 bis 1922 bereits vor dem Zusammenbruch des Nazireichs abseits der offiziellen Kulturbarbarei gravierende Kunsterlebnisse auf sich wirken lassen können. Franz Fühmann wies zum Beispiel vor einer Weile in einem Radio-Interview darauf hin, daß gegen Ende des Krieges unter anderem die Begegnung mit der Poesie Georg Trakls seinem weiteren Lebensweg eine andere Richtung gegeben habe. (Dem entspricht es, wenn in einer der Erzählungen des Fühmannschen Bandes Das Judenauto dem Ich-Erzähler bei B e g i n n des Überfalls auf die Sowjetunion Georg Heyms prophetisches Gedicht „Der Krieg“ in den Sinn kommt: „Aufgestanden ist er, welcher lange schlief…“) Aus Günther Deickes Tagebuch-Lyrik-Kombination „Du und dein Land und die Liebe“ ist ein frühes Verhältnis zur deutschen Romantik und zum Volkslied in romantischer Rezeption abzulesen. In Hanns Cibulkas Sizilianischem Tagebuch aus dem Jahre 1945 findet sich neben zahlreichen Hinweisen auf einen sicheren Fundus humanistischer Bildung der charakteristische Satz – ein Satz, der den selbstverständlichen Umgang mit Kunst und Literatur voraussetzt −:
Jeden Morgen sitze ich am Fenster, nehme meinen Homer aus der Tasche und beginne zu lesen.
Von Paul Wiens haben wir unter anderem den Hinweis auf Hölderlin; man weiß zudem, daß Stefan George für den jungen Wiens eine Rolle gespielt hat, Wiens, Deicke, Fühmann, Cibulka, auch Gottfried Unterdörfer – wir sehen sie alle, ganz anders als Walter Werner, mit einem schon ordentlich angewachsenen Gepäck an künstlerischer Bildung auf den Straßen des Anfangs nach dem Kriege; die kritische Prüfung des Überlieferten wurde für sie alle auf kürzere oder längere Zeit zum Stimulans ihrer weiteren Entwicklung.
Walter Werner wurde während seiner Jugend im wesentlichen wohl mit der Hitlerjugend-„Lyrik“ der Anacker und Baldur von Schirach und sonstiger obligatorischer Schullektüre abgespeist. „Die Schule“, berichtet Walter Werner unter anderem in einem Interview, „setzte und legte die Grenze für die Kunst in einmaligen Begegnungen, insbesondere der Klassik, mit Schillers ,Glocke‘ und Goethes ,Erlkönig‘ fest.“ Und er fährt fort:
Die geistige Geburt aber vollzog sich erst 1945.
Und Walter Werner nennt seIber die „veränderten Bedingungen unserer gesellschaftlichen Praxis“ als „Ursachen“ seiner poetischen Aktivität. (Viele Jahre nach dieser Auskunft beschreibt Walter Werner in Grenzlandschaft weitere, gleichsam außerschulische „Bildungserlebnisse“, wie sie in der Nazizeit auch Menschen seiner Herkunft zuteil werden konnten: so das vom Stammführer der Hitlerjugend „szenisch spannend“ erzählte Nibelungenlied samt weihespielartigem Hin- und Gegenruf zwischen Stammführer und Pimpfen: ,Nibelungen!‘, schrie der Stammführer wie entfesselt, und wir antworteten: ,Deutsche Treue!‘ – ,Nibelungen!‘, wiederholte Gernot, ,Deutsche Tapferkeit!‘, war unsere Antwort. Und ,Nibelungen!‘ zum drittenmal. ,Deutsch bis in den Tod!‘, schallte es…“) Auf jeden Fall mußte in den Jahren nach dem Krieg von Werner vieles, was andere längst wieder abgestoßen hatten, gleichsam nachholend entdeckt werden. Das Erlebnis Trakl zum Beispiel, von dem Fühmann schon vor Kriegsende getroffen wurde, wird vom gleichaltrigen Walter Werner fünfzehn Jahre später am Institut für Literatur nachvollzogen und selbstverständlich sofort zur kritischen Auseinandersetzung erweitert: „Problematisches zur Dichtung Georg Trakls für den sozialistischen Schriftsteller…“ – Aus der Unbeholfenheit der Überschrift mag man auf die Mühsal schließen, der sich Walter Werner hingab, die ihm in den Jahren 1956 bis 1959 abverlangt wurde. Wenn Bräunig anläßlich des Poems Sichtbar wird der Mensch davon spricht, daß in ihm die „Auseinandersetzung mit der deutschen Dichtung und der Weltliteratur… spürbar“ wird, dann ist das auch ein Hinweis auf die Arbeit des Instituts für Literatur, dem Walter Werner mehr verdankt als mancher andere, aber auch mehr als mancher andere gedankt hat mit Qualität und Konsequenz seiner Leistung. (Die beiden Jahrbücher Ruf in den Tag, die das Institut 1960 und 1962 herausgab, geben einen Eindruck von dem literarischen Umfeld, in dem er sich damals bewegte und aus dem er herauswuchs: mit weitem Abstand erscheint als Hauptbeiträger der beiden umfangreichen Bücher Helmut Preißler, mit jeweils ungefähr dem gleichen Gewicht treten dann Autoren wie Horst Salomon, Werner Lindemann und eben Walter Werner in Erscheinung; ihnen folgen in kleinerem oder größerem Abstand mit ihren Gedichten Kurt Steiniger, Klaus Wolf, Erich Köhler – als etwas hilfloser Lyriker der wichtige Prosaist −, Martha Weber, Heinz Czechowski, Karl-Heinz Tuschel, Herbert Friedrich, Werner Bräunig, Hermann Otto-Lauterbach, Klaus Steinhaußen, Dagmar Zipprich, Werner Kruse, Jupp Müller.)
Fest auf die eigenen Füße gestellt, wie bereits ausgeführt, hat sich Walter Werner schließlich mit dem Band Das unstete Holz, der im wesentlichen ein halbes Jahrzehnt (und später) nach seiner Institutszeit entstanden ist, ein Jahrzehnt nach ihr erschien. Die Angst, versagen zu können, die früher manche Instabilität seines Gedichts hervorgerufen hatte, war geschwunden. Die Welt eines gereiften Mannes, eines „Erwachsenen“ war es, die die neuen Gedichte vermittelten. Walter Werner hätte einen solchen Weg auch ohne die Begegnung mit dem Werk Johannes Bobrowskis gefunden, das im Unsteten Holz zweifellos auf die Wernersche Diktion abgefärbt hat. Gewiß hat diese Begegnung manche Entscheidung beschleunigt, bei Walter Werner wie bei Sarah Kirsch, Kito Lorene, Wulf Kirsten und anderen. Da ringsum die Begriffe Lyrik und Jugend als Synonyme gebraucht wurden, bedurfte es womöglich eines ermutigenden Anstoßes, wenn ein Erwachsener Lyrik für Erwachsene schreiben wollte (Aus einem Gespräch, das wir vor einigen Jahren mit Walter Werner in seinein Heimatort hatten, wissen wir, daß es Schwierigkeiten dieser Art waren, die er mit dem Unsteten Holz endlich überwunden zu haben glaubte.). Aber Walter Werner ist wie die anderen von uns genannten Autoren weitergegangen und wird heute mit Recht von kaum jemandem zu der Bobrowski-Schule gerechnet, wie sie hier und da bei Christ und Atheist immer noch floriert. Sicher ist auch diese bislang letzte Wegstrecke nicht ohne Mühsal absolviert worden. „Wieviel Stürze, wieviel zerbrochene Flügel!“, heißt es in den Versen „Sprungschanze hinter meinem Dorf“, die zunächst nur die genaue poetische Beschreibung eines relativ begrenzten Erlebnisses zu bieten scheinen, um sich dann aber als ein Sinnbild für das ganze Leben der Menschen zu entpuppen, weit gefaßte Symbolik: „Wer aber zählt ihre großartigen Siege?“ Frage, die ermahnt, nicht nur die Augenblicke des Scheiterns wahrzunehmen…
Zu unserer Auswahl: Der Herausgeber hat sich dafür entschieden, auf eine zunächst geplante chronologische Anordnung der Gedichte Walter Werners zu verzichten, die dem Weg des Dichters Stufe für Stufe folgen sollte. – Statt dessen hat er fünf große Abteilungen zusammengestellt, die man vielleicht als fünf verschieden angesetzte Schnitte durch das Gesamtwerk begreifen kann. Jede dieser Gruppen orientiert sich mehr oder weniger an einer bestimmten Arbeitshaltung bzw. Arbeitsbewegung Werners, die natürlich häufig ineinander- und miteinanderwirken: die Grenzen zwischen den Gruppen bleiben fließend. So schlägt sich im vorliegenden Band ein großer Bogen von der ästhetisch-moralischen Positionsbestimmung des Autors („Am Schleifstein“) über die verschiedenen Versuche poetischer Aneignung der geographisch bestimmbaren Welt, der Heimat und der Fremde („Auf dem Hochsitz“, „Der Chausseegraben“), über Erinnerungsbemühungen, der Jugend, der Kindheit, der Herkunft gewidmet, bis zu den poetischen Scharmützeln und Scherzen, Exzentrischem und Experimentellem der letzten Zeit („Laterna magika“). Daß in der Abteilung „Topf aus Ton“ Allerfrühestes von Walter Werner und Späteres in provokant schroffer Weise gegeneinandergestellt ist, wird der Leser unschwer erkennen.
Adolf Endler, Nachwort, Dezember 1977
Walter Werner,
1922 in Vachdorf (Thüringen) geboren, trat seit den fünfziger Jahren mit einer stattlichen Reihe von Lyrikbüchern hervor. Aus ihnen wird im vorliegenden Bändchen Bilanz gezogen.
Walter Werner hat sich viel von jener Ursprünglichkeit bewahrt oder wiedergewonnen, die eine Voraussetzung aller Poesie ist. Die Wurzel wurde eine seiner charakteristischsten Metaphern. Den Dichter zu umschreiben, braucht man Adjektive wie redlich, lauter, authentisch, freundlich, humorvoll, hintergründig, mitunter weise. Fern von Heimattümelei nutzt er thüringische Natur und Landschaft als archimedischen Punkt, um die Welt poetisch aus den Angeln zu heben, in „Strophen, / die sich maßlos vergnügen / und taktvoll verwehren…“
Manche der Texte, vergleichsweise still und intim, sind wie Briefe an gute Bekannte, voll Vertrauen und voller Fragen. Mit anderen unternimmt er reizvolle Ausflüge ins Skurrile, Clowneske, schickt die Phantasie zu Erkundungen aus, neugierig auf die verführerischen Gedanken der Schmetterlinge.
Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, Klappentext, 1982
Notiz zu Walter Werner
In der Tat, welche – von Endler (im Nachwort zu Werners Gedichtband Die verführerischen Gedanken der Schmetterlinge) vermerkte – Entwicklung!
1958: „Der Holzfäller“.
Der schlägt – in dem kurzen Gedicht – einen enormen Bogen. Zwischen den Wurzeln hielt mich die Zeit, heißt es eingangs, und nach neun Versen ist der Gebeutelte Gott, der dumpfe Dulder Weltenmacher: Zwischen den Wurzeln halt ich die Zeit. Alsbald folgt gar die schwerlich zu übergipfelnde (überwipfelnde) Geste So wink ich mit dem Wald mir / die Welt / (…) heran.
Mich hielt die Zeit ➛ ich halt die Zeit: Wie ist dieser, wie gesagt, enorme Vorgang beglaubigt? Gar nicht.
Ich hackte dem Gras die Späne ins Blatt,
und das Sägemehl, meiner Hände Schnee,
fiel zurück in den erdigen Grund.
Studiert hab ich sechzig Semester Wetter und Luft.
In der Schule des Windbruchs gab’s kein Examen.
Die Vögel warfen ihre Lieder herab,
bis die Träume der Menschen zu mir kamen.
Mancherlei Register sind gezogen; doch zu hastig, als daß mir die Töne eingingen. Das schöne Bild meiner Hände Schnee verliert sich im eilfertig beigebrachten Biografischen, das seinerseits rasch in Ungriffiges abdriftet (Wetter und Luft [?], die examenlose Schule des Windbruchs). Natur, so wird behauptet, arbeitet zielstrebig darauf hin (Vögel werfen [?] Lieder), die Träume der Menschen (welche?) nahezubringen. Mir kommen Zweifel an diesem Satz und so auch am folgenden, eben jenem halt ich die Zeit. Weit oben baumelt der, grundlos, als These. Das Gedicht ist gezeichnet von der sympathischen Hybris, die so manchen Text jener Jahre blähte (und mittlerweile nostalgischen Neid weckt).
Acht Jahre später: „Holzhacken“, ein Gedicht von kraftvoller Gelassenheit; seine Energie bezieht es aus dem genau benannten Vorgang.
(…) Das Beil
treib ich an.
Mein Beil kreist mich ein.
Ich stoß seine Flugbahn voraus
und kehr seine Fall-Linie um.
Beiltreibend, beilgetrieben – der Mann ist, vermittels der (wie es im Text weiter heißt) die Welt einräum(enden) Arbeit mit dem Werkzeug auf einen Nenner gebracht. Und so überrascht es nicht, wenn nicht er, sondern sein Beil es ist, dessen Rede wir vernehmen: findig und zäh, ortsderb.
Freilich geht von solch durchweg heiler Darstellung der Arbeit rosigste Behaglichkeit; sie muß Werner irritiert haben. Welteinräumung geschieht, ja. Doch durch Welt-Ausräumung. Das Gedicht „Meine Bäume“, 1968 geschrieben, sieht denn auch fröstelnd Schlagbäume: sie waren einst Bäume, Waldung, der Luftsee schiefe Schaukel, die unauflösliche Signale gibt.
1971: „Barlach öffnet das Holz“, ohne das Durchkosten und Durchmachen jener Erfahrungen, die sich in „Holzhacken“ und „Meine Bäume“ aussprechen, nicht denkbar und mehr als eine Mitte. Der Schnitte ins Holz (aber solcher, die das Ganze meinen, die zur Erde gehen) bedarf es – so ist nun gedeutet – ebenso wie des Holzes unauflöslicher Signale. (Das Gedicht selber ist bis ins Letzte nicht aufzulösen, scheint mir.) Die Spuren (die Barlach, oder Werner, oder der Mensch hinterläßt) machen, daß die verirrten Körper der Kinder zu fragen beginnen, und
die Arme der Armen
finden ins Leben.
Doch diese Spuren sinken aus Bäumen, sie untergraben sie auch. Und:
Wo der Wald vor der Welt nachläßt,
ist (…) der Mond
von den Schultern gehoben.
Wenn es schließlich heißt:
Im Holz erholt sich das All,
so scheint mir Wald gemeint, der nicht nachläßt zu sein, s o w i e behutsam gestiftete Spur. Als kostbare Ahnung scheint vermenschlichte Natur auf und von Türmen aus Fleisch und Knochen nicht versehrte, natürliche Menschheit.
„Barlach…“ und „Tagsüber eine Katze“, jenes hoffnungsvolle Geweb über abhandengehender Roheit (doch das Leben: es geht auch dahin) – vielleicht Werners bleibendste Gedichte. Durch sie hindurch sein wundervolles Gesicht; die Warmherzigkeit in Person.
Peter Gosse, in Peter Gosse: Mundwerk. Essays, Mitteldeutscher Verlag, 1983
Die Dinge der Natur
Naturlyrik gilt heute als Domäne der bürgerlichen Literatur. Seit die sozialistische Lyrik der fünfziger Jahre „Humanisierung der Natur“ so weit geführt hatte, daß sie die Grundsituation der Trennung von Natur und Gesellschaft für sich aufheben konnte, ging die Geschichte der Naturlyrik zu Ende. – Oder doch nur ein Abschnitt dieser Geschichte? „Was der Dichter von seinem Verhältnis zur Natur sagt, sagt er von der Gesellschaftsordnung, in der er lebt. Damit geht die sogenannte moderne Naturlyrik ihrem Ende entgegen, und es beginnt die Moderne“, schreibt Georg Maurer. Im gleichen Aufsatz heißt es aber auch:
Durch Einsichten in den Marxismus gewinnen vom Modernismus diffamierte poetische Mittel Leben.
(„Gedanken zur Naturlyrik“, 1971)
War Natur für die Lyrik nicht mehr gewesen als nur ein Abseits vom gesellschaftlichen Leben, als das sie nun nicht mehr geduldet war? Konnte sie nicht vormals höchst bedeutend auf die Zustände der Gesellschaft weisen und als Medium von Aussagen dienen, die den Kern des gesellschaftlichen Lebens trafen? Walter Werners Gedichte geben Anlaß zu diesen Fragen. Denn sie scheinen mir ein Beispiel für eine andere Naturlyrik, die nicht aus der Nachkommenschaft der empfindsamen und weltflüchtigen Naturpoesie stammt. Der Autor verwendet die Sprache einer Gattung, um eigentümliche Erfahrungen dieser Zeit auszusprechen. Sein Thema ist nicht Natur allein, sondern die natürliche Welt in den Gedichten trägt Mitteilungen über menschliche Verhältnisse aller Art.
Der Reclam-Verlag hat eine Auswahl vorgelegt, die Gedichte Walter Werners aus drei Jahrzehnten enthält. Die Auswahl begleitet damit auch den gesamten Zeitraum der Entwicklung der Lyrik in der DDR. Obwohl nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet, zeichnet die Auswahl mit dem Wandel der lyrischen Sprache und mit charakteristischen Einschnitten diese Entwicklung nach. Auswahl und Anordnung wurden von Adolf Endler vorgenommen. In seinem Nachwort stellt er Walter Werner als einen Gefährten der mittleren Generation unserer Lyrik dar und mißt dessen Weg an ihrem Fortschreiten. Dagegen zeigt der Band auch, daß Walter Werner auf eine eigenwillige Weise seinem Elbteil, der Beziehung zu einer bestimmten Landschaft, treu blieb. Aus diesem hat er sein eigenes System von Bildern und Zeichen, Bedeutungen schließlich hervorgebracht. Was damit nicht zu fassen war, blieb aus der Lyrik Werners fort. Aber das wechselhafte Vordringen von Themen und Motiven in der Phase des Erprobens hat ihn auch fast unbeeinflußt gelassen. Wenn Werner auch zu allen deutschsprachigen Lyrikern, die die Gattung Naturlyrik als Ausdrucksmittel benutzten und veränderten, Beziehungen aufnimmt, so ist er doch in unserer Lyrik ein Alleingehender.
Nur in den frühsten Gedichten findet man Werners Sprache noch im Banne anderer Lyriker, im Banne auch fertiger Aussagen. Das Gedicht „Der Fluß“ (1957) trägt die Spuren einer angenommenen Sprache, die daraus folgt. Der Autor verhält sich beschreibend zum Gegenstand. Zwischen ihm und dem Fluß besteht ein ungewollter Abstand, der aus der Unbewegtheit der Beziehung herrührt. Der Fluß bedeutet nicht mehr, als sich in seiner dinglichen Eigenschaft darstellt. Aus der freundlichen Heimat der Berge kommend, fügt er sich ins nützliche Schaffen, das die offene Landschaft beherrscht. Kein Spiel mit einem „Hinter den Bergen“ hält den zweckmäßigen Lauf von Fluß und Gedicht auf. Auch von dem Bedürfnis nach gelegentlich schützender Stätte, die das Gedicht „Refugium“ später ausbreitet, ist hier noch keine Vorahnung. Eine Eintracht zwischen Menschen und Natur wie hier wird es später nicht mehr geben. Denn ohne Einverständnis sieht Werners Gedicht schon Mitte der sechziger Jahre die unbedenkliche Nutzung von Natur, die Dominanz des falsch verstandenen Ökonomischen überhaupt in der Beziehung zu Natur an:
Und derweil ich
bis zur absoluten Wahrheit
noch immer den jüngsten Verzicht
und den letzten Betrug mitnehmen muß,
nimmt’s ab das Geheimnis, geht’s
aufwärts mit der angewandten Natur.
(„Aus der Beichte eines gewissen Sisyphus“, 1966).
In diesen polemischen Äußerungen findet man aber nicht, was Landschaft und Natur für Werners Lyrik wirklich bedeuten. Ironisch verfahrende Texte sind immer wieder eingestreut. Sie verhalten sich wie Kommentare zu den übrigen Gedichten. Der Prosa recht nah, bewahren sie doch auch die unkundigen Leser vor dem Irrtum, daß die Sprache der Naturlyrik einer unverbindlichen und gemütvollen Weltsicht dient. Schon zu Beginn der sechziger Jahre findet man in Werners Gedichten Stellen, wo Mensch und Dinge so miteinander verschmelzen, das nicht mehr von Natur geredet wird, wohl aber durch Natur. Nicht ohne Anstrengung wird die Sprechweise gefunden:
Bäume, Wald. Da tauch’ ich ein
mit dem Schluß der guten Eroberungen:
Liebe zum Holz, die wieder erholsam ist.
Ich kämpf’ mit Wettern.
Schlafe mit nassen Tieren.
Und in den Lüften kann ich liegen
stundenlang, den Mund voll Licht.
Fata, schlagen ihr Zeichen die Fische.
Morgana, brauen ihre Nebel die Flüsse.
(„Unterbrochenes Selbstporträt“, 1961).
Noch – eignet sich die poetische Sprache ihre Nähe zu den natürlichen Dingen fast gewaltsam an. Auch ist sie mit dieser Annäherung und also mit sich selbst beschäftigt, so daß zunächst Beziehung zur Natur wenig darüberhinaus mitteilt. Wird diese Nähe im Vergleich hergestellt, dann muß das Menschliche in Vegetatives hinein geholt werden:
Der Gärtner lebt wie die Pflanze
in seiner feuchtwarmen Welt,
(„Der Dorfgärtner“, 1964).
Dieser Zug zur Rückverwandlung, Mensch wird Pflanze, stellt sich als sicher unerwünschte Eigenmächtigkeit der Bildsprache ein. Ähnlich wie in Fürnbergs Gedicht „Epilog“ bringt die Sprache, die sich der Natur anvertrauen will, zuweilen die Naturhaftigkeit des Jugendstils hervor:
Da droben wird der Frühling
ein Fluß aus buntem Glas, drunten
streut er sich der Erde Salz
auf den leicht gewordenen Schuh.
(„Werrafrühling“, 1962).
Auch das Gefällige in Bildern von Pflanzen und Tieren wurde gestreift:
Nichts von dem blassen,
bleichen Winter
ist bei dir geblieben.
Nur das kleine, gebogene
Weiß. Ein Windlicht,
das bald die Hände
des Frühlings
verspielen
(„Schneeglöckchen“, 1965).
Sobald aber die Als-ob-Redeweise abgestreift, einfache Personifikation als Verfahren abgetan war, konnte die Naturwelt gebraucht werden wie ein empfindliches Instrument. Nun taugen freilich nicht so große Gegenstände wie die Flüsse, welche von ihrem Ursprung her dem unabänderlichen Ziel ihrer Bestimmung zugehen. Obwohl Werner sich auch auf Hölderlin bezieht, bei ihm auch ein sprechendes Eigenleben der Flüsse, Gestirne vorfindet, ist die weitreichende Gebärde und der geschichts-philosophische Anspruch der Sprache dieses Dichters seine Sache nicht. Er vermeidet, was die heroisch-pathetischen Landschaften anklingen lassen könnte. „Waldwege“, die „Wie unentbehrliche Flüsse, / die fortgehn / und wiederkommen,“ (1962) oder der „Waldbach“, der „die stumme Sprache der Bewegung“ übt (1972) oder der kaum ziehende Fluß an der „Alten Werrabrücke“ (1974) sind nun die Linien der Landschaft. Sie fassen eine Natur ein, die für sich selbst da ist, dem Menschen nicht entgegenkommt, noch nutzbar ist, wenn nicht gestalthafte Wahrnehmung und das ästhetische Spiel als nützlich gelten können.
Wenn in Werners Gedichten das Ich mit den Dingen verschmilzt, sich im wachsenden Holz erkennt oder im vergänglichen Augenblick eines Sommernachmittags sich der Empfindung des Daseins hingibt, so bedeutet das nicht dauerhafte Eintracht zwischen den Menschen und der Natur. Naive Naturlyrik kann es unter unseren Bedingungen des Produzierens und Lebens nicht mehr geben. Es sei denn, Lyrik bewegt sich auf dem schmalen Grat philosophischer Vorwegnahme oder täuscht sich über ihre Voraussetzungen hinweg. Eine Lyrik wie die Werners darf sentimentalisch genannt werden, sie muß die volle Übereinstimmung immer suchen. Wo sie aber erreicht ist, darf sie nicht anders als flüchtig und für den Augenblick bestehen. Die dargestellte Eintracht ist eigentlich der Wunsch danach oder die menschliche Unruhe in einem sich befestigenden Zustand. Es gibt keinen Anlaß zu vermuten, daß der Autor sich in dem Gedicht „Romantiker“ (1972) aus der Rede zurückgezogen hat, wo es heißt:
Landschaft richte ich auf,
ihren geselligen Luxus…
In dieser Landschaft, die sich selbst als Artefact zu erkennen gibt, findet ein „heiteres Kunststück“ statt, die Vereinigung mit Natürlichem, die keine Einheit ist:
Aus meinem Armschwung wechselt das Wild
und an die Erde verschrieben,
mit Federn, komme ich wieder.
Ein einprägsames Bild der Nähe ohne Dauer sind die Schmetterlinge in Werners Gedichten. Im Gedicht „Feuerfalter“ (1969) ziehen sich Betrachter und Betrachtetes auf eigentümliche Weise an. Die Schönheit des Falters verbirgt nicht, wie sehr sie der Vergänglichkeit ausgesetzt ist, sondern bringt dies zum Vorschein. Der Betrachter, welcher in dieser Bedingung von Schönheit ihre einzige Möglichkeit für sich begreift, macht aus dem Bild des Schmetterlings ein Selbstbildnis. In der schmerzhaften und bedeutungsvollen Situation, die eigentlich nur auf eine einzige Wahrnehmung beschränkt ist, sich aber als Selbstempfindung überaus verlängert, findet sentimentalisches Weltverhältnis seine genaue bildliche Entsprechung. Zwei Halbverse aus dem Gedicht „Kahlschlag“ (1969) sind als Titel über die Auswahl gesetzt worden: Die verführerischen Gedanken der Schmetterlinge. Der Kahlschlag, er mag noch so zweckmäßig sein, bricht in die Naturbeziehung ein wie die Enttäuschung ins Liebesgedicht. Sein Anblick läßt sich ertragen im Vergessen, das die Schmetterlinge vorzuspielen scheinen: „Liebe im Vergessen“. Wo immer sie stattfindet, schließt sie beides ein; die Übereinstimmung lebt vom Vergessen. Dafür sind Schmetterlinge die Sinnbilder. Dieses Siegel des flüchtigen Augenblicks ist die Voraussetzung für eine Naturlyrik, die nicht in rückwärts schauende Idylle verfallen will, sich aber auch nicht naturhaft der Natur anheimgeben kann.
Dem Verständnis des zeitgenössischen Naturgedichts steht hemmend der verbreitete Fluchtverdacht entgegen. Aber in Werners Gedichten sind Natur und Landschaften nicht Orte des Rückzugs vor der Zeit. Wendung zur Natur ist nur dann Abwendung von der Gesellschaft, wenn damit der Rückzug des Individuums auf eine Innerlichkeit, die frei von Verantwortung und Verbindlichkeit ist, einhergeht. Werners Waldstücke haben aber nichts von Eichendorffs Scheidung zwischen Welt und Wald. In seine Wälder ist mit der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten unsere Geschichte eingetragen. „Im Sperrgebiet“, „Grenzlandschaft Grabfeld“ und „Waldwege“ nehmen diese Grenze als Notwendigkeit an, gleichzeitig lassen die Landschaften Trauer darüber verspüren. Werners Dörfer und versunkene Plätze sind kein Abseits. Immer wird ja der „Ton der aufgeregten Zeit“ in sie hineingetragen. Im Reden und Schweigen der Toten, im Gedächtnis und der Vergeßlichkeit der Dinge scheint die Geschichte auf. In diesen Gedichten will die Sprache der Dinge nicht als Ausdruck von persönlichen Empfindungen verstanden sein.
Regen kommt über mein Gedächtnis.
Ohne Wasser ist das Dorf
und eine rostig Reuse
aus Laub der Teich.
(„Amselbrunn“, 1965).
In solchen Zeilen hat man Trakl (die Entpersönlichung des Ich durch die Syntax) und Celan (die Verfremdung des Gegenständlichen in der Metaphorik) wiederzuerkennen. Die Anklänge zeigen an, daß die Dinge im Gedicht nicht allein von der subjektiven Wahrnehmung eines Ich geformt sind und das Licht, in welchem sie erscheinen, nicht nur Wiederschein subjektiver Stimmung ist. Geschichte der Landschaft, aber auch die Geschichte der Gattung und ihrer Sprache sind in Werners Auffassung der Dingwelt eingegangen. Auch wenn das Gedicht sich dem einzelnen Gegenstand zuwendet, läuft es dadurch nicht Gefahr, daß es sich „des Einzelnen durch Aufsuchen von Einzelheiten entledigt“, wie Karl Krolow den entsprechenden Vorgang beschreibt. Jedoch würde ich mich scheuen, von einer gegenständlichen Poesie zu sprechen. Auch in Gedichten wie „Der Schlehdorn“ (1960), „Schierling“ (1962), „Himbeerpflücken“ (1971), „Herbstblatt“ (1969) oder „Zwetschenbäume“ (1965), deren Titel schon anzeigen, daß hier die Dinge selbst gemeint sind als Objekte der Wahrnehmung und der Gefühle, sind die Naturgegenstände vorwiegend als Zeichen einer Sprache behandelt.
Der Begriff der natürlichen Dinge muß hier nicht eng gefaßt werden. In ihrer poetischen Qualität sind Pflanzen und Tiere nicht verschieden von alltäglichem Gerät und traditionell in die Landschaft gehörenden Bauten. „Meine Bäume“ (1968) geht der Scheidelinie nach, an der die Möglichkeit menschlicher Beziehung zu den Dingen von der Versachlichung abgelöst wird.
Zur Hälfte geborsten
und von Halbheit bedrückt,
schweigen die Chausseen
ihre erloschenen Stämme hinauf.
Schlagbäume, die Wipfel genommen,
von den Wurzeln geschlagen;
können nicht rauschen
und nicht schlafen.
Fünfzehn Jahre früher hatte Brecht die Rolle geschichtlicher Erfahrung in der Wahrnehmung der natürlichen Dinge geltend gemacht. Auch er schreibt über Bäume:
So sah ich sie
Vor einem halben Jahrhundert
Vor zwei Weltkriegen
Mit jungen Augen
(„Buckower Elegien“).
Brecht gehört nicht zu den eigentlichen Vorbildern Werners. Aber diese Wahrnehmung von Natur mit den Augen eines Menschen, der seine geschichtlichen Erfahrungen nicht verleugnet, setzt er fort. Das Einbringen der Zeit als eigene und geschichtliche Zeit ins Verhältnis zur Natur überschreitet auch die Wahrnehmungsweise in der bürgerlichen Naturlyrik und trennt von dieser, selbst wo die wahrgenommene Natur die gleiche ist.
Von selbst, gleichsam als mechanische Folge weltanschaulicher Haltungen, stellte sich diese Aussagekraft des Naturgedichts nicht her. Bei Werner bleibt es manchmal allein der sprachlichen Assoziation, dem Wortspiel überlassen, Bezug auf Zeit und Gegenwart herzustellen, „Herbstblatt“ etwa (1969), das von Blättern über das Kalenderblatt zum „kleine(n) Glück von Ansichtskarten / Sprechzeiten und Gedenktagen“ gelangt. Auch in der Sprachvermischung, wie sie „Im letzten Quartal“ (1968) aufweist, nimmt der Autor den Ernst des Naturgedichts schließlich der anspielenden Bezüglichkeit zuliebe doch zurück. Manchmal dagegen ist der Bezug auf bestimmte, also gesellschaftliche Erlebnis- und Fühlweisen allzu zart, Andeutung nur wie in den folgenden Zeilen:
So gehst du alle Wege zurück,
bis du im Schreiten mit deinen Schuhen
die verbliebenen Geheimnisse
der Erde wachklopfst
und deine schmale Spur
Abend für Abend zu reden beginnt.
(„Spazierengehn“, 1962).
Unsere Ohren sind aber auch nicht empfindlich für eine Sprache wie diese. Vielleicht hat Werner auch deshalb auf die deutlichen, die satirischen Gedichte und Gleichnisse nicht verzichten mögen. Darin ist die moderne Welt vor allem stofflich und sachlich mit ihren technischen Fortschritten und ihrem Rationalismus der Zweckmäßigkeit anwesend. Gegen sie wendet sich der Autor, wie es der Naturlyriker auch muß. Denn er macht einen anderen Teil aller Bedürfnisse und Ansprüche geltend, welche die Gesellschaft hervorbringt, und macht sich zu ihrem Fürsprecher, wenn sie in Konflikt mit der Notwendigkeit der Nutzung von Natur geraten. Darin liegt nicht, das sei wiederholt, Rückzug auf eine kleine Welt vorindustrieller Gewohnheiten und Geborgenheit. Werners Sprache antwortet der Gegenwart und spricht von ihr durch die Auffassung der natürlichen Dinge hindurch.
Der Holunder („Worte für Holunder“, 1971) schweigt nicht, sondern nimmt an den Verrichtungen des Lebens teil und reicht in seine wichtigen Ereignisse hinein:
Holderstrauch,
Einkehr der Kehlen
im Heimgang der Lieder,
womit wir die Sinne betäuben,
den Friedhof beleben.
Liebeslaube,
Rascheln im Busch…
Dieses Leben mit dem kleinen Kreislauf des Tages und dem großen der Lebenszeit erscheint so friedlich, daß es wirklich nicht sein kann. Das „Wir“, über das der Autor verfügt, klingt nach einem Grad von Gemeinschaftlichkeit und Eintracht, der unserer Lebensweise nicht gemäß ist. In Erinnerung an den Holunderstrauch des Volksliedes – er beschirmt den locus amoenus – bezeichnet das Gedicht glückliche Zeiten, jene nämlich, in denen die einfachen Dinge des Lebens die wichtigsten sind. „Leute, es möcht der Holunder / sterben / an eurer Vergeßlichkeit.“ („Holunderblüte“ in: Schattenland / Ströme) hatte es bei Johannes Bohrowski geheißen. Vor solchem Hintergrund der Bedeutungen, zu denen vielleicht auch der Holderstrauch bei Brecht gehört, für den keine Zeit mehr ist („Schwierige Zeiten“), kann das Zwiegespräch mit dem Holunder als glücklicher Vorgang angesehen werden. In der Bildsprache der Naturlyrik umspielt das Wünschbare die Wirklichkeit; es übersteigt sie, ohne sich von ihr zu lösen. Glückliche Vorgänge finden sich mehrfach unter den Gedichten, die in den siebziger Jahren entstanden und zuerst in dem Gedichtband Worte für Holunder (1974) veröffentlicht wurden. Thüringischer Nachmittag (1972) entwirft eine Welt, die voller Licht und Bewegung ist. Die Fenster nach draußen sind weit offen. Mit Augen, Ohren und allen Sinnen gibt das Ich sich dieser Welt hin und geht in Eintracht mit ihr aus sich hinaus. Ebenso öffnen sich Heißer Tag (1972) und Winterbrunnen (1970) nach außen. Natur leiht die Sprache, mit welcher Melancholie als Haltung verworfen wird. Das Ich, auf zeitgenössische Haltungen im Zitat anspielend, will sich nicht auf sich selbst zurückverweisen lassen:
Wo seid ihr..
Jetzt, wo ich am Schnee mir die Sicht verderbe,
absitze im gemütlichen sibirischen Pelz
meine Strafe, die ich verdienen
und mich suchend an mein Herz gewöhne.
Zeitangaben im Titel bezeichnen solche Dauer und heben sie aus dem Fluß des Gewöhnlichen heraus.
Werners Lyrik ist voller Bereitschaft, Märchenmotive und Märchenwelt aufzunehmen. Die Beseelung der Dinge, Pflanzen und Tiere hat im Umkreis der Märchen ein Asylrecht behalten. Naturlyrik schöpft aus der Märchenwelt nicht nur Möglichkeiten, über Beziehungen zu den Dingen spielend zu verfügen. Sie kann auch mit der Märchenerinnerung ihrer Leser rechnen. Denen mag sie helfen, eine sprechende und fühlende Natur in den Gedichten zu verstehen.
Ich gebe meinem Wald
eine andere Stimme,
eine Sprache, die gabelt
dem Himmel Antennen…
nur so zum Spaß
im Spiel
mit meinen kleinen
nackten Fingern.
(„Auf dem Hochsitz“, 1963).
Die Chancen für eine solche „Sprache… / nur so zum Spaß / im Spiel“ dürften in den Jahren ihrer Entstehung nicht groß gewesen sein. Daß sie aber gehört werden wollte und will, dafür zeugen die Zügel, welche der Autor dem freien Spiel gelockerter Beziehungen denn doch wieder anlegt. Gestalten und Verfahren der Märchen ersparen dem Lyriker, eine private Mythologie zu schaffen. Das war von Maurers „Dreistrophenkalender“ zu lernen. Hier wurde die Personifizierung aller Dinge zwischen Himmel und Erde reichlich verwendet. Auch auf Franz Fühmanns Umgang mit des Märchen im Gedicht spielt Werner gelegentlich an:
Am Grund der Märchen, barfuß
graben die Wellen
(„Alte Werrabrücke“, 1974).
Werner beansprucht aber nicht den naiven Ton der Volkspoesie für sich. Das Märchen ist auch durchaus nicht Ziel seiner Poesie. Der Märchenerzähler im gleichnamigen Gedicht (1971) gleicht keiner Figur der Volkspoesie. Es ist vielmehr der Dichter, dem sich „Mythe, die deutlichen Dinge von gestern“ („Barlach öffnet das Holz“, 1971) und moderne Welt vermischen. Wie im Kunstmärchen stellt jede Wert und Realität der anderen in Frage. Dieses Gedicht weist einen bitteren Ton auf. Der Märchenerzähler wird nicht gebraucht, er „Steht herum, lebt, geht fort“. Es ist nicht davon die Rede, daß jemand ihm zuhört. Ehe man daraus aber den Schluß zieht, daß Naturlyrik am Ende doch darauf hinausläuft, dem Ich einen Rückzug aus der gesellschaftlichen Welt zu bahnen, muß man die geschichtlichen Umstände in Rechnung stellen, die einen solchen Weg wie den Werners begleiten mußten. Nicht von ungefähr wird in diesem Gedicht das Abstraktum „Erfahrung“ verwendet, während sonst mit den Erfahrungen gearbeitet wird.
Werners Lyrik geht auf die Welt zu, während sie dem Leben der Natur eine Seele erdichtet und dessen unsymmetrische Bewegtheit und stille Gesetzlichkeit unseren Alltag bezieht. Die Freiheit der Märchen regt Werner zu einer Reihe ungewöhnlicher Dinggedichte an. Die bedeutungsvolle Selbständigkeit, mit der darin Dasein von Dingen zu Handlung wird, strömt Gelöstheit aus. Darin gleichen diese Gedichte den glücklichen Vorgängen im Umgang mit Natur. Spielerische Willkür wird freigesetzt, sobald der gewöhnliche Umgang mit den Dingen und damit die sachliche Beziehung aufgehoben ist.
Ein Vogel kann nicht sterben,
den kriegen wir nicht in die Hand.
Er singt mit den Flügeln,
redet mit dem Schwanz.
(„Aber die Tiere“, 1972).
Wenn in diesen Zeilen geheime Solidarisierung gegen die Menschen zu hören ist, so nehmen sie doch zugleich für deren Angelegenheiten Partei. Denn diese brauchen schließlich das Stück Welt, in dem die Möglichkeiten lebendig sind, nicht alles bearbeitet und durch die Spuren unserer Hand festgelegt ist. Die freundliche Dämonie aufgehobener Ordnung kann sogar technische Gegenstände befallen wie die Eisenbahn („Die verspäteten Züge“, 1969). Die Gedichte errichten Unordnungen, indem sie den Dingen ihr Aussehen als Gebrauchsgegenstände nehmen. Ihre Wahrnehmung durch das Gedicht verstößt gegen den gewohnten Umgang mit ihnen, gegen die Regeln also. Dafür bieten sie andere Sehweisen an, immer gesprächsweise, den „geselligen Luxus“ der Phantasie zum Beispiel. „Bäume“, sagt Herr Keuner bei Brecht, „(haben) wenigstens für mich, der ich kein Schreiner bin, etwas beruhigend Selbständiges, von mir Absehendes, und ich hoffe sogar, sie haben selbst für den Schreiner einiges an sich, was nicht verwertet werden kann.“ Gedichte wie „Tagüber meine Katze“ (1975) oder „Grasschneiden“ (1970) mit seinem überscharfen Bild eines vollkommen die Sinne erfüllenden Lebens übernehmen eine der vornehmsten und heilsamen Aufgaben von Naturlyrik. Sie geben der Welt um uns herum etwas von dieser beruhigenden Selbständigkeit zurück.
Ursula Heukenkamp, Sinn und Form, Heft 3, Mai/Juni 1980
KATZENROLLE
Nach Walter Werner
Neben dem Knistern
ihres Haares, samtneigig,
spricht die
Hobelzunge ratschig mit uns.
Im Holz gemaserte Vokale.
Im Stahl gehärtete Konsonanten.
Auf dem Spänelager
probt ein Kater Purzelbaum,
die uralte Rolle
vorwärts.
Axel Schulze
Zum 100. Geburtstag des Autors:
Ulrich Kaufmann: Louis Fürnberg und Walter Werner
LiteraturLand Thüringen
Fakten und Vermutungen zum Autor + Nachlass + Kalliope
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Spiegel ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Focus ✝
Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝ Die Welt ✝
Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ Basler Zeitung ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


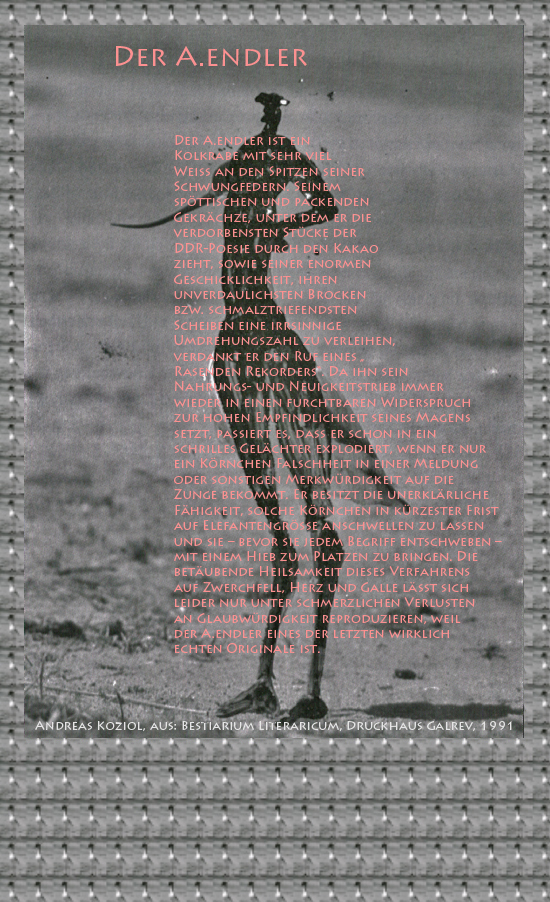












Schreibe einen Kommentar