William Carlos Williams: Die Worte, die Worte, die Worte
VÖLLIGE ZERSTÖRUNG
Es war ein eiskalter Tag.
Wir begruben die Katze,
trugen die Kiste hinaus
und verbrannten sie
im Hinterhof.
Was an Flöhen entkam
der Erde, dem Feuer
ging an der Kälte ein.
Nachwort
Gibt es eine spezifisch amerikanische Poesie? ein dichterisches Idiom, das dem Norden Amerikas eigentümlich und mit dem englischen nicht zu verwechseln wäre? Das war vor vierzig Jahren eine berechtigte, vor zwanzig Jahren eine immerhin entschuldbare Frage. Der Landarzt William Carlos Williams, Sohn eines Engländers und einer Puertoricanerin, ein Achtundsiebzigjähriger, geboren und gestorben in der Kleinstadt Rutherford, New Jersey, Ridge Road Nummer neun, hat diese Frage für alle Zukunft entschieden: er ist der Doyen und Erzvater einer Poesie, die sich von der europäischen Abhängigkeit gelöst und über den ganzen Kontinent, von New York bis San Francisco, ausgebreitet hat.
Der Wunsch der Neuen Welt, ihrer eigenen Sprache habhaft und mündig zu werden im Gedicht, das Streben danach, poetisch zu sich selbst zu kommen, ist der amerikanischen Literatur freilich seit ihren Anfängen abzulesen. Doch haben die lyrischen Muster Europas, die importierten Tonfälle und Attitüden, mehr als ein Jahrhundert lang die Oberhand behalten. Der bürgerliche Begriff der Kultur selber, eingeschleppt und mühselig fortgepflanzt, war und blieb dem amerikanischen Geist fremd. Soweit sie ihm erlag, zog die literarische Intelligenz des Landes sich vor der Gesellschaft zurück, in der sie lebte. Epigonentum und Minderwertigkeitsgefühle waren die Folge. Die höflichen, die bemühten, die gebildeten College-Dichter, die zahl- und harmlosen Formtalente aus guter Familie, die nach zwei, drei Europareisen in ihren neu-englischen Eremitagen, fern von der Wildnis Chicagos, ihre Variationen auf europäische Themen niederschrieben, vergeudeten ihre Kraft, und es kräht kein Hahn nach ihnen. Aber auch die bedeutenden Geister, ja gerade sie, waren hypnotisiert von der literarischen Tradition; sie bezahlten ihre literarischen Revolutionen mit dem Verlust ihrer amerikanischen Identität. So T.S. Eliot, der mit sechsundzwanzig Jahren sich in England niederließ und der sich später mit der äußersten Folgerichtigkeit von allem, was amerikanisch ist, abgewandt hat: heute bekennt er sich zur Monarchie, zur anglikanischen Kirche und zu einer klassizistischen Ästhetik. Ezra Pound hat Amerika mit dreiundzwanzig Jahren verlassen und ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg (nicht aus freien Stücken) in seine Heimat zurückgekehrt; er lebt heute wieder in Italien. Das sind keine biographischen Zufälligkeiten. Bezaubert von einem Begriff der Literatur, wie er europäischer nicht gedacht werden könnte, zu anspruchsvoll, um sich wie hundert geringere Köpfe mit Trostpreisen und Kompromissen zufrieden zu geben, bezahlten beide, Eliot wie Pound, ihre Zitate aus Catull und Dante mit dem Exil.
Andere amerikanische Dichter verschrieben sich dagegen aufs entschiedenste dem Land ihrer Geburt, verwarfen polemisch oder stillschweigend den Begriff der Kultur, wie er in Paris, London und Berlin galt, und machten sich gewissenhaft daran, „Amerika zu besingen“. Aber ihr ideologisches und thematisches Engagement, so willkommen es dem Selbstgefühl der Nation sein mochte, war außerstande, eine poetische Sprache sui generis zu erschaffen. Amerikanische Landschaft und Geschichte als bloßes Motiv, als Folklore und Deklamation, mystique und Selbstbestätigung: das war das Rezept der sogenannten Regionalisten, der Vachel Lindsay, Edgar Lee Masters und Carl Sandburg; allesamt abhängig von dem gewaltsamsten und monumentalsten Versuch einer poetischen Landnahme Amerikas, dem Werk Walt Whitmans. Sentimentalisch bis an den Rand der Hysterie, getragen von einer verzweifelten Rhetorik, ist dieses Werk bis tief in unser Jahrhundert die große Ausnahme, das große Beispiel einer unverwechselbar amerikanischen Poesie geblieben.
Auch Williams hat die Grashalme gelesen, als Student. Er studierte von 1902 bis 1906 an der Universität Pennsylvania Medizin. Dort lernte er Hilda Doolittle, die später unter dem Kryptonym H. D. literarischen Ruhm erlangt hat, Marianne Moore und Ezra Pound kennen, mit dem er sich anfreundete: „Schon damals pflegte Ezra mir vorzuhalten, ich sei ungebildet und unbelesen. Er tut es heute noch.“ Pound irrt; Williams ist zeit seines Lebens ein starker, wenn auch wahlloser und unsystematischer Leser gewesen. Seine Kenntnis der literarischen Tradition reicht von den Provençalen bis zu den klassischen Anthologien der Chinesen; doch sieht man sie seinem Werk nicht an. Im Gegensatz zu Pound hat er seine Lektüre nie affichiert. Er zitiert eher eine alte Negerin oder einen Landarbeiter als Konfuzius oder Cavalcanti. Er beruft sich auf kein Vorbild und keinen Meister. Der Gebrauch, den er von der Tradition macht, entzieht sich dem wohlfeilen Convenu, das nach „Einflüssen“ zu schnuppern liebt. Er greift sie nicht auf, um sie fortzusetzen; er braucht sie, um von ihr abzuspringen. Williams ist der seltenen Species der Erfinder zuzurechnen, jenen Autoren, die einen Anfang setzen und Überlieferungen, statt sie aufzunehmen, stiften.
Nur ein außergewöhnlicher Charakter ist dazu imstande. Kein „Kulturleben“, und wäre es das gepflegteste, am allerwenigsten aber das der Vereinigten Staaten, bringt eine neue Sprache hervor. Auch Talent ist nicht genug. Williams’ Leistung setzt einen durchaus unabhängigen Geist voraus. Die Autobiographie, die er als Siebzigjähriger veröffentlicht hat, zeigt einen solchen Geist, ein rarissimum in der Geschichte der Literatur, am Werk. Das macht ihre Bedeutung aus; es macht sie gleichzeitig unbrauchbar für jene banale Betriebsspionage, welche das Gedicht aus den Lebensumständen seines Verfassers erklären möchte.
Williams hat sich zeitlebens geweigert, die Rolle des literarischen Pontifex zu spielen.
Die Pose des Dichters, jene aufs Publikum berechnete Attitüde: ich habe nie nach ihr verlangt – und sie war es, was ich an Pound durchaus nicht ausstehen konnte. Ich hielt das einfach für einen alten Hut… Mein Training wies mich eher auf die Unauffälligkeit und Umsicht wissenschaftlichen Arbeitens hin. Was wir zu tun hatten, war einfach unser Bestes, und abgesehen davon, was wir zustandebringen mochten (das war eine Sache für sich), schien es mir das beste, ein gewöhnliches Leben zu führen, jeder so gut er konnte… Das war freilich nicht nach dem Geschmack des lieben Ezra.
Kein Wunder, daß die offiziellen Hüter der Literatur Williams jahrzehntelang ignorierten. Sie haben es ihm bis heute nicht verziehen, daß er sich nicht um ihr Urteil scherte, ihnen mit keiner Geste entgegenkam und um seinen künftigen Platz in den Literaturgeschichten nicht im mindesten besorgt schien.
Es handelt sich darum, fortwährend das in Frage zu stellen und aufzulösen, was man geleistet hat. Dies ist die einzige Art, saubere Finger zu behalten. Blinde Zustimmung ist durch nichts zu entschuldigen, weder durch Zwang noch durch Überlistung; höchstens durch den physischen Verfall.
Solche Lehren machen unbeliebt. Die Rolle des heroischen Außenseiters hat Williams übrigens ebenso beharrlich abgelehnt wie die des poetischen Fraktionsvorsitzenden. Ohne Verbitterung berichtet er vom Schicksal seines erstes Buches, das heute zu den größten Seltenheiten gehört: Es erschien im Selbstverlag; vier Exemplare wurden verkauft; der Rest verbrannte zusammen mit dem Hühnerstall, in dem er zehn Jahre lang liegengeblieben war.
Im Jahre 1921 erschien, als fünfte Publikation, der Gedichtband Sour Grapes (Saure Trauben). Über die Aufnahme, die er fand, berichtet Williams das folgende:
Der Titel brachte mir die Psychoanalytiker auf den Hals. Saure Trauben, wissen Sie, was das bedeutet? fragten sie. Nein. Was denn?
Es bedeutet, daß Sie frustriert sind, verbittert und enttäuscht… Sie haben Hemmungen… Die jungen Franzosen, die sind da ganz anders, sie legen einfach los… Aber Sie, Sie haben ja Angst. Sie sind ein typischer Amerikaner. Sie leben in Ihrer kleinen Vorstadt, und dort gefällt es Ihnen auch noch! Was sind Sie überhaupt für eine Figur? Sie wollen ein Dichter sein? Ein Dichter! Ha, ha, ha, ha! Ein Dichter! Sie! Saure Trauben, das ist alles, mehr ist da nicht drin.
Dabei hatte ich mit meinem Titel nichts anderes sagen wollen, als daß saure Trauben ganz genau so ausschauen wie süße: Ha, ha, ha, ha!
Bis auf wenige Ausnahmen hat die amerikanische Kritik vor Williams versagt: aus Ratlosigkeit, aus Hochmut und aus Ressentiment vor einem Autor, dem sie gleichgültig war. Bezeichnend ist das Urteil Eliots, der noch zu Anfang der zwanziger Jahre erklärte:
Williams ist ein Dichter, dem man eine gewisse lokale Bedeutung möglicherweise zubilligen kann.
Nicht ernster nahm ihn Gertrude Stein. Williams besuchte sie in Paris; das muß 1924 gewesen sein. Sie zeigte ihm die Manuskripte, die sich in ihrer Wohnung häuften.
Sie fragte mich, was ich an ihrer Stelle mit all diesen unveröffentlichten Büchern anfinge… Wenn ich so viel geschrieben hätte, sagte ich, würde ich aussuchen, was ich für das Beste hielte, und das übrige in den Ofen werfen… Meine Bemerkung rief augenblicklich ein entsetztes Schweigen hervor. Miß Stein brach es mit den Worten: Ich verstehe. Freilich ist es nicht Ihr métier, zu schreiben.
Offenbar schien es der professionellen Avantgarde unbegreiflich, daß Williams vergnügt und erfolgreich dem Beruf eines praktischen Arztes nachging; noch dazu in einem amerikanischen Provinznest (und nicht in Berlin oder Paris, wie Benn, Döblin oder Céline). „Ein derart zurückgezogenes Dasein hat einen großen Vorzug“, bemerkt Williams.
Man behält einen halbwegs klaren Kopf und kann nachdenken. Meine Art, nachzudenken, ist in erster Linie mein Gekritzel. Es ist immer meine Lieblingsbeschäftigung gewesen, zu kritzeln… Fünf Minuten lassen sich stets erübrigen. Die Schreibmaschine stand im Schreibtisch meiner Praxis bereit. Ich brauchte nur die Platte herauszuziehen, auf der sie befestigt war, und schon konnte ich mich an die Arbeit machen. Ich schrieb, so schnell ich nur konnte. Mitten im Satz kam oft ein Patient zur Tür herein, und mit einem Ruck war die Maschine verschwunden: ich war Arzt. Kaum war der Patient gegangen, ein Handgriff: und ich konnte weiterschreiben… Immer werde ich gefragt, wie ich es anstelle, mit zwei Berufen auf einmal fertig zu werden. Die Leute begreifen nicht, daß der eine die Ergänzung des andern ist, daß diese beiden Beschäftigungen nur zwei Ansichten ein und derselben Sache, nämlich des Ganzen sind.
Williams, von jeher ein pragmatischer Kopf, hat es nie verstanden, seine Einsichten zu einer Poetik zu verfestigen. Jede ideologische Fixierung ist ihm zutiefst zuwider. Seine theoretischen Äußerungen sind oft widersprüchlich, zuweilen hilflos; dennoch lassen sich einige Sätze anführen, in denen seine Auffassung von der Poesie mustergültig scharf und deutlich wird:
Ein Gedicht ist eine kleine (oder große) Maschine, hergestellt aus Worten. Nichts an einem Gedicht ist sentimentaler Natur; damit will ich sagen: es darf sowenig wie irgendeine andere Maschine überflüssige Teile enthalten. Seine Bewegung ist eine Erscheinung eher physikalischer als literarischer Art.
Williams beruft sich gelegentlich auf die „Wissenschaftlichkeit“ seiner Methode; der Zusammenhang mit seiner medizinischen Ausbildung ist unverkennbar. Zu seinen literarischen Vorbildern rechnet er den französischen Entomologen Henri Fabre. Daß es Williams eigentlich nicht um ein naturwissenschaftliches, sondern eher um ein phänomenologisches Verfahren zu tun ist, zeigt seine Reaktion auf die folgende Hemingway-Episode, die er in seiner Autobiographie notiert:
Bob (ein Pariser Bekannter) erzählte mir, daß er mit Hemingway in Spanien gewesen sei. Ihr Zug hatte an einem kleinen Bahnhof Halt gemacht, und die Reisenden waren ausgestiegen, um etwas frische Luft zu schnappen, Neben den Bahngeleisen lag ein toter Hund. Der Bauch war aufgeschwollen und schillerte in allen Regenbogenfarben der Verwesung. Bob wollte dem Gestank so rasch wie möglich entrinnen, aber Hemingway blieb stehen, zog sein Notizbuch hervor und fing an, eine detaillierte Beschreibung des Kadavers in seiner ganzen Pracht aufzunehmen. Bob hatte sich angewidert abgewandt. – Ich finde, Hemingway hat ganz und gar recht, sagte ich.
In der Vorrede zu seinem Gedichtband Kora in Hell erhebt Williams die genaue Beobachtung des Augenfälligen und seine Verwandlung in einen Text, der es vorstellbar macht, zum Kriterium schriftstellerischer Qualität schlechthin. Das führt zu einer eigentümlichen Poesie des Allernächsten, dessen, was die Wirklichkeit uns „unter die Nase“ hält.
Mein Grundstück, dieser Hinterhof, ist für mich und mein Schreiben immer von der größten Bedeutung gewesen.
Nicht ganz zu Unrecht hatten die Weltstädter Eliot und Stein den Landarzt Williams im Verdacht provinzieller Neigungen; doch kann Provinzialismus, recht verstanden, eine schriftstellerische Tugend sein. In Williams’ Fall bestand kein Anlaß zu herablassenden Gesten: seine „Zone“ war nicht weniger ergiebig als das Paris Apollinaires. Sie hieß Rutherford und war durch und durch amerikanischen Wesens: ihre Veränderungen im Laufe des Jahrhunderts spiegeln die Geschichte eines Kontinents.
Wenn ich heute durch Rutherford gehe, durch die Main Street mit ihren neonbeleuchteten Drug-Stores und ihren Maklerbüros, eins am andern, so fällt es mir schwer, mir das Dorf vorzustellen, in dem ich aufgewachsen bin. Damals gab es keine Kanalisation, keine Wasserleitung, nicht einmal Gas, und schon gar keine Elektrizität, weder Telefon noch Trambahn. Der Gehsteig bestand aus hölzernen Planken, auf Balken genagelt; Wespen hatten ihre Nester unter den Brettern und schwärmten zwischen den Ritzen aus, wenn wir darüberschritten. Sie stachen wie verrückt. Fast alle Straßen waren ungepflastert; die ersten Asphaltdecken waren eine Sensation. Wir hatten Senkgruben im Hinterhof und Scheunen wie die Bauern – all dies zehn Meilen weit vom Herzen New Yorks! Wir tranken Regenwasser, das durch die Dachrinnen in eine Zisterne lief; in der Küche stand eine Handpumpe, mit deren Hilfe wir es auf den Dachboden schafften, in einen verzinnten Wassertank. Wenn er leer war, bekamen wir Brüder für eine Stunde Pumpen einen Zehner.
Das ganze Haus war mit Petroleumlampen erleuchtet – so alt bin ich schon! Sie hingen in gußeisernen Haltern in den Schlafzimmern, und über dem Eßtisch hatten wir ein besonders schönes Exemplar aus Glas und Porzellan, das auf Ketten lief: man holte es herunter, um es zu füllen, zu putzen und anzuzünden.
Als Williams zu schreiben anfing, war es mit dieser Idylle vorbei. Heute ist die Umgebung von Rutherford ein Zwischenreich, angefressen und verwüstet von den Spuren der technischen Zivilisation, Niemandszone zwischen Stadt und Land, Revier der Autofriedhöfe, der Wellblechbaracken, der Lokomotivschuppen und der Öltanks, ein Stück der höllischen Industrielandschaft des nördlichen New Jersey:
Ein durchbrochener Saum von Fassaden aus Holz
und Ziegeln, so verflüchtigt dort oben
die Stadt sich, jenseits des Wasserturms
auf seinen Stelzen, ein vereinzeltes Haus
oder zwei hie und da, im kahlen Gefild.
Der Himmel ist unermeßlich
weit. Kein Mensch in der Nähe, und schlecht
numerierte Häuser…
aaaaaaaaaaaaaaaaaaGrobes Pflaster
und vergessene Trambahnschienen, von
plötzlichen Querstraßen überrumpelt.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAm Hang
in den Schrebergärten (Durchgang verboten)
kahle Obstbäume und unter verworrnen Ranken
von wildem Wein, nie gestutzt, niedrige Hütten
wehrlos im flutenden Licht.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDrahtseile
zwischen Stangen, über einem blau
und weiß ein Tischtuch, leicht gebauscht.
In den Fenstern Federbetten. Feigenbäume,
umwunden mit Sackleinwand und altem Linoleum.
Fässer überm Gesträuch…
Der Geist des Ortes steigt auf aus dieser Asche,
spricht insgeheim seinen dunkeln Kehrreim:
Hier ist meine Wohnstatt, hier lebe ich.
Hier bin ich geboren, dies ist mein Amt.
So steht es in dem Gedicht „Der Morgen“. Immer wieder taucht diese Landschaft in Williams’ Gedichten auf. Er akzeptiert sie, er versteht sie, er macht sie sich zu eigen, gerade dort, wo sie schäbig und verwahrlost ist.
Wallace Stevens, dessen eigene Gedichte Williams viel verdanken, hat an dessen Werk das „Anti-poetische“ hervorgehoben und gerühmt. Daran ist etwas Wahres; doch gründet die Kraft, aus Schutt und Asche Poesie zu machen, nicht in einem programmatischen Vorurteil, oder gar in einem moralischen parti pris. Williams legt es keineswegs darauf an, einem – übrigens recht wohlfeilen Begriff des Poetischen mit dessen bloßer Negation zu begegnen, Der Abfall ist zunächst weiter nichts als eine empirische Tatsache, und der Dichter begegnet ihm mit jenem unbefangenen, jenem „ersten Blick“, der ihm eigen ist. Seine Sehschärfe ist erstaunlich. Er zieht in jedem Fall der Metapher das Detail vor. Seine Ausschnitte sind stets genau begrenzt. Manches an seiner Technik gemahnt an die Malerei, der er übrigens von jeher große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Seine besten Gedichte erinnern zuweilen an ostasiatische Graphiken, besonders in ihrer genauen Ökonomie, der Kunst des Aussparens. Diese Schreibweise hat es nicht auf Deutung, sondern auf Evidenz abgesehen. Sie verzichtet konsequent auf „Tiefen“ und gibt stattdessen die Oberfläche der Erscheinungen in höchster Prägnanz; daher ihre Undurchdringlichkeit, jene Qualität, die Pound opacity genannt hat. Auf diese Weise erscheint das Unscheinbare köstlich, der Abfall wird exquisit, wie in dem berühmten Gedicht „Der rote Handkarren“.
Die genaue Beobachtung des Zerfalls enthüllt ihren Sinn als eine Suche nach der Vollkommenheit. „Vollkommenheit“ heißt auch das folgende Gedicht:
aaaaaaaaaaO lieblicher Apfel!
herrlich und völlig
aaaaaaaaaaverfault,
kaum versehrte Gestalt −
aaaaaaaaaahöchstens am Stiel
ein wenig geschrumpft, doch sonst
aaaaaaaaaabis ins Kleinste
vollkommen! O lieblicher
aaaaaaaaaaApfel! wie satt
und feucht der Mantel aus Braun
aaaaaaaaaaauf jenem un-
angetasteten Fleisch! Niemand
aaaaaaaaaahat dich geholt
seit ich dich auf das Geländer setzte
aaaaaaaaaavor einem Monat, damit
du reif werdest.
aaaaaaaaaaNiemand. Niemand!
Das ist ein Stilleben, eine nature morte. Der französische Ausdruck trifft die Sache. Das Ding-Gedicht hat es sich aus dem Kopf geschlagen, seinen Gegenstand zu beseelen (wie bei Rilke); nicht seine Dauer wird gerühmt; seine wahre Konsistenz, die Vergänglichkeit, zeigt sich im Augenblick des Verfalls. Einzig und allein in diesem Sinn kann er als Metapher verstanden werden, und zwar als implizite Metapher, die nicht für etwas anderes, sondern nur für sich selbst einsteht. Eine Art Lied beschreibt die Poetik solcher Dinggedichte; der Text nennt als Emblem seiner eigenen Schreibweise den Steinbrech.
Die meisten Arbeiten Williams’ zeigen diesen blitzartigen Zugriff. Sie gleichen poetischen Momentaufnahmen. Die Vielfalt der Erscheinungen schießt darin zu einem Augenblick zusammen. Solche Schnittbilder, in denen die Dimensionen der Zeit eliminiert scheint, hat James Joyce Epiphanien genannt; Williams, der dir Ausdrücke der Umgangssprache vorzieht, nennt sie glimpses, das heißt: rasche und flüchtige Einblicke, wie aus den Augenwinkeln, Ihre Verwandlung in Poesie setzt nicht nur ein scharfes Auge, sondern auch ein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen voraus. Williams verfügt über ein Detail-Gedächtnis, das erstaunlich und zuweilen rührend wirkt. Seine Lebensbeschreibung ist randvoll von Epiphanien. Im Jahre 1909 hat er ein paar Monate lang in Leipzig studiert. Als Siebzigjähriger besinnt er sich auf die Freudenschreie, mit denen damals der Zeppelin begrüßt wurde; auf ein kleines Mädchen, das ihn nach der Zeit fragte (er hatte keine Uhr, aber er war glücklich, mit jemandem zu sprechen); auf die Götterdämmerung und auf den Hasenpfeffer; und auf eine alte Frau, die jeden Morgen vor dem Rathaus Gras für ihre Kaninchen sichelte. Sein Andenken ist von unbestechlicher Gerechtigkeit, weil es keine Unterschiede macht; es wendet sich einer Warenhausverkäuferin mit derselben Aufmerksamkeit zu wie einem weltberühmten Schriftsteller und spricht von Majakowski ebenso deutlich wie von einer Katze, die ihn ein paar Jahre lang begleitet hat. Dem Fischhändler, der jeden Morgen die Ridge Road herunterkam, widmet er ein ganzes Kapitel seiner Autobiographie, so als verstünde sich das von selbst.
Williams hat sich nie für „die Menschheit“ interessiert: die Vokabel wäre in seinem Mund nicht vorstellbar. Er kümmert sich lieber um die Leute. Das Porträt spielt in seinem Werk eine große Rolle. Es steht ebenbürtig neben dem Ding-Gedicht. Die Technik des Aussparens verhilft ihm, bei größter Deutlichkeit, zu einer Tugend, die sich unversehens als moralische, nicht nur ästhetische Qualität erweist: einer Delikatesse, die es möglich macht, von allem, selbst dem Intimsten, zu sprechen. Das Bildnis seiner Großmutter auf dem Sterbebett, großherzig und schonungslos zugleich, ist ein vorzügliches Beispiel dieser Porträt-Kunst.
Die Zerstörung ist ein Thema, das sich durch alle Arbeiten Williams’ zieht. Wie die Dinge in ihrem Zerfall, so erreichen die Menschen, die er darstellt, ihre höchste Evidenz in der Krankheit, im Alter, im Tod. Zweifellos hängt diese Einsicht mit dem bürgerlichen Beruf des Dichters zusammen; denn der Arzt ist der einzige, der jene Augenblicke der Wahrheit bezeugen kann und in die verborgene Sphäre des physischen Leidens und Verfalls Einblick hat. Das „wüste Land“ und die „hohlen Männer“ Eliots kehrten wieder – freilich leibhaftiger und weniger summarisch – in vielen Texten von William Carlos Williams. Seine unerbittlichste Zuspitzung erfährt dieses Thema in dem Gedicht „Völlige Zerstörung“.
Die lakonische Sicherheit seiner Porträts verdankt sich nicht nur dem scharfen Blick und dem eidetischen Gedächtnis, sondern auch dem untrüglichen Ohr für Tonfälle, Sprechweisen, mit einem Wort: für Stimmen, über das dieser Autor verfügt.
Was die Leute zu sagen versuchen, was sie uns, unablässig und vergeblich, zu verstehen geben wollen, ist das Gedicht, das sie in ihrem Leben zu verwirklichen trachten. Wir haben es vor uns, fast mit Händen zu greifen; es ist abwesend in jedem Augenblick, wie eine sehr fein verteilte Substanz, die wir aus allem, was gesprochen wird, heraushören können. Das Gedicht hat seinen Ursprung in halblauten Worten, wie ein Arzt sie jeden Tag von seinen Patienten vernehmen kann.
Diese gesprochene Sprache des Alltags versteht Williams derart in den Vers zu überführen, daß sie nichts von ihrer Authentizität verliert. Er schreibt ganz unabhängig von der jeweils kurrenten Literatursprache und scheut jeglichen Jargon, den der Gebildeten ebenso wie seine Antithese, den Slang. Dieser exakte Gebrauch der Umgangsprache ist spezifisch amerikanisch; er ist ein wesentlicher Grund für die enorme Wirkung Williams’ auf die neueste amerikanische Poesie.
Das Raffinement seiner Schreibweise wird durch das scheinbar Alltägliche eines solchen Sprachgebrauches gleichsam getarnt. Die Gedichte wirken auf den ersten Blick eher unscheinbar. Der Grad von Verdichtung, den sie erreichen, wird erst beim genaueren Zusehen deutlich. Jeder Versuch, Williams zu übersetzen, ist die Probe aufs Exempel. Seine Knappheit ist im Deutschen unerreichbar. Unserer Poesie, ja unserer Literatur überhaupt, ist die Umgangssprache fremd. Eine rühmliche Ausnahme wie Arno Schmidt wirkt in ihrem Kontext outriert und absonderlich; der Versuch, der selbstverständlichen Sprache des Alltags habhaft zu werden, wird als Obskurität mißverstanden.
Seine Fähigkeit, Tonfälle und Gesten dichterisch zu transportieren, erlaubt es Williams übrigens, einer überall herrschenden literarischen Konvention den Garaus zu machen, die es für ausgemacht hält, daß die Familie, der Alltag eines gewöhnlichen Hauses, die Intimität einer Küche oder eines Badezimmers in einem modernen Gedicht nicht erscheinen darf. Ein absonderliches Tabu scheint es den Poeten dieses Jahrhunderts nahezulegen, daß der Nordpol, die Atombombe und der Minotaurus ihrer Aufmerksamkeit würdiger wären als das Handtuch, der Kühlschrank und die Nachttischschublade. Wo die Sprache des Gedichts sich von jeder gesprochenen distanziert, ist das kein Wunder. Getreu seiner Maxime, das Allernächste sei die Bewährungsprobe allen Schreibens, meistert Williams sehr anmutig und scheinbar ohne Anstrengung die empfindlichen Gegenstände des häuslichen Alltags, zum Beispiel in den bei den Miniaturen „Ein freundlicher Abschied“ und „Nur damit du Bescheid weißt“.
W.C.W. (wie ihn seine Freunde und Schüler nennen) hat sich mit den kleinen Formen, die er so souverän beherrscht, nicht begnügt. Sein Werk ist sehr umfangreich. Es umfaßt eine Reihe von Theaterstücken, ein großes Fresko der amerikanischen Geschichte, mehrere Bände mit Kurzgeschichten und drei Romane. Diese Arbeiten können hier nicht analysiert werden. Dagegen wäre ein Versuch über das poetische Werk unvollständig ohne einen Hinweis auf Williams’ größtes Gedicht „Paterson“, in dem er die Summe seiner Erfahrungen und Möglichkeiten zu ziehen sucht. Die akademische Kritik, die gerne mit herkömmlichen Begriffen arbeitet, hat es als Versepos mißverstanden; das einzige, was „Paterson“ mit dieser klassischen Gattung gemein hat, ist sein mythologischer Aspekt. Im übrigen handelt es sich um eine poetische Großform, die spezifisch modern ist und keine erzählerischen Absichten verfolgt. Das Werk ist am ehesten mit Pounds Cantos, mit Nerudas Großem Gesang, mit Majakowskis Wirbelsäulenflöte und den weittragenden Gedichten von Saint-John Perse, der Anabasis oder den Seemarken, zu vergleichen. Die Organisation so großer Texte ist enorm schwierig. Williams benutzt für seinen Bau die disparatesten Materialien, verwendet Liedformen und Eklogen, Monolog und Dialog; er montiert Prosatexte der verschiedensten Art in das Versgefüge: Briefe, Berichte aus alten Chroniken, Testamente, Plakate, geologische Tabellen und indianische Legenden. Auf diese Weise entsteht ein außerordentlich vielstimmiges Gebilde. Dem Pathos der großen Form wirkt ein spröder Humor, der feierlichen Invokation die innere Ironie des Empirischen entgegen.
Paterson ist zunächst ein ganz realer Ort: eine Industriestadt am Passaic River im Nordosten von New Jersey, 150.000 Einwohner, Textil- und metallverarbeitende Industrie. Diese kollektive Größe erscheint in dem Gedicht als Person, als „Mr. Paterson“:
Die vielfältigen Facetten der Stadt können für die Mannigfaltigkeit des menschlichen Denkens einstehen.
Auf diese Weise entsteht eine Mythologie der amerikanischen Zivilisation und ihrer Geschichte. Aber das Gedicht hat auch eine elementare Kehrseite: seine fünf Bücher sind zugleich die Naturgeschichte des Passaic-Flusses von seinem Ursprung über die großen Wasserfälle bis zu seiner Mündung. Auch der Fluß tritt, zur Person verzaubert, in Erscheinung, ähnlich wie Anna Livia Plurabelle in Finnegans Wake. Wie alles, was er geschrieben hat, sieht Williams auch dieses ehrgeizigste seiner Werke im Zusammenhang mit seinem Beruf und seiner „provinziellen“ Existenz:
New York City lag außerhalb meines Gesichtskreises. Mit Vögeln und Blumen wollte ich mich nicht zufriedengeben; ich wollte über die Leute schreiben, die mir nahe waren, über die ich bis ins kleinste Detail Bescheid wußte – ich kannte ihre Augen aus der Nähe, ja sogar ihren Geruch. Das ist die Aufgabe des Dichters: nicht in vagen Kategorien zu handeln, sondern im Besonderen zu schreiben, im Einzelnen, so wie ein Arzt an seinem Patienten an dem zu arbeiten, was er vor sich hat.
Es ist klar, daß ein Autor von solchem Schlag sich zur Gesellschaft im Ganzen, daß er sich politisch nicht nach dem Maß einer Ideologie verhalten kann. Er kann sich keiner Doktrin unterwerfen, nicht weil er ihren so oder anders gearteten Inhalt bestritte, sondern des abstrakten Charakters wegen, der jeder Heilslehre eignet. Williams ist der geborene Demokrat; die Demokratie ist für ihn weniger eine Überzeugung als ein Lebenselement, zugleich unentbehrlich und selbstverständlich. Das Christentum ist ihm fremd, wie jede Anbetung der Autorität. Die amerikanische Kritik hat ihm zuweilen seine „linken“ Neigungen zum Vorwurf gemacht; richtig daran ist, daß Williams unfähig ist, gesellschaftliche Ungerechtigkeit und ökonomische Korruption ohne Widerspruch hinzunehmen; er wäre aber ebenso unfähig, sich dem kommunistischen Dogma auszuliefern. Nicht an Bekenntnissen und Manifesten, sondern am Wortlaut noch seiner geringsten Gedichte zeigt es sich, wie tief dieser Mann mit dem Los Amerikas verbunden ist. Schier unabsichtlich und kaum je politisch in einem handgreiflichen Sinn, reflektiert sein Werk doch auf das Empfindlichste die kollektiven Chocs der amerikanischen Gesellschaft: den Eintritt in die große Weltpolitik, die roaring twenties mit ihren Stummfilm- und Prohibitions-Gespenstern, den großen Boom und die große Krise, den New Deal Roosevelts und die Verdüsterung der Welt durch den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen. Der Kritiker Robert Lowell hat in einer Besprechung des Gedichtes „Paterson“ bemerkt:
Wir haben das Amerika Whitmans vor uns, aber es ist zu einem Schauplatz der Erbärmlichkeit und der Tragödie geworden, verstümmelt durch Ungleichheit, verwüstet vom Chaos der Industrialisierung, der Vernichtung ausgesetzt. Kein anderer Dichter hat es mit soviel Kunst, Mitgefühl und Erfahrung, mit solcher Wachsamkeit und Kraft beschrieben.
Auch in den Dingen der Literatur und der Kunst scheint der Hinterwäldler, der Landarzt aus der Provinz mit allem, was „draußen“ geschieht, wie durch ein System von kommunizierenden Röhren geheimnisvoll verbunden. Auf seinen wenigen Reisen ist er fast allen bedeutenden Figuren seiner Zeit begegnet. Zusammen mit Ezra Pound hat er in London den alten Yeats besucht; in Paris traf er Aragon und Cendrars, Cocteau und Djuna Barnes, die Surrealisten und die Amerikaner der lost generation, Juan Gris und Brancusi, Léger und Duchamp: damals allesamt noch nicht weltberühmt; und in New York liefen ihm O’Neill und Majakowski, Nathanael West und Francis Scott Fitzgerald über den Weg. Er war mit allen Gruppen und Richtungen vertraut (und es war die Blütezeit der Ismen); aber nie hat er sich auf die Dauer einer von ihnen anschließen können: er traf sie, prüfte sie, und zog sich wieder nach Rutherford zurück.
Von Zeit zu Zeit pflegte er nach New York zu fahren. Er traf nicht nur die Berühmtheiten des Tages. Immer wieder geriet er an die kaputten, die „hohlen Menschen“, die Ausgelaugten und Zerstörten. Auf den tollen Parties der Fitzgerald-Ära saßen die Verlorenen mit den Erfolgreichen zu Tisch: und auch die Erfolgreichen waren Verlorene auf ihre Art. Das Bildnis einer Unbekannten, wie Williams es aufgezeichnet hat, gibt davon eine Vorstellung.
Die Wohnung von Margaret Anderson und Jane Heap mit ihrem großen Bett, das an vier Ketten von der Decke herabhing, war sehenswert. Jane Heap sah aus wie ein untersetzter Eskimo, und Margaret, immer im Vordergrund, war eine Schönheit im großen Stil. Bei ihnen sah ich eines Tages unter einem Glassturz eine Plastik, die dem Wachsmodell eines Hühnermagens glich. Sie fiel mir auf. Ich erfuhr, daß eine deutsche Aristokratin namens Elsa von Freytag-Loringhoven sie gemacht habe, eine unglaubliches Geschöpf, über fünfzig Jahre alt… Ob ich sie kennenlernen wollte? Es hieß, sie sei begeistert von meinen Arbeiten. Ich sagte zu: das war mein Verhängnis. Unglücklicherweise saß die Bildhauerin damals gerade im Kittchen, weil sie einen Regenschirm gestohlen hatte… Am Tag ihrer Entlassung holte ich sie ab, lud sie irgendwo an der unteren Sixth Avenue zum Frühstück ein, und versprach Ihr, sie wiederzusehen. Früher mochte sie schön gewesen sein. Sie sprach mit einem starken deutschen Akzent, Sie verdiente sich einen Hungerlohn, indem sie Modell stand… Ich sah sie wieder, und ob! Es wurde eine ziemlich intime Unterhaltung daraus. Sie würde einen großen Mann aus mir machen: ich brauchte mir nur von ihr die Syphilis zuzuziehen und dadurch meinen Geist für ernsthafte künstlerische Arbeit freizumachen. Übrigens war sie ein Schützling von Marcel Duchamp. Eines Tages schickte sie mir ein Aktphoto von ihr, das er gemacht haben soll, eine vorzügliche Photographie. Das Bild lag jahrelang in meinem Koffer herum, bis ich es nicht mehr sehen konnte und weggab. Immerhin, als Photo war es ein Meisterwerk. Die Baronin verfolgte mich mehrere Jahr hindurch und kam zweimal nach Rutherford hinaus. Es war nicht leicht, sie wieder loszuwerden, Sie erinnerte mich an meine Großmutter, die ,Zigeunerin‘, und ich war dumm genug, ihr zu sagen, daß ich sie gern hatte. Das hätte mich beinahe Kopf und Kragen gekostet! Ich besuchte sie und brachte ihr ein wenig Geld. In ihrem elenden Kamin häufte sich die Asche. Das Slum, das sie bewohnte, teilte sie mit zwei Hunden, die sich auf ihrem schmutzigen Bett vergnügten. Aber sie selbst war von der vollkommensten Höflichkeit… Bis sie wieder anfing, mir Szenen zu machen. Wallace Stevens wagte es ihretwegen eine ganze Weile nicht, die Vierzehnte Straße zu überqueren, wenn er in New York war, und ein russischer Maler, der sie kannte, fand sie eines Abends, als er nach Hause kam, unter seinem Bett – ohne einen Faden auf dem Leib. Er lief davon und verbarg sich in der Wohnung eines Nachbarn. Sie weigerte sich, sein Zimmer zu verlassen, wenn er nicht mit ihr ginge… Sie konnte einen verrückt machen. Später gab ich ihr zweihundert Dollar für die Überfahrt nach Europa. Der Bote unterschlug das Geld, Ich gab ihr das Geld noch einmal, und schließlich fuhr sie ab. Sie kam nicht weit. Ein Spieler, ein Franzose, soll halb aus Spielerei den Gashahn in ihrem Zimmer aufgedreht haben, während sie schlief. Das ist das letzte, was ich von der Baronin gehört habe.
Sie ist nur scheinbar eine periphere Erscheinung. Seit Edgar AIlan Poe ist die Geschichte der Künste in Amerika – soweit sie sich nicht der Reklame in einer ihrer hundert Formen verschrieben eine Geschichte der tragischen Untergänge gewesen. Williams gedenkt dieser Vergessenen, so gering oder bedeutend ihre Begabung auch gewesen sein mag, immer wieder. „Es würgte einen in der Kehle, wenn man sie ansah: sie waren fast mit Sicherheit dem Untergang geweiht.“ Niemand erinnert sich mehr eines Schriftstellers namens Emanuel Carnevali und seines ersten und einzigen Buches, Williams zu glauben, eines außergewöhnlichen Werks. Es hatte einen Achtungserfolg, der Autor wurde nach Chicago eingeladen. Dort erkrankte er, wahrscheinlich an einer Encephalitis. „Schließlich schob man ihn nach Italien ab. Sein Vater steckte ihn in ein Armenhaus in der Nähe von Bologna. Nonnen kümmerten sich um ihn. Er schrieb mir ein paarmal. Er versuchte weiterzuschreiben. Aber das Spiel war aus.“
Ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört hungrig hysterisch nackt
im Morgengrauen durch Negerstraßen irrend auf der Suche nach einer wütenden Spritze…
arm zerfetzt hohläugig und blau im übernatürlichen Dunkel
von miefigen Slums rauchend saßen sie schwimmend über dem Häusermeer in Jazzekstasen…
auf dreckigen Buden im Unterzeug hockend, ihr Geld verbrennend im Papierkorb, lauschend der Angst von nebenan…
So beginnt das berühmteste Gedicht der neuesten amerikanischen Literatur, das Geheul von Allen Ginsberg. Er ist in Paterson geboren. William Carlos Williams hat ein Vorwort zu diesem Gedicht geschrieben, das mit den Worten schließt: „Nehmen Sie die Säume Ihrer Gewänder hoch, meine Damen, wir gehen durch die Hölle.“
Und so gedenkt die Autobiographie der toten und verlorenen Freunde, in einer Litanei von Namen, die verstummt sind:
Pound eingesperrt in einem Irrenhaus in Washington; Hemingway ein populärer Romancier; Joyce tot, Gertrude Stein tot; Picasso zum Keramik-Fabrikanten geworden; Brancusi zu alt, um zu arbeiten; Hart Crane tot; Juan Gris, einst mein Lieblingsmaler, vor langen Jahren gestorben; Charles Demuth tot, Marcel Duchamp müßig in einem Dachboden in der Vierzehnten Straße ohne Telefon in New York; die Baronin tot; Peggy Guggenheim in Venedig als Hausherrin einer Galerie für moderne Bilder, an deren Wert sie nicht glauben soll; Ford Madox Ford tot; Henry Miller verheiratet in der Nähe von Carmel in Kalifornien auf einem Berg, der eine halbe Meile hoch ist und von dem er fast nie herabsteigt; Djuna Barnes verarmt, ohne Adresse, nicht mehr schreibend; Carl Sandburg, abgewandt von der Mühe des Dichtens; Eugene O’Neill schweigend, verstummt.
Die Einladungen, die Lesungen, die Schallplatten und Ehrendoktorhüte, der späte Ruhm, der ihn heimsuchte: sie vermochten Williams nicht zu trösten. Er nahm sie gutmütig hin, aber sie waren ihm wohl gleichgültig. Seine Zukunft liegt, wie die eines jeden Schriftstellers, in dem, was heute und morgen geschrieben wird. Die Renaissance der amerikanischen Poesie, der scheinbar plötzliche Ausbruch dichterischer Energien, der in den fünfziger Jahren wahrzunehmen war, läßt sich auf die mühseligen und aussichtslosen Kämpfe einer winzigen Minorität zurückführen, die in den zwanziger und dreißiger Jahren in Amerika an der Arbeit war. Wer ihre Vorgeschichte studieren will, muß sich einer beinahe apokryphen Überlieferung zuwenden: den kleinen Flugblättern und Magazinen, die damals in geringen Auflagen, jenseits des offiziellen Verlagsbetriebes und unter schweren, nicht nur materiellen Opfern, unter wenige Leute gebracht worden sind.
Diese kleinen Zeitschriften werden in mir immer einen Fürsprecher haben. Ohne sie wäre ich bald zum Schweigen verurteilt gewesen. In meinen Augen sind sie allesamt ein einziges Unternehmen, eine Zeitschrift, die nie sterben kann: das einzige Publikationsmittel, das nicht unter der Fuchtel eines Herausgebers steht. Das Kommen und Gehen ihrer Redakteure folgt einem demokratischen Gesetz. Niemand kann diese Zeitschrift beherrschen und sich zu ihrem Alleinherrscher machen, Wenn sie an einem Ort eingeht, so ersteht sie an einem andern, unter anderem Namen, neu: damit gedruckt werde, was neu ist, was in diesem Augenblick geschrieben wird.
Was damals begonnen wurde, hat heute gesiegt. Eine ganze Generation von jungen Dichtern beruft sich auf Williams. Die verschiedensten Geister einigen sich auf ihn, wenn man sie nach ihren Lehrern fragt. In Donald Allens Sammlung The New American Poetry 1945–1960, dem ersten Buch, in dem diese Dichtung in ihrer ganzen Vielfalt sichtbar gemacht wurde, trifft man immer wieder auf seine Spur. Charles Olson, Robert Duncan, Robert Creeley, Allen Ginsherg, Lawrence Ferlinghetti, Le Roi Jones, Denise Levertov und Gregory Corso: klarer als jede Literaturgeschichte bezeugen diese Namen die Leistung eines einzelnen Mannes, der in seiner Kleinstadt nicht nur ein paar hundert Kinder zur Welt gebracht hat, sondern auch einige Gedichte, die das Amerikanische zu einer poetischen Sprache gemacht haben, wie sie auf der ganzen Welt verstanden wird.
Hans Magnus Enzensberger, 1961, Nachwort
William Carlos Williams (1883–1963)
war der Doyen der modernen amerikanischen Poesie. Er residierte nicht in New York, er lebte als Armenarzt in seinem Geburtsort, einem kleinen Ort im Staate New Jersey. In diese Welt gehören seine Gedichte; sie sind ganz und gar amerikanisch: hart, genau, ohne Rhetorik, geprägt vom Pragmatismus. Ihre Sprache ist scheinbar direkt, nur im Anschein des Mühelosen verrät sich die Kunst des Dichters. Kein anderer Dichter des Landes ist so wenig gealtert und hat so tief auf die Jungen und Jüngsten gewirkt.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1962
Beitrag zu diesem Buch:
Michael Rutschky: Welcher Dichter ich gern wäre. Eine Wanderung durch neue Lyrik
Merkur, Heft 600, März 1999
(bezieht sich auf eine Neuauflage)
Zum Wiederlesen empfohlen
Der große Dichter William C. Williams mit seinen scheinbar so kleinen Gedichten ist immer wieder eine Entdeckung. Sein vielleicht bekanntestes Gedicht über einen roten Handkarren ist genau sechzehn Worte lang und löst mit jedem seiner vier Verse einen ganzen Sturm von Assoziationen aus. Diese Lyrik ist die Kunst der Reduktion in höchster Vollendung, und dabei ganz den alltäglichen Dingen und Menschen zugewandt.
Katharina Döbler, Kulturradio, 14.5.2010
Geselliger Dichter
Der Alltag an sich ist schon lyrisch, doch fehlen ihm Form und Grenze. Williams war ein Kinderarzt und Familienvater in Rutherford/New Jersey. Er wurde dort geboren und ist auch dort gestorben (1883–1963).
Kein einsamer Dichter. Ein Mann im prallen Leben, der teilnimmt und andere Künstler und Dichter leibhaftig kennenlernt: Stein, Joyce, Duchamp, Pound, Eliot. Ein Mann, der genau hinsieht und sein Gehör dem Detail schenkt. Als Arzt vernnahm er täglich die leisen wie lauten Worte seiner Patienten und in diesen Worten entdeckte er den Ursprung des Gedichts.
Williams Sprache versucht nicht zu glänzen, nichts zuzufügen oder wegzunehmen: ganz uneitel dient sie der Evidenz des Augenblicks, etwa in „Nur damit du Bescheid weißt“:
Ich habe die Pflaumen
gegessen
die im Eisschrank
waren
du wolltest
sie sicher
fürs Frühstück
aufheben
Verzeih mir
sie waren herrlich
so süß
und so kalt
Williams ist ein Meister der Miniatur, die nichts verkleinert: was sie zeigt, zeigt sie ganz.
In der Liebe
gilt, meine Liebste:
Detail ist alles
Thomas Lang, zehn.de
Ein „zerstreuter Professorentyp, aber 100% amerikanisch“
– Die FBI-Akte über William Carlos Williams. –
1870 richtete der amerikanische Kongreß das Justizministerium ein und als Teil davon 1908 das Bureau of Investigation, das seit 1935 Federal Bureau of Investigation heißt. Als nicht uniformierte Polizei, die bundesweit tätig werden darf, verfolgt das FBI Verstöße gegen Bundesgesetze, bekämpft das organisierte Verbrechen und öffentliche Korruption. Das FBI sorgt sozusagen für den inneren Frieden der Vereinigten Staaten, und dieser Frieden schien dem langjährigen Chef Edgar J. Hoover besonders durch Schriftsteller gefährdet zu sein. Hunderte von Journalisten, Verlegern, Kritikern und Dichtern ließ Hoover observieren und geheime Akten über sie anlegen. Sherwood Anderson, James Baldwin, Kay Boyle, John Cheever, e.e. cummings, E.L. Doctorow, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald, Robert Frost, Erle Stanley Gardner, Allen Ginsberg, Ben Hecht, Sinclair Lewis, H.L. Mencken, Arthur Miller, Lewis Mumford, Grace Paley, John Steinbeck, Rex Stout, Tennessee Williams, William Carlos Williams, Edmund Wilson, Thomas Wolfe, Louis Zukofsky und viele andere haben, ohne zu wollen, zur literarischen Bildung von Spezialagenten beigetragen, die sie observieren und ihre privaten Angelegenheiten ebenso wie ihre literarischen Karrieren registrieren mußten. So schrieb das FBI unter Hoover eine eigene Literaturgeschichte Amerikas – verfassungswidrig und auf Kosten des Steuerzahlers.
Daß die berühmten Immigranten aus Europa, Bertolt Brecht und Thomas Mann zum Beispiel, die amerikanischen Behörden beschäftigten und eine entsprechende Akte hatten, ist schon lange bekannt daß das FBI die nationale literarische Szene beobachtete, nicht. 1984 berichtete die New York Post, wie eine Lokalzeitung aus Kalifornien, die San Jose Mercury News, unter Berufung auf die Freedom of Information Act, das Gesetz zur Informationsfreiheit, Einsicht in eine geheime FBI-Akte über John Steinbeck bekommen hatte. Daß John Steinbeck, der Autor solcher amerikanischen Klassiker wie Früchte des Zorns und Die Straße der Ölsardinen und Nobelpreisträger von 1962, eine geheime Akte in den Archiven des FBI hatte, verstörte die Zeitungsleser und löste die Frage nach anderen möglichen geheimen Akten über Schriftsteller aus. Die Journalistin Natalie Robins ging der Frage nach. Sie beantragte und bekam Einsicht in etwa 200 Akten, sprach mit FBI-Agenten und mit aktenkundigen Schriftstellern und deren Familien und veröffentlichte vor kurzem eine Studie, in der sie zeigt, daß das FBI eine anhaltende Kampagne gegen die schreibende Zunft führte. Die Dichter und Denker waren dem FBI schon per definitionem suspekt, und ein Artikel in kulturkritischen Zeitschriften wie The Partisan Review oder The New Republic oder ein Leserbrief an „verdächtige“ Zeitschriften wie The Liberator genügte, um aktenkundig zu werden.
Ein Leserbrief von 1930 an New Masses, die 1926 gegründete linke Kulturzeitschrift, war es, der die Aufmerksamkeit des FBI auf William Carlos Williams lenkte. Williams äußerte sein Interesse an einer Nummer dieser Zeitschrift über John Reed, den Autor des Weltbestsellers über die Oktoberrevolution Zehn Tage, die die Welt erschütterten, schickte Geld und schrieb: „Wie kann ich Kommunist sein, jemand wie ich? Was mich tagein tagaus am meisten beschäftigt, ist Lyrik. Und die kann ich, ohne meinen Verstand unmöglich zu verrenken, nicht in eine Kraft verwandeln, die auf das eine Ziel Wählt kommunistisch! gerichtet ist, oder für die Weltrevolution arbeiten.“ Obwohl also Williams die kommunistische Zielsetzung mit seiner dichterischen Existenz ausdrücklich für unvereinbar hielt, glaubte das FBI, daß das Unmögliche möglich sei, und fing an, sich für Williams zu interessieren. Seine Akte schwoll über die Jahre auf 166 Seiten an, mehr als die Hemingway-Akte (120 Seiten), freilich viel weniger als die Pound-Akte (1200 Seiten). In den dreißiger Jahren unterschrieb Williams einen offenen Brief, der kulturelle Zusammenarbeit mit der Sowjetunion befürwortete, und er unterstützte das Federal Arts Project, eine staatlich subventionierte kulturelle Maßnahme, die jedoch als kommunistisch unterwandert galt. Für das FBI wurde der bürgerliche Arzt aus Rutherford, New Jersey, der Amerika in seinen Gedichten ein Denkmal aus Worten gesetzt hat, suspekt, und geradezu subversiv schien Williams’ poetische Existenz. 1942 sandte ein Informant, ein inoffizieller Mitarbeiter, den das FBI unter Dr. Williams’ Praxisangestellten rekrutiert hatte, 17 maschinengeschriebene Seiten ein, die den Agenten viel Kopfzerbrechen bereiteten. Schließlich kamen sie nach fünfmonatiger Untersuchung zu dem Schluß, daß Williams „ein zerstreuter Professorentyp, doch sicherlich 100% amerikanisch ist“, aber auch, daß er „einen expressionistischen Stil verwendet, der wahrscheinlich ein Kode ist“. Unfähig, diesen vermeintlich Kode zu entschlüsseln, observierte das FBI Williams ständig. Das Mißtrauen der Behörde war um so größer, als Williams auch eine lebenslange Freundschaft mit dem 1945 des Landesverrats verurteilten Ezra Pound unterhielt. In der Williams-Akte findet sich ein Vermerk, er halte Pound zwar für „ga-ga“, glaube aber, „Pounds Gedichte gehörten zu den bedeutendsten des Jahrhunderts“. Diese Einschätzung machte Williams für Hoover endgültig verdächtig, und als der Dichter 1951 zum Consultant in Poetry at the Library of Congress berufen wurde, verhinderte das FBI seine Ernennung. Williams’ Gedichte seien „die Stimme des Kommunismus“, heißt es unter Hinweis auf das Gedicht „Russia“ von 1948 in einem Vermerk. (Die FBI-Agenten waren vielleicht tüchtige Polizisten – große Interpreten waren sie nicht, denn Williams’ Gedicht ist nicht propagandistisch, sondern im Gegenteil durch und durch kritisch.) Nun führte das FBI eine großangelegte Kampagne gegen Williams, befragte seine Freunde, Angestellten und Patienten und ließ den Kolumnisten Fulton Lewis, Jr., Unterstellungen gegen Williams verbreiten. In einem Artikel beschuldigte Lewis Williams, „mit dem übelriechenden Haufen befreundet zu sein, der seit 25 Jahren Moskaus Propaganda in die USA verbreitet“. Schließlich verzichtete die Library of Congress auf Williams’ Ernennung und gab als Grund dafür in einer offiziellen Erklärung den schlechten gesundheitlichen Zustand des Dichters an. Tatsächlich aber findet sich in der FBI-Akte eine Notiz vom 22. November 1954 an Hoover, in der es heißt: „Nicht ernannt wegen ungünstigen Berichts“. Die Zeitung Washington Star suggerierte 1954 in einem Artikel, daß die mißglückte Ernennung politische Gründe habe, und in einem Interview äußerte Williams sein Erstaunen und Entsetzen: „For heaven’s sake, what kind of country is this?“ – Um Himmels Willen, was ist dies für ein Land?
Stefana Sabin, in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 5, Oktober 1994
Todesnachricht
Besuch bei William Carlos Williams etwa 1957, die Dichter Kerouac Corso Orlovsky saßen im Wohnzimmer auf dem Sofa und verlangten nach weisen Worten, der betroffene Williams zeigt durch die Vorhänge des Fensters auf die Main Street: „Es gibt ’ne Menge Dreckskerle da draußen!“
Nachts ging ich auf der Asphaltstraße des Campus
an dem deutschen Dozenten mit Brille vorbei
W.C. Williams ist tot, sagte er mit Akzent
unter den Bäumen von Benares; ich blieb stehn und fragte
Williams ist tot? Aufgeregt mit weiten Augen
unter dem Großen Bären. Ich stand in der Vorhalle
des International House Bungalows
Insekten schwirrten um das elektrische Licht
und las die ärztliche Todesmeldung in Time.
„draußen unter den Spatzen hinter den Fensterläden“
Williams ist im Großen Bären. Er ist nicht tot
während die vielen Seiten in seinem Tonfall
geordneter Wörter die Münder der schmächtigen Kinder
ergreifen sie sogar in Bengal besänftigen. So
dringt das Leben aus seinen Büchern; auch Blake
„Iebt“ durch seine wissenden Maschinen.
Waren seine letzten Worte irgendetwas Schwarzes da draußen
in dem mit Teppichen ausgelegten Schlafzimmer des giebligen
Holzhauses in Rutherford? Was sagte er wohl,
war irgendetwas im Bereich der Sprache geblieben
nachdem die Verdammnis von Schlaganfall und Gehirnlähmung
seine Gedanken ergriffen hatte? Wenn ich im Bardo Thödol
zu seiner Seele bete, könnte er das unerwartete Ereignis fremder
Gnade hören. Drei Wochen lang blieb es verborgen; jetzt aber sah ich
den Passaic und den Ganges als eins,
ich konnte in seine Andacht einwilligen
weil er am steinigen Ufer ging und zu einer Gottheit
im Fluß betete, die er nur erfunden hatte –
eine andere Ganga-Ma. Jetzt fährt er nicht auf einem himmlischen
Krokodil sondern auf dem alten rostigen Holland-
Unterseeboot im Erdgeschoß des Paterson Museums.
Oh trauert Ihr Engel der Linken! daß der Dichter
der Straßen jetzt ein Skelett ist unter dem Pflaster
und keine andere alte Seele so gut und schmächtig
und zart und männlich dich sehen kann,
Was du sein wolltest unter den Dreckskerlen da draußen.
Allen Ginsberg, 20.3.1963
PFLAUMEN
Verzeih W.C. Williams
Spät wieder zu Hause, finde ich dich
schlafend, eine anziehende Wölbung
unter dem Laken. Es ist klar und
deswegen sehr kalt heute nacht.
Mit meinen blutleeren Händen und
Eisfüßen dürfte ich es nicht wagen,
mich zu dir zu legen (eine ungebetene
Pause im Traum, die nach Fusel riecht).
Das Licht aus dem Kühlschrank wirkt
warm in diesem Klima, und ich mache mich
über die Nachricht her, die du wortlos
für mich hinterlassen hast. Ein Teller mit
Pflaumen, und jede einzelne schmeckt
nach einem reifen Ersatz, sehr saftig,
süß, wie die Entschuldigung für etwas,
das man sich überraschend eingesteht.
Hendrik Rost
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Hans-Jürgen Heise: Willliam Carlos Williams: die Demokratisierung der Metapher
Die Tat, 15.9.1973
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + PennSound +
MAPS 1, 2 & 3 + Internet Archive + Poets.org + Kalliope
Porträtgalerie: Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
William Carlos Williams – Eine kurze biographische Dokumentation.
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + KLG + IMDb +
Interviews + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.


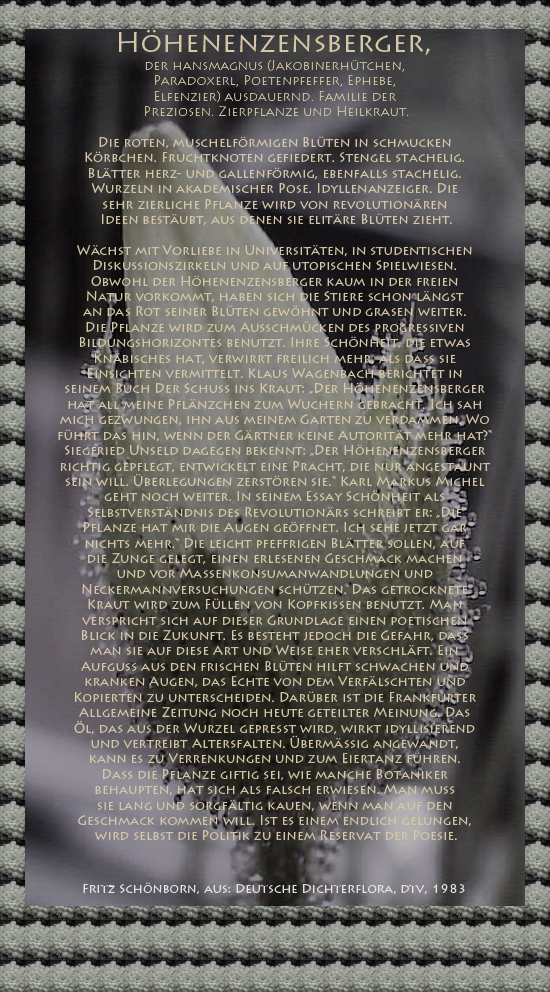
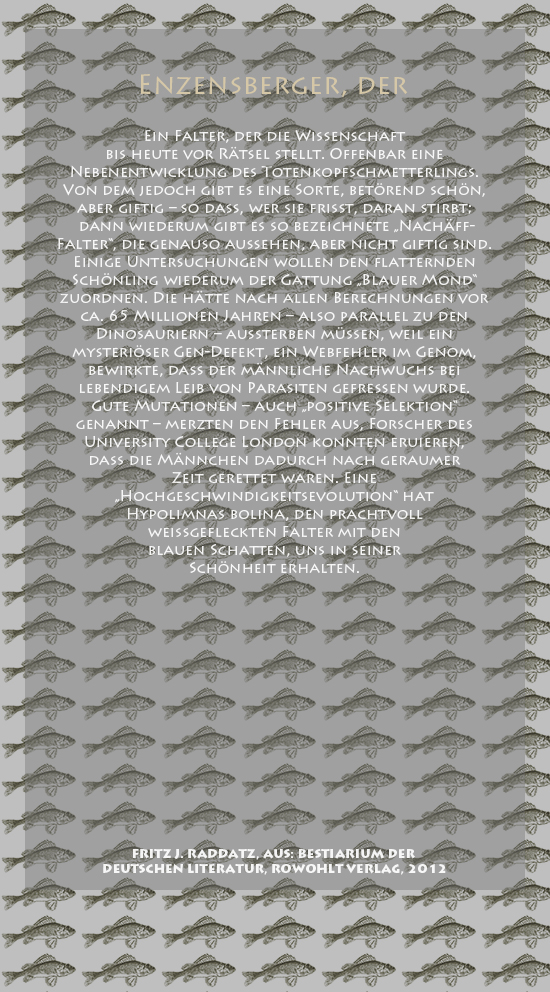












Schreibe einen Kommentar