Winfried Wehle (Hrsg.): 20. Jahrhundert Lyrik
TRANSFUGALE VERSE. LYRIK IM ZEITALTER DER DIGITALMODERNE
Kleine Archäologie der Computerpoesie
Computerpoesie ist nicht aus dem Nichts entstanden. Schon in Zeiten des sogenannten ,ersten Medienumbruchs‘ – der Entstehung der audio-visuellen Medien zu Beginn des 20. Jahrhunderts-werden entscheidende epistemische und ästhetische Voraussetzungen für die erst in den 60er Jahren einsetzende, rechnergestützte Texterzeugung geschaffen: Die alte Verskunst macht um das Jahr 1910 herum mobil. An erster Stelle genannt sei Filippo Tommaso Marinetti, dessen theoretischen Überlegungen jenseits der viel zitierten martialischen Parolen ein frühzeitiges Gespür für den Zusammenhang zwischen Literatur und Medien erkennen lassen.
Im berühmten ersten Manifest des Futurismus aus dem Jahr 1909 ist noch keine Rede von neueren Übertragungsmedien und ihren Konsequenzen für die menschliche Wahrnehmung. Wichtige Bausteine zu einer Art Medientheorie ante litteram werden in einem späteren, mit „Distruzione della sintassi“ (1913) überschriebenen Manifest geliefert. Darin werden die wahrnehmungspsychologischen Folgen respektive anthropologischen Umkodierungen durch den seinerzeit statthabenden, umfassenden Medienumbruch auf eingängige Weise entfaltet:
Coloro che usano oggi del telegrafo, del telefono e del grammofono, del treno, della bicicletta, della motocicletta, dell’automobile, del transatlantico, del dirigíbile, dell’aeroplano, del cinematografo, del grande quotidiano (sintesi di una giomata del mondo) non pensano che queste diverse forme di comunicazione, di trasporto e d’informazione esercitano sulla loro psiche una decisiva influenza. (Marinetti: 1968, 57)
Marinetti dringt demnach bereits zu einem vertieften Verständnis von der Materialität der Kommunikation vor, und wenn er von einem „completo rinnovamento della sensibilità“ spricht, dann weist er auf die apriorische dispositive Funktion technischer Medien hin. Durch entsprechende Ergänzungen steigert sich die Wahrnehmungs- und Aufnahmefähigkeit ins Unermessliche, zu eben jenem genannten „completo rinnovamento della sensibilità“ (ebd.). Dabei dient ihm die von dem italienischen Physiker Guglielmo Marconi seinerzeit entwickelte Drahtlostelegraphie (telegrafia senza fili) als Modell für eine Neuausrichtung der menschlichen Phantasie. Marinettis Argument ist dreiteilig. Da man mittels neuer Fortbewegungsvehikel bzw. neuer Übertragungstechniken entfernte Punkte der Erde bzw. entfernt lebende Kommunikationspartner kurzschließen könne, entstehe ein völlig neues Reservoir an Analogiebildungen, das wiederum in Wechselwirkung mit einer renovierten Einbildungskraft trete, die sich über entsprechende Ähnlichkeitsstrukturen bis in die Sprache des futuristischen Dichters verlängere und schließlich im futuristischen Genie-Text materialisiere:
Per immaginazione senza fili, io intendo la libertà assoluta delle immagini o analogie, espresse con parole slegate e senza fili conduttori sintattici e senza alcuna punteggiatura.
(Marinetti: 1968, S. 63)
Marinettis Befreiungsdiskurs ist also das Ergebnis eines gewaltigen Medienumbruchs. Strenggenommen sind adäquate kulturelle Sinnbildungsprozesse fortan einzig und allein dank neuer Übertragungstechniken möglich, eine Sichtweise, die schließlich zur Apotheose der Medien selbst zu führen scheint, zu Marshall McLuhan. Einer der berühmtesten Sätze aus dem Theorienhimmel des 20. Jahrhunderts lautet „The medium is the message“ und stammt aus seinem Klassiker Understanding Media (1964). Darin wird ein im Grunde einfacher, aber folgenreicher Gedanke geäußert. Bei der Reflexion über die Bedeutung von Medien müsse man von den übertragenen Inhalten absehen. Allerdings geht es McLuhan mit dieser Formel nicht um eine zynische Reduktion auf das permanente Rauschen, unangesehen der Botschaften. Vielmehr möchte er mit seinen Büchern auf die tiefgreifende und wirklichkeitsverändernde, wenn nicht realitätserzeugende Wirkung der technischen Medien hinweisen.1 Auf überzeugende Weise hatte er das bereits in seinem Buch The Gutenberg-Galaxy (1962) getan. Darin wird gezeigt, was es heißt, wenn mündliche Gesellschaften über die Chirographie in das Zeitalter der Typographie eintreten: Die Technisierung des Wortes führt zu Veränderungen im Denken – und Dichten.
Es mag von einigem Interesse sein, dass auch in dieser Hinsicht eine Linie zurück zum Futurismus führt. Schon Marinetti war die egalisierende technische Disziplinierung durch die Typographie nicht entgangen: Die ursprünglich freie Mitteilung in der mündlichen Rede oder in der idiosynkratischen Handschrift wurde im Prozess der Zivilisation dem Normierungserfordernis der Druckschriftlichkeit unterworfen und dementsprechend gezähmt. Daher plädiert er für eine „rivoluzione tipografica“ (Marinetti: 1968, 67). Der Schriftsatz habe mehrfarbig zu sein, außerdem sollten mindestens zwanzig Schrifttypen verwendet werden, schließlich Kursiv- und Fettdruck, und zwar mit folgendem Ziel: „Con questa rivoluzione tipografica e questa varietà multicolore di caratteri io mi propongo di raddoppiare la forza espressiva delle parole“ (ebd.), eine Ausdruckskraft, die mit den Mitteln digital gestützter Darstellungstechnik ins Unermessliche gesteigert werden kann und zu entsprechenden Modifizierungen in den Sprachen nicht nur der Lyrik geführt hat. – Als weitere Maßnahme gegen eine passatistisch erstarrte Tradition beabsichtigt Marinetti im Sinne der neuen Simultanwahrnehmung einen „lirismo multilineo“ (ebd., 68) ins Werk zu setzen: Texte sollen nicht länger linear sondern eher wie eine Partitur gestaltet sein, ein Vorhaben, das er u.a. in dem Kriegsgedicht „Zang tumb tuum“ (1914) umgesetzt hat und das in der heutigen Diskussion um Hypertextualität wieder aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist.
Weiterhin fällt auf, dass just in jenen Jahren, als Ferdinand de Saussure Sprache als arbiträres Zeichensystem definiert und damit den linguistischen Strukturalismus begründet, in der Lyrik das Gegenteil praktiziert wird. Gemeint ist die schon im Futurismus angelegte Tendenz zu figurativer Schriftgestaltung, genauer, zu einer ikonischen Repräsentation der Wirklichkeit durch das Schriftbild. In Apollinaires berühmtem Bildgedicht „Lettre-Océan“ (1914) zum Beispiel gerät die angestammte Letternordnung durcheinander: Die Wörter verlassen das enge linear-horizontale Korsett okzidentaler Schriftsysteme, und sie imitieren – die Möglichkeiten einer neuen Toposyntax ergreifend – auf diskrete Weise das Bild des Eiffelturms: der linke Letternkreis vermutlich den Fuß des Eiffelturms, der rechte die Funkstation auf der Turmspitze.2 Solchermaßen in konzentrischen Kreisen angeordnet, erinnern die Sprachzeichen an die Schallwellen eines Senders. Sie thematisieren damit einerseits medienreflexiv ein neues Übertragungsmedium in Gestalt der Drahtlostelegraphie, andererseits scheinen sie sich regelrecht zu bewegen. Es spricht wenig dagegen, diese pseudo-kinetischen Letternschaubühnen als Vorläufer der digitalen Künste mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Textanimation anzusehen.
Das solchermaßen multinear und prä-kinästhetisch verrückte Sinngebilde namens „Gedicht“ wird darüber hinaus noch weiter destabilisiert, und zwar durch das aleatorische Prinzip der Collage, wie etwa in Tristan Tzaras bekanntem Gedicht „Pour faire un poéme dadaïste“ (Tzara: 1975, 382). Darin wird dem Dichter empfohlen, beliebige Zeitungstexte auszuschneiden und diese nach dem Zufallsprinzip zu collagieren: „Et vous voilà un écrivain infiniment original“ (ebd.), wie es in der Coda des Gedichts heißt. Hier wird nicht nur die alte Mär vom Dichter als Seher und orphischen Beschwörer des nie Gehörten versachlicht, wenn nicht zu Grabe getragen, hier wird darüber hinaus ein Weg gebahnt, der mittelfristig zu den Permutationsexperimenten der Gruppe Oulipo3 führt und langfristig in der algorithmisch erzeugten Dichtung rechnergestützter Poesiemaschinen endet. Tzaras Absage an die klassische Werkästhetik votiert für eine mögliche, potentielle Literatur, die auf der Basis von Regeln und Programmanweisungen entstehen kann; wie zum Beispiel in Raymond Queneaus Sonett-Buch Cent mille milliards de poèmes aus dem Jahr 1961. Es enthält zehn Sonette mit jeweils 14 Versen. Alle Verse können miteinander kombiniert werden, was tatsächlich funktioniert, weil die Gesetze der grammatischen Kohäsion nicht verletzt werden. Das Ergebnis ist beachtlich, wie Queneau stolz verkündet:
Les choses étant ainsi donnés, chaque vers étant placé sur un volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 1014 sonnets différents, soit cent mille milliards.4
Damit die zehn Sonette kombiniert werden können, befinden sich die jeweils 14 Verse in der Buchfassung auf einzelnen Streifen.
Durch diesen eigenwilligen Eingriff in das statische Speichermedium Buch ist es dem Leser möglich, gänzlich neue Texte zu erzeugen. Er wird dadurch zum interaktiven Partner des Autors. Beide Tendenzen – kombinatorische Aleatorik und Interaktivität – werden im Zeitalter der Digitalmoderne aufgegriffen und mit den Möglichkeiten der ersten Großrechner auf spezifische Weise ausgebaut.
Hypertext als autooperatives Zeichensystem
Auch wenn die Buchstaben schon in Zeiten der historischen Avantgarden das Laufen lernen, indem die Wörter das vorbestimmte Korsett der Gedichtzeile abstreifen und wie von einer würfelnden Hand über das Blatt verstreut scheinen, so bleiben sie doch dem angestammten Trägermedium des Buches verhaftet. Mit der Erfindung der hypertextuellen Schriftproduktion ändert sich jedoch der Status der Schrift grundlegend. Dem Hypertext liegt mit dem Programmcode eine Art Hypotext zugrunde, der kleine Anweisungsvorschriften enthält. Die wohl wichtigste Vorschrift besteht in der Verknüpfung, dem sogenannten Link. Selbstverständlich hat es schon immer Verknüpfungen in Texten gegeben, ja, die Textlinguistik sieht sogar eine eigene grammatische Kategorie für Verknüpfungswörter vor. Zum Beispiel ist der Konnektor „Im Folgenden“ in dem Satz „Im Folgenden geht es um Poesiemaschinen“ ein textdeiktischer, kataphorischer Hinweis zum Zwecke der Leserorientierung. Aber in der Gutenbergwelt müssen vom Leser Raum und Zeit in Rechnung gestellt werden, um das Ziel des Verweises zu erreichen. Das gilt im Übrigen auch für das Inhaltsverzeichnis oder das Zitat als klassischen Formen des Verweisens. In einem Hypertext dagegen kann der Leser durch aktivierte Zeichen oder Felder ohne Umschweife zum Zielpunkt und wieder zurück oder aber zu einem anderen, neuen-Ziel gelangen, wodurch ein nicht-linearer, netzartiger Text entsteht, der seit der Erfindung des world wide web den gesamten Globus umspannt.5
Mit Blick auf die Computerlyrik ist die Idee der non-linearen Verknüpfung und die damit verbundene Rhizom-Vorstellung allerdings zu vernachlässigen. Im Unterschied zur narrativen Hyperfiction, bei der der Autor dem Leser oder User vielerlei Aktionswörter oder -felder anbietet, damit Letzterer sich seinen eigenen Text konstruieren kann, enthalten lyrische Texte vergleichsweise wenige Hyperlinks. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage nach der Medienechtheit und Medienrelevanz von Computerlyrik, herrscht doch Übereinkunft darüber, dass nur solche Lyrik, die sich die spezifischen Eigenschaften des digitalen Mediums zu eigen macht, auch diesen Namen verdient.6 An diesem Punkt könnte womöglich mit Gewinn eine alternative theoretische Diskussion herangezogen werden, nämlich die um das Medium Schrift als Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine.7 Denn aus dem Blickwinkel der Schrifttheorie wird der grundlegend neue Charakter computerieller Schrift hervorgehoben, insofern sie eine Weiterentwicklung des referentiellen bzw. operativen Schrifttyps darstellt. Traditionell wird die Schrift als ein solches Zeichensystem aufgefasst, das die gesprochene Rede phonetisch nachahmt und dessen Zeichen wie Stellvertreter funktionieren, also für etwas in der außersprachlichen Wirklichkeit stehen. Neben diesen ontologischen Symbolismus tritt in der frühen Neuzeit der sogenannte operative Symbolismus: Die Zeichen lösen sich von ihren Referenzobjekten und können unabhängig von ihnen gehandhabt werden:
Die Zeichen werden durch die Operationen, nach denen sie manipulierbar sind, als Gegenstände spezifiziert. Man muss die Operationen kennen, um einen bestimmten Zeichengegenstand zu kennen. (Grube: 2005, S. 103)
Spätestens mit dem mathematischen Kalkül kann die Schrift nicht mehr auf das Fixieren von Sachverhalten reduziert werden, vielmehr können operative Zeichen wie Lösungswerkzeuge gebraucht werden. Im digitalen Zeitalter radikalisiert sich diese Tendenz, insofern Zeichen entstehen, die auf die Anweisungen des Zeichenverwenders oder Users reagieren bzw. sogar selbständig agieren und dadurch einen autooperativen Charakter annehmen:
Beim agierenden Zeichen muss man abwarten, muss man auf die Reaktion des Zeichenautomaten schauen, muss man schauen, was die Zeichen tun. Der Mensch fordert die Zeichen auf, sich so und so zu verhalten. (ebd.)
Damit rückt neben das erklärungsmächtige Prinzip der Nicht-Linearität8 das der Interaktivität, insofern Zeichenkomplexe auf die Aktionen eines Autors oder Lesers reagieren. Daraus ergibt sich ein grundlegender Haltungswechsel beim Umgang mit Hypertexten. Fortan kommt es darauf an, das Verhalten von Zeichenkomplexen zu steuern. Überspitzt könnte man mit Grube formulieren:
Die Frage ist nicht, was steht in dem Text, sondern sie lautet: welche Reaktionen kann man von dem Text verlangen? (Grube: 2005, S. 107)
Diese Zuspitzung mag aus heuristischen Gründen gerechtfertigt erscheinen, wodurch ein oft übersehenes Merkmal von Hypertexten sichtbar werden kann. Diesem Alleinstellungsmerkmal zum Trotz wird sich jedoch in der konkreten Analysepraxis von digitaler Poesie zeigen, dass der referentielle Schriftgebrauch weiterhin eine wichtige Rolle spielt, auch wenn er in manchen Fällen auf eine Schwundstufe reduziert wird.
Poesiemaschinen
Etwa zur gleichen Zeit als Queneau die Seiten des Speichermediums Buch zugunsten kleinerer, komputierbarer Einheiten auflöste, entstanden die ersten Poesiemaschinen. Im Jahr 1959 veröffentlichte Theo Lutz, ein Schüler aus dem Stuttgarter Kreis um Max Bense, in der Zeitschrift augenblick einen Artikel unter dem Titel „Stochastische Texte“.9 Darin erläutert er ein Poesieprogramm, das er für die Großrechenanlage ZUSE Z 22 geschrieben hatte. Mit Hilfe von Subjekten, Prädikaten, logischen Operatoren und Konstanten sowie der Kopula „ist“ werden von einem Zufallsgenerator künstliche Texte erzeugt. Im Jahr 1964 veranstaltete der Oulipo-Mitbegründer François Le Lionnais eine Konferenz an der Universität Liège unter dem Titel Machines logiques et électroniques et littérature. Damit fiel eine bemerkenswerte Vorentscheidung über die Fortentwicklung der Gruppe Oulipo, die – darin ist sich die Forschung einig10 – von jeher eine Neigung zum maschinellen Dichten hatte und die dieser Neigung in Zukunft verstärkt nachgehen sollte. Ein markanter Einschnitt sollte die Gründung einer weiteren Werkstatt für potentielle Literatur sein. Gemeint ist die Gruppe A.L.A.M.O., die u.a. von den Oulipiens Paul Braffort und Jacques Roubaud im Juli 1981 gegründet wurde. Das Akronym steht für „Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs“. Bei der Definition von Regeln zur Texterzeugung setzten die Mitglieder der Gruppe A.L.A.M.O. im Unterschied zu Oulipo konsequent auf den Computer, was man sich am einfachsten im Umgang mit Queneaus Cent mille milliards de poèmes klarmachen kann: Während die Sonette in der Papierversion räumlich gegenwärtig sind, haptisch erfasst und damit im wahrsten Sinne des Wortes ,begriffen‘ werden können, ist das in der algorithmischen Version nicht mehr der Fall. Letztere wurde von dem Experimental-Dichter Tibor Papp11 programmiert, und zwar so, dass sich der Leser das Sonett über die Tastatur bzw. mittels eines Generators selbst zusammenstellt.
Den zehn Sonetten sind in einem abgetrennten Steuerfeld die Buchstaben „a“ bis „j“ zugeordnet. Als zusätzliches distinktives Merkmal wird die Farbe der Schrift eingesetzt. Der Leser kann also unter Angabe der Verszeile in Kombination mit einem Buchstaben aus dem Steuermenü unterschiedliche Versionen der virtuell vorhandenen Möglichkeiten realisieren, indem er auf das entsprechende linguistische Repertoire zugreift. Auf der Abbildung 2 beispielsweise stammen die Verse des ersten Quartetts aus dem ersten, dritten und sechsten Sonett. Zusätzlich ist die Möglichkeit vorgesehen, über den Tastaturknopf „z“ ein rein aleatorisches Gedicht zu erzeugen. Im Unterschied zur Papierversion, bei der Alternativen räumlich kopräsent sind, erscheint immer nur der unmittelbar zuvor erzeugte Oberflächentext. Daraus folgt, dass erst durch die Computerfassung das typographische Prinzip der Linearität außer Kraft gesetzt wird. Denn auch wenn die Papierstreifen die Verszeilen kombinierbar machen, so müssen sie aufgrund der drucktechnischen Beschränkung doch hintereinander angeordnet werden, das heißt, hinter dem ersten Vers des ersten Sonetts folgt der erste Vers des zweiten Sonetts usw. bis zum ersten Vers des zehnten Sonetts. Sie bilden ein zwar flexibles aber dennoch räumlich geordnetes Papierstreifenbündel, das einen ersten und einen letzten Streifen aufweist. Damit aber bleibt – wenn auch auf einer Schwundstufe – jene klassische Syntagmatik einer Canzoniere-Teleologie zumindest noch im Bereich der Möglichkeit, welche von alters her ein Gattungsmerkmal von Gedichtsammlungen war, das auch in der Lyrik des 20. Jahrhunderts durchaus noch wirksam war.
Ein weiterer Unterschied besteht natürlich darin, dass Queneaus 1014 Versionen mit EDV-Unterstützung tatsächlich durchgespielt werden können. Zusätzlichen ästhetischen Reiz bezieht Tibor Papps Version dadurch, dass der kreative Prozess an eine Maschine delegiert und damit im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand gegeben wird, eine Maschine, welche der poetischen Performance dank kombinatorischer Effizienz ein überraschendes Element der Plötzlichkeit hinzufügt und aufgrund der immateriellen Zeichenartikulation nicht zuletzt ein flüchtiges Spiel von An- und Abwesenheit in Gang zu setzen vermag: So gesehen erhält Baudelaires beau fugitif eine unerwartete – wenn auch nur akzidentelle – digitalmoderne Neuprägung.
Einer der wichtigsten Vertreter auf dem Feld der algorithmischen Poesie ist Jean-Pierre Balpe.12 In den von ihm programmierten Generatoren werden Texte erzeugt, die dem Zufallsprinzip entspringen und im Unterschied zu Queneaus Cent mille milliards de poèmes nicht immer den Regeln der grammatischen Kohäsion entsprechen, wie nachstehendes Beispiel zeigt:13
Die Verse sind aus mehreren europäischen Sprachen willkürlich zusammengewürfelt. Der lesende Benutzer dieser Maschine hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Verse. Er kann den Verse schmiedenden Generator nur in Gang setzen. Nur der Grad der Sprachmischung kann per Maus über eine Skala beeinflusst werden, die sich am unteren Bildrand befindet: Das zu erzeugende Gedicht kann „Besonders französisch“ oder „Besonders deutsch“ erscheinen. Es hätte keinen Sinn, den jeweils manifesten Text zu interpretieren, da er sich mit jedem Zugriff des Lesers verändert und in einem durchaus pathetischen Sinne absolut flüchtig ist. Auch in diesem Fall steht also der Programmcode mit seinen Erzeugungsmöglichkeiten im Mittelpunkt des Interesses. Dabei geht es Balpe nicht um die computerielle Modalisierung eines bestimmten Textes, sondern um die Ausstellung von Texterzeugungsverfahren an und für sich. Im vorliegenden Beispiel gibt es weder einen Anfang noch ein Ende, der Prozess ist wichtiger als das Resultat, eine erschöpfende Lektüre des Werks wäre unmöglich. Von Interesse ist ganz im Gegenteil die Regenerationsfähigkeit des Gedichtes, die keine Vielfalt hervorbringt, sondern Präsenz beliebig vervielfältigt und damit letztlich auf eine infinite Menge absenter Texte verweist. In anderen Worten:
Plutôt que de médiatiser du texte l’écran explore alors les imaginaires du texte, d’où les ambiguïtes de ses lectures: ce qui est lu est autant ce qui n’est pas affiché mais qui pourrait l’être que ce qui est contextuellement donné à lire: la présence du texte signe en même temps toutes ses absences.14
Damit ist sicherlich ein wichtiger Aspekt von Babel Poesie benannt.15 Wenn man sich aber nicht damit begnügt, eine Interpretation in den Selbstaussagen des Autors auf gehen zu lassen, dann könnte – den einschlägigen Hinweisen Jean-Pierre Balpes zum Trotz – die Frage nach der Semantik und der Pragmatik des Werks womöglich doch mit einigem Gewinn gestellt werden. Käme es nur auf die algorithmischen Prozesse an, müsste Balpe seinem Gedicht dann einen Titel geben? Warum wählt er den generischen Titel Babel Poesie? Zudem stellt Balpe das Gedicht in einen konnotativ aufgeladenen kulturhistorischen Kontext: Mit einigem Recht könnte man behaupten, dass Babel Poesie bei jedem Leser den Gedanken an die Sprachvielfalt bzw. – in Analogie dazu – an die zunehmende Sprachdurchmischung im Zeitalter der Mundialisierung aufkommen lässt.16 Die heutige metropolitane Vielsprachigkeit eröffnet aber im Unterschied zur alttestamentarischen Bestrafungsgeschichte nicht die potentiell tragische Dimension mangelnden Verstehens, vielmehr kann sie mit postmoderner Nonchalance auf Kommando überwunden werden: Wie schon erwähnt, wird das Gedicht per Mausklick „besonders französisch“. Allerdings besteht die Ironie dieser Ironie nun gerade darin, dass der Generator dem Wunsch nach sprachlicher Reinheit nicht vollständig entspricht, da der Text weiterhin Elemente fremder Sprachen aufweist und zudem weder dem Gesetz der Kohärenz noch dem der Kohäsion untersteht.
Man darf noch einen Schritt weitergehen in Richtung mediologischer Überlegungen, denn der Babeltopos hat sich längst auf dem Feld der Alltagssoftware ausgebreitet, entsprechende Popularität erlangt und damit natürlich sein diskursives Ansteckungspotential erhöht. Man denke etwa an die bekannten Übersetzungsprogramme namens Babel Fish oder Babylon Translator, mit denen jeder Benutzer der weltweiten Suchmaschine Altavista bzw. des Betriebssystems Microsoft Windows regelmäßig zu tun hat. Während diese kommerziellen Maschinen qua Namensgebung eine versöhnliche translatio – wenn nicht iterative Pfingsterlebnisse – dank effizienter Übersetzungsgeneratoren in Aussicht stellen, verweigert Balpes Babel-Maschine diesen Dienst, indem er genau den umgekehrten Weg einschlägt, die parasitären Mitnahmeffekte der intermedialen Bezugnahme durchaus einkalkulierend. So gesehen dient Balpes Automat paradoxerweise der Entautomatisierung und kritischen Relativierung der in postmodernen Zeitläuften geronnenen Idee von linguistischer Flexibilität.
Dass absolute Poesie in Gestalt von Poesieautomaten entgegen auktorialer Absichtserklärungen nicht ohne diskursive Kontexte auszukommen vermag, zeigt sich an einem weiteren, ähnlich gearteten Beispiel. Die Rede ist von Christophe Brunos interaktiver Maschine GogolChat. Auch dieser Titel hat eine generische Komponente, und er deutet bereits an, dass der Chat als neuere Form des schriftlichen Echtzeitgesprächs den performativen Rahmen bilden soll. Wie beim Online-Chat muss man sich mit einem Benutzernamen einloggen, um mit Gogol in einen Dialog einzutreten. Es erscheint ein Textfeld mit der Bezeichnung „Envoyez votre message“, in das man eigene oder fremde Verse eingeben kann. In nachstehender Momentaufnahme wurden die ersten fünf Verse von Baudelaires Gedicht „A une passante“ verwendet:
Die Antworten werden durch einen Algorithmus erzeugt, der nach dem gleichen Prinzip wie dem von Suchmaschinen funktioniert, das heißt, die verbalen Eingaben des Nutzers werden von Gogol wie Assoziations-Stimuli wahrgenommen und im Rückgriff auf das gesamte Text- und Bildarsenal des Internets gemischt. So wie das postmoderne Orakel, die Suchmaschine Google, das Internet nach relevanten und statistisch signifikanten Informationen durchsucht und diese für den Informationssuchenden zusammenstellt, so erkundet Gogol dessen Text- und Bildarsenal auf der Suche nach passenden Zeichenketten. In der vorgenannten Momentaufnahme reagiert die Maschine auf den hohen Ton des ersten Baudelaire-Verses mit einer sublimen, ,typisch lyrischen‘ Periphrase („astre des nuits“). Ab dem zweiten Vers erkennt Gogol dann, dass es sich um ein Baudelaire-Gedicht handelt, und er ordnet es in korrekter Weise der einschlägigen Gedichtsammlung zu, unterläuft dabei aber sogleich wieder den hohen Ton, indem „mal“ mittels phonetischer Aussprache zu „malle“ transformiert und banalisiert wird. Der Reiz der Maschine besteht also u.a. darin, dass zwischen den verbalen Impulsen des Nutzers und den per Mausklick maschinell erzeugten ,Antworten‘ immerhin eine semantische oder phonologische Ähnlichkeit besteht, aber der jeweilige Kontext dann willkürlich hinzugefügt wird, so dass der Ausgangstext wie in einem Zerrspiegel erscheint.
Wie schon im Falle von Babel Poesie liegt mit GogolChat ein Werk vor, das auf die Kulturtechniken des jüngsten Medienzeitalters reagiert oder, besser, den autooperativen Zeichengebrauch in der ästhetischen Vermittlung auf indirekte Weise im doppelten Sinne des Wortes vorführt. Diese Vorführung erfolgt im Modus der Satire, und zwar durch eine parasitäre Zweckentfremdung von etablierten Techniken der Digitalmoderne. Im Unterschied zum fiktionalisierenden literarischen Situationsaufbau, bei dem der Leser in eine unbekannte Welt geführt wird, zielt satirische Indienstnahme darauf ab, bekannte Sachverhalte zu entstellen. Auch als Mediensatire hat Satire einen Sitz im Leben. Der im Titel evozierte interrelay chat ist dem heutigen Computernutzer als neuere Form der unmittelbaren Kommunikation bekannt. Christophe Bruno kann also – was Struktur und Funktionsweise des Chat angeht – einen eingeübten Rezeptionshorizont bei seinem Publikum voraussetzen. Dementsprechend funktioniert seine Poesiemaschine auf der Oberfläche wie der Online-Chat. Zudem wird „Gogol“ als Gesprächspartner in Aussicht gestellt, eine für das französische Publikum unschwer erkennbare Anspielung auf die weltweit bedeutendste Suchmaschine namens „Google“, existiert doch seit einigen Jahren eine beliebte frankophone Netzparodie namens „Gogol“, die dem seriösen Original verblüffend ähnlich sieht:
Bekanntlich steht der Name „Google“ für höchste Effizienz bei der Informationsrecherche. Der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz beruht auf einem ausgeklügelten, streng geheimen Such-Algorithmus, der u.a. den sogenannten „Page-Rank-Wert“ – also die Verknüpfungshäufigkeit – als relevantes Kriterium berücksichtigt. Indem nun in Christophe Brunos Poesiemaschine GogolChat textexterne, ursprünglich ,gerade‘ Fakten durch Verstöße gegen die Griceschen Konversationsmaximen absichtlich entstellt werden, werden sie im Sinne einer parteilichen Aussageintention umgedeutet: In Brunos zweckfreiem Reich der Automatenpoesie können Relevanz und Ranking keine Macht ausüben. Dabei hält Bruno als digitaler Poet die Balance zwischen Tendenz und Ästhetik: Zwar muss die satirische Tendenz eindeutig als negativ abwertende Kritik textexterner Pragmatik erkennbar sein, aber dieses unabdingbar notwendige reale Substrat in Gestalt von Ereignissen, Personen, Texten oder Diskursen wird nicht direkt attackiert, sondern in der ästhetischen Vermittlung medienspezifisch präsupponiert, indem die technischen Möglichkeiten der autooperativen Schrift durch den Filter der Irrelevanz geschickt werden.
Konkrete und visuelle Poesie
Inzwischen haben sich Computer zum totalen Medium par excellence weiterentwickelt, so dass alles, was darauf gespeichert und auf dem Bildschirm dargestellt werden kann, prinzipiell beweglich ist. Auch die neuen technischen Schriften und Bilder sind aus einer mobilen, abzählbaren Menge von sogenannten Pixeln („picture elements“) zusammengesetzt und können daher beliebig rekombiniert und manipuliert werden, was der konkreten und visuellen Poesie neue Möglichkeiten eröffnete. Die durch Buchstaben symbolisierten Schallwellen von Apollinaires „Lettre-Océan“ (s.o.) etwa könnten auf einem elektronischen Trägermedium in Schwingung versetzt, seine nicht minder berühmte Buchstabenfontäne könnte zum Sprudeln gebracht werden, Gestaltungsspielräume also, die von nachwachsenden Künstlergruppen dann auch ausgefüllt wurden. Im Jahr 1988 gründete sich die Gruppe L.A.I.R.E. („Lecture“, „Art“, „Innovation“, „Recherche“, „Écriture“), deren Mitglieder im Unterschied zu denen der Gruppe A.L.A.M.O. weniger an den Algorithmen des Quellcodes als vielmehr an multimedialen Manifestationen interessiert waren. Als Verbreitungsorgan für digitale Poesie diente den Autoren die im Januar 1989 gegründete Zeitschrift alire, eines der weltweit ersten rein elektronischen Literaturmagazine, das seinerzeit auf Disketten verbreitet wurde und inzwischen als CD-ROM zur Verfügung steht. Die bislang letzte Ausgabe Nr. 12 erschien im Jahre 2004. Lässt man die wichtigsten Beispiele aus der 15-jährigen poetischen Praxis Revue passieren, dann zeichnen sich zwei gegenläufige Tendenzen ab: Multimediale Formate nehmen insgesamt zu und fächern sich mehr und mehr aus, während der schriftsprachliche Kanal zurücktritt, scheinbar auch seine referentielle Dimension. Wie man sich das im Einzelnen vorzustellen hat, sei an zwei Beispielen erläutert, an den animierten Gedichten „Les très riches heures de l’ordinateur n° 4“ (Tibor Papp) und „Passage“ (Philippe Bootz).
Das erste Beispiel ist der ersten Nummer aus dem Jahr 1989 entnommen. Es stammt also aus einer Zeit, in der Festplatten und graphische Benutzeroberflächen mit Maussteuerung noch nicht verbreitet waren. Der Titel lautet „Les très riches heures de l’ordinateur n° 4“. Urheber ist der bereits erwähnte Neoavantgardist Tibor Papp. Dem Titel ist zu entnehmen, dass es sich um ein poetologisches Gedicht handelt, das die materielle Seite der Produktion in Gestalt eines „ordinateur“ einbezieht. Angesichts des vorausdeutenden Titels steht zu vermuten, dass alles Folgende als Resultat einiger einfallsreicher Stunden des Computers Nr. 4 anzusehen ist, ein Ergebnis, das Fülle, wenn nicht Überfülle an Einfällen suggeriert und von dem sich der Sprecher des Gedichts zugleich ironisch distanzieren kann, da es ja von einer Maschine erzielt worden ist.17
Das Gedicht läuft über ein kleines Ausführungsprogramm ab. Es gliedert sich in zirka 15 Textbilder, die sich durch animierte Text- und Bildelemente nach und nach wie in einem Film aufbauen und wieder verschwinden, weshalb es vom Leser nicht unterbrochen oder manipuliert werden kann. Dabei werden Motive entfaltet, die teils auf kohärente, teils auf kohäsive Weise, mitunter aber auch gar nicht aufeinander bezogen sind. Im Gedichtauftakt wird der Titel durch eine polychrome und wechselnde Gestaltung der Schrift visuell in Szene gesetzt, die Zahl „4“ des „ordinateur n° 4“ wird dabei als mise en abyme vorgestellt, denn sie ist nach dem Muster der vorkonkretistischen Lyrik aufgebaut, wie etwa Louis Aragons Gedicht „Persiennes“:18 Bei Aragon addieren sich die Lautkörper des Wortes „persienne“ zu der Gestalt eines Fensterladens, bei Papp bilden lauter kleine ,Vieren‘ das Zeichen „4“.19 Das Komma wird hingegen entkonkretisiert, denn es erscheint im nächsten Textbild in Großbuchstaben verschriftlicht als „VIRGULE“ und erweckt durch diese Verfremdung unsere Aufmerksamkeit. Bald wird klar, dass es als rhythmisierendes Eröffnungszeichen der folgenden ,Performance‘ dient. Denn „VIRGULE“ taucht erneut im vorletzten Bild als Schlusszeichen auf, so dass das multimediale Gedicht wie ein eingeschlossener Nebensatz bzw. wie ein eingeschlossenes Satzglied anmutet. Die abendländische Syntax wird also im vorliegenden Fall als ordnungsstiftende Metapher zur Organisation transphrastischer Text- und Bildeinheiten eingesetzt. Hinzugefügt sei, dass die durch dieses Eröffnungs- bzw. Schlusszeichen hergestellte Symmetrie durch ein identisches Syntagma zusätzlich stabilisiert wird. Vor bzw. nach „VIRGULE“ steht spiegelbildlich der Sprechakt „Je te déguste à petits bilboquets“. Wörtlich übersetzt ergibt das „Ich probiere dich in der Art des Kugelfangspiels“, frei übersetzt etwa „Ich probiere Dich häppchenweise“, und, wenn man die drucktechnische Bedeutung von „bilboquet“ (= Akzidenzdruck) berücksichtigt, dann erschließt sich eine dritte Konnotation:
Ich probiere dich in kleinen Gelegenheitsdrucken.
In der Folge werden die drei genannten konnotativen Bedeutungen – ludisch, sensuell-gustatorisch, medial – fallweise aktualisiert. Dabei wird die kataphorische Proform „te“ nicht eindeutig aufgelöst. Als mögliche Referenten kommen eine Frau und „la littérature“ in Frage.
Im dritten Textbild geraten die Lettern in Bewegung. Einzelne Wörter laufen ,ruckelnd‘ von der linken Seite auf den Bildschirm und bilden dort ein elfzeiliges Gedicht:
Sowohl der referentielle Gehalt als auch die mediale Textinszenierung verstärken den bereits erwähnten Eindruck einer meta poetischen Reflexion. Zunächst werden Wörter und Satzglieder mit kleinen Eisenbahnzügen verglichen. Dabei ist die Metapher doppelt motiviert. Zum einen bewegen sich die Wörter wie Züge, zum anderen sind sie innerhalb des Satzes frei beweglich und beliebig kombinierbar. Die Schlüsselwörter „déplacement“ und „accrochage“ sind deshalb auch rückbezüglich auf ihre digitale Artikulation hin zu interpretieren. Da „ces petits trains de mots“ zudem durch eine chiastische Umstellung in „mots en train“ verwandelt werden, wird die performative Energie der aktualiter über den Bildschirm laufenden Wörter zusätzlich herausgestrichen, insofern sie damit nicht nur als Symbole, sondern scheinbar auch als Agenten auftreten. Was den „accrochage libre“ angeht, so mag man darin einen Reflex auf Freivers und parola libera sehen, indes erleichtert um jenes Pathos der Befreiung, das sich die Vertreter der historischen Avantgarden vormals auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Denn die Eigenart dieser freien Verbindungen wird im nächsten Textbild über die Vergleichspartikel „comme“ auf bizarre Weise verfremdet und banalisiert: „[libre] comme le sable mouillé / à l’embouchure de la femme“ bzw. „à la fin du livre“. Durch den Vergleich wird eine Strandszene evoziert. Bei der folgenden Minimalgeschichte wird allerdings wegen des unklaren Bezugs der Proformen nicht deutlich, ob es sich um eine Frau am Strand oder um die Strandlektüre des Sprechers oder aber um die Lektüre über eine Frau am Strand handelt. Dann wird suggeriert, dass sich die Frau Richtung „orage de sel“ bzw. „de camomille“ entferne, worunter wahrscheinlich ein Bad im Meer und das anschließende Auftragen von Sonnenschutzsalbe zu verstehen ist. Im neunten Textbild sieht man einen geraden Kreiszylinder, der vertikal mit dem Ausdruck „une paille du regard“ beschrieben ist, ein änigmatisches, in der französischen Sprache nicht belegtes Kompositum, das auf Diskursebene anschlussfähig ist an die sprichwörtliche école du regard des Nouveau Roman, zumal ein vorangehendes Syntagma durch die animierte Darstellung einer sich schließenden Jalousie unsichtbar wird, womöglich eine Anspielung auf Alain Robbe-Grillets bekannten Roman La Jalousie. Im Kontext der vorliegenden Binnenpragmatik des Gedichts könnte es sich bei der „paille du regard“ analog dazu um ein Fernrohr handeln, mit dem der Sprecher die ganze Szene beobachtet: Die nicht weniger sprichwörtliche „paille dans l’œil de l’autre“ aus Lukas 6,41 würde damit augenzwinkernd zu einer surrealistischen Prothese und damit in ihr Gegenteil umdefiniert. Denn im Unterschied zu den sichtbehindernden biblischen „paille“ und „poutre“ können mit Hilfe von Teleskopen auch entfernte Räume medial überbrückt und sichtbar gemacht werden.
Im zehnten Textbild gesellt sich eine neuerliche Ausgeburt des Imaginären hinzu, die im Unterschied zur „paille du regard“ weniger auf die räumliche als vielmehr auf die zeitliche Dimension abhebt:
Der Ausdruck „horloge de l’œuf“ ist im Französischen nicht belegt. Immerhin bietet der Trésor de la langue française informatisé unter dem Lemma „œuf“ eine Spezialbedeutung:
HORLOG. OEuf de Nuremberg. Montre dont le boîtier est ovoïde, que l’on fabriquait a Nuremberg. Une grosse montre, un oeuf de Nuremberg, […] curieusement émaillee de diverses couleurs, constellée de brillants. (Gautier, Fracasse, 1863, p. 106)20
Auch wenn es sich dabei um eine Volksetymologie handelt, so liefert diese doch eine mögliche Verbindung für die beiden Ausdrücke. In Papps graphisch-ikonisierender Darstellung nämlich entsteht die bizarre Uhr nur deshalb, weil das animierte Pendel an einem eiförmigen Punkt befestigt und demzufolge einer arbiträren, funktionalen Verschiebung im Reich des Imaginären zu verdanken ist. Im nächsten Textbild wird der ovoide Fixpunkt des Pendels verwandelt und durch seine morphologische Ähnlichkeit mit dem Lautkörper des Buchstabens „o“ in nachstehender Apostrophe weitergeführt: „ooooooooooh littérature“. Damit wird das zweite mögliche Bezugswort für die vorerwähnten Proformen ins Spiel gebracht. In weiteren Text-Bild-Arrangements wird über sie ausgesagt, dass ihr Zimmer leer sei („ta chambre est vide“), eine Aussage, die sich natürlich auch auf die Frau beziehen kann, zumal der Zimmergrundriss durch das Schema eines Augapfels grundiert wird, was mit der bereits angesprochenen voyeuristische Komponente zu verrechnen ist. Schließlich erscheint das Pronomen „ELLE“ in übergroßen Majuskeln auf dem Bildschirm, die Buchstaben scheinen zu tanzen, der gesamte Wortkörper dreht sich um seine eigene Achse, ändert die Farbe, verwandelt sich in „BELLE“, erweitert sich dann um die beiden Buchstaben „RE“ („REBELLE“) und wird im Folgenden durch nachstehendes Syntagma kontextualisiert:
elle est REBELLE
et ruisselante
Beiden möglichen Referenten wird also eine paradoxe Kollokation zugewiesen. Frau bzw. Literatur sind widerspenstig und fließen doch sprudelnd dahin, eine gegenstrebige Fügung, die jedoch das lyrische Ich nicht von jener im Eingangssprechakt bekundeten Absichtserklärung abhalten kann – wird sie doch am Ende noch einmal aufgenommen:
Mais je te déguste à petits bilboquets.
Der Konnektor „Mais“ aktualisiert in diesem Kontext übrigens nicht seine primär adversative Bedeutung, sondern refutiert eine aus dem Vorangehenden resultierende negative Schlussfolgerung, die jedoch unausgesprochen bleibt und bloß suggeriert wird. Positiv formuliert: Der Sprecher wird durch den obwaltenden Befund nicht gehemmt, sondern, ganz im Gegenteil, er fühlt sich ermuntert zu fortgesetzten „heures de l’ordinateur“ und damit zu neuen Proben seiner Kunst.
Das zweite Beispiel „Passage“ (2004) stammt aus der bislang letzten Ausgabe Nr. 12 der Zeitschrift alire.21 Sein Schöpfer, Philippe Bootz,22 wäre seinem Anspruch nach eigentlich primär der algorithmischen Poesie zuzurechnen, einer Richtung also, der es weniger um multimediale Oberflächengestaltung als vielmehr um die dahinter liegenden Codes geht. Aber das vorliegende Gedicht übersteigt die auktoriale Selbstauslegung in mehrfacher Hinsicht, nicht zuletzt durch seine mehrdimensionale Oberflächengestaltung. Auf dem Bildschirm erscheinen zunächst einzelne Buchstaben und Wörter. Sie bilden Verse und vervollständigen sich nach und nach zu einem Gedicht, das von einer Unbekannten handelt, die entlang eines Wasserlaufs vorübergeht. Parallel dazu ertönt Musik, eigens komponiert von Marcel Frémiot. Das Programm läuft autonom ab wie bei einem Film, der Leser-User hat also keine Eingriffsmöglichkeiten. Besonders irritierend ist die Tatsache, dass der Mauspfeil verschwindet, wodurch sich beim User ein Gefühl der Ohnmacht einstellt. Haben doch Maus und Mauszeiger inzwischen den Status prothetischer Körperextensionen erreicht, deren Nichtfunktionieren als beunruhigend, wenn nicht als Krise erfahren wird. Allerdings ist man aufgrund der Paratexte bereits auf einen konterdiskursiven Umgang mit medialen Gepflogenheiten eingestellt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Nach dem Öffnen des Inhaltsverzeichnisses der Zeitschrift bewegen sich die Einträge in Gestalt von Schriftstellernamen sogleich mit großer Geschwindigkeit über den Bildschirm, und selbst geübten Computerspielern dürfte es kaum gelingen, beim ersten Versuch den gewünschten Eintrag anzuklicken. Damit opponiert alire also bereits auf der Ebene des Beiwerks zum Werk gegen Konventionen im Bereich der Internetkommunikation.
Aber zurück zu „Passage“. Die sich nach und nach aufbauenden und sogleich wieder verschwindenden Verse würden folgendes Gedicht ergeben:
Le pas
Le passe
Elle passe
Elle passe le fil
Elle passe le fil de l’eau
Le fil de l’eau passe
L’eau passe
Passe
Von einem Fußabdruck bzw. vom Schreiten eines Fußes über eine unspezifisch bleibende „Elle“, die entlang eines Wasserlaufs vorbeigeht, bis zum Wasserlauf selbst, dessen bloßes Fließen am Ende thematisiert wird, lässt das Gedicht eine minimale Erzählung erkennen, die von einem vergleichsweise neutralen Sprecher in einem rein konstativen Gestus aufgezeichnet wird, ohne dass einzelne Bestandteile miteinander verknüpft würden. Es ergibt sich insofern ein gewisser Spannungsbogen, als schon nach dem zweiten Vers das Prinzip der Ergänzung erkannt und in der Folge mit entsprechenden Auflösungen in Form solcher Ergänzungen gerechnet werden kann. So wird zum Beispiel vom zweiten auf den dritten Vers ,umgeschaltet‘, indem der Signifikant „Le“ durch „El“ ergänzt wird, wodurch ein neues Agens und damit eine Bedeutungsänderung ins Spiel kommt. Die folgende Ergänzung ist möglich, weil das Verb passer im vierten Vers nicht wie zuvor intransitiv sondern transitiv gebraucht wird, wodurch die Bewegung von „Elle“ nicht länger unbestimmt sondern in Relation zu anderen Entitäten erfolgt, wir es also von da an mit einem gestimmten Raum zu tun haben. Der ,Höhepunkt‘ der handlungsarmen Szene ereignet sich im längsten Vers, also in jenem Moment, als „Elle“ ihren Weg entlang des Wasserlaufs fortsetzt. Denn schon im folgenden sechsten Vers wird klar, dass nach der Zäsur im fünften Vers der Rückbau des sprachlichen Materials einsetzt: Von der Ausdrucksseite her lässt sich die Makrostruktur des Gedichts durch die Zu- und Abnahme von Signifikanten beschreiben.
Auf den ersten Blick hätte man es also mit einem typisch modernistischen Gedicht zu tun, dessen hermetischer Charakter der Tatsache geschuldet ist, dass die deiktischen Relationen nicht hinreichend geklärt werden, gleichviel, ob es sich nun um die Kategorien von Raum und Zeit oder um die der Personenerwähnung handelt – ganz abgesehen von der ungeklärten Beziehung zwischen Sprecher und Dargestelltem. Zieht man allerdings den akustischen Kanal hinzu, dann rückt dieses Gedicht mit einem Schlag in einen berühmten Überlieferungshorizont ein: Zitiert doch der oben erwähnte Musikgenerator ganz unverkennbar den Stil Claude Débussys, mehr noch: Instrument, Melodie und Rhythmus evozieren sein epochales Prélude à laprès-midi d’un faune. Die Flöte steht für Pan bzw. für einen römischen Faun, und ihr Melodiebogen gleicht dem der Soloflöte zum Auftakt in Débussys Prélude, insofern ein lang angehaltener, hoher Ton vernehmbar ist, der dann in kurzen Tönen chromatisch absteigt und anschließend in gleicher Linie wieder aufsteigt. Außerdem bleibt der typisch impressionistische Rhythmus haften: Durch Überbindungen und schnelle Folgen von Sechzehnteln und Sechzehnteltriolen werden wie bei Débussy die Taktgrenzen scheinbar überspielt, in jedem Falle aber unkenntlich gemacht. Die medienspezifische mise en scène besteht nun darin, dass sich die Abfolge der Musik bei jeder neuen Lektüre ändert, weil sie durch Zufallsalgorithmen erzeugt wird. Dadurch wird die Instanz des Autors geschwächt, was auch ganz im Sinne des Verfassers ist:
La génération contrainte consiste á asservir le résultat produit par un algorithme géneratif à une intentionnalité supérieure: une métalogique. (Bootz: 2004)
Unter einer solchen Metalogik versteht Bootz letztinstanzlich lernfähige Maschinen, die sich selbst programmieren bzw. erneuern und zu einer stets neuen und damit einzigartigen Rezeption führen. Dem eigenen Anspruch nach hat Bootz mit dem Zusammenspiel zwischen Text- und Musikgenerator in „Passage“ bereits dieses Stadium erreicht:
Une telle combinaison entre un générateur adaptatif et un générateur combinatoire alternativement contraints l’un par l’autre produit un générateur combinatoire d’un type non oulipien: les ,points de focalisation‘ de l’attention sont modifiés d’une lecture à l’autre. (ebd.)
Gewiss besitzen die vorgenannten Überlegungen hinsichtlich der intendierten pluralen Lesbarkeit ein interessantes medienspezifisches Erneuerungspotential. Aber ob schon durch die zufallsgesteuerte Variation der Tonspur eine Modifizierung der Fokalisierung erzielt werden kann, das sei bezweifelt. Zum einen bleibt ja bei aller Variation der impressionistische Musikstil als ostinates Merkmal erhalten. Wichtiger ist jedoch zum zweiten, dass sich das textuelle Substrat trotz animierter Inszenierung nicht verändert, und im Hinblick auf den Gedichttext lässt sich daher der Fokalisierungstyp eindeutig bestimmen. Es handelt sich um eine externe Fokalisierung, weil der Sprecher weniger weiß als die dargestellte Figur, deren Handlungen wie mit einem Kameraauge aufgezeichnet werden. Diese Perspektive ändert sich m.E. nicht bei einem erneuten Abspielen des Ausführungsprogramms. Eine weitergehende Sinndimension erhält das Gedicht allerdings, wenn man über die akustische Débussy-Markierung zu jenem Text greift, der dem musikalischen Prélude zugrundeliegt: Mallarmes Gedicht „L’après-midi d’un faune“ (1876). Es gilt als eines seiner bekanntesten Gedichte, nicht zuletzt durch mediale Transpositionen Manets, Débussys sowie durch Nijinskys gleichnamiges Ballett.
Das Gedicht handelt von einem Faun, der aus mittäglichem Schlaf erwacht und in einem Monolog von triebhaften morgendlichen Ausschweifungen erzählt, an denen mutmaßlich zwei Nymphen beteiligt waren, wobei erotische Wunschvorstellungen und arkadische Wirklichkeit wohl auseinanderklafften. Die symbolistisch durchwirkte Erzählung enthält traumartige Sequenzen mit entsprechenden semantischen Verschiebungen, Verdichtungen und Auslassungen, die insofern umso virtuoser erscheinen, als sie auch durch strenge Alexandrinerverse nicht gebändigt werden können. Vor diesem Hintergrund erscheint die bei Bootz beschriebene Passage in neuem Licht. Offensichtlich knüpft er an eine arkadische Szenographie an, allerdings mit minimalen Mitteln. Schon durch den Gedichttitel liegt der Fokus erkennbar nicht auf der sensuellen Begierde eines Fauns, sondern auf der Passage einer namenlosen Person, reduziert auf die Proform elle, die von einer wiederum namenlosen Sprechinstanz mit scheinbar unbeteiligtem Blick verfolgt wird. Immerhin gilt der erste Blick dem Fußabdruck der Passantin, was darauf schließen lässt, dass auch ein Faun des 21. Jahrhunderts seine Objekte der nurmehr visuellen Begierde noch über das archaisch anmutende Verfahren der wortwörtlichen Spurensuche aufspürt. Auf der Ebene der Wortsemantik bietet Bootz also eine arkadische Schwundstufe, eine irreduzible Restverwertung, deren spröder Reiz in der Aussparung liegt. Wörter und Verse bilden ebenso viele Leerstellen, in denen eine wirkmächtige lyrische Tradition schlummert, die beim Lesen geweckt wird. Hinzu kommt, dass die Verse zwar stabil aber nicht statisch sind, sondern über eine medienspezifische Aufführung sekundär semantisiert werden. Die gelben Buchstaben und Verse finden vor einem tiefblau changierenden Hintergrund zueinander. Das Objekt „le fil de l’eau“ bewegt sich und fließt unter dem Subjekt und dem Prädikat („Elle passe“) hindurch, begleitet von wasserblauen, beweglichen Rechtecken, die für einen natürlichen Wasserlauf stehen mögen, ebenso wie die variierenden Klangvariationen. Denn nicht nur die Flöte des Fauns, sondern auch die Klavierläufe und Xylophonklänge evozieren einen sprudelnden Wasserlauf, der mal mehr, mal weniger Wasser führt. So gesehen erklärt sich auch der o.g. Anspruch des Schöpfers, der darin besteht, einen Generator zu programmieren, der nicht-oulipotischen Regelzwängen untersteht, also solchen Regeln, die in jedem Rezeptionsakt neu ausgerechnet werden und die den Code durch diese Neuberechnung jedes Mal fortschreiben, darin einem autopoietischen System ähnlich, das sich ohne menschliches Zutun erneuert. Abschließend kann hinzugefügt werden, dass Bootz dank der medienspezifischen Ubiquität des digitalen Codes und der damit einhergehenden Simulationsmacht aller Künste jenes faunische Gesamtkunstwerk umgesetzt hat, das in der transmedialen Ambition des französischen Fin de Siècle noch sukzessiv und arbeitsteilig entstanden war.
Fazit
Lässt man die hier versammelten Fallbeispiele noch einmal Revue passieren, dann bietet auch die noch junge Computerpoesie bei allen Unterschieden zunächst einmal eine gewisse Kontinuität im Wandel. Sie knüpft direkt an die Verskunst der Neoavantgarde an (Cent mille milliards de poèmesi; sie perfektioniert Tzaras aleatorische Poetik (Babel Poesie, GogolChat), indem sie die interaktiven Potentiale des Trägermediums Computer (freilich konterdiskursiv) zum Einsatz kommen lässt, sie reagiert ironisch auf diese neuen Trägermedien (Les très riches heures de l’ordinateur n° 4) und setzt damit die Tradition einer typisch modernistischen Medienreflexivität fort, die sich im Zeitalter des ersten großen Medienumbruchs auf die Druckschriftlichkeit bezog, wie etwa in Mallarmés Gedicht „Un coup de dés jamais n’abolira le hazard“, und schließlich bleibt sie bei aller Medienspezifik auf überlieferte Topoi oder generische Strukturen angewiesen, damit ebendiese Medienspezifik umso wirksamer entfaltet werden kann („Passage“). Darüber hinausgehend lassen sich drei spezifische Merkmale bestimmen, welche für einen nicht nur in der französischen Lyrik festzustellenden hypertextuellen Gestus der Überbietung stehen: Computerverse sind mobil, autooperativ und plurimedial. Was die poetischen Avantgarden seit dem Futurismus immer wieder umtrieb, das war die Umsetzung von Dynamik mit den Mitteln der Wortkunst, ein Vorhaben, das durch die technischen Möglichkeiten hypertextueller Inszenierung ohne Zweifel neue Impulse erhalten konnte. Zwar mochte die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommende Filmkunst das Rätsel der adäquaten ästhetischen Darstellung von Dynamik gelöst haben, was auch für die bewegte Schrift galt und damit auf die Wortkunst abfärbte,23 aber durch den autooperativen Schriftgebrauch werden Dynamik und Plurimedialität auf neue Weise interpretiert, insbesondere dann, wenn Computerlyrik auf einer generativen Basis beruht. In solchen Fällen entwickeln sich bei jeder Rezeption je neue Dynamiken bzw. neue plurimediale Koppelungen. Damit erreicht die Lyrik im Zeitalter der Digitalmoderne eine Offenheit, welche die traditionell im Namen insbesondere der Rezeptionsästhetik postulierte Offenheit der modernen Lyrik übersteigt. Es ist hier nicht die Rede von potentiell unendlichen Auslegungen ein und desselben wahlweise dunklen oder polysemen Textes, zur Debatte stehen absolut transfugale Verse, die sich in jedem neuen Rezeptionsakt tatsächlich verändern und damit je neue Sinnkonstellationen eingehen können, die jedoch – und das ist die Kehrseite dieser Dynamik – ebenso schnell wieder verschwinden und dem Vergessen anheimfallen. Auffällig dabei ist, dass die letztgenannte, aleatorische Tendenz weniger der modernistischen Beschwörung des auratischen Zufalls dient, sondern in mehr als einem Fall zugunsten einer satirischen Stellungnahme gegen Auswüchse sekundärliteraler Formen und Formate refunktionalisiert wird. Man kann also festhalten, dass lyrische Hypertextualität nicht zuletzt einen konterdiskursiven Anstrich besitzt, insofern habitualisierte hypertextuelle Gebrauchsformate wie Übersetzungsprogramme, Chats oder Suchmaschinen entpragmatisiert und mittels ungerader Sprechakte in Gestalt tendenziöser Implikationsstrukturen bis zur Kenntlichkeit entstellt werden.
Dietrich Scholler
Dietrich Scholler Literaturverzeichnis
Einführung:
– Lyrik der Zweiten Moderne – Wandlungen einer dissidenten Sprachbewegung im 20. Jahrhundert. –
I
Niemals zuvor hat sich der Eingang in ein neues Jahrhundert der Kunst – die Epochenschwelle von 1800 auf ihre Weise ausgenommen – so selbstentschieden am Abbruch seiner Herkunft als Aufbruch in die Zukunft der Gegenwart identifiziert wie das 20. Jahrhundert. Entsprechend emphatisch rief es sich selbst als eine Revolution aus – zumindest bis zum Ersten Weltkrieg. Die Wunder der zweiten industriellen Revolution versetzten die Zeitgenossen, exemplarisch in der Hauptstadt dieser neuen Zeit, Paris, in einen Zustand der Modernolatria. Ihr Lebensgefühl entsprang maßgeblich den technisch veränderten Vollzugsformen des Alltags. Auf grundlegende Weise sind es nicht mehr Inhalte, Ideen, Anschauungen, das ,Was‘ des Lebens, vielmehr seine Performanzbedingungen, das ,Wie‘, welche das Bild des Lebens ausmachen. Die perzeptiven Umbrüche, die eine beschleunigte Fortbewegung, eine intensivierte Kommunikation, gesteigerte soziale Kontakte auslösen, setzten eine zweite zivilisatorische Moderne in Gang.24 Ihre Bewegungsmomente haben bis heute, an die Schwelle einer dritten, informationstechnologischen Revolution fortgewirkt.
Abermals gilt: niemals zuvor in der abendländischen Ideengeschichte hat eine säkulare Ära wie die des 20. Jahrhunderts so unverkennbar den Gegenwartsbezug kultiviert – und die Traditionen ins Museum gestellt. Die Folgen waren grundsätzlich und unwiderruflich. Was italienische Vorkämpfer als Futurismus proklamierten, ist im Grunde irreführend: ihre Prognosen waren pathetisch auf die technischen Errungenschaften der Epoche hochgerechnet. Sie versprachen geradezu menschheitsgeschichtliche Entgrenzungen, die die Vertriebenen des Paradieses aus eigener Kraft aus den Erniedrigungen des Sündenfalls zu befreien vermöchten. Zum Verständnis bot sie ihnen das Leitbild eines deus qua machina an. Zwar haben die Weltkriege die ,Maschinenangst‘ katastrophisch aufgedeckt, die in dieser Hybris angelegt war. Die kulturelle Kritik am technisch-wissenschaftlichen Fortschritt konnte dennoch nicht verhindern, dass die zivilisatorische Strategie der Innovation ungebrochen weiter gegen die Defizite der menschlichen Natur vorgeht – bis hin zu der kaum verhüllten Utopie, der Tod sei eine bislang noch nicht heilbare Krankheit.
Am frühesten haben die Künste versucht, die Erfahrungen dieser neuen Lebenswelt kulturell in Besitz zu nehmen. Im Grunde waren wesentlich sie es, die das Revolutionäre dieser Zeit als einer Zweiten Moderne in ihren ästhetischen Akten gespiegelt haben. Mehr noch: sie vor allen anderen Kulturträgern haben, im Bewusstsein, die Avantgardisten einer neuen Epoche zu sein, Avantgarde als solche zum Paradigma kulturellen Fortschreitens generell erhoben.25 Wo aber der Bruch mit Hergebrachtem zur Regel wird, werden historische und biographische Zusammenhänge grundlegend anders gebildet: das revolutionäre Schema setzt sich an die Stelle des evolutionären. Das Bild des Menschen, die Ansichten von Welt, gehen nicht mehr organisch auseinander hervor. Identität bildet sich vielmehr heteronom, ,chemisch‘, wie Friedrich Schlegel, der Prophet der Moderne, vorausgesagt hatte (1972, S. 71; 77), also indem Ich sich von sich selbst abhebt. Es liefert sich dadurch einem nie zur Ruhe kommenden Bedürfnis aus, kontinuierlich diskontinuierlich, ständig neu und anders zu sein. Identität als unabschließbaren Prozess aufzufassen, entbindet allerdings ebenso viel Chance wie Risiko. Proust hat dem die Kunst abgewonnen, viele Ich sein zu können; Musil das Misslingen expliziert, das dem Mann ohne Eigenschaften ins Gesicht geschrieben steht; Camus die energetische Selbstüberschreitung als ,homme révolté‘.
Die Erschaffung eines neuen Menschen (T. Tzara ), den die historischen Avantgarden proklamierten, zog nach und nach alle Kulturtätigkeiten in Bann. Die Künste blieben dabei über das ganze 20. Jahrhundert hindurch maßgeblich Protagonisten dessen, was als eine Grammatik der Modernisierung gelten darf. Ihnen wiederum war die Lyrik die erste und kühnste. Sie wurde deshalb mit dem Ehrentitel „Paradigma der Moderne“26 bedacht. Gerecht wurde sie ihm allerdings erst, als ihre avantgardistischen Experimente zum Äußersten entschlossen waren: den Begriff von Lyrik selbst preiszugeben und das Gedicht bis hin zum Unding und Unsinn zu entgrenzen. Gewiss, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé hatten unwiderruflich die Aufbruchsignale zu radikaler ästhetischer Autonomie gegeben. Ins Extrem getrieben hat sie jedoch erst die antipoetische Poesie der historischen Avantgarden. Sie nahmen für sich eine bislang undenkbare Freiheit von allen Traditionsvorgaben in Anspruch. Auf einer solchen ,tabula rasa‘ ließen sich die Zeichen der Zeit wirklich neu konfigurieren: in der Signatur einer Zweiten Moderne. An der Lyrik mehr als an anderen Ausdrucksweisen profilierten sich dabei die sich durchhaltenden Agentien, die deren Vorgang im 20. Jahrhundert bis hin zu OuLiPo, zur Rap-Poesie oder der Cyberlyrik in Bewegung hielten.
Für diese Leitfunktion spricht ein kulturgeschichtlicher und ein systematischer Grund. Mit einem radikalen Schnitt das Herkömmliche abzustoßen ist eine Sache; eine ungleich schwierigere dagegen die Frage, wie, danach, neu zu beginnen wäre. Auch eine noch so heftige Negation entkommt nicht dem hermeneutischen Zirkel: bestehende kulturelle Verhältnisse zu leugnen ist selbst ein kultureller Akt. Botho Strauß (1992) glaubte deshalb, Beginnlosigkeit prinzipiell annehmen zu müssen. Das neu sich situierende 20. Jahrhundert konnte sich jedoch, zumal in der Perspektive der Künste, auf eine vorbildgebende modernistische Initiation berufen, die romantische Revolution, die die Erste Moderne begründet hatte. Ihr Umsturz hatte die Ideen der politischen und gesellschaftlichen Revolution von 1789 adoptiert, die die geschichtliche Wirklichkeit schnell verraten hatte, um daraus ein kulturelles Fortschrittsschema zu machen. Das Manifest, das die Aspirationen der ganzen Epoche in eins fasste, war Victor Hugos Préface de Cromwell (1963, 409ff.). Seitdem gilt die Modernitätsregel: ständig erneut aufzubrechen „pour trouver du nouveau“ (Baudelaire). Ihr gewann Hugo eine einflussreiche Kulturtheorie der Dichtung ab. Demnach durchläuft die Menschheitsgeschichte jeweils drei Zivilisationsstadien. Ihnen entsprechen drei poetische Grundsprechweisen. Den Anfängen aber gehört die ursprachliche Äußerung schlechthin, die Lyrik. Und genau in ihr hat sich die erste Generation der französischen Romantik gefunden. Der Parallelismus zu den historischen Avantgarden ist mehr als nur zufällig. Ganz wie die Ursprungstheorie Hugos es vorsah, reagierten sie auf die zweite industrielle Revolution, indem sie deren umstürzende Modernität zuerst lyrisch, elementarsprachlich in Worte zu fassen versuchten. Ihre poetische Befreiungsbewegung trägt ihrerseits alle Züge einer kulturellen Palingenese.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg? Gewiss, der Bruch mit der Vergangenheit war die Folge eines schuldhaften Zusammenbruchs. Doch als sich auch die Literatur wieder aus den Trümmern erhob und nach einem Rest von unverletzter Sagbarkeit suchte, lernte sie, gerade in Frankreich, mit dem Ursprungsmoment von Lyrik, dem Chanson, erneut das Sprechen (vgl. Beitrag Asholt). Diesem modernistischen Initiationsschema widerspricht nicht, dass sich Lyrik danach wieder unter den Schutz der systematischen Errungenschaften stellt, mit denen sie sich ihren Widerspruchsgeist gegen aufziehende Beherrschungszwänge von Nationalismus, Kommunismus und Industrialisierung gesichert hatte: unter das Patronat des abstrakten Kunstwerkes. In ihm verkörpert sich die höchste rettende Identität, die äußerste Konsequenz ihrer Autonomie, mit der sie sich zugleich in eine Zweite Moderne verabschiedet. Mit Berufung darauf durfte alles Mögliche auch wirklich werden. In seinem Namen ließ sich der Diskursbruch als Diskursprinzip legitimieren. Darauf beriefen27 sich auch die begleitenden Kampagnen des Nouveau Roman, des Theaters des Absurden oder der Nouvelle Critique. Sie waren darauf aus, erstarrte Sprachgewohnheiten dem Purgatorium ihrer literarischen Exerzitien zu unterwerfen, um für blind gewordene Vollzugsformen von Alltäglichkeiten – „Du merkst nicht, dass du nichts merkst“ (Enzensberger: 1991, 88) – die Augen zu öffnen.
Nirgends aber hat die Idee des abstrakten Kunstwerks seine entgrenzende Energie mehr entfaltet als in den Bildenden Künsten – und der Lyrik. An ihnen brachen sich damit repräsentativ aber auch Glanz und Risiko einer ungebundenen Kunst. Wo keine normativen Schranken mehr gelten, findet die Freiheit des Ausdrucks erst dort ihre Grenze, wo das abstrakte Kunstwerk sich selbst auslöscht. Dreifach hat es unter dieser Perspektive jetzt sein lyrisches Feld zu bestellen. Vers und Reim; Strophe und Gattung; gewählte Sprache: jeder Nachhall auf den Ursprung der Lyrik in der Sangbarkeit ist außer Kraft gesetzt. Der neue Grund ihrer Sprachgebung entspringt dem Bedürfnis, im Prinzip stets anderslautend zu sein; vorsätzlich anders zu sprechen als jeweils gesprochen wird. Dem dient ihre geradezu regelhafte Ungebundenheit. Notwendig ist „la provocation sans contrôle de l’image pour elle-même“ (Aragon: 1953, 81). Was daran als ungeordnet, verstörend, befremdlich – dissonant – erscheint, zeigt dabei nur, woran sie Anstoß nimmt: dass die rapide fortschreitende Differenzierung des Wissens über den Menschen und seine Welt ihn auch sprachlich zunehmend in seinen Differenzen festlegt – und einsperrt –, nach Meinung modernistischer Lyrik bedrohlich zu viel. Wer diskursiv so zugerichtet wird, dem glaubt sie nur entgegentreten zu können, wenn sie dagegen einen uneingeschränkten Befreiungskampf führen kann. Wie beengend ihr die Fesseln der Tagessprache erscheinen, enthüllt das Risiko, das sie einzugehen bereit sind, um sich aus ihnen freizusetzen: lieber die Worte verstummen lassen, schreien, Unsinn reden, Sinn verdunkeln, artistisch sich verweigern, mit Sprache zeichnen, seriell sich verlaufen, algorithmisch sich um und umwenden, in Bildkaskaden sich ans Unaussprechliche verschwenden – als sich an das ausgeübte Wort zu halten. Haben nicht Lettrismus, konkrete Poesie, strukturale Textgenese, OuLiPo diese Entlastungsangriffe jeweils auf die Spitze getrieben – ohne Rücksicht auf das Publikum? Das Wagnis der Abstraktion, Gestaltlosigkeit, Unverständnis, galt ihnen mehr.
Einen zweiten, kühnen poetologischen Horizont des 20. Jahrhunderts hat namentlich Lyrik sich dadurch erschlossen, dass sie sich das Prinzip der Ungegenständlichkeit einräumte. Ohnehin war sie schon bisher die intimste unter den literarischen Sprechweisen, ungleich mehr den Blick nach innen als nach außen gewendet. Dennoch war es ein revolutionärer Akt, sich auch von der Vorstellung noch zu lösen, das menschliche Innenleben bilde – zart substantialistisch – eine eigene Welt. Bergsons ,élan vital‘, Freuds Anschauung des Unbewussten, Jungs Archetypologie hatten dem wissenschaftstheoretisch die Grundlage entzogen. Die Künste brachten sich auf die Höhe der Zeitenwende, indem sie sich der gewagten Freiheit aussetzten, auf die Welt als einer Sprache einzugehen. Dies hieß, den vertrauten Boden von verbürgten Motivbezügen, sinntiefer Symbolik, konvergenten Bildfeldern, modellierten Affektzuständen zu verlassen. Ihre tradierten sprachlichen Bezeichnungen beruhten auf der Anschauung, auch noch die labilsten Seelenzustände seien aufgehoben in einem ,système du cœur‘ (E. S. de Gamaches, Paris 1704). Gewiss, das bisherige sprachliche Aufgebot wird als Arbeitsmaterial weiterhin fortgeschrieben, aber nur um sich reflexiv daran abzuarbeiten. Im Grundsatz ist mit der Lizenz zur Ungegenständlichkeit unwiderruflich das Ende jeder Mimesis besiegelt. Zwar reagiert auch moderne Lyrik auf die ,Natur‘ der Lebenswelt. Aber was sie sprachlich ausbildet, ahmt nichts mehr nach, was sie dort vorfindet. Sie hat das Prinzip der Referenzialität endgültig aufgegeben, nicht zuletzt auch, weil es ,die‘ Wirklichkeit nicht mehr gibt. Die wissenschaftlich-technisch-industrielle Revolution hat die Idee eines Universums des Geschaffenen zunehmend umgekehrt in ein Multiversum des Machens, das sehen will, was sich machen lässt. Wirklichkeitscharakter kommt dem Wirken zu, nicht dem Verwirklichten.
Sieht man es politisch und geschichtlich, so bietet die Realität auch aus dieser Sicht nichts, wonach sich die Literatur, und Lyrik insbesondere, hätte positiv modellieren können. Zwei Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, nationalsozialistische und kommunistische Gewaltherrschaften, Kalter Krieg, 68er-Revolution – wer sich der Idee der individuellen Freiheit verpflichtet fühlt, musste er diese Wirklichkeiten nicht vor allem als das Verwirkte wahrnehmen?
Wie also sollte sich Lyrik dazu stellen? Ihr alter Auftrag im Namen der Nachahmungslehre legte auch ihr ,aemulatio‘ nahe: einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft gerecht zu werden, indem sie auf ihre Weise differenzierter über sie redet als bisher. Wenn aber deren hergebrachte Leitbilder wie ,honnête hemme‘, ,citoyen‘, ,bourgeois‘, ,individu‘ in keiner ganzheitlichen Identität mehr unterkommen können, dann vermag selbst die abgehobene Sprache der Lyrik ein solches intermittierendes Ich-Geschehen nicht mehr nur mit verbesserter Fortschreibung aufzufangen. Die Revolution, die ihre Sprechweisen im 20. Jahrhundert prägt, vollzog deshalb einen radikalen poetologischen Systemwechsel. Dieser vielgesichtige moderne Proteus, dessen Freiheiten mit eben so vielen Anpassungen einhergehen, war, dem Sprachgebrauch der Lyrik nach zu urteilen, diskursiv nicht mehr mit Überbietung einzuholen – mit welchem Format auch? Vielmehr galt es, ihn aus den Maschen seiner Komplexität zu befreien und in diesem Sinne sprachlich zu überschreiten. Dies wäre die ,,route enchantée“ (Ch. Trenet), die vom Surrealismus zum Chanson der Nachkriegszeit führt (Perez: 1964, 60). Die lyrische Lizenz zur ungegenständlichen Darstellungsweise hat maßgeblich dazu beigetragen, die Frage nach dem Menschen entscheidend anders zu formulieren: nicht länger substantialistisch: ,wer bin ich?‘, sondern poietisch, Identität als Ausführung verstanden, ,wie spielt sich Ich ab?‘ Das ist, nicht nur literarisch, zu einer kulturellen Denkweise der zweiten Moderne und postmodern zu einem intellektuellen life-style geworden.
Wie aber kommunizieren abstrakte Texte; was haben sie mitzuteilen? Auch sie sind in der Erwartung verfasst worden, dass sie jemand zur Bedeutung erweckt. Je mehr sie sich mithin der Sprache der Lebenswelt versagen, desto ausschließlicher müssen sie dies der Gunst eines wohlwollenden Wahrnehmenden anheimstellen. Doch was steht ihm bevor? Er sieht sich einem Textgebilde ausgeliefert, das sich nicht nur die Freiheit der Ungebundenheit und Ungegenständlichkeit, sondern auch der Unverständlichkeit einräumt. Der Futurist Marinetti hatte diese Provokation gewissermaßen als Motto der kommenden Kunst ausgegeben; Dada sie zum Programm gemacht; nonsense-Dichtung sie perfektioniert. Wer das Publikum so vor den Kopf seiner Verstehensgewohnheiten stößt, musste damit rechnen, dass diese Anti-Kunst als ästhetischer Freitod verworfen wird. Zumindest wagte sie sich an die selbstverleugnende Grenze vor, wo das Prinzip der Gestaltung von Unvermögen, Beliebigkeit und Scharlatanerie nur schwer noch zu unterscheiden ist.
Umgekehrt zeugt es von der Entschiedenheit, mit der Künstler glaubten, die Aussagekraft des Wortes gegen seine nötigende Alltäglichkeit zu verteidigen.28 Welchen Gewinn aber konnten sie, im positiven, also kunstbewussten Falle, mit dieser Grenzerfahrung ihren unerschrockenen Liebhabern in Aussicht stellen? Mehr noch als andernorts gilt: wer sich ihr aussetzen will, muss Negation, das erste modernistische Gebot, unerbittlich erfüllen; ein Exerzitium der Verfremdung auf sich zu nehmen, das keine Bedeutungen gelten lässt, auf die die Worte im gewöhnlichen Sinne und in der üblichen Fügung reagieren. Erst im Durchgang durch eine solche semantische Generalreinigung vermag sich der Wahrnehmende – so als stünde Orpheus Pate – im Medium der Sprache noch als wahr erfahren. Ein solcher Rückgang hinter alle kulturellen Überformungen muss jedoch mit einem entsprechend hohen Preis erkauft werden. Je unverständlicher ein Text, desto mehr liegt es an dem, der sich seiner annimmt und ihm Verstand beibringt. Gelingen kann dies jedoch nur, wenn er sich ganz den Zeichen überlässt. Dann sprechen sie auch ganz die alternative Erkenntnisinstanz an, aus der nach Auffassung von Tiefenpsychologie, Neurologie – und Poesie die primäre Erfahrung unseres Selbst kommt: den ,élan vital‘ und seine Sprache der Metapher, dem ,eigentlichen Blut der Dichtung‘, von der Imagination in Bewegung versetzt.29 Denn darauf baut das Risiko der Unverständlichkeit ihre rettende Utopie: dass die Sprache, mit der wir unsere Lebensbedürfnisse bearbeiten, uns auf Gemeinplätze und Begriffe fixiert; sie in der Bilderwelt der Poesie aber noch an ihre kreatürliche Welterzeugungskraft anknüpft. Eine Rückkehr zur uranfänglichen Schöpfungsmacht des Wortes, zum demiurgischen Logos, zum ,Verbe‘, das selbst Mallarmé und Valéry noch beschworen, ist allerdings ausgeschlossen. Abstraktion, Fragmentation und Schwerverständlichkeit eröffnen zwar weite Spielräume des Bedeutenkönnens; über eine letzte Bedeutung des Lebens aber können sie nichts mehr mitteilen. Sie zeugen damit auf ihre Weise vom Verlust weltanschaulicher Letztbegründungen. Unmißverständlich etwa Francis Ponge: ,,je condamne donc a priori toute métaphysique“ (1999, S. 213). Früher hatte Lyrik zarte transzendente Interessen; jetzt ist sie nurmehr transitiv, indem sie den Leser als ihr freibleibendes Objekt an sich bindet. Ihr Angebot an ihn muss sich auf semantische Ökologie beschränken.
Wie schwer es ihm fällt, von der eingeführten, pragmatisch bewirtschafteten Sprache abzulassen, belegen die Besucherzahlen moderner lyrischer Reservate. Der Weg dorthin verlangt, sich vom Konsumenten zum Mit-Produzenten und Pionier des Textes zu wandeln. Dieser bietet ihm, wenn er gelungen ist, eine Konstellation an – in bestem Sinne des Begriffs: die Worte auf der Fläche eines Gedichtes gleichen Sternen, die erst in der imaginativen Begehung des Betrachters ein Sinn-Bild hervorrufen. Sofern dies an eine meditative Versenkung in sich selbst erinnert, wird daran der Unterschied zu einer ersten, romantisch gestifteten Moderne sichtbar. In Lamartines Méditations poétiques (1820) etwa ließ der Autor den Leser an den ,Herzensergießungen‘ seines lyrischen Ich teilhaben. Im 20. Jahrhundert ist es, in der Tendenz, der Leser, an den appelliert wird, die Worte mit einem – seinem – lyrischen Ich zu beseelen. Ein Rest an kontemplativer Hingabe allerdings bleibt erhalten: um in die andere Welt der fremdartigen, dunkel lockenden, metaphorisch blinkenden, eiligen Gästen jedoch hermetisch sich verschließenden Wunderkammern dieser Lyrik einzudringen, muss man ganz die Worte selber machen lassen. Sich den Korrespondenzen ihrer Zeichen hinzugeben, verlangt jedoch im Grunde die Bereitschaft zu semiotischem Fundamentalismus. Und hier findet auch eine Wissenschaft von der Literatur ihren textgemäßen Grund: statt den Zeichengebilden womöglich ideologisch auf die Beine zu helfen, käme es darauf an, ihr Beziehungsgeflecht aufzudecken, allemal Lesewege durch schwieriges Textgelände, dessen Einzelheiten einen gleichwohl vertraut anschauen, wie Baudelaire prognostiziert hatte. Was sie damit zu sagen haben, bleibt dem Betrachter anheim gestellt. Valéry hatte ihm mit einem berühmt gewordenen Wort die Richtung gewiesen:
Mes vers ont le sens qu’on leur prête.
Doch so sehr erst er erfüllt, was der Text vorgibt – ohne eine Disposition von dessen Seite liefe alle Wahrnehmung auf pures Zufallsgeschehen hinaus. Wohin dies führt, hat bereits Tristan Tzara in seinem Manifest „Pour faire un poème dadaiste“ karikiert (1975, 492). Selbst Abstraktion kann, wenn sie Kunstcharakter, Literarizität beansprucht, auf Fügung, Komposition deshalb nicht verzichten, und sei sie auch noch so unwirksam. Die große, prinzipielle Frage lautet dann: wie soll solche Kunst ihre Textur bilden? Ohne normativen Rückhalt in Poetiken der Tradition ist sie ganz auf eine immanente Ästhetik angewiesen. Worauf hätte sie sich noch konstitutiv beziehen können, wenn nicht auf die letzte, verbliebene Verheißung von etwas Objektivem: auf die Sprache selbst als objektalem Medium und kommunikativem Zeichensystem.30 In diesem Rückgang spiegelt sich die tiefe Skepsis des 20. Jahrhunderts gegenüber allen transzendenten Ausgriffen. Sprache sieht sich doppelt geerdet: als Zeichending betrachtet weiß sie nicht mehr als es sagt. Andererseits ist das, was für Wirklichkeit gehalten wird, unhintergehbar an ihre Bezeichnungen als Bedingung gebunden. Wenn auf das 20. Jahrhundert ein ,linguistic turn‘ zutrifft (Rorty: 1967), dann hatte ihn die lyrische Revolte der historischen Avantgarden (und die kubistische Malerei) de facto bereits längst vollzogen.31 Ihre zahllosen Manifeste spielen darauf an, ohne daraus schon eine Theorie zu machen. Wie Sprache als funktionierendes System zu begründen wäre – die Grundlagen wurden früh woanders formuliert, in der neu sich auffassenden Sprachwissenschaft – kaum zufällig im selben Zeitraum. Ihre Einsichten in die Sprache als Organismus vermögen zu erhellen, was Poeten eher intuitiv ausgeführt haben.
Zwei Entwürfe bieten sich an. Zum einen die Systemstudien Ferdinand de Saussures zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sein später Erfolg als Begründer des Strukturalismus beruht nicht zuletzt darin, dass sich daraus eine allgemeine – strukturale- Wissenschaftstheorie ableiten ließ. Dies wiederum lag an seinen methodisch gefassten Untersuchungsprinzipien. Ihm zufolge ergibt sich der Wert der sprachlichen Zeichen primär aus den Oppositionen – Dichotomien –, in denen sie stehen. Bedeutung stiften mithin ihre Relationen, nicht ihre Substanz. Umgekehrt gelten sie selbst dadurch als arbiträr, eben als Zeichen, weil sie von sich aus nichts Höheres oder Tieferes wissen können. Bereits hieran wird erkennbar, dass Saussure logisch, nach dem Ausschließlichkeitsprinzip vorgeht. Das kam zweifellos der sprachkritischen Wendung der Philosophie entgegen, erst recht einer digitalen Informationstheorie. Welchen Einfluss Saussures Auffassung der Sprache auf das Modernitätverständnis von Literatur hatte, lässt sich mit einiger Gewissheit erst im Strukturalismus seit dem Zweiten Weltkrieg nachweisen, vor allem als er die sprachliche Grundeinheit vom Satz auf den Text ausweitete. Generative Texttheorie, Textlinguistik, Tel Quel haben erkennbar die Erzählliteratur, namentlich im Umkreis des Nouveau Roman, aber auch die Lyrik strukturalistisch inspiriert (vgl. Beitrag Föcking).
Mehr noch als mit Saussure und den Folgen lassen sich theoretische Umrisse einer modernistisch vorgehenden Lyrik des 20. Jahrhunderts mit der Sprachtheorie von Karl Bühler erschließen (Bühler: 1934), die er zeitgleich mit den Avantgarden seit 1918 entwickelt. Zum einen bestimmt er das sprachliche Zeichen drei- statt nur zweidimensional. Zum anderen begreift er es von seinem ,Sitz im Leben‘ her: es ist Werkzeug menschlicher Rede, eingelassen in eine Sprechsituation.32 Von daher übt es drei Funktionen aus (Bühler: 1934, S. 28).
Das Grundlegende, Weitreichende dieses Organon-Modells besteht darin, dass sich darin jahrhundertealte Dichtungsauffassungen neu, semiotisch, veranschlagen lassen. Wo der Ausdruck des ,Senders‘ dominiert, steht das Zeichen im Dienst eines Ich, „dessen Innerlichkeit es ausdrückt“, mithin seine subjektiven Interessen widerspiegelt. Wo es hingegen beschreibend, darstellend „Gegenstände und Sachverhalte“ in den Vordergrund rückt, spricht es gleichsam in der dritten Person, die das, was einem begegnet, objektivistisch, um seiner selbst willen ins Auge fasst. Wo das Zeichen sich hingegen erkennbar an den Empfänger, an ein Du richtet, geht es darum, Trennendes und Verbindendes, normatives Verhalten zur Sprache zu bringen. Was Bühler unausdrücklich vollzogen hat, effektiv aber überall durchscheint: sein dreifacher Zeichenbegriff ruht im Grunde auf drei anthropologischen Einstellungen auf, wie sie, im Prinzip, bereits Kant zur Grundlage seiner kopernikanischen Wende der Erkenntnistheorie gemacht hatte.33 Wo ich die Sprache ganz für mich einnehme, schlägt sich darin vor allem nieder, was mich – subjektiv – stark bewegt, Lust und Unlust, Neigung und Abneigung, anthropologisch das Wollen, das Begehrungsvermögen. Wo ich jedoch von meinen Beweggründen absehe, um – objektiv – auf anderes zu achten, gehe ich denkend, rational (auch mir selbst gegenüber) mit der Sprache um. Sie begibt sich dadurch unter den Einfluss des Erkenntnisvermögens. Wo ich mich aber an andere wende, geht es um Zwischenmenschliches, Verbindliches, Einvernehmliches, das dem Regime des Empfindungsvermögens untersteht.
Doch Ausdruck, Appell und Darstellung verfügen nicht nur über eine anthropologische Implikation. Häufig erläutert sich Bühler selbst mit literarischen Befunden. Heißt dies nicht: seinem semiotischen Zeichenmodell kommt eine elementare literarische Kompetenz zu? Seit die Nachahmungstheorie im Schwinden begriffen war, stand die Suche nach einem anderen Referenzmodell auf der Tagesordnung moderne Künste. Goethe hatte bereits in diese Richtung gewiesen.34 Statt normativer Gattungseinteilungen sprach er lieber von Naturformen der Poesie. Sie als episch, lyrisch und dramatisch zu bestimmen, hatte im Prinzip bereits die alte Schreibordnung nach Genera durch die moderne nach Diskursen abgelöst. Mit Bühler lässt sich schließlich begründen, dass diese Formen nicht eigentlich natürlich vorkommen. Vielmehr setzen sie die drei Dimensionen des sprachlichen Zeichens um: das epische, indem ein Er-Erzähler hinter die welthaltige Darstellung von Gegenständen und Sachverhalten zurücktritt; das dramatische, das in der (theatralischen) Wechselrede den appellativen Modus des Du aufnimmt und das Kommunikative der Sprache zur Aufführung bringt; das lyrische schließlich, in dem das Ich seine Subjektivität zum Ausdruck bringen kann.
Bühlers Semiotik aber kommt gerade einer systematischen Annäherung an Lyrik im 20. Jahrhunderts bestens entgegen. Zeichentheoretisch bestimmt das grammatische Ich die Origo des Zeigefeldes, der das Hier und Jetzt des Sagens zusteht (auch wenn es über Vergangenes meditiert). Insofern bildet es „das Koordinatensystem der subjektiven Orientierung“ (102). Alles was in seinem Namen gesagt wird, zeigt primär auf dieses Subjekt der Aussage hin. Sofern etwas anderes oder jemand anderes im Spiel ist, dann höchstens gespiegelt in seiner Wirkung auf das Ich. Wer so selbstbezüglich auf sich eingeht, realisiert sich kaum gesellschaftlich, noch rational: er lässt seine wunschhafte Natur, sein Begehrungsvermögen zur Sprache kommen. Sofern es aber Text wird, und erst recht als Lyrik, kann es sich da anders als in einem narzisstischen Diskurs äußern – mit einer ausgeprägten Binnenreferentialität? Die Sprache der Lyrik ist damit, mehr als alle anderen Sprechweisen, in ihrem Verhältnis zu sich selbst zu bestimmen. Konkret, als semiotisch eröffneter Zugang, wäre das Zentrum des „Koordinatensystems der subjektiven Orientierung“ als ,lyrisches Ich‘ zu rekonstruieren.35 So wie sich alle sprachliche Aufmerksamkeit an ihm ausrichtet, ist umgekehrt eine Orientierung im Text an seiner Textur abzulesen. Das lyrische Ich ist der methodische Schlüssel, um hinter die – subjektive – Ordnung zu kommen, die sein sprachliches Gewand zusammenhält. Im Blick darauf lassen sich Zugangsfragen stellen: Wer spricht? Wie hat er sich im Text positioniert? Wovon ist die Rede? Vor allem: wie steht der Sagende zum Gesagten? In welcher Situation befindet er sich, um so – besonders – zu reden wie er redet?
Nebenbei berührt Bühler allerdings ein Problem, das moderne Literatur, namentlich ihre Lyrik und gleichermaßen die Philosophie tief bewegt. Die subjektive Orientierung, die das Sprachsystem einer Ich-Identität gewährt, enthält eine Verführung, die weit über eine lebenspraktische Zweckhaftigkeit hinausweist: sie könnte zu philosophischer Spekulation verleiten und einen „Schlupfwinkel der Metaphysik“ eröffnen (104/105). Die kulturellen Zeichen der Zeit aber standen gerade für einen tiefen Argwohn gegen alle Subjektivismen – eine der zuverlässigsten weltanschaulichen Konstanten des 20. Jahrhunderts. Marinetti, der futuristische Provokateur, proklamierte bereits 1910 die ,Zerstörung des Ich‘; Proust gewann dieser Krise die Kunst eines multiplen Ich ab; Pirandello trieb die Unidentifizierbarkeit des Ich mit „Einer, keiner, Hunderttausend“ (1926) auf die Spitze; Musil entmachtete es im Mann ohne Eigenschaften; Sartre löste es in Nichtigkeit und Absurdität auf; Barthes verlangte, um noch authentisch schreiben zu können, den (fiktionalen) Tod des Autors; Foucault die Leerstelle des Subjekts; Derrida die beständige Entselbstung aufgestauten Selbst-Bewusstseins. Wenn also das System der Sprache darauf angelegt ist, eine lebenspraktische Ich-Origo zu bilden – lässt sich dann gegen die Gefährdung, die in solcher Selbstbezüglichkeit liegt, nicht am treffendsten wiederum mit Sprache vorgehen? Dies ist der vornehmste Einsatz moderner Sprachkunst. Und wer könnte auf diese subjektivistischen Unbeherrschtheiten – die selbstermächtigten Führer des 20. Jahrhunderts haben ihre tiefen Abgründe ermessen lassen – sprachlich besser eingehen als die Lyrik, die semiotisch dem Ich am nächsten steht? Dass sie unter allen literarischen Sprechweisen die ohnmächtigste ist, sollte nicht täuschen. Die Kulturkritik, die sich als Sprachkritik einen bedeutenden Namen macht, hat ihre sprachlichen Befreiungsbewegungen wohl verstanden. Die ausgreifende Ästhetisierung des Lebens – holte sie nicht lediglich systematisch ein, was Kunst seit ihrer Zweiten Moderne praktiziert und damit abermals Friedrich Schlegel, den Anwalt der Moderne, bewahrheitet, der alle Gegensätze in einer „progressiven Universalpoesie“ (1972, S. 37) aufheben zu können glaubte?
Wie eine lyrische Befreiungsbewegung im Sinne dieser Modernität effektiv vorgehen kann – gerade dies auch lässt sich unter semiotischer Perspektive grundsätzlicher umreißen. Auf der einen Seite ist der Sprechakt ,Ich‘ darauf angelegt, eine stabile „Zuordnungskonstanz“ (Bühler) zu erzeugen, gewissermaßen der Identitätsfrage vorzuarbeiten: wer bin ich? Das Sprechenlernen, -können und -müssen schafft so einerseits notwendige Ich-Gewohnheiten, die die Suggestion nähren, diese Ich-Origo sei eine – natürliche – Gegebenheit und insofern eine feste Größe, ein letztes Prinzip unseres Lebens. Die Zweite Moderne hat jedoch andererseits, vor allem dank der Künste, mit allen Mitteln, wenn es sein musste, uns darauf gestoßen, dass unsere Wirklichkeitsbegriffe und damit auch die von uns selbst, gemacht sind und gemacht werden, streng genommen also lebensweltliche Fiktionen sind: wir sitzen einer ,,illusion Réalité“ auf (Aragon: 1972, 80). Wir halten sie nur deshalb für objektiv, weil im täglichen Selbstvollzug ihr artifizieller Charakter undurchschaut bleibt. Als ,Unbehagen in der Kultur‘, als vereitelte Biografien, als ungute Lebensgefühle zeigt sich diese Inauthentizität gleichwohl an. Sie geben unartikuliert Meldung von den Käfigen in unseren Köpfen. Hier setzen die Künste an. Und die intimste unter ihnen, Lyrik, lässt dabei diese sprachliche Ich-Routine auf ihre sondersprachliche Weise als solche auffällig werden. Dabei wendet sie eine modernistische Strategie an, die das ganze 20. Jahrhundert hindurch wirksam blieb. Sie geht davon aus, dass sie von denen, die ihre hohen Hürden nicht scheuen, gleichsam auf den ersten Blick an ihren formalen Eigenheiten erkannt wird, gerade im Unterschied zu narrativen und dramatischen Textoberflächen. Noch bevor sie ein Wort sagen kann, fällt ihre Kurzform ins Auge, mit der ihr eigenen semantischen Ökonomie, die Worte zu verknappen, um ihre Bedeutung zu mehren. Ihre besondere typografische Anordnung, ein Erbe ihrer Versform, treibt ein unterstützendes Spiel mit der Schreibfläche und der vertrauten Zeilenordnung. Die Worte selbst, und kämen sie von der Straße, aus der Pop- oder der Rap-Welt, haben zwar auf den Wohlklang von Reimen verzichtet – worauf hätte sich deren Harmonie noch berufen können? – dennoch klingt ihre Fügung vom ersten Augenblick an wie ein Echo auf ihre Zeit: befremdlich anders.
So subjektiv wie sie auftritt, appelliert sie – einerseits – an unsere eingeübte Zeichenerfahrung, dass Äußerungen im Ich-Modus mit einer subjektiven Orientierung im Bunde sind, dass hier jemand davon spricht, was ihn in seinem Innersten bewegt und dies in der Immanenz seiner Mitteilung abbildet. Andererseits scheint dies ein untrügliches Kriterium für Modernität gerade der Lyrik zu sein, dass sie diese Erwartung gezielt enttäuscht. Ihre Dunkelheit, Schwerverständlichkeit, ihre irritierende Zeichenfolge führt ein lyrisches Ich vor, dem eine subjektive Orientierung, die die Sprache semiotisch verspricht, gerade zum Problem geworden ist. Eine epochale Kluft hat sich aufgetan zwischen der Identitätleistung der Sprache und dem alltäglichen Identitätvollzug des Sprechenden. Zum Anwalt dieser Nicht-Übereinstimmung hat sich, in allgemeiner Weise, die Lyrik der Zweiten Moderne gemacht. Sie verstößt gegen den vertrauten Umgang mit unserem Ich, um darauf aufmerksam zu machen, dass, wo ihm überindividuell keine Verbindlichkeiten mehr auferlegt werden (können), man einem zeitgemäßen Vollzug seines Selbst nur dann gerecht werden kann, wenn dieser statt auf eingespielte Selbstbilder gerade auf ein befreiendes Spiel mit eingespielten Selbstbildern aus ist: ,,parler contre la parole“ (Ponge: 1999, S. 196).36 Gewiss, Psychologie, Soziologie, Philosophie des 20. Jahrhunderts kommen zu ähnlichen Befunden. Sie versuchen allerdings rationalistisch aufzufassen, was nicht zuletzt eine aggressive rationalistische Ausdifferenzierung aller Lebensverhältnisse erst nach sich gezogen hat. Lyrik hingegen geht gerade nicht denkend, theoretisch, sondern handelnd, konstruktiv-kreativ darauf ein. Ihre Texte fassen das Ich wie eine Textur auf (Ricoeur: 1990). Ihre befremdlichen Sprachzeichen verwehren es ihm, rezeptiv auf sie einzugehen. Da sie einen vorbereiteten Sinn nicht mehr vorhalten, liegt es an ihm, wie es sich durch ihre Konstellation hindurchfindet. Was es aus dem Text herausliest, deckt sich erheblich mit dem, was es von sich aus hineinsieht. Umgekehrt muss es dabei aus sich herausgehen – um sich dadurch gleichsam als Objekt seiner selbst zu erfahren. Dies gilt zuerst für das Ich selbst. Identität im Bilde modernistischer Lyrik verdankt sich einem Akt unvorgreiflicher Interpretation.37 Verharrt sie nur in ihren Vorannahmen, setzt sie sich der Suggestion unbedachter Heteronomien aus. Die Verfremdung, die auf sich nehmen muss, wer den Zeichenraum dieser Lyrik durchqueren will, wird mit Aneignung belohnt: er erfährt sich in einem anderen, freisetzenden Verhältnis zu sich selbst. Verse ihrer Art haben eine ,symbolische‘ In/vers/ion von Ungereimtheiten unserer Wahrnehmung im Sinn. Gedichte dieses Stils sind Ich-Übungen zur Flexibilisierung unseres Selbst-Bewusstseins.
Die Tendenz zur Abstraktion, so sehr sie sich über Realitäten hinwegzusetzen vermag – sie bleibt doch an die Sprache gebunden, gegen die sie zu Felde zieht. Sie wahrt durchaus den Widerschein der Realien, die ihr Vokabular mit sich führt, zumal es jede Selektion aufgegeben hat. Sieht man von politischer, allgemein engagierter Lyrik ab, wie sie etwa die Résistance hervorgebracht hat, so gleichen solche Anspielungen aufs gelebte Leben dennoch nur Reflexen, deren diskursive Quelle in der Beziehung auf ihre Sprachzeichen liegt. Wer direkter in den literarischen Spiegel der Wirklichkeit schauen will, muss unterhaltsame Romane lesen. Im Vergleich zu ihnen bildet Lyrik sich charakteristisch als nicht-referentiell. Das heißt jedoch keineswegs, dass sie nur ein narzisstisches, zu Autismus neigendes Selbstgespräch führte. Ihre Außenbezüge sind nur von grundsätzlich anderer Art. Maßgeblicher Referenzraum ist das weite Redekontinuum der Lyrik selbst. Analog zur Subjektzentriertheit des lyrischen Ich bestreitet sie auch ihren Weltbezug selbstreflexiv: keine andere literarische Sprechweise ist vom Echo ihrer Tradition so durchdrungen wie sie. Äußert sich darin ein letzter Reflex ihrer musikalischen Ursprünge? Wo das poetische Wort sich am Klang und Rhythmus und nicht nur an seiner Klarheit ausrichtete? Zudem: ließ sie sich nicht von Anfang an im Chor verlauten? Wo, wie bereits in der Troubadourlyrik, im Minnesang, dem ,Dolce stil nuovo‘, im Petrarkismus die Gedichte und die Poeten untereinander eine subtile Korrespondenz unterhielten? Diese poetische Gruppendynamik hat sich auch in der Moderne nicht verloren; die nachfolgenden Beispiele belegen es. Programmatisch geändert hat sich jedoch die Einstellung zur Tradition. Dichten im Rahmen eines Überlieferungszusammenhanges hat sich seit der romantischen Revolution der Künste Schritt um Schritt in einen Gegensatzzusammenhang mit seiner Herkunftsgeschichte verwandelt. Um 1800 begann eine Entwicklung, in der die Philosophen Freiheit predigten, Napoleon Unfreiheit praktizierte und die Künstler Evasion suchten im Reich der Kunst, beseelt von einer orphischen Sprachgläubigkeit, die ihrer Fantasie Heimat versprach. Zwar werden in ihren Worten noch lange klassizistische Töne nachhallen. Dennoch sind sie, sprachtheoretisch gesprochen, unwiderruflich zu einem antiklassischen ,langage‘ aufgebrochen. Das 19. Jahrhundert hat ihn weiter erschlossen – und etabliert. Die historischen Avantgarden haben ihn dominant gesetzt und in einem kühnen Anlauf seine Möglichkeiten experimentell durchgespielt. Sie boten gleichsam eine ,langue‘, eine poetische Grammatologie auf, nach deren Gestaltungsregeln die Zweite Moderne ihre literarischen Sätze, die ,parole‘ ihrer Werke bildet. Durchgehende, sich verschärfende Mentalität dieses Modernisierungsprozesses ist ihr romantisch-revolutionäres Erbe: der disjunktive Progress, der Fortschritt nurmehr an der Abstoßung vom gegenwärtig Gültigen als dem bereits Überlebten bemißt, über dem unartikuliert die Schatten der Uneigentlichkeit und des Vergangenen liegen. Dieses Verfahren der abweisenden Anknüpfung hat sich als eine der ehernsten Vorgehensweisen der Zweiten Moderne behauptet.38
Nicht nur, dass hierin die Lust zur Provokation ihren tieferen Grund hat. Das Selbstverständliche vor den Kopf zu stoßen, um das Unselbständige darin bewusst zu machen – dieser ästhetische Anstoß zur Selbst-Tätigkeit könnte als das Ethos ihrer Unangepasstheit angesehen werden. Dies prägt auch den Umgang mit den überlieferten Besprechungsmustern der Lyrik selbst. Doch wie wäre dies unter ihrem Vorzeichen der Verfremdung und Abweichung systematisch aufzufassen? Das konjunkturell naheliegendste Angebot macht das Konzept der Intertextualität.39 Es knüpft an die Erfahrung an, dass literarische Texte von jeher einen Dialog mit literarischen Texten führen; Autoren nicht nur Schreiber, sondern ebenso Leser sind. Diese Binnenkommunikation ist eine Konstante, auf der Nachahmungslehre ebenso wie Rhetorik oder Gattungsbegriffe aufbauen. Intertextualität hat daraus allerdings ungleich mehr gemacht: eine kulturtheoretische Ideologie. Der Begriff ist dadurch inflationär geworden, wird häufig genug als Passepartout verschwendet. Gerade für Lyrik – und für modernistisch sich verweigernde insbesondere – scheint es deshalb geboten, ihre kommunikativen Neigungen in einen ihr gemäßen terminologischen Rahmen zu stellen. Dafür empfiehlt sich ein Begriff, der dem langen Gedächtnis lyrischen Sprechens Rechnung trägt: Responsionalität. Er kann sich auf zwei einflussreiche Sprachordnungsverfahren berufen. Er antwortet in einer Hinsicht auf das Responsorium, den Wechselgesang in religiöser Kultausübung. Wie sein griechisches Fachwort – Antiphon – verdeutlicht, hat seine Sprache ihr Paradigma, wie Lyrik, in der Musik (Phon). Er ist zugleich ,dagegen tönend‘ (anti-) wie Rede und Gegenrede. Sie kommen jedoch in einem höheren Sinne, im Klangraum des Gotteshauses ,una voce‘ zusammen. Von Ferne wirkt dieses liturgische Moment noch immer nach, wenn sie Wirklichkeit als sprachliche Gegebenheit nimmt und ,fremdsprechend‘ auf sie antwortet. In anderer Hinsicht lässt sich ihr Responsionscharakter zugleich auf die drei Gattungen der Rede beziehen, wie die Rhetorik sie kennt (Lausberg: 1963, 143). Ob sie lobt oder tadelt, rät oder abrät, anklagt oder verteidigt: stets liegt ihrer Redeführung ein antithetisches Gesprächsverhalten zu Grunde, mit dem sie glaubt, Urteilsgewissheit zu bewirken. Dies kommt auch einer Lyrik im modernen Sinne auf das Beste entgegen. Da sie es nicht (mehr) auf Aussagen, Botschaften, letzte Wahrheiten abgesehen hat, liegt ihr eigentlich nicht am Ergebnis ihrer Rede, sondern dass sie eine Verständigungshandlung in Gang bringt. Sie fordert zu einer Wechselrede der besonderen Art heraus. Da sie dem Leser gerade nicht nach dem Munde redet, verneint sie ihn, um ihn – antithetisch – dazu zu bringen, sich im sprachlichen Gegenbild ihres lyrischen Ich bejahen zu lernen: als Aktivist einer emphatischen Fremderfahrung.
Nicht nur dass sie entschieden anderslautend auftritt, macht ihren Unterschied zu früheren poetischen Redeweisen aus, sondern dass sie mit unvergleichlicher Konsequenz alle sprachlichen Beziehungen diesem reinigenden Antagonismus unterzieht. Dass Lyrik immer schon anders als die umgebende Lebenswelt gesprochen hat, treibt sie nun auf die Spitze. Apollinaire hat ihr gleichsam alles erlaubt:
Je n’écrirai plus qu’une poésie libre de toute entrave, serait-ce celle du langage. (1966, I, S. 257)40
Diese Fundamentalopposition hatte sie tief in ihrer abstraktiven Tendenz verinnerlicht. Nicht minder radikal ,antwortet‘ sie auch auf ihre eigene Herkunft. Mit ihrem avantgardistischen Bruch hat sie sich von jeder Verpflichtung gegenüber ihren Traditionsgütern losgesagt. Seitdem stehen sie ihr zur freien Verfügung. Sie unterwirft auch sie ihrer provozierenden Fremdsprache. Zwar sollen sie sich durchaus – im Sinne einer Lesehilfe – als Zitate zu erkennen geben. Aber der Dialog mit ihnen ist uneigentlich: sie sind Anlässe, um Aussagen gegen deren Bedeutung zu machen. Die poetische Tradition insgesamt wird dadurch, in der Tendenz, in eine Anthologie, zu einem Responsoriale, einem literarischen Antiphonar umgewertet. Die Vergangenheit soll nicht länger die Gegenwart beeinflussen; das wäre Passatismus. Die Gegenwart hat vielmehr über den Gebrauch der Vergangenheit zu bestimmen. Die – emanzipatorische – Chance, die darin läge, hat Derrida in einen (moralischen) Imperativ übernommen: ,,choisir son héritage“ (2001, S. 11ff.).
Mit betroffen von diesem Responsionsverhalten ist dann auch die klärungsbedürftige Frage nach dem Verhältnis von Erster und Zweiter (ästhetischer) Moderne (Becker/Kiesel: 2007, S. 10). Obwohl die eine der anderen den Boden bereitet hat, ließe sich dies nur dann als Kontinuität und Fortschreibung verbuchen, wenn die Revolte der historischen Avantgarden gegen ihre erklärte Absicht unterschlagen würde. Andererseits besteht kein Zweifel, dass die Errungenschaften der Lyrik des 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert fortwirkten und einen breiten Unterstrom an poetischen Kundgaben entstehen ließen, die dem Erbe subjektiver Selbst( er)findung eine angesehene literarische Begegnungsstätte erhielten. Wenn sie auch keine authentische Ich-Identität mehr zu beschwören vermögen, so geht es ihnen zumindest noch um den Erhalt der Frage danach. An ihr scheiden sich die moderneren Umgangsformen: ihnen geht es um die Erfahrung eines pluralen Ich.
Unter der Anleitung des Responsionsmodells lässt sich auch die dritte sprachliche Seite, ihr Binnenverhältnis, unter eine systematische Perspektive rücken. Dringlichere, aufmerksamere Leser moderner Sprachkunst gibt es kaum als deren Autoren selbst. Wo es darauf ankommt, mit immer neuen Zeichenkonstellationen das eingefahrene Denken vom Weg abzubringen, ist die Hinwendung und Abwendung von den anderen, die im selben abstraktiven Paradigma schreiben – Responsion –, geradezu eine Notwendigkeit. Sie kann nur gelingen durch eine ständige, auf Dauer gestellte Erneuerung des Ausdrucks. Nichts altert jedoch schneller als das Neue in der Kunst. In den besten Fällen wird es klassisch, in anderen kunstgewerblich oder obsolet. Umso mehr ist gerade das Reanimationsvermögen von Lyrik darauf angewiesen, ihre Appell-Funktion akut zu erhalten. Wenn die Autoren sich deshalb gegenseitig studieren, dann nehmen sie die Stimmen der anderen zwar auf, aber im wesentlichen, um sich, dem Gebot ihrer modernistischen Responsionsgemeinschaft folgend, dialogisch-dialektisch eine eigene, anderslautende und dadurch selbstkritische Stimme zu sichern (Meschonnic: 1985, S. 184).
Selbst die vierte Seite ihrer Referenzverhältnisse, die Beziehungen eines Autors zu seinen eigenen lyrischen Bildungen, hat sich im Prinzip dem Responsionsgrundsatz unterstellt. Dada hat zuerst mit aufrührerischer Kompromisslosigkeit die Direktive vorgegeben:
les vrais Dada sont contre Dada. (Tzara: 1975, S. 381)
Das heißt: authentisch auch sich selbst gegenüber zu sein, indem man sich beständig antithetisch selbst überschreitet und, im Prinzip, ein folgendes Gedicht zum Widerruf des vorhergehenden macht. Dichten in diesem Kontext will nicht in einem Stil, einer Figuration, einem metaphysischen Gehäuse zu beruhigter Gestalt kommen. Es hat sich vielmehr umfassend einer Mentalität der Palinodie verschrieben, die später, in den Begriffen des Palimpsestes und der ,réécriture‘ Einzug gehalten hat in eine Text- und diese in die Kulturtheorie (Genette: 1982). Dies läuft zuletzt auf ein unmögliches Textideal hinaus. Im Grunde müsste jedes Gedicht darauf bedacht sein, dass es die Worte und Zeichen, die es fixiert, zugleich wieder – im Wortsinne – liquidiert, um die Wahrnehmung ,flüssig‘ zu erhalten. Gewiss, dies bezeichnet eine utopische Grenze. Aber sie ist als solche selbst Lyrik geworden. Wie ein Refrain klingt sie beharrlich an in dem Motiv des Schweigens als der paradoxen Erfüllung aller (poetischen) Rede. Es wäre die kommunikative ,arche‘ schlechthin, in der sie, einem poetischen Pfingstwunder gleich, sich noch im Vollbesitz ihrer schöpferischen Weltergreifung weiß oder sich in Gestalten des Verstummens hüllt, weil sie nur so noch auf die öffentlichen Sprachmisshandlungen aufmerksam machen kann.
II
So entschieden lyrische Rede die Geschichte des 20. Jahrhunderts diskurskritisch begleitet, so schwer fällt es andererseits, ihren eigenen Verlauf als eine zusammenhängende Geschichte zu rekonstruieren.41 Vielleicht entspricht auch dies ihrem nonkonformistischen Bedürfnis nach einer uneingeschränkten sprachlichen Anderwelt. Konsequent ist es in jedem Fall im Hinblick auf ihre ästhetischen Grundkonzepte der Abstraktion und Responsion. Beide entziehen sich gewissermaßen systematisch den Systemzwängen, die von instrumenteller Vernunft, ideologischen Beugungen und medialen Kanalisierungen von Sichtweisen ausgeübt werden. Was aus ihrer Perspektive als weltfern, insular, exzentrisch oder unsinnig erscheint, ist ihre Waffe, um gewaltfrei gegen die belastete Sprache der Zeit vorzugehen. Gleichwohl unterliegt sie deshalb geradezu notwendig beständigem Wandel, Veränderungen und Brüchen, die sie ihrem Gesetz der Neurede schuldet, um die Widerständigkeit ihres Wortes gegen den Mehltau der Gewohnheit zu verteidigen.42 Wie ihrer Diversität also einen literaturgeschichtlichen Gang zuschreiben, wo sie doch gerade versucht, geschichtlichen Laufrichtungen in die Quere zu kommen? Ohne Respekt für ihre „démarches plurielles“ wäre historisch angemessen nichts gewonnen. Sie wiederum legen zwei Restriktionen nahe. Die Partialität, die der Moderne generell innewohnt, gilt auch für ihre Darstellung. Sie verlangt eine Entscheidung: entweder möglichst alle lyrischen Stimmen, die einen Nachhall hinterlassen haben, einzelnen zu würdigen und ein großes Album von Autoren- und Werkporträts anzulegen, ein methodisches Echo der ,l’homme-et-l‘œuvre‘ Literaturgeschichtsschreibung. Die monumentale Histoire de la poésie française von Robert Sabatier43 verbindet sie mit synchronen Gruppenbildungen, nach thematischen und expressiven Verwandtschaften geordnet. Zahllose monographische Studien üben andererseits individualistische Gerechtigkeit. Großer Referenzrahmen sind dabei die als literarhistorische Epoche bereits etablierten historischen Avantgarden vom (literarischen) Kubismus bis zum Surrealismus der Zwanziger Jahre. Ihre Expeditionen ins Neuland der Expressivität hatten jedoch bereits in den Dreißiger Jahren (vgl. Beitrag Greiner), erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg an kultureller Zuständigkeit verloren.44 Doch gerade deshalb eigneten sich ihre systematischen Irrationalitätsstudien als Bezugspunkt für eine anknüpfende Abwendung, die den Prozess der Modernisierung in Gang hielt. Denn vor aller Bindung steht das Bedürfnis dieser Lyrik nach Ungebundenheit. Nur so kann sie ihren Anspruch als Dissidentin gegen jede Art von Diskursherrschaft wahren und zugleich sich die Freiheit einräumen, beständig sich selbst zu überschreiten und dadurch zu erneuern, ganz entsprechend ihrer avantgardistischen Gangart. Dies darf als ihr erstes, bestimmendes Kriterium gelten. Mit seiner Hilfe lässt sich daher andererseits auch ein Parcours ihrer Bewegung durch das 20. Jahrhundert anlegen. Keine Frage, dies zieht eine Auswahl aus den vielen, sich überlagernden lyrischen Stimmen nach sich. Sie wiederum setzt Wertung voraus, nimmt erhebliche Absenzen in Kauf. Umgekehrt gewinnt dadurch eine – die modernistische – Tendenz schärferes Profil. Aber war es nicht sie, die das ästhetische Gesicht des 20. Jahrhunderts geprägt hat?45 Ist nicht das Bedürfnis, die Gier, die Sucht nach Neuem (in allen problematischen Spielarten) die wahmehmungspsychologische Konstante des vergangenen Jahrhunderts? Gegenreaktionen wie Sammlung, Ruhe, Sicherheit scheinen eher auf Entlastung als auf Kritik aus zu sein.
So gibt es gute Gründe, dessen charakteristischen lyrischen Ausdruck eher von seinen kreativen als von den rekreativen Seiten her zu bestimmen. Wie aber diesem Proteus eine Ordnung abgewinnen, dem die freien Möglichkeiten der Zweiten Moderne doch Lebenselixier sind? Es kann nur darum gehen, in seinen wandelbaren Äußerungen Konstellationen zu erfassen, in denen sich Grundtöne, Homophonien, Sprachumgangsformen, Bildgalerien zu diskurskritischen Foyers auf Zeit verdichten. Sie gleichen sprachlichen Magnetfeldern, die konvergieren, ohne eine Mitte auszubilden. Unter die übergeordnete Perspektive eines idealen Raumes, ,,entre centre et absence“, hat Henri Michaux bezeichnenderweise einen zentralen Teil seines Gedichtbandes Lointain intérieur (1972, S. 214) gestellt. Es ist ihre Art, um einen Bedeutungszufluss von seiten des Lesers zu bewirken, gewissermaßen einen Systole-Diastole-Wechsel ihrer Semantik anzustoßen. Ganz ohne Wiedererkennbarkeit kommt auch sie nicht aus, insofern alles Neue nur relativ erfahrbar ist, als Abweichung von Bekanntem. Auch von daher scheint es methodisch sinnvoll, historisch sich ablösende, überlagernde Konvergenzfelder anzulegen, soviel ihre Synthese sich auch einem Ordnungswillen der Interpreten verdankt. Sie bieten freibleibende Annäherungen, wie Prousts Kirchtürme von Martinville. Auf diese Weise entsteht eine Flucht von lyrischen Leseräumen. Zwar folgen sie sich nicht entlang einer innerliterarischen Filiation. Sie reagieren historisch allerdings in dem Sinne, dass sie, um die fortlaufenden sprachlichen Kolonialisierungen der Lebenswelt bloßstellen zu können, ihre Widerrede jeweils neu justieren müssen. Ihr Wandel entspringt mithin keiner diskursiven Logik, sondern einem Ethos der Dissimilation.
Die ersten lyrischen Sezessionen des 20. Jahrhunderts haben den Vorteil, dass sie, beflügelt vom Gründungselan einer Zweiten Moderne, sich mit einer Flut von Manifesten zumindest in ihren Visionen selbst situiert haben. Dies gilt namentlich für den literarischen Simultanismus, Futurismus, Dadaismus, und, aus ihnen hervorgehend und ihren Aufbruch abschließend, Surrealismus. Die Vehemenz, mit der sie ihre Vergangenheit im 19. Jahrhundert abwiesen, hat ihr Gegengewicht in der Entschiedenheit, mit der sie das Tor ins Freie einer bislang undenkbaren Sprachlandschaft aufstießen (vgl. Beitrag Wehle). Sie nahmen ästhetische Freiheit in äußerster Konsequenz in Besitz: dass alles Mögliche auch möglich gemacht werden sollte. Dies hieß umgekehrt, sich – zunächst – unvoreingenommen, ohne festgelegte Ziele, der Berauschung eines uneingeschränkt offenen Kunstwerks hinzugeben. Positiv bestimmt war allenfalls der Wille, die Gegenwart nach einer ,post-intellektuellen Ordnung‘ (J. Rivière: 1920, S. 234) neu zu veranlagen. Ursachlos war der Aufstand der Künste im Zeitalter der Avantgarden gleichwohl nicht. Ihre heftige Reaktion übersetzt nur in ästhetische Erfahrung, was der zeitgenössische Umbruch im Wahrnehmungsverhalten bewirkt hat, den die neue, wissenschaftlich-technische Zivilisation eingeleitet hat: den Lebensrhythmus von Omnipräsenz, Ubiquität und Simultaneität. Lyrik hat im Verein mit den bildenden Künsten darauf zuerst reagiert und einer kommenden Kunst das Paradigma ihrer dissidenten Entfaltung gestiftet. Denn ihre besondere Leistung war, mit immer neuen Experimenten die Bindung an die Sprache, auf die alle angewiesen sind, umzuwandeln in eine Ungebundenheit von eben dieser Alltagssprache.
Sie auch hat einer der unverbrüchlichsten Achsen der (ästhetischen) Modernisierung zum Durchbruch verholfen. Um mit den Freiheiten, die sie sich nahm, eine Befreiung unserer Wahrnehmung zu erreichen, setzte sie entschieden, wie niemals zuvor in der abendländischen Kulturgeschichte, auf ein Erkenntnisprinzip, das den Siegeszug des Logos stets wie das dunkle Andere seiner selbst begleitet hatte: das Pneuma und sein subversives, weil unterschwelliges Wissen, über das das Instinktvermögen verfügt. In diesem Souterrain des Denkens herrschen die umwerfend anderen, politisch unkorrekten Gesetze des Begehrungsvermögens, das, wenn es kann, sich über alle vernünftigen Werturteile hinwegsetzt. Die avantgardistischen Versuche brachten eine immer kühnere Entwicklung in diesem Sinne in Gang, maßgeblich beeinflusst von der technisch gesteigerten Sinnlosigkeit des Ersten Weltkriegs. Modernistisches Dichten identifiziert sich dadurch bleibend an seiner Wandlungsfähigkeit, um jeweils neu und anders als Dissident die herrschenden Verhältnisse konvertieren zu können. So entfaltete es innerhalb seiner avantgardistischen Ära drei immer kühnere Stadien der Kunstwirklichkeit, verkörpert in der Tendenz zu einem simultanistischen Sprachkunstwerk, maßgeblich beeinflusst von kubistischer Gegenstandesüberwindung; radikalisiert in dadaistischer Weltverachtung zu abstrakter Loslösung; gipfelnd im Absolutheitsanspruch surrealistischer Tiefenpoetik.
Deren Bedeutung für die Wandlungen lyrischer Modernität im 20. Jahrhundert kann kaum überschätzt werden. Was in den vorausgehenden Avantgarden Aufbruch, Anlauf war, wird namentlich von Breton wissenschaftlich eingemeindet. Die bisherigen Versuche, eine Sprache der Irrationalität auszubilden, erfahren dadurch eine konzeptionelle Fundierung (vgl. Beitrag Wetzel). Liegt aber einer Systematisierung des Unsystematischen nicht ein innerer Widerspruch zu Grunde? Faszination wie Misserfolg des Surrealismus haben hierin wohl ihre Wurzeln. So oder so empfahl er sich nicht zuletzt deshalb als Berufungsinstanz des 20. Jahrhunderts schlechthin: kaum eine der nachfolgenden lyrischen Initiativen, die sich nicht, anknüpfend-abwendend, mit ihm auseinander gesetzt und damit die Sprechordnung der Responsion nachhaltig ratifiziert hätte, die die surrealistische Bewegung selbst angewandt hatte, um sich ein Profil zu verschaffen (Wetzel: 1982, S. 71–132). Es verdankt sich einer doppelten Abgrenzung. Fernhorizont war einerseits, wie für alle avantgardistischen Distanzierungen, die Lyrik des 19. Jahrhunderts, die unter dem theoretischen Dach der ,Kunstautonomie‘ aus einer unvollkommen empfundenen Realität noch einmal einen Begriff für Vollkommenheit zu retten versuchte. Diese Logik einer ,negativen Ästhetik‘ lassen surrealistische Positionsbestimmungen entschieden hinter sich. Wie ihr Name es besagt, steht hinter ihren Kunstanstrengungen die Absicht, die Partialität der Ersten Moderne zu überwinden und alle Welterfahrungsbereiche des Menschen in einem höheren, umfassenderen Begriff von Realität, einer ,sur-réalité‘ zu totalisieren.
Keine geringe Strukturhilfe bot dabei die Verwissenschaftlichung der menschlichen Psyche. Den dunklen, instinktiven Regungen der ,Seele‘ konnte im Rahmen der Tiefenpsychologie als Unterbewusstsein ein eigenes Format zugeschrieben werden, weil es über elementare systemische Momente verfügt. Wenn es noch ein letztes Absolutum gibt, dann, so die Annahme, ereignet es sich in der Unterwelt der Psyche, weil in ihr sich ein kollektiver Schutzraum erhalten hat, der sich der Beherrschung von verstandesgeleitetem und zweckgerichtetem Denken zu entziehen vermag. Wenn es gelingt, sich dorthin Zugang zu verschaffen, ließe sich das Leben auf einen ,archimedischen Punkt‘ (Breton) beziehen, wo die urgründigen Gesetze der Libido und des ,amour fou‘ walten, von denen aus gesehen die Bewusstseinsspaltung von Intellekt und Instinkt, Kunst und Leben, Kultur und Natur in einer „réalite suprême“ (Breton: 1981, 51), einer ganzheitlichen Existenzerfahrung (wieder) aufgehoben wäre.
Und dieser Zugang scheint surrealistisch möglich. Unausgesprochen liegt dem die Überzeugung zu Grunde, dass das Unterbewusste über eine eigene – alogische – Poetik verfügt. Anschauungsunterricht gibt der Traum. So zufällig wie seine Assoziationen erscheinen – unterbewusst machen sie jedoch durchaus einen objektiven Anspruch geltend. Wer aber könnte diesen Zugang besser initiieren als die Kunst? Vorausgesetzt sie verabsolutiert eine Redeweise, wie sie namentlich von jeher Lyrik auszeichnet: metaphorisches Sprechen. Es vermag über etwas zu sprechen, das nicht ausgesprochen wird (und werden kann) und gerade deshalb „vous force à réviser tout l’Univers“ (Aragon: 1953, S. 81). Um die ,wilde‘, niemals zur Ruhe kommende Artikulationsweise des Unterbewusstseins jedoch wirksam gegen die sprachlichen Fixierungen der Lebenswelt ins Feld führen zu können, muss poetische Sprache sich deren Vitalität auf ihre Weise anverwandeln und sie als einen – im Idealfall – unabschließbaren metaphorischen Prozess anlegen.
Vor diesem Hintergrund wird auch die zweite Responsionsfront des Surrealismus einsichtig: die produktive Abstoßung von seiner unmittelbaren Herkunft aus der dadaistischen Bewegung. Deren Unsinnsgebärdensprache, die die Sinnlosigkeit des Krieges in ästhetische Erfahrung übersetzte, verharrten weithin in ihrer anarchistischen Bankrotterklärung bürgerlicher Leitvorstellungen. Dagegen vertrauen surrealistische Kunstexpeditionen darauf, dass sie unter Anleitung von ,écritures automatiques‘ (die allerdings nicht leugnen können, dass sie einem kulturellem Bedürfnis entspringen), Bild-, Ton- und Denkstörungen in einem akzeptierten, aber inakzeptablen Lebenszusammenhang (Breton) hervorzurufen vermögen. Es wären Durchbrüche zu einer heilsamen Ganzheitserfahrung unserer Identität. Nehmen Sie dabei aber nicht insgeheim Zuflucht zu einer Metaphysik der Tiefe, die dem Unbewussten zuletzt unterstellt, es wisse (noch), was für die ,conditio humana‘ wahr und gut ist?
Zumindest die Frage danach werden die folgenden lyrischen Kunstrichtungen weiterführen – und sich im Sinne der Responsion antithetisch daran ihrerseits in Position bringen (vgl. Beitrag Greiner). Keine geringe Rolle spielten dabei nationalistische, faschistische und kommunistische Anfälligkeiten. Notwendig schien, auf Nietzsche, den Ziehvater einer Zweiten Moderne zurückweisend, die „große Loslösung“. Der produktiven Distanzierung davon verdankt sich, bereits in den Dreißiger Jahren, also noch in der Hochphase des Surrealismus, eine bedeutende nach-surrealistische Revision von Poeten wie Supervielle, Saint-John Perse, Char oder Michaux. Ihre befremdlich dunkle Rede („Vous ne pouvez rien / Saus obscurité“; Supervielle) begann auf ihre Weise, dezidiert das Befremden zu bearbeiten, das die aufziehenden Diktaturen bereits aussandten. Unverhältnismäßig musste ihnen schon früh der (radikale) Rückgang in den Lebensstrom des Unbewussten erscheinen, der surrealistisch als der irrationale Königsweg eines wahren Lebens galt. Angesichts der offenbar werdenden Schattenseiten der historisch-politischen Irrationalismen sollte es im ,Entre-deux-guerre‘ vielmehr darauf ankommen, einen Modus zu finden, der auf die Befreiungsschläge der Imagination nicht losgelöst von reflektierten Identitätsbedürfnissen vertraut. Sie nehmen Zuflucht zu einer Gegenschöpfungsästhetik, deren Darstellungsweise (surrealistische) Unvermitteltheit suggeriert, dies aber gerade durch einen äußerst reflektierten Einsatz sprachlicher Mittel erreicht. Ihre Poesie kreist dabei um die Frage, wie das verloren gegangene Gleichgewicht zwischen Kalkül und Traum, Reflexion und Irrationalismus wiederherzustellen wäre – unter der modernistischen Bedingung allerdings, ihre Vermittlung selbst stets als einen unabschließbaren Erneuerungsprozess offen zuhalten, gemäß dem avantgardistischen Credo der Lyrik als einer „novation – (nicht Innovation!) – toujours qui déplace les bornes“ (Saint-John Perse: 1972, S. 445).
Und dann: wieder ein Krieg; in seinen Ausmaßen inkommensurabel, nicht nur für imaginative Bewegungsschübe von Lyrik. Dessen eruptive Gewalt musste ihr zuerst die Sprache verschlagen. Die Realität selbst sprengte jedes Vorstellungsvermögen ungleich mehr als es ihre semiotischen Eklats je vermocht hätten. Sie waren auf eine problematische Kultur, nicht auf eine barbarische Unkultur des Krieges berechnet. Wie also von diesem Nullpunkt aus wieder zu Wort kommen? Abermals bestätigt sie ihre modernistische Responsionalität als anknüpfende Ablösung. Die Avantgarde des Surrealismus hatte ihre Wirksamkeit weithin eingebüßt. Er war gewissermaßen frei für eine neue Rolle und Bezugnahme. Seine Autoren hatten sich politisiert, poetische Texte ließen sich als subversive politische Aussagen, als Résistancelyrik neu in Anspruch nehmen (Krauß: 2002). Gedichte von Éluard, Desnos, Cassou, Emmanuel, von Aragon insbesondere, sollten als „poésie de contrebande“ in den verbalen Untergrund gehen und dort einen Schwarzmarkt der Gegenkultur bilden. Dazu musste sie allerdings ihre Performance ändern. Um sich in abgründiger Zeit Gehör zu verschaffen, bedurfte es einer entsprechend elementaren Ansprache, einer „parole vierge“ (Max-Pol Fouchet). Wie immer, wenn Lyrik in Ausdrucksnöte kam, ging sie auf ihre emphatische Ursprungsgewissheit zurück, auf die Macht der Musik, auf den Gemeinschaftssinn des Liedes. In Gestalt des Chansons fand sie einerseits politische Deckung, um andererseits verdeckt nur umso mehr ihrem gewaltlosen Widerstand zuzusprechen: ,,Rimes“ zu verbreiten, ,,où le crime crie“. Alle ästhetische Unabhängigkeit hatte dann allerdings zurückzustehen vor der Aufgabe, sich als „l’arme pour l’homme désarmé“ (Aragon) zu qualifizieren. Verlangt war dafür gleichermaßen eine Rückkehr zur Semantik ihrer Anfänge, das trobar clus, das doppelte Sprechen. Hinter dem Rücken der geknebelten Öffentlichkeit blieb so eine Enklave von verbindender Gedankenfreiheit.
Auch wenn Résistancelyrik nach dem Krieg schnell verstummte: sie hat gleichwohl ein Paradigma geschaffen, das in der Nachkriegszeit den Wiederaufbau einer poetischen Sprache nachhaltig prägen sollte (vgl. Beitrag Asholt). Das Leitwort hatte bereits 1937 einer ihrer Wortführer, Raymond Queneau, vorweggenommen, als er den Vorschein einer Sprache an den dunklen Horizont der Zukunft warf, die, „retrouvant sa nature orale et musicale, deviendrait bientôt une langue poétique, et la substance abondante et vivace d’une nouvelle littérature“ (1965, S. 26). Selbst wo sie sich auf surrealistische Intertextualitäten einlässt, bleibt sie in ihrem modernistischen Element: auch im Chanson der Fünfzigerjahre spielt sie nur mit der Tradition. Sie ruft sie – beispielhaft bei Boris Vian oder Jacques Prévert – auf um sie in die Atmosphäre von Saint-Germain-des Prés zu tauchen und existentialistisch zu ,nichten‘. Doch nach dem Krieg waren offene Worte, keine verschwiegene Rede mehr gefragt. Mit Georges Brassens und Léo Ferré wurde das Chanson populär, weil es einem verbreiteten Zug zur Protestkultur Vorschub leistete – damit aber die Kompromisslosigkeit moderner Lyrik preisgab. In anknüpfender Abwendung, auch hier, ging sie erneut an die Front radikaler Sprachkritik. Anstoß für ihr antagonistisches Einschreiten gab – in ihrer Sicht – eine große Sprachlüge der existentialistisch getönten Nachkriegszeit: stilistisch brillant die Absurdität des Daseins zu beschwören und gleichwohl daraus ein Engagement abzuleiten. Dies ignorierte auf provozierende Weise, dass, wer authentisch die Sprache literarisch wieder erheben wollte, er sie im Durchgang durch das Purgatorium eines „degré zéro de l’écriture“ (R. Barthes: 1953) erst legitimieren musste. Deshalb das anarchische Motto von François Dufrênes: ,,Existentialistes! Merde!“ Wie im Theater des Absurden, dem Nouveau Roman, der Nouvelle Critique sollte das ,Zeitalter des Argwohns‘ (N. Sarraute) seine Zeichen neu veranschlagen. Lyrik tat das ihre, um den terroristischen Neigungen des ,Vaters des Logos‘ (E. Jabès) ins Wort zu fallen. Um sinnvoll sein zu können, hatte sie allererst – wieder – Negation der Negation zu betreiben; die historische Sinnleere bloßzustellen, die die herrschende Sprache aushöhlte.
Sie tat es von zwei Seiten her. Das eine ihrer poetischen Foyers der Nachkriegszeit bildet sich nicht ohne Wechselwirkung mit der aufkommenden strukturalen und semiotischen Wendung der Sprachwissenschaft (vgl. Beitrag Föcking). In ihrem Sinne rettete sich auch Lyrik, um ihr Medium gegen ideologische Infektionen in Schutz zu nehmen, in die bare Materialität der sprachlichen Zeichen: Schrift unabhängig von der Rede zu behandeln; Wörter als ,,objets écrits“, nicht als Container von ,contenus‘ (R. Barthes) zu nehmen; deshalb auf die Ebene der Buchstaben, unterhalb der Wörter zurückzugehen. Nach der avantgardistischen Subversion der Semantik nun die der Schrift – ein Angriff auf die Schriftkultur, wie ihn später Derrida zum Philosophikum machen wird. Auch darin nimmt sie das Erbe der historischen Avantgarden und deren Experimente zur Kunst der Technopaignia (Pabst: 1980, 1–30) auf ihre Art, kontrapunktisch, wieder auf. Ihre Arrangements unterlaufen auch noch die letzte Sinnperspektive: dass jemand sie in eine persönliche Aussage überführen könnte. Entschieden verschreibt sie sich daher einer ,objektalen Poesie‘, die allen substantialistischen Ausflüchten, der Frage nach einem ,Was?‘, alle möglichen asemantischen Riegel vorschiebt. Zählen soll allein, dass ihren poetischen Gebilden mentale Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. In einem solchen Foyer skripturaler Poesie (vgl. Beitrag Krüger) konvergieren Bewegungen wie Lettrismus, Konkrete Poesie, Spatialismus, ,nouveaux réalistes‘ u.a. Bemerkenswert, dass neben Hauptvertretern wie Isidor Isou, Pierre Garnier, François Dufrênes, Jean Tradieu, auch Claude Simon, Henri Michaux und Boris Vian auf diese radikale Textstrategie eingeschwenkt sind.
Daneben fand zugleich eine andere Wiederaufnahme der lyrischen Vorkriegsmoderne statt. Doch was wie eine Anknüpfung an Poeten des ,Entre-deuxguerre‘ und über sie zurück zum großen Imaginationskonzept der Lyrik des 19. Jahrhunderts erscheint, muss sich abermals zugleich mit dem Gestus der Unumkehrbarkeit versehen, um dessen verschwiegene Sinngaben zu dementieren.
Nach dem Krieg ist eine Rückkehr in jedwede Sinnhaftigkeit mit keinen Mitteln mehr möglich. Schon das ausgehende 19. Jahrhundert hatte sich an ,leerer Idealität‘ abgearbeitet (Friedrich: 1967, S. 35). Umso mehr musste diese weltanschauliche Grundlosigkeit der Fünfziger und Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts zu Buche schlagen. Was also blieb? Ein ,transzendenzloser Idealismus‘, den Autoren um die bezeichnende Zeitschrift L’Ephemère wie Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Jacques Dupin, aber auch Michel Butor oder Claude Simon umkreisen (vgl.Beitrag Weiand). Wie aber wäre ein solch entleertes Ideal noch zu fassen? Wenn überhaupt, dann allenfalls als kunstvoll verschlüsseltes ,memento vitae‘, und auch das nur in der doppelt vorenthaltenen Identität von „vestiges“, ,Überresten‘ eines Lebens ,unter totem Himmel‘ (Bonnefoy: 1959, S. 166), zu dem allein noch ,Fieberanfälle des Dichters‘ (J. Dupin) Spuren der Erinnerung aufzudecken vermögen. Erfüllung fände diese Kunst, wenn ihre Bildbewegungen – gut modernistisch – zwar Sinnzuschreibungen in Gang setzen, sie aber in einem unabschließbaren Aufschub zugleich vorenthalten: Signatur des Unwahrscheinlichen („l’improbable“), in dem etymologisch das Unbeweisbare (,l’improuvable‘) durchscheint. Poesie, das Rettende von einst, hat sich von einer Welt der bergenden Semantik verabschiedet. Als Überrest bleibt ihr nur mehr Semiose, eine Sprachführung, die zu nichts führt, aber bewegt unterwegs ist als ob.
In diesem poetischen Foyer versammeln sich nicht eigentlich mehr Dichter, sondern lyrische Schriftgelehrte. Francis Ponge unmissverständlich: „Poète, c’est un mot, mauvais mot“ (Ponge: 1999, S. 673). Auf ihren Worten liegt das dunkle Licht von Baudelaire, Mallarmé oder Valéry. Sie haben es vor dem finsteren Horizont des Weltkriegs noch einmal, wie eine Huldigung an ein Abwesendes entzündet – zum letzten Mal im 20. Jahrhundert. Sie wussten wohl, dass es der endgültige Abgesang auf das hohe Lied der Imagination als Quelle eines emphatischen Urwissens war. In den Vordergrund trat die kritische Anspannung einer Generation, die in allem, vor allem in der Normalität Ideologie am Werk sah und damit gedankenlos einer Herrschaft der Unbedenklichkeit diente. Dem sollte mit einer strengen Ordnung des (unübersichtlich gewordenen) Wissens abgeholfen werden. Und da der Stoff, aus dem Wirklichkeit ist, Sprache ist, war Strukturalismus die gebotene kulturelle Gegenindikation (vgl. Beitrag Föcking). Sein militanter Anspruch machte vor keiner Humanwissenschaft halt; auch nicht vor Literatur. Neben dem Nouveau Roman entstand eine ,wissenschaftliche‘ Poesie um die Zeitschrift Tel Quel, quasi Antipode zum konkurrierenden Konzept von L’Ephemere. Entsprechend fällt ihr responsionaler Gestus der Negation aus: auch die letzten Reste eines (lyrischen) Subjekts zu eliminieren, die sich im grammatischen Aussagesubjekt ,Ich‘ noch halten konnten. So theoretisch/terroristisch sollte dieses „iconoclastiquer la poésie“ (F. Ponge) sein, dass es auch die Autodestruktion mit einschloss – die Vereitelung selbst von Autoreferentialität. Sie mit Foucault ,intransitive‘ Lyrik zu nennen (1966, 313), bliebe hinter der Zumutung zurück, die Denis Rache, Marcelin Pleynet, Jacqueline Risset, Jean-Pierre Faye oder Francis Ponge dem Sprachort der Lyrik und seinen (wenigen) Besuchern zufügen wollten. Sie schützten den Text mit einer „illisibilité“, die ihn den Grenzen seiner Möglichkeit aussetzt. Wer an ihm festhalten will, kann ihn nicht nur nicht mehr realisieren – er muss zugleich lernen, aller entstehenden Textualität wieder zu entsagen, die er sich zurechtlegt. Ein Text, ein Ganzes, böte ja Anlass zu – falscher – Eigentlichkeit.
Nicht minder erkenntniskritisch, aber auf ganz andere Weise, geht eine lyrische Tendenz vor, die sich um eine Art poetische Handwerkskammer sammelt, dem „Ouvroir de Littérature Potentielle“ (OuLiPo; vgl. Beitrag Schleypen). Sie setzt sich mit einem Kernproblem der Zweiten literarischen Moderne auseinander: dass, je mehr ihre Erzeugnisse den Kontext mindern, sie das Verstehen umso mehr dem Zufall dessen ausliefern, der sie je nachdem einlöst (und herstellt). Steht aber hinter der Patronin einer solchen Inspiration, der Kontingenz, ein untergründiges Sinnprojekt, wie mit dem surrealistischen ,hasard objectif‘ behauptet? Wer dies leugnet, wie der Gründer von OuLiPo, Raymond Queneau, hat den Zufall in lyrischen Sprachanordnungen deshalb anders zu veranlagen. Unverzichtbar bleibt er allemal. Aber er muss, um Mittel und nicht Zweck zu sein, gesteuert werden. Da modernistische Textbewegungen nicht auf etwas Bestimmtes hinauslaufen sollen, kommt es, auch hier, entschieden darauf an, mit Texten Texttätigkeit, nicht Botschaften zu generieren. Alles andere liefe auf mystifizierende Œuvre-Gedanken hinaus. Deshalb die Konsequenz: lyrische Wortverhältnisse so einzurichten, dass sie sich weder in unwegsamer Freiheit der Abstraktion, noch in uferloser Pluralisierung verlaufen, sondern sich einem Prinzip der Potentialität („potentielle“) beugen. Das weithin wirkende Modell dafür gab das mobile Buch Cent mille milliards de poèmes von Queneau: zehn Sonette, deren Verse sich einzelnen umblättern und damit neu kombinieren lassen. Aus einem begrenzten Inventar an sprachlichen Vorgaben lassen sich so (nahezu) unbegrenzte Textoperationen auslösen. In dieser gezielten Unterwerfung unter Gesetzmäßigkeiten – die „écriture saus contrainte“ – scheint ein nachhaltiger kulturkritischer Hintersinn zu walten: sie vermögen, lyrisch vorgeführt, gerade die zwanghaften Gesetzmäßigkeiten zu sprengen, denen sie sich verdanken. Sollte dies nicht auch für die undurchschauten Gesetze der Alltäglichkeit gelten?
Ausgetragen wird diese Auseinandersetzung jedoch demonstrativ nach den modernistischen Regeln der Responsionalität. Keine andere Gruppierung geht so intensiv auf die Wortkunst vor und neben ihr ein – um sich als eine Art Gegen-Avantgarde gegen ihre als ideologisch empfundenen Strategien abzusetzen. Reihum greifen oulipiens wie Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud, François Le Lionnais Texte von Mallarmé, aus dem Surrealismus, Tel Quel, Ephémère oder dem Strukturalismus auf – alle diese literarischen Modernismen verfallen ihrer geordneten Manipulation der Sprachzeichen: ,,l’on pouvait avoir tout intérêt, pour s’approcher du réel, à lui tourner le dos“ (Bens: 1980, 244) – einschließlich und vor allem der umgebenden Literatur.
Nur auf höchst artifizielle Weise noch natürlich bewegt sein zu können, war etwa zur gleichen Zeit der Beweggrund einer lyrischen Artistik, die sich ihrerseits exemplarisch an Queneaus Cent mille millards de poèmes inspirierte. Sie zog daraus allerdings Konsequenzen, die sie auf literarischem Gebiet zum Schwellenereignis einer dritten, einer Digitalmoderne werden ließ (vgl. Beitrag Scholler). Lyrisch wäre sie nur noch in dem Sinne, als sie die Freiheit der Abstraktion, wie sie die Avantgarden einst erstritten haben, abermals zu einer absoluten Poesie der anderen Art nutzt. Worauf Sie hinaus will – philosophisch gesprochen: ihre Entelechie – ist der Hypertext. Negation gilt, erwartungsgemäß, auch hier als erstes, platzschaffendes Exerzitium. Insofern Wirklichkeit Repräsentation, Repräsentation aber medial bedingt ist, lässt sich alles, was sie vorstellt, in kleinste digitale Einheiten, Pixel, auflösen. Sie unterlaufen in revolutionärer Weise die Sprache als Zeichensystem. Selbst der einzelne Buchstabe ist im Prinzip nichts anderes mehr als eine definierte Konfiguration von Bildpunkten. Was sich dadurch abzeichnet, ist nichts weniger als das Ende der ,,Semiosphäre“ (J. Lotman; Hahn: 2008, 290).
Soweit diese Digitalpoesie an kulturell vertrauten Sprachmitteln ansetzt, handelt es sich im Grunde um deren Input. Der rechnergestützte Output aber negiert jede Referenzialisierbarkeit. Die Sprache dieser maschinellen Dichter lebt nur dann, wenn das Textspiel der Maschine – autooperativ – läuft und in der nächsten Sequenz sogleich wieder ausgelöscht wird. Es betreibt Responsion in ihrer äußersten Form: an Sprache anzuknüpfen, um ihr total auch noch die letzten semantischen Ablagerungen auszutreiben. Anders gesagt: uns vorzuführen, dass das, was wir für Wirklichkeit halten, lediglich von einem erstarrten (sprachlichen) Betriebssystem abgespielt wird. Eingeschlossen ist dabei auch literaturmoderne Responsion. Denn die Kritik gilt nicht minder dem offenen oder verdeckten Zauber, den die poetische Befreiungstheologie der historischen Avantgarden, von Tel Quel und selbst von OuLiPo noch genährt hatten. Welches „plaisir du texte“ (R. Barthes) bleibt dann noch den poetischen Maschinisten ,Autor‘ und ,Leser‘? Sie decken auch selbst das humanistische Gegenprinzip zu rationaler Selbstermächtigung, Metamorphose, als mythologische Fassade auf, hinter der höchstens ein animalisches Bedürfnis (G. Bataille) als hintergrundloser Bewegungsdrang waltet. Dieser hat allenfalls Neuerung, nicht aber metamorphotische Erneuerung im Sinn. Kein Wunder, dass die Autoren dieser Kunst sich deshalb ins Ethos von entlarvender Satire und Ironie retten müssen.
Sollte dies das letzte Wort der Lyrik im 20. Jahrhundert sein? Sie hat dem kulturkritischen Wert von ästhetischer Abstraktionen einen weiteren Höhepunkt abgewonnen. Vielleicht lässt sich mehr denn je darüber sagen:
Neue Kunst ist so abstrakt, weil die Beziehungen der Menschen in Wahrheit es geworden sind. (Adorno: 1970, S. 54)
Doch stets, wenn ihr selbstvernichtende Grenzen drohen, geht sie verlebendigend zurück ,ad fontes‘, zu Musik, Gesang und Lied als ihrer diskursiven ,arche‘. In diesem Sinne darf eine Bewegung gedeutet werden, deren Anerkennung als neues Projekt der Lyrik noch aussteht: Rap-Poesie, die verbal betonte Seite des Hip-Hop (vgl. Beitrag Kimminich). Seit drei Jahrzehnten entwickelt sich neben und gegen skripturale, strukturale oder digitale Sprachkunst eine „Contre-littérature orale“. Sie negiert – ihrerseits gut modernistisch – deren intellektualistischen Antirationalismus. Ihr Motiv ist dabei aller Ehren der Responsionalität wert. Auch sie ist, allerdings auf höchst realistische Weise, Gegenspielerin der Realität: ihre Protagonisten sind Außenseiter der Gesellschaft, Underdogs, Minderheiten, verbannt in Vorstadtsubkulturen. (Kritische) Alterität ist ihnen auf den Leib geschrieben. Ihre ,natürlichste‘ Ausdrucksweise ist das Fremdsprechen, das am Medium die Gewalt inszeniert, die sie gesellschaftlich erfahren. Als „guerriers de mots“ praktizieren sie gewissermaßen unmittelbaren avantgardistischen Widerstandsgeist. Dass sie ihn dabei gegen die Sprache der ,Anderen‘ richten, ist bestes modernistisches Ethos, nur in diesem Fall nicht von innerhalb, sondern heteronom, von außerhalb der sprachlichen Normengemeinschaft geltend gemacht. Auch für sie gilt: Wirklichkeit ist sprach-instrumentell hergestellt – und kann auf die selbe Weise zersungen werden.
Dieses Rap-Chanson weist unverkennbar zurück auf das Vorbild der Résistance und der Nachkriegszeit. Andererseits ist es, trotz seines rauen, barbarischen Tones, ungleich mehr Lyrik als ,Engagement‘, damit auf seine Weise nahe an der konstruktiven Unzugehörigkeit, die eine fortgeschrittene Sprachkunst gegen gewöhnliche Zugehörigkeiten ausspielt. Gleichwohl: einem Rückzug unters Dach selbst einer unbehausten Identität weiß auch eine ,Rapattitude‘ entschieden auszuweichen, so sehr ihre Gesänge andererseits das ,sujet d’énonciation‘ im Sinne Bühlers wieder aufleben lassen. Ihr ,Ich‘ ist jedoch nur lediglich bewegter Beweger, dessen wahres Haus sein Lied ist (,,Ma maison, C’est ma chanson“). Selbst wenn am Horizont da und dort das Ideal eines ungezwungenen Sozialverkehrs aufscheint – die ,Lyrics‘ der Rapkultur deuten im Grunde auf die Freiheit, die moderne Kunst meint: dass sie uns auf die „Autoroutes de l’imagination, de la création“ führen. Irgendwo ankommen zu wollen, entspräche auch hier desolatem Passatismus. Geistige Beweglichkeit, angestoßen von ,mentalen Einbrechern‘, das sollte die modernistische Musik in den Ohren einer ausgereizten Schrift- und Zeichenkultur sein.
Beurteilt man es nach der periodischen Wendung von Lyrik zurück in ihre Ursprünge im Lied – zeichnet sich damit nicht auch in dieser Hinsicht die Schwelle zu einer dritten Moderne ab? Und da Lyrik in aller Regel die Rolle der Avantgardistin unter den literarischen Diskursen innehat: wäre es ein Indiz für einen kommenden ,oral turn‘ der Sprachkunst, der den Verlust an Identität in Bezug auf sich selbst performativ, in einer Hör- und Konzertgemeinschaft auffängt? Spräche dafür nicht auch der Siegeszug des walk-man, sogar des Hörbuches? Bestellen zumindest quantitativ Schlager, Song, Rock und Pop nicht längst unterhalb einer abstraktiven E-Lyrik das weite Feld einer U-Lyrik,46 die eine einfache, kreatürliche Ansprache pflegt? Die solidarisiert, wo der Ausdifferenzierungsprozess unaufhaltsam Differenzen produziert? Dann bliebe es erneut dabei: dass die schwache Sprache der Lyrik die Macht bedrängender Begriffe für die Zeit ihrer Rede zu schwächen vermag und einen Tonausfall, eine Bildstörung, einen Riss im Film der medialen Kolonialisierungen verursacht, die lebensweltlich am Werk sind.
Winfried Wehle, Vorwort
Winfried Wehle: Literaturverzeichnis
Inhalt
– Winfried Wehle: Einführung: Lyrik der Zweiten Moderne – Wandlungen einer dissidenten Sprachbewegung im 20. Jahrhundert
– Winfried Wehle: Lyrik, avantgardistisch (1909–1920)
– Hermann H. Wetzel: Surrealistische Lyrik: Breton, Soupault, Aragon, Char
– Thorsten Greiner: Die Beschwörung des Fremden – Lyrik der 30er und 40er Jahre (Supervielle, Saint-John Perse, Michaux, Char)
– Wolfgang Asholt: Das goldene Zeitalter des Chansons: Eine andere Geschichte der Lyrik?
– Reinhard Krüger: Konkretismus, Skripturalismus und die Medialität der Schrift als Felder poetischen Handelns in Frankreich nach 1945 (Michaux, Tardieu & Vian)
– Christof Weiand: Die französische Lyrik um 1960 – Bonnefoy, Butor, du Bouchet und Dupin
– Marc Föcking: Lyrik und Strukturalismus – poststrukturalistische Lyrik
– Uwe Schleypen: Oulipo – poesie sous contrainte
– Dietrich Scholler: Transfugale Verse. Lyrik im Zeitalter der Digitalmoderne
– Eva Kimminich: RapAttitüden – RapAttacken – RaPublikaner
– Zeittafel
Die Lyrik des 20. Jahrhunderts
hat sich unter zwei divergenten Perspektiven entfaltet: Die eine schreibt die poetischen und reflexiven Errungenschaften sowie die Subjektproblematik des 19. Jahrhunderts fort. Die andere hat ihren Gründungszusammenhang in der ästhetischen (und zivilisatorischen) Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie trug, begleitet von vergleichbaren Umbrüchen in Psychologie, Philosophie und Wissenschaftstheorie, auf ihre Weise maßgeblich zum Bewusstsein bei, dass eine zweite Moderne angebrochen ist. Ihr verändertes Welt- und Menschenbild hat, trotz eines beträchtlichen Unterstroms an traditionsverbürgten Auffassungen, das Gesicht des vergangenen Jahrhunderts geprägt. Die einzelnen Wandlungen der Lyrik, von den historischen Avantgarden bis zur Digital- und Rap-Poesie, blieben, bei aller Stimmenvielfalt, dem avantgardistischen Prinzip verpflichtet: sich anknüpfend und abstoßend eine sprachliche Unabhängigkeit zu erhalten – bis hin zur Unverständlichkeit –, die es ihr erlaubt, mit ihrer unverfügbaren Sprache als Dissidentin gegen die jeweils herrschenden und beherrschenden Nomenklaturen vorzugehen. Die vordergründige Ohnmacht ihrer elitären Rede sollte jedoch nicht täuschen: wie die zahlreichen Einzelinterpretationen zeigen, haben elitäre Leser ihre Lektion wohl verstanden und ihre subversive ästhetische Strategie übernommen, um philosophisches Denken als Sprachkritik auszuüben.
Stauffenburg Verlag, Klappentext, 2010


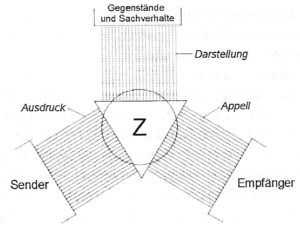












Schreibe einen Kommentar