POESIE IM PROZESS
– Internationale Lyrik seit den sechziger Jahren. –
Konspiration
Mitte der sechziger Jahre stieß ich in einem zweisprachigen Lyrikband auf ein Gedicht mit dem Titel „Conspiracy“ (Verschwörung). Die deutsche Fassung ging so:
Du schickst mir deine gedichte,
ich schick dir meine.
Manches wacht auf
selbst durch beiläufige mitteilung.
Wir wollen überraschend
den frühling ausrufen. Und spotten
über die andern,
all die andern.
Ich schicke auch ein bild von mir
wenn du mir eines schickst von dir.
Die Verschwörer konspirieren per Post, per Luftpost vermutlich. Der Dichter übrigens war der Amerikaner Robert Creeley, sein Übersetzer der Anglist Klaus Reichert. Dies zu einer Sache, die man – ebenfalls in den Sechzigern – etwas vollmundig „Weltsprache der modernen Poesie“ nannte.
Ist nun jemand so unseriös, einen Überblick über die internationale Lyrik zu versprechen, kann es sich nur um einen Liebhaber handeln, einen Dichter oder um einen Anthologisten. Ich bin etwas von all dem. Ich spreche nicht zuletzt aus der Erfahrung mit dem Machen einer Anthologie – einer Anthologie mit dem luftigen Titel Luftfracht. Sie transportiert, ihrem Untertitel zufolge, internationale Poesie der Jahre 1940 bis 1990, lyrische Texte aus sechs Jahrzehnten also; ich darf das ein oder andere Beispiel dieser Anthologie entnehmen.
Ich spreche über Poesie in einem Moment, da die Zeiten für Lyrik wieder einmal schlecht sind. Wer liest heute Gedichte? Nicht bloß scherzhaft hat ein kluger Kopf, Hans Magnus Enzensberger nämlich, behauptet, die Zahl der Leser, die einen neuen, einigermaßen anspruchsvollen Gedichtband in die Hand nehme, lasse sich empirisch ziemlich genau bestimmen:
Sie liegt bei +– 1354. Diese Zahl (die Enzensbergersche Konstante) ist nicht nur unabhängig von Moden, Publizität, ,Zeitgeist‘: sie gilt auch – und hier wird die Sache mysteriös – universell, für jede Sprachgemeinschaft, ganz unabhängig davon, ob sie einen ganzen Kontinent bevölkert oder nur einen kleinen Fleck auf dem Globus. Ein guter Dichter kann in Island (250.000 Einwohner) mit ebenso vielen Lesern rechnen wie in den Vereinigten Staaten (250 Millionen).
Eine einzige Ausnahme ließ Enzensberger gelten: die Russen. Aber das war vor der großen Umwälzung. Heute gilt die Enzensbergersche Konstante offenbar auch dort.
Mir geht es nicht um ein Lamento. Im Gegenteil. Die marginalisierte Poesie – oft verspottet, oft totgesagt – ist zäh und buchstäblich nicht totzukriegen. Je kleiner ihre Bedeutung, um so größer ihr Anspruch. Es muß also paradoxerweise der allergrößte sein.
Lyrik ist die Essenz der Kultur der Welt.
Diese riskante Behauptung stammt von Iossif Brodskij oder Joseph Brodsky, wie er sich seit seiner Emigration nannte. Er, der russische Jude, Sowjetdissident und spätere Nobelpreisträger, konnte als Beweis dafür gelten, daß es eine Internationale der Poesie gibt. Brodsky sagte diesen Satz in Sachen eines Kollegen: des englisch schreibenden karibischen Lyrikers Derek Walcott. Und er sagte ihn im Kontext einer Weltsituation, die seiner These einen historischen Hintergrund gibt. Ich zitiere:
Da Zivilisationen endlich sind, gibt es im Leben einer jeden einen Augenblick, da ihre Zentren keinen Zusammenhalt mehr geben. In solcher Zeit bewahrt keine Legion, sondern die lingua sie vor dem Zerfall. Das war schon in Rom so und vorher, im hellenischen Griechenland. Die Aufgabe des Zusammenhaltens wird in solchen Zeiten von Menschen aus der Provinz übernommen, aus den Randgebieten. Im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Auffassung endet die Welt in den Randgebieten nicht – vielmehr franst sie genau dort aus.
Nun will ich die Kühnheit dieser Sätze nicht zu der These zuspitzen, die Poesie könne die Aufgaben der UNO übernehmen oder gar deren Versagen kompensieren. Ich will auf etwas relativ Schlichtes hinaus: auf das utopische Potential der Poesie, das sie gegen alle Widerstände von Vernunft und Realitätsprinzip bewahrt. Ich riskiere also im folgenden einige Überlegungen zum Prozeß der Poesie seit den sechziger Jahren.
1960 erschien die wichtigste und folgenreichste Lyrikanthologie der deutschen Nachkriegsära: Enzensbergers Museum der modernen Poesie. Sie nutzte eine einmalige Chance und versammelte die bedeutendsten Lyriker der Moderne. Diese Sammlung hat vielen jungen Poeten vor Augen geführt, was seit der großen Literaturrevolution um 1910 geleistet worden war, und sie inspiriert, ihre eigene Arbeit zu tun. In der DDR z.B. wurde die Anthologie als lyrische Konterbande von Hand zu Hand weitergereicht. Sie vermittelte den jungen Lyrikern jene Techniken und Freiheiten, mit denen die Dogmen des Sozialistischen Realismus überwunden wurden. Auch für die im Provinzialismus befangene westdeutsche Lyrik von damals ist die befreiende Wirkung kaum zu überschätzen. Enzensbergers Leistung ist unwiederholbar und – historisch. Seine Sammlung ist das „Museum“ geworden, das es nicht sein wollte. Doch ihr Herausgeber wußte auch, daß man die Zeit nicht anhalten kann. Er schrieb:
Poesie ist ein Prozeß. Kein Museum, auch kein imaginäres, kann ihn sistieren. Wer’s versucht, verdinglicht die poetische Produktion zum Fetisch. Er sieht das Werk als zeitlos transportablen Kunstschatz, in dem sich das vermeintlich Unvergängliche als mündelsicherer Wert verkörpert.
Dieser Prozeß der modernen Poesie ist in den vergangenen drei Jahrzehnten weitergegangen; die Impulse sind nicht erlahmt, sondern haben sich erweitert und verstreut: neue Autoren und Literaturen sind in den poetischen Diskurs eingetreten; und es fragt sich, wie er zu resümieren und bilanzieren wäre.
Ich nenne zunächst drei Begriffe – durchaus nicht als positive, sondern eher, um mich von ihnen zu verabschieden: Avantgarde, Kristallisation, Bricolage.
Avantgarde
Durch die Jahrzehnte seit 1940 – und vor allem seit den fünfziger Jahren – geisterte das Phantom der Avantgarde: die Vorstellung, in der Kunst gebe es (wie im materiellen Bereich) den Fortschritt, und sei es den Fortschritt der Materialbeherrschung. Daß schon Baudelaire die militärische Metapher von der künstlerischen Vorhut mit jenen Geistern zusammengebracht hatte, „die der Disziplin, das heißt der Anpassung zuneigen“, wurde verdrängt: Die selbsternannte Avantgarde hielt sich für progressiv und autonom.
Theodor W. Adorno sprach seinerzeit vom „Altern der modernen Musik“ und meinte, die „Errungenschaften des Materials“ kämen kaum der Qualität der Werke zugute, die sie verwerteten. Seine Diagnose, die das Scheitern der musikalischen Avantgarde formulierte, ließ sich sehr wohl auf ihren literarischen Flügel übertragen. Auch sie zeigte Ermüdungs- und Verfallssymptome, die durch dogmatische Theorien verdeckt werden sollten: die Experimente der Gründergeneration wurden als Rezepte kanonisiert, nach denen sich die „avancierten“ Produkte herstellen ließen. So etwa auf dem Sektor der experimentellen und konkreten Poesie, wo viele Produkte nur im Gefüge einer vorgegebenen Theorie funktionieren. Der verbindlichen Theorie entsprechen lauter unverbindliche Objekte. Mit der Erledigung des alternden Fortschritts durch den jeweils neuesten wurden seine Hervorbringungen zum jeweils alten Eisen geworfen.
Wer sich seinerzeit durch den Anspruch auf Avanciertheit und Zeitadäquatheit nicht verblüffen ließ, wurde kurzerhand als Reaktionär abgetan. Er konnte sich nur durch besondere Schärfe verwahren. Das erklärt die Rigorosität von Enzensbergers Satz (aus dem Essay „Aporien der Avantgarde“):
Jede heutige Avantgarde ist Wiederholung, Betrug oder Selbstbetrug.
Kristallisation im Posthistoire
Wie aber? Soll denn Stillstand sein in Kunst und Poesie? Auch der Stillstand hat seine Apologeten. Oder sagen wir vornehmer, mit Arnold Gehlen, die „Kristallisation“. Gehlen hat bereits Anfang der sechziger Jahre dekretiert:
Von jetzt an gibt es keine kunstimmanente Entwicklung mehr! Mit einer irgendwie sinnlogischen Kunstgeschichte ist es vorbei, selbst mit der Konsequenz der Absurditäten vorbei, die Entwicklung ist abgewickelt, und was nun kommt, ist bereits vorhanden: der Synkretismus des Durcheinanders aller Stile und Möglichkeiten, das Posthistoire.
In gewisser Weise wird bei Gehlen das eine Phantom durch ein anderes ersetzt, der Fetisch „Avantgarde“ verdrängt durch das philosophische Gespenst „sinnlogische Kunstgeschichte“, als deren Priester und Verwalter die Ästhetiker oder Historiker fungieren. Werden die Künstler und Dichter nicht zu deren Subjekten, eingezwängt zwischen Scylla und Charybdis, nämlich zwischen einer diskreditierten Avantgarde und den Relikten einer ehemals „sinnlogischen Kunstgeschichte“?
Bricolage
In dieser Situation mochte es verführerisch sein, im Bastler die aktuelle Inkarnation des Künstlers zu sehen und die bricolage als Ultima ratio der ästhetischen Programme zu sehen. Vom Bastler sagt Levi-Strauss, daß die Regel seines Spiels darin bestehe, „jederzeit mit dem, was ihm zur Hand ist, auszukommen, d.h. mit einer stets begrenzten Auswahl an Werkzeugen und Materialien, die überdies noch heterogen sind, weil ihre Zusammensetzung in keinem Zusammenhang zu dem augenblicklichen Projekt steht, wie überhaupt zu keinem besonderen Projekt, sondern das zufällige Ergebnis aller sich bietenden Gelegenheiten ist, den Vorrat zu erneuern oder zu bereichern oder ihn mit den Überbleibseln von früheren Konstruktionen oder Destruktionen zu versorgen“.
Das liest sich wie eine Beschreibung von Produkten, wie sie gegenwärtig massenhaft als postmodernes Design begegnen; übrigens auch in der Lyrik. Wir kennen die entsprechenden Formeln: das „Anything goes“ oder Andy Warhols famosen Satz „All is pretty“. In dieser Situation kann ein Rekurs auf die Impulse der Moderne von Nutzen sein.
Die Entwicklung der Lyrik verlief nicht nach vorgegebenen Mustern. Sie war nicht monokausal bestimmt, sondern hielt sich, um zu überleben, ihre Optionen offen. Hugo Friedrich hatte seinerzeit in seiner vielgelesenen Struktur der modernen Lyrik (1956) die Entwicklung auf eine einzige Linie beschränken wollen: auf die Tendenz zur „reinen“, „absoluten“ und hermetischen Lyrik. Die logische Konsequenz des Gedichts wäre das Verstummen gewesen; und über dies mögliche Verstummen wurde auch genug geredet. Dagegen hat Michael Hamburger, der Dichter, Kritiker und Übersetzer von Lyrik, in seinem bei uns zuwenig beachteten Buch The Truth of Poetry (1969) auch die moderne Lyrik an die Probleme von Wahrheit und Wirklichkeit gebunden. Er hat darauf verwiesen, daß schon Baudelaire nicht bloß Ästhet, sondern auch Moralist war und daß in den späteren Entwicklungsschüben der modernen Poesie ein beständiges Wechselspiel von Artistik und Moralistik zu beobachten ist. Wie sonst wäre die Lyrik Audens und Brechts zur modernen Lyrik zu zählen? Wie wären die Resistance-Gedichte der französischen Surrealisten und Symbolisten zu erklären? Wie Celans „Todesfuge“? Und wie die Neigung mancher Dichter zu einer neuen „Enthaltsamkeit“, zu einer Poesie als Anti-Poesie?
Anti-Poesie
Hamburger hat die neue Anti-Poesie als ein Produkt des Zweiten Weltkriegs bezeichnet, als erwachsen aus dem „akuten Mißtrauen gegen all die Mittel, mit Hilfe derer sich die Lyrik ihre Autonomie bewahrt hatte“. Ein Argument dafür, daß sich ohne den Bezug auf Krieg und Faschismus die Lyrik seit den dreißiger Jahren gar nicht begreifen läßt.
Man muß dabei nicht einmal auf Audens Spanien-Engagement und Brechts antifaschistische Emigrationslyrik beziehen; auch Lyriker, deren politische Haltung nicht so dezidiert scheint, wenden sich vom Kunstglauben ab und beginnen, der artistischen und hermetischen Poesie zu mißtrauen. Marianne Moore hatte schon 1936 in ihrem Gedicht „Poetry“ geschrieben „I, too, dislike it“ – die Poesie nämlich, die gängige poetische Poesie – und auf die Dichter als „Prosaiker der Phantasie“ gesetzt. Der Chilene Nicanor Parra nannte seine zwischen 1938 und 1953 geschriebenen Verse Poemas y antipoemas. Tadeusz Różewicz, Teilnehmer an der polnischen Widerstandsbewegung, bekannte sich gar zum „Haß gegen die Poesie“ und erklärte, er betrachte seine eigenen Gedichte mit schärfstem Mißtrauen:
Ich habe sie aus dem Rest der übriggebliebenen, geretteten Worte gefügt, aus uninteressanten Worten, aus Worten vom großen Müllhaufen, vom großen Friedhof.
Das macht vielleicht deutlich, daß die Anti-Poesie, die Lyrik einer neuen Enthaltsamkeit, ein internationales Phänomen ist; eine produktive Antwort auch auf Adornos bekanntes Verdikt, nach Auschwitz Gedichte schreiben zu wollen sei barbarisch. Denn nicht bloß Celans Œuvre widerlegt Adornos (von ihm selbst übrigens später relativierten) Satz. Auch andere Dichter haben gezeigt, daß man nicht bloß nach, sondern auch über Auschwitz Gedichte schreiben kann. So der eben erwähnte Różewicz in seinem „Museum – Auschwitz 1948“ datierten Gedicht „Kleiner Zopf“
Als alle Frauen
des Transports rasiert waren
fegten vier Arbeiter
mit Besen aus Lindenreisig
das Haar zu einem Haufen
Unter den sauberen Scheiben
liegt das spröde Haar
der Vergasten
Nadeln und Hornkämme
stecken in diesem Haar
Kein Licht durchleuchtet es
kein Wind zerzaust es
keine Hand kein Regen
kein Mund berührt es
In großen Kisten
ballt sich trockenes Haar
der Vergasten
auch ein kleiner grauer Zopf
Rattenschwänzchen mit Schleife
an dem in der Schule
die bösen Buben zupften
Ü: Karl Dedecius
„Die Lyrik“, hat Różewicz gesagt, „muß, um wiederauferstehen zu können, sterben.“ Das könnte auch für Paul Celan gelten. Zwar hat er seine „Todesfuge“ in späteren Jahren nicht mehr öffentlich vorgelesen; vermutlich weil er sie nicht zum Alibi der Verdrängung durch eine schwärmerisch-ästhetisierende Rezeption machen wollte. Doch hat er sie nie widerrufen; und sein nachfolgendes Werk ist die rigorose Engführung eines Themas, das ihn in Leben und Tod bestimmte.
Es wurden vor allem die Dichter Osteuropas „in Menschheitsgeschichte geprüft“; und für die polnische Lyrikerin Wisława Szymborska findet diese „Reifeprüfung“ vor den „Zwei Affen von Breughel“ statt: Der eine hört ironisch zu, der andere, der sich schlafend stellt, sagt der Kandidatin vor „mit leisem Klirren der Kette“. Wir müssen nicht mehr fragen, was. Die Parabel ist ebenso deutlich wie unausschöpfbar. Sie erhält ihre Tiefe durch den schmalen Ausblick, der der Geprüften gestattet scheint:
hinter dem Fenster segelt der Himmel
und badet das Meer
Es ist ein Traum von Freiheit; es ist „Der Traum des Gefangenen“, wie ihn der Italiener Eugenio Montale beschreibt:
welch langes Warten,
und auch mein Traum von dir ist nicht zu Ende
Im übrigen wird seit den fünfziger Jahren deutlich, daß die abendländisch-eurozentrische Perspektive immer weniger geeignet ist, das Ganze zur Darstellung zu bringen. Auch in der Poesie wird das unübersehbar. Neue Idiome treten in ihre Weltsprache ein. Japan und die USA seien als Beispiele genannt. So ist auch begreiflich, daß die Lyrik auf Dauer nicht bei der auf europäischen Erfahrungen beruhenden moralistisch-asketischen Haltung der Ami-Poesie verharren konnte. Poesie kann Nüchternheit nicht in Permanenz erklären, ohne zu verdorren und abzusterben. Sie ist immer auch Glücksversprechen, das zwischen dem „Prinzip Hoffnung“ und dem „paradis artificiel“ changiert. Sie sucht nach neuen Erregungen, neuen Euphorien; und sei es in dem großen Supermarkt, wie ihn die USA damals schon repräsentieren.
Poetry Renaissance
Dort, innerhalb der amerikanischen Massenzivilisation, gelang den Dichtern zumindest vorübergehend der Ausbruch aus der traditionellen Isolation, der Umschlag aus der Vereinzelung in eine enorme Resonanz. Sie befreiten die Lyrik vom Diktat des Akademischen. Man wollte nicht mehr englisch schreiben, sondern amerikanisch. Das hieß den durch Whitman eingeschlagenen Weg fortsetzen. Von Ezra Pound (aber auch vom Jazz) kam das Postulat, nicht nach dem Metronom, sondern nach dem Ohr zu komponieren. Von W.C. Williams die Reduktion aufs Lokale, Konkrete, Alltägliche, auf die gesprochene Idiomatik.
In kleinen Freundeszirkeln bereitete sich vor, was man dann Beatgeneration und später Pop-art nennen sollte. Die poetologischen Diskussionen wurden in Briefen und kleinen Magazinen geführt. Aus Briefen war Charles Olsons Essay über den projektiven Vers zusammengesetzt, der 1950 in der Zeitschrift Poetry erschien. Er wurde für eine ganze Generation richtungweisend. Dort heißt es:
Das Gedicht ist eine Energiemenge, die von dort, wo der Dichter sie herhat (er wird eine Reihe verschiedener ,Quellen‘ haben), mittels des Gedichtes selbst, den ganzen Weg hinüber zum Leser übertragen wird, Okay. Dann muß das Gedicht selbst, an jeder Stelle, ein hochwertiger Energieträger, und, an jeder Stelle, ein Energieentlader sein.
Diesen Maximen schien nicht Olson allein zu folgen. Der Durchbruch in die große Öffentlichkeit geschah in San Francisco. Von hier ging die „Poetry Renaissance“ aus. Sie begann mit Lesungen von Michael McClure, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, vor allem aber mit Allen Ginsbergs Vortrag von The Howl (Das Geheul). Der zentrale Vers lautet:
Ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört.
Die Buchausgabe von The Howl erschien 1956 und machte ungeheuer Furore; sie wurde bis 1960 über fünfzigtausendmal verkauft und in 25 Sprachen übersetzt.
Die Massenlesungen von Lyrik lösten die Dichtung vom Papier. In der Kommunion mit dem Publikum schien der Dichter seine Stimme wiedergewonnen zu haben. „Whitman Ginsberg guru“, heißt es bei Ferlinghetti. Freilich sank bei manchen Lyrik-Gurus die poetische Qualität denn doch besorgniserregend. Poesie, als Massenphänomen, hat ihren Preis. Das zeigt sich auch in Japan.
Beispiel Japan
In der Lyrik Japans kam es nicht auf die Rückgewinnung, sondern auf die Loslösung von der eigenen Tradition an. Der Eintritt Japans in den Prozeß der modernen Poesie geschah unter dem Schock der Niederlage und der totalen Kapitulation. Dieser Schock klingt noch bis in die achtziger Jahre nach; so in Tanikawa Shuntarōs Gedicht „15. August“. Der 15. August 1945 ist der Tag, an dem der japanische Kaiser Hirohito in einer berühmten, nur schwer verständlichen Radioansprache die Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg bekanntgab. Hier das Gedicht:
Eine Ente watschelte vorüber
sagte der Mann
Quer über den ausgetrockneten weißen Sandweg
watschelte eine Ente das ist alles
was mir im Gedächtnis haftet
Ich erinnere mich an die Stimme
sagte ein anderer Mann
eine seltsame Stimme ohne Herz und Seele
aber das lag wohl am Japanischen
ich selbst verfalle auch manchmal in diesen Ton
Ich schlief damals sagte die Frau
in Schweiß gebadet mit meinem Geliebten
das Kind von damals ist jetzt Frauenarzt in Oregon
hat auch das Bürgerrecht von drüben
Ü: Eduard Klopfenstein
Der Schock der japanischen Niederlage setzte Kräfte frei und bewirkte die endgültige Modernisierung des Landes. Er bewirkte auch die Modernisierung der Lyrik. Neben die traditionelle Tanka- und Haiku-Poesie trat Gendaishi, die moderne Lyrik. Nach 1945 haben die Gruppen ,Arechi‘ und ,Rettō‘ die verstreuten modernistischen Tendenzen der zwanziger Jahre weitergeführt und zu breiter Resonanz gebracht. Für die Arechi-Gruppe waren Auden und vor allem Eliot vorbildhaft. Eliot wurde gleichsam zum Paten der Gruppe, denn „Arechi“ heißt „Das wüste Land“, meint also Eliots Jahrhundertgedicht. In einem Manifest von 1951 heißt es:
Keinen Frieden kennen, Fragen stellen, die Ohren als Instrument der Aufmerksamkeit spitzen, das intellektuelle Forschen geduldig fortführen, um so die Erkenntnis des eigenen Lebens zu vertiefen – nur durch solche echten geistigen Anstrengungen können wir der Wüste unserer Gegenwart entgegentreten.
Die linksgerichtete Gruppe ,Rettō‘ (Inselkette) entstammt der sogenannten Zirkelpoesie, einer kulturellen Bewegung von Arbeitern, Bauern und Angestellten. In der Zeitschrift Rettō heißt es 1952:
Wir sind in einer Zeit, da Dichtung ganz Japan zu überziehen beginnt. Wohin man heute auch in Japan kommt, es gibt keinen Ort, wo nicht Poesie-Zeitschriften, Gedichthefte und -sammlungen oder lose Gedichtblätter die Runde machen. (…) Jetzt, da den Japanern die Krise ihres Landes deutlich geworden ist, da sie dafür kämpfen, alle Schwierigkeiten, Zwänge und Nöte zu überwinden und die Unabhängigkeit Japans herzustellen, jetzt ist ihnen zum Bewußtsein gekommen, daß dazu gerade auch die Dichtung notwendig ist.
Pop-Lyrik
Auch die westliche Pop-art verdankt sich einem Kulturschock, dem Versuch, einer übermächtigen Warenwelt durch Affirmation und Imitation Paroli zu bieten. Der aggressiv synkopierte Sound der Beat-Generation ging über in die raffiniert simplizistischen Techniken der Underground- und Pop-Lyrik. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Northope Frye mit seiner Anatomy of Criticism (1957) hatte den Begriff des „low mimetic“ zur Hand, das heißt einer Darstellung und Wiedergabe des Alltäglichen, Niederen, Häßlichen in einer direkten, konkreten und nüchternen Weise.
Wieder einmal konnte William Carlos Williams als Pionier gelten und wurde so zum Ziehvater auch der nächsten und übernächsten Generation amerikanischer (und nicht bloß amerikanischer) Lyriker: zunächst der New York School (Ashbery, Koch, O’Hara u.a.), dann eines ganzen Schwarms von Pop-Lyrikern, wie sie durch Rolf Dieter Brinkmanns Anthologien Acid (1969) und Silverscreen (1969) auch bei uns bekannt wurden.
Einer dieser Pop-Lyriker, Harold Norse, bekannte:
Pop-art fängt an mit W.C. Williams’ „Nur damit du Bescheid weißt: Ich habe die Pflaumen / gegessen / die im Eisschrank / waren“.
Als aktuelles Vorbild wird immer wieder Frank O’Hara mit seinen Ich-tue-dies-ich-tue-das-Gedichten genannt. Der Kurator am New Yorker Museum of Modern Art war zum Vermittler von literarischer und bildnerischer Pop-art prädestiniert. Seine Lunch-Poems erschienen, in Brinkmanns Übersetzung, auch bei uns.
Man wird O’Hara und seine Nachfolger nicht überschätzen: aber neben Pop-art und Pop-Musik gab es eine Welle von Pop-Lyrik, die auch nach Europa und Japan überschwappte. Umgekehrt strömten, im Gefolge von Vietnamprotest und Flower-Power-Bewegung, auch ostasiatische Meditationstechniken und Lyrikformen in die anglo-amerikanische Szene. Gary Snyder und andere begannen, Haikus und Tankas zu schreiben und versuchten, ostasiatische Gedanken und Meditationstechniken zu rezipieren. Als Synthese kam etwa heraus, was Gary Snyder Hitch Haiku nannte; z.B. dies:
Trinken heißt saké
aaaaaaarösten fisch auf holzkohle
aaadas motorrad
draußen im regen geparkt.
Ü: Alexander Schmitz
Bildersturm
Während sich in Nordamerika Pop-Lyrik und Vietnamprotest durchaus miteinander vertrugen, ja einander inspirierten, kam es in Westeuropa zum Bildersturm auf die Poesie. Hier wurde nach allen (folgenlosen) Kunstrevolutionen die politische Revolution erwartet. Die Literatur wurde totgesagt; sie flüchtete sich in die Politik. Der Begriff der Revolution wurde zur Metapher: eben durch den Versuch, eine Metapher in Praxis zu überführen. Der Pariser Mai, der die „Phantasie an die Macht“ bringen wollte, geriet zum politischen Happening. Herbert Marcuse blieb es vorbehalten, das ästhetische Arrangement für einen Akt des Weltgeists auszugeben. Er schwärmte 1969 in seinem „Versuch über die Befreiung“:
Das Piano mit dem Jazz-Spieler stand trefflich zwischen den Barrikaden; schicklich zierte die rote Fahne die Statue des Autors von Les misérables; und streikende Studenten forderten in Toulouse die Neubelebung der Sprache der Albigenser. Die neue Sensibilität ist zur politischen Kraft geworden.
Aber auch das war nur Literatur, waren die Ausstattungsstücke eines Revolutionstheaters, Freiluftdramatik.
Unter bundesrepublikanischen Auspizien schien es eine Weile, als sei die Poesie selber anachronistisch geworden. Das Gedicht, sofern es nicht überhaupt als bürgerlich oder elitär abgetan wurde, erhielt Bewährungsfrist. Es hatte den Nachweis seiner politischen Nützlichkeit zu führen und mußte dabei natürlich versagen. Die Flucht ins Agitationsgedicht und sogenannte „Kampftexte“ war die Flucht in eine Sackgasse. In einer der damaligen Anthologien hieß es denn auch selbstkritisch:
Agitprop wird zum Praxisersatz des kleinbürgerlichen Literaten mit marxistischer Gesinnung.
Die vom Ausbleiben der Revolution Enttäuschten hätten die Lyrik am liebsten abgeschafft. Wer damals öffentlich Gedichte vorlas, wurde nach seiner „Zielgruppe“ gefragt. Er konnte nur antworten:
Ich ziele nicht auf Menschen.
Außerhalb des Spiels
In Lateinamerika und Osteuropa hingegen bewies und erneuerte die Poesie ihre Lebenskraft. Sie tat es unter den schwierigsten Umständen. Der Russe Andrej Wosnessenskij schrieb:
Ich denke, die Menschen fühlen sich heute zur Poesie hingezogen, so wie man bei Skorbut zu Vitaminen sich hingezogen fühlt.
Das erklärt die Resonanz, die hohen Auflagen von Gedichtbänden in den östlichen Ländern. Das erklärt auch die Repressionswut des totalitären Staats.
Zwei Exempel. Heberto Padilla, dessen Manuskript Außerhalb des Spiels 1968 den Lyrikpreis des Verbandes der kubanischen Schriftsteller und Künstler erhalten hatte, wurde monatelang als „Provokateur“, „Faschist“ und „CIA-Agent“ gejagt – sein Buch erschien erst gar nicht im Buchhandel. Der Dichter, von Castros Staatssicherheitsdienst vernommen, wurde zur „Selbstkritik“ gezwungen, zur Selbstbezichtigung, seine Gedichte bewirkten den defaitistischen Geist der Konterrevolution.
Ein anderes Beispiel. Der junge, von Anna Achmatowa geförderte Dichter Iossif Brodskij wurde 1963 beschuldigt, ein „Parasit“ zu sein und keine gesellschaftlich nützliche Arbeit zu verrichten. Eine Leningrader Zeitung hatte ihn als „Quasiliteraten-Drohne“ bezeichnet und behauptet, er habe versucht, ein Flugzeug zu entführen, um ins Ausland zu gelangen. Obwohl Brodskij nachweisen konnte, daß er seinen Lebensunterhalt durch Übersetzungen verdiente, wurde er zu fünf Jahren Verbannung verurteilt. Anderthalb Jahre leistete der Dichter Zwangsarbeit im äußersten Norden, bei Archangelsk, ehe er nach Leningrad zurückkehren durfte. Er konnte einige Übersetzungen aus dem Englischen und ganze vier Gedichte veröffentlichen. 1972 legten ihm die sowjetischen Behörden die Ausreise nahe. „Ich habe gearbeitet, ich schrieb Gedichte“, dieser Satz kehrt in den Vernehmungsprotokollen des späteren Nobelpreisträgers mehrfach wieder.
Spätestens hier enden die Träume von Revolution und sozialistischer Utopie: in der Verfolgung der Dichter. Wo Revisionismus als Verbrechen galt, wurden Revisionen nötig. Sie waren die Antworten auf eine längst pervertierte Vision.
Revisionen
Es war schon viel, wenn der westeuropäische Intellektuelle und Poet den einzigen Fortschritt sah, der blieb: den Fortschritt seiner Ratlosigkeit. So setzt der Amerikaner John Ashbery einen überaus lapidaren Titel „Das Eine, was Amerika retten kann“. Doch das nachfolgende Gedicht verweigert die Antwort, es ignoriert geradezu die Frage. Es hält sich an die Schärfe einzelner Wahrnehmungen, ja ans Private:
Ich weiß, ich flechte zuviel an meinen eigenen
Abgerupften Wahrnehmungen der Dinge, so wie sie auf mich zukommen.
Und die entscheidende Maxime – wenn man diesen schweren Begriff überhaupt verwenden will – lautet:
Alles andere ist Warten,
Auf einen Brief, der nie eintrifft.
Wer dazu neigte oder bereit war, politische Reflexionen in seine Lyrik einzubeziehen, sah sich auf eine phantastische Metaphorik verwiesen. Er sah sich etwa, wie in Lars Gustafssons „Gedicht vom Revisionismus“ als Fliege in einem Zug. Die am Ende des Zugs angekommene, klüger gewordene Fliege entdeckt, daß das Fliegen „hervorragend geht“ – freilich in einem Zug, der immer schneller in die Nacht hineinfährt:
Unsichere Fliege
in einem Nachtschnellzug eingeschlossen
versucht trotzdem zu fliegen
und entdeckt, daß es ja hervorragend geht.
Vom südlichen Ende des Zuges zum nördlichen gekommen,
eine schon viel klügere Fliege.
Und der Zug immer schneller in die Nacht hinein.
Ü: Verena Reichel
In Osteuropa konnten solch subtile Relativierungen nicht genügen; hier konnte Hoffnung nur aus einer tieferen Depression kommen. „Wirklich leben können wir nur in der Niederlage“, heißt es bei dem Polen Adam Zagajewski. Und die schon erwähnte Wisława Szymborska hat für die Situation unter den diktatorischen Systemen des Ostblocks der alten Theatermetapher einen neuen Sinn, eine tiefere Bedeutung gegeben. In ihrem Gedicht „Eindrücke aus dem Theater“ schildert sie den sechsten Aufzug einer Tragödie:
Für mich ist der wichtigste in einer Tragödie der sechste Aufzug:
die Auferstehung vom Schlachtfeld der Bühne,
das Zupfen an den Perücken, Gewändern,
das Ziehen des Dolchs aus der Brust,
das Lösen der Schlinge vom Hals,
das Einreihen zwischen die Lebenden
mit dem Gesicht zum Parkett.
Verbeugungen, einzeln, gemeinsam:
die weiße Hand auf der Wunde des Herzens,
die Knickse der Selbstmörderin,
das Nicken geköpfter Häupter.
Verbeugungen paarweise:
der Zorn Arm in Arm mit der Sanftmut,
das Opfer blickt selig dem Henker ins Auge,
Rebell und Tyrann schreiten friedlich nebeneinander.
Zertreten der Ewigkeit mit der Spitze des goldenen Pantoffels.
Fortfegen der Moral mit der Krempe des Hutes.
Die unverbesserliche Bereitschaft, morgen alles zu wiederholen.
Der Einzug im Gänsemarsch der früher Verstorbnen,
im zweiten, im vierten Akt, auch zwischen den Akten.
Die wunderbare Rückkehr der spurlos Verschollnen.
Zu denken, daß die geduldig hinter Kulissen warteten,
immer noch kostümiert,
ohne sich abzuschminken,
rührt mich stärker als alle Tiraden des Dramas.
Wahrhaft erhaben ist erst das Fallen des Vorhangs
und was man dann durch den unteren Spalt zu sehen bekommt:
da hebt eine Hand die Blume eilig vom Boden,
dort eine andre das liegengelassene Schwert.
Erst dann erfüllt eine unsichtbare dritte
ihre Verpflichtung: sie schnürt mir die Kehle.
Ü: Karl Dedecius
Ist dieses 1971 publizierte Gedicht angesichts der Ereignisse im Osten nicht von anhaltender, ja gesteigerter Aktualität? Anders als im Gedicht wurden freilich die Dolche nicht aus der Brust gezogen, die Schlingen nicht vom Hals gelöst, blickte post festum das Opfer nicht selig dem Henker ins Auge. Das Gedicht gibt ein Gegenbild, tröstlich, obwohl es auf allen Trost verzichtet.
Furie des Verschwindens
Die siebziger, achtziger Jahre wurden also zu einer neuen Epoche der Ernüchterung. In ihr begann der Glaube an den Weltgeist, an den Fortschritt oder zumindest den Sinn der Geschichte sich allmählich aus den Verlautbarungen der Zeitgeistberichterstatter zurückzuziehen. Die Dichter im Osten sagten es schon früher – unter Bedingungen, die Klartext nur zwischendurch zuließen: „Man lebt mit dem Wissen um die Dinge“, so der Rumäne Marin Sorescu. Und der Pole Adam Zagajewski läßt Kierkegaard sich über Hegel mokieren. Statt der versprochenen herrlichen Staaten begnügt man sich mit der Gefängniszelle, „mit dem Lied des Häftlings“. Aber hat es diesen Hegel überhaupt gegeben? Lesen wir (in Pastiors Übertragung) Marin Sorescus Gedicht „Auf der Suche nach einem Bild von Hegel“:
Ich habe noch nie
ein Bild von Hegel gesehen;
immer war er in meinen Büchern
gerade nicht abgebildet.
Doch wie ich höre,
soll nicht weit von hier
in einem Antiquariat
eine Photographie von ihm existieren,
auf der er, im Begriffe
sich über alle philosophischen Systeme
hinwegzusetzen,
wie eine Seidenraupe aussieht,
die an Maulbeerblättern nagt.
Das muß sehr ungewöhnlich und schön sein,
elektrisierend
fast menschlich.
Einmal wenn ich Zeit habe,
werde ich dort vorbeigehn,
werde höflich alle Zitate ersuchen,
mich mit Hegel alleinzulassen –
und ihn mir wortlos
ein paar Minuten
dann ansehn.
Aber erkennbar wird die von Hegel beschworene „Furie des Verschwindens“, ein „rächender Geist, der schon bei den ältesten Dichtern vorkommt“. Enzensbergers Band Die Furie des Verschwindens (1980) verabschiedet vielleicht am rigorosesten – gegen Hegel oder in Hegels Namen? – eine Philosophie der Hoffnung auf Veränderung. Das Titelgedicht „Die Furie“ lautet:
Sie sieht zu, wie es mehr wird,
verschwenderisch mehr,
einfach alles, wie auch;
wie es wächst, über den Kopf,
die Arbeit auch; wie der Mehrwert
mehr wird, der Hunger auch;
sieht einfach zu, mit ihrem Gesicht,
das nichts sieht; nichtssagend,
kein Sterbenswort;
denkt sich ihr Teil;
Hoffnung, denkt sie,
unendlich viel Hoffnung,
nur nicht für euch;
ihr, die nicht auf uns hört,
gehört alles; und sie erscheint
nicht fürchterlich; sie erscheint nicht;
ausdruckslos; sie ist gekommen;
ist immer schon da; vor uns
denkt sie; bleibt;
ohne die Hand auszustrecken
nach dem oder jenem,
fällt ihr, was zunächst unmerklich,
dann schnell, rasend schnell fällt, zu;
sie allein bleibt, ruhig,
die Furie des Verschwindens.
Poesie der Ränder
Ich nähere mich dem Ende meiner tour d’horizon, die eine tour de force sein mußte, weil sie so viele Namen, so viele Individualitäten aussparen mußte. Ist Lyrik, wie Brodskys hochgemute These meint, die „Essenz der Kultur der Welt“? Wäre sie es: es ließe sich nicht deduzieren, nur erfahren. Aber für eine andere Vermutung ließe sich noch etwas anführen, nämlich für Brodskys Ansicht, die Welt werde poetisch nicht mehr von den Zentren, sondern von den Rändern her zusammengehalten.
„Die Welt franst aus“ – das meint ja auch, daß die Zentren sich ausdünnen, die Konzentrationen wechseln können. Daß aus alten Kulturen neue Elemente hinzutreten, in Mischungen, die den Reiz einer zweiten Unschuld haben können. Ich denke an die Gedichte der jungen Chinesen Gu Cheng und Bei Dao. Gu Cheng, als „obskurer Lyriker“ verfemt, rehabilitiert die vom System inkriminierten „falschen Gefühle“ durch seine Gedichte. In einem seiner Gedichte heißt es:
In einem Zeitalter der Fehler hegte ich
„falsche Gefühle“ der folgenden Art
Mein Glaube ist unverrückbar,
meine Augen schauen unverwandt.
Regenbogen
treiben in schäumender Quelle,
blicken sanft auf die Passanten,
ein Zwinkern –
und schon sind sie Schatten von Schlangen.
Die Uhr
ruht in der Kirche,
still knackt sie mit den Zeigern,
ein Zwinkern –
und schon ist sie ein tiefer Brunnen.
Rote Blüten
brechen auf der Leinwand auf,
heißen inbrünstig den Frühlingswind willkommen,
ein zwinkern –
und schon sind sie der Geruch von Blut.
Um meines unverrückbaren Glaubens willen
ist aufgerissen das Augenrund.
Ü: Wolfgang Kubin
Ist das nicht die aktuelle Variante von Gottfried Kellers „Trinkt, o Augen, was die Wimper halt“? – ein skeptisches Dennoch des Welterlebens?
Gu Chengs Kollege Bei Dao schreibt mit der melancholischen Einsicht:
Viele Sprachen
sind in der Welt unterwegs
Ihre Produkte
machen das stille Leid der Menschheit
weder leichter noch schwerer.
Dialektik des Dialekts
Schließlich noch eine andere Beobachtung. Bei allen interkontinentalen Bezügen: es gibt auch Entwicklungen, Verwandlungen im Mikrobereich; linguistisch wie regionalistisch, oder beides zugleich. Das poetische Idiom konstituiert sich nicht bloß in den großen konkurrierenden und kommunizierenden Nationalsprachen, es dringt auch in die Binnenstrukturen dieser Sprachen ein, in die Dialekte. Und das Hin und Her der Bezüge, das Übersetzen, kann sich wiederum über Dialekte vermitteln: Der italienische Poet Andrea Zanzotto aus Treviso schreibt sehr moderne Gedichte im Dialekt des Veneto, und seine deutschen Übersetzer wählten für ihre Übertragungen die Variante des Bergdorfes Stilfs. Verzicht auf Kommunikation? Hermetismus? Durchaus nicht. Das Element der Modernität verteilt sich in kleinste Spurenelemente und hält doch Bezug zur ältesten Tradition. Die alte Tante in „Onde éli“ (Wou saintze) hatte in ihren eigenen Versen „parole in latin“ – „Prokkn ass Latain“. Ich zitiere den Anfang jeweils im Trevisanischen, im Stilfser Dialekt und in Hochdeutsch:
Onde éla mai la pi cara de le me jèje
che la scrivéa carnevai e feste
i ,dialoghi‘ in puisia e fin
co dentro parole in latin
che rento i se li recorda ancora (…)
Wou eppr kannt die liabscht va maine Tantn iatz sain
dia za Fosching ollm unt zu di Fescht
di Schtikklan gschriibm hott, mit Raim drinnan
unt goor mit Prokkn ass Latain
an dia si haint nu di maischtn psinnan (…)
Wo ist die liebste meiner Tanten
die für den Karneval und zu den Festen
die Dialoge schrieb in Versform
sogar mit lateinischen Wörtern darin
viele können sich noch erinnern (…)Ü: Capaldi, Paulmichl, Waterhouse
Wer für den Charme des trevisanischen Originals und der Stilfser Version empfänglich ist, wird die alten Gegensätze von Weltläufigkeit und Provinz, von Modernität und Tradition für gegenstandlos halten. „Ausfransung der Welt“ – das kann als Regionalität auch Konzentration von Welt und Sprache sein. Der Übergänge und Vermittlungen sind viele. Dazu ein anderes Beispiel. „Babylonwald gibt verschiedenen Sinn“, bemerkt Sarah Kirsch zu den deutsch geschriebenen Gedichten Jiří Grušas und zielt nicht bloß auf die Sprachverwirrung, sondern auch auf die „Errettung des Dichters am Ufer der anderen Sprache“.
Man könnte sich damit trösten und schließen: daß die Poesie ubiquitär ist und ein unschuldiges Geschäft. Aber wo sind die Rimbauds? Gibt es ihn noch, den Aufbruch ins Neue, ins Unbekannte? Wer entwirft uns die lyrische Karte einer neuen Welt? Der Mann heißt Derek Walcott, ist in der englischsprachigen Welt seit wenigstens zwanzig Jahren als ein major poet etabliert, hat 1992 den Nobelpreis bekommen und ist hierzulande immer noch nicht nach Verdienst bekannt. Er stammt aus der Karibik und stellt sich mit souveräner Ironie so vor:
I’m just a red nigger who love the sea,
I had a sound colonial education,
I have Durch, nigger, and English in me,
and either I’m nobody, or I’m a nation.
Wir kommen später zu Walcotts Karte einer neuen Welt. Die Karibik erscheint uns als eine neue griechische Inselwelt; denn wir haben mit ihrem Dichter einen neuen Homer. Zumindest ein Langgedicht, das den Dichterheros Omeros etabliert. So wäre der älteste Anfang noch einmal möglich? Walcott sagt in einem Interview 1987:
Ich sehe mich eher am Anfang als am Ende einer Tradition.
Das scheint mir ein guter Schluß für das Überleben der Poesie.
![]()
Wie modern ist die moderne Lyrik?
– Eine Art Einleitung. –
Pyrrhus-Sieg
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wer vor der Moderne? Niemand. Niemand mehr fühlt sich eingeschüchtert durch Begriffe. Einer, der besonders sensibel ist für die Schwankungen des Zeitgeists, hat es schon vor zwei Jahrzehnten ausgesprochen:
Was es, für mich vor zehn Jahren, noch für Einschüchterungen gab: Die konkrete Poesie, Andy Warhol, Marx und Freud und der Strukturalismus und jetzt sind all diese Universal-Pictures verflogen, und nichts soll irgendeinen mehr bedrücken als das Gewicht der Welt.
Kein Zufall, daß dieser Stoßseufzer Peter Handkes in einem Journal notiert ist, das sich emphatisch einer begriffslosen Welt- und Selbsterfahrung überläßt. Das „Gewicht der Welt“ wird ausgespielt gegen das Falschgewicht von Theorien, Namen und Moden. Was die Zeit noch nicht geleistet hat, soll durch die Unmutsgeste beschleunigt werden. Freilich weiß Handke 1977, da er diesen Satz drucken läßt, daß die „Universal-Pictures“, wie er sie höhnisch nennt, schon so gut wie verflogen sind.
Wir haben die Moderne überstanden. Sie schreckt uns nicht mehr durch ihre Schocks, sie fordert uns nicht mehr durch ihre Ansprüche. Was sich durchgesetzt hat, meint man zu besitzen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das anders. Da wurde gestritten, wurde die Moderne als Verlust der Mitte diskriminiert. Da löste (1957) eine Zeile Günter Eichs, „Die Kanaldeckel heben sich um einen Spalt“, eine heftige mehrwöchige Leserbrief-Diskussion in der FAZ aus – und ein Nervenarzt, der sich rühmte, „in früheren Jahren“ für Entmündigung und Einweisung Geistesgestörter in Irrenanstalten gesorgt zu haben, schrieb:
Der Herr Eich gehört meines Erachtens dorthin.
Noch 1960 vernahm man ähnliche Töne, als dieselbe Zeitung ein Gedicht Elisabeth Borchers’ druckte, das begann: „eia wasser regnet schlaf“. Das war aber schon die Nachhut der Entrüsteten.
Heute gilt „moderne“ Lyrik wohl immer noch als „schwierig“, doch erregt sie kaum jemanden und schüchtert im Ernst niemanden ein. Einige hunderttausend Menschen haben seit 1956 Hugo Friedrichs Struktur der modernen Lyrik gelesen – wenn auch nicht unbedingt die Dichter, die er behandelt. Anthologien, Seminare und Volkshochschulkurse taten das ihrige. Während antiautoritäre Studenten die Dichter nach ihrer „Zielgruppe“ fragten (als wären die Lyriker Scharfschützen), wollten einige Didaktiker hermetische Lyriker in der Unterstufe behandeln. Es gab tatsächlich einen Aufsatz über „Celan im vierten Schuljahr“.
Die Moderne verbucht einen Pyrrhus-Sieg. Sie ist angekommen, auch bei den Dilettanten. Die dichtenden Laien benutzen die „Errungenschaften“ der Moderne als quasi naturwüchsige Lizenzen: so die Reimlosigkeit und das Freivers-Parlando. Reim und Vers sind lästige Mühe. Moderne erscheint nicht mehr als Anspruch oder Stachel, sondern als Entlastung. Sie ist das Selbstverständliche, das in Wahrheit halb vergessen ist. Man darf nämlich nicht annehmen, daß Pounds Cantos oder Rilkes Duineser Elegien wirklich gekannt wären. Noch heikler freilich die Frage, welcher literarisch Interessierte noch imstande ist, eine Odenstrophe Hölderlins oder die Distichen Mörikes versgerecht zu sprechen. Große Dichter, wie Joseph Brodsky, mahnten die Formstrenge wahrer Poesie an – aber das hat sich noch nicht herumgesprochen.
Recycling
Da ist es schon begreiflich, daß der eine oder andere Kritiker die Kriterien der Moderne, oder was er dafür hält, retten möchte. Vor einiger Zeit hieß es in der Laudatio auf eine junge Lyrikerin:
Die häßliche Verszeile, die mißlungene Wendung ist die eigentliche stilistische Leistung des modernen Dichters.
Man sagt dergleichen nicht in einer Preisrede, wenn man es nicht halbwegs ernst meint. Aber das Paradox, an das möglicherweise gedacht war, verliert seine Kraft, wenn ihm die Texte nicht entsprechen. Das zweischneidige Lob, das ihnen galt, ist bezeichnend für eine Ratlosigkeit, die als Ausweg aus der permanenten Lyrikkrise das Phantom einer genialen sprachlichen Unkultur empfiehlt.
Nicht zu leugnen allerdings, daß es seit den achtziger Jahren ein neues Biedermeier, eine Herz-Schmerz-Poesie gibt. Sie ist die Kehrseite eines deliranten Avantgardismus. Das Problem sitzt tiefer als der Gegensatz von Kultur und Unkultur, von häßlicher und schöner Sprache. Enzensbergers These, wonach sich die meisten poetischen Erzeugnisse mit der Wiederaufbereitung ausgebrannten Materials begnügten, gilt ja nicht bloß für den konventionellen, sondern auch für den progressiven Flügel der jüngsten Lyrik. Nur ist hier das Problem verzwickter, weil im ostentativen Avantgardeanspruch das Konventionelle sich um so besser tarnt. Wer Reimgedichte und Sonette schreibt, muß einiges aufbieten, um zu zeigen, daß er nicht dichtet wie Eichendorff oder Rilke oder nur wie Ulla Hahn. Das sogenannte „Experimentelle“ darf mit Aufmerksamkeit, ja Respekt rechnen, und sei es, weil niemand gern zugibt, daß er etwas nicht versteht.
So gehen die Recyclingprozesse vonstatten und der lyrische Betrieb weiter. Das Gedächtnis der Gegenwart ist ohnedies kurz. Imitationen überlagern die halbvergessenen Originale, Imitationen die Imitationen. Experimentelle Techniken sind längst in die Sprache der Werbung und den politischen Jargon übergegangen. Es war kein Lyriker, der im Herbst der deutschen Wende auf die Parolen „Wir sind das Volk“ und „Wir sind ein Volk“ als Trumpf sein „Ich bin Volker“ setzte. Er hatte nur die Lektion des Sprachexperiments gelernt.
Da war wohl eine ganze Epoche passé. Seit Lenin 1919 die Kommunistische Partei als „Avantgarde des Proletariats“ ausgerufen hatte, wollten die Künstler nicht nachstehen. Manche auch nicht, da Stalin von den Schriftstellern als den „Ingenieuren der Seele“ sprach. So war die künstlerische Avantgarde immer auch mit den Fiktionen der Gesellschaft verbunden: entweder in direkter Abhängigkeit, als Proletkult oder Agitation, oder indirekt und notfalls gegenläufig mit dem Anspruch, selber die Speerspitze fortschrittlichen Bewußtseins zu sein. Bewahrenswert ist Helmut Heißenbüttels famoses Diktum von 1969:
Was ich mir sprachlich vorstellen kann (aus der Sprache heraus halluzinieren kann), ist fähig, Wirklichkeit zu decken. Meine Arbeit, als solche, selbst wenn es keine Leser dafür gäbe, könnte mehr bewirken als alle Kriege der Reaktion und alle Proteste der Progressiven.
Auf der Höhe dieser Idolatrie und Illusion mochte einem Gehlens Begriff der „Ritualisierung“ einfallen. Danach werden Verhaltensweisen zugleich stereotypisiert und selbstwertgesättigt, stabilisiert und einwandsimmun:
Die Kunst, so eingeregelt, verliert natürlich dann an revolutionärem Gehalt, braucht ihn auch nicht mehr, weil ja der Gegner, der alte Klassizismus oder Akademismus von früher, nur noch als Untergrundbewegung weiterlebt, und weil sie selbst kritikfest etabliert ist.
Klassische Moderne – Moderne Klassik
Nein, wir wollen nicht über die Postmoderne reden, wir streifen das später und bleiben noch einen Moment im Bereich dieser Moderne, deren Epigonen ein neues Establishment formierten. Als sich in den Sechzigern das Aktuelle etabliert hatte und verkäuflich geworden war, wurde die backlist zur besseren Verwertung in den Rang der Klassik versetzt und reklamewirksam als „Klassische Moderne“ präsentiert. Wem damals Adornos Ästhetik imponierte, konnte in dieser Formulierung nur den Zynismus jener Kulturindustrie sehen, die darauf bedacht schien, die Impulse der Moderne zu neutralisieren.
Aber natürlich kann man nicht verkaufen, was es nicht irgendwie gibt (und seien es des Kaisers neue Kleider). Nicht zu leugnen war freilich, daß sich ein Kanon der Moderne herausgebildet hatte, und also eine moderne Klassik. Wenn man will, kann man diesen Kanonisierungs- und Ausleseprozeß als Musealisierung sehen. Mit größerem Recht, größerer Besonnenheit hat Enzensberger seinerzeit das Museum als „Annex zum Atelier“ gedacht und seine Lyrikanthologie dieser Prämisse gemäß eingerichtet.
Der intime Zusammenhang von Moderne und Klassik – das ist nun keine Einsicht erst von heute. Schon einer der Begründer der modernen Lyrik hat ihn benannt und erwogen. In seinem Essay über Constantin Guys, den „peintre de la vie moderne“, will Baudelaire nicht bloß den Begriff der modernité einbürgern, er bindet ihn auch auf bemerkenswerte Weise an den der antiquité, wenn er sagt:
Mit einem Wort, damit jede Modernität einmal Antike zu werden verdient, muß die geheimnisvolle Schönheit, die das menschliche Leben ihr unwillkürlich verleiht, herausgefiltert worden sein.
Freilich geht es Baudelaire – wie Hans Robert Jauß dargelegt hat – nicht um eine erneute Anbindung der Moderne an die Autorität der Antike, um nichts Klassizistisch-Akademisches, sondern um das neue, das zeithaft oder transitorisch Schöne, das unter dem Begriff der modernité seine eigene antiquité hervorbringt.
Wenn man dem folgt, begreift man auch den strategischen Sinn, den Walter Benjamins verkürzte Zitierung der erwähnten Stelle hatte: nämlich die strikte Verknüpfung der Moderne mit der Antike. Er schreibt in seinem nachgelassenen Kapitel „Die Moderne“:
Daß „alle Moderne es wirklich wert sei, dereinst Antike zu werden“ – das ist ihm (d.i. Baudelaire) die Umschreibung der künstlerischen Aufgabe überhaupt.
Jauß belegt an Beispielen, daß Benjamins Versuche, die Antike im Paris der Fleurs du Mal aufzusuchen, hochproblematisch, wenn nicht unhaltbar sind. Damit fällt etwa die Interpretation von „Le Cygne“ (Der Schwan), Benjamins Exempel für jene Hinfälligkeit von Paris, „worin zuletzt und am innigsten die Moderne der Antike sich anverlobt“.
Daß man ohne Antike-Bezug zum Begriff der Klassik gelangen kann, beweist am Beispiel Baudelaires ein anderer. Paul Valéry, dessen Definitionen nie ohne Chuzpe zu denken sind, hat 1924 in Die Situation Baudelaires folgende Definition vorgeschlagen:
Klassisch ist der Schriftsteller, der einen Kritiker in sich trägt und ihn zuinnerst mit seinen Arbeiten verbindet.
Womit Valéry, auch wenn er höflich den Boileau in Racine erwähnt, sich selbst als Klassiker ausruft. Denn wenn er anschließend eine notwendige Abfolge von Unordnung und Ordnung, Romantik und Klassik statuiert und durchblicken läßt, daß Baudelaire, inmitten der Romantik, an einen Klassiker denken, aber eben nur denken lasse, dann sind die Bedingungen bestimmt, nach denen man Valéry einen Klassiker nennen muß – einen modernen Klassiker. Der etwas banal klingende, von Valéry aber durch Kursivierung hervorgehobene Satz tritt in seine Rechte:
Das Wesen der Klassik besteht darin, daß sie später kommt.
Hier könnte man nun mit einigem Recht die These anschließen: Das Wesen der Moderne besteht darin, daß sie die Intention hat, Klassik zu werden. Und als Zugabe hätte man den Satz: Postmoderne ist der Verzicht darauf, Klassik werden zu wollen. Nur wer verzichtet schon gern – es sei denn, die Trauben hängen ihm zu hoch.
Die Legende vom lyrischen Labor
Wer dem Verdacht nachgeht, die Moderne habe Klassik, also Dauer und Vollendung im Auge gehabt, wird vielleicht auch einige ihrer Legenden mit gelinder Skepsis betrachten. Nun wäre es töricht, das Interesse moderner Lyriker an Produktion und Reflexion zu leugnen; und Valérys Bemerkung, ihn interessiere die Hervorbringung mehr als das Werk selbst, scheint ziemlich glaubwürdig. Wenn ein Prinzip tatsächlich erkannt und ergriffen sei, meinte er, dann sei es nutzlos, die Zeit mit seiner Anwendung zu verschwenden. So hat Valéry manche Gedichte offenbar nur geschrieben, weil die Reflexion und die Neugier auf den Prozeß ihm doch einige praktische Exempel, eben Gedichte, abforderte. Was dem, der’s glaubt, doppelten Respekt abnötigt: vor der übermenschlichen Intelligenz des Theoretikers und der genialen Bescheidenheit des Praktikers. „Dummheit“, so beginnt „Der Abend mit Monsieur Teste“, „ist nicht meine Stärke.“
Sie war es auch nicht im Fall von Edgar Allan Poe, der ja nicht bloß Lyriker und Theoretiker, sondern auch der Erfinder der Kriminalgeschichte ist. Wer an der vollständigen Aufklärung interessiert ist, könnte auch der Frage nachgehen, wie – in Analogie zum perfekten Mord – ein perfektes Gedicht zu machen wäre. Poe dürfte den Satz des Novalis nicht gekannt haben, wonach Schönheit „ein Erzeugnis von Vernunft und Calcul“ ist. Doch er handelte danach oder schien es doch zu tun. 1846, in seiner Philosophy of Composition, wendet er sich gegen die Auffassung, Dichtung entstehe aus dem schönen Wahn oder aus entrückter Inspiration. Er setzt gegen die Inspiration das, was er den „modus operandi“ nennt, d.h. eine methodische Herstellung, und demonstriert sie an der Entstehung von „The Raven“ (Der Rabe).
Poes Einfall war es, die von der älteren Poetik angenommene Reihenfolge der dichterischen Akte umzukehren. Was als Resultat erscheint, die Form, wird nun zum Ursprung des Gedichts. Am Anfang steht die Wahl des Umfangs, des Effekts, eines bestimmten Tons, der Metrik etc. Nur eine Andeutung: Nachdem Poe sich entschlossen hat, einen Refrain zu verwenden, sucht er nach dem passendsten Wort dafür:
Daß ein solcher Schluß, wenn es um Wirkung ginge, klangvoll sein und sich mit gedehnter Betonung sprechen lassen mußte, stand außer Zweifel; diese Überlegungen führten mich zum langen o als dem klangvollsten Vokal, in Verbindung mit dem r als stimmhaftesten Konsonanten. (…) Bei der Suche unter diesen Bedingungen war es nahezu unmöglich, nicht auf das Wort ,nevermore‘ zu verfallen; tatsächlich war es das erste, das mir einfiel.
Man darf annehmen, daß die Praktiker Poes Erzählung immer schon cum grano salis genommen haben, nämlich als eine fiktive Rekonstruktion von Prozessen, in denen geschulter Instinkt und halbbewußtes Kalkül ineinandergreifen. Auch Poe selbst konnte kein Rezept daraus machen. Denn was taugt eine Poetik, nach der genaugenommen nur ein einziges Gedicht herzustellen ist?
Poes Wirkung auf Baudelaire freilich war ungeheuer, nämlich die einer „sonderbaren Erschütterung“, eines mächtigen Impulses. Entschieden reservierter verhielt sich die anglo-amerikanische Szene. Für T.S. Eliot war Poe ein zweitrangiger Gefolgsmann der romantischen Bewegung, „eine Art von heimatlos gewordenem Europäer“, und Poes Verse erschienen ihm von kruder Magie, die einen allenfalls im Knabenalter begeistern könnten und reiferen Ansprüchen nicht standhielten. Eben die berühmte Philosophy of Composition galt Eliot entweder als Schabernack oder als „ein Stück Selbsttäuschung über die Art, wie er es geschrieben zu haben wünschte“. Daß der seiner Meinung nach überschätzte Poe in Frankreich zum Propheten des Symbolismus wurde, hinderte Eliot nicht daran, sich seinerseits sehr deutlich von Franzosen anregen zu lassen: von Tristan Corbière und Jules Laforgue. Edmund Wilson hat in Axels Schloß vermutet, daß Poes lyrische Technik dem englischen Leser aus Shakespeare und den Elisabethanern wesentlich vertrauter erschienen sein muß.
Anders die Franzosen, anders die Deutschen, die ohnedies mehr an Theorie interessiert waren; also etwa Paul Valéry und Gottfried Benn. Natürlich tappten sie nicht in Poes Falle, oder taten nur so. Valéry immerhin nahm Poe so ernst, daß er ihn als seinen Vorläufer anerkannte und sich als Endpunkt der Reihe Poe–Mallarmé definierte. Dabei hielt er sich zugute, nicht auf die altüberlieferten Begriffe zurückgegriffen, sondern „alles auf rein analytischer Basis“ neu aufgenommen zu haben: Lyrik als rationale Magie. Das meinte unter anderem die Einbeziehung der Methodik der Naturwissenschaften. Doch wenn man etwas schärfer hinsieht, verbleibt gerade der szientifische Bezug weitgehend im Metaphorischen; so etwa Valérys Ansicht, das Kunstwerk gleiche höchst geheimnisvollen Körpern, „die die Physik erforscht und die Chemie sich zunutze macht“.
Von hier ist es nicht weit zu Gottfried Benns Vorstellung vom Labor, darin der Dichter tätig sei:
Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium für Worte, in dem der Lyriker sich bewegt. Hier modelliert, fabriziert er Worte, öffnet sie, sprengt, zertrümmert sie, um sie mit Spannungen zu laden, deren Wesen dann durch einige Jahrzehnte geht. Der Troubadour kehrt zurück: trobaire oder trobador = Finden, das heißt Erfinden von Worten (elftes Jahrhundert, zwischen Loire und Pyrenäen), also: Artist. Wer den Reigen kennt, geht ins Labor.
Auch hier dominiert das metaphorische Verständnis; und eh man sich versieht, ist das Labor auch verlassen, und Benn geht, wie etwa Pound, auf die Troubadours zurück und berührt Nietzsches Begriff der Artistik. Nichts also von einem technoiden Lyrikkonzept; weder bei Benn noch bei seinen Epigonen. Bei einem seinerzeit diskutierten Lyriker war die Rede vom „labor der träume“: „im labor der träume / wird das lied dieser stunde gehämmert“ – da war wohl die gute alte Schmiede näher als jedes Labor.
Lyrik und Prosa
Nun muß man Verse immer noch schmieden, Prosa offenbar nicht. Das führt zu der Frage: Ist der Vers nicht ein archaisches Medium? Und rührt die Vielzahl poetologischer Selbstzeugnisse nicht aus dem Zwang, die Obsoletheit der Lyrik zu rechtfertigen?
Hat nicht schon Hegel…? Hegel ist immer gut. Natürlich hat bei ihm die Poesie ohnehin keinen leichten Stand in einer zur Prosa gewordenen Welt. Während der Roman als „bürgerliche Epopöe“ noch von seinem Totalitätsanspruch zehren darf, hat sich die Lyrik mit dem Selbstausdruck des Subjekts zu begnügen; so daß es – wie Hegel fast boshaft formuliert – „nur auf die Seele der Empfindung und nicht auf den näheren Gegenstand ankommt“.
Wenn diese Reduktion auf die Seele des Subjekts überhaupt je gegolten haben sollte: für Heine oder Baudelaire galt sie gewiß nicht mehr – und also nicht für alles, das folgte und lyrische Moderne genannt werden wollte. Lyrik hält seitdem Distanz: nicht bloß zur Seele, sondern auch zur Welt, zu dem, was ist. Für sie ist das Ganze nicht das Wahre, sondern eher das Un-Wahre. Soweit aus dieser Negation ein eigener Anspruch erwächst, ist es primär der eines anderen Sprechens, einer anderen Sprache. Es ist, positiv gewendet, die Annahme, daß die Verssprache, also die Technik von Melo-, Phano- und Logopoeia, etwas erreicht, das in der geradeaus laufenden Prosa nicht einzuholen ist – ähnlich dem Paradox, wonach Achill die Schildkröte nicht einholt. Das könnte zugleich aber etwas sein wie die Modernitätsfalle der Lyrik, wie sie Ulrich Schödlbauer beschrieben hat:
Die Moderne treibt den Gegensatz von Vers und Prosa ins Extrem. Der Vers erschließt in ihr eine Welt der Artikulation, die sich von der Welt der Prosa, in der die Alltagssubjekte, wie vermittelt auch immer, miteinander kommunizieren, um Lichtjahre entfernt. Das gilt auch dann, wenn sie Versatzstücke der Alltagssprache montiert; der Zweck macht die Differenz.
Auch der prosanahe Flattersatz also, sofern er mit dem Anspruch von Lyrik auftritt, ist Lyrik (und gewiß auch das Prosagedicht); und Schödlbauer berührt ein ernstes Problem, wenn er darauf verweist, daß die Moderne, anders als die Renaissance, über keine ausgebildete Verslehre verfügt. Daraus resultiere der Sprachmystizismus und die Selbstreferentialität der modernen Lyrik, also – so gibt uns Schödlbauer zu verstehen – auch der Pakt zwischen den Lyrikern und dem schmaler werdenden Lyrikpublikum:
Doch ein wohlvertrauter Effekt nötigt sie auf getrennte Bahnen. Der in seinem Material arbeitende und sich den objektiven Gegebenheiten beugende Lyriker forscht nach Techniken, die es ihm erlauben, dem verzweigungsreichen und randlos wuchernden Labyrinth ästhetisch motivierter Negationen, in denen er sich bewegt, eine weitere Windung hinzuzufügen. Währenddessen hat das Publikum, lektüregesättigt und oberflächenfixiert, das Prinzip aller Innovation längst erkannt und zeigt sich entschlossen, die individuelle ästhetische Ambition unbeeindruckt zu konzedieren.
Das klingt überzeugend – wenn man davon absieht, daß diese Lagebeschreibung sich ohne Mühe auch auf die Situation der Malerei oder der modernen Musik beziehen ließe. Zu bedenken wäre immerhin, daß dies möglicherweise ermüdete Widerspiel von Innovation und Akzeptanz nicht das entscheidende Moment von Produktion und Rezeption sein kann (anders wäre das Spiel längst zu Ende). Beide Seiten, Künstler wie Publikum, suchen in den ästhetischen Produktionen offenbar etwas, das über das Versprechen von rational nachvollziehbarer Realitätsadäquanz hinausreicht. Man kann das einen Erkenntnismystizismus nennen. Nur unterscheidet sich die Lyrik vom esoterischen Hokuspokus dadurch, daß sie ihr Gemachtes vorführt und reflektiert; das ist ihr Tribut an die Moderne. Ihr Ansehen als ein geistiges Genre ist folglich nicht völlig ruiniert. Immer noch hat sie – auch unter den literarischen Gattungen – einen Sonderstatus. Er wirkt zwar manchmal wie eine Kompensation für mangelnde Resonanz und kümmerliche Bezahlung. Immerhin hat ein erfolgreicher Prosaautor, nämlich Martin Walser, gemeint:
Ich glaube, es gibt keinen Schriftsteller, der nicht am liebsten Lyriker wäre.
Er gestand, daß er die Gedichte, die er gelegentlich schreibe, meist wieder in Prosa auflöse und in seinen Romanen verstecke:
Meine Achtung vor Gedichten ist zu hoch.
Karriere
Lyriker sind offenbar sonderbare Heilige. Sie investieren in eine wenig aussichtsreiche Sache. Daß man Geld und selbst Ruhm anderswo eher erwirbt, dürfte sich herumgesprochen haben. Um so erstaunlicher, wenn große Poeten Mut machen; so merkwürdigerweise Baudelaire. In seinen Ratschlägen für junge Literaten vermerkt er:
Die Poesie ist eine der Künste, die am meisten einbringen; aber es handelt sich um eine Art Anlage, bei der man erst spät die Zinsen einheimst – die dann allerdings beträchtlich sind. – Ich fordere Mißgünstige auf, mir diejenigen guten Gedichte zu nennen, die einen Verleger ruiniert hätten.
Nun ist Baudelaire nicht einmal ein Exempel in eigener Sache, zumindest nicht zu seinen Lebzeiten. Gottfried Benn hat 1926 die bekannte Gegenrechnung aufgemacht und seine Einnahmen aus fünfzehn Jahren literarischer Produktion beziffert:
Mit diesen 975 Mark bin ich übersetzt ins Französische, Englische, Russische, Polnische und in lyrische Anthologien Amerikas, Frankreichs und Belgiens übergegangen.
Die Geldfrage hat übrigens einen ernsten politischen Aspekt, wie der Fall Pound zeigt. Ezra Pound hielt es für einen Skandal, daß das Land „seine 5 bis 10 besten Autoren nicht ernähren will“ – und erhoffte Sold und Ehre von Mussolini. Benn nahm das von ihm verbuchte Honorar mit grimmigem Humor:
Alles für 4,50 Mark pro Monat, aber ich zu meinen Trippern und jeden Monat ein Gedicht! Gedicht ist die unbesoldete Arbeit des Geistes, der fond perdu, eine Aktion am Sandsack: einseitig, ergebnislos und ohne Partner –: evoë!
Andererseits bewunderte Benn „die skrupellose Art, wie die Ausländer ihre Lyrik starten – ohne Rücksicht auf das Edle, Getragene, Schulbuchfähige, Präsidentengefällige, Pour-le-mérite-würdige“. Sein Erstling Morgue machte ja auch genügend Furore und brachte ihm einen Schwall von Presseattacken ein. Polemiken oder, besser noch, Gerichtsverfahren sind auch für Dichter die beste Werbung. „Eine gigantische Reklame“, befand Flaubert 1857 über den Prozeß, in dem seine Madame Bovary inkriminiert wurde. Im selben Jahr wurde Baudelaire zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht schloß sich weitgehend dem Staatsanwalt an, der auf Verletzung der öffentlichen und religiösen Moral plädiert hatte. Erst 1949 hob die französische Justiz den Schuldspruch förmlich auf und erklärte seine Begründung für unzutreffend. Freilich paßte der „Ruhm eines Prozesses“ durchaus in Baudelaires Strategie, in das, was Benjamin „weitreichende Berechnung“ nannte. Das war selbst dem Staatsanwalt deutlich, der die Dringlichkeit der Verurteilung damit begründete, nur so könne ein Skandalerfolg vermieden werden.
Doch sind Skandale vergleichsweise grobe Mittel. Baudelaire verfügte über entschieden feinere und wirksamere Strategien. Diese Strategie demonstriert bereits die Publikationsgeschichte der Fleurs du Mal. Seit 1843 bereits ließ Baudelaire Gedichte in Zeitungen und Zeitschriften drucken und kündigte seinen Gedichtband unter wechselnden Titeln an, als Les Lesbiennes, als Les Limbes, und gab 1855 einer größeren Gedichtkollektion in der Revue des Deux Mondes jenen Titel, den dann, zwei Jahre später, das Buch erhielt.
Baudelaire etablierte seinen Mythos Zug um Zug. Was schon die zeitgenössische Kritik bemerkte. Sie warf Baudelaire vor, er habe ganz Paris durch eine Mystifikation an der Nase herumgeführt. Natürlich gehört zu Baudelaires Karrierekalkül die Exhibition seiner Privatsphäre, etwa seiner Beziehung zu der Kreolin Jeanne Duval; all das, was ihm den Ruf eintrug, ein monströser Exzentriker, ja ein Monster zu sein. Der Schock der Fleurs du Mal war gleichwohl enorm. Die Revue des Deux Mondes fragte denn auch:
Was wäre eine Gesellschaft, was wäre eine Literatur, die M. Charles Baudelaire als ihren Dichter akzeptierte?
Das Akzeptieren fiel selbst den Späteren schwer; und das Skandalon Baudelaire machte den Nachgeborenen zu schaffen. Sartre etwa suchte ihm dadurch beizukommen, daß er Baudelaires Verurteilung als selbstgewählt interpretierte, als Versuch, durch eine provokante Unmoral die Anteilnahme der Gesellschaft auf sich zu lenken. Brecht, indem er Baudelaire zum Dichter des französischen Kleinbürgertums degradierte und die Fleurs du Mal zu „Blumen des Schlechten“. Dabei würde nämlich „ein Moment des Aktiven, Produktiven, Erfinderischen wegfallen, ein heroisches Moment“ – eben das, was bis heute die Faszination des Buches ausmacht. „Und wie zerfrißt der Ehrgeiz diesen Zyniker“, ruft der nicht wenig ehrgeizige Brecht Baudelaire nach.
Benns Diktum vom skrupellosen „Starten“ der Lyrik bewährt sich auch bei dem anderen Gründervater der modernen Lyrik, bei Walt Whitman. Auch er richtete, wie Benjamin es von Baudelaire behauptet hat, seine Strategie nach den Bedingungen des literarischen Marktes. Dort trat er sogar vor Baudelaire auf. Immerhin erschien die erste Ausgabe der Leaves of Grass 1855, also zwei Jahre vor den Fleurs du Mal. Nicht bloß die hochartifiziellen Blumen des Bösen, auch die Grashalme waren stilisierte, künstliche Natur; also modern. Modern war auch die Selbststilisierung des Verfassers zum Mythos.
Das zeigte schon die Aufmachung der Erstausgabe, eines in grünes Leinen gebundenen Quartbändchens. Den Goldbuchstaben Leaves of Grass entsproßten Wurzeln, Blätter und Ranken. Statt eines Innentitels mit dem Verfassernamen gab es als Frontispiz eine Photographie: Da stand ein junger Mann mit Christusbart, einen großen Filzhut keck auf dem geneigten Kopf, die eine Hand in die Hosentasche, die andere in die Hüfte gestemmt. Ein Dichter? Nein, ein Mensch als sinnliche Botschaft. Der fehlende Dichtername wurde im Text nachgeliefert, dort aber um so eindrücklicher. In der Mitte des ersten langen Gedichts, das später „Song of Myself“ heißen sollte, stellte sich der Verfasser emphatisch vor als:
Walt Whitman, ein Kosmos, von Manhattan der Sohn,
Ungestüm, fleischlich, sinnlich, essend, trinkend und zeugend,
(…)
Nicht bescheiden, noch unbescheiden.
Wie immer es mit der Bescheidenheit bestellt sein mochte: Whitman versprach dem Leser, er berühre kein Buch, sondern einen Menschen. Immerhin hatte auch Baudelaire, wenn auch kühler, distanzierter, den Leser angeredet: als „Hyprocrite lecteur, – mon semblable, mon frère!“ (Scheinheiliger Leser, – Meinesgleichen, – mein Bruder!)
Zu Whitmans Karriere gehört ein Brief, den man den berühmtesten Brief der amerikanischen Literaturgeschichte genannt hat. „Werter Herr“, so begann er, „ich bin nicht blind gegen den Wert der wunderbaren Gabe Ihrer Grashalme. Ich halte sie für die außerordentlichste Probe von Geist und Weisheit, die Amerika je beigebracht hat.“ Der Schreiber, der Whitman derart nobilitierte, war kein Geringerer als Ralph Waldo Emerson, der schon 1837 nach einer spezifisch amerikanischen Literatur gerufen und in seinem Reisetagebuch von einem Gedicht geträumt hatte, „völlig westlich, frisch und grenzenlos – ganz und gar unser eigen, ohne die Spur oder den Geschmack europäischer Erde, Erinnerung, nach Buchstaben oder Geist“. Whitmans Antwort an den verehrten Meister ließ es an Selbstbewußtsein nicht fehlen:
Der Weg liegt deutlich vor mir. Noch ein paar Jahre, dann wird der durchschnittliche Jahresbedarf an meinen Gedichten zehn-, zwanzigtausend Exemplare betragen, wahrscheinlich mehr.
Das hatte der Geschäftsmann im Dichter vorerst überschätzt. Er war zudem geschmacklos genug, Emersons Brief ungefragt in die zweite Auflage seiner Grashalme zu setzen und den Satz „Ich begrüße Sie am Anfang einer großen Laufbahn… R.W. Emerson“ auf dem Umschlag abzudrucken. Emerson war verärgert, nahm aber sein Lob nicht zurück. Über Whitmans spätere Gedichte urteilte er nicht ohne eine gewisse Berechtigung:
Ich dachte, er würde die Lieder der Nation schaffen – aber er scheint sich damit zu begnügen, ihr Inventar aufzustellen.
Wie auch immer: Die amerikanische Lyrik nach 1910 – die Chicago-Gruppe mit Sandburg und Masters, aber auch Hart Crane – ist ohne Whitman nicht zu denken. Und wenn Ezra Pound auch der Meinung war, man könne aus den Grashalmen allenfalls dreißig Seiten guter Lyrik zusammenstellen – er wußte, wen er zu entthronen gedachte: Mit seinen Cantos wollte er der amerikanische Homer werden.
Scheitern
Wer aber nun keine Karriere macht, hat noch eine andere Chance: das Scheitern. Zur Moderne gehört das Pathos des Scheiterns, der Mythos vorn Abbruch. Doch erst wo Scheitern oder Abbrechen bemerkt und für bedeutsam gehalten werden, eröffnet sich diese andere Art der Karriere. Rimbaud ist das große, nicht einholbare Exempel. Ein Ruch der Gefahr, in die sich der Waffenhändler begibt, hängt seitdem am Scheitern der Dichter. Jeder Lyriker kennt zumindest die Versuchung, die Poesie hinzuwerfen, sei es wegen mangelnder Resonanz, sei es, weil er sich ihrem Anspruch nicht gewachsen fühlt. Das ergibt einen Seitenhieb auf jene, die einfach weitermachen. Allerdings öffnet sich auch hier die Modernitätsfalle: Das Publikum, durch schwerere Schocks desensibilisiert, ist durch Produktionseinstellungen kaum noch zu beeindrucken.
Vor einiger Zeit gab ein junger (damals achtunddreißigjähriger) Lyriker seinem dritten Gedichtband ein Nachwort mit, das begründete, warum er künftig wohl noch einzelne Gedichte, aber keinen Band mehr publizieren wolle:
Abschließend möchte ich anmerken, daß in den zwanzig Jahren, in denen ich mich fast uneingeschränkt der Dichtung ausgesetzt habe, mir immer wahrscheinlicher wurde, daß sie – und zunehmend mehr – die kühnste unter den Künsten ist, über deren extremste Bedingungen, die sie ab einer bestimmten Höhe diktiert, sich Unverfallene wohl schwerlich einen Begriff machen.
Der Autor hatte sich gleichsam auf das Kreuz seines Werkes genagelt. Er hielt fest an einem unzeitgemäß emphatischen Begriff von Poesie. Man muß schon auf Mallarmé, George oder Celan zurückgehen, um die Formulierung begreiflich zu finden, die Dichtung – gemeint ist die Lyrik – sei „die kühnste unter der Künsten“ und stelle die „extremsten Bedingungen“. So ist das Nachwort weniger eine Erklärung als eine Geste: ein Protest gegen den Betrieb, für den es kein Aufhören geben darf. Sollte er’s nicht gleich gewußt haben, so mußte der Autor es erfahren: Die Geste blieb folgenlos. Der Betrieb ging zur Tagesordnung über.
Soll man das beklagen? Das Publikum ist offenbar nicht mehr geneigt, im Dichter den Träger einer Dornenkrone zu sehen, und erwartet von ihm auch kein wie immer geartetes Heil. Überhaupt haben die bekannten Stilisierungsmuster – Priester, Präzeptor, Animateur – als reine Typen ausgespielt. Schon George, Borchardt oder Schwitters paßten nicht mehr recht ins Schema; wie also Botho Strauß, Peter Handke oder Peter Rühmkorf? Der eben erwähnte Lyriker hat übrigens seine Entscheidung revidiert und einen neuen Gedichtband veröffentlicht.
Das Überleben der Lyrik
Und was erhellt aus alldem? Das langsame Sterben oder das zähe Überleben der Lyrik? Wer Lyrik mag oder sich zumindest für sie interessiert, wird da nicht zweifeln. Der meint auch, daß die Dichter selbst sich mit ihren Maximen nicht bloß nur Mut machen wollen. Paul Celan fragte in seiner Meridian-Rede 1960:
Die Kunst erweitern? Nein. Sondern geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge und setze dich frei.
Das Bedürfnis nach Poesie überlebt, also wird auch die Lyrik überleben. „Die Behauptung, die Poesie sei tot, läßt sich beim besten Willen nicht aufrechterhalten“, so Enzensberger in seinen „Meldungen vom lyrischen Betrieb“.
Solche Befunde werden auch durch die Literaturgeschichte gestützt. Gerhard Kaiser, der in zwei Werken die deutsche Lyrik von Goethe bis Heine und von Heine bis zur Gegenwart dargestellt hat, spricht von der um 1770 geborenen „modernen Seele“, die sich, mit Akzentverlagerungen vorn ödipalen zum narzißtischen Muster, bis in unsere Zeit erhalten habe. Er konstatiert auch eine bemerkenswerte Stabilität der lyrischen Muster:
Grundsätzlich bleiben die Gattungen, wie sie sich um 1770 darstellen, erhalten: Lied, Freie Rhythmen, Balladen, Romanzen, Sonette, antike lyrische Formen usw. Es vollziehen sich allerdings quantitative Verschiebungen zum Freien Rhythmus hin, weiter zum freien Vers mit Reimbindung, aber fließender Metrik und zum metrisch gebundenen, doch reimfreien Gedicht.
Ein Befund, der sich grosso modo auch auf etliche andere Literaturen übertragen ließe. Man denke an die erstaunliche Lebensfähigkeit des italienischen Endecasillabo, des französischen Alexandriners, des englischen Blankverses – Formen, die auch die Experimente von Lettrismus und Lautpoesie überstanden haben.
„Ewiger Ruhm dem Erfinder des Sonetts“, schreibt Valéry 1928 im Notizbuch eines Dichters. Er konnte nicht ahnen, daß sein japanischer Kollege Tanikawa Shuntarō Anfang der fünfziger Jahre diese so fremde Form ins Japanische transferieren wird. Überhaupt kennt die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts keine Literaturrevolutionen mehr. Schon die endzwanziger Jahre bringen allerlei klassizistische Rückgriffe, und die Bewegungen der experimentellen Literatur und der Konkreten Poesie sind Reprisen, allenfalls Weiterführungen von Versuchen der dadaistischen Ära. Der Surrealismus vollends hat zwar bedeutende Dichter wie René Char oder Paul Celan beeinflußt, erscheint aber dort, wo er als Methode verstanden und gehandhabt wird, eigentümlich flach. Seine Schocks haben sich verbraucht, manche Traumsequenzen wirken schon wie psychisches Material, bloß dokumentarisch. Da er die tradierten Bindungen verschmäht, muß er – jedenfalls in der französischen Lyrik – die Rhetorik zu Hilfe nehmen; was bis heute seine deutsche Rezeption erschwert. Daß die Reaktion der Bourgeoisie den Surrealismus nach links drängte, wie Benjamin bemerkt, hat ihn in eine andere, in die kommunistische Orthodoxie geführt. Sagen wir also vorsichtig: Es ist nicht abzusehen, ob und wann der poetische Surrealismus eine Renaissance erfährt.
Um so erstaunlicher ist die Regenerationskraft der Tradition und ihrer Formen. Oder sollte es ein Zufall sein, daß die drei Lyriker, die in den vergangenen Jahren den Literatur-Nobelpreis erhielten, nämlich Joseph Brodsky, Derek Walcott und Seamus Heaney, durchaus formstrenge Dichter sind? Ebensowenig ist es ein Zufall, daß alle drei, die so involviert sind in die zeitgenössische Problematik, sich auf große alte Traditionen beziehen, auf Homer, auf Dante, aber auch die nähere, die nationale Überlieferung.
Diese Autoren haben das Recht, Eliots Frage „Was ist ein Klassiker?“ zu radikalisieren und zu fragen Warum Klassiker? Der polnische Dichter Zbigniew Herbert überschreibt so ein Gedicht, das schließt:
wenn ein zerschlagener krug
zum thema der kunst wird
die kleine zerschlagene seele
mit dem großen leid über sich
wird das was nach uns zurückbleibt
wie das weinen des liebespaares
in einem kleinen schmutzigen hotel
wenn morgens die tapeten dämmern
Ü: Karl Dedecius
Wer diese Zeilen liest, wundert sich nicht, daß Herbert im klassischen Konflikt zwischen Marsyas und Apollon die Partei des Geschundenen gegen den Schinder und göttlichen Autokraten ergreift. Er weiß sehr wohl, daß Klassizität teuer, allzu teuer erkauft sein kann. In dem Prosagedicht „Klassiker“ heißt es von Cicero:
Sogar im stein kann er lesen. Nur kam er niemals darauf, daß die marmoräderchen in Diokletians thermen geplatzte blutgefäße von sklaven aus den steinbrüchen sind.
Herbert, ein Kenner und kritischer Liebhaber der Antike, betont aber noch ein anderes Moment, das man, je nach Geschmack, klassisch oder modern nennen kann: die Unpersönlichkeit des Dichters. Herbert verweist auf Flauberts Empfehlung, sich in seinem Schaffen zu verstecken, und spricht vom alten Traum des Dichters, „daß sein Werk zum konkreten Gegenstand werde, wie der Kiesel oder der Baum, daß es, aus der Materie der Sprache gebildet, die einer ständigen Wandlung unterliegt, ein dauerhaftes Leben erlange“. Er, der die Selbstbezogenheit der meisten Künstler ablehnt, wäre gern einer der namenlosen alten Meister. „Mein Traum ist ein anonymes Schaffen“, bekannte er in einem Interview. Da solche Anonymität nicht mehr zu haben ist, spricht Herbert gern durch Masken. Am meisten von sich gab er einer Spielfigur mit, die er Herr Cogito nennt, einem lyrischen Monsieur Teste. Aber dieser Herr Cogito, dem er 1974 einen ganzen Band abtrat, ist nicht bloß Intelligenz (wie Valérys Geschöpf), sondern auch Emotion, Herz, ja Frömmigkeit. „Je est un autre“, sagte Rimbaud. Bei Herbert erhält das Ich noch einmal die Chance, es selbst zu sein, indem es sich als ein anderer ausspricht.
Masken und Stimmen
In der Lyrik unseres Jahrhunderts zeigt sich diese Dialektik immer wieder: Der Dichter, der sich maskiert, versucht unter der Maske seine authentische Stimme zu finden. Der Möglichkeiten, der Varianten sind viele: sie reichen von den Personae Ezra Pounds und dem Personenpluralismus der Heteronyme Fernando Pessoas bis in die linguistischen Exerzitien Helmut Heißenbüttels, Oskar Pastiors oder Inger Christensens; von der Ausdrucksartistik Gottfried Benns bis zum reduktionistischen grido Giuseppe Ungarettis; von der nüchternen Wahrheit Philip Larkins bis zu den kühnen Metaphern, unter denen Tomas Tranströmer den Kampf um den verlorenen Namen führt. Und der Name, unter dem Paul Antschel im anagrammatischen Silbentausch zu Paul Celan wurde, bot er nicht so viel Schutz, daß in seinem Schatten Atem und „Atemwende“ möglich wurden?
Man kann die poetische Stimme auch physiologisch fassen wie Charles Olson, der seine Gedichte als „Feldkompositionen“ ansah, die aus dem Atem kommen:
Und die Zeile stammt (ich schwörs) vom Atem, vom Atem dessen, der schreibt, im Augenblick, wo er schreibt.
Robert Creeley spricht vom „beat of breath“, was das deutsche „Atemgesetz“ nur sehr unvollkommen wiedergibt. Er widmete Olson sein Gedicht „Le Fou“, das beginnt:
wer schmiedet, denn, die Zeilen,
bestimmt sich, nimmt sich, immer den Takt aus
dem Atem
aaaaaaaader langsam ist –
Ich meine, Grazien kommen langsam,
so ist es eben. (…)
Ü: Klaus Reichert
Dieser Doppelaspekt von Maske und Stimme, persona und Ich, ist mir beim Schreiben der hier versammelten Arbeiten immer wieder aufgefallen. Daher der Titel Masken und Stimmen. Ein Titel aber, sagt Lessing, müsse kein Küchenzettel sein; es genügt, wenn er den Appetit stimuliert. Dennoch wird der Koch befragt, warum er dieses bringt und anderes nicht. Er zieht seinen Kopf aus der Schlinge und sagt, daß jede Küche, jeder Appetit Grenzen hat.
Vollständigkeit der Aspekte und Figuren konnte mein Ziel nicht sein. Allein ein Blick in die Anthologien nationaler oder internationaler Poesie zeigt, was und wer alles fehlt – etwa die französische, spanische oder griechische Lyrik. Respekt und Kompetenz kommen nicht immer zueinander. Wie wünschte ich, ein Kenner Apollinaires, Audens, Wallace Stevens’ oder der spanischen „Generation von 27“ zu sein. Bei einigen anderen Autoren war ich mir nicht sicher, daß die vorhandenen Übersetzungen dem Rang der Dichter entsprechen; und das ist bei einem Buch, das sich an den nichtspezialisierten Leser wendet, schon ein Kriterium. Gern hätte ich über W.C. Williams oder Robert Lowell geschrieben usw. usf. Und bei den deutschen Lyrikern, die hier fehlen – etwa Brecht, Huchel, Eich, Bachmann –, tröstet mich nicht bloß die schon vorhandene Literatur, sondern auch die Nötigung, einen gewissen Umfang meiner Darstellung nicht zu überschreiten.
Andererseits komme ich auf einige Dichter zu sprechen, denen man in Darstellungen und Anthologien selten oder kaum begegnet, also David Jones, Gunnar Ekelöf oder Dieter Leisegang. Repräsentanz und Prominenz sind nicht alles. Zudem verleugnet das Buch nicht, daß etliche der darin enthaltenen Analysen durch Aufträge angeregt wurden; Grund, den Redakteuren, die mir etwas abforderten, zu danken.
Schließlich wird es dem Leser nicht verborgen bleiben, daß die moderne Lyrik sich in Sprachen ausdrückt, von denen auch der interessierteste Leser nur die eine oder andere beherrscht. Ich bin kein Spezialist und habe nicht für Spezialisten geschrieben. Aber wie sollte man auf einen so faszinierenden Dichter wie Joseph Brodsky verzichten? Und warum sollte man die Übersetzer von Poesie desavouieren, die man getrost die Dichter der Dichter nennen darf? Als der junge Stefan George nach Paris kam, führte ihn Albert Saint-Paul bei Mallarmé mit den Worten ein:
Il traduit en vers les Fleurs du Mal.
Lapidarer kann man wohl kaum sagen, was Übersetzung als „Nachgesang und Gegengesang“ (Bernhard Böschenstein) meint. Zu danken ist also auch den Übersetzern, die das lyrische Terrain überschaubar machen und – notfalls – die ihre für eine andere Landschaft geben. Ich schließe hier mit einem zitierenden Vorgriff auf Zeilen von Derek Walcott:
Was denn ist Poesie, die etwas taugt,
als ein von Hand zu Mund gereichtes Wort?
Harald Hartung, Vorwort
Inhalt
– Wie modern ist die moderne Lyrik? Eine Art Einleitung.
– Poesie im Prozeß. Internationale Lyrik seit den sechziger Jahren
– Ezra Pound. Die Goldwaage im Glashaus
– T.S. Eliot. Der Märtyrer unter der Maske
– Gottfried Benn. Rückblick auf einen Stundengott
– Georg Heym. Das Ich in den Bildern
– Fernando Pessoa. Die Personenperson
– Giuseppe Ungaretti. Die Suche nach dem verheißenen Land
– Eugenio Montale. Der Dichter ohne Botschaft
– David Jones. Das Gedichtwerk Anathemata
– Gunnar Ekelöf. Das unbegreifliche Dritte
– Karl Krolow. Proteus als Lyriker
– Paul Celan. Vom Hochseil herab
– Helmut Heißenbüttel. Experiment und Text
– Oskar Pastior. Das Rauschen der Sprache im Exil
– Dieter Leisegang. Lauter letzte Worte
– Philip Larkin. Die nüchterne Wahrheit der Lyrik
– Tomas Tranströmer. Der Kampf um den Namen
– Inger Christensen. Eine lesbare Welt
– Charles Simic. Tanz auf dem brennenden Schal
– Derek Walcott. Landkarte einer Neuen Welt
– Seamus Heaney. Poesie als Feldarbeit
– Joseph Brodsky. Gegen die Gorgo
– Im Schatten der Shoah. Tuvia Rübner, Dan Pagis, Asher Reich
– Anhang
– Literaturverzeichnis
– Nachweise
– Register
Wer gerne und vielleicht schon lange Lyrik liest,
wird heute leicht desorientiert. Zieht er nämlich die Sekundärliteratur zu Rate, weiß er bald nicht mehr, wie es um die Lyrik steht: Bedeutet die Rückkehr zu traditionellen Formen in der Lyrik das Ende der Moderne oder existiert die Moderne mit ihren Errungenschaften – irgendwie – in der Postmoderne weiter? Haben wir nach der Moderne gar mit einem neuen Biedermeier in der Lyrik zu rechnen? Solche akademischen Fragen und Zweifel löst Hans Hartung in dem hier vorzustellenden Band Masken und Stimmen – Figuren der modernen Lyrik, mit leichter Hand. Als „ein Liebhaber, ein Dichter oder ein Anthologist“, wie er sich selbst vorstellt, muß er sich nicht aus akademischen Ehrgeiz hinter Fußnoten verschanzen, um dem Leser zu imponieren, sondern ihm geht es ganz offensichtlich um die Lyrik selbst – und mögen seine Antworten auf offene Fragen auch subjektiv sein, dem Liebhaber der Lyrik geben sie Orientierung und vielleicht sogar Trost.
Auch wenn es sich bei diesem Buch um eine Aufsatzsammlung handelt, sind die Beiträge für die Publikation doch sorgfältig komponiert und aufeinander abgestimmt und es läßt sich durchaus in eine Reihe mit ehrgeizigen Gesamtinterpretationen der modernen Lyrik stellen, wie dem mit ältlichen Progressismus bereits in den 50-iger Jahren von Hugo Friedrich geschriebenem Werk Die Struktur der modernen Lyrik oder der immer noch lesenswerten, aber schon 1972 auf deutsch erschienenen essayistischen Studie von Michael Hamburger Wahrheit und Poesie.
Hartung bietet intime, souveräne Kenntnis von Lyrik und ein ausgewogenes Urteil, vor allem in Bezug auf den einzelnen Autor, auf das einzelne Gedicht, wofür jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Gegenstand und eigene Praxis Voraussetzungen sind.
Der Verfasser macht es dem nicht spezialisierten Leser vielleicht einfacher, zum komplexen Bereich der modernen Lyrik Zugang zu finden als die eben erwähnten Autoren, dies aber keinesfalls auf niedrigerem Niveau. Denn der dem Leser von Lyrik längst als der Herausgeber der internationalen Anthologie Luftfracht bekannte Harald Hartung behandelt die zentralen Themen der modernen Poesie in einzelnen Aufsätzen, fast Porträts von Lyrikern, die untergründig verwoben, doch ein Gesamtbild ergeben. Allerdings, und das zeigen die beiden systematischen Einleitungsaufsätze, besteht zu Hugo Friedrich und Michael Hamburger ein wesentlicher Unterschied: Hartung schreibt gleichsam nach dem Ende der Moderne und er hat vor theoretischen Konzepten zur Lyrik keinen Respekt mehr. Gleich auf der ersten Seite liest man:
Wir haben die Moderne überstanden. Sie schreckt uns nicht mehr durch ihre Schocks, sie fordert uns nicht mehr durch ihre Ansprüche.
Erfrischend und knapp werden darauf Bergriffspopanze wie Avantgarde, Posthistoire, Bricolage und andere zerlegt, denn der Autor weiß, worum es ihm geht, um Dichtung nämlich – und nicht um Begriffsspalterei. Das heißt aber weder, daß er sich im theoretischen Gestrüpp aktueller Literaturwissenschaft nicht zurechtfände – denn auch das ist sein Metier – noch, daß er die Lyrik von der blutigen Geschichte des Jahrhunderts trennen möchte. Aber Moral und Artistik stellen für ihn keine Alternativen dar, wie auch, und das ist noch erstaunlicher, Tradition und Moderne keinen fundamentalen Gegensatz mehr bilden. Deshalb heißt es auch, nach einem Rückblick auf die Moderne:
Um so erstaunlicher ist die Regenerationskraft der Tradition und ihrer Formen.
Vielleicht will Hartung also, sozusagen nach der Schlacht um die Moderne, zeigen, wie stark diese selbst von der abendländischen Tradition geprägt war. Schon der Titel Stimmen und Masken klingt ,antikisch‘ und das Bild, daß das Individuum nicht selbst spricht, sondern gleichsam anonyme archetypische Stimmen aus Masken tönen, unterstreicht diese Vorstellung einer durch millenaire Dauer überindividuell gewordenen Tradition, in der Transzendierung der Zeit möglich wird durch mythische Präsenz. Dieses Konzept wird freilich an einem besonders an die Antike gebundenen Dichter wie Ezra Pound entwickelt, läßt sich aber ohne weiteres auf andere Gründungsheroen der modernen Lyrik, wie Fernando Pessoa übertragen. Diese ,mythische Methode‘ wie sie ein weiterer moderner Klassiker, nämlich T.S. Eliot genannt hat, muß aber keineswegs den Bezug zur Geschichte, ja zum Tagesgeschehen ausschließen. Das zeigt Hartung sehr schön an dem irischen Nobelpreisträger Seamus Heaney, der über keltische Moorleichen schreibt und unvermittelt beim Konflikt in Nordirland ankommt. Aber diese Privilegierung des mythischen oder überlieferungs-geschichtlichen Bezuges führt Hartung weder in die Gefahr des Eurozentrismus noch in die einer Ausklammerung von Lyrikern, die diesen Bezug nicht vorrangig pflegen. Im Gegenteil: Das Älteste mit dem Neuesten verbindet der karibische Nobelpreisträger Derek Walcott, der sich in einer ganz originellen Weise auf Homer bezieht und sich doch am Anfang einer neuen Epoche sieht. In Hartungs Konservatismus zeigt sich also – nach der Moderne – etwas Neues und etwas zugleich sehr Altes: die fortbestehende Kraft des geformten Wortes, das sich in die Überlieferung eines millenairen Gesanges einbezogen weiß.
Freilich werden – wie schon angedeutet – auch andere Lyriker, die zu dieser spezifisch abendländischen Tradition gar keinen Bezug haben, vorgestellt. Auch hier wählt Hartung eigenwillig aus: Denn eines jedenfalls verbindet alle vorgestellten Lyriker: Die starke Reflexion auf die Form, die ja immer auch Nähe zur Tradition – und zugleich eine gewisse Strenge – bedeutet. So gelingt es Hartung, selbst einen Dichter der experimentellen Poesie wie Helmut Heißenbüttel, der mit dem Schmuckwort „Avantgardismus nach Rezept“ versehen wird, auf grund seiner Liebe zur Form, in den Rahmen der Tradition zurückzuholen.
Die Internationalität der Auswahl kann zum Schluß nur kurz angedeutet werden.: Außer den schon erwähnten werden u.a. Gottfried Benn, Giuseppe Ungaretti, Paul Celan, Joseph Brodsky von den allgemein bekannten Lyrikern vorgestellt. Aber auch uns weniger geläufige Namen wie der Engländer David Jones, der Schwede Gunnar Ekelöf oder die Dänin Inger Christensen finden Berücksichtigung. Der letzte Beitrag mit dem Titel „Im Schatten der Shoa“ widmet sich drei Lyrikern Israels. Über die Zukunft der Lyrik macht sich Hartung keine Sorgen. Dafür bietet ihm auch Joseph Brodsky – neben Seamus Heaney und Derek Walcott der dritte Nobelpreisträger, der in diesem Essayband vorgestellt wird – Gewähr für den die Poesie „Die Essenz der Kultur der Welt“ darstellt. Auch wenn Hartungs Anspruch bescheidener ist – aber vielleicht hätte Brodsky ohne seinen Glauben an die Poesie den Gulag nicht überlebt – weiß er selbst doch genau:
Poesie – oft verspottet, oft totgesagt – ist zäh und buchstäblich nicht totzukriegen.
Denn trotz seines auffälligen Konservativismus in Bezug auf die Form und die Neubewertung der Tradition ist ihm bewußt – und das hat er schon mit seiner Anthologie unter Beweis gestellt – daß die Welt poetisch von den Rändern zusammengehalten wird, und immer weniger vom Zentrum: Homer wird in der Karibik neu geboren.
Georg Doerr, Hessischer Rundfunk
Harald Hartung, Dichter, Übersetzer, Dozent,
legt eine Studie zur modernen Lyrik vor. Entgegen Hugo Friedrichs Standardwerk Struktur der modernen Lyrik zeigt Hartung 40 Jahre später, dass das Ziel der Poesie im 20. Jh. nicht das hermetische, absolute Gedicht sein konnte. Zu vielfältig sind die neueren experimentellen Formen, die Alltagsgedichte, die Speech-Performances, die Agitprop etc. Überzeugend legt Hartung dar, dass Lyrik, trotz aller Unkenrufe, gerade unserer Zeit entspricht. Sie regeneriert sich heute nicht nur aus dem Fundus ihrer reichen Formentradition, sondern auch durch ihre Offenheit für aussereuropäische Kulturen, für die „Poesie der Ränder“, durch ihre grundlegende Wandelbarkeit, Vielstimmigkeit, ihr „utopisches Potential“. Der lebendig geschriebenen Einführung lässt Hartung über 20 Einzeldarstellungen folgen, die einen weiten weltliterarischen Bogen spannen.
Florian Vetsch, carbe librum
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Thomas Krüger: Masken und Stimmen. Harald Hartungs Essays zur modernen Lyrik
Merkur, Heft 578, Mai 1997
Am 12.2.2013 sprach Harald Hartung mit Jan Wagner in der Literaturwerkstatt Berlin in der Reihe Klassiker der Gegenwartslyrik über sein Werk.
Am 2.2.2006 las Harald Hartung im Literarischen Colloquium Berlin und sprach mit Jan Wagner über sein Werk.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Langsamer Träumer
Stuttgarter Zeitung, 29.10.2002
Walter Helmut Fritz: Das Ziel kommt zu dir
Badische Zeitung, 29.10.2002
Jörg Plath: Ruhe unterm Riesensegel
Der Tagesspiegel, 29.10.2002
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Felicitas von Lovenberg: Von Wurzeln und Flügeln
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.10.2012
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Andreas Platthaus: Bei ihm müssen es keine Fixierungen sein
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2022
Hannes Krauss: Harald Hartung schreibt Gedichte, um verstanden zu werden
Westfälische Rundschau, 29.1.2022
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IZA + KLG + Antrittsrede + Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Merck-Preis
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Harald Hartung: FAZ ✝︎ SZ ✝︎ FR


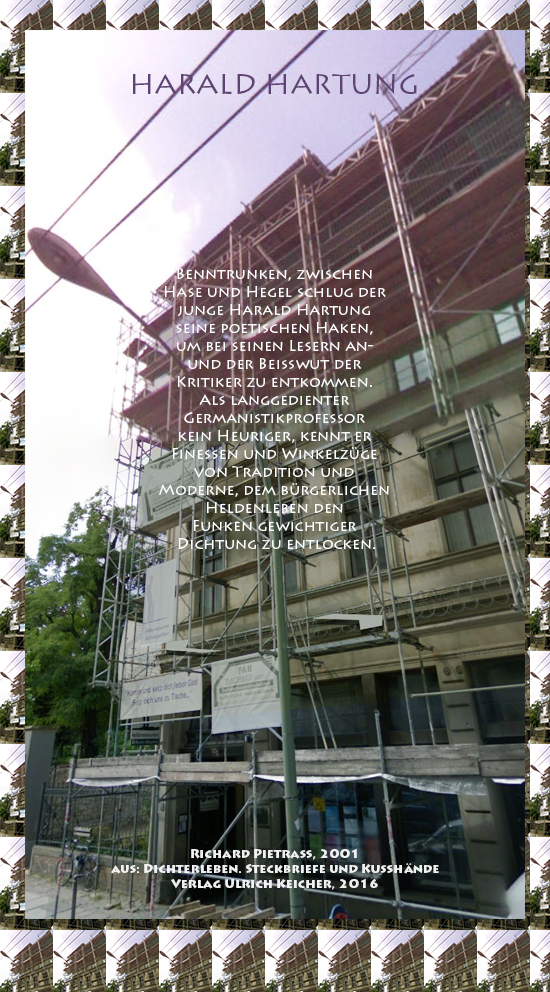












0 Kommentare