WENN DU ES WISSEN WOLLTEST
Es scheint, das eis hat sich bewegt.
Jan Skácel, letzter brief vor seinem tod
am 7. november 1989
Das eis, mein lieber, ist geborsten
Doch wenn du wissen wolltest,
was aus uns geworden ist,
wenn es möglich wäre, daß du’s wissen wolltest,
würde ich dir raten:
frag nicht
Die menschen meiden die stille
Sie können in sich sonst
die schuld knien hören
![]()
Inhalt
Von der vertrauten sprachlichen Sicherheit und Lakonie abgesehen, wirkt dieser Gedichtband Kunzes im Vergleich mit seinen früheren Bänden völlig neuartig: Ob im Erleben von heimatlicher oder exotischer Welt, von Natur und Kunst, von Geschichte und politischer Gegenwart – im Licht der poetischen Bilder, zu denen Kunze gefunden hat, gewinnt das einfachste Wort an neuer Aussagekraft, und die Nähte zwischen Bild und Begriff, Wahrnehmung und Diskurs, Ernst und Heiterkeit sind unsichtbar geworden. Diese Gedichte sind noch intensiver und sinnlicher in der Wahrnehmung und zugleich stärker in der Distanz, die nach Simone Weil die Seele des Schönen ist. Es gibt in keinem der bisherigen Bände so viele Verse, an deren Ende „Schiffe ankern“, die über den Rand der Welt hinausführen. Der Zyklus „ein tag auf dieser erde“, der dem Band den Namen gibt, dürfte das Äußerste an Genauigkeit in der Beobachtung von Landschaft, Tieren und Pflanzen und an meditativer Versenkung sein.
Während Reiner Kunze seinen Gedichtband für Kinder Wohin der Schlaf sich schlafen legt (1991), das Tagebuch eines Jahres Am Sonnenhang (1993) oder den Notizen- und Bildband Steine und Lieder (1996) schrieb, sind in ihm die Gedichte gereift, deren Kennzeichen das absolut autonome Bild ist. Thematisch reichen die Gedichte vom „ortfühligen“ Schweigen in Kunzes Haus an der Donau bis zum Denkmal der Aufstände in Posen, von der geschleiften deutschen Mauer bis zu Vladimir Horowitz, der in Wien zum letzten Mal Mozart spielt, und vom Krankenbett des Tierbildhauers Heinz Theuerjahr bis zum Vanitasbild, das mit dem Mond, dem „beinernen Schädel“, aus der Nacht tritt.
S. Fischer Verlag, Ankündigung
Sitzen, Schauen, Sinnen
Nein, nein! So neu ist der neue Kunze nicht! Wie immer will der Dichter Reiner Kunze das einfache Wort. Wie immer will er die eindeutige Antwort. Wie immer ist er auf die Frage und die Antwort aus, die in jedem Wort-Sinn steckt. Das einfache Wort für die eindeutige Antwort findet er, wenn, dann „Abseits … / von den wühltischen der sprache“. Das bedeutet für ihn, weiter die von ihm beschrittenen „sensiblen wege“ zu gehen. Das sind die Wege, die den Dichter dahin und dazu bringen, so schlichte Formulierungen wie „Die Brennessel sticht“ ins Poetische zu übersetzen. Aus der schlichten Formulierung wird bei Kunze das Sinn-Bild: „Die mannshohe nessel / brennt dir ein / daß du lebst.“ Das ist so persönlich wie allgemein gesagt und zudem allgemeinverständlich. Also einfach, eindeutig, einprägsam. Vielleicht ist das Neue in den Gedichten des Mittsechzigers – ein tag auf dieser erde –, daß er nie so entschieden, so direkt im Persönlichen wie Allgemeinen war und nie von solcher Allgemeinverständlichkeit.
Reiner Kunze setzt seine lyrische Linie fort, an deren Rand er immer wieder die erreichte Position des Poeten markiert. Er schreibt „… den dichter richtet / das gedicht“. „Das gedicht / ist der blindenstock des dichters.“ „Wort ist währung / je wahrer / desto härter.“ Die Worte des Dichters auf den Dichter gemünzt, ist er sich sicherer denn je, daß er das richtende Urteil seiner Gedichte akzeptieren kann. Sicher, daß ihn der Blindenstock, daß er den Blindenstock gut führt. Sicher, daß seine Wortwährung derzeit zu den härtesten der deutschen Gegenwartssprache gehört.
Mit der Geduld des Anglers sitzt der Autor am Fluß des Lebens. Längst ist er nicht mehr auf jeden Fang versessen. Er kennt den Gewinn, der im Sitzen und Schauen und Sinnen ist. Er weiß um den Wert der Stille. Kunze holt Worte aus der Stille. Stille ist ein Wort, das Kunze liebt. An stillen Orten entdeckt sich der Dichter Kontinente, sieht er seine Horizonte. Oft machen zwei Gedichtzeilen den Gipfelpunkt eines Gedichts. Sentenzen stehen in Kunzes Gedichten nicht plötzlich wie unbezwingbare Felsmassive vor dem Leser. Der Lyriker lotst die Leser hinauf auf die Höhen. Angekommen, ist – fast immer – das Erstaunen groß, derart leichtfüßig derart hoch hinaufgekommen zu sein. Was nun wirklich nicht bedeutet, daß sich der Poet zum fröhlich pfeifenden Pfadführer entwickelte. Sich Kunzes Versen anzuvertrauen heißt auch weiterhin, einem Skeptiker zu vertrauen, der sich Sicherheit in und mit der Sprache gewinnt. Wenn Visionär, dann der, der nicht – oder verhalten! – auf das Prinzip Hoffnung baut. Der Lyriker glaubt, „daß der mond / das vorweggenommene antlitz ist / der erde“. Womit nicht angedeutet ist, daß destruktives Denken Kunzes Dichtung beherrscht und bestimmt. Selbst unverhohlene Wehmut, wahrhaftige Melancholie machen die Gedichte des auch heiteren Skeptikers nicht geringer. Wehmut, Melancholie, Skepsis sind Stärken des Dichters. In seiner Stärke zeigt sich Reiner Kunze so stark wie nie zuvor. Der Lyriker, so scheint das nicht nur, hat seinen inneren Frieden mit seiner inneren Natur gemacht. Mit seinem Leben, das Teil des Lebens der Natur ist. Eine Tatsache, die den Dichter feststellen läßt: „Wesen bist du unter wesen.“ Das ist es! Ist alles. Ist das Wesentliche. Ist das Göttliche. Für Reiner Kunze. Der ermöglicht sich eine Annäherung an das Ewige, die Verbindung mit der Ewigkeit. „Wesen bist du unter wesen“, das ist die Wahrheit der Wahrheiten für den Dichter. Sich der Wahrheit zu beugen bedeutet nicht, sich in Demut zu beugen. Bedeutet Verbeugung in Dankbarkeit. Die fern ist von dumpfer, drückender, duckender Demütigung. Warum nicht aufrichtig einem Dichter wie Reiner Kunze dafür dankbar sein, daß seine Gedichte so dankbar machen? Für das Leben. Das Leben, das uns hat. Das wir haben. Das Leben, wie es ist. Einen Nachmittag und noch einen Nachmittag die neuen Gedichte des Reiner Kunze gelesen, wächst die Freude von Tag zu Tag. Die Freude an und mit der Familie. An und mit den Freunden. Am Sitzen im Garten und auf dem Balkon. Am Liegen im Bett. Soviel Freude ist selten. Alles ist von Wert. Alles hat seinen Wert. Alles hat einen Wert. Wie jeder Tag auf dieser Erde. Wie das Buch ein tag auf dieser erde.
Bernd Heimberger, Berliner LeseZeichen, Heft 4, 1999
Von einer tiefen Lebensfreude
Wir schlafen, die wange am fluß,
an der unbeirrbarkeit des wassers.
Doch immer öfter liegen wir wach,
um halt zu finden an der stille.
Abseits der wörter,
von den wühltischen der sprache.
Vor dem haus, in der astgabel der eibe,
brütete die amsel unhörbar gesang aus.
Und die glocke von Pyrawang jenseits des stroms,
bucht ab von der zeit.
Schon im Eingangsgedicht „In Erlau, wortfühlig“ hat der Schriftsteller Reiner Kunze die wesentlichen Motive seines neuen Lyrikbandes angeschlagen: Die Neuentdeckung der Natur, das spannungsreiche Verhältnis von Distanz und Nähe zum aufgeregt-banalen Alltag, die Ahnung der eigenen Endlichkeit. Und das Aufbäumen gegen Resignation. Schimmerte früher aus den Gedichten des jetzt 65jährigen verhaltene Bitterkeit durch, ist heute heitere Gelassenheit spürbar. Es ist zusätzlich reizvoll, sie auch als Gegenentwurf zur späteren Lyrik Heiner Müllers lesen, der in der Gegenwart keinen Ideenvorrat mehr vorfand und dem eben dazu nichts mehr einfiel: „Das letzte Programm ist die Erfindung des Schweigens“. Kunzes Gedichte sind Versuche, dieses Verstummen zu überwinden.
Der wichtigste Grund der ungewohnten Leichtigkeit sind wohl die Umbrüche von 1989/90. In den siebziger Jahren hatte Kunze mit den Wunderbaren Jahren (1976), diesen scharf gestochenen Prosa-Miniaturen über die DDR, die denkbar schärfste Absage an den „realexistierenden Sozialismus“ formuliert, die bei der SED-Führung einen Veitstanz auslöste und ihm auch von vermeintlich fortschrittlichen Kräften im Westen übelgenommen wurde – bis heute übrigens. Die erlittenen Verwundungen sind noch da, außerdem ist Kunze einer, der sich selbst am wenigsten schont und selbstkritisch zurückblickt: „Unsere trauer? / Daß wir hatten sein können, / wie wir einmal waren –“. Doch so wichtig das alles ist, es steht nicht mehr im Zentrum. „Die zeit ist schon zu kurz, den mut zu verlieren“.
Die neuen Gedichte handeln von süddeutschen Landschaften und Städten, von Orten in Osteuropa, in Asien und Afrika, von Konzerten, Abschieden und, in all dem, von einer tiefen Lebensfreude. Kunze weiß (und schreibt), daß es wieder die ewigen Opportunisten sind, die in der postsozialistischen Ära an den Schaltstellen von Macht und Wohlstand stehen, und nicht diejenigen, die den Diktaturen widerstanden haben. Trotzdem sieht er letztere als die eigentlichen Gewinner. „Für die existenz der poesie / die existenz riskieren“, heißt es im Gedicht „Dichterverleger“ über ein Leben in der Wahrheit unter der Diktatur, das dem Posener Lyriker und Celan-Übersetzer Ryszard Krynicki gilt. Und wenn er dem Leipziger Publizisten Horst Drescher die Verse widmet: „Und sonst: poesie ist außer wahrheit, / vor allem poesie“, dann leuchtet in der Differenz zwischen den Erfahrungshorizonten beider Gedichte der ganze reale Zugewinn an politischer, persönlicher und geistiger Freiheit nach 1989 auf.
Dem tschechischen Lyriker Jan Skácel (1922–1989), dem er bereits im Gedichtband Sensible Wege (1969) gehuldigt hatte, ruft er, Hölderlin-Verse gegen den Strich bürstend, in seinem Grabspruch nach: „Woher aber nimmst du / den schatten dort?“ Die Frage richtet er auch an die Lebenden, voller Sorge, sie könnten sich künftig, im Vollgefühl der Leichtigkeit des Seins, mit einer Literatur von den erwähnten „Wühltischen der Sprache“ begnügen, die jeden Gedanken an Untiefen und Gefährdung der menschlichen Existenz verdrängt. Nichts hat Kunze von seiner scharfsinnigen Dialektik eingebüßt oder zurückgenommen.
So viele antworten gibt’s,
doch wir wissen nicht zu fragen
In Bonmots wie diesem fällt anhaltende Lust an der Erkenntnis mit gleichzeitiger Erkenntnisskepsis zusammen, die aus Lebenserfahrung und biographischen Brüchen herrührt.
Der baum, ein schräges segel,
wirft den schatten sich
als boot
Das ist fein beobachtet und greift zugleich die Eröffnungsverse der Buckower Elegien auf, in denen Brecht die Bewegung als Möglichkeit andeutete, um ihre Abwesenheit in der gesellschaftlichen Realität zu beklagen. Für Kunze ist die Realität selber zu einem Gewebe aus Metaphern geworden, die sich überdies nur als Schatten mitteilen und sich der Begrifflichkeit großangelegter Kausalerklärungen und Fortschrittsutopien á la Brecht entziehen. Diese dreifache Bescheidenheit macht ihn frei, die Erscheinungen der Welt erneut in ihrer Vielfarbigkeit wahrzunehmen:
Nur daß du hängst am schönen
und weißt, du mußt
davon
So erfüllt sich in Kunzes Lyrik der als Motto gewählte Satz von Camus: „Ein Geborenwerden und ein Sterben und dazwischen die Schönheit und die Schwermut.“
Kunze vermag seine Gedanken prägnant zu verknappen und zugleich vielfarbig funkeln zu lassen. Natur ist ihm Metapher und Erfahrungsraum, in dem Menschlich-Allzumenschliches aufgehoben und transzendiert wird:
Unterm dach, fast
haut an haut mit dem himmel.
Das universum
dringt durch die poren
Es gibt Schlüsselwörter, die immer wieder auftauchen und die Gedichte miteinander verknüpfen:
Als bete der bach in den wiesen
so viele buchten hat er ausgekniet
So bietet die Natur ein Lehrstück für die moralische Bewährung in der Gegenwart, denn:
Die menschen meiden die stille.
Sie könnten in sich sonst,
die schuld knien hören
In einem dritten Gedicht signalisiert eine vorbeihuschende Bachforelle, daß diese Bewährung die Chance auf existentielle Erfüllung eröffnet:
Du möchtest niederknien,
die unwiederbringlich verlorene nadel zu suchen
Schönheit und Schwermut, wie gesagt, erfüllen Kunzes Gedichte. Und eine bisher nicht gekannte Sinnlichkeit. „Auf der weichselpromenade / das glockenspiel der kurzen röcke“ – spätestens in diesen Versen wird aus der Kunzetypischen Sprödigkeit Musik. Eine Musik, die der Dichter durch das Brechen von Zeilen und Rhythmen immer wieder dissoniert, als fürchte er falsche Harmonien.
Der von der deutschen Gegenwartsliteratur geforderte, bisweilen auch mit Aplomp behauptete Bruch in der künstlerischen Wahrnehmung hat sich in Kunzes Gedichten gleichsam beiläufig vollzogen und ein neues Staunen über die Wunder ermöglicht, die im Alltag präsent sind. Für den Leser, übrigens, gehören zu diesen Wundern auch einige der neuen Gedichte Reiner Kunzes.
Doris Neujahr, jungefreiheit.de, 12.3.1999
Kunzes tag auf dieser erde
Die nachzustotternde Welt,
bei der ich zu Gast
gewesen sein werde…
(Paul Celan)
Reiner Kunzes „Tag“ auf dieser Erde währt inzwischen bereits an die siebzig Jahr. Sein Gedichtband dieses Titels erschien 1998, also vor fünf Jahren und zu seinem 65. Geburtstag.
Wohl wissend, daß es ein „Ruhealter“ für einen Dichter nicht gibt und daß ihn die Tummelplätze einer bürgerlichen Rentnerzunft nie werden locken können, ist ihm die Fünfundsechzig dennoch offenbar eine suggestive Zäsur gewesen. Man spürt, wie da Zeit rinnt, Abschied weht, Melancholia tropft, Alter winkt, Zweisamkeit teurer wird, der Tag sich endgültig neigt – vielleicht ein Zuschlag noch, der aber zusammenzucken läßt wie in der Mär den Tausendfüßler, zumindest kurzzeitig ein Stocken und Stolpern bewirkt, bevor – nunmehr für den Rest des Lebens vielleicht leicht irritiert – wieder Schritt aufgenommen werden kann. Leiser, vorgewarnt vielleicht. Mehr Besinnen vielleicht, ein tiefer, wägender Blick zurück vielleicht, der ungewisse ins Voraus vielleicht: Woher und wo bin ich wie angekommen auf dieser Eintagefahrt. Rasch noch einen „Radwechsel“ vielleicht, letzte wichtige Korrektur vielleicht vorm Einlauf in die Zielgerade. Kurzes Luftholen und eilige Zwischenbilanz, vielleicht, mit Befragung über seine bisherige Zuständigkeit im Tagverlauf. Vielleicht. Doch noch das „weiße Gedicht“ finden, in dem alle Farben des Regenbogens gebrochen sind. Vielleicht.
Genug. Ein Dichter Reiner Kunze, bis dato uns offiziell- und „inoffiziell“ selbst noch unterm DECKNAMEN „LYRIK“ – bekannt, offeriert uns mit seinem Gedichtband EIN TAG AUF DIESER ERDE eine Menge Selbstauskunft über seine Ankunft am Abend, der sich bei der Lektüre jedoch sofort nur als fragile Übergangszeit gibt; denn je näher ihm der Himmel nun rückt – „zwischen himmel und hölle / der weg, (schon – E. K.) ausgetreten“ –, umso drängender schiebt der sich – „haut anhaut“ – ins Bild: „… der himmel sei ein schlachtfeld“, läßt er Marian Nakitsch, den Dichter vom Balkan, sagen, und „friedhöfe lägen am himmel, so viele / schwärme von kreuzen“. Da ist sofort unser geschundener Orbis ganz konkret in seinem Abend-Bild. Früher einmal hat Kunze Eichendorffs Erkenntnis zitiert, daß der Dichter nicht den Himmel zu zeigen habe, sondern allenfalls die Leiter dahin. Doch er richtet nun bang seine Blicke hinauf und beobachtet die Sphäre überm Erlauer Karpfenteich bis hin nach Windhoek und Kioto. Gern ließe er aufheiternd heiter und „über und über / mit licht“ „das blau der fahnen“ flattern, denn Lichtbringer wolle er trotz allem sein, aber die Verse fügten sich nun einmal nicht immer so.
Denn Kunze fühlt als „wortfühliger“, dem die übliche Worteflut voller Untiefen und Seichtwasser steckt. Er steht mit seinen „watestiefeln“ am Weiher und wirft, Verse-Angler, die unendlich biegsame Rute aus. Denn nie könne er seine Worte von den „wühltischen der sprache“ fischen, nein, was in ihm den Dichter ausmache, passiere so:
Eines Morgens wecke ihn ein Amselruf. Da breche er, Rutengänger und Wortefischer, auf, einen Vers zu fangen, vielleicht einen, „mit dem der fluß flucht, wenn er so über die steine / nachts, im dunkeln, stolpert“. Hat der Dichter nun Glück und endlich ein Wort an der Angel, dann stößt er damit vielleicht eine ganze Schleuse auf, aus der es dann vielleicht – auf wunderbare Weise vom Wort zur Metapher changierend – poetisch strömt und es sich zugleich wie Nacht und Nebel sacht auf die ansonsten strichweis taube Asphaltwelt senkt. Kunstraum wird betreten, die Staunewelt der Poesie. Der Dichter der Erste Staunende vom poetischen Dienst. Das Bild vom Worte-Angler taucht bei Kunze indes schon vor drei Jahrzehnten auf. Damals – es mag um 1974 gewesen sein, der Dichter also schon auf dem Index und vom Thüringer Schriftstellerverband bereits mit Ausschluß bedroht – trug er im Gohliser Schlößchen seine elf Thesen vom „Angler und Dichter“ vor:
1. Dichter und Angler gehen verborgenen Geheimnissen nach; dieser dem Fisch, jener dem Vers.
5. Dichter und Angler müssen früh aufstehn.
6. Dichter und Angler müssen warten können.
8. Der geangelte Fisch stirbt (…), der Vers aber beginnt zu leben (…).
10. Der Fisch ist stumm. Der Vers spricht. Deshalb bereitet das Dichten mehr Ärger als das Angeln.
Und die Rede ist von „Schonzeiten“ und „verbotenen Gewässern“.
Oder neuerdings ein anderes Kunzesches Schreibe-Bild: wie da der Dichter ein Verseschiff – wer denkt da nicht an Sebastian Brants NARRENSCHYFF auch? – takelt und dabei ins Staunen gerät
über den eigenen einfall,
der ihm, ein nicht gewußtes ufer mit dem seinigen verknüpfend,
einen kontinent entdeckte
Wie da im närrisch kontaminierten Kopf ozeanweis ungeahnte Welten sich einstellen! Der Dichter-Entdecker auf großer Erkundungsfahrt nach unbekannten Ufern
Oder einen weg
über den weltrand hinaus
Alle bislang be- und erfahrene Welt stellt sich also als zu klein heraus angesichts der großen Metaphernabenteuer,
und am ende ihrer straßen
ankern noch immer schiffe
Und wie dann das Gemetapher phantastisch heckt, und wie immer neue und unergründliche Kosmen sich auftun!
Wie am ende großer verse
Nicht zu begrenzen oder gar zu dämmen das wuchernde Phantasiegeblüh! Da fühlt sich der Dichter als des großen Welt-Entdeckers Vasco da Gamas direkter Nachfahr: Wie da ein bislang weißer Kontinent auf dem Weiß des Blattes Kontur gewinnt! Und so empfindet sich der Dichter Kunze in seinem poetologischen Text auch selbst als DA GAMAS NACHFAHR.
Der Dichter weiß, daß es Alltagssprache mit dem Wort bis zur totalen VerantWORTungslosigkeit treiben kann. Denn der Rohstoff Wort ist zunächst nicht mehr als ein Angebot, ein undifferenziertes Konglomerat, das eines Tags jedoch gehörig auf der Seele lasten kann. Da lernt man dann vielleicht das Schweigen und die Stille lieben – wie die Stille zwischen Koi und Koi in einem Karpfenteich (da lauert schon wieder eine Dichter-Angler-Analogie!), eine Stille, die dennoch alles Lebensnötige mitzuteilen vermag. Warum aber, fragt der Dichter, meiden die Menschen solche Stille? Und er mutmaßt: „Sie könnten sonst / die schuld knien hören“. Man beachte, wie da das Angelwort „Schuld“ synästhetisch verbunden wird mit Hellhörigkeit: „knien hören“!
Von Fischen ist bei Kunze indes nach wie vor und offenbar immer öfter die Rede (2002 hat er darüber mit DER KUSS DER KOI ein bibliophiles, poetisches und bildprächtiges Buch herausgebracht, entstanden „aus der Melancholie glückseliger Augenblicke“, wie er sagt, ein „Gegen-Buch, ein Buch gegen das Tonangeben des Häßlichen, des Ekelhaften, des Brutalen“. Fast ist man versucht, von des Dichters Flucht in eine Schweigewelt oder zumindest Scheinwelt des Schönen und Guten zu sprechen, in die selige Sehnsucht nach Idyll und Eden, einer Insel der heiligen Kalokagathia mit Reinheitsgebot, einem Animamismus pur, dafür Realitätsverlust in Kauf nehmend. Ists gar der weisheitsverklärte Versuch, das schnöde Gemeine mittels Eutopie zu überlisten? Das Harmonieverlangen in dieser ständig kollidierenden Welt( un)ordnung auf den Nenner „Heiterkeit und Stille“ einpegeln zu wollen? Ists Sehnsucht nach endlichem Beisichsein? Fortschreibung des Paradiesgedankens? Fort mit allem Bösen, Miserablen und dem „Grinsen“ des Lebens! Her mit dem Elysium und seiner „freundlichen Unschuld“!
Vor seinen hochbegnadeten und tiefbeseelten Koi breitet er jedoch auch aus, „was kaum noch zu ertragen ist, und ihr Koi streicht durch, streicht durch, streicht durch.“ Denn wie vieles an diesem Leben – und damit geht Kunze auch aus seinem Buch EIN TAG AUF DIESER ERDE – ist nichts als Eitelkeit, Vanitas, angesichts des „beinernen schädels“, den Nacht für Nacht die Sonne bleicht, „das vorweggenommene antlitz der erde“ und des seinen. Gefragt, wie er denn lebe, kommt dann die Antwort: „Wand an wand / mit der kreuzotter“, und dazu die Gewißheit: „Niemals wird es uns gelingen, die welt / zu enthassen“. Wie gern würde sich Kunze da zu seinen „stummen kleinodien“ (102), den bunten Koi, in die Unterwasserwelt flüchten und „die Überwasserwelt die Welt sein lassen über Wasser“.
Doch „vieles in uns / ist älter als wir“, und gottgebs, daß „am ende uns nicht reue heimsucht / über die nicht geliebte liebe“. Auch deshalb könne, wer auf die Siebzig zugehe, gar nicht genug unnötig gestapeltes Papier entsorgen. Wieviel Geworte, auch in falscher Münze und Währung, hat sich da angesammelt! Wie oft habe man sich von einer Begeisterung zu Falschmünzerei begeistern lassen.
Vor allem in der Jugend. Dabei war das, wofür ich mich begeisterte, die Begeisterung nicht immer wert, und unter Umständen war ich schuldhaft…
Da ists wieder, das Angelwort „Schuld“, Schuld, die man „knien hören“ könne. Und sie schwärt wie ein reifer Karfunkel tief im Innern und kann Heilung nimmer finden, ist wohl eingewachsen selbst „in den himmel“. Denn „sie hatten uns geformt / nach ihrem bild // Bis wir uns erblickten / in verbotenen spiegeln“. Aus solch lastender Selbsterkenntnis resultiert schließlich die Gewißheit, daß einer, der seine Verführbarkeit bitter erfahren hat, für den Rest seines Lebens Verführungen besser zu erkennen weiß als einer, der diesbezügliche Zweifel nicht kennt.
Zudem ahnt der Dichter: Jedes Gedicht kann ihn richten. Denn alles Geschriebene ist Existentes und auch ideologisch deutbar, und das „Nur-Ästhetische“ könne sich erst recht als „Zu-Richtung“ erweisen, so ähnlich hatte es der DDR-erfahrene und -gebrannte Reiner Kunze in seiner Münchner Poetik-Vorlesung formuliert. Da wußte er längst um die lebensbedrohliche „Konsequenz Leben“ in einer geschlossenen, umminten und belauerten Gesellschaft.
Dennoch der Triumph: „Wenn da die Worte-Angel nicht wär, das Gedichte, mit dem man sich eine Welt zumindest zurecht denken könne, auch zu neuen Küsten gelangen, unbekannte Gestade betreten mit ihren „steilen worthängen“, aus deren Steinbrüchen der Dichter nun seine Worte brechen könne für neuerlichen Sprechversuch, dabei immer im Sinn so Kunze in seinem programmatischen Text POETIK –, daß letzten Endes „Das gedicht / … der blindenstock des dichters (zu sein habe) // Mit ihm berührt er die dinge / um sie zu erkennen“. Was doch heißen soll: um sich in den Dingen zu erkennen.
Freilich: Alle Kunst sei „hoffart“ auch. Dabei ist „Hoffart“ raffinierterweise ein mindestens dreidimensioniertes Wortspiel:
(1) Kunst sei ein hoffärtiges/arrogantes Unternehmen, der Künstler selbsternannter, anmaßender Schöpfer, denn „keiner ahmt gott nach / wie er“, also der Dichter als Kreator neuer Welten, auch Gegen-Welten; aber
(2) Kunst sei auch eine Hoff-Art, eine Art/Kunst des Hoffens, auf Hoffnung hin orientiert, die eine „Himmelsleiter“ möglich macht; aber
(3) Kunst sei auch eine „hofart“, die als Hof-Art bei Hofe gar artig zu Tische zu schmarotzen vermag.
Mit solchem hintersinnigen Wissen kommt uns Kunze in seinem total unodischen DICHTERTRINKSPRUCH:
Zu einem großen wein
führt nie ein kurzer weg
Auch genuß
kann das bewußtsein schärfen
Nicht der wein, der einfall reißt zurück
vom abgrund
Die langlange Odyssee des Gedichts aus den urtiefen Lebens(ur)wäldern und den immer wieder verstutzten Rebenfeldern heraus in eine dionysische Trunkenheit mit dem Doppel- und Mehrfachblick, aber immer nah dem Absturz in einen der verschiedenen Feuerschlünde. Das Grausen eines Empedokles also am Kreuzweg zwischen Himmel und Hölle. Dabei die vage Hoffnung, den „fingerabdruck des himmels“ nicht zu versäumen. Denn er, Kunze, sei immer zugleich – im Gleichsinne mit Rilke und Celan – des Wunders und eineinmaligen Glücks teilhaftig und gewärtig, auf dieser Welt lediglich zu Gast sein zu dürfen. Und das – so fügt er hinzu – „noch arm in arm“ mit einem „du bist!“, also jenem „blauen Komma“ Elisabeth, das seiner Welt erst Sinn gibt.
Da sind wir vollends eingetreten in Kunzes nunmehr immer enger werdenden Circulus melancholicus „zwischen Schönheit und Schwermut“ (Camus).
In kühner Collage, indem ich die hochpoetischen Sentenzen des Dichters einfach respektlos addiere, will ich versuchen in sträflicher Kürze auf das rotierende und zugeich gravierende Phänomen des zunehmenden Alterns in seinen Texten einzugehen. Solche ungehörige Addition sei gestattet, weil sie vielleicht auf seltsam versimpelnde und verfremdende Weise die hochemotionalisierten Aussagen des Autors zu einem schockierenden Kurz-Schluß zu führen vermag.
Lesen wir also nacheinander jene von mir des Poetischen entfleischten Lebensfazite, zu deren Besinnlichung und Besinnung Kunze das nahe Tag-Ende, „diese paar Jahre“ noch, aufgeboten hat: denn
– „Das jahr ist abgeblüht“,
– „Im Teich beginnt’s / heraufzuschnein // Lautlos // Wie in uns, wenn wir ergrauen“,
– „Bei meinem weißen haar / und bei deinem: // Die zeit ist schon kurz…“
– und „bucht“ sich unaufhaltsam ab.
– Und der Sternenhimmel gerät Kunze dabei zunehmend zur „lederhaut“,
– „immer öfter liegen wir wach, / um halt zu finden an der stille“, und „Das universum / dringt durch die poren“.
– Und selbst „Noch arm in arm / entfernen wir uns voneinander // Bis eines wintertags / auf dem ärmel des einen / nur schnee sein wird“,
– und aus der Nacht dann tritt „das vanitasbild“.
Wer Reiner Kunze erlebt hat, wie er seine Gedichte vorträgt – Wort für Wort wägend, jedes gleichsam probeweis, aber eindringlich in den Raum stellend, dem Hörer Bedenkzeit einräumend und dann auf Reflexe wartend, einen Vers vorsorglich auch wiederholend, damit er auch in allen seinen Teilen erwogen werden könne, bevor er zum nächsten Vers ausholt – der kann nicht anders, als – freilich mit zeitlupenartiger Verschiebung – seine Texte lesend auch derart zu intonieren. Denn Kunze praktiziert einen konsequenten Minimalismus, der das Ergebnis zugespitzter sinnlicher Konzentration, sprachlicher Komprimierung und strenger bildlicher Fokussierung ist.
Am Ende die nach Maß gemeißelte Bild-Formel.
Oder Worte, verschliffen wie Gemmen und in adäquate Fassung gebracht, dennoch keines „käuflich“.
Oder Worte zurechtgewogen nach Gran und Gramm und daher gewichtig jedes, während sich von Wort zu Wort lebenlanger Erkenntnisweg windet. Oder: Da macht ein Sprachmagier lustvoll sein Spiel mit Sprach:
Hinterm wald, vor den wäldern,
in den wiesen die Wies
Verse, die es in sich haben. Wie das jambt und dithyrambt, elementar und raffiniert, streng freirhythmisch daherkommt, lieblicher Zungenbrecher fast (man beachte die eben von mir verwendeten Oxymora, meine in sich selbst widersprüchlichen Redefiguren zur Charakterisierung der Kunzeschen Paradox-Rhetorik!). Das Kunzesche Wortspiel, das Onomatopoesie (Laut- und Klangmalerei), Klimax (Steigerung der Aussage), Paranomasie (Vorliebe für ähnliche Wörter) und Figura Etymologica (Verwendung sinngleicher Wörter) einschließt, erweist sich sprachlich als außerordentlich kunstvolle Kompositionsform. Zu solch scheinbar zwangloser elliptischer Konzentration sprachlicher Mittel auf derart engem Raum kann nur kommen, wer über ein Sprachgespür par excellence verfügt. Am Ende ist Verdichtung Versdichtung bis zur Ausschließlichkeit. Dabei bleibe noch unerwähnt, wie sich in unserem Beispielfalle „wald“ und „wiesen“, vor allem „die Wies“ und selbst noch „hinterm“ und „vor“ metaphorisch zu freiem, weitem Flug zu erheben vermögen.
Aus lediglich vier Zeilen besteht ein LIED:
Als bete der bach in den wiesen,
so viele buchten hat er ausgekniet
Das jahr ist abgeblüht
Am pappelwehr staut sich der wind
Bach, Wiese, Wind, dazu Wald und Wolke haben bereits zum Vokabular des 25-jährigen Dichters gehört. Doch wie hat sich seither ihr Bedeutungshorizont geweitet!
Wie auch der konzentrierte Einsatz poetischer Mittel: des Vergleichs, der Personifikation, der alliterativen Lauthäufung, der Assonanz, der Wechsel von stumpfen, vollen und klingenden Kadenzen; das gleitende Spiel mit dreihebigem Versmaß, das in der Schlußzeile nahezu volksliedhaft auf einen Knittelvers kommt.
Seit den sechziger Jahren benutzt Kunze die Kleinschreibung, weil es für ihn keine Haupt- und Nebenwörter mehr gibt (ausgenommen sind Satzanfang und Eigennamen) und eine gemäßigte Interpunktion. Die Überschriften bilden zuweilen relativ ausführliche Kommentare zu den knappen Texten, etwa bei WIE YO YO MA MIT DEM CELLO BIS ZUR ANKUNFT DER PANNENHILFE AUF DER AUTOBAHN DIE ZEIT NUTZT, wo 18 prosaischen Einleitungswörtern 27 Worte als Gedichttext folgen.
Die Texte sind formal allesamt freirhythmisch und freistrophisch organisiert: ein bis vier Strophen mit meist kurzzeiligen Ein- bis Vierzeilern; Langzeiler bleiben Ausnahme. Reimerei wird prinzipiell abgelehnt, das gilt nicht für die gern benutzten Stabreime und zuweilen für Schlag- und Halbreime. Der Vers entspricht oft einer Sinneinheit und setzt sich zumeist auch als Redeeinheit – wie in der Musik – mit langer Pause vom folgenden Vers ab, auch dann, wenn der Autor über mehrere Strophen hinweg das Enjambement verwendet. Die wechselnden Kadenzen illusionieren Dynamik und bringen Musikalität ein.
Doch trotz der elliptisch-minimalistischen Syntax gibt es Satzschrauben und Schachtelungen, die er durch Einschübe oder Inversionen noch verkompliziert, um damit den Lesevorgang immer wieder zu stoppen und vom Leser Bedenken einzufordern.
(Solches minimalistische, elliptische und inversive Sprechen ist – bei Wahrung aller subjektiven Unterschiedlichkeit – in der modernen Lyrik seit dem Expressionismus manifest und findet sich in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts beispielsweise bei Brecht, Sachs, Borchert, Bobrowski, Celan oder Jiménez. Nicht zu vergessen die „böhmischen Fermate“ mit ihrer bilderreichen, naturlyrischen, poetistischen „Motivsemantik“ in Kunzes Lyrik.
Und Kunze liebt Wortspiele, liebt Anaphern und Repetitionen, liebt Aphoristisches. Seine poetischen Superbilder sind daher monumentale Miniaturen: monumental in Komplexität und Bildhaftigkeit, Miniatur in ihrer konsequenten sprachlichen Verknappung.
Und Kunze schreibt gleichermaßen als Augen- und Ohrenmensch. Zuweilen scheint der Seh-Sinn über den Hör-Sinn zu dominieren, der ihn aber immer wieder und bis zu tiefer Ergriffenheit zu erfassen vermag. Ja, Musik und Musikalität des Sprechens scheinen ihm geradezu immanent zu sein. Sein Seh-Sinn reagiert – über das ihm wichtige Schwarz und Weiß hinaus – stark farbig: die Grundfarben Rot, Blau, Grün und Gelb erscheinen zumeist ungebrochen; als Zwischenfarben bringt er Purpur, Rotorange, Rosa, Grau und einmal auch Silber ins Spiel.
Und er liebt Neologismen, mit Lust kombiniert er Oxymora bzw. Paradoxa: beileidsfreudenfest, glockennägel, pupillenkeil, afterkarussell, aschenfahne, mittagslava, seelenlupe, strudellauf, ruhmeskörner, fingerschweben, heraufschnein, schneeschwarz…
Philosophisch sind Paradoxa vor allem Logikkonstrukte, die allzu eindimensionierte Bedeutungen ad absurdum führen wollen. Die Kunzeschen Oxymora sind jedoch Wortwürmer mit Widerhaken. Ein Grundwort wird durch ein normalerweise hierzu nicht passendes Bestimmungswort konterkariert: Beileid mit Freudenfest. Das Gewohnte oder Vernünftige wird zu einem Ungewohnten, zu einem mittels Vernunft nicht Auflösbaren. Die Aussage bekommt einen reziproken Sinn, die Grenzen zu allzu Logischem werden betont. Es ist also ein geistreiches Spiel mit z.T. gewagten Variablen. Der Rezipient muß die (Un-)Stimmigkeit der Kunzeschen Bildkonstruktionen „probieren“, anschmecken, verkosten. Die Metaphorisierung beginnt dann zunächst irrational und irritierend, um dann aber in weitem Spannungsbogen eine um so reichhaltigere „Erleuchtung“ zu ermöglichen. – Am Ende sinds schwarz-weiße Verse und hell-dunkle Gedichte heiter-melancholischen Gemüts, die ihre weitgehende Mensch-Natur- und Natur-Kunst-Ambivalenz gerade auch in jenen zuwiderhakenden Komposita und gewagten Bildern – „fingerabdruck des himmels“ – die „Schönheit“ und deren Brechung empfindbar machen. Dichter sein heiße: „immer bis ans Ende gehen“. Das hat Kunze so von Milan Kundera übersetzt. Mir scheint, in solchen Ambivalenzen läßt er gegensätzliche Sinnfälligkeiten bis an die Grenzen des Vorstellbaren aufeinandertreffen.
Reiner Kunze gehört zur immer seltener werdenden Dichter-Spezies der praktizierenden Humanisten, oft genug als „Gesinnungsliterat“ denunziert, weil er – poesie-immanent und auf Existentielles zielend – um den Fortbestand der Menschheit bangt. Daher in seinen Texten das Hin und Her und Auf und Ab von Idylle und Elegie, einer Poesie, die „vor allem poesie“ sein möchte, mit der er aber auf der „Haaresbreite seines sensiblen Wegs“ entlangbalanciert, auf dem ihn nur seine Sprache zu halten scheint, wie es Böll 1977 in seiner Büchnerpreis-Laudatio auf Reiner Kunze formuliert hat, eine Sprache, die das allwärts triumphierende „Häßliche, Ekelhafte und Brutale“ dadurch zu bannen versucht, indem sie allem Adjectiven die Sprache verweigert und ihm heiter gewappnet entgegentritt. Und als wichtige Botschaft verkündet er als seiner „Weisheit (vorläufig) letzten Schluß“:
Vor dem haus, in der astgabel der eibe
brütet die amsel unhörbar gesang aus
Da besinnt sich doch wohl einer – wie einst der Dichterkollege Brecht bei allerletztem Blick aus dem Fenster der Berliner Charité – auf alles Weiter- und Fortlebige nach uns und heißt uns heiter hoffen an der Neige unseres Tags auf dieser Erde, auf der wir einst „zu Gast gewesen sein werden“.
Edwin Kratschmer, aus: Ulrich Zwiener und Edwin Kratschmer (Hrsg.): Das blaue Komma – Zu Reiner Kunzes Leben und Werk, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2003
Tönender Stein
Wer vor Jahr und Tag im Osten aufgewachsen ist und in der ummauerten Dürre nach geistiger Erfrischung lechzte, wußte Reiner Kunze früh zu schätzen. Doch kam nach dem Poesiealbum II von 1968 erst einmal eine ganze Weile nichts. Wer sich die folgenden, lediglich im Westen erschienenen Gedichtbände heimlich besorgen konnte, dem wurden allein deren Titel zum Programm: Sensible Wege, die führten fort von den Marschmagistralen der selbsternannten Sieger der Geschichte, Zimmerlautstärke schwieg an gegen deren martialisches Gedröhn, das außer den Ohren auch Seelen ertauben ließ. Neben den hauptamtlichen und inoffiziellen Dunkelmännern, die den Dichter in Greiz und Leiningen mittels „operativer Zersetzung“ zu zermürben suchten, mühte sich zudem ein Lexikonkollektiv, die Leser 1974 vor dem K. solcherart zu warnen:
Problematischer wurde K.s Entwicklungsweg in der Folgezeit, in der er – selbst das Gedicht ausschließlich als Orientierungspunkt des Ich bezeichnend – die Position eines kritischen Individualisten einnahm, der das Verhältnis Individuum und Gesellschaft undialektisch reflektierte, was zu substantiellen Verlusten und künstlerischen Einbußen führte.
Ach, was haben wir da gelacht, um nicht zu weinen!
Nun also, 30 Jahre nach dem ersten Schätzenlernen und neun Jahre nach dem Erdbeben, das die Köpfe der rechtgläubigen Wortklauber gehörig wackeln ließ, der neueste Gedichtband Reiner Kunzes: ein tag auf dieser erde. Ich kann nicht sagen, daß sich seitdem irgendetwas geändert hätte:
Einer ging, der wußte:
die nicht gegebenen versprechen halten –
das ist treue.
Es ist diese poetologische wie politische Verläßlichkeit, die über Zeitenwenden hinweg trägt. Nur der windschnittig Angepaßte muß sich, wechselt der Weltwind, wenden, der intellektuell Autonome nicht. Der eigensinnig Integere kann bei sich und seinen Dingen bleiben, wie Reiner Kunze: leise, doch nicht lau, zart und doch prägnant, verletzlich, doch nicht lamentierend, radikal im Verzicht und doch reich, hochpoetisch in dem ihm eigenen Lakonismus, ethisch eindeutig, ohne je zu moralisieren, ein politisch entschiedener Mitmensch, doch kein politischer Dichter, von einer ernsten Heiterkeit, die auf dunklem Urgrund zu leuchten beginnt, und Worten „abseits der wörter / von den wühltischen der sprache“, gebettet in Stille, die atmet und im wortfühligen Gedicht zu uns spricht. Beschreibt Camus seinen Sisyphos als einen Blinden, der sehen möchte und weiß, daß die Nacht kein Ende hat, so findet Kunze für seine Poetik das Bild:
Das gedicht
ist der blindenstock des dichters
Mit ihm berührt er die dinge.
In diesem Jahr 65 Jahre alt geworden, scheint es, als sähe der Dichter die Welt heilloser als zuvor.
Niemals wird es uns gelingen, die welt
zu enthassen.
Oder im Rückblick auf die Kindheit:
Ich wußte noch nicht, daß der mond
das vorweggenommene antlitz ist
der erde.
Doch dann die Selbstermunterung, der trotzende Trost:
Bei meinem weißen haar
und beim weiß in deinem:
Die zeit ist schon zu kurz,
den mut zu verlieren.
Für mich das schönste Gedicht in diesem Band heißt „Spaziergang zu allen Jahreszeiten“, es strahlt aus seinem Kern eine kleine Wärme in die große Kälte, es versöhnt sich mit dem Unabwendbaren und ist trotz der verhaltenen Trauer von einer sanften, fast zufriedenen Gelassenheit:
Noch arm in arm, entfernen wir uns voneinander
Bis eines wintertags
auf dem ärmel des einen
nur schnee sein wird.
Solche Wortschönheiten gibt es in diesem Band noch viele, doch einiges Düstere auch. Dabei ist das Bedrückende nie bleischwer, und der Bedrückte läßt uns nicht in Versen der Hoffnungslosigkeit versinken. Weil er nichts leichtnimmt, so scheint es, fällt ihm nichts schwer. Der Stein, den er wälzt, tönt.
Wir müssen uns Reiner Kunze als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Joachim Walther, Ostragehege, Heft 13, 1998
Drei Stationen des Werks
Der Vater Bergarbeiter im Erzgebirge, die Mutter Heimarbeiterin der Strumpfindustrie, Eltern also aus der Klasse des Proletariats – günstigere Voraussetzungen für die Übereinstimmung der Interessen von sozialistischem Staat und jungem Schriftsteller lassen sich kaum denken. Der Schriftsteller findet Wohlwollen und die besten Startbedingungen vor, die Kulturpolitik des Staates rechnet mit seiner Zustimmung und Linientreue. Im Falle des 1933 geborenen Reiner Kunze schien diese Rechnung zunächst aufzugehen.
Denn eine erste Phase zeigt Kunze noch ganz aufgehoben in der staatlichen Förderung von Arbeiterkindern, die ihn zum Abitur führt. So stark ist noch das Maß der Konformität, dass Kunze schon als Sechzehnjähriger in die SED eintritt (1949). Der Prozess der Abnabelung beginnt wohl mit dem Studium in Leipzig, an einer Universität, an der noch ein Geisteswissenschaftler wie der Autor des mehrbändigen Werks Geist der Goethezeit, H.A. Korff lehren durfte und der Philosoph Ernst Bloch und der Literaturwissenschaftler Hans Mayer, beide aus dem Exil zurückgekehrt, mit ihren Vorlesungen einen weiten Horizont aufrissen (und schließlich dann von der marxistischen Orthodoxie in den Westen getrieben wurden).
Kunzes Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent in der Journalistischen Fakultät, zunehmend von einer neuen Freiheit des Denkens bestimmt, stößt auf die Entrüstung der ideologischen Hardliner; er fällt in Ungnade. Dieser erste eklatante Bruch im Verhältnis zum System der DDR hat tiefgreifende Folgen. Kunze wird aus dem Lehrkörper der Universität verstoßen und in die Verbannung geschickt, zur Arbeit als Hilfsschlosser im Maschinenbau (1959–1961). Aber immer noch ist er formell Mitglied der SED. Was wie Inkonsequenz scheinen mag, ist wohl ein Tribut um der Literatur willen. Dem jungen Autor, der 1959 seinen ersten Gedichtband veröffentlicht und sich 1962 ins Risiko des freien Schriftstellers eingelassen hat, kann an einer totalen Konfrontation noch nicht gelegen sein. Dieser entscheidende zweite Bruch mit dem Regime wird unaufschiebbar, als im August 1968 die Bewegung des „Prager Frühlings“ von 1968, die Bewegung eines „humanen Sozialismus“, von den Truppen des Warschauer Pakts, auch der DDR, niedergewalzt wird. Kunze, seit 1961 mit einer tschechischen Ärztin verheiratet, protestiert und erklärt seinen Austritt aus der SED.
Eine totale Vereisung der Beziehung zwischen Regime und Dichter ist die Folge. Der autoritäre Staat und sein Instrument, die Staatssicherheit, schließen das Netz der lückenlosen Überwachung. Verschärft wird die Situation, weil es Kunze gelungen ist, in der Bundesrepublik einen Verlag für einige Bücher zu finden. Zum Signal werden die Veröffentlichung des Bandes Die wunderbaren Jahre (1976), der Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR und Kunzes Beteiligung am Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns (1976). Kunze, längst zur unerwünschten Person geworden, antwortet seinerseits mit dem Antrag auf Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft und kann mit seiner Familie die DDR verlassen (1977). In der Nähe von Passau findet er ein Asyl.
Drei Bücher sind es vor allem, in denen der Zündstoff dieser Schriftstellerexistenz, das Daseinsbewusstsein und die Schreibtechniken Kunzes ihren exemplarischen Ausdruck finden: zimmerlautstärke, gedichte (1972), Die wunderbaren Jahre, Prosa (1976) und ein tag auf dieser erde, gedichte (1998).
(…)
ein tag auf dieser erde. gedichte (1998)
IN ERLAU, WORTFÜHLIG
Wir schlafen, die wange am fluss,
an der unbeirrbarkeit des wassers
Doch immer öfter liegen wir wach,
um halt zu finden an der stille
Abseits der wörter
von den wühltischen der sprache
Vor dem haus, in der astgabel der eibe,
brütet die amsel unhörbar gesang aus,
und die glocke von Pyrawang jenseits des stroms
bucht ab von der zeit.
(S. 9)
Dieses Gedicht eröffnet den Band. Erlau ist der Ort in der Nähe (donauabwärts) von Passau, in dem Kunze 1977 nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Asyl fand. Das ist ein Ort abseits des literarischen Marktes. Im Baum vor dem Haus hat sich jener Vogel eingenistet, von dem Bertolt Brecht in seinem letzten Gedicht vor dem Tod im „weißen Krankenzimmer der Charite“ spricht, nachdem er die Todesfurcht überwunden hat:
Jetzt
Gelang es mir, mich zu freuen
Alles Amselgesanges nach mir auch.
Den Gedanken an das Sterben hält in Kunzes Gedicht die letzte Strophe wach. Und die allerletzte Strophe im Gedichtband überhaupt wird diesem Gedanken noch einmal volles Gewicht geben.
Ist aber das Eingangsgedicht programmatisch für den Band von 1998? Nur sehr bedingt. Die Themenvielfalt lässt sich nicht auf Formeln bringen. Titel wie „kreuz des südens“ und „spaziergang zu allen jahreszeiten“ deuten auf eine neue Bewegungsfreiheit, eine neue Sensibilität für Natur und Landschaft und Neugier auf weitere Welthorizonte. Aber auch Ereignisse der politischen Geschichte wie die polnischen Aufstände, der Freiheitskampf in Prag oder die Erbschaft des Baus der Berliner Mauer drängen ins Bewusstsein zurück. Ein Gegenpol erstarkt: die Faszination, die von Musik, bildender Kunst und Poesie ausgeht. Das Ende beschwört der Zyklus „ein tage auf dieser Erde“ an denen das lyrische Ich verschmilzt mit der ins Mythische erhobenen Gestalt eines Anglers, der „der schöpfung zur hand geht“. (S. 99)
Ansichten der Natur
WINKL
Unterm dach, fast
haut an haut mit dem himmel
Das universum
dringt durch die poren
Nachts hörst du
das flügelheben des habichts, der im dämmer
einschoß ins gebälk,
und in der frühe
rüttelt der fasan an deinem schlaf
und schreit, sein reich abschreitend,
in dessen mitte du
dein lager aufschlugst
Hier verschläft kein dichter
das gedicht
(S. 14)
Die Nacht macht die Umgebung hörbar, selbst das Flügelheben des Habichts im Gebälk. Der unter dem Dach Nächtigende saugt vom Universum so viel ein, wie die Poren es erlauben. Naturerlebnis wird zum Allerlebnis. Wenn der Fasan am Morgen schreit, weckt er keinen Nachtschläfer. Denn was die Poren einsaugten, ist schon zum Gedicht geworden.
Kunzes Reiseradius reicht nun vom Fernen Osten bis nach Afrika. Wie in alter ostasiatischer Weise gemalt scheint das Gedicht „KIRSCHBAUM IN KIOTO“ (S. 48).
Von menschenhand
zweig für zweig
eingeflochten in den himmel
Die götter wandeln
auf blüten
Gegen den Blütenhimmel dieses Gedichts gestellt, erscheinen Wüste und Dürre Afrikas in „WINDHOSE BEI WINDHOEK“ (S. 55) in ihrer ganzen Trostlosigkeit.
Als bohre die erde den himmel an
Der sand rast
Alles, was dürstet,
duckt sich
Doch der fluß wird nicht kommen
Zuwehen wird das springbockgebein […]
Da liegt die Vision einer Erde, von der die Natur weggetilgt ist, nicht so fern.
Minen aus der geschichtlichen Vergangenheit
Ist der Gedichtband zu einem Gutteil ein lyrisches Reisetagebuch, geschrieben aus unmittelbarer Anschauung, so werfen sich doch in die mit allen Sinnen wahrgenommene Gegenwart die Schatten der politischen Erfahrungen von einst. Die Reise nach Polen führt in Posen zum „DENKMAL DER AUFSTÄNDE 1956/68/70/76/80/81“ (S. 33):
zwei kreuze
aneinandergeseilt
und am himmel vertäut:
Posen Danzig
Mir aber war, als schlügen
Polen und Deutschland
gemeinsam das kreuz
[…]
Ein ganzes Kapitel des Bandes steht unter dem Stichwort „DIE MAUER“ (S. 60), nicht nur dieses:
Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht,
wie hoch sie ist
in uns
Wir hatten uns gewöhnt
an ihren horizont
Und an die windstille
ln ihrem schatten warfen
alle keinen schatten
Nun stehen wir entblößt
jeder entschuldigung
Scheint die Anfangsstrophe eine Erkenntnis auszusprechen, die mittlerweile zur rhetorischen Floskel geworden ist, so führt doch das Gedicht in eine tiefere ethische Dimension. Kunze, der zur Zeit des Baus der Berliner Mauer im August 1961 bereits von der Universität verstoßen war und Fabrikarbeit leistete, war schon selbst Opfer von Zwangsmaßnahmen der DDR geworden. Was sich hier ein ehemaliger Oppositioneller bewusst macht, ist eine Eingewöhnung in einen Unrechtszustand, die zunehmende Blindheit für das Skandalöse einer inhumanen Eingitterung der Menschen, eine mentale Anpassung an das nun einmal Bestehende. Mag auch das Urteil „entblößt jeder entschuldigung“ zu hart sein, so ehrt es die entschlossene Weigerung, sich aus der Selbstprüfung zu stehlen.
Wo Minen aus der geschichtlichen Vergangenheit unentschärft bleiben, schaffen sie neue Anpassungsmuster. Lehren aus historischer Erfahrung zu ziehen, macht Kunze zur Maxime im letzten Gedicht des Kapitels „die mauer“, im aphoristischen „VERS ZUR JAHRTAUSENDWENDE“:
Wir haben immer eine wahl,
und sei’s, uns denen nicht zu beugen,
die sie uns nahmen
(S. 65)
Die Macht der Kunst
LEGENDE VOM GROSSEN MALER SESSCHU
Nichts nützliches tat
der schüler Sesschu, vertat
die zeit mit malen
Zur strafe ließ binden
der zenmeister ihn und werfen
in den turm
Da malte mit seinen tränen Sesschu
eine ratte, sie biß
die fessel durch
(S. 50)
Dieses Gedicht vom Ausgreifen der Kunstwirklichkeit in die Lebensrealität ist als Gleichnis zu lesen, als Parabel von der großen Verwandlungsmacht der Kunst. Was Leidenschaft für die Musik sein kann, zeigen die Verse über die „WIENER JUGEND VOR DEM KONZERT“, die schon lange vor dem Beginn „die günstigsten der billigsten plätze“ besetzt hält „wie eine eroberte festung“ (S. 75). Ovationen an die Musik sind die Gedichte über den Cellospieler Yo Yo Ma und Vladimir Horowitz’ letztes Mozart-Konzert in Wien (S. 74, 76).
DER DlCHTER MARIAN NAKITSCH
Eine schwarze brodelnde welke, so zog er
vom Balkan herauf, breitete aus sich
über tische und stühle und füllte
das haus uns, bis wir tasteten
im fremden
aaAuch der himmel sei ein schlachtfeld, sagte er,
aadie sonne kämpfe
aaUnd friedhöfe lägen am himmel,
aaso viele schwärme von kreuzen
Er saß wie nebenbei,
er aß wie nebenbei,
er trank, als trinke er nicht
Er sprach
Sprechend
verdichtete er sich […]
Die Rede ist hier (77) vom kroatischen Dichter Marian Nakitsch, der in deutscher Sprache schrieb und recht eigentlich erst von Reiner Kunze für Deutschland entdeckt wurde. Der Verfasser dieses Essays gehörte zu jenem Gremium, das auf Empfehlung von Kunze 1992 Marian Nakitsch für seinen Gedichtband Flügelapplaus den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung zur Förderung junger Künstler zusprach und ihm auch weiterhin den Weg zum deutschen Publikum zu ebnen versuchte. So verbindet sich für ihn Kunzes Beschreibung mit eigener Kenntnis. Nakitsch erschien wie ein poetisches Kraftbündel, wie ein Besessener, überzeugt von seiner fast missionarischen Berufung, wie ein Egomane und eine Klette, die abzuschütteln schwer war. Er hatte abenteuerliche Vorstellungen von der Verwirklichung seines Berufenseins. Er meldete sich zuletzt aus einer der Berliner Künstler- und Bohemegruppen am Prenzlauer Berg, aber Nachrichten über dichterische Erfolge blieben aus. Dem Verfasser ging seine Spur verloren – Nakitsch, vielleicht ein Genie, das seiner poetischen Besessenheit zum Opfer fiel und sich zu früh verbrauchte?
Kleine Poetik des Gedichts
Kunzes Text „POETIK“ (S. 81) schließt mit diesen beiden Strophen
Das gedicht
ist der blindenstock des dichters
Mit ihm berührt er die dinge,
um sie zu erkennen
Der „blindenstock“ ruft das Bild einer zum Mythos gewordenen Dichtergestalt der Antike, des blinden Dichters Homer, auf. Dem Blinden ist der Stock ein Mittel, sich in einem Raum, den wahrzunehmen ihm das Augenlicht fehlt, zu orientieren. Um solche Raumorientierung aber geht es in Kunzes Text nicht. „Erkennen“ bedeutet mehr: zur Substanz der Dinge vordringen. Dieses Erkenntnisvermögen macht den Dichter zu einem Halbbruder des Philosophen. Wieder bewährt sich Kunzes Kunst der lakonischen und aphoristischen Verdichtung und Zuspitzung. Dem „erkennen“ fällt das ganze Gewicht des Schlussworts zu.
Einem philosophischen Anspruch freilich setzt das Horst Drescher gewidmete Gedicht „SANFTER SCHULTERSCHLAG“ auch klar seine Grenzen:
poesie ist außer wahrheit
vor allem poesie
(S. 63).
Unabdingbar aber bleibt (zumal in Zeiten der Gefährdung ihrer Freiheit) die Pflicht zu verantwortlichem Handeln. Dem „DICHTERVERLEGER“ Ryszard Krynicki gewidmet ist dieses Gedicht:
Für die existenz der poesie
die existenz riskieren
Die halbe bibliothek verkaufen,
um ein buch zu drucken
Es heften
mit dem eigenen lebensfaden
(S. 34)
Magie der Natur
Früh, vor dem offenen fenster,
läutet der rehbock, das seil im maul,
den apfelbaum
Du störst den fledermausschlaf
der watestiefel, die an der wand
schaftüber hängen,
und schulterst den fischkorb
(S. 95)
So beginnt der Schlussteil, dessen Titel mit dem des Bandes identisch ist. Der „tag auf dieser erde“ ist ein Tag des Fischers. Eine auch sonst im Werk begegnende Glaubensskepsis Kunzes meldet sich neu:
lm domschatz rühmen sie gott
Du betest den bach,
die leere rosenkranzschnur
(S. 100)
Ein Ur-Muster wird wieder gegenwärtig:
Die jagd, der alte
trieb
(S. 105)
Durch den bogen der fliegenden schnur
schießt der eisvogel seinen blauen faden
Der fischer grüßt den fischer!
(S. 96)
Der Fischfang erscheint in einer mythisch-religiösen Aura. Gott gab „den kindern den fisch als geheimes / und stummes kleinod fast als ein lösegeld / für alles, was er uns vorenthält“ (102). Vom „Ufer“ springt die Assoziation des lyrischen Ich zum mythischen Lethe-Fluss und zu einer eigenen Legende der Entschädigung für die von ihren Zeitgenossen unbeachteten Dichter. Der Fluss des Vergessens ist zugefroren, die „zu lebzeiten totgeschwiegnen dichter / sind nun auf dem weg!“ (103).
Es gibt Verse, die wie eine frohe Botschaft die Tätigkeit des Fischers beflügeln.
lm frühjahr regnet’s fische in den bach […]
lm Frühjahr gehst du der schöpfung zur hand
(S. 99)
Aber aller Überfluss, den die Fischgründe spenden, alle Magie der Natur stößt an ihre Grenzen. Zu denen, die es am tiefsten wissen, gehört der Dichter:
Wesen bist du unter wesen
Nur dass du hängst am schönen
und weißt, du musst
davon
(S. 106)
Und so hat diese Einsicht in die Vergänglichkeit auch das letzte Wort im Band ein tag auf dieser erde.
Die weiden haben vom himmel
das letzte tageslicht gekehrt, der bach
dunkelt es ein
Rings um den mond, den beinernen schädel,
tritt aus der nacht
das vanitasbild
(S. 111)
Mit dem Vanitas-Topos, dem aus der Bibel (Prediger Salomon) zitierten Eitelkeits- und Vergänglichkeitsbild, fädelt sich Reiner Kunze in eine der mächtigsten literarischen Traditionsreihen ein.
Walter Hinck, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
„… wir wissen nicht zu fragen“
– Zu Reiner Kunzes Gedicht „POETIK“ und dem Lyrikband ein tag auf dieser erde. –
Unter dem Motto Paul Celans „Wir wissen ja nicht, was gilt“1 fand am 30. November 2001 das VI. „Literarische Symposium“ der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin statt. Literatur- und Naturwissenschaftler, Schriftsteller, Theologen und Politiker sprachen und diskutierten vor einem großen Publikum (darunter zahlreiche Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet) über „Wertorientierung“ in einer offenen Gesellschaft, vor allem über die Wahrheits- und Wertesuche in der Literatur.
Höhepunkt der Veranstaltung war eine Lesung von Reiner Kunze, der Gedichte aus dem Band ein tag auf dieser erde2 vortrug und die Funktion des Gedichts als ,Stabilisator und Orientierungspunkt‘ hervorhob. Diese 1998 erschienene Lyriksammlung enthält eine Reihe von Gedichten, die der Beziehungslosigkeit und Beliebigkeit Widerstand entgegensetzen und an Grundbestimmungen des Menschen erinnern, die um keinen Preis aufgegeben werden dürfen, da sie den Menschen erst zum Menschen machen. Zu diesen Bestimmungen gehört nach Kunzes Meinung sogar die Fähigkeit zum Empfinden des Schönen und – damit unlösbar verbunden – das Nachdenken über das eigene notwendige Ende:
Wesen bist du unter wesen
Nur daß du hängst am schönen
und weißt, du mußt
davon.3
Die sprachlichen Eigentümlichkeiten dieser Poesie lassen sich subsumieren unter dem Begriff der Reduktion – gemäß dem ästhetischen Credo des Dichters: „auf knappestem Raum ein Höchstmaß an Ausdruck“.4 Diese Ästhetik der Reduktion hat ihren Grund im geglückten „Zusammenspiel von Metaphorik und Lakonismus“, das „ein Mitteilen durch Verschweigen“ ermöglicht.5 Kunze misst dem dichterischen Bild existentielle Bedeutung bei. Die Metapher ist für ihn „die Entsprechung zu einer poetischen Apperzeption der Wirklichkeit, die durch keine andere Form der Realitätserfahrung zu ersetzen ist“.6 Der Lakonismus als verkürzte, verhüllende Rede reicht über die Grenzen des Sagbaren hinaus. Kunzes Sprechweise ist leise und verhalten. Vorsichtig tastet er sich den Rändern erinnerter und erfahrener Wirklichkeit entlang, überzeugt er durch eine dichte authentische Sprache und ein großes kompositorisches Talent. Die Sparsamkeit der Mittel ist eine eindrucksvolle Komponente seiner Lyrik, in der poetische Substanz und thematische Relevanz im Sinne von Heinrich Böll eine ,Ästhetik des Humanen‘7 verwirklichen.
Diese Poetik einer humanen Wertorientierung entspringt dem Geiste eines Fragens, das nicht bei Sinn- und Wertsuche endet, sondern offen bleibt auf eine zu erhellende Zukunft hin, wie das Gedicht mit dem programmatisch überschriebenen Titel „POETIK“8 belegt:
So viele antworten gibt’s,
doch wir wissen nicht zu fragen
Das gedicht
ist der blindenstock des dichters
Mit ihm berührt er die dinge,
um sie zu erkennen.9
Die Spruchhaftigkeit dieses poetischen Textes erinnert an die älteste Formtradition der deutschen Lyrik. Mit der Anspielung auf die „Zaubersprüche“ der germanischen Dichtung greift Reiner Kunze zurück auf die Anfänge der Literatur, um über das Morgen nachzudenken, um in der Herkunft die Zukunft zu finden.
Das Bild ist überaus treffend gewählt. Den Dichter leitet nicht der Scheuklappenblick des ideologisch Verblendeten, und der Blindenstock ist keine Krücke der Einbildungskraft. Es verwundert geradezu, dass einem so zerbrechlichen und zarten Gebilde wie dem Gedicht zugetraut wird, einen Weg zu weisen im Gelände der postmodernen Ausweglosigkeiten. Indem der Dichter die Dinge berührt, verwandeln sie sich und gewinnen einen neuen Sinn. Auf diese Weise erinnert das Gedicht an die Werte der Treue und des Vertrauens, wie sie Teiresias, der blinde Prophet, verkörperte, dem Homer im zehnten Buch der Odyssee allein unter allen Menschen ,ungeschwächten Verstand‘ und ewige Weisheit zusprach. Die salopp formulierte erste Zeile des Kunze-Textes entspricht der Realitätserfahrung des Menschen von heute, der mit einem Überangebot an phrasenhaften Antworten überschüttet wird. Aber im Horizont dieses auf Oberflächenreize angelegten Daseins brechen keine Fragen auf, weil das Frag-Würdige allzu gleichgültig geworden ist. Darum ist im zweiten Vers die Kant’sche Frage „Was kann ich wissen?“ – gestellt in einem Zeitalter, das alle hergebrachten Grundwerte ins Rütteln bringt – fast sokratisch zugespitzt zu der Aussage „wir wissen nicht zu fragen“, die an die von Kunze übersetzten Verse Jan Skácels erinnert:
Ich bin nur ein Dichter, ein Radar unter den Linden.
Nicht an mir ist’s zu antworten. Ich frage.10
Die zweite Strophe weist einen Weg jenseits politischer Rezepte und gesellschaftlicher Vorschriften: Das Gedicht als „blindenstock des dichters“ ist Wegweiser, Halt und Orientierungshilfe, besonders in dunklen Zeiten. Die sanfte Berührung der Dinge genügt, um „zu erkennen“. Dieses Erkennen, das Sensibilität und Hellhörigkeit voraussetzt, ist eine Grundform poetischer Welterfahrung, die den Blick auf den Grund der Dinge richtet und ihr Wesen zu erforschen bemüht ist.
Diese Suchbewegung ist konstitutiv für Reiner Kunzes poetische Wertorientierung. Sein Gedicht ist, wie der Autor in einer Nachbemerkung zu seinem Band zimmerlautstärke11schreibt, „Stabilisator“ und „Orientierungspunkt eines Ichs“. Es ist ein Stabilisator der Werte, indem es verlässliche Signale im Zeitalter der Unsicherheiten aussendet und jene Antworten aufbewahrt, die unter dem Schutt falsch oder gar nicht erst gestellter Fragen begraben liegen. So formuliert das poetische Wort keinen direkten handlichen Wert, aber es birgt in sich einen zeit- und raumüberdauernden, krisenfesten Wert, der „MÜNZE IN ALLEN SPRACHEN“ ist, wie Reiner Kunze ein anderes sinnspruchartiges Gedicht überschreibt und festhält:
Wort ist währung
Je wahrer,
desto härter.12
Sprache ist für Reiner Kunze „nicht nur menschliches Kommunikationsmittel, sondern auch Identität“. Als Medium der Selbstfindung berührt das Gedicht die tiefsten Schichten unseres Seins, lässt es uns „zu Entdeckungen in uns selbst aufbrechen“.13 Der Dichter bekennt sich zum Individuum und spricht in seiner Büchner-Preis-Rede von der Notwendigkeit, sich „auf die Substanz Mensch“14 zu besinnen. Aber er ist auch der Meinung, dass der Lyriker immer auf dem Weg“ ist, „die inneren Entfernungen zwischen sich und anderen zu verringern“, um „die Erde um die Winzigkeit dieser Annäherung bewohnbar zu machen“.15 Dichtung ist für Reiner Kunze Kommunikation. Er ist davon überzeugt, dass der Dichtende sich immer auf dem Weg zu den Mitmenschen befindet.16 Poesie als Dialog bedeutet jedoch im Werk von Kunze zunächst Selbstvergewisserung und ist zudem immer auch engagierte Poesie, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, wobei der Begriff ,Engagement‘ nicht im Sinne des Agitprop zu verstehen ist, sondern als Partizipation am Zeitgeschehen. Seine Gedichte widersprechen Gottfried Benns Ästhetik einer monologischen Kunst und sind – wie Hilde Domin formulierte – Ausdruck eines Glaubens an die „Anrufbarkeit des anderen“.17 Im Sinne Paul Celans ist das Gedicht bei ihm immer Anrede und intendiertes Gespräch:
Das Gedicht will zu einem Andern, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu.18
Den Glauben an die Möglichkeit des Gedichts, den anderen erreichen zu können, teilt Kunze mit Celan, der von dem Gedicht sagt, dass es „seinem Wesen nach dialogisch“ sei:
eine Flaschenpost…, aufgegeben in dem – gewiß nicht immer hoffnungsstarken – Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an Herzland vielleicht.19
Eine solche „Flaschenpost“ ist für mich das Gedicht „POETIK“, das Reiner Kunze mir am 30. November 2001 als Widmung in seine 2001 veröffentlichte Sammlung Gedichte geschrieben hat.
Birgit Lermen, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Kurt Oesterle: Die Welt zu enthassen
Süddeutsche Zeitung, 14./15./16.8.1998
Wulf Segebrecht: Die Verläßlichkeit des Blindenstocks
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.11.1998
Jochen Jung: Kunzes Kunst
Die Zeit, 10.12.1998
Von einem Land in ein anderes
– Zur Lyrik Reiner Kunzes. –
Ich wähle meine Stoffe nicht, die Stoffe wählen mich.
Im Vorspann zu seinem Tagebuch eines Jahres „Am Sonnenhang“ zitiert Reiner Kunze Albert Camus:
Mit vierzig Jahren klagt man nicht mehr laut über das Böse, man kennt es und kämpft gemäß seiner Schuldigkeit. Dann kann man sich dem Schaffen zuwenden, ohne irgend etwas zu vergessen.
Dem fügt er lakonisch hinzu:
Mit sechzig gilt das doppelt.
Im Munde eines deutsch-deutschen Schriftstellers am Ausgang unseres Jahrhunderts gewinnen die Worte des Philosophen der Existenz eine konkrete, biographische Bedeutung; was dort – vielleicht etwas pathetisch – in philosophischer Allgemeinheit konstatiert worden ist, füllt sich hier mit der Wirklichkeit eines Lebens unter den Bedingungen deutscher Geschichte in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Zitat und Kommentar schlagen jenen lebensgeschichtlichen Bogen, der in der Auseinandersetzung mit diesem Autor schon oft von seiner frühen Zeit in der DDR bis zu seinen späteren Jahren in der Bundesrepublik gezogen worden ist.
Kunze hat immer besonderen Wert auf die Feststellung gelegt, daß sein Schreiben – jedenfalls seit es ernst zu nehmen ist, d.h. seit es Ende der 50er Jahre aus der Spur sozialistischer ,Volksverbundenheit‘ getreten ist – sich dicht an die Erfahrung von Realität anschließe. Nach dem Impuls für sein Schaffen gefragt, antwortete er:
Ich wähle meine Stoffe nicht, die Stoffe wählen mich. [… Sie] ergeben sich aus dem unmittelbaren oder mittelbaren Erleben, und insofern liegen meiner Arbeit oft eigene Erfahrungen zugrunde. Das schließt das Erschaffen von fiktiven Welten […] nicht nur nicht aus, sondern ein.
Kunzes Schreiben folgt in der Tat den Erfahrungen seines Lebens. Im Rückblick, „mit [mehr als] sechzig“, erweist sich, daß die zentrale Erfahrung seiner schriftstellerischen Existenz die Erfahrung mit den Spielräumen gewesen ist, die dem Schreiben nach Einschätzung des Autors jeweils gegeben waren: So wie der Moralist die Unmoral braucht, so scheint der Schriftsteller Kunze die Erfahrung der Einschnürung des Schreibens zu brauchen, um wie er selbst zu schreiben. Und da er dieser Aufgabe mit Nachdruck nachging, blieb es nicht bei der Erfahrung einer Einschnürung nur des Schreibens.
In den frühen Jahren der DDR erlebte er, in welchem Maße die Sprache der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Realität durch die politischen Verlautbarungen von Partei und Staat besetzt waren, die den ,Kulturschaffenden‘ im wahrsten Sinne des Wortes vor-schreiben wollten, in welcher Weise diese Sprache der (unterstellten) unmittelbaren ,Widerspiegelung‘ von Realität in der Literatur weiterzuverarbeiten sei. In der Auseinandersetzung vor allem mit tschechischen Lyrikern der 50er und 60er Jahre, mit der Aphoristik des späten Brecht, mit Paul Celans Vers-Verknappungen und den atmosphärischen Verdichtungen Huchels suchte Kunze eigene Wege im bedrückenden Labyrinth zwischen den Sprachmauern und fand schließlich zu seinem eigenen Stil. Die Veröffentlichungen zwischen Widmungen (1963) und dem Auswahlband Brief mit blauem Siegel (1973) legen von diesen Versuchen ein beredtes Zeugnis ab. Was Wunder, daß ihm Schreiben weder ein Bekunden im Auftrag wessen auch immer ist noch eine Tätigkeit, die den mechanischen Regeln eines Berufsstandes folgt, etwa dem Gebot der kontinuierlichen Präsenz auf dem Markt; Schreiben wird dem organischen Reifeprozeß in der Natur gleichgesetzt. Wenn der Meister des Marktes, Marcel Reich-Ranicki, im vertrauten Zweijahres-Rhythmus die Kontinuität des Publizierens einfordert und meint, es sei „höchste Zeit“, mit einer neuen Veröffentlichung herauszukommen, dann antwortet ihm der Dichter (die merkantile Formel der Unrast „höchste Zeit“ pointiert theologisch umdeutend):
Höchste zeit kommt von innen
Höchste zeit ist, wenn die kerne
schön schwarz sind
Und das weiß zuerst der baum
Unter den Doktrinen der verordneten realsozialistischen Regeln fühlte Kunze seine Texte dazu verurteilt, mit ihrer Wahrheit hinter dem Berge zu halten; in ihren poetischen Verschiebungen und gedanklichen Verknappungen reklamieren sie das Recht des Einzelnen; nicht als ,Regimekritiker‘, sondern vom Standpunkt eines sozialistischen (oder vielleicht doch eher eines schlichten menschlichen) Humanismus vermaß er die Erfahrungen, die der Einzelne machen mußte.
Greiz grüne
zuflucht ich
hoffe
Ausgesperrt aus büchern
[…]
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
Konsequenterweise formulierte der Autor seine Erschütterung über den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 oder die Empörung über die Behandlung, die Alexander Solschenizyn in seiner sowjetrussischen Heimat widerfuhr. Seine Gedichte legen – anders als viele der Kurztexte in Die wunderbaren Jahre – recht eigentlich keine Sachverhalte dar, verkünden keine Botschaften; sie notieren Gefühle, halten Spuren fest und fixieren, was bleibt:
Nur die erinnerung in ihm
ist belichtet
Genau diese Sprache wurde verstanden; wo er las, kamen Hunderte zusammen. Er wußte, für wen er schrieb, und es bedurfte keiner großen Erläuterungen darüber, was unter der Brechtschen List zu verstehen sei, die Wahrheit zu verbreiten. Und er wußte selbstverständlich auch, wer da noch unter den Zuhörern saß. Denn die Obrigkeit blieb nicht untätig. Es nutzte nichts, wenn er beteuerte, er kämpfe nicht gegen den Staat, sondern für eine bessere Welt. Diese Arbeit und diese Kunst, prägnante Worte für die schikanöse Allgegenwärtigkeit der Macht zu finden, erreichen in seinem bekanntesten Buch, in Die wunderbaren Jahre, ihren markanten Höhepunkt.
Bis in jede Nuance sind dem Autor seine Umwelt und die Menschen, mit denen er sie teilt, und vor allem ihre Sprache vertraut, er kennt die Machinationen der staatstragenden Institutionen und findet stets neue Bilder, die von seinen Lesern unmittelbar verstanden werden. Das bereitete der Lektüre im ,Westen‘ durchaus Schwierigkeiten, weil die Assoziationsräume erst durch Kommentare und Erläuterungen geöffnet werden mußten, wo sie den Lesern im ,Osten‘ unmittelbar vertraut waren.
Der Staatssicherheitsdienst der DDR revanchierte sich dafür auf der Höhe seiner literarischen und künstlerischen Möglichkeiten: er produzierte und archivierte 3491 Blatt Akten in zwölf Ordnern, darunter ein Foto von nachgerade Kunzeschem Reduktionismus. Der Betrachter sieht wenig, eigentlich gar nichts, jedenfalls nichts Aufregendes: drei Autos verlassen auf den PKW-Spuren des Grenzübergangs Rudolphstein die DDR. Wäre da nicht ein großer handgemalter Pfeil, der auf einen dunklen Wartburg mit schmaler Decklast zeigt, in dem zwei Personen zu erkennen sind: Die Kunzes verlassen die DDR, und die Sicherheitsorgane knipsen die Rücklichter!
Wenn man Schriftsteller sein will, muß man sich zu der Konsequenz durchringen, nicht unbedingt Schriftsteller sein zu wollen.
Als Reiner Kunze mit seiner Familie 1977 die DDR verließ, veränderte sich dieses bedingende Umfeld für ihn schlagartig und grundlegend. Er war gezwungen, sich neu zu orientieren und die neuen Lebensbereiche zu vermessen. Er kam nicht allein in eine andere politische, er kam vor allem auch in eine andere literarische Welt. Bei aller stilistischen ,Modernität‘ seiner Texte, Kunze war – trotz Böll oder Wallraff – in der Westliteratur eine befremdende Erscheinung. Ohne daß vereinfachend und populär Text und Biographie kurzgeschlossen werden sollen, läßt sich in den Gedichten, die nun entstehen, doch deutlich erkennen, welchen Widrigkeiten die sprachliche Erkundung der neuen Umwelt ausgesetzt ist. Wo der Druck eines regulierenden Anspruchs fehlt, steht Kunzes Schreiben in der Gefahr, ins Leere zu gehen.
Die Ängste, die ihn im alten System bedrückten, werden zwar in der neuen Umgebung nicht vergessen, und die Erfahrungen, die er in der DDR machen mußte, sind nicht aus den nun entstehenden Gedichten verbannt; aber sie ändern gleichsam ihren Modus: sie werden in die Erinnerung eingegraben, und wiederholt spuken sie durch die Texte, etwa – Wolf Biermann und Walter Mehring gleichermaßen paraphrasierend – „Beim auspacken der mitgebrachten bücher“: Die Bücher von Mandelstam, Nadeshda, Solschenizyn,
Hier dürfen sie
existieren
Noch
Wo die DDR allerdings weiterhin über die Staatsgrenze hinweg auch in westliche Lebensverhältnisse eingreift, etwa mit ihren Ausreiseregularien, da bleibt sie auch im Gedicht unmittelbar gegenwärtig:
Das grab herbeisehnen,
um am tisch des freundes
eine tasse tee trinken zu dürfen
Kunzes Schreibweise ändert sich nicht grundlegend, aber der Ausdruck vieler Gedichte ist weniger aufgesplittert, die Bilder schließen sich leichter und erinnern entfernt an Haikus; der Gedanke tritt direkter und unmittelbarer ins Bild. Und wenn etwa dem bereits erwähnten Gedicht „In Deutschland“ eine prosaische Erläuterung über das bürokratische Reglement des ,innerdeutschen‘ Reiseverkehrs beigefügt wird, dann verweist das auf ein neues Publikum, dem Erklärungen mit auf den Weg gegeben werden müssen, das also den Dichter zwingt, aus seinem Gedicht herauszutreten, um diesem überhaupt erst erläuternd den Weg zu bahnen.
Die ,Übersiedlung‘ in die Bundesrepublik wurde somit von Kunze als eine Entfremdung erlebt: Die Welt, aus der er gekommen sei, meinte er in einem Interview, kenne er bis in die letzte Webfaser, und er sei sich nicht sicher, ob er die Welt, in die er hineingekommen sei, je werde in dieser Weise verstehen können. Daraus folgte für ihn eine bittere Wahrheit:
Wenn man Schriftsteller sein will, muß man sich zu der Konsequenz durchringen, nicht unbedingt Schriftsteller sein zu wollen.
Das war keine leere Bemerkung; sie wies in die Zukunft.
Kunze behält auch in den neu entstehenden Gedichten im Prinzip seine einmal entwickelte Schreibweise bei, vor allem das Bestreben, durch Verknappung auf engstem Raum ein Höchstmaß an Ausdruck zu erreichen. Er versucht, diese, wenn man es gelehrt sagen will, ,ecriture‘ an den neuen Wahrnehmungen zu erproben. Das Blickfeld des in diesen Texten Sprechenden ist auf den Horizont seiner Privatheit zurückgezogen; die Gedichte der bei den schmalen Bände Auf eigene hoffnung (1981) und Eines jeden einziges leben (1986) beziehen sich auf die unmittelbar erlebte Umwelt, auf die neue Lebenssituation, auf Erinnerungen und auf den Schmerz eines zerteilten Lebens, und wo sich der Horizont weitet, bleiben sie doch an die persönliche, ja private Perspektive gebunden. Die Welt erscheint in isolierten Reiseeindrücken (aus Amerika, aus Portugal, aus der Provence oder aus Israel). Die einfachen täglichen Dinge, die Selbstverständlichkeiten geben die Themen vor, das Finden eines Lebensortes, befremdliche (und auch abgelehnte) Gewohnheiten der neuen Nachbarn, die Jahreszeiten, die Beschädigung und Zerstörung der Natur, deren Teil wir sind.
Das Echo auf seine Gedichte veränderte sich indes, sein Erfolg bekam eine besondere Färbung. Kunze blieb im wesentlichen der Autor der frühen Lyrikbände sensible wege (1969) Zimmerlautstärke (1972), vor allem aber von Die wunderbaren Jahre (1976) und des Kinderbuchs Der Löwe Leopold (1970). Ein Teil seiner Bücher erlebt durchaus hohe Auflagen, aber ihr Autor steht doch – trotz Büchner-Preis (1977) und vielen Ehrungen – eher am Rande. Das mochte zunächst auch einigermaßen äußere Gründe haben; er störte – ähnlich wie Jürgen Fuchs – das herrschende Meinungsklima, das auf ein Agreement mit ,dem Osten‘ geeicht war und die Konfrontation eher über den Atlantik suchte. So konnte es nicht ausbleiben, daß er politisch konservative Kräfte anzog:
Ein menschliches buch, sagte die stimme am telefon […]
Könnten Sie, sagte die stimme,
nicht auch etwas schreiben
in unserem sinn?
Aber nach 1990 änderte sich die Situation nicht sonderlich; das lenkt die Aufmerksamkeit zurück auf das diesem Autor literarisch Eigentümliche. Er sei, stellt er einmal diese Erfahrung überdenkend fest, in den Augen der ,Westler‘ „altmodisch“. Das ist nicht unrichtig. Schon der Sprachgebrauch Kunzes sticht (in den beiden ,westdeutschen‘ Lyrikbänden vielleicht noch merklicher) gegen den als zeitgenössisch-modern geltenden Duktus ab. Trotz ihrer häufigen Frakturierung mag Kunzes Metaphernsprache dem ,westlichen‘ Ohr zu dringlich, zu geschlossen vorkommen, etwa die von Christa Wolf her berüchtigte Metaphorik des Hausbaus, und der Ton zuweilen (bewußt!) arg hoch angesetzt sein:
Wo,
aaawo bliebe das wort, abgeschwiegen
dem tod, wäre, hochgesetzt,
der hallraum nicht
eines herzens
Aber auch dort, wo Verse artifiziell, stilistisch ,modern‘ angelegt sind, führen die Gedichte nur zu leicht in Bereiche, die jenseits der Scheidelinie zur ,Moderne‘ liegen. Das betrifft ganz besonders jene Texte Kunzes, die sich mit der Erfahrung ,westlicher‘ Lebensweisen auseinandersetzen. Schnell wird hier das ,moderne‘ Leben in sehr altvertrauter Weise als bar jeder ,Mitte‘ und als röhrend leer denunziert: Jugendliche Motorradfahrer mutieren zur Metapher moderner Uneigentlichkeit:
Auch durch euch ertaube ich
an dieser zeit
Im leerlauf
vollgas
Es scheint, als schütze sich der Autor hier gegen die Fremdheit der neuen Erfahrungswelt durch eine Flucht in vertraute gedankliche und literarische Modelle. Während – um hoch zu greifen – Rilke etwa im Archaischen Torso Apollos die Zentrierung, die Wendung in ein wesentliches Innen, nur noch negativ, nur noch in der Aufforderung zur Umkehr formulieren kann, dieses ,Innen‘ selbst aber nicht mehr aufzufüllen vermag, setzt Kunze auf die positive Kraft des lyrischen Sprechens; der ,poetischen‘ Sprache kommt noch die Kraft zu, ,Sinn‘ zu produzieren:
Aus der höhe schlägt der bach ein, der berg
weist nach unten
Die richtung, die auf uns lebenden lastet
Unter der kalkuliert zersplitterten Textoberfläche funktioniert hier die poetische Sprache noch uneingeschränkt; Metaphern erzeugen noch direkten ,Sinn‘, Natur dient noch als Symbol; das Signifiant zieht ungebrochen das Signifié nach sich. Unter Umständen kann diese ästhetische Korrespondenz politische Dimensionen bekommen:
Lieber über eure köpfe
hinwegfliegen, freunde, lieber
hinwegfliegen müssen über eure köpfe, als
hinwegschreiben
Wo die Kunst-Sprache der ,Moderne‘ die Zerstreuung, die Dispersion – klagend oder feiernd – beschwört, da setzen Kunzes Verse immer wieder auf die sammelnde Kraft von Phantasie und Dichtung. Auf den – nach des Autors Meinung – groben Klotz der Skepsis gegenüber solcher Hoffnung, setzt er – als sei er Robert Gernhardt – den groben Keil reimender Polemik:
Von hundert germanisten liebt die dichtung einer
Berufen ist zum germanisten außer diesem keiner
Die so Gescholtenen könnten zu den Überlegungen über die zeitkritischen Gedichte Kunzes aber doch eine historische Anmerkung beisteuern: Auch wenn (oder vielleicht sogar weil) diese neue Welt – stärker als ihr Autor es selbst einräumt – in den beiden Bänden fremd bleibt, dann ist sie ihm doch auf eine bekannte Weise vertraut; auch literarisch: Der traditionell kulturkritische Blick auf die USA sieht, was er schon vorher und immer gewußt hat. Und er antwortet in der bekannten Sprache, etwa wenn es um eine Garage geht:
Raubtiere,
schieben sie ihre schimmernden schnauzen
über die betonbalustrade,
gierig, am abend wieder
ihren menschen zu verschlingen
Die Motive, die der Autor in diesem Themenkomplex aufgreift, sind durchaus nicht – wie es auf den ersten Blick scheinen möchte – beliebig, es sind vielmehr diejenigen, die vom kulturkritischen Diskurs seit einem Jahrhundert aufbereitet worden sind, und zwar im Negativen (wie vor allem in Motivfeldern ,USA‘ oder ,Stadt‘) wie im Positiven (z.B. im Bildfeld ,Süden‘). Wenn man diese Niederschläge seiner Reiseeindrücke kontrastiv etwa mit denen von Peter Handke oder Rolf Dieter Brinkmann in Beziehung setzt, dann erkennt man leicht die Schablone, auf der sie aufgetragen sind.
Ich bin angekommen – auch dies ist mein Land.
Aber diese – der gescholtene Germanist mag sagen – Gefährdung, im Verlust der Erfahrung den Verlockungen der Diskurse zu verfallen, läßt am Ende doch auch das Spezifische des Lyrikers Kunze deutlich heraustreten. Die beiden ,westdeutschen‘ Bände sind überzogen mit Zitaten von Dichtern und Anspielungen auf Autoren der europäischen Moderne. Hermann Hesse, Georg Trakl, Gottfried Benn, Alfred Kubin, Oskar Loerke, Marie Luise Kaschnitz, Sergej Jessenin, Fernando Pessoa, Ilse Aichinger… Die Texte sind am dichtesten dort, wo ihr Verfasser mit den An- und Aufgerufenen ins Gespräch kommt, so mit Peter Huchel:
Wenn eure lesebücher die verluste melden werden,
die eure zeitungen verschweigen – dann
vielleicht
Dabei stellen vielleicht nicht einmal die Inhalte oder die Themen die Verbindungen her, es ist die Form, der Duktus, der sie stiftet. Kunze bewohnt – wenn man es einmal poetisch ausdrücken will – einen gemeinsamen Sprachraum mit ihnen.
Anders als die Zivilisationsbezirke des ,Westens‘ sind – so will es dem Leser dünken – die Landschaften der ,Kunst‘, jene Bezirke, in denen der Autor nicht anzukommen braucht, weil er schon seit langem dort wohnhaft ist. In der Literatur, und überhaupt in der Kunst, findet er neben dem verlassenen und dem neu zu gewinnenden Deutschland ein spezifisches, adäquates Areal, das ihm mit Erfahrung gefüllt ist.
Bereits in den Gedichten, die in der DDR entstanden sind, spielen Literatur, Musik und Kunst eine deutliche Rolle; das setzt der Autor fort. Im selbstbezüglichen Reden der Kunst über sich selbst entfalten die bislang letzten Lyrikbände ihre Prägnanz:
Von niemandem gezwungen sein, im brot
anderes zu loben
als das brot
Dabei sprechen nicht einmal diejenigen Gedichte am intensivsten von Literatur oder Musik, in denen in fast poetologischer Weise die Kunst zum Thema wird, etwa wenn von Andersens Märchen gesprochen wird, über den Dirigenten Lawrence Forster oder über die leidige Frage „Und was will der dichter [womöglich: uns] damit sagen?“. Prägnanter ist das Gespräch über Kunst dort, wo von ihr recht eigentlich gar nicht die Rede ist, wo der Bezug sich über den Ton herstellt, wo der Sprechende seinen Gegenstand in den Ton eines anderen nachgerade übersetzt:
Halb hängend am gestein halb
ins wasser gepfählt
Todüber todunter
Vom fels der abschlägt erzählt
das beinhaus
Kunze schreibt sich ein in die Traditionslinie der deutschen Naturlyrik unseres Jahrhunderts; die Webfäden gehen zwischen den Texten hin und her, spinnen ein dichtes Netz, hier zu Huchel, dort zu Loerke, anderswo zu Langgässer, auch zu Sarah Kirsch. Das Gewebe wird dicht in seiner Selbstbezüglichkeit.
Der Junge hat Mut zum Niegesehenen
Dieser Weg ins gleichsam rein Poetische kommt in den 90er Jahren an ein überraschendes Ziel; Kunze schreibt noch einmal ein Kinderbuch: Wohin der Schlaf sich schlafen legt. Gedichte für Kinder. (1991) Es knüpft zwar in manchem an den Löwen Leopold an, aber es setzt sich auch ganz entscheidend dagegen ab. Zwar: „Auch die wunder im märchen sind verzauberte wunden des dichters“, aber die Wunden sind – anders als im Löwen Leopold – bewundernswert gut verheilt. Es ist, als hätte der Autor endlich wieder ein Publikum gefunden, mit dem er zusammenschwingt wie einst mit seinen Hörern (und Lesern) in der DDR: Kinder im allgemeinen und seine bei den Enkel im besonderen. Oder als hätte er sich ein adäquates Publikum erschrieben: die Kinder in uns Erwachsenen:
Kindergruß
kommt zufuß,
schwebt dir ins Gemüt;
leichtes Ding,
Schmetterling –
sucht, was in dir blüht.
In dieser – wenn man so will – Poetologie des Kindergedichts liegt am Ende ein nicht unerheblicher Appell an den Leser. Die Gedichte dieses schmalen Bändchens sind dort, wo sie geglückt sind, und das sind sie sehr häufig, Geburten der Phantasie und Kinder des sprachlichen Spiels; man möchte sie zitieren, eines nach dem andern,
Der Hahn hat einen Kamm,
mit dem er sich nicht kämmen kann.
Kamm hin, Kamm her – der Hahn ist eitel
und kämmt der Wiese einen Scheitel.
Die hält, wenn sie der Hahn kämmt, still
und trägt das Gras dann, wie sie will.
um zu sehen, welches das schönste sei; und kann sich dann doch nicht entscheiden. Die Referenz für diese Gedichte ist keine irgendwie geartete Realität außerhalb ihrer selbst. Der Kamm, mit dem der Hahn die Wiese kämmt, das sind die verhexten, verwunschenen vier (oder sind es nur drei?) Buchstaben, mit denen die Phantasie des Dichters den Hahn ausstattet, auf daß dieser die Wiese kämmen könne. Schon Morgensterns Wiesel brauchte seinen Kiesel. Das Wort wird bei sich selbst, ,wörtlich‘, genommen, und bei seinem Klang. Und das wird über inhaltliche und klangliche Assoziationen weitergesponnen. Der Wortschatz bleibt knapp, die Gedanken entfalten sich eng im Bild, jede Pointe wird gemieden, die Verse sind knapp, die Strophen werden parallel geführt, ohne doch mechanisch zu leiern. Der ,sentimentalische‘ Kritiker würde sagen, die gelungenen Gedichte seien vollkommen ,naiv‘.
Der Autor wirft die naheliegenden Fragen auf, die unsereiner nie mehr stellt, die aber doch so nahe liegen, wenn sie erst einmal gestellt worden sind. Und in unsern Herzen stellen sie die Kinder: Wohin legt sich z.B. der Schlaf eigentlich schlafen, wenn wir wachen? Darüber muß man in der Tat einen Augenblick nachdenken und zurückfragen, um Zeit für die Antwort zu gewinnen:
Wohin der Schlaf sich schlafen legt,
wenn Großvater erwacht?
Am Morgen zwischen die Hörner der Kuh.
Das erscheint glaubwürdig, denn was wäre ruhiger als eine wiederkäuende Kuh? Und das ist zugleich poetisch, denn was erfreute mehr als die heile Natur? Und damit es denn doch nicht zu idyllisch wird, und wir uns besorgt (und banausisch) fragen, ob denn die Kühe am Morgen wirklich schon wiederkäuen, wird behend ein „Furchttraum“ und in der folgenden Strophe ein „Wirrtraum“ eingestreut. Und außerdem erkennt man in der Zeichnung von Karel Franta ganz deutlich zwischen den rosen bekränzten Hörnern der Kuh, wie dem Schlaf die Augen zufallen!
Der Dichter dieser Verse verwandelt sich in den Sohn einer Geschichte aus den Wunderbaren Jahren, dem einer der Freunde des Erzählers prophezeit, er werde Dichter, denn „der Junge hat Mut zum Niegesehenen.“
Die Wiese ist geschoren,
und hätte sie zwei Ohren,
wäre sie ein Schaf
[…]
Und Gras und Wolle wachsen
in Bayern wie in Sachsen
der Wiese und dem Schaf
Eva und Uwe-K. Ketelsen, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Unversiegelte Botschaften
– Anmerkungen zu Reiner Kunzes Dichtung. –
Über Jahrzehnte habe ich wohl keine Gedichte von Reiner Kunze gelesen, oder sie doch nur gelegentlich in diversen Jahrbüchern, Anthologien wahrgenommen. Dabei sie mir in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre so dringlich und gegenwärtig gewesen, diese zumeist kurzen, streng gearbeiteten Texte, die 1973 in einer aus den in Westdeutschland publizierten Bänden Sensible Wege (1969) und Zimmerlautstärke (1972) kompilierten Auswahl in der DDR erschienen waren, unter dem Titel Brief mit blauem Siegel im Leipziger Reclam Verlag. Zu dieser Zeit erst sollte mir auch der Name ihres Autors bekannt werden, über ein zerlesenes Reclam-Bändchen, das im Freundeskreis von Hand zu Hand ging. Mit Gedichten, von denen sich viele aus meiner Generation angesprochen fühlten, ob ihrer sprach-, zeit- und gesellschaftskritischen Haltung; in ihnen fand sich kaum verschlüsselt auf den Punkt gebracht, was die Verhältnisse in der DDR ausmachte, oft formelhaft, eingängig, zuweilen auch didaktisch (wie wenig später in Die wunderbaren Jahre), die Verse dabei von einer Klarheit und Klarsichtigkeit, mit einem Impetus von Aufklärung, in einer Zeit, in der es noch nicht obsolet war, in Zusammenhang mit Lyrik von Botschaften zu sprechen. Reiner Kunzes ab Mitte der fünfziger bis in die siebziger Jahre hinein entstandenen Gedichte sind ohne den Kontext des obrigkeitlich verordneten Schweigens über die tatsächliche Verfaßtheit des Landes, in dem sie verortet, kaum denkbar, sie bildeten nicht zuletzt eine poetische Antwort darauf. Bestechend ist die epigrammatische Kürze vieler Texte, ihre Pointiertheit, die sie mit wenigen Metaphern auskommen läßt – und was die Peripetie, der Umschlag in eine neue Weise des Sehens, der Wahrnehmung, die zumeist in den letzten drei vier Zeilen dieser Gedichte statthat, an veränderten Sichtweisen, Perspektiven generiert, eignet mitunter Sentenzcharakter. Beispielhaft dafür wie auch für die Arbeitsweise des Autors, der sinnliche Eindrücke zu einprägsamen Metaphern zu verdichten weiß, mag hier ein Auszug aus den 21 Variationen über das Thema „Die Post“ stehen:
1
Wenn die post
Hinters fenster fährt blühn
Die eisblumen gelb
2
Brief du
Zweimillimeteröffnung
der tür zur welt du
geöffnete öffnung du
lichtschein,
durchleuchtet, du
bist angekomme
3
Tochter, briefträgerin vom
briefkasten bis zum
tisch, deine stimme ist
das posthorn
[…]
Dabei schwingt in diesen Gedichten etwas mit, das unauflösbar und nicht einfach als Subtext oder Anspielung zu verstehen ist, sondern in dieser strengen Diktion auf kleinstem Raum, der Reduktion bis fast auf den Kerneinfall Atmosphäre und Weite entstehen läßt, Allgemeingültigkeit besitzt. Liest man diese Gedichte heute, entkleidet der Vordringlichkeit des Kontextes, in dem sie entstanden sind und auch rezipiert wurden, vermittelt das Unauflösbare ein Gefühl von Lebendigkeit, Aktualität und entfaltet poetische Wirkkraft. Diese an chinesische oder ostasiatische Dichtung gemahnende Strenge seiner Arbeiten der 60er/70er Jahre findet eine Fortsetzung in neueren Gedichten, die von einem Aufenthalt 2005 in Südkorea und der Auseinandersetzung mit altkoreanischer Dichtung inspiriert sind (lindennacht 2007).
Nach seinem Weggang aus der DDR 1977, aufgrund der über ein Jahrzehnt lang erduldeten Repressionen, hat Reiner Kunze sich sofort auf die Verhältnisse im anderen Teil Deutschlands eingelassen und sie in seine dichterischen Erkundungen einbezogen, wovon auch der erste nach seiner Übersiedelung publizierte Gedichtband auf eigene hoffnung (1981) Kunde gibt.
Kunzes frühe Gedichte (zum Teil in den Bänden Die Zukunft sitzt am Tische 1955 und Vögel über dem Tau 1959 im Mitteldeutschen Verlag Halle/S. publiziert) geben sich erzählerischer, bildreicher, etwa wenn von den Bergbaulandschaften der Kindheit die Rede ist, der Arbeit seines Vaters, der als Hauer tätig war. Ein thematischer Faden, der dann in den späten Arbeiten der lindennacht wieder aufgenommen wird, hinübergeleitend zu Texten, in denen Altersthemen Niederschlag finden. Aber bereits in den frühen Texten kann man zum Teil vorgebildet entdecken, was auch späterhin sein Schreiben bestimmen sollte. „Gespräch mit der Amsel“:
Ich klopfe an bei der amsel
Sie
zuckt zusammen
Du? fragt sie
Ich sage: es ist still
Die bäume loben die lieder der raupen, sagt sie
Ich sage: … der raupen?
Raupen können nicht singen
Das macht nichts, sagt sie,
aber sie sind grün
Reiner Kunze ist in einem Elternhaus ohne Bücher, doch mit viel Liebe aufgewachsen. Krankheitsbedingt lebte er zeitweise isoliert von anderen Kindern, und in dieser notgedrungenen Einsamkeit ist er zum Schreiben gelangt, vermittels dieses metaphorischen, schöpferischen Sehens, das allen Kindern eigen ist und poetische Einfälle zu generieren vermag, wie er in einem Fernsehgespräch mit Peter Voß im Jahre 2000 auf 3sat bekannte. Wenn Ihnen solche Einfälle kommen, so führte der Autor in diesem Gespräch weiter aus, und Sie schreiben die Gedichte nicht, versündigen Sie sich an der Poesie, der Freiheit und den Menschen.
Die Zeitgenossenschaft etwa mit der Dichtung Huchels und des späten Brecht, aber auch die Einflüsse der tschechischen Dichtung der fünfziger und sechziger Jahre, für die stellvertretend Jan Skácel, Miroslav Holub oder Ivan Blatny genannt seien, von denen er auch Arbeiten nachdichtete, sollten dabei stilbildend wirken. Über seine spätere, aus einem deutsch-tschechischen Elternhaus in Böhmen stammende, Ehefrau Elisabeth, die dort als Ärztin arbeitete, kam Reiner Kunze mit einer tschechischen Literatur- und Kulturszene in Berührung, die sich nach der Entstalinisierung ab der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre weit liberaler und vitaler als die in der DDR gab. Sie lieferte auch die Übersetzungen tschechischer Texte, auf deren Grundlage seine Nachdichtungen basieren. Und die Beschäftigung mit dieser Lyrik, die selbstbewußt mit den Ausdrucksformen der europäischen Moderne hantierte, zeitigte auch Auswirkungen auf sein eigenes Schreiben, brachte beispielsweise ein spielerisches Moment hinein.
Jayne-Ann Igel, signaturen-magazin.de, 2013
Nachträgliche Erläuterung des Selbstverständlichen
Diese nicht wichtigen, ganz und gar nicht wichtigen Zeilen schrieb ich für Reiner Kunze, nachdem man ihm endlich erlaubt hatte, zum erstenmal nach England zu reisen – wo ich ihm eine Einladung zum Internationalen Lyrikertreffen in Cambridge verschafft hatte –, ihn aber trotz Gallenkrankheit zuvor mit abwechselnden Erlaubnissen und Verboten und den dazu erforderlichen Reisen zwischen Greiz und Berlin dermaßen strapaziert hatte, daß er in unserem Londoner Haus zusammenbrach. Als er fast bewußtlos im Bett lag, riefen wir die Botschaft der DDR an, um den Namen eines deutschsprachigen Arztes zu erfahren, damit ihm Reiner Kunze sein schon längst diagnostiziertes Leiden erklären könne. Die Antwort war, daß man dort an der Verfassung Reiner Kunzes nicht interessiert sei. Dann riefen wir bei der Botschaft der Bundesrepublik an, die uns einen Arzt empfahl, der aber im Urlaub war. Daraufhin riefen wir unseren englischen Hausarzt, der glücklicherweise ohne Erklärung sofort erkannte, was Reiner Kunze fehlte und sogar das Medikament, welches ihm dringend eingespritzt werden mußte, bei sich hatte. Später schrieb mir Reiner, daß er ohne diesen Eingriff sehr bald gestorben wäre, und dankte meiner Frau und mir dafür, daß wir ihm das Leben gerettet hatten. Natürlich hatten wir nur das Selbstverständliche getan, übrigens in einer doppelten Krise, da direkt nach dem selben Lyrikertreffen ein anderer Beteiligter, Rolf Dieter Brinkmann, in London überfahren und getötet worden war und sein Freund Jürgen Theobaldy von unserem Haus aus die Witwe benachrichtigen mußte.
Vor kurzem las ich in einer Besprechung in der NZZ meiner deutschen Gedichtauswahl UNTEILBAR folgendes Urteil über Reiner Kunzes Version meines Textes:
Es gibt originellere Gedichtzeilen als die, die uns belehren, ,wie man Bürokraten schlägt‘, uns dann dazu auffordern, diesem Impuls doch lieber nicht nachzugehen.
Schon als ich Reiner Kunze seine Übersetzung mit einigen Änderungsvorschlägen zuschickte, entschuldigte ich mich für die Frivolität meiner Verse, aber ohne Erklärung der Gründe dafür, die ja für ihn selbstverständlich waren. Falls aber das Selbstverständliche für andere Leser erläutert werden muß, hole ich zur Feier seines Überlebens und unserer Verbundenheit mit dem Dichter die Erläuterung nach.
Über den Fall Reiner Kunzes, seine Folterung durch die Bürokratie bis an den Rand des Todes, durfte das Gedicht nichts aussagen. Jede erkennbare Anspielung auf seinen Fall hätte seine Lage in der DDR, in die er zurückgekehrt war und wo er wieder krank lag, weiter gefährdet. In seiner Situation hatte schon zur Übersetzung meiner Zeilen sehr viel Mut gehört, nachdem für eine von mir zusammengestellte Anthologie der DDR-Lyrik mit englischen Übersetzungen auch von Gedichten Reiner Kunzes mir die Veröffentlichungsrechte pauschal entzogen worden waren, weil ich mich weigerte, die von mir gewählten Texte mit den von der Behörde gewählten zu ersetzen, aber die Anthologie trotzdem veröffentlicht hatte. Damit war auch ich zum Staatsfeind geworden.
Warum aber kein ernsteres, wichtigeres Gedicht in originellerer Sprache? Weil ich zu einem solchen gar kein Recht hatte, in einem anderen Land lebte und nur andere, weniger lebensgefährliche Bürokratien am eigenen Leib erfahren hatte. Selbstverständlich für Reiner Kunze war auch, daß das Gedicht zu gar nichts aufforderte, sondern etwas zum Wesen der Bürokratie – jeder Bürokratie, irgendwo in der Welt – sagen wollte: etwa daß die Bürokratie eine Nichtigkeit, eine Lächerlichkeit ist, die sich so ernst nimmt, daß sie Menschen quälen und morden kann. Um diese Lächerlichkeit und Nichtigkeit ging es mir, der ich auch keinen Beitrag zum Kalten Krieg liefern konnte und wollte. Aus Amerika, wo ich Jahre lang als Gastprofessor arbeitete, kannte ich schon die andere Bürokratie, jene des grassierenden Finanzwesens, welche die Zahlen und Ziffern des Profits zur Ideologie und Idolatrie erhebt. Dort hatte ich auch schon längst gelernt, daß man mit Gedichten keine Systeme umstürzen oder auch nur ändern kann, mußte aber trotzdem einige Gedichte zum Vietnam-Krieg schreiben – zu einer Zeit, da wir in Großbritannien noch den Wohlfahrtsstaat hatten, der auf ethischer, menschenfreundlicher, nicht ideologischer Basis einen Ausgleich zwischen den zwei herrschenden Systemen zu bewahren versuchte.
Solche Bedenken und Erfahrungen stehen hinter der Frivolität meiner Zeilen. Wenn die Bürokratie der DDR ohne Gewalt gestürzt werden konnte, weil sie, wie ich glaube, ihre Nichtigkeit und Lächerlichkeit selber zur Absurdität, damit zur Selbstauflösung übertrieben hatte, sind auch die Absurditäten und Übertreibungen des Gedichts nicht ganz unsinnig. Das war 1975 noch nicht vorauszusehen. Aber, wie ich schon irgendwo schrieb, wissen die Gedichte oft mehr als deren Autoren.
Michael Hamburger, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Ohne Traumata kein Leben
– Ein Gespräch mit Reiner Kunze. –
Christian Eger: Herr Kunze, Sie wurden im August 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge als Sohn eines Bergmannes und einer Heimarbeiterin geboren. Sie können mit Gottfried Benn sagen, „in meinem Elternhaus hingen keine Gainsbouroughs“. Welcher Geist herrschte im Haushalt Ihrer Kindheit?
Reiner Kunze: Mein Vater, ein gelernter Klempner, hat Zeit seines Lebens als Steinkohlenbergmann gearbeitet, ebenso der Groß- und Urgroßvater. Der Vater meiner Mutter war Steinbildhauer und scheint ein begabter Mann gewesen zu sein. Bei ihnen zu Hause – meine Mutter hatte vier Geschwister – ist viel gesungen worden. Sie und die älteren Schwestern haben auch in Chören gesungen. Der Vater nahm sich jedoch das Leben. Wahrscheinlich – darüber ist nie gesprochen worden – war das Geschäft hochverschuldet gewesen. Die Familie verarmte über Nacht, und meine Mutter ging nach Berlin und verdingte sich als Dienstmädchen. In meinem Elternhaus gab es keine Bücher, aber das ständige Singen meiner Mutter. Sie hat bei fast jeder Arbeit gesungen, so daß ich als kleiner Junge alle gängigen Volkslieder auswendig konnte.
Eger: Die Volkspoesie ist Ihre Basisbücherei?
Kunze: Mein erstes Buch war ein gesungenes Buch. Mein Interesse aber galt vorerst dem Malen. Selbstverständlich gab es bei uns keine Bilder an der Wand, an denen sich hätte ein Stilgefühl orientieren können. Ich saß bei einem Bauern auf der Haustreppe oder auf einem leeren Leiterwagen und habe Tiere gemalt, Tiere mit großen Augen. Tieraugen faszinieren mich noch heute – das Unergründliche in ihnen, das Geheimnis, das für uns immer verborgen bleiben wird.
Eger: Wie kamen die Bücher in Ihr Leben?
Kunze: Auf meinen Füßen. Aber erst, als ich lesen gelernt hatte. Ich möchte nicht wissen, was ich da alles an nicht Empfehlenswertem angeschleppt habe. Aber es waren auch die Grimmschen Märchen und die Märchen von Andersen dabei, die meine Phantasie bevölkerten. Und mit dem Lesen kam das Schreiben.
Eger: Das alles lief nebeneinander her: Malen, Lesen, Schreiben, ungewöhnliche Tätigkeiten für ein Arbeiterkind.
Kunze: Ich war ein Eigenbrödler oder, freundlicher gesagt, ein Einzelgänger, und das hing wiederum mit meinem Gesundheitszustand zusammen, der mich oft längere Zeit von anderen Kindern fernhielt.
Eger: Gab es einen resignativen Zug im Alltag Ihrer Familie, der sich dem sozialen Statusverlust Ihrer Mutter verdankte?
Kunze: Nein. Meine Mutter hat unter der Armut gelitten, aber nicht darunter, daß sie eine Arbeiterfrau geworden war. In der Inflationszeit – mein Vater war arbeitslos gewesen – haben beide gehungert. Meine Mutter hatte darin sogar eine Ursache dafür gesehen, daß ich kurz nach meiner Geburt am ganzen Körper an einem endogenen Ekzem und an Asthma bronchiale erkrankte. Sie hat zusätzlich an meinen jahrelangen Leiden gelitten. Statusdenken war ihr jedoch ebenso fremd gewesen wie Klassendenken.
Eger: Das Erzgebirge Ihrer Kindheit war eine ernste, arme und verheißungsarme Landschaft. Welches Weltbild herrschte im Milieu der Bergleute?
Kunze: Der Vater meines Spielkameraden aus dem Nachbarhaus war Mitglied des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps. In Uniform stoppte er mit seiner Verkehrskelle die Motorradfahrer, die den Höhlteichberg herab gebraust kamen, und demonstrierte so stolz seine Macht. Ein Bergmann. In einer Gärtnerei lebte zurückgezogen der alte Herr Schmalfuß. Eines Tages war er verschwunden. Ich schnappte auf, man habe ihn „abgeholt“. Die Bergarbeiterfrauen tuschelten nur, und meine Mutter war verstört. Was es damals bedeutete, Jude zu sein, habe ich gewiß nicht verstanden, aber es war mir lange Zeit unheimlich, am Zaun der Gärtnerei entlangzugehen. Unmittelbar nach Kriegsende holte ein Bergmann sein verstecktgehaltenes Mitgliedsbuch der Kommunistischen Partei hervor, ging zum Kommandanten des Lagers, in dem die Sowjets die Mitglieder der NSDAP interniert hatten, und verbürgte sich für seinen Arbeitskollegen, der später als „Verdienter Bergmann der DDR“ ausgezeichnet wurde. Noch Anfang der fünfziger Jahre denunzierte ein Rentnerehepaar – er war Bergmann und früher Mitglied der KP gewesen – einen ehemaligen Kollegen als nationalsozialistischen Überzeugungstäter. Nach wochenlanger Untersuchungshaft in Chemnitz wurde dieser jedoch freigelassen, weil das Ehepaar aus dem Gefühl des politischen Zurückgesetztseins die denunzierte Tatbeteiligung erfunden hatte. Von diesen und anderen Erinnerungen ein „Weltbild der Bergleute“ abzuleiten, sehe ich mich außerstande, zumal ich damals selbst die Welt erst kurze Zeit im Bild hatte, denn ich war ein Kind.
Eger: Das Bergleute-Milieu war nicht imprägniert gegen die NS-Propaganda?
Kunze: Wohl nicht mehr als vergleichbare andere Milieus. Ich habe das Regime nicht gehaßt, weil ich ein Arbeiterkind war, sondern weil ich ein Individualist war. Wir mußten ja alle zu den „Pimpfen“ und uns bei den Geländespielen gegenseitig blutige Nasen schlagen. Das Aufgehen in der Masse widerstrebte mir ebenso wie das Einschlagen auf einen anderen.
Eger: Das Bündische, Cliquenhafte, dabei auch Auftrumpfende, hat Sie nie auch nur etwas fasziniert?
Kunze: Ich weiß nur, daß es für mich ein Grauen war. Ich hatte immerfort verbundene Arme, verbundene Beine, da das Ekzem eiterte, und ich hatte damals so schweres Asthma, daß ich mich im Straßengraben nach vorn beugen und mit beiden Armen aufstützen mußte, um Luft zu bekommen: Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Wir mußten uns aber im Schlamm wälzen und ins Wasser springen, und damals konnte ich noch nicht schwimmen, weil ich nicht ins Wasser durfte. Eines Tages ging ich an der Hand eines SA-Mannes, der ein Arbeitskollege meines Vaters war, an der Oelsnitzer Schmiede vorüber und erzählte ihm von meinen Erstickungsängsten. Daraufhin sagte er mir: Reiner, sag das niemandem – versprich mir, daß Du das niemandem sagst! Geh zu den Pimpfen und tu, was Du kannst. – Erst Jahrzehnte später begriff ich, daß der Mann offenbar etwas vom „unwerten“ Leben gehört gehabt hatte.
Eger: Spielte Politik in Ihrer Familie eine Rolle?
Kunze: Nicht die geringste. Als meine Mutter mit mir schwanger war, ernährten sich meine Eltern monatelang von Kartoffeln, Senf und Salz. Plötzlich bekam mein Vater Arbeit – und diejenigen, die sie ihm gebracht hatten, dürften ihm eines Tages zugeredet haben, in die Partei einzutreten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich kenne von meinem Vater keine einzige ideologische Äußerung. Er bekam regelmäßig eine Zeitschrift, die ungelesen im Nachtschränkchen gestapelt wurde. Als ich eines Tages aus dem Umschlagkarton eines dieser Hefte eine Taube gefaltet hatte und sie auf der Straße fliegen ließ, verpaßte mir mein Vater eine Ohrfeige, und die Taube verschwand augenblicklich. Die Zeitschrift hieß Der politische Leiter.
Eger: Warum gibt es von Ihnen keine Texte, die die Zeit vor 1945 verhandeln?
Kunze: Es gibt sie. In dem Buch Am Sonnenhang. Oder in dem Gedichtband Ein Tag auf dieser Erde. Sollten Sie aber meinen, warum es außer diesen Texten nicht noch andere gibt, könnte ich nur antworten, daß mir zu anderen bisher keine Einfälle gekommen sind.
Eger: Das Gedicht „Nachtmahl auf dem acker“ hebt an:
Wenn großvater am abend
das kräutichtfeuer schürte,
machte er die sterne,
die später über unseren köpfen standen
Wir erkannten sie wieder
Dieses Erleben bewegt sich im naturmagischen, metaphysischen Raum, ohne politische Einspielunqen. Es hat Sie nie gereizt, das Erlebnis Ihrer NS-Jugend zu verhandeln?
Kunze: Nein.
Eger: Was heißt „Einfall“: Ist es ein Gedanke, ein Gefühl, eine Idee?
Kunze: Ich meine natürlich poetische Einfälle, und ein poetischer Einfall ist eine nie dagewesene Vorstellung von Welt. Juan Ramón Jiménez fragt in einem seiner Gedichte die Sterne:
Seid ihr Augen von toten Freunden?
– Ihr blickt so starr! –
Seid ihr Augen von toten Freunden,
die der Erde gedenken…
bei Einzug des Frühlings?
Die Vorstellung, die Sterne könnten die Augen von toten Freunden sein, die der Erde gedenken bei Einzug des Frühlings, ist unerhört. Sie hat den Blick des Menschen vom Universum aus auf die Erde um ein halbes Jahrhundert vorweggenommen, und zwar in seiner tragischsten Dimension: nie wieder auf die Erde zurückkehren, sie nie wiedersehen dürfen. Und Jiménez steigert den Schmerz ins Extreme: Die Erde nie mehr erleben zu dürfen, wenn sie ani schönsten ist: im Frühling. Der poetische Einfall ist eine Vorstellung, die aus Banalem besteht, das ins Unerhörte gewendet ist.
Eger: Schreiben Sie von einer Erkenntnis her oder auf eine Erkenntnis hin?
Kunze: Weder, noch. Zumindest nicht ursächlich oder in zwingender Folge. Ich füge der Welt ein winziges Stück Welt hinzu. Hans-Georg Gadamer sagt, Kunst ist „Zuwachs an Sein“. Dieses Sein kann dann aber – unter vielem anderen – Erkenntnis provozieren.
Eger: Das hieße im Blick auf Ihr Erlebnis des Dritten Reiches, daß es da kein Stück Wirklichkeit hinzuzufügen gibt, das es nicht schon gäbe. Dabei ist die Kindheitsperspektive doch immer originär. Wulf Kirsten zeigt das in Die Prinzessinnen im Krautgarten, Martin Walser in Ein springender Brunnen.
Kunze: Nein, das heißt es nicht, sondern das heißt nur, daß es mir bisher nicht vergönnt war, ein Stück Welt hinzuzufügen, von dem ich annehmen durfte, es sei unerhört, nie dagewesen, nie gesehen. Oder, um es anders zu sagen: Das heißt nur, daß ich nicht Wulf Kirsten oder Martin Walser bin. Und noch einmal anders gesagt: Zu folgern, daß mich das, wozu ich mich literarisch nicht äußere, nicht bewegt, wäre unzulässig. Es gibt keine Kunst ohne tiefe Gefühle, aber ein tiefes Gefühl führt nicht zwangsläufig zu einem Kunstwerk.
Eger: Im Juni 1945 verließen die Amerikaner Sachsen, die Russen rückten nach. Was war es, das Sie für die neue Zeit, die nun begann, so empfänglich machte?
Kunze: Zum einen Dankbarkeit. Ich wurde von der sechsten in die achte Klasse vorversetzt, um mit anderen eine der neu eingerichteten Oberschulklassen für Arbeiter- und Bauernkinder zu füllen. Wozu wir ausersehen waren, konnten wir nicht wissen.
Eger: Das wird auch vielen Ihrer Lehrer nicht klar gewesen sein.
Kunze: Mit Sicherheit nicht. Zum anderen sollte das, was gewesen war, nie wieder möglich werden. Die Buchenwald- und Auschwitz-Fotos loderten in uns.
Eger: Können Sie mit Franz Fühmann sagen, Sie seien „über Auschwitz zum Sozialismus“ gekommen?
Kunze: So abstrakt haben wir damals nicht gedacht, und heute denke ich, was den Begriff „Sozialismus“ betrifft, erst recht nicht so abstrakt. Auschwitz sollte nie wiederkehren, und so wurden wir verführt, ein Lügengebäude mitzuerrichten und zu stabilisieren, in dessen Gemäuer sich tausende Lager mit unvorstellbar furchtbaren Schicksalen befanden.
Eger: Was war es, das Sie angekoppelt hat an das Neue System: War es das neue Selbstbewußtsein, die Freude über eine Chance, die sonst nicht dagewesen wäre…
Kunze: Auch. Ich sagte ja: Ich war dankbar.
Eger: … oder stellten sich über die Präsentation von Auschwitz- oder Buchenwald-Bildern Scham- und Reuegefühle ein, die beantwortet werden wollten?
Kunze: Was sollte ich, der ich ein Kind gewesen war, bereuen? Unsere Verantwortung für die Vergangenheit bestand in unserer Mitverantwortung für die Gegenwart und die Zukunft.
Eger: Aber die Bilder bewirkten doch etwas: Sie stellten doch auch den Schüler in einen Tatzusammenhang.
Kunze: Die Bilder bewirkten, daß wir Kinder für die Vergangenheit, die wir nicht zu verantworten hatten, Verantwortung übernehmen wollten.
Eger: Sie sind 1949 mit 16 in die SED eingetreten. Das war für Sie eine Selbstverständlichkeit?
Kunze: Ich wäre damals nie auf die Idee gekommen! Mein Direktor, Fritz Bellmann, ein ehemaliger Sozialdemokrat, der später von der SED wegen „ideologischer Unklarheiten“ reglementiert und versetzt wurde, holte mich während des Unterrichts auf den Korridor und eröffnete mir, man habe sich entschlossen, mich als Kandidat in die Partei aufzunehmen. Da sind Sie erst einmal sprachlos, fühlen sich aber auch geehrt, in Ihren Leistungen anerkannt. Ich hatte jedoch keine Ahnung, was das bedeutete.
Eger: Wenn Sie zur SED-Mitgliedschaft wie nebenbei – oder besser – wie Hans im Glück zum Goldklumpen kamen, welches Selbstverständnis hatte der Jüngling Reiner Kunze als frischgebackener Genosse?
Kunze: Das Bild vom „Goldklumpen“ trifft ebensowenig zu wie das Wort „nebenbei“. Unwissend bin ich zu einer Last gekommen, die mich letztlich fast erdrückt hätte. Ich habe die Dinge ernst genommen und denen vertraut, die die Dinge, davon bin ich noch heute überzeugt, ebenfalls ernst nahmen, zum Beispiel meinem Direktor, Fritz Bellmann.
Eger: 1951 zogen Sie nach Leipzig, um Philosophie und Publizistik zu studieren. Philosophie hieß, was Sie damals noch nicht wußten, Marxismus-Leninismus. Haben Sie sich für dieses Studium entschieden oder ist es Ihnen präsentiert worden?
Kunze: Lange Zeit hatte ich Malerei studieren wollen. Aber ich hatte immer auch geschrieben, und als ich mich kurz vor dem Abitur nicht für den malenden, sondern für den schreibenden Bleistift entschieden hatte, kam es zu der Empfehlung, Publizistik zu studieren, was damals nur in der Kombination „Philosophie und Publizistik“ möglich war.
Eger: In Leipzig lebten Sie in einem Internat, zusammen mit Kommilitonen wie Klaus Höpcke, dem späteren stellvertretenden DDR-Kulturminister. Die Journalistenfakultät, die „Rotes Kloster“ genannt wurde, war eine tatsächliche, von innen und außen bewachte Kaderschmiede. Hat Sie das Gefühl, Avantgarde und Umwerter zu sein, je erfüllt?
Kunze: Sie verwenden Begriffe, die es damals für uns nicht gab. Wir waren auserkoren, die Menschen davon zu überzeugen, daß ihnen einzig und allein der Sozialismus eine menschenwürdige Perspektive garantierte. Das, was dem in der Wirklichkeit, vor der wir weitestgehend abgeschottet waren, widersprach, hielten wir für nicht systemimmanent. Es waren, glaubten wir, Irrtümer, Fehlentwicklungen, bedauerliche Übergangserscheinungen.
Eger: Welches Ereignis war Ihr erster „Renegatentermin“?
Kunze: Sie meinen ein Geschehen, das mich abtrünnig werden ließ? Das war der Prozeß, der während meines Studiums und meiner Assistentenzeit in mir vorging. Es waren ungezählte Erlebnisse, Haarrisse in der Familie dieser Ideologie und immer tiefere Sprünge in ihrem Kern. Wenn Sie ein weltgeschichtliches Ereignis wissen wollen: Ungarn 1956.
Ich nahm an einer Versammlung des Schriftstellerverbandes der DDR in Berlin teil, auf der Anna Seghers sagte, sie glaube nicht, daß ihr Freund Georg Lukács ein Verräter des Sozialismus sei. Als ich von dieser Versammlung zurückkehrte, standen am oberen Ende der Hintertreppe, die ins Fakultätsgebäude führte, meine Kollegen Klaus Raddatz und Klaus Höpcke und fragten: Nun, was war in Berlin? Ich gab wieder, was Anna Seghers gesagt hatte.
Noch am selben Tag wurde eine Fakultätsversammlung einberufen. Einziger Tagesordnungspunkt: Die ideologischen Schwankungen des Assistenten Reiner Kunze.
Eger: Wie lief diese Versammlung ab? Wer sprach, und was hatten Sie zu sagen? Mit welchem Bekenntnis traten Sie ab?
Kunze: Daran erinnere ich mich nicht. Ich habe eine Unzahl solcher Versammlungen über mich ergehen lassen müssen – von den ersten Wochen des Studiums an bis zum Ausscheiden aus der Universität. Auf der letzten, die über sieben Stunden dauerte, bekam ich Herzsensationen mit Übelkeit bis zum Erbrechen und sah offenbar so elend aus, daß mich das Präsidium kurz nach Mitternacht nach Hause gehen ließ (die Pförtnerin half mir und rief eine Taxe). Die Herzgeschichte erwies sich dann als ernstzunehmend und zog ein längeres Krankenlager nach sich.
An diese Versammlung erinnere ich mich sehr wohl. Man warf mir Verbindung zu einer „konterrevolutionären Gruppe“ vor, die ich nicht hatte (hätte ich sie gehabt, wäre ich verhaftet gewesen), und als ich verlangte, zwei Zeugen zu befragen, rief ein Präsidiumsmitglied, dessen Namen ich nicht nennen möchte: „Wir sind hier nicht in einer bürgerlichen Gerichtsversammlung, wo man Zeugen aufrufen kann!“ Außerdem warf man mir vor, daß einer Reihe meiner Gedichte, die der Berliner Rundfunk gesendet hatte, der Klassenstandpunkt fehle, und forderte, daß ich mich von ihnen distanzierte. Es waren Liebesgedichte.
Ich muß Ihnen wohl nicht erst sagen, mit welchem Bekenntnis ich abgetreten bin. Es war das Ende meiner Universitätslaufbahn.
Eger: Herr Kunze, hatten Sie für das, was Sie in den 50er Jahren schrieben bereits einen Entwurf? Wo sollte das hinführen?
Kunze: Ich hatte nur mehr oder weniger untaugliche Vorbilder, die nicht zur Poesie hin-, sondern von ihr wegführten. Wenn ich den einen oder anderen Text lese, den ich damals geschrieben habe, graut mir.
… griff der Herr zum leeren Glas.
Ach, mir taten diese Menschen leid,
hatten nicht die Gegenwart
nicht die Vergangenheit,
und auch die Zukunft war nicht mehr die ihre,
weil sie lächelnd schon am Tische saß.
Die Klassenarroganz, zu der wir erzogen worden waren, ist unüberhörbar. Der einzige Trost: Auch damals sind einige Texte entstanden, denen man weder etwas von dieser ideologischen Finsternis, noch von dem literarischen Irregeleitetsein anmerkt.
Eger: Welcher lebende Autor hat Sie damals beeindruckt?
Kunze: Zum Beispiel Martin Andersen-Nexö. Ich kannte seine Novelle „Der Lotterieschwede“, und als ich ihn auf einer Tagung der „Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren“ in Dresden persönlich kennenlernte, beeindruckte er mich nachhaltig. In einer Pause lud er mich ein, mit ihm ein paar Schritte ins Freie zu tun. In dem kurzen Gespräch – er hatte eine fistelnde Altersstimme – sagte er unter anderem diesen Satz: Es kommt nicht darauf an, daß man die Marseillaise auf der Bühne singt, es kommt darauf an, daß das Publikum sie singt.
Eger: Dieser Satz hat Sie beeindruckt?
Kunze: Damals schon. Da sang man auf der Bühne.
Eger: Ihre epigrammatische Lyrik wird in Diktion und Färbung gern mit den „Buckower Elegien“ Brechts verglichen. Haben Sie Brecht jemals persönlich getroffen?
Kunze: Nur gesehen.
Eger: Was beeindruckt Sie an Brechts Gedichten?
Kunze: Sein paradoxes Denken. Bei ihm ist es die Paradoxie, die das Banale ins Unerhörte wendet.
In den finsteren Zeiten
Wird da auch gesungen werden?
Da wird auch gesungen werden
Von den finsteren Zeiten.
Eger: Der Leipziger Student Reiner Kunze war nicht nur ein Dichter, sondern auch ein Mann des Apparates, einer, der wenn es denn darauf ankam, die scharfe propagandistische Zunge zu führen wußte. Wie schauen Sie heute auf den jungen Mann, der Sie damals gewesen sind?
Kunze: Jeder, der das System unterstützte, machte sich schuldig, auch wenn er nicht für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet und niemanden denunziert hat. Nur war ich mir damals dieser Schuld nicht bewußt. Wenn ich Grund gesehen habe, aufzubegehren, habe ich aufbegehrt.
Eger: Gibt es auch Sympathiepunkte, die Sie dem jungen Mann geben, der Sie einmal gewesen sind?
Kunze: Ich hoffe, nie wider besseres Wissen oder gegen meine Überzeugung gehandelt zu haben.
Eger: Jurek Becker sprach von Opportunismus als von jenem „Ingredienz Menschlichkeit, das in Anpassung steckt“, und das auf die nur relative und nicht absolute Wahlfreiheit hindeutet, die den Menschen zur Verfügung steht. Für welchen Opportunismus haben Sie Verständnis?
Kunze: Vorübergehende Anpassung an die jeweilige Situation ist oft unumgänglich, um die Situation eines Tages verändern zu können. Das darf aber nicht an die menschliche Substanz gehen und zum Verrat an Grundwerten führen .
Eger: Warum sind Sie 1959, mit Ihrem Abgang von der Universität, nicht aus der SED ausgetreten?
Kunze: Weil ich damit Personen geschadet hätte, die sich für mich eingesetzt und mich gebeten hatten, diesen Schritt nicht zu tun, unter anderen Hermann Budzislawski, Chef des Institutes für Publizistik, und Edith Nell, die Witwe des Arbeiterschriftstellers Peter Nell, mit der ich seit vielen Jahren befreundet war. Sie war die Chefredakteurin der Modezeitschrift Sibylle. Ihr schuldete ich ebenso Rücksichtnahme wie meinem Chef. Ich gehörte dann zu einer Wohnparteiorganisation von Hausfrauen. Aber nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei am 21.8.1968 war auch eine formelle Mitgliedschaft nicht mehr zu vertreten.
Eger: Gibt es, das Ideologische abgezogen, Linien, die Ihre Vor-59er-Lyrik mit dem späteren Werk verbinden?
Kunze: Die Einflüsse, die vom Volkslied, herrühren, vom Minnesang und von Heine.
Eger: Welchen Heine meinen Sie? Den frühen Herztondichter oder den Spötter und Patrioten?
Kunze: Den Heine der „Lutetia“ samt Vorwort zur französischen Ausgabe („Ich wünsche den Dummen ein bißchen Verstand und den Verständigen ein bißchen Poesie.“), den Briefeschreiber über Deutschland oder den Verfasser der „Harzreise“. Was nicht heißen soll, ich verneigte mich nicht vor frühen oder halbfrühen Gedichten wie „Im wunderschönen Monat Mai…“ und „Leise zieht durch mein Gemüt…“.
Eger: Die DDR war eine Erziehungsdiktatur: Volkserzieher auf der offiziellen Seite, die großen Durchschauer auf der anderen. Kein Land ist (gerade von „unten“) so in Breite durchschaut worden, ohne daß der Einzelne mit Genauigkeit wüßte, wo es lang gehen kann: politisch, privat. Auch in einigen Ihrer Gedichte gibt es den Gestus der pädagogischen Ansprache. Halten Sie den Menschen für belehrbar?
Kunze: Manchen. Wobei Belehrung nicht in meiner Absicht lag.
Eger: Sie bezeichnen das Jahr 1959 als „die Stunde Null“ in Ihrem Leben. Sie verlassen die gesellschaftspolitische Herberge, arbeiten ein Jahr lang als Hilfsschlosser, schreiben nebenbei und lernen – zunächst und über ein Jahr – Ihre spätere Frau, die Deutsch-Böhmin Elisabeth Littnerová, als Briefpartnerin kennen. Von 1961 anführen Sie wiederholt längere Aufenthalte in die Tschechoslowakei, vor allem nach Böhmen. Was haben Sie in Böhmen gefunden?
Kunze: Durch die Begegnung mit der tschechischen Poesie ist mir erstmals das Wesen des Poetischen voll bewußt geworden. Das ist das eine. Das andere: Ich stieß im monolithischen und ideologischen Gestein erstmals auf Adern entideologisierten Denkens. Und beides bedeutete in beiden Bereichen den Vorstoß ins Existenzielle.
Eger: Wie würden Sie die politische Position konturieren, die Sie Mitte der 60er Jahre eingenommen hatten. Waren Sie noch Sozialist? Es gibt ja von Ihnen das Gedicht „dreiblick“ von 1965, das endet: „eingesperrt in dieses Land / das ich wieder und wieder wählen würde…“
Kunze: Ich spreche vom Land, nicht vom politischen System.
Eger: Sie meinen Deutschland?
Kunze: Václav Havel schreibt in seinen „Sommermeditationen“, er behaupte schon lange nicht mehr, Sozialist zu sein. Nicht weil sein Herz seinen Platz gewechselt hätte, sondern weil dieses Wort eher verwirre, als daß es etwas Präzises ausdrückt, und soweit es heute wieder etwas auszudrücken beginne, dann nicht das, was entsprechend seinen derzeitigen Erkenntnissen irgendeinen sinnvollen Ausweg anbieten könnte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Eger: Wann war Ihnen klar; daß die DDR real und faktisch auf ihr Ende zuläuft?
Kunze: Ende der fünfziger Jahre war mir klar, daß das politische System der DDR in seinem Wesen nicht reformierbar war. Ich habe aber nie geglaubt, noch eine Welt ohne sowjetischen Machtblock und ohne DDR zu erleben.
Eger: War der „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, der von Alexander Dubček von Prag aus verkündet wurde, für Sie in den 60er Jahren eine politische Option?
Kunze: Dubček hatte mehr geistige Freiheit angemahnt und durchzusetzen begonnen sowie eine vorsichtige Öffnung der Planwirtschaft in Aussicht gestellt. Er hatte Willkür Willkür genannt und dem Unterdrückungsapparat Zügel angelegt. Die Macht sollte aber fest in Händen der Kommunistischen Partei bleiben und das Prinzip der Diktatur des Proletariats nicht in Frage gestellt werden. Václav Havel, mit Rio Preisner damals der Wortführer einer verschwindenden intellektuellen Minderheit, trat dagegen für ein pluralistisches System ein, für Parlamentarismus, Gewaltenteilung und umfassende Privatisierung als Grundlage für eine Marktwirtschaft und einen sozialen Rechtsstaat.
Eger: Sie haben damals bereits zwischen demokratischen Sozialisten und Demokraten unterschieden?
Kunze: Nicht zwischen „demokratischen Sozialisten“ und Demokraten, sondern zwischen Politikern, die an den Grundfesten des sozialistischen Systems festhielten, und Demokraten. Die Grundfesten des sozialistischen Systems bedeuteten das Gegenteil von Demokratie. Diese Unterscheidung paßte natürlich nicht ins Weltbild der Achtundsechziger im Westen.
Eger: Und im Osten?
Kunze: Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen in der DDR sahen sich lediglich vor der Entscheidung, den Einmarsch der Warschauer Paktgruppen zu bejahen oder zu verurteilen. Die einen bejahten ihn, weil sie meinten, nur so könne der Sozialismus gerettet werden, und die anderen verurteilten den Einmarsch, weil sie meinten, er schade dem Sozialismus.
Eger: Mit 1968 war der Punkt erreicht, von dem an Sie literaturpolitisch in der DDR nicht mehr zu vermitteln waren. Das „Aktiv Lyrik“ des DDR-Schriftstellerverbandes unter Vorsitz von Günther Deicke, als ehemaliger U-Boot-Offizier und NSDAPler Mitglied der NDPD, gab die Anweisung, keine Kunze-Texte mehr zu drucken. Wie und worauf richteten Sie sich ein? Oder wußten Sie bereits damals, daß das mit Ihnen und der DDR nicht gut ausgehen würde, daß es irgendwann darauf hinauslaufen würde, die DDR zu verlassen?
Kunze: Wir haben mit keiner Wimper daran gedacht, die DDR zu verlassen. Wir lebten dort und mußten dort unserem Leben einen Sinn geben. Ich habe geschrieben und das, was ich geschrieben habe, publiziert. Da das größtenteils nur in der Bundesrepublik möglich war, sind die Bücher im Westen erschienen. Dabei habe ich mich strikt an die Devisengesetze der DDR gehalten: Jede im Westen verdiente Mark ging an die Staatsbank der DDR, die mir für eine DM-West 99 Pfennige Ost erstattete.
Eger: Schauen wir zurück auf den Zeitraum von 1963 bis 1968, in dem für Sie in der DDR doch einiges möglich gewesen ist und einiges mehr möglich gewesen wäre. Sie gehörten aber nicht zur sogenannten Lyrikbewegung, die ab 1962/63 in tatsächlichen Lyrikwellen über Land ging. Warum nicht?
Kunze: Ich lebte abseits der Zentren und habe nie einen Grund gesehen, mich an einer „Lyrikbewegung“ zu beteiligen. Ich hätte auch gar nicht gewußt, wie ich das hätte anstellen sollen, denn ich habe nie einer Gruppe angehört.
Eger: Hatten Sie, wenn Sie denn nicht zu einer Gruppe gehörten, nicht doch das Gefühl, zu einer Generation zu gehören, zur Generation der in den 30er Jahren geborenen Schriftsteller, zu Autoren also wie Biermann. Braun, Jentzsch, den Kirschs? Wenn Sie dieses Gefühl hatten, welchen inhaltlichen Nenner hatte es?
Kunze: Welcher Generation eine Kollegin oder ein Kollege angehörte, hat mich nie gekümmert. Ich hatte es zu dem dreißig Jahre älteren Peter Huchel und später zu einigen wesentlich jüngeren Autoren näher oder zumindest ebenso nahe wie zu manchen meiner Altersgenossen. Ausschlaggebend waren die Poesie und die Haltung.
Eger: Sie haben in der DDR, auch wenn Sie die ideologischen Grundlegungen nicht teilten, die Bücher Ihrer Kollegen zur Kenntnis genommen. Nach der Lektüre von Nachdenken über Christa T. schrieben Sie im April 1969 einen Brief an Christa Wolf, in dem Sie die Autorin lobten, „ganz große Prosa“ geschrieben zu haben, die Sie „äußerst (innerst) berührt“ hat, wenngleich mehr die „Nachdenkende“ Ihnen als Heldin galt. Was dachten Sie damals über diese Art der Literatur des sich Abarbeitens am Widerspruch von Echt- und Wunschwelt. Was dachten Sie über deren Verfasser? Etwa das: Sie mühen sich ab, vergeblich?
Kunze: Ein Buch wie Nachdenken über Christa T. half, den Geist hochzuhalten und literarischen Maßstäben höchstmögliche Geltung zu verschaffen. Was ich immer bedauert habe, ist, daß Christa Wolf und andere in ihren Büchern der Mut dort verließ, wo er hätte einsetzen müssen.
Eger: Wo, meinen Sie, hätte sich dieser Mut erweisen müssen? Und woraus schließen Sie, daß es einem Autor an Mut mangelte?
Kunze: In Christa Wolfs Kindheitsmuster heißt es:
Du beobachtest dich, wie du Gründe dafür suchst, jene leider zutreffenden Nachrichten, die Moskauer Prozesse des Jahres 1937 betreffend, im Gegensatz zu der Meldung über Guernica übergehen zu können. (…) Moskau, 14. Juni 1937: „Acht Sowjet-Generale hingerichtet!“ Wie es dazu gekommen ist, daß eine solche Meldung in dieser Zeitung dich traf – die Gebeine der Generale sind schon vermodert –, als sei sie neu, vor allem, als ginge sie dich persönlich an, während du von den Zeitungsschreibern des „General-Anzeigers“ und von den Leuten, die die Zeitung lasen (…), „die“ und „denen“ dachtest, als seien sie Fremde (denen soll ihre Heuchelei im Halse steckenbleiben): Das wäre schon eine andere Geschichte.
Diese „andere Geschichte“ hätte dem Stoff die Wahrheitsdimension gegeben, die er verdient gehabt hätte, und hätte ihn große Literatur werden lassen können. An einem Mangel an Meisterschaft kann es bei Christa Wolf nicht gelegen haben.
* * *
Eger: Zurück zu Ihrer Person: 1969 ereignete sich der fortan viel zitierte Auftritt von Max Walter Schulz auf dem VI. DDR-Schriftstellerkongreß. Für Schulz offenbarte sich in Ihrer Poesie „der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe“. Mitte der siebziger Jahre nannte Ursula Ragwitz, im SED-Zentralkomitee für Kulturfragen zuständig, den Autor Reiner Kunze vor Journalisten einen „Staatsfeind“. Hatte sie recht?
Kunze: Ich habe die herrschende Ideologie in Frage gestellt.
Eger: Das ist feindlich, das geht an die Substanz.
Kunze: Aber der Staat hatte nichts von mir zu befürchten – außer, daß ich meine Bücher geschrieben und veröffentlicht habe. Ich selbst habe mich nie als Staatsfeind empfunden, sondern als jemand, der in diesem Staat leben und zurechtkommen mußte.
Eger: Ihr Gedichtband zimmerlautstärke erscheint 1972 bei S. Fischer, weil Ihr Lektor bei Rowohlt meinte, daß mit Ihren Gedichten die revolutionären Studenten nicht zu gewinnen seien. War Ihnen damals klar; daß Sie mit Ihren Büchern im Westen als ein politischer Dichter, das hieß unter den damaligen Bedingungen als ein tagespolitischer Dichter, wahrgenommen wurden?
Kunze: Nein. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Aber auch, wenn es mir bewußt gewesen wäre, hätte das nichts geändert, weder an den Gedichten, noch an meiner Zustimmung, sie zu publizieren.
Eger: Ihr 1976 bei S. Fischer erschienener Prosaband Die wunderbaren Jahre entfaltete seine West-Wirkung zu einem Zeitpunkt, als der Strauß-Schmidt-Wahlkampf seinen Höhepunkt erreicht hatte.
Kunze: Wenn das Programm oder die tagespolitischen Positionen einer Partei dieses Buch nicht aushalten, dann stimmt etwas nicht an den Vorstellungen dieser Partei.
Eger: Der Schriftsteller Dieter Schlesak fragt 1970 in der Frankfurter Rundschau:
Hat der Autor den schwer zu bestimmenden Ausnützungswert seines emotionalen Anti-Stalinismus durch rechtes Denken im Westen, das solches Vakuum besetzen könnte, einkalkuliert? Hat er den fatalen politischen Ost-West-Reflex-Gesetzen Rechnung getragen, die jedes publizierte Wort in Ost und West treffen und mit Beifall von der falschen Seite belohnen könnten?
Kunze: Da kann ich nur noch mit Jan Zahradníček antworten:
Wie Bileams Eselin, die man schlägt und stößt, um sie vom Weg abzubringen, beharrt die Dichtung auf dem ihrigen: denn sie sieht einen Engel vor sich.
Eger: Welchen Engel sieht Ihre Dichtung?
Kunze: Balak, der König der Moabiter, ließ Bileam rufen, damit dieser Israel verfluche. Der Eselin, auf der Bileam ritt, trat jedoch dreimal ein Engel in den Weg, denn Bileam war auf dem falschen. Den Engel erblickte jedoch nur die Eselin (zumindest vorerst). Hier setzt Zahradníčeks Gleichnis an: Wie die Eselin, die nicht Bileams Weg folgt, sondern dem, den ihr der Engel weist, folgt auch die Dichtung einem Engel – nämlich ihrer eigenen Wahrheit. Trotz aller Schläge. Das Gestaltwerden einer literarischen Figur unter den Händen eines ernst zu nehmenden Dichters bedeutet, daß sie zu leben beginnt und nicht gegen ihren Charakter geführt werden kann. Auch ein Gedicht läßt sich nicht gegen die ihm innewohnende Wahrheit schreiben. Die Frage kann also nur lauten, ob das, was ein bestimmter Autor schreibt, zur Dichtung gehört.
Eger: Schauen wir zurück in den Osten der 70er Jahre: Sie waren ein ost-west-deutscher Schriftsteller in der DDR. 1973 erschien Brief mit blauem Siegel bei Reclam Leipzig. Warum? Und war das auch für Sie überraschend?
Kunze: Nach dem Wechsel von Ulbricht zu Honecker kam ein jüngerer Staatssekretär zu uns und sagte, man wisse, daß Fehler gemacht worden seien, und wünsche nicht, daß Leute wie ich ausgegrenzt würden. Ich solle für Reclam einen Gedichtband zusammenstellen. Natürlich wußte ich, daß ich, um diese geistige Öffnung nicht zu gefährden, Augenmaß bewahren mußte.
Eger: Noch das, was schließlich zum Druck gelangte, war für DDR- Verhältnisse unerhört. Gedichte wie „sensible wege“, „erster brief der Tamara A.“ oder „appell“, das mit der Zeile endet: „Lenin kann ihm nicht mehr helfen. tochter“.
Kunze: Ich weiß nicht, wie oft ich nach Berlin gefahren bin, um beispielsweise eine Auswahl aus dem Zyklus „einundzwanzig variationen über das thema ,die post‘“ aufnehmen zu können. Der Zyklus als Ganzes war undruckbar, darüber war ich mir im Klaren. Aber ich wollte nicht den Eindruck entstehen lassen, die von mir ausgewählten Nummern mitzudrucken: 1, 6, 9 usw. Das wurde abgelehnt. Auch der Titel „aus: einundzwanzig variationen über das thema „die post‘“. Was ich hatte erreichen wollen, war erreicht. So ging das mehr oder weniger von der ersten bis zur letzten Seite.
Eger: Brief mit blauem Siegel war der wahrscheinlich erfolgreichste Lyrikband der DDR, mit jeweils zwei sofort vergriffenen Auflagen von 15.000 Exemplaren. Hatte sich für Sie danach etwas verändert?
Kunze: Kaum. Jedenfalls nichts von Dauer. In der Klassenelternversammlung sagte ein Genosse, man verwahre sich dagegen, daß die Tochter eines Mannes, der solche Bücher schreibe, ihre Mitschüler „verseuche“. Andere pflichteten ihm bei (vor jeder Elternversammlung kamen die „Genossen Eltern“ zusammen, um die Linie festzulegen.) Das alles geschah in meiner Gegenwart.
Eger: Warum wurden die zwei Auflagen nicht beworben? Hatte man dann doch Angst vor der eigenen Courage?
Kunze: Wozu? Das Buch war am Erscheinungstag vergriffen.
Eger: Warum ist keine dritte Auflage erschienen?
Kunze: Die Zeiten hatten sich bereits wieder geändert.
Eger: Die Zeile, die dem Band den Titel gab, ist dem Stephan Hermlin gewidmeten und auf dem Rückumschlag abgedruckten Text „Fast ein frühlingsgedicht“ entnommen. Die letzten Zeilen des Gedichtes lauten: „Nichts / währt / ewig“. Warum haben Sie dieses Gedicht Hermlin gewidmet?
Kunze: Hermlin hatte sich für dieses Buch eingesetzt und mir mehrmals geholfen.
Eger: Sind Sie ihm öfter begegnet?
Kunze: Nach Erscheinen des Buches sensible wege lud er mich zu sich nach Berlin-Niederschönhausen ein. Ich habe ihn auch danach noch einige Male besucht.
Eger: Was beeindruckte Sie damals an Hermlin?
Kunze: Sein Horizont, seine Weltläufigkeit.
Eger: Hermlin inszenierte sich ja als ein „Grandseigneur“, als der letzte Bürger der DDR.
Kunze: Zu mir sagte er, er sei der letzte Kommunist in der DDR.
Eger: Welchen Blick haben Sie heute auf Hermlin und seine Iiteraturpolitische Rolle in der DDR?
Kunze: Die Phase, in der ich Kontakt zu ihm hatte, war kurz. Was danach kam, möchte ich auf sich beruhen lassen.
Eger: Welche Autoren gehörten in den späten 60er und frühen 70er Jahren zu Ihrem Kreis, über Greiz hinaus?
Kunze: Herzlichen Kontakt hatte ich zu Heinz Knobloch, Horst Drescher, Volker Braun, Günter de Bruyn, Bernd Jentzsch oder Wulf Kirsten. Peter Huchel war für mich die große Autorität. Ich war des öfteren bei Stefan Heym, auch über Nacht. Als ich zum erstenmal durch das Büro für Urheberrechte zu einer Ordnungsstrafe verurteilt worden war, kam plötzlich eine Geldanweisung von Stefan Heym, er hatte gesammelt. Wolf Biermann war bei uns, ich war bei ihm. Selbstverständlich kannte ich Günter Kunert, Sarah und Rainer Kirsch oder Paul Wiens. Aber das war kein „Kreis“.
Eger: Haben Sie Peter Huchel aufgesucht, der von 1963 bis zu seiner Ausreise 1971 abgeschnitten von der großen Öffentlichkeit in Wilhelmshorst lebte?
Kunze: Das erste Mal mit Ludvík Kundera und František Hrubin, später auch allein.
Eger: Wie erinnern Sie Peter Huchel in Wilhelmshorst?
Kunze: Als einen zutiefst verbitterten alten Mann, der der bedeutendste lebende deutsche Dichter war. An den Spaziergängen mit ihm – am Schweigen wie am Reden – orientierte ich mich. Was er und sein Urteil mir bedeutet haben, können Sie daraus ersehen, daß ich außer meiner Frau keinem Menschen mehr Gedichte gewidmet habe als ihm – im Laufe der Jahre, glaube ich, sechs oder sieben. Auch Jan Skácel habe ich eine Reihe von Gedichten gewidmet, aber zwischen ihm und mir handelte es sich um eine Art von Korrespondenz.
Eger: Hat Ihnen Huchel Gedichte vorgelesen?
Kunze: Ja, nur hatte ich nicht den Gewinn davon, als wenn ich sie selbst las. Huchel las sie, als läse er sie weg von der Welt.
Eger: Huchel und Hermlin waren ja die beiden alten Männer, die die Literatur in der DDR als Autoritäten polarisierten. Zwischen ihnen hatte sich ein dritter mit großem Ruf eingerichtet, in Berlin-Friedrichsfelde – mittendrin am Rand: Johannes Bobrowski, der Verfasser von Levins Mühle…
Kunze: … und singulärer Gedichte: „Das Wort Mensch… Wo Liebe nicht ist, sprich das Wort nicht aus.“ Auch Bobrowski bin ich leider nur ein einziges Mal begegnet, in Weimar, nachts, im Winter. Er kam mit einigen anderen aus einer Gaststätte, und jemand sagte ihm: Dort ist Reiner Kunze. Daraufhin schlug er mir in einer Sturzumarmung auf den Rücken und rief: Ein scheener Dichter, ein scheener Dichter! – Entweder war er betrunken, oder es war ein kollegialer Ritterschlag. – In einem Brief Bobrowskis an Peter Jokostra heißt es:
… ich selber werde mich nicht auf ostdeutsch firmieren lassen, sowenig wie auf ,heimlich westdeutsch‘. Entweder ich mach deutsche Gedichte oder ich lern Polnisch.
Mit dieser Position stand er Huchel wesentlich näher als Hermlin.
Eger: Von 1968 an waren Sie mit der Unterbrechung 1973 eine unerwünschte Person im DDR-Literaturbetrieb. Wie haben Sie Ihr Publikum gefunden?
Kunze: Die Gedichte haben es gefunden, sie wurden abgeschrieben und weitergegeben. Die Lesungen, die fast ausnahmslos nur noch in Kirchenräumen stattfinden konnten – und auch das nur unter Schwierigkeiten –, waren überfüllt.
Eger: Waren Sie ein Volksdichter?
Kunze: Da wäre das Volk sehr klein.
Eger: Wolf Biermann; dem von 1965 an kein öffentlicher Auftritt in der DDR gestattet war, gehörte zu den Kollegen, zu denen Sie Kontakt hatten. Sie waren befreundet? Was verband Biermann und Kunze? Die Lust, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen?
Kunze: Ich habe nichts und niemanden zum Tanzen bringen wollen – abgesehen davon, daß ich es nicht vermocht hätte. Wolf Biermann hätte und hat es mit seinen genial-frechen Liedern vermocht.
Eger: Er hat Ihnen das Kunze-Lied geschrieben. Dessen Refrain lautet: „Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um.“ Was fällt Ihnen dazu ein?
Kunze: Recht hat er.
Eger: Biermann und Sie waren in den 70er Jahren die populärsten Schriftsteller in der DDR – auch in Richtung Westen.
Kunze: In Ihren Augen, weil Sie damals sehr jung waren.
Eger: Biermann und Kunze wurden oft in einem Atemzug genannt…
Kunze: Weil wir beide an dieselbe Deichsel paßten.
Eger: Sie haben sogar gegenseitig aufeinander verwiesen. Reiner Kunze in der Süddeutschen Zeitung vom 20. März 1974:
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es, wenn es keine Biermann-Auswahl geben würde, auf die Dauer einen in der DDR publizierenden Kunze geben würde.
Kunze: Da haben Sie die Antwort darauf, warum es keine dritte Auflage von Brief mit blauem Siegel gegeben hat.
Eger: Wolf Biermann zeigte sich seinerseits nicht gerade als feiner Austeiler. Er sagte wörtlich auf seinem legendären Kölner Konzert im November 1976:
Jurek Becker und ich… sind Kommunisten, wir sehen die Schwächen, die Fehler; die verschiedenen Formen bürokratischer Barbarei in der DDR bestimmt nicht weniger deutlich, als unser Freund Kunze. Aber wir sind der Meinung, daß die DDR trotz alledem eine große Errungenschaft für die deutsche Arbeiterklasse ist, daß sie kostbar ist, daß der Weg des Sozialismus unter Mühen und mit Rückschlägen bestritten wird, und daß dieses große gesellschaftliche Experiment wichtig ist und weitergeführt werden muß.
Wie wirkten diese scharfen Worte auf Sie – damals als Zuhörer – in Ihrer Greizer Wohnung?
Kunze: Als eine der von ihm gewohnten ideologischen Rempeleien.
Eger: Das war mehr als eine Rempelei. So eine Auspreisung als ein Mann, der die Zeichen der Zeit nicht versteht, hat doch Folgen.
Kunze: Die hatte es in der DDR wie in der Bundesrepublik – hier bis heute. Aber immerhin hat der Verursacher selbst inzwischen die Zeichen der Zeit verstanden.
Eger: Die im Hause Hermlin gefertigte Schriftsteller-„Petition“ an Honecker trug prominente Unterschriften. Ihre gehörte nicht dazu. Warum nicht?
Kunze: Ich habe von dieser Petition nichts gewußt. Manche der Unterzeichner hätten es wohl auch abgelehnt, ihre Unterschrift neben meine zu setzen, wie sich bei den Schriftstellerverbandsversammlungen in Weimar niemand an meinen Tisch setzte – mit Ausnahme von Wulf Kirsten, den daraufhin zwei Mitarbeiter der Staatssicherheit aufsuchten und ihn zwei Stunden verhörten, warum er das tue. Nachdem ich von Biermanns Ausbürgerung erfahren hatte, habe ich sofort im Hessischen Rundfunk Stellung genommen, ich kannte dort Karl Corino.
Eger: Wolf Biermann hat sich 1980 in der Zeit unter dem Titel „Rechtslinkslinksrechts“ schwer an der Verfilmung der Wunderbaren Jahre abgearbeitet.
Kunze: Aber nicht bösartig.
Eger: Biermann sprach davon, daß er das Kino wie das Begräbnis Ihrer Freundschaft besucht habe.
Kunze: So konnte er ihre Auferstehung erleben… Wissen Sie, Wolf Biermann scheint bisher nur eines noch nicht richtig begriffen zu haben: daß es Leute gab, die durch DDR-Gefängnisse gegangen sind, auch Kollegen, zum Beispiel der Schriftsteller Ulrich Schacht, und die einiges mehr riskiert und und viel mehr geopfert haben als er.
Eger: Für das Buch Die Wunderbaren Jahre mußten Sie im Osten die Druckgenehmigung einholen. Warum wurde sie erteilt?
Kunze: Weiß ich nicht, es geht aus den Akten nicht hervor. Nur das blanke Entsetzen der Staatssicherheit darüber geht hervor. Sie hatte jahrelang nach dem unfertigen Manuskript gesucht – es lag unter den Laststeinen einer ausgedienten Wäschemangel –, und nun, als sie es gedruckt besaßen, konnte man mich nicht sofort verhaften, da ich für die Veröffentlichung den Gesetzesweg eingehalten hatte.
Eger: Sie hatten also nur den Vertrag zur Genehmigung eingereicht? Die Erlaubnis war ein Blankoscheck?
Kunze: Ein Scheck für die Staatsbank der DDR. Meine Bücher brachten Devisen. Vielleicht war das ein Grund für die Genehmigung.
Eger: Nun aber wurden Gutachten angefertigt.
Kunze: In einer „Einschätzung“, die Klaus Höpcke am 29.9.1976 handschriftlich unterschrieben und mit Stempel des Ministeriums für Kultur versehen, an den Staatssicherheitsdienst schickte:
Seine [Kunzes] Stimme unterscheidet sich durch nichts von jenen prononciert antikommunistischen Stimmen, die die sozialistische Gesellschaft als totalitären Staat verunglimpfen… Seine Attacke richtet sich gleichzeitig gegen Partei und Staat und gegen alle Schriftsteller der DDR.
Die Hauptabteilung IX/2 des Ministeriums für Staatssicherheit folgerte:
Der Prosaband Die wunderbaren Jahre stellt somit eine Hetzschrift im Sinne des Paragraphen 108 StGB dar.
Diese beiden Paragraphen hatten es in sich.
Eger: Am dritten November 1976 sind Sie aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen worden. Wie haben Sie die Kollegen erfahren in diesen Tagen?
Kunze: Jurek Becker kam nach Greiz und sagte, daß er mit dem Ausschluß nicht einverstanden sei. Das war nicht nur honorabel, sondern auch mutig. Später wandte sich Bernd Jentzsch aus der Schweiz in einem Brief an Honecker, was ich ihm noch heute hoch anrechne. Vereinzelt gab es auch noch andere Solidaritätsbekundungen.
Eger: Waren die „wunderbaren“ Jahre für Sie verlorene Jahre?
Kunze: In dem Buch Die wunderbaren Jahre geht es um die „wunderbaren“ Jahre unserer Kinder, nicht um unsere eigenen. Meine Studienjahre waren insofern verlorene Jahre, als sie eine Zeit finsterster Indoktrination waren. Vieles, was wir an Welt und Weltbewußtsein hätten aufnehmen können, war uns verschlossen, verboten, unerreichbar. Natürlich ist kein gelebtes Leben „verloren“ – weder in seinen Glücksmomenten, noch in seinen Verstrickungen und Nöten. Auch sie formen.
Eger: Es kann einen heutzutage erstaunen, liest man das Statut des DDR-Schriftstellerverbandes von 1973 im Wortlaut:
Die Mitglieder des Schriftstellerverbandes der DDR anerkennen die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei in der Kulturpolitik. Sie bekennen sich zur Schaffensmethode des Sozialistischen Realismus. Sie treten entschieden gegen alle Formen der ideologischen Koexistenz und das Eindringen reaktionärer und revisionistischer Auffassungen in die Bereiche der Literatur auf.
So stand es auf dem Papier.
Kunze: Und auf dem Papier des einen oder anderen Mitglieds stand ein Gedicht, das standhielt oder widerstand, und deshalb mußte ab und zu ein Mitglied ausgeschlossen werden.
Eger: Auch wenn Sie selbst, wie Sie dem Gedichtband auf eigene hoffnung voranstellten, zuweilen „des fahnenhissens müde“ waren, haben Sie doch immer wieder die Fahne – nicht einer Partei, sondern Ihrer Person – hochgehalten. Sie haben dreingeredet, gegengehalten, protestiert – im Osten, im Westen, „notorisch“ und „querulierend“ im Urteil mancher Zeitgenossen. Was ist es, daß Ihre Persönlichkeit so oft lautstark neben die offizielle Spur setzt? Erziehung, Haltung oder Opposition aus gescheiterter Anpassung?
Kunze: Bleiben wir einen Moment bei den Zeitgenossen: Querulieren heißt, grundlos zu klagen. Das mir nachzuweisen, dürfte kaum gelingen. Wenn wir „notorisch“ mit „berüchtigt“ übersetzten, frage ich: In wessen Augen berüchtigt? – Zur Sache: Ich bin kein Kämpfer und gehe Kämpfen so weit wie möglich aus dem Weg. Ich ziehe mich zurück, begründe, warum, und mehr werden Sie dann von mir nicht hören – es sei denn, ich werde, und das geschieht leider bis zum Überdruß, immer von neuem danach befragt. Wenn ich jedoch gezwungen werde zu kämpfen, kämpfe ich. Aber die Schwelle ist hoch. Und dann, bitte, nie „lautstark“. Sie unterschätzen meine Lärmempfindlichkeit, auch was die eigene Stimme betrifft. Ich hatte, hoffe ich, Lautstärke auch nie nötig. „Opposition aus gescheiterter Anpassung“ – halten Sie es tatsächlich für verantwortbar, diese Möglichkeit zu erwägen? Vielleicht hat das Nichteinschwenken auf die „offizielle Spur“ etwas damit zu tun, daß es Literatur ohne Wahrheit nicht gibt.
Eger: Welche Wahrheit meinen Sie? Lüge und Literatur können sich doch hervorragend verschwistern, da zieht sich von der Antike bis in die Gegenwart eine bedeutende Linie durch die Literaturgeschichte, und das ist nicht allein die satirische Linie.
Kunze: Gedicht und Lüge schließen einander aus; nicht, weil der Dichter ein besonders ehrlicher Mensch wäre – er ist hoffentlich so ehrlich, wie jeder andere ehrliche Mensch auch –, sondern weil der poetische Einfall kein taktisches Kalkül kennt und der Dichter nicht gegen die dem Einfall innewohnende Konsequenz dichten kann, ohne das Bild oder das Paradoxon zu unterhöhlen oder zu zerstören, Apollinaire:
Die Dichter sind nicht nur die Männer – ich füge ein: und Frauen – des Schönen. Sie sind auch und vor allem die Männer (und Frauen) des Wahren, soweit es das Eindringen ins Unbekannte erlaubt.
Natürlich muß der Dichter, wie es in einem Brief Hölderlins heißt, „oft etwas Unwahres und Widersprechendes sagen, das sich aber… im Ganzen, worin es als etwas Vergängliches gesagt ist, in Wahrheit und Harmonie auflösen muß“.
Eger: Wahrheit ist kein literarisches, sondern ein ethisches Problem.
Kunze: Inkonsequenz in bezug auf die Wahrheit zieht jedoch immer ästhetische Inkonsequenz nach sich.
Eger: Sind Sie Moralist?
Kunze: Der Moralist, heißt es, brauche die Unmoral. Ich kann mich nicht entsinnen, sie jemals gebraucht zu haben.
Eger: Der Ostberliner Feuilletonist Heinz Knobloch schreibt über Sie in seinen Erinnerungen: „Kunze, zeitlebens ein erzgebirgischer Dickschädel“. Hat er recht?
Kunze: Vielleicht weil es an Löchern im Kopf nicht gefehlt hat.
Eger: Am 7. April 1977 stellten Sie den Antrag auf Ausreise, am 10. April wurde er genehmigt, am 13. verließen Sie die DDR: nach zahlreichen zermürbenden Aktionen. Auf welches intellektuelle Klima stießen Sie im Westen?
Kunze: Das intellektuelle Klima, das bei unserer Übersiedlung in die Bundesrepublik herrschte, charakterisierte Daniel Cohn-Bendit so:
Als ich 1968 nach Deutschland kam und anfing, auch über den Kommunismus zu diskutieren, hat mich bei den Freunden vom SDS immer gewundert, warum Hannah Arendt dem rechten Lager zugeordnet wurde. Wer damals über sie sprach, wurde fast automatisch dem Lager der Konservativen und dem vorherrschenden Antikommunismus zugeordnet. Ich habe das lange Zeit ebenso wenig verstanden, wie mir auch das verkrampfte Verhältnis der deutschen Linken zur DDR stets ein Rätsel blieb. Es war als Linker damals nicht möglich zu sagen, daß es auf deutschem Boden einen demokratischen und einen totalitären Staat gibt und daß man auch als politisch aktiver Linker natürlich lieber im demokratischen Staat leben möchte…
Eger: Da ist noch genau die eine Frage offen: Warum das damals nicht möglich war.
Kunze: Weil Indoktrination keine Grenzen kennt, und hier es insofern noch schlimmer war, als diese Leute nie in einem totalitären Staat gelebt hatten.
Eger: Sie sagten in Ihrem ersten Interview nach der Ausreise, daß von Osten her „kein neuer Anfang für die Menschheit“ kommen wird. Damit standen Sie scharf neben den Wunschbildern von links.
Kunze: Als bemerkt wurde, daß ich den Glauben, man könnte das politische System in der DDR reformieren, längst verloren hatte, lichteten sich die Reihen unserer Freunde in der Bundesrepublik rasch. Für die einen war ich über Nacht ein Gegner, den es politisch und menschlich zu diskreditieren galt, und andere zogen sich zurück, um nicht selbst diskreditiert zu werden (unter ihnen bekannte Literaturkritiker, Redakteure und Kolleginnen und Kollegen).
Eger: Der Osten wirkte in den Westen hinein?
Kunze: Auch das. In einem Operationsplan der Staatssicherheit zur weiteren Zersetzung des Ansehens meiner Person hieß es, es müsse erreicht werden, daß Kunze nicht mehr die Hand gegeben wird.
Eger: Jene West-Intellektuellen fragten nicht: Was bedeutet das, was Reiner Kunze sagt, oder, was erzählen diese Bücher über die Situation in der DDR, sondern: Wem nützt es? Es war ein Schnappen nach dem funktionalen Nenner, der ein ideologischer war.
Kunze: Es war seitenverkehrt dasselbe wie in der DDR. Sie haben die Literatur nach Politik abgeklopft, nach Ideologie, und zwar nach vereinnahmbarer Ideologie.
Eger: Gab es denn im Westen ein tatsächliches Interesse an den tatsächlichen Verhältnissen in der DDR?
Kunze: Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre es schlecht um die Bundesrepublik bestellt gewesen. Aber der aus den unterschiedlichsten Gründen verzerrenden Brillen gab es ebenfalls nicht wenige. Und auch Desinteresse gab es, Wohlstandsdesinteresse.
Eger: Im Gegensatz zu anderen von Ost nach West abgewanderten Schriftstellern strahlten Sie im Westen auf: Sie waren nicht zerknirscht, Sie nagten nicht an Ihrer Ostgeschichte. Sie zeigten, daß Sie in der westdeutschen Gesellschaft gerne leben und gerne leben wollen. So viel Glück war eine Provokation.
Kunze: So sehr mir zugesetzt wurde und noch immer zugesetzt wird: Das Gefühl, ein freier Mensch, zu sein, ist das Grundgefühl meiner hiesigen Existenz. Da kann ich denen, die darin eine Provokation sehen, nicht helfen.
Eger: Der Ruf des Reaktionären folgt Ihnen auf dem Fuß. Seit wann?
Kunze: Seit unserer Übersiedlung.
Eger: Lassen Sie uns die Gründe abklopfen. Das macht sich fest an Ihrer Sofort-Aussage, daß von der DDR aus nichts Zukunftsfähiges kommen würde; an Ihrer Mitgliedschaft in der Bayerischen Akademie der Künste, die seit 1973 bestand…
Kunze: … und daß wir überhaupt nach Bayern gegangen sind, was aber nur darauf zurückzuführen war, daß wir hier Freunde hatten.
Eger: Und dann am Bayerischen Filmpreis für das Beste Drehbuch, der Ihnen von Franz-Josef Strauß verliehen wurde…
Kunze: Verliehen hat ihn eine unabhängige Jury von Filmschauspielern, Regisseuren, Produzenten usw., und da in den Satzungen steht, daß ihn der jeweilige Ministerpräsident überreicht, bekam ich ihn von Franz Josef Strauß in die Hand gedrückt.
Eger: An Ihrem Besuch der CSU-Klausur 1984 in Wildbad Kreuth…
Kunze: Wer steinigen will, dem wird alles zu Stein. Als ich vorher einer Einladung zu einer SPD-Klausur mit Willy Brandt und Helmut Schmidt gefolgt war, hatte kein Hahn danach gekräht.
Eger: Egal, wo Sie sich bewegten, die Alarmglocken schrillten mit. Sogar die Präsentation des Films Die wunderbaren Jahre geriet zu einem Politikum. Ursprünglich sollte der Streifen 1980 im Wettbewerbsprogramm der Berlinale gezeigt werden, die osteuropäischen Länder zeigten sich davon nicht erfreut. Der Film wurde kassiert, damit Konrad Wolfs Film Solo Sunny gezeigt werden konnte.
Kunze: Der Film ist künstlerisch nicht gelungen. Aber auch, wenn er gelungen gewesen wäre, hätte er keine Chance gehabt. Das Schlagwort lautete: Das ist Wasser auf die Mühlen von Strauß.
Eger: Was hielten Sie von Strauß Ende der 70er Jahre?
Kunze: Ich habe ihn nur ein einziges Mal aus der Nähe erlebt – 1984 auf eben jener Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, auf der ich am Vorabend den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden hatte. Ich habe nie wieder eine derart scharfsichtige, hochdifferenzierte und kenntnisreiche weltpolitische Analyse gehört wie damals von Strauß. Das war nicht der Strauß der Passauer Nibelungenhalle. Der Mann war blitzgescheit und wußte auf allen Klavieren zu spielen. Welche politische Intentionen er hatte, ist eine andere Sache. Politik ist immer konkret, und ich habe mir abgewöhnt zu verallgemeinern oder nach Farben zu urteilen.
Eger: Trotzdem pappten die Namen Strauß und Kunze fortan aneinander. Welche Folgen hatte das für Ihren Alltag?
Kunze: Zum Beispiel schickten mir eine Zeitlang Gymnasiasten aus Untergriesbach, das ist ein Ort in unserer Nähe, meine Bücher zurück – zerfetzt und mit Aufschriften versehen wie „Strauß-Intimus“. Ich hatte Strauß bis dahin nur ein einziges Mal gesehen, und zwar bei einer öffentlichen Veranstaltung im Münchner Cuvilliés-Theater. Oder: Wir hatten den Hang an unserem Haus mit Jungbäumen bepflanzt. Achtzehn wurden abgeschnitten und wieder in die Erde gerammt. Ich bemerkte es erst, als das frische Laub dahinwelkte. Im Briefkasten lag ein Artikel aus der Zeit von Bernt Engelmann, der u.a. meinen Austritt aus dem Verband deutscher Schriftsteller betraf („Keine Krise“). Man schüttete Pflanzengift in unser Gelände und bewarf das Haus mit Eiern – stets mit einem Memento im Briefkasten. In Abständen klingelte wochenlang jeden Abend um 22 Uhr das Telefon, ohne daß sich jemand meldete. Ich behaupte, man hörte den Anrufer schweigen. Das waren die Auswirkungen der Anfeindungen im Kleinen.
Eger: Und im Großen?
Kunze: Nach über fünfzig Goethe-Instituts-Lesungen in mehreren Erdteilen hatte ich darum gebeten, zwei Jahre pausieren zu dürfen, um wieder zum Schreiben zu kommen. In Unkenntnis dieser Sachlage fragte bei einer Diskussion über die Aufgaben des Goethe-Instituts jemand aus Bayern – ich weiß nicht, wer es war –, warum nicht auch Autoren wie Reiner Kunze zu Lesungen eingeladen würden. Am 5. März 1987 reagierte der Stern-Redakteur Sven Michaelsen mit folgender Äußerung:
Kunst als schmeichelnde Staatsreklame und Schmiermittel für den Export – auf dieses Ideal sollen die Goethe Institute eingeschworen werden (…) Was die schwarzen Kulturrevolutionäre wollen, ist klar: Reiner Kunze, Konsalik und Otto von Habsburg statt Grass und Enzensberger.
Nach dieser Invektive bin ich viele Jahre von keinem Goethe-Institut mehr eingeladen worden. Eines Tages besuchte mich ein junger Goethe-Instititut-Mitarbeiter aus Südamerika, der noch als Schüler hier in Deutschland an einer meiner Lesungen teilgenommen und dem Leiter seines Instituts vorgeschlagen hatte, mich einzuladen. Sein Chef hatte ihm jedoch zu verstehen gegeben, daß das politisch unmöglich sei, und ihn auf den Stern verwiesen. So funktionierte das im Großen. Lassen Sie mich hier aber gleich hinzufügen: Ich schildere hier nur die Situation. Das ist keine Klage. Ich habe die Goethe-Instituts-Einladungen nie vermißt. Die fremdsprachlichen Ausgaben meiner Bücher machen mir mehr Quartier, als ich bisher habe beziehen können.
* * *
Eger: Sie haben protestiert, Sie haben Offene Briefe verfaßt, haben Schlußstriche gezogen. Man könnte – bei Ihren vielen Austritten aus Institutionen – den Eindruck gewinnen, Sie stünden zuweilen kurz davor, aus der Welt auszutreten. Das Kalkül von Gruppen waltet doch überall.
Kunze: Sie übersehen, daß ich seit Jahrzehnten einer Reihe von Institutionen angehöre, aus denen auszutreten ich bisher glücklicherweise keinerlei Veranlassung hatte. Ich kann mir aber durchaus einen Grad von Ermüdung vorstellen, der in einem Menschen den Entschluß reifen läßt, aus der Welt auszutreten.
Eger: Eine der Aufgaben der Literaturbetriebswärter West bestand noch bis in die 90er Jahre hinein darin, festzustellen, wann denn nun ein von Osten übergesiedelter Autor mit seinem Werk endlich im Westen „angekommen“ sei. Das war, unter anderen ideologischen Vorzeichen, ein Pendant zur „Ankunftsliteratur“ der DDR in den 60er Jahren – eine Art Ablegen der Reifeprüfung. Wann sind Sie als Schriftsteller im Westen „angekommen“?
Kunze: Als ich den Lichtschalter im Dunkeln fand – auch in der Poesie.
Eger: Wie lange hat es gedauert, bis es so weit war?
Kunze: Sagen wir, zwei Jahre – als mir plötzlich wieder Einfälle zu Gedichten kamen.
Eger: Wo überhaupt muß ein Schriftsteller ankommen?
Kunze: In der Literatur – wie immer sich die Verhältnisse verändert haben mögen.
Eger: Wie bemerkt ein Autor, daß er in der Literatur angekommen ist und nicht etwa auf den Spielplätzen des Kunsthandwerkes, der Kolportage oder des Kitsches?
Kunze: Indem er sich u.a. vergewissert, daß er, wie es in einem Gedicht von Milan Kundera heißt, „immer bis ans Ende“ geht, „ans Ende der Zweifel / ans Ende des Hoffens / ans Ende der Leidenschaft / ans Ende des Verzweifelns“, so daß ihm die Summe des Lebens nicht „lächerlich klein“ herauskommt.
Eger: Sie sind im Februar 1990 nach Greiz gereist, wo Sie sich mit einer sehr knappen Ansprache als Redner auf dem Marktplatz an die Demonstranten wandten. Im Gegensatz zu vielen ost-westdeutschen Kollegen waren Sie in den ersten Jahren nach der Wende nicht mit einer Vielzahl von tagespolitischen oder kommentierenden Einlassungen anzutreffen. Sie waren tatsächlich sehr zurückhaltend, warum?
Kunze: Wenn ich öffentlich gefragt worden bin, habe ich geantwortet, und mich zusätzlich im Rundfunk oder in der Presse zu Wort zu melden, hatte ich keinen Grund. Wie ich mich auch früher fast nie ungefragt zu Wort gemeldet habe. Ich bin Schriftsteller, und meine Sache ist die Literatur. Ich habe Gedichte geschrieben, die in dem Buch ein tag auf dieser erde vorliegen und inzwischen in den Schulbüchern stehen, nicht nur in deutschen. Das ist das Eigentliche. Außerdem erschien aber 1990 die Dokumentation Deckname „Lyrik“, die, wie Sie wissen, einiges bewegt hat und noch immer bewegt. Als das Buch in Serbien herauskam, habe ich dort Rede und Antwort gestanden. Ebenso in Rumänien, um nur diese beiden Länder zu nennen. 1993 erschien das Buch Am Sonnenhang, ein Tagebuch voller Anmerkungen zur Zeit. 1994 kam der Band Wo Freiheit ist… heraus. Dieses Buch enthält vorwiegend politische Gespräche, die bis ins Jahr 1993 reichen. Und das ist noch nicht alles an Büchern, die in jener Zeit entstanden sind. Außerdem habe ich Reden gehalten. Genügt das nicht?
Eger: Deckname „Lyrik“ war eine der ersten Dokumentationen, die nach 1989 den „Sicherungsbereich Literatur“ ausleuchteten, ein Buch von hoher Schärfe im Detail bei gleichzeitiger Diskretion gegenüber den betroffenen Personen. Das Buch hatte, nicht zuletzt im Blick auf die hier nachgewiesene Spitzeltätigkeit Ibrahim Böhmes, einige Brisanz. Mit welchen Begleiterscheinungen ging die Drucklegung über die Bühne?
Kunze: An dem Tag, an dem das Buch die geheimgehaltene Druckerei verlassen hatte, erreichte mich die bisher letzte Morddrohung. Es war am 9. Dezember 1990, wieder punkt 22 Uhr. Der Anrufer sagte, ich solle nicht auflegen, wie ich sähe, verfüge er über meine Geheimnummer, aber ich könne sicher sein, daß er sich kein zweites Mal melden werde. Wörtlich sagte er:
Lassen Sie die Finger von Dingen, die für Sie oder Ihre Frau tödlich ausgehen könnten.
Kunze: Sie schrieben in Ihrer Vorbemerkung zu „Deckname „Lyrik“, es gehe Ihnen um Mechanismen, nicht um Personen. Ist aber über die Mechanismen der DDR-Herrschaft zu reden, wenn über Personen geschwiegen werden soll?
Kunze: Wenn ich schreibe, es geht mir in diesem Buch nicht um Personen, sondern um Machtmechanismen, heißt das nicht, daß nicht auch über Personen gesprochen werden muß.
Eger: Welche Spitzeltätigkeit ist zu entschuldigen im nachhinein?
Kunze: Jede, für die um Entschuldigung gebeten wird.
Eger: Es wird gern beklagt, daß „der Osten“ über seine Vergangenheit schweige; die Konflikte und Haltungen von einst weichspülende „Ostalgie“-Welle ist nur eine Variante dieses Verstummens. Das Schweigen hat Gründe: Es verdankt sich der Scham, die ihre Ursachen in Anpassung und erlittenen Niederlagen findet: Wer stellt das gerne aus? Dem Westen hingegen gerät der Osten nur in hochtönenden Leitartikeln in den Blick: Ein Schweigen in eigener Sache auch das. Schweigt der Westen aus Scham – oder aus Desinteresse?
Kunze: Diejenigen im Westen, die allen Grund hätten, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, haben auch allen Grund, nicht an sie zu rühren. Ihre Ideologie würde dekuvriert.
Eger: Gab es jemals Lockerungsübungen der Art, daß eine Selbstreflexion der West-Intellektuellen eingesetzt hätte im Blick auf ihr Verhältnis zur DDR? Oder im Verhältnis zu Ihnen?
Kunze: Da fehlt mir der Überblick. Was meine Person betrifft, gab es zwei, drei Äußerungen, für die ich dankbar bin. Nur haben es diejenigen, die sich öffentlich oder halb öffentlich entschuldigen, am wenigsten nötig.
Eger: Hat sich Ihre gesellschaftliche Problemlage aufgelöst?
Kunze: Nein. Aber es werden andere Akzente gesetzt. Die öffentlichen Angriffe hörten 1990 schlagartig auf. Man hörte nur ab und zu noch ein Zähneknirschen. Als Deckname „Lyrik“ erschienen war, sagte ein bekannter Journalist in kleinem Kreis:
Das fehlt uns gerade noch, daß der (also ich) zum Märtyrer wird!
Nach einiger Zeit begannen die Attacken jedoch von neuem, nur nimmt man sich jetzt nicht mehr die Person, den Dissidenten, den Verräter der guten Sache vor, sondern das Werk, und zwar rückwirkend – also das Gesamtwerk. Man sagt nicht mehr, der Mann ist nicht ernst zu nehmen, sondern das Werk. Dabei geht man nicht weniger skrupellos und denunziatorisch vor als der Stern-Redakteur Michaelsen. Aber es gibt zur Welt der Gegner auch eine Gegenwelt, die der Freunde, meiner Leser und der seriösen Literaturkritik. Und: Die Bücher finden ihren Weg in die Welt ohne mein Zutun.
Eger: Das geht doch nicht spurlos an einem vorüber.
Kunze: Ohne Traumata kein Leben… Aber lassen Sie mich an einem Beispiel erklären, was mich seit dreißig, vierzig Jahren tatsächlich bedrückt: In einem Brief vom 22. August 1986 schrieb mir Hans Mayer, Tübingen, in politischen Tagesdingen seien wir beide vermutlich oft verschiedener Meinung. Er habe darüber nachgedacht und glaube, die Ursache zu kennen. Wir, also die Leute wie ich, hätten das Aufkommen eines Dritten Reiches nicht erlebt, vor allem nicht in so kennzeichnenden kleinen Symptomen. Solche Symptome hätte ich doch „drüben“ sehr genau gespürt. Warum nicht hüben? Leute wie er erlebten hierzulande immer wieder, was sie damals erlebt hätten. Freilich gebe es trotzdem das Wort: noch nicht.
Eger: Woraus schloß Hans Mayer, daß Sie diese Symptome im Westen nicht gesehen hätten?
Kunze: Weiß ich nicht. Vielleicht hatten es ihm bestimmte Leute eingeredet. Möglicherweise hatte er aber in dem einen oder anderen Fall recht, doch dann hätte ich gern auf ihn gehört, denn aufgrund seiner Herkunft und Vergangenheit verfügte er über Erfahrungen, die ich nicht besaß. Darin, daß sich diese Vergangenheit nicht wiederholen dürfte, waren wir uns einig gewesen, sonst hätten wir nicht zwanzig Jahre lang freundschaftlich miteinander korrespondiert. Zweifelsohne stimmte es aber, daß wir in politischen Tagesdingen nicht immer einer Meinung waren. Es schien außerhalb seiner Wahrnehmung zu liegen, daß manche sich auch hier im alleinigen Besitz der Wahrheit wähnten und in den Mitteln mit denen sie von ihnen zu Gegnern erklärte Personen verfolgten, nicht wählerisch waren.
Verdrängte Hans Mayer, oder trübte ihm seine sozialistische Grundüberzeugung den Blick? Trotz allem wußte ich ihn jedoch in der Ablehnung auch der linken Diktatur an meiner Seite. Am 22. September 1998 schrieb er mir, vor einigen Tagen habe er im Südwestdeutschen Rundfunk eine Sendung aus Anlaß meines neuen, offenbar demnächst erscheinenden Gedichtbandes gehört – es handelte sich um das Buch ein tag auf dieser erde –, und er habe sich über diese Nachrichten gefreut. Ich dürfte seit langem wissen, daß er sein Urteil über mich sorgfältig getrennt habe von allen „geistigen oder ,geistlichen‘ Divergenzen“.
Eger: Was meinte Mayer mit „geistig“ und „geistlich“?
Kunze: Wenn ich es richtig verstehe: weltanschaulich.
Eger: Was ist es, das Sie so nachhaltig bedrückt?
Kunze: Daß es so wenige waren und sind, die ihr Urteil über einen Menschen und sein Werk sorgfältig von allen „geistigen‘ oder ,geistlichen‘ Divergenzen“ zu trennen vermögen. Zu ihnen gehörten Jean Améry, Heinrich Böll, Elias Canetti, Uwe Johnson und Mazino Montinari.
Eger: Die politische Landschaft ist eine Landschaft der Kränkungen; hier ist mit Analysen nicht viel zu retten. Recht eigentlich ist diese Landschaft ein Käfig. Ist es nicht so, daß Menschen, die sich von einer Ideologie verabschiedet haben, nicht gestattet werden soll, den Raum des Ideologischen zu verlassen? Immer wieder wird Ihr Werk auf Spuren von Ideologie hin befragt.
Kunze: Ich äußere nur ein Gefühl: Wir Deutschen sind in dieser Beziehung besonders unbelehrbar.
Eger: Herr Kunze, sind Sie ein „Sieger der Geschichte“?
Kunze: Ich wüßte nicht, wen ich besiegt haben sollte.
Eger: Sie schreiben in einem Horst Drescher gewidmeten Gedicht:
Wir aber haben erlebt, daß das leben
auch recht geben kann
Worin hat Ihnen das Leben recht gegeben?
Kunze: In der Überzeugung, daß – um es mit Václav Havel zu sagen – die Totalität des kommunistischen Systems im Widerspruch zum Wesen des Lebens selbst steht und deshalb am Leben scheitern wird.
Eger: Wie kann man sich als ein Aufklärer vor belehrenden, auch eifernden Zügen schützen, kommt die Rede auf die Vergangenheit – eben auch auf die, die nicht vergeht?
Kunze: Die Fakten sprechen lassen und niemanden mit Erkenntnissen zwangsbeglücken wollen, vor denen er sich – aus welchen Gründen auch immer – verschließt.
Eger: Sollte man nicht mit dem sich selbst Verteidigen aufhören, denn jedes Verteidigen heißt ja bereits, in der Erwartungshaltung des Anklägers das Unterstellte zu akzeptieren. Sollte man nicht seine Erfahrungen sprechen lassen, nicht die Gebote?
Kunze: Dort, wo es um Ihre Integrität, Ihre Glaubwürdigkeit geht, müssen Sie eine Verleumdung als Verleumdung kenntlich machen. Alles andere können Sie dem Regen überlassen – Sie müßten es sogar, sonst werden Sie unschöpferisch. Wird eine Denunziation, die Ihre Integrität tangiert, unter Verweis auf einen Ihrer Texte in die Welt gesetzt, bleibt Ihnen nichts anderes, als ihn zu Hilfe zu rufen. Ihre Bücher dürfen es jedoch nicht nötig haben, von Ihnen verteidigt zu werden. Ein Buch, das seine Rezensionen nicht überlebt, überlebt sie zurecht nicht.
Eger: An welcher Ortsmarke Ihres Werkes sehen Sie sich heute? Was steht auf dem Plan?
Kunze: Zuerst einmal die Lese- und Ausstellungsreisen zu überleben, die bis mindestens Anfang 2004 dauern werden. Wenn neue Bücher erschienen sind, bedeutet das, daß ich mich vorher einige Jahre mit Lesungen zurückgehalten habe – es waren „Schreibtischjahre“ – und ich den Einladungen nun wenigstens zum Teil nachkommen möchte. Die Ausstellungen stehen im Zusammenhang mit dem Prosa-Foto-Band Der Kuß der Koi. Das alles – jede Lesung, jedes Neuentwerfen und eigenhändiges Hängen der Ausstellung in immer anderen Räumlichkeiten, jede Vernissage usw. – verlangen mich so sehr ganz, daß ich im Augenblick noch nicht daran denke, welche Art Faden ich danach spinnen werde, und wüßte ich’s, würde ich es nicht wagen, heute darüber zu sprechen.
Eger: Eine Frage an den Camus-Verehrer zum Schluß: Dürfen wir uns den Dichter Reiner Kunze als einen glücklichen Menschen vorstellen?
Kunze: Als einen, der mit „Ja“ beginnt.
Die horen, Heft 210, 2. Quartal 2003
Die Initiative der Worte
– Laudatio auf Reiner Kunze zur Vergabe der Christian Ferber Ehrengabe am 4.4.2000 im Literaturhaus Hamburg. –
Kürzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, musste ich bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung den Schauspieler Hardy Krüger dem Publikum vorstellen, der – übrigens hervorragend – aus seinem neuesten Buch las. Im Augenblick, da wir beide den Saal betraten, wisperte mir Hardy Krüger, Deutschlands Blondschopf außer Diensten, inzwischen auch schon über die 70 hinaus, zwischen Tür und Angel insgeheim rasch noch zu, ich solle doch, bitte, bitte, um Gottes Willen nicht allzu viel über ihn sagen. Das wäre ihm immer peinlich. Ich erwiderte, er könne in dieser Beziehung ganz beruhigt sein, ich spräche sicherheitshalber sowieso immer nur über mich selbst. Ich fürchte, sehr verehrter Herr Kunze, das wird auch heute geschehen.
Einige von Ihnen, meine Damen und Herren, werden vielleicht wissen, dass ich für DIE WELT seit Olims Zeiten über Tanz und Ballett und Musik schreibe. Selten dagegen über Literatur. Und so habe ich mich als Laudator bei Preisvergaben bislang auch immer nur an Choreographen wie Maurice Bejart geübt, an Sängerinnen wie Julia Varady, an Geigern wie Frank Peter Zimmermann. Nicht im Rühmen von Literaten.
Dabei gingen Tanz und Literatur ja immer erneut Hand in Hand. Ida Rubinstein hieß Gabriele d’Annunzio für sie „Le Martyre de Saint Sébastien“ schreiben, zu dem Debussy seine erlauchte Musik schuf. André Gide dedizierte ihr seine „Persephone“, die Igor Strawinsky für sie komponierte. Paul Claudel stiftete ihr, der Tänzerin Rubinstein, der Rezitatorin und Bühnenmagierin, seine „Jeanne d’Arc auf dem Scheiterhaufen“, zur Musik Arthur Honeggers. Da war Isadora Duncan, die sich im revolutionären Russland den Lyriker Sergej Jessenin erst an Land, dann ins Bett zog. Reiner Kunze gedenkt dieses Jessenins übrigens mit einem wundervollen Zitat:
Wie du auch singst, die Erde bleibt die alte, du singst kein Blatt vom Zweig
Weiter im Tanz! Im ewigen pas de deux der Tänzerin mit dem Dichter: Tilly Losch, die Wienerin, wurde die tanzende Anna neben der singenden Anna Lotte Lenya in Brecht und Weills „Die sieben Todsünden“. Und da bin ich schließlich selber als Romanfigur: unverstellt eingegangen in Günter Grassens „Hundejahre“, diesen bislang einzigen deutschen Ballett-Roman, wenn auch erst auf Seite 636 der Erstausgabe von 1963. Doch das Sprichwort weiß es wirklich ganz richtig:
Besser spät, als nie“
In gewissem Sinne darf ich mich also auch mit einem winzigen Zacken des Nobelpreises geehrt fühlen.
Ich bin möglicherweise sogar noch einer der wenigen, die wirklich und wahrhaftig mit Ezra Pound zu Tisch saßen (wiederholt stand ich inzwischen auf dem venezianischen Friedhof von San Michele an seinem Grab).
Vielleicht bin ich einer der wenigen, die noch Gerhart Hauptmann bei der Uraufführung seiner unseligen „Tochter der Kathedrale“ im Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ehrfurchtsvoll zujubelten: mehr aus Respekt allerdings für den Doppelgänger Goethes im Gehrock, denn aus Begeisterung für sein Stück. Ich habe mit St. John Ferse gespeist, immer wieder mit W.H. Auden. Ingeborg Bachmann habe ich buchstäblich, hier in Hamburg, auf meinen Händen getragen, damit sie ihre apfelsinenfarbenen Seidenpumps von Guerlain nicht in den winterlichen Straßenmatsch tauchen musste: von Kopf bis Fuß Kavalier und Saubermann also im Dienste der Lyrik.
Ich bin Jewtuschenko begegnet und Pier Paolo Pasolini, Tennessee Williams und Eugène Ionesco, ja und dann, eines schönen Tages, holte ich eine sehr reife, wundersame Japanerin vom Berliner Flughafen ab und lud sie zum Brunch zu mir nach Hause: Kanzaki Hidejo, die Meisterin des Jiuta-mai: einer höfischen Tanz-Art von formal ausgepichtestem Raffinement und dadurch ebenso kostbar wie annähernd bewegungslos. Wirklich ein Tanz für die kultiviertesten unter den älteren Damen.
Ich schenkte Kanzaki Hidejo zur Erinnerung an ihren Besuch bei mir ein schön gerahmtes, handkoloriertes Photo von Anna Pawlowa aus der ersten Vor-Weltkriegszeit. Ich erhielt als Gegengeschenk einen Fächer mit ihrem Signum in altjapanischer Blumensprache.
Wo Tänzerinnen sind, da sind Dichter. Im Gefolge der noblen, alten Japanerin fand ich Makoto Ooka, den Nobelpreis-Anwärter unter den japanischen Dichtern. Ich erfuhr, dass er 1979 begonnen habe, jeden Tag auf der Titelseite der Tokioter Tageszeitung Asahi Shimbun in Viel-Millionenauflage ein japanisches Gedicht aus alter oder neuerer Zeit abzudrucken und es gleichzeitig auszulegen. Prompt fand ich in Paris Ookas Anthologie Poèmes de tous les jours, die Sammlung dieser „Gedichte für jeden Tag“.
Natürlich eignen sich für einen solchen tagtäglichen Abdruck gerade die berühmten japanischen Haikus mit ihren nur drei Zeilen vorzüglich: diese Verse, die wie durch ein Nadelöhr ins Gedächtnis dringen; in heftigem Gegensatz zu den Vers-Güterzügen unserer Schiller-Balladen, die wir als Schuljungen in unser Gedächtnis zu rangieren hatten. 56 Strophen, mein Gott, „Der Kampf mit dem Drachen“, in denen uns Knaben gewissermaßen Schiller höchst persönlich als Drache erschien.
In Japan dagegen: Westentaschen-Lyrik, Verse wie Schnupftabak. Lyrische Prisen
Yosa Buson (1715–1783) schrieb diese Verse (ich habe sie und die folgenden aus dem Französischen übertragen):
Eine Forelle niederlegend
geht er des Nachts seines Weges
an meiner Pforte vorbei.
Tan Taigi (1709–1771) dichtete kurz und knapp:
Erste Liebe
Dicht bei der Laterne
Gesicht gegen Gesicht.
Kyôgoku Tamekane (1254–1332) konstatierte:
Was Brücken wissen:
sie verbinden über Wasser,
was unter Wasser verbunden ist.
Hashimoto Takako (1899–1963) beschließe für heute diesen kleinen japanischen Reigen aus Versen:
Die Menschen meiden die Stille.
Sie könnten sonst in sich
Die Schuld knien hören.
Wohin führt uns, meine Damen und Herren, dieser kleine Ausflug nach Japan, dieser zarte poetische Exkurs? Er führt uns einer überrumpelnden Wahrheit entgegen, die Reiner Kunze, wie denn anders, ich sah es ihm an, natürlich längst schon erkannt hat:
Unter den letztgenannten Namen Tamekame und Takako habe ich Haiku-ähnliche Verse von Reiner Kunze versteckt: geschliffene lyrische Formulierungen von Messerschärfe und verzweiflungsvoller Eindringlichkeit, wenn ich auch bezweifle, dass man die Schuld knien hören kann. Und zwar aus folgendem niederträchtigem Grunde:
Diese Unhörbarkeit liegt zweifellos nicht an der wundervollen dichterischen Formulierung, auch nicht an unserer Taubheit gegenüber den Schuldbekenntnissen, sondern einzig daran, dass Schuld, so schwer sie auch wiegen mag, heutzutage nicht mehr kniet.
Schlimmer noch: sie denkt gar nicht mehr daran. Das ist der Jammer. Und es ist tatsächlich die Aufgabe der Dichter, unnachgiebig daran zu erinnern.
Reiner Kunze hat es getan. Wieder und immer wieder. Unter Einsatz von Freiheit und Leben. Das wird ihm die deutsche Literatur, das deutsche Volk oder die deutsche Bevölkerung, ganz egal, nie vergessen. Mögen andere auch gleichzeitig immerfort selbstgerecht, aber verlogenen Mundes über vorgebliche Errungenschaften klagen, die verloren gegangen seien.
Das Gegenteil ist der Fall: Man hat Deutschland von diesen sogenannten Errungenschaften der „wundervollen Jahre“ befreit, in denen man versuchte, wie Imre Kertész es formuliert hat, das ganz „normale Dasein für illegal zu erklären“; und es war eine Befreiung aus Innen im aller wortwörtlichsten Sinne. Es war eine Selbstbefreiung durch das geknechtete, das lange Zeit geknebelte Volk, das geknebelte und geknechtete Wort. Ihm hat Reiner Kunze lange vorab die Stimme zurückgeschenkt in seinem Gedicht.
Aristoteles hat uns vor über zwei Jahrtausenden vorgegeben, was die Lobpreisung eines Menschen niemals vergessen darf. Es hat jeder Laudatio um das Zur-Erscheinung-Bringen der menschlichen „Bestheit“ zu gehen, „die der höchste, wahrste Wesensausdruck, der höchste Ausdruck von Mensch oder Ding ist“. Dreifaches hat, immer nach Aristoteles, dieser Lobpreis zu bewirken: erstens den Gelobten in dieser seiner „Bestheit“ zu bestätigen und zu bekräftigen, zweitens sein Wesensbild als Vorbild für andere hinzustellen, drittens dem Gelobten durch das Lob eine ideelle Schuld zu entrichten, kurz und knapp: ihm zu danken.
Dieser Dank gilt also heute hier Reiner Kunze. Er kommt von Herzen, und er kommt in diesem Falle glücklicherweise von überall her. Kunzes Poesie hat ihren Weg von Anbeginn über alle Stacheldrahtzäune, Mauern und Schützengräben der kalten Kriege und kalten Krieger gefunden. Sie hat Erleichterung gesät. Sie hat Mut gemacht, sie hat Hoffnung gesät und Befreiung geerntet.
Und dennoch: diese „Bestheit“, die Aristoteles herauszustellen forderte, festgeschrieben, wie es zu seiner klassischen Zeit war, ein Leben lang, sieht man in unserer schnelllebigen Epoche nicht mehr so dauerhaft fest zementiert wie in altgriechischer Zeit. Heute ist diese „Bestheit“ Schwankungen des Urteils ausgesetzt, der willentlichen Blindheit, der Vergesslichkeit, sogar der Häme.
Reiner Kunze ist sich sehr schnell darüber klar geworden. Der Fall Peter Huchels, der Sturz Peter Huchels hat es ihm deutlich vor Augen geführt.
Kunze zitiert ein Verdikt, in bemerkenswert edlem Zeitungs-Deutsch formuliert, das schon 1972 behauptet, „dass die Bedeutung dieses Dichters (Huchel ist gemeint) mehr von zeitgeschichtlicher als von künstlerischer und psychologischer Beschaffenheit ist.“
Kunze zieht mit diesem Urteil auf seine Art vor Gericht. Er geht in die Berufung. Er schreibt:
So sehr demütigten sie ihn,
dass er sein leben von den wegen nahm,
die die ihren kreuzten
Angekommen hier, las er, dass er
nicht entkommen war.
Immer wieder findet sich bei Kunze dieses Lamento, die Lebensklage, die Daseinsklage, die Forderung an das Dasein:
Übe die hohe Schule des Entkommens, in der wir alle mehr oder weniger Klippschüler sind, die der Dichter indes wie kein anderer zu bestehen hat.
Kunze weiß:
den Dichter richtet das Gedicht.
Er hat, wie Stéphane Mallarmé es formulierte, „die Initiative an die Wörter“ abzutreten. Nichts anderes bleibt ihm zu tun. Kein anderer Richter ist über ihm. Wie Münchhausen am eigenen Zopf, so zieht sich der Dichter einzig an seinem Gedicht aus dem Sumpf der Zeit.
Kunze weiß auch, dass „das Gedicht der Blindenstock des Dichters“ ist. Das Gedicht ist „zur Ruhe gekommene Unruhe“. Immer wieder befragt Kunze voller Unruhe sich selbst und sein Gedicht.
„Lass uns die Angel auswerfen nach oben“, sieht er als poetisches Ziel. Doch was kann man dort fangen? Die Ewigkeit – oder den Tod. Mit einigem Glück: das Gedicht – und dies in voller eindrücklicher Klarschrift.
Kunze ist kein lyrischer Geheimniskrämer. Er ist ein Dichter der Beherzigungen, des Einleuchtenden, das tatsächlich aus der Sprache heraus zu leuchten versteht, der Prägnanz. Kunze gibt sich und seinen Lesern keine Rätsel auf. Es setzt keine leerlaufenden Metaphern. Um Kunze ist Wahrheit und Klarheit, Schlichtheit und lyrisch geläuterte Normalität.
Mir gefällt immer die Erinnerung daran, dass Goethe ein bisschen umständlich, aber sorgfältig eigens festliche Kerzen anzündete, bevor er Eckermann die Marienbader Elegie zu lesen gab. Ähnlich hat uns Kunze, wenn auch aus anderen Anlässen, eine Vielzahl von Lichtern aufgesteckt und angezündet, das, was ihm am Herzen liegt, zu erhellen. „Niemals wird es uns gelingen, die Welt zu enthassen“, konstatiert er mit einiger Bitterkeit. Aber entmutigen darum lässt er sich nicht. Er zeigt sich willig „für die Existenz der Poesie die Existenz zu riskieren“, und er hat das nicht einzig dahingereimt.
Er hat es bewahrheitetet. Mit den Nägeln der Poesie hat er sich immer wieder eigenhändig ans Kreuz geschlagen. Die Wundmale sind seine Gedichte. „Die nicht gegebenen Versprechen halten“, weiß Kunze, „– das ist Treue“.
Reiner Kunzes Gedichte zu lesen, heißt im Warmem, auf dem Trockenen, im Frieden noch einmal die schrecklichen Abenteuer, die uns glücklicherweise verschont haben, die Fährnisse des Lebens zu bestehen, denen die meisten von uns nicht in die Fänge gelaufen sind. Oder noch nicht gelaufen sind.
Allenthalben bastelt man schließlich an neuen Bedrohungen, von denen noch keiner zu sagen weiß, welche Opfer sie fordern werden. Aber keine Sorge: das Fernsehen von übermorgen zählt sie uns alle nachdrücklich her. Es gilt sich darauf vorzubereiten, sie zu bestehen am Ende.
Reiner Kunzes Gedichte sind fraglos dabei eine Hilfe.
Nie hat er gelernt, den Kopf in den Sand zu stecken. Helläugig hat er die Schwierigkeiten des Daseins in den Blick genommen. Nie hat er den Opfern die Anteilnahme verweigert. Stets hat er einzig das Notwendige in unverwechselbare, knappe und eindringliche Worte gefasst.
Er spricht nicht zur Menschheit. Er spricht, was schwieriger ist, zu den Menschen. Er lebt ihnen ohne Aufdringlichkeit zudem seine Lyrik vor. Er zitiert Robert Schumann:
Ich mag den Menschen nicht, dessen Leben mit seinen Werken nicht im Einklang steht.
Bei Kunze klingen; beschönigungslos, Leben und Werk stets zusammen.
Er ist sich dieses Einklangs ganz sicher. Er ist davon auf schier schlafwandlerische Art fest überzeugt. Er glaubt sich aufs Wort. Darum geht er mit dem Wort so vorsichtig um.
Er weiß felsenfest, er ist ein Dichter, und er weiß, was er als Dichter zu tun hat: Wahrheit säen und Betroffenheit ernten – und dies mit den Mitteln der Poesie. „Poesie ist außer Wahrheit vor allem Poesie“, hat Kunze erkannt.
Diese Betroffenheit durch Wahrheit wie Poesie hält bei der Lektüre Kunzes über viele Gedichtbände an. Sie frisst sich fest. Sie wird immer aufs Neues herauf beschworen. Wie das geschieht, das ist Kunzes zuhöchst originelle poetische Leistung.
Sie gibt sich unverklügelt. Sie kommt wie auf Katzenpfoten daher. Sie springt den Leser nicht an, sie schleicht sich ein, fern aller Pathetik. Kunze erscheint als ein Fürsprecher dichterischer Normalität. Aber gerade das ist heutigen Tags das Anomale.
Seine Gedichte sind Erkundungsfahrten ins vermeintlich Allbekannte und öffnen ihm erstaunlicherweise mit dem Schlüssel des Wortes unvermutete Horizonte. Übrigens auch in sich selbst. Als Schlüsselloch dient ihm dabei das Zitat. Kunze ist ein Meister im Zitieren.
„Heute habe ich nichts gemacht. Aber viele Dinge geschahen in mir“. Er ruft mit diesen Worten Roberto Juarroz, wer auch immer das sein mag, zum Bezeugen eines Geschehen auf, das Kunze immer erneut überfällt, heimsucht, inspiriert, erleuchtet.
„Ich suche nicht. Ich finde“, hat Picasso von seiner künstlerischen Arbeit gesagt, und so findet nicht nur der Vers zu Kunze, sondern auch das Zitat.
Es findet von überall her seinen Weg zu ihm, von Paul Valéry und Ingeborg Bachmann, von Gottfried Benn und Alexis de Togueville, von Pico della Mirandola und Albert Camus, von Erasmus von Rotterdam und Marie Luise Kaschnitz, von Georg Trakl und Friedrich Hebbel, von Fernando Pessoa und Hermann Hesse.
Kunze lässt auf einem fiktiven Flugblatt Albert Einstein zu Wort kommen:
Jeden Tag denke ich daran, dass mein äußeres und inneres Leben auf der Arbeit der jetzt lebenden sowie schon verstorbener Menschen beruht; dass ich mich anstrengen muss, um zu geben, im gleichen Ausmaß wie ich empfangen habe und empfange.
Die ganze Welt der Poesie wirft im Zitat ihren flammenden Sternenhimmel über Kunzes Gedichte hin, und sie kreisen mit, gleichberechtigt, selbstbewusst, undemütig. Ganz von dieser Welt und ganz von der seinen.
Klaus Geitel
WIE MAN BÜROKRATEN SCHLÄGT
für Reiner Kunze
Du kannst sie nicht treffen: Sie sind dünn wie Papier.
Du kannst sie nicht verletzen: Das Papier sind nicht sie.
Doch bekämpfen müssen wir sie, wir, die Friedfertigen.
Und Schmerz empfinden, oder alles wird zu Papier.
Sie vergeuden deine Zeit. Es wird dich
Noch mehr deiner Zeit kosten, all die Muße, die sie dir noch ließen.
Sie verschwenden deine Energie. Es wird dich noch mehr kosten,
All den Verstand, all die Freude, die sie dir noch ließen.
Ja. Fülle jene Formulare aus. So minuziös,
Daß es für sie schwer sein wird, die wichtigen Dinge
Von denen zu unterscheiden, die du ihnen als Bonus schicktest,
Als es an dir war, die Mischung zusammenzustellen.
Denk dir Komplikationen aus, abstrakter noch als jene,
Die sie dir aufzwingen. Verkompliziere ihre
Verklausulierungen noch mehr. Zwinge sie, neue Formulare zu drucken,
Neue Abteilungen zu öffnen, neue Spezialisten einzustellen,
Um deinen Fall zu bewältigen. Überfüttere ihre Computer,
Bis diese nur noch reine Mathematik ausspucken, sich selbst löschen
Und sich zu einer mysthischen Meditation
Über die unendlichen Brüche des Nichts abschalten. Unterdessen
Bombardiere die Computer-Programmierer mit immer mehr Papier,
Bis aus Papier und Tinte Mann oder Frau entstehen,
Das Wort zu Fleisch wird; und sie, in den Papierstößen nach Luft schnappend,
Wieder das erste unserer Bedürfnisse lernen: zu atmen.
Ah, und die Akte wird ihre Blätter unklassifizierten Winden überlassen müssen,
Inspektoren werden sich selbst inspizieren und unverzüglich
Anträge in dreifacher Ausfertigung auf ihre eigene Entlassung stellen,
Und der Beamte wird sich mit dem Antragsteller niederlegen.
1975
Michael Hamburger
Übertragen von Hans-Christian Trepte
GEDICHT DAS ES ABLEHNT EINEN TITEL ZU HABEN
Für Reiner Kunze der ein angler ist
Kinder mit kleinen angelruten kehren ins dorf zurück
und tragen einen fisch ins taschentuch gebunden
Er ist noch lebendig
unterm nassen leinen bewegt er langsam die kiemen
und sondert schleim ab
Gott erlaubte es
und gab aus den tiefen den kindern den fisch als geheimnis
und stummes kleinod fast wie ein lösegeld
für alles was er uns vorenthält
Doch in wirklichkeit einen schlüssel aus kaltem silber
zu all den häusern
die er für uns absichtlich ohne türen baut
Die kinder ahnen es nicht und gehen stolz von dannen mit dem fang
auf dem weißen weg zwischen den disteln
Der himmel umzog sich
und es regnet zart gleichförmig fein
Jan Skácel
übersetzt von Reiner Kunze
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
Herlinde Koebl spricht mit Reiner Kunze – „Einen weiteren Ansehensverlust der DDR wollte man vermeiden“, Die Zeit, 22.5.2019
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.1.2012, literaturWERKstatt berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb + Archiv + IZA + Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Dirk Skiba Autorenporträts + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


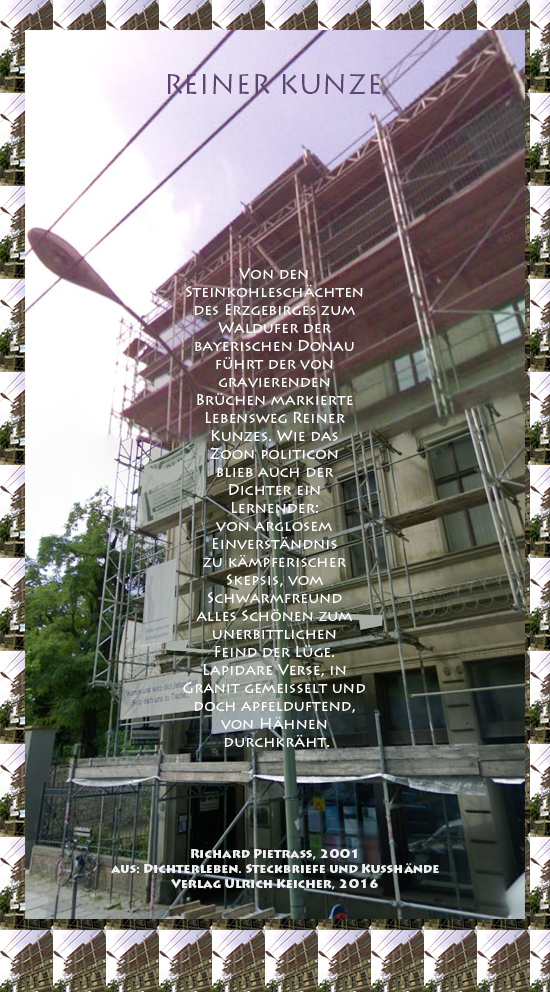












0 Kommentare