APOCALYPSE NOW
Die Apokalypse ist rein rechnerisch gesichert
aber kommt anders, als wir erwartet haben.
Sie beginnt nicht mit dem Engel, der die Posaune
aaaaabläst
oder seine Phiole ausgießt, und mit den ersten Takten
aaaaader Matthäuspassion
noch viel weniger.
Sie entspricht nicht unseren Vorstellungen.
Sie ist kein Knall und kein Licht.
Es kann sogar sein, daß sie so ganz nebenbei längst begonnen
aaaaahat,
daß sie nicht einmal bis zu uns durchkommt
und auch für die paar stocktauben Engel, die noch immer auf den Kick der Explosion warten,
die größte und letzte Enttäuschung wird.
Jacques Hamelink
übersetzt von Gregor Laschen
![]()
Noch etwas:
Ein Belegexemplar des Jahrbuchs hat mich wie üblich nicht erreicht; Heinz Czechowski hat mir deshalb sein Exemplar geliehen. Ich möchte jetzt nicht viele Sätze, obwohl das notwendig wäre, bezüglich des Buchs machen. Nur so viel: Es ist sicher das interessanteste und auch stärkste Werk dieser Art seit mehreren Jahren, die Vorgänger weit überrundend was allerdings wohl auch einigen wieder lebhafter gewordenen Lyrikern zu danken ist; meine Mutter würde murmeln: „Irgend etwas ist da im Gange, paß auf!“… PS: Können Sie, bitte, feststellen, was aus meinem Honorar geworden ist.
Adolf Endler
In das letzte Jahrbuch lese ich mich ein; ich denke, es hat unter Autoren Diskussionen ausgelöst (und das ist gut so), besonders über die starke Präsenz der DDR-Lyriker.
Michael Buselmeier
Die Lektüre hat mich betroffen gemacht. Es sind gute Texte drin, unbestritten, aber fast alle Texte können nur von intellektuellen Überfliegern und Insidern in dieser Art lyrischer Oberschichtsprache verstanden werden. Ich meine, Lyrik müßte immer wieder versuchen, unter die Leute zu kommen, ohne dabei umzukommen, wenn zeitkritische Texte irgend etwas bewirken sollen, was mehr ist als Exhibition.
Fritz Deppert
Diese Autoren, wie sie sich in Lyrik ’84 präsentieren (auch da, wo sie für mich unverständlich bleiben, z.B. Oskar Pastior), stellen sich ihrem Deutschland, diesem Fragezeichen-Dasein. Titel wie „Der Frieden“ (Volker Braun), „Ein Fremder kommt und kennt die Ortsgeschichte nicht“ (Jürgen Becker), „Die Väter sind tot“ (Bodo Morshäuser) etc. signalisieren das Sujet: eine Schreckensvision nach rückwärts geblickt, der man sich stellt, indem man sie zeigt. Zeigen jedoch als ein unabgeschlossener Verarbeitungsprozeß im schreibenden Ich: „Fremdsprache“ (Felix Philipp Ingold), „Sprechender Apfel“ (Ralf Thenior), „Wachgeträumt“ (Michael Buselmeier), „Auch ihr? So wahr diese Erde“ (Alfred Kolleritsch). „Wie soll ich eine Geschichte / verlassen, in der ich endlich lebe?“ So äußert sich Michael Krüger und umreißt damit fragend einen Standort, für den Flüchten aus der geschichtlich gewordenen Lebenserfahrung keine Alternative ist. „Es ist aus.“ Aus ist das Verschieben von Verantwortung auf die Väter, die nicht gefragt, aber „etwas gewußt haben“ von dem „Nichts“, das um sie herum geschah. Voller Skepsis geht Elke Erb diesen Fragen auf den Grund in ihrem Gedicht „Fluchtpunkt“:
Ich frage mich,
wie ich mich zurückziehen kann
Das Ich fragt sich selbst, denn nur von hier kann, da die Väter tot sind, die Antwort, die Hannelies Taschau in „Immer gab es etwas“ so fürchtet, kommen. Der Blickpunkt des Ich – und hier spricht Elke Erb das Unbehagen der in den beiden Nachkriegsgesellschaften herangereiften Generation aus – ist „ohne Obdach“. Die Unschuld unserer Generation erweist sich als Trugbild, und jede Frage, die nicht am eigenen Ich ansetzt:
ist ja dem Meineid verschworen. (diese Zeile könnte von Ingeborg Bachmann sein?)
Schon das Wörtchen „wie“, mit dem Elke Erb die Frage nach der Möglichkeit eines Fluchtpunktes einleitet, verweist auf die Unmöglichkeit.
Lassen Sie mich zum Schluß noch einige Überlegungen hinzufügen, von denen ich hoffe, daß sie Sie als Herausgeber interessieren, da sie die technische, die herausgeberische, d.h. auch herausfordernde Seite betreffen. Ich hätte es als Erleichterung empfunden, wenn – wie in vielen ausländischen Anthologien der Fall – zu jedem Gedicht das Entstehungsjahr oder das der Erstveröffentlichung angezeigt worden wäre. Am meisten habe ich einen solchen Hinweis bei Ernst Meisters Gedichten aus dem Nachlaß vermißt. Mir stellt sich auch sogleich die Frage, ob es sinnvoll ist, die wenigen Gedichte eines jeweiligen Autors nur wegen einer mehr oder weniger willkürlichen Themengliederung auseinanderzureißen. Ich persönlich ziehe es vor, ohne umständliches Hin- und Herblättern die Gedichte eines Autors nacheinander offeriert zu bekommen, um mich etwas in seine Sprache, seine Eigenart einzulesen. Erst dann vermag ich herauszufinden, ob ich diesem Autor und seinen Arbeiten weiter nachgehen möchte. Ein weiterer für mich erschwerender Aspekt ist das Fehlen eines Anmerkungsapparats, in dem z.B. Ausdrücke wie „Dumper“, „Ormid“ etc. erklärt werden. Ebenso würde ich es begrüßen, wenn – soweit möglich – die literarischen Anleihen der Autoren ausgewiesen würden. Mir ermöglichen solche Querverweise, wie sie der Aufbau-Verlag für Lyrikbände angibt, gezielt zu recherchieren. Werfen doch solche Verweise wie z.B. bei Volker Brauns „Im Ilmtal“ zu Goethes Gedicht „An den Mond“ ein ganz anderes Licht auf das vorliegende Gedicht. Verzeihen Sie, wenn ich solche Ansprüche anmelde, aber 1. ist für mich Literatur keine hop and go-Ware und 2. kann ich die Texte all der Bücher, die ich gelesen habe, nicht ständig präsent haben, und 3.: literarische Verweise sind für mich Einladungen, auf Entdeckungsreisen zu gehen.
Rita Hess
Sie schreiben: „Es scheint, als ob die Anstrengung das Unsagbare sagbar zu machen, zur Zeit von den Lyrikern der DDR unternommen würde und hierzulande von den etablierten Autoren.“ Meinetwegen! Ich will Ihnen Ihre Meinung nicht streitig machen. Sie als Lektor bei Claassen und Hanser und Jahrbuch-Herausgeber (wo Sie bevorzugt Claassen/Hanser/Luchterhand-Autoren veröffentlichen) müssen es ja wissen. Aber sie hätten besser schreiben sollen: von den Lyrikern, mit denen die Herausgeber in beruflicher und privater Beziehung stehen. Ich habe auch nichts gegen Gregor Laschens Affinität zu Meister, Arendt und Hein und auch nichts gegen seine Anthologie Lyrik in der DDR, die er 1971 herausgegeben hat, aber warum wird dann nicht geschrieben: von den ETABLIERTEN Lyrikern der DDR, denn von den jüngeren Lyrikern sind nur Pietraß und Kolbe vertreten und sonst kein einziger Autor, der nicht auch schon in Laschens DDR-Anthologie vertreten war. Das ist jetzt vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, aber Sie werden schon verstehen. Was die Widmung „Für Ernst Meister“ betrifft, so sagt ein Zitat von Nicolas Born alles:
Und übt sich nicht der Luchterhand Verlag in unbescheidener Zurückhaltung, indem er Meisters Bücher mit langsamer Geduld verbreitet und sie dafür schnell wieder einstampft?
Das hat er zwar 1976 geschrieben, aber geändert hat sich da nichts. Oder? In Ihren „Abschließenden Notizen“ stecken noch einige Bumerangs, aber ich wäre schon zufrieden, wenn Sie mir den zuerst zitierten Satz näher erläutern würden.
Lothar Reese
Abschließende Notizen
I
„Fortsetzen und Niveau durchhalten“, schreibt einer – und „Die Ossies werden immer stärker“ ein ganz Junger.
II
Auf 80 Einladungen, für das zweite Luchterhand Jahrbuch der Lyrik Gedichte zu schicken, erhielten wir gut 160 Einsendungen: das ist fast die Hälfte weniger als im Vorjahr. So entstand diese Auswahl, die, als sie stand, die Herausgeber selbst überraschte. Ein Paradigmenwechsel kündigt sich an. 1985 werden Gedichte eher am Reißbrett gezeichnet als mit dem Munde gemalt. Viele dieser Gedichte sind kopflastig. Jene „Sorge um Volkstümlichkeit“ in der Lyrik, die jüngst eine konservative Zeitung einer anderen konservativen Zeitung bescheinigte, teilen wir nicht. Der Genuß des lyrischen Gegenstandes von der Hand in den Mund, das Schreiben aus der hohlen Hand: beides kann nicht Sache dieses Bandes sein. Die Tatsache, daß wir kaum noch Gedichte bekamen, die unter aller Kritik waren, gibt dem Kritiker recht, der meinte, das erste Jahrbuch werde die Hobbyschreiber endgültig verschrecken. Jedenfalls hat es die Zweifel, die einige Vorsichtige am Unternehmen Jahrbuch der Lyrik hegten und auf deren Gedichte wir Wert legten, zerstreuen können.
III
Das schwärzeste Schwarz der vor Jahr und Tag beschriebenen lyrischen Depression hat blaue Flecken und bunte Punkte bekommen. Von Zartsinnigem ist weniger die Rede, die Gedichte sind streng erzogen. Ihr Maß geben und nehmen sie sich selbst. Konstruktionen, Denkspiele, das Hantieren mit einem eigenen Regelkanon. Es wird entschieden weniger geträumt, dafür mehr beobachtet und erfunden. Das ins Abseits geschobene politische Gedicht taucht wieder auf.
Es wäre zu einfach, wir behaupteten, die Gedichte seien – wie in Diskussionen häufig gefordert – formenbewußter geworden. Die Wahrnehmungsweisen haben sich individualisiert. Es gibt keinen großen Topf des Zeitgefühls, aus dem jeder Lyriker seinen Teller Brei schöpft.
Der Reim geht um/bleibt aber häufig stumm. Wie sagt Mickel: „Der Reim im Deutschen ist Stammreim, hat also mehr Gewicht als der Reim einer Sprache, die Flexionen zum Gleichklang bringt, er ist äußerst direkt…“
IV
Das Jahrbuch 1985 ist dem in Berlin (DDR) lebenden Lyriker Karl Mickel gewidmet, der Titel einem Gedichttitel des Autors entlehnt. Ohne seine Gedichte ist uns die Lyrik vieler jüngerer DDR-Autoren schwer vorstellbar. In der Bundesrepublik ist Karl Mickel ein (viel zu) wenig gekannter Autor, und es wäre gut, wenn wir das Höllengelächter seiner Gedichte, diese streng gebauten, hinterhältigen Verse in mehr Mickelbüchern, Anthologien, Schulbüchern und Zeitschriften nachlesen könnten.
V
Im Kapitel „Retrospektive“, unter den im besten Sinne beispielhaften Gedichten aus den Zeitschriften und Lyrikbänden 1984/85, ein wohl nicht zufälliges Verhältnis: vier Gedichte von Lyrikern aus der DDR, vier von Lyrikern aus der Bundesrepublik und eines aus Österreich, keines aus der Schweiz.
VI
Eine Frage am Rande: Warum gibt es so wenig Schweizer Lyriker – und das nicht erst seit diesem Jahrbuch der Lyrik, sondern seit vordenklichen Zeiten? In diesem Band ist kein einziger Schweizer vertreten. Sind die Berge schuld, die Luft, Klopstock, der den Zürcher See schon vereinahmt hat, die vielen phantasievollen Prosa-Autoren, die Stiftung pro Helvetia, die Honorare? Wir denken im Dunkeln und bitten um Erhellung. Warum gibt es trotz des deutschen Mangels an Bergen, trotz des Wald- und Wiesensterbens, trotz Luftmangels, trotz der vielen phantasielosen Prosaisten dennoch so viele deutsche Lyriker? .
VII
Die Auswahl 198; enthält auffallend viele Gedichte von Lyrikern aus der DDR. Das Jahrbuch 1984 scheint dort sehr genau gelesen worden zu sein, einige Autoren haben ihre Kollegen gezielt darauf aufmerksam gemacht und zur Mitarbeit eingeladen. So finden sich in diesem Jahrbuch hierzulande (noch) unbekannte Namen von Lyrikern, deren weitere Arbeit aufmerksam zu verfolgen wir die Leser einladen möchten. Zum Einlesen sei auf die von Elke Erb und Sascha Anderson herausgegebene Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung (Köln 1985) hingewiesen und auf die Gedichtbände von Thomas Rosenlöcher und Brigitte Struzyk.
Die Gedichte der meisten neuen Autoren aus der Bundesrepublik sind uns auf unsere Anfrage hin von Rundfunkredakteuren zugeschickt worden. Das Getto der anthologisierten „jungen Lyrik“ ist für diese Autoren offenbar kein Aufenthaltsort, weil alt/jung keine Kategorien der Poesie sind, und das ist gut so.
VIII
Das Kapitel „Blick zum Nachbarn“ soll im Lyrik-Jahrbuch eine ständige Einrichtung werden. Neun Gedichte aus Holland sind allenfalls „smaakmakers“, wie die Holländer sagen, Fingerzeige auf eine Lyrik, die bei uns fast niemand kennt. Zum Weiterlesen sei auf das Schreibheft 24 (Rodrigon Verlag Norbert Wehr, Essen), auf die Straelener Manuskripte I mit Gedichten von Judith Herzberg, auf den Herzberg-Gedichtband und die Anthologie Niederländische Gedichte aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Jérôme Decroos (Herder, Freiburg/ Basel/Wien 1960) verwiesen.
Von holländischer Literatur und Poesie gründlichere Kenntnis zu haben, wäre wichtig auch in Erinnerung der Tatsache, daß die Niederlande bis zum Einmarsch der Hitlertruppen einen guten Teil unserer Literatur in unserer Sprache gedruckt und also gerettet haben.
Das Gedicht von Remco Campert haben wir wegen der Unterschiede in den Übertragungen von Gregor Laschen und Oskar Pastior in beiden Versionen gedruckt. Darüber hinaus steht es als Hinweis und als Anregung für die Autoren des Jahrbuchs, sich an Übertragungen fremdsprachiger Lyrik zu versuchen und mitzuhelfen, die Poesie der Nachbarländer bei uns bekannter zu machen. Gregor Laschen und Rosemarie Still, zwei unermüdlichen Vermittlern und Übersetzern niederländischer Literatur, sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit herzlich gedankt. Der nächste Blick zum Nachbarn geht nach Norden: nach Dänemark.
IX
Die Zeichnungen für dieses Jahrbuch sind von Christoph Meckel. Sie belegen eindringlich das sich verändernde Berufsbild des Poeten Mitte der 80er Jahre.
X
Karl Mickel, „Fünf Fragen durch die Tür“: „… die Geschichte wirtschaftet in unserm täglichen Leben so selbstverständlich, daß wir sie schon nicht mehr bemerken. Kunst ist Kunst und nicht das Leben; ohne Kunst sähen wir nur 1/10 des Wirklichen.“
Christoph Buchwald und Ursula Krechel, Nachwort, August 1985
Das Luchterhand Jahrbuch der Lyrik 1984
war ein Anfang, dessen Anspruch und Absicht im Band für 1985 fortgesetzt wird. Er ist Karl Mickel gewidmet und enthält:
− einen Rückblick auf die Lyrikbände des Vorjahres, aus denen die Herausgeber ihrer Meinung nach Maßstäbe setzende Gedichte vorstellen
− eine Auswahl unveröffentlichter Gedichte, die wieder thematisch in Kapiteln versammelt wurden
− einen „Blick zum Nachbarn“: sieben holländische Lyriker werden vorgestellt
− poetologische Verlautbarungen, Leserzuschriften, eine Montage und abschließende Notizen
− acht Zeichnungen von Christoph Meckel
Luchterhand Literaturverlag, Klappentext, 1985
Luchterhand Jahrbuch der Lyrik 1985
Drei Herbste lebten die Lyrik-Jahrbücher bei Athenäum und Claassen. Christoph Buchwald, der einstige Herausgeber des Claassen-Jahrbuchs, konnte seine Arbeit in der Sammlung Luchterhand fortführen, diesmal zusammen mit Ursula Krechel. Die Herausgeber fragen im Jahrbuch 1985:
Warum gibt es trotz des Wald- und Wiesensterbens, trotz Luftmangels, trotz der vielen phantasielosen Prosaisten so viele deutsche Lyriker?
Die Frager geben keine Antwort. Die Parallelfrage lautet:
Warum gibt es so wenig Schweizer Lyriker – und das seit vordenklichen Zeiten?
Es ist fast unmöglich, wenn Außerordentliches nicht geschieht, für das laufende Kalenderjahr eine Tendenz zu markieren. Die Herausgeber meinen – aber das gilt schon seit Jahren:
Es wird entschieden weniger geträumt, dafür mehr beobachtet und erfunden. Das ins Abseits geschobene politische Gedicht taucht wieder auf.
Das neue Jahrbuch enthält zahlreiche Gedichte von DDR-Autoren, zum ersten Mal ein Kapitel Gedichte aus Holland zwischen Idylle und „Apocalypse now“. „Stalingrad“ wird bei einem niederländischen Autor zur nachdrücklichen Metapher für Stacheldraht und Niemandsland.
Die meisten Gedichte des Jahrbuchs sind Orts- und Zeitbeschreibungen. Liebesgedichte fallen auf. Zahlreiche Gedichte darf man als Selbstaussagen eines sich bedroht fühlenden Ich verstehen. Man liest Gedichte als Ausdruck ironischer Erregung, als Erfahrung oder Begründung utopischer Augenblicke. Nein, das Gedicht ist, wie Ludwig Fels betont, „keine Eintrittskarte“ – weder ins Kino noch in die sogenannte Wirklichkeit noch in eine Urlaubsexotik. Und doch formt das Gedicht – für Autor und Leser – Auseinandersetzung mit und Annäherung an Wirklichkeit.
Als eines der eindrucksvollsten Gedichte lese ich „Die Erleuchtung“ des Dresdeners Thomas Rosenlöcher (geb. 1947). Das fünfstrophige Gedicht erzählt auf realistischer Basis in teilweise surrealer Manier eine geradezu metaphysische Geschichte. Die Ausgangssituation in der ersten Strophe: Straßenverkehr, über der Dunstglocke Musik, von einem Flugzeug durchbrochen. Den Vorgang interpretiert der Sprecher dahin, daß die Betrachter, die Hörenden, die Erlebenden (er spricht in der „Wir“-Form) den Unterschied zwischen dunst-unten und himmel-oben erkannten, nämlich „den Himmel / samt seiner beweglichen Teile“. Und einer warf seinen Hut in die Luft, daß er in „der unerforschlichen Bläue“ zerschmolz. Der Vorgang erscheint wie eine „messianische“ Geste. Das Wort „erlösend“ ist bereits in der ersten Strophe eingeführt. Darauf die dritte Strophe:
Da stand die Sonne am Mittag
vorübergehend still,
und vor aller Augen nahm einer von uns
seinen Dienstausweis
und legte ihn feierlich nieder
und trat, mit zögerndem Staunen,
als wäre sie Festes, die Luft,
und stieg auf der Treppe aus Luft
über die Dächer hinaus,
daß unten ein massenhaftes Lastablegen begann
und viele ihm folgten. Die Liebenden aber,
nackt wie die Schwalben, entkamen von selbst.
Diese Strophe vermeldet den außerordentlichen Augenblick, ein geradezu mystisches „plötzlich“. Es ereignen sich zwei bedeutsame Bewegungen, eine nach unten, die andere nach oben. Nach unten wird „der Dienstausweis niedergelegt“. Wir befinden uns im Kontext der DDR. Nach Ablegung des Dienstausweises steigt er zögernd und staunend „auf der Treppe aus Luft über die Dächer hinaus“. Er steigt auf eine Art Jakobsleiter. Und indem er nach oben steigt, ereignet sich unten Ansteckung: eine massenhafte Befreiung von Lasten (nach unten) mit anschließendem Nachsteigen (nach oben). Die Liebenden aber entkommen von selbst (den Lasten und schließlich in die Flughöhe).
Die vierte Strophe führt den surrealen Vorgang weiter. Jetzt fahren die Straßenbahnen „schrägaufwärts mit Hänger“. „An luftigen Haltestellen“ über der Stadt pflücken die Menschen „oben im Licht / massenhaft Himmelsschlüssel“. Die fünfte Strophe steigert das „Wunder“. Der Ich-Sprecher:
Nur ich
suchte, die Hände am Dachrand verkrallt,
noch immer die Plankommission.
Aber die Plankommission war irgendwohin zerbröckelt
und ihre leeren Jacketts flatterten umher
und riefen: Heilig, heilig, da uns
der tiefinnen leuchtende Abend erhöhte,
und wir, die Gesichter aufwärts gewandt,
getrost zu den Sternen aufstiegen.
Es ereignet sich so etwas wie eine „Himmelfahrt“ der Stadtmenschen. Sogar die Herren der „Plankommission“ rufen, nachdem ihre Aufsichts- und Weisungsfunktion „zerbröckelt“, das ihnen dienstlich fremde liturgische „heilig, heilig“. Der Leser mag den Vorgang surreal oder metaphysisch, als poetische Utopie oder als weltliche „Himmelfahrt“ deuten. Das Gedicht steht im Jahrbuch singulär und verdient Aufmerksamkeit.
Paul Konrad Kurz, Die Presse, 1.6.1985
Christoph Buchwald: Selbstgespräch, spät nachts. Über Gedichte, Lyrikjahrbuch, Grappa
Das Jahrbuch der Lyrik im 25. Jahr
Jahrbuch der Lyrik-Register aller Bände, Autoren und Gedichte 1979-2009
Fakten und Vermutungen zum Jahrbuch der Lyrik
Fakten und Vermutungen zu Christoph Buchwald + Instagram + Facebook + Kalliope
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
Fakten und Vermutungen zu Ursula Krechel + Instagram + KLG + IMDb + Kalliope
Georg-Büchner-Preis: FAZ + Tagesspiegel + Welt + NDR + NZZ+ Die Zeit+ FR + SZ + Die Rheinpfalz +
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Brigitte Friedrich Autorenfotos + Bogenberger Autorenfotos + Galerie Foto Gezett + gettyimages + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Ursula Krechel – Neue Dichter Lieben, Komposition und Klavier: Moritz Eggert, Bariton: Yaron Windmüller, Expo 2000 Hannover.


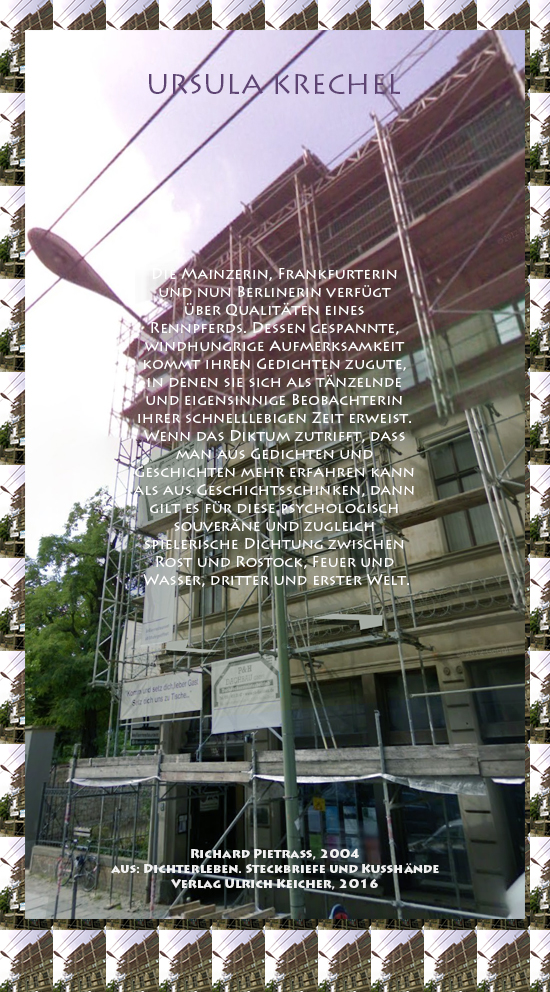












0 Kommentare