HEIMWEG
Nacht aus Schlüsselblumen
und verwunschnem Klee,
feuchte mir die Füße,
daß ich leichter geh.
Der Vampir im Rücken
übt den Kinderschritt,
und ich hör ihn atmen,
wenn er kreuzweis tritt.
Folgt er mir schon lange?
Hab ich wen gekränkt?
Was mich retten könnte,
ist noch nicht verschenkt.
Wo die Halme zelten
um den Felsenspund,
bricht es aus der Quelle
altem, klarem Mund:
„Um nicht zu verderben,
bleib nicht länger aus,
hör das Schüsselklirren,
komm ins Wiesenhaus!
Reinen Fleischs wird sterben,
wer es nicht mehr liebt,
über Rausch und Trauer
nur mehr Nachricht gibt.“
Mit der Kraft des Übels,
das mich niederschlug,
weitet seine Schwinge
der Vampir im Flug,
hebt die tausend Köpfe,
Freund- und Feindgesicht,
vom Saturn beschattet,
der den Ring zerbricht.
Ist das Mal gerissen
in die Nackenhaut,
öffnen sich die Türen
grün und ohne Laut.
Und die Wiesenschwelle
glänzt von meinem Blut.
Deck mir, Nacht, die Augen
mit dem Narrenhut.
![]()
Inhalt
Die gestundete Zeit, 1953 erschienen, begründete Ingeborg Bachmanns Ruhm als eine der größten Dichterinnen der europäischen Moderne. Sämtliche vollendeten Gedichte, von der frühen Lyrik bis zur Anrufung des Großen Bären, bilden den Kern ihres facettenreichen Werkes und gehören zu den großen dichterischen Leistungen des 20. Jahrhunderts.
Reden wir in Bildern! – Oder: Sprachgewalt und Bilderstürme
Ich bin ein Strom,
mit Wellen, die Ufer suchen.
[…]
Ich bin satt von der Zeit
und hungere nach ihr.
[…]
Tief im Grund verlang ich immer
alles restlos zu erzählen,
in Akkorden auszuwählen,
was an Klängen mich umspielt.
[…]
Ich weiß die Welt näher und still.
Die besten Dichter lassen uns ständig auf- und untertauchen. Sie heben uns zur Sonne ihrer größten Gedanken und werfen uns in die Wasser der tiefsten Empfindungen. In den besten Gedichten, so finde ich, wandelt sich die Stimmung mindestens zwei-drei Mal. Zumindest in den besten Gedichten von Ingeborg Bachmann.
Die Axt der Nacht fällt in das morsche Licht.
Ingeborg Bachmann, die früh verstorbene Sinngestalt der Nachkriegspoesie, gehört trotz ihres recht schmalen Werks zu den größte lyrischen Talenten des 20. Jahrhunderts. Wenn Rilke mit seiner Stille und seinem Kreisen ganz am linken Rand eines Spektrums stünde, so stände sie, zusammen mit Paul Celan und Gottfried Benn, wohl am entgegengesetzten Ende. Allerdings: Wo Benn blutet und vordringt, wo Celan die Welt in Grund und Boden ruft – da weint sie, harrend in ihrem eigenen, übermächtigen Sturm.
Ich bin mit Gott und seiner Welt zerfallen,
Und habe selbst im Knien nie gefühlt,
dass es den Demutfrieden gibt,
den alle anderen sich so leicht erdienen.
Bachmann ist, mehr noch als die meisten Expressionisten, in ihren besten Texten eine Formerin von Dichtung in Bildern.
Wer gerne einmal kurz in der Brandung, dem wahren Sturm ihrer Worte stehen will:
In die Muscheln blasend, gleiten die Ungeheuer des Meers
auf die Rücken der Wellen, sie reiten und schlagen
mit blanken Säbeln die Tage in Stücke, eine rote Spur
bleibt im Wasser, da legt sich der Schlaf hin,
auf den Rest deiner Stunden,
und dir schwinden die Sinne.
Doch ist Bachmann trotz ihrer beiden Hauptthemen Verzweiflung und Ungewissheit, eine der poetischsten Lyrikerinnen überhaupt. Im Prinzip greift sie darin sogar noch etwas in der Tradition zurück, auf Else Lasker-Schüler zum Beispiel. Abwechselnd ist sie prägnant und dann wieder zwischen den Dingen; es ist, als würde sie in ihren eigenen Worten wildern und doch teilt sie ununterbrochen mit, wobei sie weder abstrakt noch klar ist, sondern einfach poetisch; manchmal reimt sie, manchmal nicht; es ist schwierig eine überflüssige Zeile zu finden.
Wie bei Vielen, sind ihre Thematik und ihr Erfolg natürlich auch von der Zeit bestimmt. Ihre beiden Gedichtbände erschienen 1953 (Gestundete Zeit) und 1956 (Anrufung des großen Bären), also nicht sehr lange nach dem Krieg, in der diese vage ausholende Dichtung den Zeitgeist traf. Dennoch läge man völlig falsch, wollte man ihre Lyrik als ausschließlich historisch relevant einsortieren. Bachmann wurde vielleicht – auch – berühmt, weil sie in ihren Gedichte Zeilen niederschrieb wie:
Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt,
sucht ein enthaupteter Engel ein Grab für den Hass
und reicht dir die Schüssel des Herzens.
aber der größte Teil ihrer Verse ist von unglaublicher Universalität (sie müsste keine deutsche Dichterin sein); von der Universalität einer Welt, gefangen in einem einzigen dunklen Wesen.
In der Dämonen Gelächter gebrannt,
bodenlos, sind die Schalen
dieses glücklosen Lebens,
das bis zum Rand uns bedenkt.
Gedichte , schrieb De Quincey auf einer der Seiten seiner 14 Bände, sind Privatvergnügen. Kaum eines liest sich zweimal wie dasselbe, nur 2% – 3% der Gedichte, die man gelesen hat, kann man sich entsinnen und liebt sie. Und so werde auch ich von diesem gesamten Lyrikwerk vielleicht nur weniges im Genauen behalten. Aber was auf jeden Fall bleiben wird, als Ahnung, ist dieses ganz eigene Gefühl von Sturm… Sturm und Kälte, dann plötzlich rote Farben, dann ein Schemen von Nacht, dann Gedanken, dann plötzlich Stille. Ein Sturm, der einem ein bisschen Stille zu offenbaren versucht.
So stoß ich zu dir und bringe die Schatten zum Klingen.
Bachmann ist, meiner Meinung nach, keine Dichterin, die man rundum verstehen kann, sondern vielmehr eine, die einem einige poetisch-erfüllte Stunden verschafft.
Lassen wir ihr das letzte Wort und diesen vier Zeilen, in denen sie uns Schicksal des Dichters lesen lässt:
Vielleicht kann ich mich einmal erkennen,
eine Taube einen rollenden Stein…
Ein Wort nur fehlt! Wie soll ich mich nennen,
ohne in anderer Sprache zu sein.
Timo Brandt, amazon.de, 22.11.2011
Von den Grenzen des Sagbaren
Ingeborg Bachmann gilt seit langem als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, der Werke wie „Die gestundete Zeit“ oder „Reklame“ zu Weltruhm verholfen haben. Ihr vergleichsweise schmales lyrisches Werk liest sich wie ein konzentriertes Destillat subjektiver Erfahrungen. Ihre Gedichte sind fragile, lichte Gebilde. Konstrukte, die die kaum greifbare äußere Welt in einem bestimmten Augenblick einfangen, der einen Wimpernschlag später schon Vergangenheit ist. Es ist Lyrik, die den Leser zwar sehr fordert, aber an nahezu jeder Stelle für sich einnimmt. Man hat den Eindruck, hier eine Anleitung für eine neue, empfindsamere Betrachtung der Welt vor sich zu haben. In ihren Gedichten gegenwärtig ist immer die Auflehnung gegen die Mechanismen der modernen Massen- und Mediengesellschaft, die eben jene Empfindsamkeit und jeden Tiefgang zu zerstören drohen. Eine sehr schöne Sammlung, deren Lektüre man jedem an Lyrik Interessierten nur ans Herz legen kann.
MM 1981, amazon.de, 6.5.2011
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Jochen Kelter: In der Satzzelle
Stuttgarter Zeitung, 27. 2. 1988
An einem kleien Nachmittag
– Brecht liest Bachmann. –
Von Natur bin ich ein schwer beherrschbarer Mensch.
Autorität, die nicht durch meinen Respekt entsteht,
verwerfe ich mit Ärger.
(Brecht, Tagebuch 1952)
Brecht ist ein sehr merkwürdiger Dichter…
Eine radikale Intelligenz, ein Bleigewicht,
eine Luftleichtigkeit, das sind Voraussetzungen,
es wird Machbares gemacht.
(Bachmann, Entwurf eines Vorworts zu einer Anthologie mit Brecht-Gedichten 1969)
Es heißt, Ingeborg Bachmann wußte, Brecht, den sie verehrte, habe ihre Gedichte gelesen und an ihnen Veränderungen vorgenommen; es heißt, sie wußte, das Exemplar des Buches gab es in Berlin (DDR); und sie hatte öfter den Wunsch, es zu sehen; zugleich scheute sie diese Begegnung.
Das Buch findet sich bei Käthe Reichel. Es ist die Erstausgabe des Bandes Die gestundete Zeit, erschienen in der Reihe studio frankfurt in der Frankfurter Verlagsanstalt 1953, herausgegeben von Alfred Andersch. In diesem Band, der vor uns liegt, sind von 24 Gedichten 9 mit handschriftlichen Anmerkungen versehen; Gedichtzeilen mit Rotstift unterstrichen; Ziffern am Rand, die auf Zeilenumstellungen hindeuten, in einem Fall ist eine Zeile hineingeschrieben. Wir geben die so gezeichneten Gedichte hier nach diesem Exemplar.
Käthe Reichel, von uns befragt, erinnert sich:
Es war so, daß mich der Brecht 1954 nach Frankfurt am Main schickte als Grusche im Kreidekreis, daß ich längere Zeit da lebte und daß da eine Titelgeschichte im Spiegel erschien über eine Schriftstellerin. Auf dem Spiegel war auch ein Bild von der Bachmann, so daß ich mir das Heft kaufte und las. Da waren Verse; einer hieß:
Sieben Jahre später
in einem Totenhaus
trinken die Henker von gestern
den goldenen Becher aus.
Da dachte ich mir, daß dieses Zurückgreifen auf ein Bild der deutschen Klassik, in Verbindung gebracht mit dem Faschismus und in ein Verhältnis zur Gegenwart gesetzt, den Brecht interessieren könnte. Da war auch die Quellenangabe, daß da ein Lyrikbändchen erschienen war. Die gestundete Zeit, und da hab ich mir das Bändchen gekauft und fuhr damit in den Ferien nach Buckow – im späten Sommer oder Herbst 54 – und zeigte das dem Brecht, und da hat er das mit mir zusammen gelesen am Tisch, und was ihm gefiel, hat er, wie man an dem Bändchen sieht, mit diesem Fliederrot unterstrichen. Er hat alles gelesen bis zu diesem letzten Teil (gemeint ist der Monolog des Fürsten Myschkin zu der Ballettpantomime Der Idiot für Werner Henze), wo man auch keine Striche mehr findet. Alles, was ihm gefällt, ist unterstrichen, und alles was nicht unterstrichen ist, könnte nach Brecht – oder müßte nach Brecht weg. So ist das… Du siehst, es ist nicht allzuviel stehengeblieben von den Gedichten, eben von manchem Gedicht nur Zeilen am Anfang, dann eine am Schluß.
Von dem Gedicht „Früher Mittag“ – es gilt uns als bedeutendes Zeugnis deutscher Lyrik jener Nachkriegsdezennien – gefielen Brecht nur zwei Strophen aus der Mitte. Sie zitieren Wilhelm Müllers bekanntes „Am Brunnen vor dem Tore“, das durch Schuberts Vertonung der „Winterreise“ wie ein Volkslied empfunden wird, und sie schließen die sich kreuzweise reimenden Verse jeweils mit Variationen auf Goethes „Der König in Thule“, („Die Augen täten ihm sinken…“) reimlos ab. Zeilen, die Käthe Reichel an dieses klassisch gewordene deutsche Kunstlied denken ließen: kühne Adaption, mit der sich die lyrische Stimme in der zweiten Person ausspricht, die tradierte Ballade jäh in einem aktuellen Sinne verkehrt und uns durch das Du dieser Anrede miteinbezieht: „Die Augen täten dir sinken…“
Daß diese zwei Reimstrophen nur als Kontrapunkt gesetzt waren in dem als Fuge komponierten, verschiedene thematische und literarische Motive zueinander- und gegeneinanderführenden, zumeist freirhythmisch gesprochenen Gedicht, kümmerte den beim ersten Lesen urteilenden Brecht scheints nicht.
Man kann es sich nur schwer versagen, nicht polemisch zu reagieren, wenn man mit ansehen muß, wie hier ein Dichter mit einer Dichterin verfährt. Aber, die Literaturgeschichte bietet zahlreiche ominöse Beispiele dafür, wie schwierig es ist, daß ein Gestirn das Leuchten eines anderen wirklich wahrzunehmen vermag und es als Licht erkennt. Man lese Schillers Korrektur zu Hölderlins Gedicht „An die klugen Rathgeber“, und man weiß genug.
Brecht sah sich nach seinem Selbstverständnis in der Rolle eines solchen Ratgebers, in der ihm angetragenen und längst, respektierten Mission des Lehrers; der allein weiß, wie ein Gedicht zu sein hat. Da war der Rotstift gleich bei der Hand. „Je mehr er jemand schätzte“, entschuldigt Käthe Reichel, „um so strenger war er“, und erklärt dazu: „Nein, prinzipiell muß ich aber auch den Brecht verteidigen, denn im Umgang mit einer Qualität wie hier der Bachmann sagte Brecht immer: ,Von einem Satz mit fünf Worten kann man mindestens ein Wort streichen‘, und nach diesem Prinzip verfuhr er, der sich selbst ungeheuer um Kürze und um Nicht-Ausschweifen bemühte und eine bestimmte Linie verfolgte in einer Sache, auch mit anderen Leuten.“ Sehen wir ihn also, wie er als Stückeschreiber, in der Funktion des Bearbeiters, der einen gegebenen Text nach seinen Vorstellungen einrichtet, und durch die Mühe, die er an ihn wendet, zu erkennen gibt, daß er ihn soweit akzeptiert, um seine eigene, gültige Fassung aus ihm herauszufiltern, die er dann „Versuch“ nennt, bescheiden darauf verweisend: „Er hat Vorschläge gemacht…“
Wie sehen – die Kompetenz solchen Verfahrens zuhächst nicht in Frage gestellt – diese Vorschläge aus?
Tilgt Brecht bei dem ersten Gedicht, welches das Motto anschlägt, nur die persönlich bewegte Rede „Wohin wir uns wenden“, mit der Ingeborg Bachmann ihre lyrische Tonart bestimmt, so läßt er von dem großen Entwurf „Thema und Variation“, der ein Grundmotiv des gesamten Bandes vorgibt, nur die vierzeilige erste Strophe gelten und schließt, als Pointe gesetzt, mit einem Vers aus dem letzten Teil des Gedichts, das sich dann, nach Brecht, so liest:
In diesem Sommer blieb der Honig aus.
Die Königinnen zogen Schwärme fort,
der Erdbeerschlag war über Tag verdorrt,
die Beerensammler kehrten früh nach Haus.
Unten im Dorf standen die Eimer leer.
Die antithetisch sich entfaltende Dichtung der Bachmann mit ihren offenen und verschlüsselten Metaphern auf Natur- und Zeitereignisse für persönliches und menschliches Schicksal, verkürzt sich bei Brecht zum kausal gedachten Epigramm. Das weitgefaßte „Thema“, in seinen auf mehreren Ebenen spielenden „Variationen“, aus Bewegung und Gegenbewegung, Fragen und Antworten, die sich nicht auf ein erschöpfendes Resultat bringen lassen, wird auf den einfachen Mechanismus, den kleinsten Nenner reduziert. Von den ursprünglichen Intentionen der Autorin bleibt kaum etwas erhalten, weil herausgegriffene Strophen oder Verse, rigoros versetzt und rigide aufeinander bezogen, eine Konstellation und einen Sinn bekommen müssen, den sie zuvor nicht hatten. Das Gedicht wird auf die „Aussage“ fixiert, auf den „Kausalnexus“ eines Vorgangs (von dem Brecht in anderem Zusammenhang spricht), der nur eine Möglichkeit der Deutung, die dialektische Entsprechung vorbehalten, zuläßt. Es wird zum Brecht-Gedicht: „Ja“, sagt Käthe Reichel, „mit einem radikalen Sprung vergesellschaftet er jedes Gedicht von der Bachmann. Aber er hat das ja prinzipiell mit allen Leuten gemacht.“
Brechts Korrektur richtete sich vermutlich nicht nur gegen diese ihm zufällig vor Augen kommenden Gedichte. Seine Kritik traf eine Art Lyrik, die er weder weltanschaulich noch künstlerisch billigte. Rilke oder Hofmannsthal zählte er kaum zum bürgerlichen Erbe, von dem zu lernen war; und so bleibt, folgerichtig, von der solche Tradition aufnehmenden, sie mit dem Bewußtsein einer veränderten Wirklichkeit konfrontierenden, sie in „neuer Abschiedsgestalt“ anrufenden Elegie „Große Landschaft bei Wien“ – nach Brecht – nur der nackte Vierzeiler:
Maria am Gestade –
das Schiff ist leer, der Stein ist blind,
gerettet ist keiner, getroffen sind
viele.
Man wird bei dieser Lesart natürlich an Brechts eigene späte Lyrik erinnert, deren Muster auch an die Bearbeitunegen dieser Gedichte angelegt werden. Seit den „Liebesliedern“ von 1950 (Brecht verdankt sie auch Käthe Reichel) und den epigrammatischen Stücken der folgenden Jahre, seit den Buckower Elegien von 1953 ist ihre Struktur auf letzte Schlichtheit bedacht, auf einen wesentlichen lyrischen Moment konzentriert, einfach, unaufwendig; Ingeborg Bachmann schreibt: „Vorbildlich: Er hatte die großen Worte auch an der richtigen Stelle.“
Wie kommt es, daß uns, angesichts seiner drastischen Eingriffe in fremde dichterische Bereiche, beim Wiederlesen manche von Brechts späten Gedichten nicht nur lapidar, sondern auch ein wenig dürftig, nicht nur klug, sondern auch lehrhaft-trocken, nicht nur weise, sondern auch einäugig vorkommen?
Das Gedicht „Glückliche Begegnung“ von 1952 beispielsweise – es greift die Tätigkeit des Beerenlesens als lyrisches Motiv auf wie Ingeborg Bachmann das Beerensammeln in „Thema und Variation“ –, es fällt uns nun vor allem durch seine stringent-didaktische Einteilung in Beobachten und Schlußfolgern auf, die mit dem Zeigefinger anweist, wie man Ereignisse dialektisch zu betrachten habe; demonstrative Szene, die weniger lebendig denn kurzgeschlossen wirkt:
GLÜCKLICHE BEGEGNUNG
An den Junisonntagen im Junggehölz
Hören die Himbeersucher vom Dorfe
Lernende Frauen und Mädchen der Fachschule.
Aus ihren Lehrbüchern laut Sätze lesen
Über Dialektik und Kinderpflege,
Von den Lehrbüchern aufblickend
Sehen die Schülerinnen die Dörfler
Von den Sträuchern die Beeren lesen.
Dagegen sind die Brecht-Fassungen der Bachmann-Gedichte poetisch. Eigenartig, wenn auch durchschaubar, ist es doch, daß der Lehrer, der oft doziert, warum der Lehrende vom Belehrten ständig zu lernen habe („Höre beim Reden“), nicht aufmerksam wird, wo sein Vorbild Wirkung hatte; nicht spürt, daß seine Diktion Eindruck hinterließ. Ingeborg Bachmanns Gedicht „Alle Tage“, das den heutigen Leser sofort an Brecht denken läßt – nichts weist darauf hin, daß er es damals beachtet hätte. In manchen Fällen hat er sogar die dialektische Unruhe, die in den Gedichten der Bachmann auf eigene Weise waltet, zugunsten eines linearen Ablaufs mit voraussehbarem Ergebnis eingeebnet. „Er meinte wohl“, kommentiert Käthe Reichel Brechts Verhalten, „daß die Abschweifungen sich bei der Bachmann verselbständigen, daß sie vom Ziel fortgehen, auf das hin begonnen wurde. Deshalb diese Merkwürdigkdten, daß er da vier Zeilen nimmt, dann streicht er im Gedicht, dann wählt er eine Zeile und hat damit eine soziale Zielrichtung. Er hat es ja bei ihr auf den bösartigen Satz gebracht: Jetzt quatscht sie wieder… Ich meine, er würde ihr einen Mangel an Zielstrebigkeit und Klarheit unterstellen wollen… Wenn Brecht ausschweift, dann gehört es zum Thema; das Allgemeine dient dann immer dem Spezifischen, dem Zwecke, zu dem er dieses Gedicht macht.“
Werden Gedichte mit einem bestimmten Ziel begonnen, das in einem entsprechenden Zweck seine Erfüllung sieht?
Das Gedicht „Holz und Späne“, in seiner erregten Dikontinuität bedrückend aktuell:
BIätterverscheiß, Spruchbänder,
schwarze Plakate… Bei Tag und bei Nacht
bebt, unter diesen und jenen Sternen,
die Maschine des Glaubens…
– es wird seiner inneren Widersprüchlichkeit beraubt, weil es im Sinne von Brechts poetischem Prinzip in jenen Jahren zurechtgestutzt wird: abschweifende Pfade begradigt, die sprachliche Geste der Auflehnung – „Seht zu, daß ihr wachbleibt!“ – durch Auslassung beschwichtigt. Reiner Kunze hat einmal solche pädagogische Maßnahme in ein Bild gebracht,das einem dazu einfällt: „der, hochwald erzieht seine Bäume / … Keiner sieht mehr als der andere, / dem wind sagen alle das gleiche / holz.“
Holz,
Aus den Wäldern trugen wir Reisig und Stämme.
Berauscht vom Papier,
erkenn ich die Zweige nicht wieder.
Aber ins Holz,
solang noch grün ist, und mit der Galle,
solang sie noch bitter ist, bin ich
zu schreiben gewillt.
Man kahn sich diese Version eines Bachmann-Gedichts in der Reihe der späten, „umfunktionierten“ Elegien Brechts vorstellen. Daß Ingeborg Bachmann, nach Brechts gesellschaftlichem Standort, die „soziale Zielrichtung“ fehlte, bedarf kaum der Erörterung; die Feststellung besagt nichts über ihr dichterisches Vermögen. „Daß Brecht unbezweifelbar für den Klassenkampf geschrieben hat“, konstatiert sie selbst (1969), „daß er anarchisch, dann klassenkämpferisch, dann im System verankert geschrieben hat, jeder weiß es, niemand hat dran zu rütteln.“
Brechts marxistisches Urteil, war es – zumindest in unserem Falle – von dieser noblen Toleranz? Aber wer sagt, daß er seine damalige Position nicht später wiederum in Frage gestellt hätte? Systemimmanent waren seine Ansichten nicht. Von der Dichtung seiner schreibenden Zeitgenossen kannte er allerdings, nach vorhandenen Zeugnissen und Aussagen, nur wenig, und vermutlich war sie ihm nur wenig „kennenswert“. Junge Talente – das waren seine Schüler; „kleine Brechts“, sagt Käthe Reichel, „auch Leute, die bei ihm schreibunfähig geworden sind. Denn er ließ dann ja auch nicht mehr mit sich handeln. Er hätte das der Bachmann so lange bewiesen, bis sie es akzeptiert hätte; und darin hätte sie, fürchte ich, nicht mehr schreiben können. Das ist ja Leuten widerfahren; und man kann ja auch nichts dagegen sagen, daß der Brecht so großen Einfluß auf die Literatur genommen hat zu seiner Zeit.“ Wir geraten in Disput darüber, ob sich niemand gegen seine Persönlichkeit, gegen seine schon klassische Größe behaupten konnte oder behauptet hat. „Die sind weggegangen“, sagt Käthe Reichel; – in diesem Zusammenhang fällt auch der Name Max Frisch. „Beweis zu nichts“ – dieses Gedicht von Ingeborg Bachmann hat Brecht, ohne Unterstreichungen oder Auslassungen, nur in zwei Worten und mit einem Satzzeichen verändert. Es ist das einzige der von ihm durchgesehenen Stücke, in das er hineingeschrieben hat. Vielleicht sagt diese winzige Verschiebung mehr über die Verschiedenheit beider Dichter als der grobe Verschnitt. Die letzte Zeile des Gedichts lautet bei der Bachmann:
Wein! Aber winke uns nicht.
Brecht macht daraus:
Weine, nur winke uns nicht.
„Ja“, sagt Käthe Reichel, „das ist ganz genau Brecht. Wenn ich das lese“ – und sie wiederholt rezitierend beide Fassungen –, „dieses ,nur‘ ist natürlich schlimmer als das ,aber‘; der Schmerz ist tiefer bei Brecht, würde ich sagen.“
Auf den Einspruch, daß die Befehlsform bei der Bachmann doch eigentlich die Abschiedsgeste härter und unwiderruflicher hörbar macht und daß Brechts Änderung verbindlicher klingt, auch konventioneller, erwidert Käthe Reichel: „Der Schmerz ist ein Schmerz zwischen schmalen Lippen bei Brecht. Bei der Bachmann, würde ich sagen, ist es ein geöffneter Mund.“ Und indem sie, wie auf eine vergangene Situation zurückblickend, sich die Verse noch einmal vergegenwärtigt, sagt sie: „Ja, dieses ,nur‘ – weil da der Atem beim Sprechen des Verses vollauf das ,nur‘ geht –, das ist die erhobene Hand; diese Abwehrstellung: Um Gottes, willen! Das ,nur‘ ist Schmerzhafter und kälter – doch vielleicht nur, weil ich den Brecht kenne. Wenn ich das sehe: Da ist eine Frau, die spricht, aber nicht nur eine Frau – das ist ein geöffneter Mund bei der Bachmann. Bei Brecht, das ist ein geschlossener Mund, der nichts rausläßt, der im Verschweigen spricht, wenn das verständlich ist, was ich meine.“ Und sie fügt, mehr verallgemeinernd hinzu: „Die Person, die das Gedicht macht, hat eine große Distanz zu dem Gedicht, so eine Unantastbarkeit. Sie liefert sich nicht aus, nicht einer Empfindung. Der Brecht hat doch immer die Hitze, die in ihm war – als Mensch und als Dichter – durch Kälte erzeugt, so daß die Kälte die Hitze war. Und was er gar nicht ertragen konnte, war eben, wenn das Gefühl schweift, ausschweift… Er war ja ein großer Lutheraner, wenn du willst, was seine große Strenge in der Sprache betrifft.“
Der Vers, gesprochen mit geöffnetem Mund. Der Vers zwischen geschlossenen Lippen.
Vers, der sich rückhaltlos aussetzt, fast wehrlos als Geständnis, als Botschaft, als Klage:
Sieh dich nicht um…
Es kommen härtere Tage.
(„Die gestundete Zeit“)
Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt…
(„Alle Tage“)
Und was bezeugt schon ein Herz?
… was es schlägt,
ist schon sein Fall aus der Zeit.
(„Fall ab, Herz“)
Und Brechts Vers, der den Sprecher nicht preisgibt, der sich durch Vernunft zügelt, aus entsprechender Erkenntnis zurückhaltend, freundlich, als Überlegung in Spruch und Lied, als letztwillige Verfügung:
Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?
(„Der Radwechsel“)
Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten
Habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen!
(„An meine Landsleute“)
Dauerten wir unendlich
So wandelte sich alles
Da wir aber endlich sind
Bleibt vieles beim Alten.
Lassen sich Gedichte von Autoren so verschiedener Generationen, Erfahrungen und Weltanschuungen überhaupt mit Gewinn vergleichen? Gedichte eines Mannes in der Reife des Alterns – Gedichte einer Frau am Beginn ihrer ersten Leidenschaft am Wort? Das philosophische „Nichts“, das die Bachmann in ihrem Nachdenken über Heideggers Existentialismus umschreibt, so fremd ist es dem Marxisten Brecht wiederum nicht:
Geh ich zeitig in die Leere,
Komm ich aus der Leere voll.
Wenn Ich mit dem Nichts verkehre
Weiß ich wieder, was ich soll.
Wenn ich liebe, wenn ich fühle
Ist es eben auch Verschleiß
Aber dann, in der Kühle
Werd ich wieder heiß.
Brechts extrahierende, apodiktische Redaktion schärft unser Empfinden und Bewußtsein für das Parlando der frühen Poesie von Ingeborg Bachmann, für die Schönheiten und Übersteigerungen, ihres metaphorischen Sprechens, ihrer Emotionen, ihrer Sinnlichkeit, die sich in ihren „ausschweifenden“ Versfolgen offenbart (die Kritik in den fünfziger Jahren hat ihr eher „Kühle“, „Nüchternheit“ und „Gedankenschwere“ bescheinigt). Daß hier eine Frau spricht, die man heute in der Traditionslinie Else Lasker-Schüler – Nelly Sachs – Ingeborg Bachmann – Sarah Kirsch sieht – der geöffnete Mund! – das steht auf einem anderen Blatt.
Die Absage der Bachmann in ihren letzten Gedichten, Mitte der sechziger Jahre, ist auch eine Verabschiedung von ihrer vorherigen Lyrik: „Soll ich / eine Metapher ausstaffieren / mit einer Mandelblüte?“ Diese Gedichte haben, mit anderer Konsequenz, die Einfachheit, Schlichtheit und Unwiderruflichkeit der späten Gedichte Brechts – „die großen Worte auch an der richtigen Stelle“ –, ihnen ähnlich und unvergleichbar. „La grazia sola ist ein Begriff, den er nicht geliebt hätte, nur in dem Wortsinn, und es gibt doch nur den Wortsinn.“ Anmut, Gnade allein.
Ich habe ein Einsehn gelernt
mit den Worten,
die da sind
(für die unterste Klasse)
Hunger
aaaaaaaSchande
aaaaaaaaaaaaaaTränen
und
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFinsternis…
(„Keine Delikatessen“)
Brecht, in Buckow, versagt es sich, nach den schwarzen Beeren des Holders zu sehen, die ihn an seine ausschweifende Jugend erinnern – „Schwierige Zeiten“. Die geschlossenen Lippen verraten noch die Anstrengung, der es bedurfte, sich so unantastbar zu machen im Vers. („Brecht muß die Sentimentalität sehr gekannt haben, und was nur von ferne hätte ein Gefälle dahin haben können, verbannte er“, beobachtet Max Frisch.) Da ist einer leicht geneigt, Worte zu meiden, die er für überflüssig hält, Leidenschaften zu fliehen, denen er sich nicht mehr ungezügelt überläßt, Zweifel, die ihn irritieren könnten (er hat längst geübt, sie als Impulse in Dienst zu nehmen), nicht mehr zu dulden – er, ein „von Natur schwer beherrschbarer Mensch“, der Autorität – fremde Größe – nur anerkennt, wenn sie seinen Respekt abgefordert hat, sonst verwirft er schnell und mit Ärger. Ein sich beunruhigt fragendes Abschiednehmen, beschwörende, wehe Geste wie Bachmanns „Abschied von England“, verkürzt er da resolut zum endgültigen, übersonnten sela!:
Mit Meerhauch und Eichenblatt
hieltest, du die Gräser satt;
wenn dein Tag begann,
wagten sich Sonnen heran.
„Es kann übrigens sein“, sagt Käthe Reichel beim Weiterlesen, „wenn ein Gedicht wie ,Nachtflug‘ überhaupt keinen Strich hat, daß ihm das ganze Gedicht nichts gilt, was ich fürchte. Das Ganze, hat Brecht an einem kleinen Nachmittag gemacht, und die Schnelligkeit könnte man ihm, einer so bedeutenden Lyrik wie der Bachmann gegenüber, zum strengen Vorwurf machen. Aber wenn man so geübt ist wie er in Sprache und Umgang mit Vers – so wie ich, sagen wir mal, im Kochen, weil ich schon so viel in meinem Leben gekocht habe, daß ich genau weiß, was da reinkommt, was da verändert oder zu- oder weggetan werden muß … ich, denke mir, daß er das so an einem kleinen Nachmittage gemacht hat, wie andere Leute Zeitung lesen.
Die Bachmann hat ja noch lange gelebt nach Brecht, ich hatte nie den Mut, ihr das zu zeigen.“
Gerhard Wolf 1981, aus: Hans Höller (Hrsg.): Der dunkle Schatten, dem ich schon seit Anfang folge – Ingeborg Bachmann – Vorschläge zu einer neuen Lektüre des Werks, Löcker Verlag, 1982
Ingeborg Bachmanns Allüre
Damals, zu Beginn der fünfziger Jahre, als Ingeborg Bachmann nicht etwa allmählich, sondern jäh, unwiderstehlich, blendend den wackeren Schriftstellern der Gruppe 47 deutlich machte, was das sei: eine „Dichterin“, eine „Auserwählte“, da ergriff und besiegte ihre Allüre. Es war dies keineswegs eine irgendwie laute, gar aggressive Art, vorzulesen, zu reden, zu schweigen. Eher eine Mischung aus Scheu und Glanz. Aus tränennahem Flüstern und der Aura von Unnahbarkeit, Unbesiegbarkeit.
Man bewunderte damals – sofern man nicht passioniert nachholte, was während der Nazizeit literarisch in Frankreich, England, den USA geschehen war – die Elisabeth Langgässer. Man stritt um Brecht und Benn. Es gab den Alfred Andersch, den Ernst Schnabel, den jungen Böll, den stillen Eich, den klugen Jens. In der Gruppe 47, die Ingeborg Bachmann 1953 den Preis verlieh, hatte man zuvor gewiß nicht nur „Trümmerliteratur“ oder realistische Aufklärungstexte zur Diskussion gestellt. Aber so etwas, wie die Königinnenallüre der (1953 ja erst 27jährigen) Ingeborg Bachmann war ganz neu. Die besaß auch Ilse Aichinger nicht, die gleichfalls aus Österreich stammende Preisträgerin des Jahres 1952; mochte sie gelegentlich auch rätselhafte Sätze äußern nach Lesungen:
Es fehlt, daß es noch einmal verschwiegen wird.
Ingeborg Bachmann bezwang ihre Hörer, ihre Redakteure, ihre Freunde mit der Üppigkeit hochgespannter Subjektivität. Das dürfte kein bloßer Hochmut gewesen sein, auch kein stolzes, gar eitles Hochgefühl. Nein, ihre Allüre schien ganz unmittelbar dem Wesen dieser Dichterin zu entspringen. Sie war dann freilich auch klug und tüchtig genug, die überwältigenden Effekte ihres So-Seins durchaus einzukalkulieren.
Zur charakteristischen Allüre einer genialischen Poetin gehört nicht nur, was sie sagt, welche Worte sie wählt. Sondern in mindestens ebenso hohem Maße wird die Allüre bestimmt vom Tonfall, in dem die Worte sich geltend machen. Von der flehenden oder auch sieghaften Gebärde der Rednerin. Es ist darum nicht leicht, mit bloßen Zitaten Ingeborg Bachmanns einstige Allüre zu beschwören. Freilich legt sich heute, im Jahre 2001, der Eindruck nahe, daß jüngere Literaten eben wegen der Allüre, die damals uns alle bezwang, gegenwärtig ihre Schwierigkeiten mit der Bachmann haben. Was uns „königlich“ dünkte, „Dame Dichterin“, das empfinden anscheinend die Jüngeren als Plüsch, als Pomp, als Makart, als österreichischen Jugendstil. Damit können Zeitzeugen des dritten Jahrtausends nichts mehr anfangen. Das ist vorbei, lädt höchstens noch ein zum Bekichern oder Begrinsen…
„Alle Liebe ist glücklos, und unter ihrem grausamen Gesetz geraten die Liebenden in ein Räderwerk von Angst; Eifersucht und Lüge und einen Schmerz, den Tod und Abwesenheit… nicht zu heilen vermögen“ – so schrieb sie, als sie selber noch dieses Räderwerk der Glücklosigkeit eher aus Büchern kennen mochte denn aus verzweifelter Erfahrung. Wenn man versucht, diesen für eine Sprecherin gedachten Text laut zu lesen: dann ahnt man vielleicht, wie Ingeborgs Allüre beschaffen war. So hat sie – es herrschte dabei gleichsam Kerzenschein-Feierlichkeit, die den hemdsärmeligen Hans Werner Richter zu ärgerlichem Knurren bewog – auch einst, als sie ihre Novelle „Alles“ vorlas, (was damals als Signal ihrer Wendung von Lyrik zur Prosa erahnt, begrüßt oder kritisiert wurde) den riesigen ersten Satz jener am Ende der fünfziger Jahre entstandenen Erzählung gehaucht wie eine Absage an alle simpel-realistische Vermittlung von Seelischem, Sachlichem, Sensiblem. Es tönte wie eine mystische Unglücksbotschaft:
Wenn wir uns, wie zwei Versteinte, zum Essen setzen oder abends an der Wohnungstür zusammentreffen, weil wir beide gleichzeitig daran denken, sie abzusperren, fühle ich unsere Trauer wie einen Bogen, der von einem Ende der Welt zum anderen reicht – also von Hanna zu mir –, und an dem gespannten Bogen einen Pfeil bereitet, der den unbewegten Himmel ins Herz treffen müßte.
Ja, darunter tat sie es nicht. So herzlich, lustig, witzig, damenhaft vernünftig und hilfsbereit sie sein konnte: der Glanz, ein nie leeres, hohles, nie angedrehtes Pathos zarter Noblesse, ihre Allüre eben, umgaben sie dabei als Königswürde. Und es wirkte nahezu komisch, wie sie einen geistesschlichten Interviewer, der ironisch zurückfragte, ob sie denn tatsächlich der Ansicht sei, alle Männer wären krank, mit der ungläubigen und blamierenden Replik beschämte:
Ja, wußten Sie das nicht?
Daß Ingeborg Bachmann mit der Gedichtproduktion aufhören wollte (und natürlich keineswegs konnte, an Rückfällen fehlte es nicht): Es war dies kein aus gesellschaftskritischen oder gattungsspezifischen Erwägungen herrührender, rationaler Entschluß („Keine Delikatessen mehr“). Sondern die Konsequenz eines Verlustempfindens. Ihre Seele verweigerte sich nämlich allmählich der großen lyrischen Attitüde.
In den ersten hundert Seiten von Malina findet sich gleichwohl ein gutes Dutzend von gedichthaft gebotenen, in Form lyrischer Einsprengsel mitgeteilten Texten. Doch: alle diese Gedichte sind nicht nur weniger bedeutend oder originell als die „frühe“ Lyrik der Autorin – sondern diese versartigen Stücke kommen, so scheint mir, dem Rang auch von Ingeborg Bachmanns Malina-Prosa nicht gleich. Diese „Prosa“, deren Allüre manche Jüngere befremdet, ist von der deutschen literarischen Öffentlichkeit (trotz viel unübersehbarer und ungeschickter Bachmann-Philologie) anscheinend immer noch nicht apperzipiert. Das könnte auch folgende Erfahrung belegen, die ich als Autor eines Literaturquiz jüngst noch machte. Es ging in meinem Quiz – „Träume, Träume – Flackerndes und Flammen“ – um lauter literarische Alpträume. Einer der Texte, der von vielen Ratenden als vielleicht sogar allerstärkster empfunden, doch keineswegs identifiziert, erraten wurde, war die grausame Vereisungs-Vision, der Kältetod-Traum aus Malina (Frankfurt: Suhrkamp 1971, S. 219–221)! Selbst Bachmann-Bewunderer oder -Liebhaber (er)kannten ihn nicht. Dabei bebt auch er von der großen Allüre unserer Ingeborg Bachmann.
Als Verzweiflung und Drogen im Begriff schienen, die Poetin, ihre Allüre und Attitüde, zugrunde zu richten, zu zerstören, da entstanden einige Fragmente. Sachen, die sie nicht veröffentlichte. Die heute einen beklemmenden Einblick gewähren in die gekränkte, die kranke Seele der Dichterin. Vielleicht waren Bestürzung, Neugier und Befremden der Öffentlichkeit beim Bekanntwerden aller dieser Texte („Ich weiß keine bessere Welt“. Unveröffentlichte Gedichte) auch darum so groß, so beklommen, weil die Leser hier einer Schutzlosen, einer seelisch Nackten, einer Ingeborg Bachmann ohne Allüre zu begegnen meinten.
Joachim Kaiser, aus Reinhard Baumgart und Thomas Tebbe (Hrsg.): Einsam sind alle Brücken, Piper Verlag, 2001
Ekkehart Rudolph im Gespräch mit Ingeborg Bachmann im Jahr 1971.
Im Palais Palffy
fand am 10. Mai 1965 die Lesung von Ingeborg Bachmann statt. Der Saal war zum Bersten voll. Ich ergatterte gerade noch einen Stehplatz vorne am Rand. Dann setzte ich mich seitlich auf das Podium, auf dem die Dichterin stand und ihre Gedichte vorlas. Nein, sie rezitierte nicht, sondern sie las sie wie die Abfolge eines Zugfahrplanes völlig emotionslos, mit immer derselben Stimmlage und Modulierung vor, fast wie teilnahmslos. Keine Emotionalität sollte stören. Das einzige, was zählte, war das dichterische Wort, das reine Gedicht, sonst nichts. Groß und schlank und mit glattem blondem Haar, das sie immer wieder in gleichmäßigen Bewegungen aus ihrem Gesicht zurückstreifte, stand sie aufrecht da und las ihre Gedichte. Und diese ertönten wie in einem Singsang, wie in einem Lied. Eigenartig und ungewöhnlich war all dies. Etwas völlig Neues, Unbekanntes; auch die Subjektivität, das eigene Ich in ihren Gedichten und die Widerspiegelung ihres Ichs in ihrem Gedicht, in ihrer poetischen Sprache, in diesem Strom an Worten, in der Strömung einer neuen Sprache und Bildhaftigkeit, die man nicht sogleich verstand, die man erst entschlüsseln mußte, um zu begreifen, wovon die Rede war. „Und Böhmen liegt am Meer…“: Dieser Satz hat mich seither als etwas geheimnisvolles und zugleich Geoffenbartes begleitet und ich weiß, er wird nie mehr aus meinem Gedächtnis, aus meinem Leben verschwinden.
Peter Paul Wiplinger: Schriftstellerbegegnungen 1960–2010, Kitab-Verlag, 2010
NACHLASS
Für Ingeborg Bachmann
Geh du in deinen Schmerz hinein
den du haben wolltest
wie eine Sonne über dir
ein gleißendes Meer in der Tasche
den Mandelmond hinter dem Vesuv
der sich nächtlich erbricht.
Wolltest du denn eine vernünftige Welt
aufgebahrt auf einem löwenfüßigen Katafalk
und ein persönliches Puppenspiel
gefaltet in einer Streichholzschachtel?
Geh du in deinen Schmerz hinein
dies vielstöckige städtische Haus
und folg der Straße, die führt
geradewegs in die zivilisierten Löwengruben.
Warum denkst du immer noch in Säulen
und ich in Netzen? Die Netze rissen und Säulen
fielen, wenn denn vom Fallen geredet wird
und Fische sterben in Öl
aufzuckend in den verseuchten Meeren.
Zu Lebzeiten hätten wir uns schlecht verstanden.
Wir aber sind tot und leben
in kühl gekachelten Höhlen
drei Fuß unter den Wandelgängen der Männer.
Briefe erreichen uns mit vertauschten Küssen
blutorangen gefärbt
und glatt wie italienische Telefonmünzen.
Du hast vergessen, einen Nachsendeantrag zu stellen.
Antworte nicht. Schweig nicht.
Ich glaub nicht an die Sommerzeit
und wenn kein Hahn nach uns kräht, erschrick nicht.
Ich glaub nicht an die Eingeweide von Lehrerinnen
gegürtet mit Richtlinien und Erlassen.
Und du auch nicht. Wassermelone und Feuerbohne:
Die wachsende Stille ein Watteteich
ein abschüssiges Ufer verflochtener Flechten.
Bleib. In die Uniform eines Augenblicks gesteckt.
Die Küsten, die du liebst, sind jetzt untertunnelt
mit einem Vierkantschlüssel montiert ein Mann die Welt
von der du dir deinen Teil reißen wolltest.
Geh du und bleib.
aaaaaaaaaaaaaaUnd brich die Zeile –
Ursula Krechel
ALLE TAGE IN DIESER STUNDE
Nachruf auf Ingeborg Bachmann
Es ist eigentlich immer Nacht
oder Dämmerung
und das Singen der Vögel
im gelben und roten Laub
verbindet die Nacht nicht
den Tag nicht
und die gestundete Zeit
Was in Gefährdung verblieben
was über dunkler Klage
klaglos verbrannt:
fürchtet euch oder fürchtet euch nicht
Celan der Bruder im Fluss von Paris
Christine Lavant
Schwester im Nachbartal
es sind so viele geworden
die ihre Zeit auf den Mantel
zwischen Tag und Nacht
und vor der Tür des Hauses
niedergelegt
ohne Laut abgelegt haben
denn die Tage und Nächte der Zeit
waren nicht ihre Zeit
und sie waren in ihrer Betroffenheit
dunkle Geschwister
die wie Bedrohte Zerstreute
am Fluss
im Spital
oder am Feuer
wie Bilder aus Traum und Angst
hilflos vergehen
D.M. Frank
Bachmann Loops von Tim van Jul
Stimmen zu Ingeborg Bachmann
Lia Wolf: Ingeborg Bachmann
Buchkultur, Heft 18, November 1992
Hermann Burger: Abend mit Ingeborg Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Peter K. Wehrli: Unverbunden in Zürich
DU, Heft 9, 1994
Uwe Johnson: Good Morning, Mrs. Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Inge Feltrinelli, Fleur Jaeggy, Toni Kienlechner, Christine Koschel, Inge von Weidenbaum: Römische Begegnungen
DU, Heft 9, 1994
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstlerin Ingeborg Bachmann
Heinz Bachmann: „Die Ärzte wollten dringend wissen, ob es irgendwelche Medikamente gab“
Die Welt, 5.9.2023
Ria Endres: Es kommen härtere Tage
textor.online, 25.7.2024
Ria Endres: Die härteren Tage
textor.online, 21.8.2024
Ria Endres: Auf Widerruf (III)
textor.online, 27.8.2024
Ingeborg Bachmann erhält den Georg-Büchner-Preis 1964. Dankesrede und kurzer Fernsehbericht über sie inklusive Interview. Außerdem Rezitation des Gedichts „Die große Fracht“.
Zum 10. Todestag der Autorin:
Christa Wolf: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
DU
Zum 30. Todestag der Autorin:
Rolf Löchel: Es schmerzte sie alles, das Leben, die Menschen, die Zeit
literaturkritik.de, Oktober 2003
Zum 40. Todestag der Autorin:
Jan Kuhlbrodt: Zum 40 Todestag von Ingeborg Bachmann
signaturen.de
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Susanne Petersen: „Keine neue Welt ohne neue Sprache“
Sonntagsblatt
Diemut Roether: Ein Ungeheuer mit Namen Ingeborg
die taz, 23.6.2001
Otto Friedrich: Zum 75. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Furche, 20.6.2001
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Evelyne von Beime: „Doch das Lied überm Staub danach / wird uns übersteigen“
literaturkritik.de, Juni 2006
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Ria Endres: „Es kommen härtere Tage“
faustkultur.de, 15.6.2016
Hans Höller: Ingeborg Bachmann: Phänomenales Gedächtnis ganz aus Flimmerhaar
Der Standart, 25.6.2016
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Hans Höller: Die Utopie der Sprache
junge Welt, 26.6.2021
Zum 50. Todestag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2022
Edwin Baumgartner: Bachmann für Verehrer
Wiener Zeitung, 24.11.2022
Ingeborg Bachmann: Eine poetische Existenz auf der Rasierklinge
Kleine Zeitung, 16.10.2023
Hans Höller: Kriminalgeschichte der Autorschaft
junge Welt, 17.10.2023
Claudia Schülke: Elementare Grenzgängerin
Sonntagsblatt, 11.10.2023
Paul Jandl: Vor fünfzig Jahren starb Ingeborg Bachmann an schweren Brandverletzungen. Dann gab es Gerüchte über einen Mord, und es entstand ein Mysterium
Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2023
Teresa Präauer: Nur kurz hineinlesen – und nächtelang hängen bleiben
Die Welt, 17.10.2023
Andrea Heinz: Erinnerung an eine Unvergessene: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann
Der Standart, 17.10.2023
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Interview mit Martin Meyer: „Ihre Kompromisslosigkeit und Unbestechlichkeit“
literaturoutdoors.com, 22.1.2026
Interview mit Linda Treiber: „Schreiben als eine Form der Verantwortung“
literaturoutdoors.com, 23.1.2026
Interview mit Ingrid Walter: „der Sog des „Ungargassenlandes“
literaturoutdoors.com, 24.1.2026
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + Forum + IMDb + ÖM + IZA + KLG + Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Interview
Porträtgalerie: akg-images + deutsche FOTOTHEK + gettyimages + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachruf auf Ingeborg Bachmann: Die Zeit


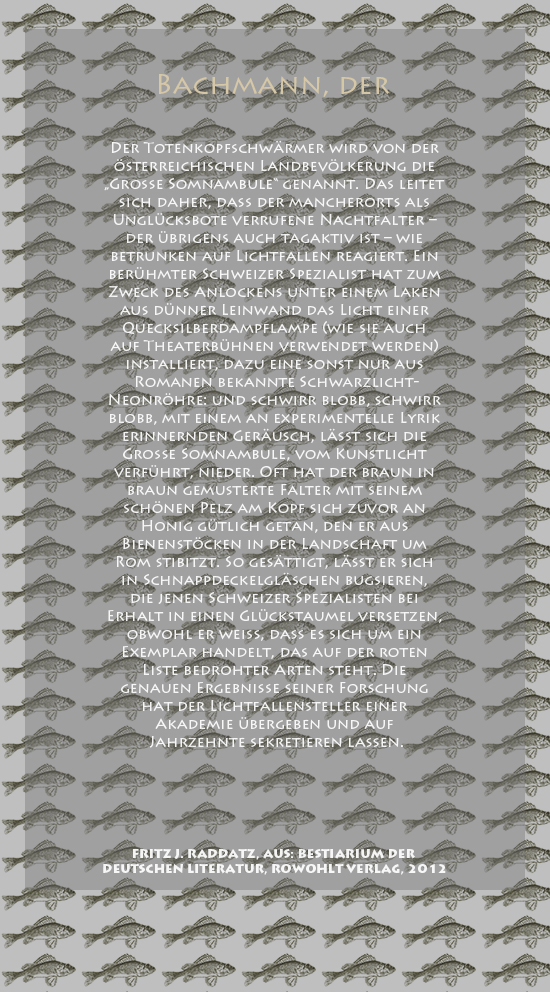












0 Kommentare