WAS BRAUCHST DU
was brauchst du? einen Baum ein Haus zu
ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch
wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone
dich verlierst in grüner üppiger Schönheit
wie groß wie klein bedenkst du wie kurz
dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der
aaaaaBäume
du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach
zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen
zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund
die Gestirne das Gras die Blume den Himmel
für Heinz Lunzer
![]()
Das ewige Leben der Worte
Friederike Mayröcker hat es ihren Lesern nie leicht gemacht, doch seit einigen Jahren weht ein Hauch von Leichtigkeit durch ihr Werk, der zum Trugschluss verleiten könnte, selbst sie – die grosse Puristin vertiefter Spracharbeit – heule inzwischen mit den Wölfen marktgängiger Kulinarik. Tatsächlich geht sie bloss souverän und zusehends souveräner mit ihren Mitteln um, und wenn das zuweilen gelöste, schwerelose Texte zeitigt, resultiert derlei Leichtigkeit nicht aus irgendeinem vorschnellen Einverständnis mit dem Flachsinn der Sprache, sondern aus einer lebenslangen, unbeirrbaren Schreibanstrengung.
Zu den Erscheinungsformen dieser angespannt-entspannten Souveränität gehört in Mayröckers jüngstem Gedichtband, Notizen auf einem Kamel, erstmals auch der mild-ironische Blick auf die „Anstössigkeiten“ des eigenen Sprachgebrauchs, wobei die Instanz, die diesen Blick lenkt, naturgemäss der ratlose, verzweifelte Leser ist. Bereitwillig lässt ihn Mayröcker zu Wort kommen:
ach! lauter Neologismen – „es wimmelt in Ihren Schriften von
Neologismen…“
Und steht zu befürchten, dass er wieder einmal nicht begreift, was „gemeint“ ist, springt sie ihm hilfreich bei, etwa mit einem vorsorglich eingeschobenen „(adj.)“, das unterstreicht, dass das Wort „krähen“ in der seltsamen Sprachwelt dieser Gedichte ausnahmsweise die „Eigenschaft“ eines späten Novembermorgens bezeichnet.
Überhaupt zieht sich die Geste der Hilfsbereitschaft wie ein roter Faden durch die Texte. Wo sich in früheren Gedichtbänden das lyrische Subjekt durch ein insistierendes „ich sage“ bemerkbar gemacht hat, dominiert jetzt ein leserfreundliches „ich meine“, das willfährig zu erläutern sucht, was allenfalls dunkel und missverständlich wirken könnte. „das NOVEMBERGESTECK“, heisst es zum Beispiel, „ich meine Nebelwolke und feuchte Sicht ich meine feuchtes Auge“, oder: „dieser zerrissene ich meine Halbmond im Fenster“. Nach und nach freilich erweist sich, dass derlei „Erklärungen“ entweder überflüssig oder nicht wirklich zielführend sind, weil sie, statt „Klartext“ zu reden, bloss neue Undeutlichkeiten produzieren. So gesehen, läuft Mayröckers ostentative Leserfreundlichkeit letztlich darauf hinaus, das prinzipielle Versagen eindeutigen, zweifelsfreien Sprechens vor Augen zu führen und gleichzeitig zu unterstreichen, dass es keine Frage des Leser-, sondern des Weltbezugs ist, wenn das eigene Sprechen vor Eindeutigkeiten zurückscheut.
Welcher Art dieser Weltbezug ist, hat Friederike Mayröcker vor nahezu dreissig Jahren klargemacht (im poetologischen Essay „Ein Gedicht und sein Autor“, 1967), und daran dürfte sich, bei allem Wandel des gestalterischen Zugriffs, bis heute nichts Entscheidendes geändert haben:
Das ,freie‘ oder ,totale‘ Gedicht, das ich anstrebe, ist meiner Vorstellung nach ein Gedicht, das einen Ausschnitt aus der Gesamtheit meines Bewusstseins von der Welt bringt. ,Welt‘ verstanden als etwas Vielschichtiges, Dichtes, Bruchstückhaftes, Unauflösbares.
Die Subjektivität, die Mayröcker hier für sich in Anspruch nimmt, hat ihren Niederschlag lange Zeit vor allem im „privatsprachlichen“ Zuschnitt der Texte gefunden. Mittlerweile, und das mag den Eindruck der „Zugänglichkeit“ verstärkt haben, äussert sich diese Subjektivität zusehends in einem geradezu unverschämten Mut zum Gefühlsausdruck. Auch im neuen Gedichtband darf die Träne ungehemmt quellen („Tränensturz und Tränenklause“), und die Frequenz der „Ahs“ und „Ohs“ erinnert gelegentlich an hochromantische Exerzitien.
Dass solch emphatisches Sprechen trotzdem nicht peinlich oder epigonal wirkt, verdankt sich den poetologischen Zusammenhängen, in die es gestellt ist. Mayröcker hält nach wie vor fest an der „Biographielosigkeit“ ihres Schreibens. Das erstaunt zunächst, da viele der neuen Gedichte oft schon im Titel lebensweltliche Personen namhaft machen und auch sonst autobiographische Inhalte ziemlich unverstellt zur Sprache bringen. Zu Mayröckers Überzeugung gehört freilich, dass erst die Spracharbeit diese Inhalte mit „Wirklichkeit“ auflädt. So gesehen, feiert das emphatische Sprechen nicht den Gefühlsanlass, sondern den Akt der Verwandlung, der die Realität des Gefühls aufspürt und zur Geltung bring.
Wenn Schreiben in dieser Weise „Welt“ schafft, kann es vielleicht auch helfen, das Verschwinden von Welt zu verhindern, die Drohung des Nichts zu bannen: Solche Zuversicht wider besseres Wissen erklärt, warum es vielfach die Erfahrung des Alterns, Schwindens und Sterbens ist, die in Mayröckers Gedichten der letzten Jahre beschworen wird. Unstillbarer Lebenshunger, übersetzt in den tendenziell „offenen“ und unabschliessbaren Prozess des Schreibens, kollidiert mit der Unabweisbarkeit des Todes, und aus dieser Kollision erwächst die Dringlichkeit eines Sprechens, das nackt und unbekümmert um irgendwelche „Schicklichkeit“ sein Recht behauptet.
Weil der blosse Gedanke an die Vergänglichkeit sie „aufheulen“ lasse, der Tod ein „Fehler der Schöpfung“ sei, sucht ihm Mayröcker immer wieder das Unvergängliche des Schöpferischen, das „ewige“ Leben der Worte entgegenzuhalten. Das führt zum seltsamen Paradox, dass gerade die schmerzlichsten ihrer Abschiedsgedichte nicht den Tod, sondern das Leben festhalten. Zwar reden sie vom Sterben, aber dass sie reden können davon, holt zurück, was vergangen scheint. Von daher mag sich der innerste Kern von Mayröckers Poetik erschliessen: das es letztlich und zuletzt das Leben ist, das die Worte bewahren. In diesem Sinn ist es nicht nur der Schmerz des letzten Kusses, den Mayröcker in einem ihrer Gedichte auf den Tod der Mutter vergegenwärtigt, sondern auch die glückhafte Gegenwart eines Kusses, der andauert über den Rand des letzten Verses hinaus:
NACH IHREM TOD
dies Rosenblättrige / blasse Rosenblätter behangen mit
kühlem Tau Morgentau ich meine betaut blasse Rosenblätter
hauchdünn wenn sie wenn ihre schmalen Lippen mich küsste
mich küssten und vor dem Küssen mich anblicken mit einer
Trauer und sagen: wenn ich tot sein werde kann ich
dich nicht mehr sehen darum will ich nicht sterben noch
nicht wenn ich gestorben bin kann ich dich nicht mehr sehen –
mit schmalen geschlossenen Lippen blassen rosenblättrigen
Lippen zärtliches Neigen des Kopfes der Lippen zu mir
zu Auge zu Mund und leichtes hauchdünnes Berühren
meine Lippen meine Lider / rosenblättrig und neigen zu mir
mich küssen mit in den Augen Angst und Trauer und Wehmut
nie mehr nie mehr werden ihre Lippen sich neigen zu mir
nie wieder nie wieder ihre Lippen nie wieder werden mich küssen
Gerhard Melzer, Neue Zürcher Zeitung 1.10.1996
Dies ist mein Thymianstämmchen
Friederike Mayröckers neueste Gedichtsammlung Notizen auf einem Kamel – Gedichte 1991 bis 1996 beginnt schon auf dem Umschlag, mit dem erst 1995 geschriebenen Eröffnungsgedicht „was brauchst du“. Es unterläuft eine Erwartung: Denn der „gelernte Mayröcker-Leser“ (Harald Hartung) will mindestens dies verstanden haben, daß ihre Texte das „Assoziationspotential“ des Lesers mobilisieren (W. Schmidt-Dengler), daß sie also fragen, aber die Antwort selber nicht wissen. Um so erstaunter wird er sein, daß dieses programmatische Gedicht auf die gestellte Frage ohne Umschweife antwortet, in einer Sprache, die auch der ungelernte Mayröcker-Leser auf Anhieb versteht, deren fehlende Interpunktion er mühelos restituieren kann und in deren Rechtschreibung nur das mayröckerische „sz“ beinahe anheimelnd auffällt:
was brauchst du? einen Baum ein Haus zu
ermessen wie grosz wie klein das Leben als Mensch
wie grosz wie klein wenn du aufblickst zur Krone
dich verlierst in grüner üppiger Schönheit
wie grosz wie klein bedenkst du wie kurz
dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume
du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach
zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen
zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund
die Gestirne das Gras die Blume den Himmel
Ein „du“ darf sich angesprochen fühlen, die unergründliche Wahrheit der poetischen Klischees „Baum“ und „Haus“ wird Leserinnen und Lesern zugemutet und schamlos ästhetisch aufgeladen: „in grüner üppiger Schönheit“! In der vorletzten Verszeile bringt das lyrische Ich sich ein, es ist die Autorin selber, mit ihrem Schreiben, ihrem Schweigen und ihrem Freund, aber natürlich dürfen und sollen hier jede Leserin und jeder Leser die Person imaginieren, die ihnen die teuerste ist – denn das ist ja das Wunder des Gemeinplatzes: Er ist Ort der Begegnung, er gehört allen und jedem. Und tapfer heißt es im Klappentext (vor dem hier ausdrücklich gewarnt sei):
Sprache wird nicht erst durch eine Person verbürgt… Ein Begriff wie lyrische Subjektivität deckt die Herkunft des Gedichttextes nicht mehr ab, so wenig wie der herkömmliche Bezug auf eine gegenüberliegende Wirklichkeit gilt.
Wer Deutsch versteht, wird sich jedoch der Einsicht nicht verschließen können, daß hier eine der bedeutendsten dichterischen Stimmen unseres Fin de siècle genau das versucht, nämlich mit ihrer Person zu verbürgen, was sie zu sagen hat. Das ist ihr Wagnis, darum läßt sich ihr Gedicht auch so leicht parodieren, ridikülisieren, als Kitsch abtun.
Der gelernte Mayröcker-Leser braucht jedoch nicht zu erschrecken: Nicht alle 122 Texte des Bändchens wandeln auf den Wegen dieses ersten. Die Autorin bleibt auch hier jene Artistin, die ihr Publikum seit einem halben Jahrhundert an ihren Fanatismus der Perfektion gewöhnt hat: was sie schreibt, ist gewollt, ist gekonnt, ist gelungen. Suchen wir aber diesmal nicht nach den mayröckerischen Ingredienzien, sondern folgen wir dem Fingerzeig des Eingangsgedichts!
Da ist rückblickend zuerst einmal zu bemerken, daß Friederike Mayröcker immer schon, selbst in der Blütezeit der Konkreten Poesie, ihre Sprache mit den subjektiven Krallen hypertropher Metaphorik und vagabundierender Assoziation festgehalten und für ihr Dichten als Ausgangspunkt ein „Körpergefühl“ verantwortlich gemacht hat. Das mag auch oft genug den Rhythmus ihrer „Atemgedichte“ bestimmt haben. Von Versen ist allerdings kaum je die Rede, und wenn einmal, dann ist „der Jambus: ein Inkubus, rufe ich, als Fünf- oder Sechstakt, hat er sich einmal / festgekrallt, ist er nicht ab- / zuschütteln, ist er kaum los- / zukriegen (fließende / Metrik!) und schon verloren…“ (aus „Levitation“ von 1985).
Die „linguistische Wende“ mit ihren Vorstellungen von Emanzipation durch Spracherziehung, von Generierbarkeit des Satzes und angeblichen Merkmalen poetischer Sprache war dem Vers nicht günstig: die Poesie mußte sich in die Wortlehre retten. Ohne Wortzertrümmerung, ohne metaphorische Zwangsverschweißung, ohne Neologismen kein modernes Gedicht. Daran hat man sich gewöhnt und rühmt zum Beispiel „jene mehrdimensionale Dialogstruktur der Sprache – entdeckt im Assoziationshof ihrer Wörter“. Werden aber Gedichte aus Wörtern gemacht?
Das ist ja die zweite und vielleicht noch größere Überraschung des neuen Gedichts: Es nähert sich behutsam klassischen Formen an, es benutzt den Zeilensprung auf dem Papier durchaus nicht zum demonstrativen Zerreißen dessen, was zusammengehört, und es besteht aus Versen, aus vierhebigen (und zwei fünfhebigen) Versen mit ein- oder zweisilbigen Senkungen. Dieser jambisch-daktylische Rhythmus, schon im Mittelalter für die deutsche Sprache entdeckt, konnte im achtzehnten Jahrhundert den Sturm und Drang junger, heftiger Poeten beflügeln und sie in Hexametern, griechischen Strophen und endlich in klopstockischen freien Rhythmen von ihrem Jambus befreien. Wenn wir es dann unsererseits wagen, die letzten drei Verse als Terzett zu lesen, ordnet sich das Vorhergehende zu zwei Quartetten, und das Gedicht erhebt sich zum virtuellen Sonett.
Die autobiographische Referenz hat Friederike Mayröcker nie verschmäht, besonders ihre eigene Kindheit wurde immer wieder zum Thema, gerade weil sie nicht erlebt, sondern nur als „Totenschrift“ erschrieben werden konnte: Der „herkömmliche Bezug auf eine gegenüberliegende Wirklichkeit“ war unterbrochen, wie auch sonst Sprachkonstruktion das Medium der „Weltkomposition“ sein mußte. In dieses moderne literarische Allerheiligste, das Schreiben des Schreibens, ist nun aber bei Friederike Mayröcker seit längerem eine Wirklichkeit eingebrochen, die sich nicht wie die Kindheit erschreiben läßt, sondern die vor allem Schreiben tatsächlich gelebt werden muß: 1992 zeugte davon der Gedichtband Das besessene Alter. Bestand das Ziel früheren Dichtens in der rücksichtslosen Erfüllung eines Ausdrucksbedürfnisses, so tritt jetzt eher ein Bedürfnis nach Verständigung und Vergewisserung in den Vordergrund, dem unser Eingangsgedicht Form und Inhalt verdankt: Es ist schlicht didaktisch und spricht aus Erfahrung: gewollt, gekonnt, gewagt – und gelungen?
Man sollte das Bändchen unter diesem Blickwinkel lesen. Die selbstherrlich-assoziative Metaphernproduktion und die destruktiv-konstruktive Spracharbeit tritt zurück, die Autorin schlüpft selber in die Rolle des lyrischen Subjekts, sucht den Anklang an neue und alte Poesie, nennt Namen von Dichtern, versichert sich fast ausnahmslos mindestens einer Leserin oder eines Lesers durch namentliche Widmung und zieht vor allem immer wieder, gleich wohlgehüteten Photographien, eigene Motive und Formulierungen, erschriebene Erlebnisse zitatweise hervor.
Rilkes „Wer jetzt kein Haus hat…“ klingt mit hinein in „du brauchst ein Haus“; in „eines Lebensabschnittes Bestandsaufnahme„“ heißt es: „in meinem Tornister / ein Thymianstämmchen / zwei Münzen / ein stumpfer Bleistift…“, als Geste des Sichvergewisserns vielleicht nie einprägsamer realisiert als in Günter Eichs „Inventur“; ein Gedicht für Ernst Jandl versucht sich in der Erhabenheit Klopstocks, ohne Hölderlins „nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!“ ist der schöne Vers „noch einen Sommer nein zwei nein drei laß mich noch hier“ ein Waisenkind. Die Widmungen stellen wirkliche Bezüge her, pochen darauf, daß hier die Sprache von einer Person verbürgt werden soll, am stärksten vielleicht in dem intimen Achtzeiler „wie und warum ich dich liebe / für Ernst Jandl zum 70. Geburtstag“. Die beunruhigende Erfahrung hinter diesen poetischen Formen drängt aber auch nach direkter Vermittlung, und das geschieht so:
„/ noch / sich sagen ich lebe / noch /“ oder so:
zugeschüttetes Gesicht: was wird sein wenn
ich schon bald vielleicht statt in den Büchern
zu lesen nur noch über die Buchrücken meiner Bibliothek
werde streichen können…
Dieselbe Erfahrung rechtfertigt auch einen erneuten Zugriff auf die Vergangenheit, auf neue Tode der Mutter, den bittersten („Verfärbung einer Oberlippe“), den anklagendsten („Mutters Hostienblatt“), den traurigsten („nach ihrem Tod“) und den gültigsten („MEINE MUTTER MIT DEN OFFENEN ARMEN“).
Das Wagnis des Eingangsgedichts nimmt die Autorin wieder und wieder auf sich. Eine sprachbenutzende Poesie, die sich vornimmt, über etwas zu sprechen und etwas zu sagen, setzt sich allen jenen Gefahren aus, denen die automatische, die sprachzerstörende, die sprachschaffende, die sprachkritische zu entgehen verstand. Das macht die Lektüre dieses Bandes so spannend und vielleicht noch spannender als die der vorausgehenden, obwohl doch alles schon da war. Es sei nicht verschwiegen, daß dies Wagnis manchmal auch mißlingen kann: bei der Betulichkeit in „ein Eschenblatt auf regennassem Balkon am Morgen“, bei der Wichtigtuerei des Bedeutens in „Die abgeschnallte Armbanduhr in der Jackentasche, die abgehalfterte Zeit“, bei dem musikalischen und anderem Bildungsplunder. Diese Entgleisungen, wenn es denn welche sind, gehören vielleicht „zu den Lizenzen von Alterswerken“, wie sie Harald Hartung in „Lectionen“ fand. Aber die „flehentliche Bemühung um Verständigung („verstehst du“, „ich meine…“) in der Annäherung an Gemeinplatz und poetische Form sollte man für ein Zeichen der Zeit halten, den mutigen Versuch, zu beweisen, daß nicht das Klischee und die Sprache, sondern vielleicht doch die Menschen lügen, wenn sie nicht die Wahrheit sagen.
Hans-Herbert Räkel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.10.1996
Textablenkungen, Lebensablenkungen
− Friederike Mayröckers neueste Gedichte. −
Warum lieben wir Geschichten, stories? weil sie uns erlauben, Zusammenhänge herstellen zu lassen und weil uns, den Durchschnittsleuten, oft Angst durch den Eindruck von Zusammenhanglosigkeit widerfährt? weil wir geprägt sind von der Suche, ja Sucht nach Konklusionen: „wenn, dann dann“? Was für eine story machen wir aus dem Titel Notizen auf einem Kamel? Zunächst sehen wir einen auf dem Kamel sitzen und etwas notieren, oder besser eine, Friederike Mayröcker oder ihr lyrisches Ich. Die zweite Möglichkeit ist ebenso erlaubt, nämlich daß ein Kamel auftaucht, welches voller Graffiti und Notizen angesprüht, wie die frühere Berliner Mauer, entlangzieht (das war mein erster Einfall). Aber beide Deutungen stimmen nicht. Vielmehr ist Notizen auf einem Kamel ein Zitat aus einem Text von Gustav Flaubert, der nicht näher angegeben wird; das Zitat stellt die dritte Zeile des vierzeiligen Gedichts „Tränenzeile, für Wendelin Niedlich“ dar:.
Biscotten Schnee, weißgraues Gewölk
dahinter das Blitzen des blauen Himmels
Notizen auf einem Kamel
bei Flaubert
die schwimmenden Augen des Freunds.
Da wird keine story in lyrischer Verkleidung erzählt, und genau betrachtet wird auch kein Bild beschrieben. Oder wie läßt sich „Biscotten Schnee“ als Teil eines „Gewölk“ usw. in Zusammenhang bringen? Wenn Biscotten Schnee, warum dann Notizen auf einem Kamel, bei Flaubert?
Das Lesen der neuesten Gedichte aus den letzten fünf Jahren, wie sie hier vorliegen, verlangt wie vieles, was Friederike Mayröcker schreibt, zunächst einmal, daß ich von mir selber absehe, von den Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten meines Alltags und meiner Person. Mir wird keine Geschichte geboten, mich zu indentifizieren. So begebe ich mich in Klausur und lese und horche.
Es heißt, daß bei Gedichten das Hören oder laute Lesen ganz wichtig sei. Bei diesen 124 Gedichten ist das Horchen (oder Zuhören) unverzichtbar, und zwar zuerst schon wegen des Rhythmus. Der Rhythmus dieser Gedichte stellt einen Widerstand für das Durchdringen oder Erfassen ihrer Texturen dar, der, wenn er überwunden ist, mich erleichtert seufzen läßt: es hat sich gelohnt, diese synkopierten Sätze und Satzfragmente zu sprechen und zu hören. Dem staunenden Leser bilden sich jetzt aus Wörtern auf dem Papier neue Gebilde, sinnliche Figuren aus Worten, die durch die Logik der Poesie betören.
Ich wage den Vergleich von manchen dieser Gedichte mit Eisenblüten (wie sie etwa in Kärnten vorkommen), das sind nun weder Blüten noch haben sie mit Eisen zu tun, es sind Mineralien (aus Kalkspat, CaC03): als verzweigte und „lose verknäuelte Aggregate“, oder auch (z.B. in Karlsbad vorkommend) als Krusten aus heißen Quellen. Diese Mineralien sind Modifikationen von Kristallen, aber ohne deren gesetzmäßige Strukturen bzw. Zusammenhänge. Aus der Musik bietet sich der Cluster zum Vergleich an. Bei all diesen Strukturen scheint es nicht sinnvoll, unsere eigenen sagen wir Ordnungskriterien hineintragen oder wiederfinden zu wollen. Statt dessen müssen wir in sie hineinsehen und hineinhören. Friederike Mayröcker ist sich dessen sicherlich bewußt, daß sie von uns einiges verlangt. Davon gibt es vereinzelt als Beweis ein „ich meine“ oder ein „nicht wahr“, wie überbrückend; etwa in dem Gedicht „römische Lebensüberschriften“ für Christa Kühnhold: Da werden aus den „verzehrenden Pflanzen“ durch den Hinweis der Autorin Agaven, oder die „riesigen Tüten der Häuser… ich meine Tüten: Trichter“ gelten als erklärt; doch für wen? für sie selber? für uns?
Noch das Persönlichste wird durch das Veröffentlichen aus dem Privaten gehoben und wird offen für uns als Publikum, als auch sprechende Subjekte.
Die Gedichte des Bandes sind nicht chronologisch geordnet und nicht thematisch gegliedert etwa in inhaltliche Kapitel oder in Gedichte mit bzw. ohne Widmung (mehr als die Hälfte, nämlich 64, sind einer oder mehreren Personen gewidmet, ein weiteres Gedicht ist sogar „für niemand“). Das heißt doch, ein Text richtet sich nicht nur an den Leser, sondern ist an einen Menschen „gesendet“. Als Widmungsträger finden sich Literatur-Menschen wie Elfriede Czurda oder Hans Mayer, oder Menschen der Umgebung wie Siglinde Balvin und die Mutter und, am öftesten, Ernst Jandl. Bei manchen dieser gewidmeten Gedichte bezieht sich der Inhalt evidentermaßen auf die genannte Person, bei anderen ist es nicht unbedingt ersichtlich. Was ist der Grund für diese große Zahl der Zueignungen? Ich meine nicht den psychologischen Grund, sondern den schriftstellerischen. Ich deute es als einen prinzipiellen Bezug auf Intersubjektivität, wenngleich manche der Gedichte in ihrer Reduktion denjenigen Aspekt der Sprache, der Verständigung ist, außer acht zu lassen scheinen. Mit Reduktion meine ich den offenbaren Verzicht auf unmittelbar ansprechende Bilder oder Redewendungen, ich meine das Hinstellen von sprachlichen Elementen, deren Reiz dann auch im Unerwarteten besteht:
Brillanz der Liebe
der Mühe das Pathos von unten abzuschneiden, nicht wahr
Das ist undurchdringlich und soll wohl auch so sein, anders als die doch einleuchtende Metapher „ein verregnetes Herz“ oder die „verzehrenden Pflanzen“ ein paar Zeilen zuvor im selben Gedicht.
Die Lösung ist: in manchen Sprachwendungen liegt eben keine Lösung. Mit einem Hauch von Koketterie spielt die Autorin auf eine Bemerkung an, es „wimmele in ihren Schriften von Neologismen“; wir Leser von Lyrik nehmen es als Empfehlung, ja Ansporn, nach neuen Wörtern zu suchen: da ist schon eines, „das Atemwäldchen“, oder „die Körperschläuche“, oder das „Veilchenlicht“. Da aber das Zurechtfinden in Friederikes Poesie die Freude erhöht, teile ich die Gedichte grob in drei verschiedene Gruppen ein: es sind die sozusagen poetologisch einfachen, dann die sozusagen raffinierten, und die hermetischen.
Zur ersten Gruppe gehören neben anderen einige Gedichte in der Mitte des Bandes, die sich mit der Mutter, ihrem Leben und ihrem Tod beschäftigen. Sie erlauben, wie andere kaum, lebensgeschichtliche Einblicke, sind also vielleicht die einzigen „Aufarbeitungsgedichte“. Sie heißen „Nach ihrem Tod“ und „Meine Mutter mit den offenen Armen“ und „Bildnis der Mutter mit 87“, und „… vernichtende Selbstanklage“. Sie vollziehen in gewisser Weise Erlebtes nach, nicht nur Krankheit und Tod der Mutter, sondern auch die lange vergangene Kindheit der Tochter, der Dichterin.
Hier wie übrigens auch in anderen Texten, etwa „zugeschüttetes Gesicht“ oder „ausgerasselte Sprache“ spricht Mayröcker als älterer Mensch. Die vertikale Dimension der Zeit, einer ganzen Lebenszeit wird wie auf einem Diagramm sprachlich gezeichnet: Hinauf in der Vorzukunft „weil ich mich zurückentwickelt haben werde“, und hinunter in der Vergangenheit „mir habe vorlesen lassen müssen von meiner Mutter“.
Nicht nur das „Vorgefühl einer strengen Auflösung“, sondern auch das Gedicht „Psalter / Verfärbung einer Oberlippe“ rühren an die schmerzhafte Kränkung, die der Gedanke an unseren körperlichen Verfall uns schon im voraus bereitet, und an die Trauer, die der Tod des nahestehenden Menschen bringt „,die mich geboren hat‘ (Sappho)“.
Dies Psalter-Gedicht, gestammelt, stockend, klingt, als hätte jemand beim Aufschreiben fast blind die richtigen Tasten der Buchstaben erst suchen müssen. Aber es ist dennoch keine einfache Klage über den Tod der Mutter, sondern schon versachlicht oder verfremdet, siehe das Handhaben des Zitates der Sappho.
Von den „poetologisch einfachen“ Gedichten bezaubert eines besonders durch seine Musikalität: „für Georg Kierdorf-Traut, Frühsommer 95“, es heißt:
und alles zugelöffelt Weihrauchbüsche
und triefend Himmels Wand und Himmels Winkel
und ungelenk der Wind, darin die Schwalbe nistet
ah! Juni’s Schwermut mächtiges Kastanienhaupt
die Sonne schwarz umschwärmt von fransenden Gewitterwolken
und ohnegleichen Tränensturz und Tränenklause
„Naturlyrik“? jedenfalls liedhaft melodische Strophe voller Singbarkeit, in der das drohende Bild vom Unwetter aufgehoben ist, ohne rhythmische Widerborstigkeiten wie etwa Synkopen. Hölderlins Schwermut…
Es ist fast, als wollte die Autorin ihre sprachlich-handwerkliche Meisterschaft beweisen, ihre Kunst, auch abgerundete Strophen bauen zu können.
Dem gehobenen Ton der durchkomponierten Strophe kontrastiert das Nachbargedicht „bin jetzt mehr in Canaillen-Stimmung“, dessen holprige Zeilen die sperrige Laune ausdrücken:
ich freue mich nicht wenn mir jemand gepreßte Blumen
oder 200 Millionen Jahre alten Lavasand sendet…
Dies Gedicht ist keinem gewidmet, seine Unruhe ist an alle gerichtet, die verstehen wollen und keine Blumen bringen, es lädt aber zugleich dazu ein, eigener Canaillen-Stimmung einmal nachzugeben und mitzuweinen. Indem Mayröcker in manchen Gedichten so unbedingt ICH sagt, „subjectivissime“ spricht, ermutigt sie MICH, auch ICH zu sagen.
Manche dieser Gedichte sammeln Wörter wie Schnipsel aus dem Papierkorb, es scheinen banale Momente des Lebens, des Alltags sich in ein paar Zeilen zu kristallisieren: schon die Angabe der Titel soll genügen, den Inhalt zu begreifen: „eine Lebensabschnittes Bestandaufnahme“, „ein Eschenblatt auf regennassem Balkon am Morgen“, mit dem mehrdeutig schönen Satz „ach wie verschmerzt diese Tage!“).
„Telefunkengedicht für Irmgard Flemming anläßlich ihrer Ausstellung in der Galerie…“ sammelt Elemente aus Bildern und schafft daraus Sprachmaterial, das wiederum Bilder erzeugt: „das Tirilieren der Kopflandschaft: Frühlingsbastard im Winter“.
Für den Gefährten des Lebens, Ernst Jandl, sind sieben Gedichte, darunter einige richtige Liebesgedichte, wie das zum 70. Geburtstag „wie und warum ich dich liebe“. Es ist im umgangssprachlich selbstverständlichen Ton und steht dadurch im Kontrast zur „artistischen“ Sprache vieler anderer Gedichte. Seine scheinbare Einfachheit wirkt besonders raffiniert. Der Leser ist bewegt über den Ausdruck dieser lange dauernden „unbeirrbaren Liebe“, wie Mayröcker sie nennt.
Kürzlich wurde in der Süddeutschen Zeitung das Literarische Quartett des ZDF (Namen müssen nicht genannt werden!) so charakterisiert: dessen Eindruck beim Zuschauer sei letztlich, daß die Kritik von Büchern sich nicht von der Kritik an Suppen unterscheide: „gut, schlecht, versalzen usw.“. Da fällt erst auf, daß Lyrik anscheinend nie auf dem „Menü“ des Quartetts auftaucht. Ja und daß sich die Vier doch meistens an den stories, dem plot, abarbeiten, natürlich nicht ausschließlich, es geht auch dort am Rande um die Würze und Zubereitung, aber hauptsächliches Objekt der Bücherfresser ist der „Stoff“.
Das muß bei der Präsentation von Lyrik anders sein. Und wenn Mayröcker sich in einem Liebesgedicht an E. J. exponiert und wenn sie die Zeilen mit einer Einfachheit verkleidet, dann ist das ein bestechendes Kunstmittel.
Ein anderer häufiger Kunstgriff, als Stilmittel, ist der Wechsel der Reflexionsebene. Mit diesem Ariadnefaden in der Hand können wir die verschiedenen Bedeutungsebenen oder Semantiken dieser Lyrik leichter nachvollziehen.
Die Dichterin weiß, daß die Sprache in verschiedene logische Ordnungsstufen aufgebaut ist, und manchmal läßt sie uns wissen, daß sie weiß:
sollte ich jetzt das ganze Buch nocheinmal schreiben, daß damit die Textablenkungen den Lebensablenkungen entsprechen
Natürlich sind Text und Leben „irgendwie“ aufeinander bezogen, aber im allgemeinen werden diese Ordnungsregeln oder Bezüge nicht eigens für uns gekennzeichnet. Darin ähneln die Gedichte strukturell den alten Orakeln, die der Empfänger selber deuten mußte, weil sie grundsätzlich mehrdeutig waren. Darin liegt auch der Sinn meiner Charakterisierung mancher Gedichte als „hermetisch“.
Noch einmal zurück zur Frage des „Stoffes“: Ich behaupte, manche der Gedichte, vor allem die „hermetischen“, haben gar keinen „Stoff“ im eigentlichen Sinn. Ihr Grund sind Wörter als Materialien, die dann thematische Strukturen ergeben, eben wie Eisenblüten.
Dazu gehören einige längere Gedichte, z.B. „auf einen Mistelzweig über der Schwelle“ oder „die wetterleuchtenden Stimmen, für Heinz von Cramer“, oder „so wie man oft mitten in 1 Gedanken oder Satz steckenbleibt, für Thomas Kling“.
Das letztere ist ein Gedichttitel, der schon das Thema des Gedichts erklärt, nämlich das Schreiben auch als Experiment, als Schreiben pur. Es heißt:
1 feuchter Schwarm oder Schwamm…
(…) sage ich
ich weiß nicht…
oder im Gedicht vorher ähnlich:
der Schwamm oder Schwan immer der ganze Wald als einziger Baumschwamm vor meinen Augen…
ein Schwarm über den Wipfeln der Buchen
Es ist wichtig, die Gedichte von Friederike Mayröcker immer wieder aufeinander zu beziehen, also auch im Zusammenhang zu lesen, um dann wie in einem Gewebe bestimmte Muster, also Texturgesetze, zu erkennen. Da ergeben sich dann Beziehungen durch das ganze Buch. Ich nenne einige. Da ist das Wohnungsmuster, die Honigtropfen beim Frühstück, oder das Straßen- oder das Waldmuster, man könnte auch Motiv sagen. Diese Muster oder Motive stehen in Spannung zu den assoziativ hervorgeholten Wörtern und verleihen ihnen eine Rahmung: aha Großstadt, aha Reise, aha Kindheit. So entstehen horizontale oder vertikale Gerüste oder Netze und verteilen sich über den Gedichtband als eine lockere Orientierung. Locker, nicht bindend, nicht zwingend: diese Lyrik vermittelt ihren Lesern eine gewisse Freiheit, mit ihr zu spielen. Dies wenigstens lese ich aus Mayröckers Methode heraus, die das Spiel mit Wortassoziationen und die Aufhebung der Syntax kombiniert: in vielen der Gedichte gibts weder „normale Sätze“ mit Hypotaxe oder Parataxe noch „unnormale Sätze“, sondern Konglomerate von Worten, entsprechend viele Partizipien, da sie die Funktion des Prädikates im Satz einnehmen. Durch diese „undefinierte“ Verwendung der Zeitwörter entsteht sehr oft eine Atmosphäre des Schwebens, eine Einladung zum Verweilen.
Ich glaube nicht, daß assoziatives Aneinanderreihen als demokratisch zu verstehen ist; assoziieren entspricht in der Literatur eher dem, was gemäß der Psychopathologie sogenannten autistischen Zwängen entspringt.
Jedoch, eine Raffinesse der Texte dieser Dichterin besteht darin, dem Leser die Möglichkeit zu eröffnen, sich auf ihre Assoziationen einzulassen; z.B. dadurch, daß sie darauf hinweist, wie sie und daß sie gemacht werden: „ich meine, ich sage, ich frage“. Mayröcker ist sozusagen viel zu gründlich oder grundsätzlich reflektierend, sie gestattet sich zwar Rätsel, aber keine Autismen. Der Rahmen bzw. der Blickpunkt wird noch in schwierigsten Kompositionen angegeben, wenn sich in einem Halbsatz oder in einer Wortwendung der Hinweis auf das Zustandegekommene, das G e m a c h t e dieser Gedichte findet:
… wo das ganze Arrangement…
an die Vorstellung EINE STRÄHNE AUS IHREM ZOPF /
EINE SCHNECKE IN IHREM HAAR
denken läßt, an das abermals Verzehren von Veilchensträußen
(Ende des Gedichts „Adriena Simotovas Tisch Wächter, oder also alles gesteinigt“, für Dieter Peharda).
Es wäre noch hinzuweisen auf die feinsinnigen Beobachtungen, aus denen lyrische Darstellungen synästhetischer Phänomene werden, die feine Sinnlichkeit von Mayröckers Gedichten, etwa in „die Anrichte, rote Harmonie, nach Matisse, für Siglinde Balvin“, ein Achtzeiler, in dem fünf Mal (5 x) das Wort gelb vorkommt, Dach, Horizont, Witterung der Lampions, Tau und Lampenlicht, alles gelb, natürlich verschieden gelb. Oder ein Wort wie „die Enzianschwermut“ muß erst einmal gekostet, ja geschmeckt werden (aus dem längeren Gedicht „eine der Blumen unserer Jagd / Puchbergserie“. Die Titel werden angeführt, weil sie selber poetischer Bestandteil der Strophen sind.)
Schon fast am Ende meiner Umkreisungs- und Annäherungsversuche angelangt, lese ich im Artikel von Franz Schuh „Anarcher Kunstverstand. Über das Geheimnis der Poesie in Friederike Mayröckers Gedichten“ (DIE ZEIT, Hamburg, 4. Oktober 1996) etwas, was ich nicht so zu nennen wagte: Verrücktheit sei da zu finden, es gäbe da ein Gleichgewicht von Einfachheit und Verrücktheit. Ich habe es / siehe oben / mit der „Atmosphäre des Schwebens“ umschrieben, auch „Trance“ trifft dies „Ver-rückte“. (Der „anarche Kunstverstand“ ist ein Zitat aus einem Text von Fritzi selbst.) Ja was bleibt noch zu empfehlen? nun natürlich ein Beispiel für „Verrücktes“:
Das Gedicht „Fußnoten“:
1 Gottheit der Gnade
2 Jüngling mit Blüte, auf Amphora
3 auf schmerzen, auf geschmerzt
4 „mein Joch“
5 Mäuse-Altar
6 Romangedicht
(und so weiter, bis Fußnote 25)
Aber Noten zu welchem Fuß? Füße zu welchen Noten? Sicher ist die Widmung des Gedichtes für Klaus Kastberger sowie für Wulf Segebrecht, welche mir weiter nicht bekannt sind. Und doch, die Geste der Zueignung hat etwas Verbindendes: Hier wurde für euch, ihr Widmungsträger, etwas ausgegraben, ein Jüngling mit Blüte, auf Amphora, und noch andere Zufälligkeiten. Wenn auch die sichtbare Ebene aus blindlings Gesammeltem besteht, so ist das Gedicht auf einer anderen Ebene selbst ein Geschenk, so wie Kinder schenken, was sie gerade erst zusammengepflückt haben („Eisenblüten“ etwa).
PS. Proëmium oder Proömium, „Teil vor dem Gesang“, Einleitungshymnus mit Musenanruf und Themenangabe (Brockhaus, unter Verweis auf die Homerischen Hymnen). (Dies als Fußnote zu dem Gedicht „Proëm auf den Änderungsschneider Aslan Gültekin“, mein Lieblingsgedicht, voll Spannung und „Thrill“. Deutungen sind möglich, werden aber nicht mitgeliefert.)
Hedwig Wingler-Tax, manuskripte, Heft 134, 1996
Poetische Karawanserei
Anmerkungen? Wenn das nicht, zumal in einem Gedichtband, Abfall ist, der sich ans Werk klammert und nichts weiter verrät als die Pedanterie des Autors. Friederike Mayröcker sammelt den Plunder und zählt auf: 1, 2, 3, 4.; bei Nr. 25 ist ihr Papierkorb leer, und ein Gedicht steht auf dem Papier, das direkt ins Zentrum ihrer Poetik führt.
Jeder einzelne Vers ist eine Preziose: „Gottheit der Gnade“, „Jüngling mit Blüte, auf Amphora“, „aufschmerzen, aufgeschmerzt“. Doch das Textganze stellt unverblümt die Beziehungslosigkeit und die Unvollständigkeit des Sammelsuriums zur Schau, wenn Verweise mitten im Satz abbrechen und Worte halb verschluckt werden. Mit jeder unaufgeräumten Zeile vergrößert sich der Scherbenhaufen. Unmöglich, die Verse als Zusammenhang zu lesen. Aber Eigenart haben sie, einen Tonfall, unverkennbar sind sie als Bruchstücke eines poetischen Idioms.
Die Latenz des Gedichts führt geradewegs an die unbestimmten Ränder des Textes, wo Spuren gelegt werden zu einem zugehörigen Nichttext. Abwesenheit, Schweigen, Leere gehen in die Schrift ein und verwandeln das Werk in eine Art Anwesenheitsliste. Das einzelne Buch zeichnet befristete Aufenthalte auf und die Augenblicke des Verstummens. Zugleich melden die Nullzustände von Sprechen und Sprache die Notwendigkeit der Fortsetzung und den Anspruch auf unendliche Erörterung. Es wird weitergehen, melden sie, so oder so, in diesem Text oder in einem anderen, oder im andern eines anderen. Abschiede in der Kunst, auch der letzte und endgültige, sind Transitzustände.
Kommen und Gehen der Sprechstimme fällt nicht unbedingt mit dem Anfang und Ende des Textes zusammen. Wenn sie mitten im Vers im Satzfluß, in der Prosaperiode kehrtmacht, taucht todsieherein „usw.“ auf, oder es folgen Pünktchen, die gelegentlich komplette Verse ersetzen. Das Undsoweiter, die Pünktchen, Klammern, Anführungszeichen, der Kursiv- und Sperrdruck gehören als Vorhof zu den stereotypen Einrichtungen ihrer Texte.
Bild der Altersexistenz
„Polyphone Spur“ überschreibt Friederike Mayröcker ein zerrissenes Lebensbild, dessen Hälften lose auseinanderklaffen. Ein sommerlicher Regentag, den die „prasselnde Glut“ der Liebe erhitzt bricht mitten im Glücksausruf ab:
was für 1 Ergötzung was für 1 geplättete (Bienen) Lust
usw.
Das „Undsoweiter“ hält Verschiedenes fest und verweist auf verhüllte Bildzonen. Dann der Registerwechsel, ein Tonschnitt trennt und verklebt Vergangenheits- und Gegenwartsebene, das leuchtende Erinnerungsbild mit seinem trüben Gegenstück, das schäbiges, „abgehalftertes“ Altersleben zeigt und den Widerschein früheren Glücks:
in den Hainen die Reflexe deines
Gesichts deiner Stimme…
Die Pünktchen, die hier folgen, kündigen eine zweite Bruchstelle des Textes an:
… Oh wie spelzet
das Fluten des gelben (Anbaus) nämlich, und Wogen von Raps:
Süßkind
enormer Kadaver die abermals Sterne ins Darmstädtische
versprüht
Die splittrige Schlußzeile besiegelt den Eindruck des heillos Disparaten den das Druckbild mit Kursivdruck, Zeilenbruch und Klammer bestätigt. Die pathologische Fragmentierung ist beides, Zustandsbestimmung des Alters und Indiz für die Zugehörigkeit der Textteile zu je eigenen Zusammenhängen und zu Sprachen außerhalb des Gedichts.
Mit der Operation löst die Autorin die Textgrenzen auf und kennzeichnet individuelle Rede, die sich in eine von weither kommende allgemeine Sprache einschaltet. Beginn und Schluß werden als kommunikative Augenblicke kenntlich. „Was brauchst du“ fragt das erste Gedicht des Bandes, als werde ein unterbrochenes Gespräch mit dem Leser fortgesetzt: „Einen Baum ein Haus“ lautet die bündige Antwort, die Vers für Vers zu einem Lebensbild eingeschränkter äußerer und reicher innerer Altersexistenz ausgepinselt wird. Unverkennbar kennzeichnet die Frage den Textbeginn als Sprechbeginn und Themenkopf, der das folgende Gedicht „eines Lebensabschnittes Bestandsaufnahme“ einbegreift. Sprachgesten sind ihre Gedichte, direkter Selbstabdruck und umgekehrt: Identität ist an den Ausdruck gebunden. Ich schreibe, also bin ich. Wer so denkt, verwandelt den Ton in eine flüssige Biographie des Schreibens mit Momentaufnahmen seiner selbst. Aber keine gilt ganz und ist das ganze Bild. Die hinreißend selbstironischen Altersbilder ihres Gedichtbandes Besessenes Alter (1992) werden ergänzt durch bruchstückhaft zersplitterte Ansichten eines poetischen „Augengewerbes“, das um sein Werkzeug bangt, die Sinne, Wahrnehmung, das Gedächtnis.
Aussicht auf Repetitionen
Die einzelne Scherbe kann winzig sein, der Abdruck eines Lidschlags bei der Begegnung mit dem Änderungsschneider Aslan Gültekin, ein aus der Kindheit gelöster Erinnerungssplitter, das Streiflicht, das auf ein farbiges Treppenhausfenster fällt, oder jene „Tränenzeile“, die im Titel des neuen Gedichtbands wiederkehrt. Das Bild von den Notizen auf einem Kamel verbindet sich mit dem winterlichen Weißgrau des Gewölks und den „schwimmenden Augen des Freunds“ zur Ansicht blicklosen Sehens.
Gegenstück zum Wischverfahren in „Tränenzeile“ ist das „Telefunkengedicht“. Auch hier ist die Scheibe winzig, ein Stilleben mit rostig verfärbtem Apfel, auf einem blauen Papierteller, das die Bildphantasie mit der Erinnerung an elfenbeinfarbene Wölkchen über Berggipfeln zu einer echoreich „tirilierenden Kopflandschaft“ verspiegelt. Die pointierte Schlußzeile übersetzt das Bild in den deutenden Begriff:
Frühlingsbastard im Winter
Die Gedichte des Bandes entstanden in den Jahren zwischen 1991 und 1996. Aber den historischen Kalender ersetzen sie durch die natürliche Zeit eines Jahreszeitenzyklus, der im September einsetzt und nach einem schneereichen Winter in Frühling und Sommer wechselt, um mit einem Augustgedicht das Finale und das „erahnbar(e) Ende / des Jahres“ anzukündigen. Das Ende, der Abbruch der Schrift vollzieht sich in einem Gedicht, das die Autorin im Titel als „Repetition“ bezeichnet.
Es handelt sich um Picassos Bildnis eines schreibenden Knaben, in dessen Brust, als sei es ein Teil seiner selbst, ein verschlossenes Briefkuvert ruht. Die letzte lautmalerisch polternde Verszeile „-papier / Karpathen Genosse“ schließt das kunsthistorische Museum in Gegenwart und Zukunft auf, wo der Knabe im Schlepptau seiner Schreib-„Genossin“ Platz nimmt im zeitlosen Familienbild der Kunst. Die Aussicht auf „Repetitionen“ ist der letzte Baustein ihres schönen Porträts alternder Künstlerschaft und das Vestibül zu künftigen Fortschreibungen eines Versprechens.
Sibylle Cramer, Süddeutsche Zeitung, 4.12.1996
Übergänge zum Mannesalter, in Arbeiten Friederike Mayröckers
Ein Junge sitzt über einen niedrigen Tisch gebeugt, die linke Faust, den rechten Unterarm aufgestützt, und zeichnet auf ein Blatt Papier. Sein Blick ist angestrengt, vielleicht hat er die Brille abgenommen, der Junge sitzt in kurzen Hosen und hat Schuhe an, er sitzt nach links gewandt, das nackte linke Bein, das Blatt Papier, die linke Hand und das Profil sind von derselben Helligkeit. In Graustufen die gesamte Szene, im Hintergrund der Vorhang und die Fenster, der Tisch mit einem dunklen, hervortretenden Auswuchs oder Schatten an der linken Seite, der Boden, auf dem die Sohlen mit der ganzen Fläche liegen.
Der Junge zeichnet konzentriert, er sitzt versunken, und dabei wird er doch beobachtet, gezeichnet: Jemand muß ihn gesehen haben, während er selbst nichts wahrgenommen hat außer dem Zeichenblatt, der Spitze seines Stifts und den gezogenen Linien. Er habe, schreibt Michel Leiris 1930 in Antwort auf eine Umfrage zur kindlichen Sexualität, mit sechs oder sieben Jahren auf einem Ausflug mit den Eltern bei der Rast auf einer Lichtung einige Jungen und Mädchen ungefähr seines Alters dabei beobachtet, wie sie mit nackten Füßen auf die Bäume geklettert seien. Seinerzeit habe er die Betrachtung der fremden Kinder und die Veränderung seines Geschlechtsteils in keinem Zusammenhang gesehen, sondern allein „die verwirrende Gleichzeitigkeit beider Vorkommnisse“ bemerkt.
Ein junger Mann sitzt auf einer von Laub verdeckten Mauer unter freiem Himmel, gebeugt über ein Blatt Papier oder einen Zeichenkarton auf seinen Knien. Sein Kopf wird von der linken Hand gestützt, der Ellbogen ruht auf dem Oberschenkel oder auf der Mauer, der rechte Unterarm liegt auf dem Schreibgrund, die Feder steht am Kopf der Seite und das Blatt ist leer.
Er sitzt nach rechts gewandt, in Grau und Schwarz und Weiß die Szenerie mit Mauer, Gras, Gestrüpp, die Unterschenkel und das Blatt Papier, der Himmel und die freie Brust im offenen Hemd sind von derselben Helligkeit. Der junge Mann trägt Kniebundhosen, lange Strümpfe, der rechte Fuß ist hinter den linken geschlagen, der Boden wird nur von den Fußspitzen berührt.
Der Mann denkt nach, er hat noch keinen Strich gemacht, von seiner Umgebung nimmt er nichts wahr, und wird doch wahrgenommen, ist vor dem ersten Federstrich bereits gezeichnet worden.
Die Erektion, schreibt Michel Leiris Anfang der dreißiger Jahre unter der Überschrift „Subjekt und Objekt“ in Mannesalter, die sich bei ihm angesichts der Beobachtung jener etwa gleichaltrigen Kinder beim Erklettern von Bäumen eingestellt habe, die durch die Vorstellung vom Kontakt nackter Fußsohlen und Zehen mit rauher Baumrinde bewirkte körperliche Veränderung stelle für ihn im Rückblick jenen Moment dar, da er zum erstenmal die äußere Welt wahrgenommen habe über die unmittelbaren Bedürfnisse oder Ängste des Kindes hinaus.
Für den auf der Wiese sitzenden, den fremden Kindern zuschauenden Jungen habe sich die Welt so in Subjekt und Objekt aufgeteilt und fortan sei sie nicht mehr allein zwischen die bisherigen beiden Pole der eigenen Aufmerksamkeit, dem Gesäß und den Genitalien, eingespannt gewesen.
Die Titelfindung Notizen auf einem Kamel (NAK) deutet eine Wahrnehmungsposition an, die oberhalb der menschenüblichen Perspektive liegt. Beim Lesen der Gedichte des Bandes fällt demgegenüber jedoch auf, daß die wahrnehmende Figur (die Figur, die „ich“ sagt) kaum eine solche Position einnimmt: Weder imaginiert sie zum Beispiel den Blick aus der Perspektive eines Vogels, noch werden Eindrücke, die von der Straße in die offenkundig in einem der oberen Stockwerke liegende Wohnstatt der Figur dringen, als visuelle Eindrücke dargestellt: Der Autoverkehr am Morgen zum Beispiel wird nicht beobachtet, sondern gehört.
Die im Titel signalisierte Perspektive scheint, wiewohl die Formulierung sich in einem Gedicht findet, weniger einen beispielhaften Hinweis auf die Wahrnehmungsposition der Figur in den Gedichten zu geben, als daß sie eine zusätzliche, auf die gesamte Sammlung von Gedichten bezogene Ebene der Wahrnehmung markiert.
In den Gedichten erscheinen, als Anordnung in der Vertikalen, vielmehr deutlich drei räumliche Bereiche, die durch Maße und Verrichtungen des Menschen voneinander abgegrenzt und bestimmt werden. Erstens der Bereich, auf den gerichtet der Mensch den Kopf aufrecht halten oder gar heben muß: festgemacht etwa an den Baumkronen, dem Vogelflug, dem Himmel. Zweitens der Bereich, in dem die Hände des stehenden oder sitzenden Menschen hantieren oder ruhen: ablesbar an Tisch, Anrichte Waschbecken und Armaturen. Drittens der Bereich, in dem sich die Füße befinden, zuallererst das Parkett und das Straßenpflaster, doch auch, im Liegen, die Matratze, das Bettlaken, oder, bei hochgelegten Beinen im Sitzen, die Stuhl- oder Schemelhöhe.
Innerhalb dieser dreiteiligen vertikalen Ordnung von Körperbereichen und Gegenständen allerdings werden in den Gedichten gravierende Abweichungen einzelner Elemente markiert, kommt es zu auffallenden Verschiebungen der räumlichen Beziehungen, „ein Kilo Privatwelle so / stand oder lag ich kopfunter / was mir die Qualen nahm eines Alleinseins“ („unsere Töchtersöhne in den Papiertaschentüchern wären jetzt dreißig“, NAK, S. 108).
Er habe bemerkt William Faulkner hinsichtlich der Komposition von The Sound and the Fury, die Wahl vier verschiedener Perspektiven darum getroffen, weil es ihm bei diesem Roman in erster Linie um ein plötzliches Bild gegangen sei. Dabei handele es sich um ein Mädchen, das als einzige von mehreren Geschwistern den Mut gehabt hat, auf einen Baum zu klettern, um durch ein Fenster ins Haus schauen zu können und den unten stehenden Jungen von einer dort abgehaltenen Trauerfeier zu berichten. Während das Mädchen die Vorgänge im Innern des Hauses beobachtet, können ihre heraufblickenden Brüder, aus deren Perspektiven der Roman erzählt wird, die mit Bodenstaub oder Lehm behaftete Unterhose unter dem Rock der Schwester sehen. Um dieses Mädchen nicht vordergründig hübsch und rührend erscheinen zu lassen, habe er entschieden, es mit den Augen anderer zu sehen.
Stärker als Körperteile und -partien wie etwa die Hände oder der Kopf erscheinen in Friederike Mayröckers Arbeiten die Füße erotisch besetzt. Dies gilt für die Beobachtung an anderen Menschen, etwa jungen Verliebten:
in der Bahn dann die beiden
Poussierenden, das
poussierende junge Paar…
des Poussierens vor aller
Welt vor aller Augen nicht müde werdend…
Fuß an Fuß, Fuß über Fuß,
Fußschale, -bank
(„beim Hinwegfegen der Abbilder, oder nach dem Besuch der Ausstellung ,Palastmuseum Peking Schätze aus der Verbotenen Stadt‘“, WG, S. 53).
Ebenso ist der Fuß zentraler erotischer Körperteil im Rahmen erotischer Szenen zwischen der Figur und einem Gegenüber, beispielhaft deutlich in während die Fußspuren : Füße auf dem Boden zurückbleiben, wo die Nennung der Füße Ausgang für eine Aufwärtsbewegung vom Fußboden hin zur Körpermitte ist: „Er lockert mir die Schuhriemen, streift mir den Schuh vom Fuß, liebkost meinen Fußknöchel Sohle und Rist, streicht behutsam aufwärts, zum Knie und darüber hinweg, beide Arme keuchen“, und, weiter unten, wie schon im Straßenbahnbild des jungen Paares verbunden mit einer auffälligen Veränderung der räumlichen Relation von Körperpartien zweier Menschen zueinander:
ich stehe mit meinen nackten Füßen auf seinen nackten Füßen, wir torkeln im Zimmer, wie er standhält. Die Decke lichtet über unseren Köpfen, eine Beschlafenheit: Paß- oder Bärenritt, -tritt oder -gang. Eiskufen Liebeskufen auf dem Parkett
(MB IV, S. 30–33; 31).
Doch der Fuß muß nicht enthüllt werden, nicht nackt sein. Das erotische Moment kann auch auf den den Fuß umschließenden Schuh übertragen werden. Der Schuh kann zum Fetisch werden, oder das Hantieren am Schuh stellt einen Liebesbeweis dar:
du schnürst
mir den Schuh das Glück ich weine lange
mit eigener Hand
schnür ich ihn nie wieder auf
(„finest gold eyed sharp“, DBA, S. 70).
Eine solche Handlung erfordert nicht nur, daß das Gegenüber Hände und Kopf auf den Fuß der Figur hinbewegt, eine Abwärtsbewegung macht und eine Abweichung des Verhältnisses von Körperpartien zueinander herbeiführt (ein erotischer Zusammenhang, in den mitunter das Bild von Gesten wie der Fußwaschung oder des Pantoffelkusses hineinspielt), sondern das Gegenüber nähert sich auch dem Boden, geht aus eigenem Antrieb die Gefahr ein, mit Schmutz in Verbindung zu geraten, da Fuß und Schuh sich in dem Bereich befinden, der dem Unrat am nächsten liegt:
Der infame Fuß steckengeblieben im Kot, ein Röllchen Kot war im Schuh
(„während die Fußspuren : Füße auf dem Boden zurückbleiben“, MB IV, S. 30–33; 32).
Trotz gelegentlichem Widerspruch und deutlicher Belege für die Annahme einer zumindest mehrschichtigen Textentwicklung ist William Faulkner nicht müde geworden, als Auslöser für The Sound and the Fury den Anblick einer Unterhose zu nennen, die nicht sauber ist, weil das mit ihr bekleidete Mädchen kurze Zeit vorher auf dem staubigen oder lehmigen Boden gesessen hat. Die Eindrücklichkeit dieses Bildes, die Obszönität liegt einmal an der Sichtbarkeit der Unterhose selbst, dann am daran haftenden Lehm. Sichtbar wird die Unterhose hier selbstverständlich erst dadurch, daß das Mädchen auf den Baum klettert – doch wäre die Wirkung vielleicht kaum so ausgeprägt, wäre die Unterhose zum Beispiel aus der Perspektive am Boden liegender Beobachter am aufrecht stehenden Mädchen erblickt worden.
Die Heftigkeit des Anblicks rührt auch aus der erfolgten Positionsveränderung, der Verschiebung von Körperpartien zueinander: Die dem Hüftbereich zugeordnete Unterhose befindet sich hier in einem Bereich, der oberhalb der Beobachterscheitel liegt. Der Übergang zum Mannesalter ist, neben dem Erreichen der Geschlechtsreife und der Geschlechtszuordnung innerhalb der Gemeinschaft, mit körperlichem Wachstum verbunden, und dies zieht eine Veränderung der Perspektive nach sich, bedeutet eine Erhöhung der Wahrnehmungsposition. Zugleich steht er auch in einem Zusammenhang mit der Anerkennung von Positionen und Beziehungen der Körperpartien im Raum und zueinander.
Erwachsenwerden zeigt sich unter anderem daran, daß sich ein Mensch im häuslichen Rahmen nicht länger auf den Boden setzt, sondern auf einen Stuhl. Es ist dem Kleinkind vorbehalten, den eigenen Fuß in den Mund zu nehmen, ohne damit Peinlichkeit zu erregen, und der Erwachsene vertauscht die Position der Füße mit der des Kopfes vor anderer Augen lediglich in dafür geschaffenen Zusammenhängen, wenn er sich sportlich oder artistisch betätigt, oder sofern er, mit einem Handstand, in einem Spielgerüst kopfüber hängend, sich vor Kindern demonstrativ auf die Ebene eines Kindes begeben will.
Ein Erwachsener legt, will er in Gegenwart von Erwachsenen die Anerkennung als Erwachsener erhalten sehen, zum Beispiel die Füße nicht auf einen Tisch, und auch der Kopf signalisiert, sofern er auf der Tischplatte zu ruhen kommt, daß ein Mensch die ihm anstehende Selbstbeherrschung verloren hat, sei es, daß er betrunken oder eingeschlafen ist.
Hier wird, selbstverständlich, zuerst einmal die Hygiene (der Straßenkot, die Läuse) eine Begründung sein, doch die Verletzung der festgelegten Zuordnung von Körperteilen im Raum macht den Verstoß gegen die Erwachsenenordnung augenfällig.
Eine 1979 erfolgte Vorabveröffentlichung aus Die Abschiede (DA) trägt den Titel „Das Beklopfen einander des Grashüpfers“. Diese Wortfügung findet sich, im Zusammenhang einer erotischen Szenerie, 1989 erneut, im Prosatext „erste Liebe“: „Er erdrückt sie beinahe (das Beklopfen einander des Grashüpfers). Die große den Arm miteinbeziehende Liebesstudie, fortlaufende Passion.“ (MB III, S. 9–12; 10), und in der Prosa „Stilleben“ (S. 30) von 1991. Ein 1992 entstandenes Gedicht hat dieselbe Formulierung zum Titel, hier ist damit eine auf das Verhältnis des Kindes zu den Elternfiguren verweisende Erinnerung überschrieben.
In einer der als „Das Beklopfen einander des Grashüpfers“ vorveröffentlichten Passagen aus Die Abschiede beobachtet die Figur das auf dem Fußboden kauernde Gegenüber dabei, wie es ein Plakat in der anderen Zimmerecke betrachtet. Die Abbildung wird beschrieben, ein Plakat, „welches einen schönen dunkellockigen Jüngling in altertümlicher und bunter Tracht darstellte, der, inmitten ländlicher Gegend, mit Schreibmappe und Federkiel ausgestattet, wie sinnend auf einem Viereck-Stein sitzt und dessen Hand den Kopf stützt während die andere zum Schreiben ansetzen will“ (DA, S. 97)
Die Abbildung selbst gibt den Schutzumschlag von Die Abschiede ab. In ihrer Beschreibung imaginiert die Figur diese schwarzweiße Zeichnung allerdings als farbig. Dieser junge Mann, heißt es, „trug scharlachfarbene Kniestrümpfe die an den Rändern, in der Mitte der Waden, locker umgeschlagen waren und weiche Falten warfen – ein düsterrotes Gilet, darunter ein lichtblaues, offenstehendes Hemd, zu dunkelblauen Hosen, die unterhalb des Knies bündchenartig abschlossen“ (DA, S. 97).
Der unter freiem Himmel sitzende junge Mann erscheint der Figur als „das idyllische Bild eines Dichters in Schäferstimmung“ (DA, S. 97). Daneben wird der Blick des Gegenübers beschrieben als „auf einen glühenden Körper, oder auf eine Flamme gerichtet“ (DA, S. 97). Da die Figur sich selber als Dichter charakterisiert, scheint sich der Blick des Gegenübers auf ein Abbild der Figur, auf einen Stellvertreter zu richten. Und zugleich mag die Figur, während sie das Gegenüber beim Betrachten beobachtet, im abgebildeten jungen Mann einen Stellvertreter des Gegenübers erblicken.
Nicht die damit gar nicht zwangsläufig verbundenen Laute oder die ebensowenig erforderliche Nacktheit, vielleicht nicht einmal die Beobachtung von Berührungen, sondern die Lage von Körpern im Raum, die Körperstellung und -haltung mögen das in erster Linie verwirrende Moment sein, wenn ein Mensch (für ein Kind kann es Erschrecken sein, für einen Erwachsenen Peinlichkeit) unbeabsichtigt Zeuge einer erotischen Szene zwischen zwei anderen Menschen wird.
Indem zwei Menschen eine Abweichung ihrer räumlichen Beziehung zueinander herbeiführen und indem sie gemeinsam ihre Position im Raum auffällig verschieben, kann ein deutliches Signal von Intimität gegeben sein.
Im Bereich der Zuordnung wäre dies zum Beispiel die Nähe zweier Körper zueinander jenseits der konsequenten vertikalen Anordnung menschlicher Gliedmaßen, jenseits der zwei den Boden berührenden Fußpaare: Zwei beieinander stehende Menschen ergeben ein anderes Bild als zwei Menschen, die beieinander liegen, zwei Fußpaare nebeneinander auf dem Boden ein anderes Bild als das eine Paar Füße auf das andere gesetzt.
Im Bereich der räumlichen Lage läßt sich dies besonders augenfällig innerhalb des häuslichen Rahmens festmachen, etwa am Körper auf dem Tisch, an den zwei Körpern auf dem Boden. Nicht nur durch Berührung, Mimik und Lautgeben, sondern allein durch die absichtliche Veränderung der räumlichen Beziehung zu einem Gegenüber kann zudem ein Mensch den Wunsch nach Intimität signalisieren.
Anstelle der Verlagerung des eigenen Körpers können auch Gegenstände Signal bestehender oder gewünschter Intimität sein: Sobald ihr räumliches Verhältnis zu einem Gegenüber einer auffälligen Abweichung unterworfen wird, mögen Dinge, die deutlich einer bestimmten Körperpartie zugeordnet sind, eine intime Atmosphäre herbeiführen oder einen intimen Rahmen abstecken, sei es nun in beiderseitiger Übereinkunft oder in einseitiger Deutung und daraus erfolgender Reizung: Das ist als Beispiel für ersteres der Schuh auf dem Tisch, aus dem getrunken werden soll, das ist als Beispiel für letzteres die Unterhose, die nicht im Wäschestapel, auf Hüfthöhe, zu einem Fetisch wird, sondern in Augenhöhe, auf der Wäscheleine.
Im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel „Übergänge zum Mannesalter“, die in Reaktion auf die Pariser Maiunruhen konzipiert worden sei, schreibt Michel Leiris Ende der sechziger Jahre im vierten Band seiner Autobiographie Die Spielregel, Wehlaut, habe er unter anderem die Einrichtung einer Vitrine übernommen, die, „in ihrer Sprache mit nicht diskursiver Rhetorik – wo die Dinge lauter sprechen als die Wörter“, anhand von Dokumenten und Kommentaren das Leben von Menschen darstellen sollte, die „auf skandalöse Weise die Normen verletzt haben“.
Eine Auswahl der Gegenstände und Erscheinungen, die sich, nachvollziehbar oder überraschend, in Das besessene Alter (DBA) und in Notizen auf einem Kamel auf dem Boden finden: „vielleicht der Widerschein eines roten/ Unterhöschens auf dem Fußboden in meiner Schlafkammer usw. / und mit roter Farbe Fetzen von Zeit also / RAGTIME und auf dem Fußboden“ („Vervielfältigungen eines Gefühls“, DBA, S. 82), „der Abdruck des nassen Fußes auf dem Parkett“ („beim Anhören einer Gambenmusik von Diego Ortis“, NAK, S. 28), „die lumpigen / Schuhe unter dem Schemel, der struppige Plastikkorb, die fingierte / Japansonne. Ein grüner Faden läuft / mitten durchs Zimmer, der Fuss TURBAN : gelbes / Frottee Handtuch um Vorfuß geschlungen, Ferse frei“ („in den Milchgärten des Traumes, oder drei Zeilen Giordano Bruno“, NAK, S. 114), „der Stengel einer Kirsche im September? / (auf dem Fußboden neben den Winterpantoffeln)“ („Liebesgedicht unausgesprochen“, NAK, S. 67), „Seitenteil des Medikamentenkartons / der unter dem Konzertflügel verrottet“ („bloody Mary“, NAK, S. 97), ein paar braune zertretene Käfer / auf dem Parkett maliziöse Geknirsch“ („ob Flügel ob Vogel“, DBA, S. 37f.; 37), „das Register auf dem Fußboden“ („passim“, NAK, S. 45), „ein Buchstabe plötzlich aus meinem Namen / fällt zu Boden ich sehe ihn fallen, verschwinden –“ („Proëm auf den Änderungsschneider Aslan Gültekin“, NAK, S. 10).
Von den zwei am häufigsten erwähnten Lebensmitteln in Notizen auf einem Kamel, Honig und Milch, ist der Honig räumlich dem Bereich zwischen Tisch und Kopf zugeordnet, der Bewegung zwischen Taillenhöhe und Mund.
Folgt man dem Honig über einige Gedichte hinweg, erweist sich diese Verbindung als nachvollziehbar: „der erste Biß in den Honig am Morgen“ („für Georg Kierdorf-Traut“, NAK, 24) und „im Boom der Gefühle : der erste Biß in den Honig am Morgen“ („solch Schnee und Biß und Augenmolkerei“, NAK, 25) führen hin zu „mein Honigtisch tropft“ („Leibes Genie“, NAK, 35) und „am Honigtisch am Morgen“ („,ich schreibe dir ins Jenseits‘ (Maria Lassnig)“, NAK, 53), wobei sich die Wortfindung „Honigtisch“ aus dem Frühstück und dem Ort seiner Einnahme ergeben zu haben scheint: „die Heimatkeule : die Honigkeule / auf meinem Frühstückstisch“ („das GRAVE im Fenster“, NAK, 54) und „der honigverklebte Tisch“ („Hiob XXIX“, 2–6, NAK, S. 70).
In keinem Gedicht taucht der Honig oberhalb des Figurenscheitels oder unterhalb der Tischkante auf. An einigen Stellen jedoch findet sich im Umkreis der Honigerwähnung ein Verweis auf äußere Extremitäten, sei es im weiteren Zusammenhang des Gedichts oder in direkter Nachbarschaft zum Honig: Leibes Genie schließt mit den Versen „mein Honigtisch tropft, die braune Sandale / imitiert die Ungestalt meines linken Fußes“ (NAK, 35), der vollständige erste Vers von „,ich schreibe dir ins Jenseits‘ (Maria Lassnig)“ lautet „am Honigtisch am Morgen Tatzen so scheint es“ (NAK, S. 53), und „das GRAVE im Fenster“ setzt ein mit dem Vers „Tatzen so scheint es“ (NAK, 54), eine Fügung, die sich zusätzlich auch in passim findet (NAK, S. 45).
Anders als der Honig aber, der, sofern er sich nicht aufgrund der Schwerkraft, tropfend, in einer Abwärtsbewegung befindet, stets ausschließlich in eine Aufwärtsbewegung gebracht wird, zum Mund hin, anders als der Honig also erscheint die Milch in den Gedichten erstens nicht im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme, wird sie zweitens kaum Orten, Gefäßen oder räumlichen Positionen zugeordnet, die üblichem Gebrauch oder üblicher Lagerung entsprächen, sondern drittens mehrfach auf auffällige Weise in eine Abwärtsbewegung gebracht, wird sie, sei es versehentlich oder, eigentümlicherweise, absichtlich, verschüttet, ausgeschüttet oder ist, da sie genannt wird, bereits auf dem Fußboden ausgegossen, etwa: „Milchreste in den Papierkorb / warum auch nicht“ („Landschaftlichkeit eines Weihrauchkegels“, NAK, S. 17), „während der Estrich im sonnenüberfluteten Gehäuse / mit weißlichen Sternen übersät, die verschüttete Milch“ („eingeäscherter Frühling“, NAK, S. 33), und „SOMA: Jugendwäsche oder / Stück Milch auf Küchenboden“ („Fußnoten“, NAK, S. 111).
Indem die Figur Milch auf den Boden schüttet, ordnet sie sie zum einen Staub, Unrat und achtlos hingeworfenen Gegenständen zu, zum anderen wird die Milch so in die Nähe der erotisch besetzten Füße gebracht. In „nach Sappholektüren (und Gennadij Ajgi) / Fingerknöchel Jasmin und fragmentarischer Eros“ (NAK, S. 115) wird dieser Zusammenhang entworfen: „die bescheidenen / Füße wie sie aus dem Becken mit dem viel zu heißen / Wasser zurückweichen und sich nebeneinander in ihre Fußmulden / krümmen auf verschimmeltem Dielenboden“, und sieben Verse später heißt es: „DAS KÄLBERNE sagt Mutter DAS KÄLBERNE den Dielen- und / Bretterboden tränkt mit den nassen Umrissen eines Kalbes“, dann: „milchig verwest“.
Die Figur schüttet Milch auf den Boden ebenso, wie sie Speisereste auf den Boden spuckt, zum Beispiel in auf dem Kokosläufer das Sputum, oder Vorfrühling tobt:
Sturm der knarrenden Flügel, der Häute: gelbe papierdünne
Häute verspuckter gespuckter Klementinengehäuse samt Kernen
vertrocknete Häute von Früchten auf schmutzigen Bohlenbrettern
auf den Kokosläufer des Küchenraums gespuckt gesputet
(NAK, S. 119).
Auf dem Fußboden befindliche Nahrungsmittel und Fäulnisprozesse erscheinen im Gedicht in nächster Nachbarschaft zueinander. Begrifflich als Abwärtsbewegungen gefaßt, signalisieren sie Gesten der Geringschätzung und Abfälligkeit gegenüber sich selber und gegenüber anderen. So in „Hausaltar : Hieronymus Bosch“:
auf dem Boden der Fliesenküche zerquetschte Beeren
in der Flickkiste die nach Tabakrauch stinkende ausgebesserte Wäsche,
das feucht verquollene Strumpfzeug : 1 verfaulte Birne
zum Geschenk gemacht der Näherin vor 1 Woche –
(NAK, S. 123).
Zum einen erscheinen das Verschütten von Milch und das Ausspucken als Ausdruck von demonstrativer Nachlässigkeit, zum anderen haben die mutwilligen Auswürfe auf den Fußboden die Qualität obszöner Gesten, obszön, auf offener Szene, vor aller Augen. Dieses Moment der Obszönität überträgt sich auch auf vorgefundene Lachen und Abwärtsbewegungen außerhalb des häuslichen Rahmens, selbst wo diese weder Resultat einer obszönen Geste noch einer Nachlässigkeit in hygienischen Dingen sind, im Gegenteil: „und wie die weißliche Waschlauge : Laugenschlange ich meine / ausgegossen über den Bürgersteig, nach unten züngelnd / nach unten wie Rinnsal (Zote), unendlicher / FADENSCHEIN“ heißt es in „BROTWOLKE, nach Karla Woisnitza“ (NAK, S. 99).
Abwärtsbewegungen stellen in Friederike Mayröckers Arbeiten Gesten und Anzeichen des Verstoßes gegen die vertikale Aufteilung dreier Körperbereiche und der ihnen zugeordneten Handlungen, Gegenstände und Sphären, die Veränderung räumlicher Beziehungen markiert ein mutwilliges Abweichen von der geltenden Ordnung.
Zusätzlich signalisieren sie auch Bewegungen auf ein Ende dieser Ordnung hin: In den Umkreisen von Niedergeschlagenheit, Zugrundegehen und Untergang geben sie Verletzungen, Altern, Vergänglichkeitsbewußtsein und Todesahnung eine Richtung. Dies zeigt sich an am Boden liegenden Gegenständen, die von der Figur dem menschlichen Alter zugeordnet oder als Todeserscheinungen imaginiert werden, etwa: „auf dem Boden / ein altes angebissenes Stückchen Brot / Greisen- / laut, grau“ („Schwärmer etcetera aus dem Ungarischen“, WG, S. 86), „da liegt / der Kopf auf dem Boden / rosa lila und gelb Stiefmütterchen- / kopf plattgedrückt… Totenkopf: aus einer Bodenritze mit starrem / Auge blickt er mich an“ („lieber Bräutigam, Nervenschnee“, WG, S. 28) und „ein Totenkopf am Straßenrand aus Stanniol“ („Proëm auf den Kopf eines Klassikers, für Hans Mayer“, NAK, S. 105f.; 106). Die Figur selbst vollzieht eine Abwärtsbewegung: „Kopf nach unten geklappt, fresse / Staub“ („Kurskorrektur“, NAK, S. 112), hat sie bereits vollzogen: „mich flieht der Schlaf / ich hocke auf dem Boden mit angezogenen Beinen… ein junger Dichter schreibt mir / ob ich ebenso oft wie er daran denken muß / daß wir allein sterben / aus meiner rechten Nase sickert das Blut“ („,die Scherben eines gläsernen Frauenzimmers‘ (Carl Einstein)“, DBA, S. 103), oder sieht das eigene Zugrundegehen voraus:
irgendwo hinter obskuren Gardinen
stehen sie schon zusammengerottet hämisch grinsend ohne Erbarmen
warten auf meine endgültige Niederlage
und daß ich hingestreckt auf dem Erdboden darniederliege
(„hineinversäumte hineinversäumende Nacht“, NAK, S. 94).
Wo in den Gedichten Menschen erscheinen, die kurz vor, mitten im oder kurz nach dem Übergang zum Mannesalter stehen (Kinder also, Halbwüchsige, Jugendliche, junge Männer und Frauen), beobachtet die Figur an ihnen eine gewisse Grobheit, Heftigkeit des Auftretens, aggressive Vitalität: „zwei Burschen handtellerklatschend (,roh‘?)“, heißt es in „Quell der Erbarmung / Paulanerblume“ (NAK, S. 100).
Bewegungen und Laute von Kindern und Jugendlichen führen zu militärischen Assoziationen: „Nachwuchs mit unüberhörbaren wenngleich / unverständlichen Kehllauten, sie / marschieren ins nächste / Robinsonland, schnalzen dann mit den / Zungen, Stoppelrevolvern“ („das eine Auge verdeckt von China“, WG, S. 51f.; 51), und:
unter den laufenden Schuhen nicht wahr
in den U-Bahnschächten das Klappern der Frauenschuhe
das bedrohliche Hacken das heftige Ausschreiten junger Männer
mit eisenbeschlagenen Absätzen (,Stechschritt‘)
(„Nachtpost“, DBA, S. 85ff.; 86).
Die Lautstärke der verursachten Geräusche und mitunter unartikulierten Äußerungen gerät mit fortschreitendem Alter offenbar in einen Zusammenhang mit der Ausstrahlung demonstrativer Sexualität:
die
jüngsten, zwischen den Strähnen, die Lüfte, auch Gestöhn Häusergezücht,
jung caramelfarben die Schultern der Söhne : imaginäre Schmeichler
(Chimären)
(„schöner Brunnen, Schönbrunn“, WG, S. 100f.).
Ebenso das Auftreten, die Kleidung, die zugeordneten Gegenstände: „Chitin zotig der brüllende Kumpel / in schwarzer Lederkluft“ („Todes Auffassung / für Andrea Zanzotto“, DBA, 113), und, eine Inszenierung der Männlichkeit, in „lärmgewaltiger Schwärmer“ (WG, S. 55):
so lang war die Stimmung so
doppelt bedient die Maschine (kalt)
ein Cape ein Käppi ein
roter Knall, der Bräutigam seine
Braut ist HONDA, Taille Flanken Brust-
wölbung alles vorhanden Schenkelreibung und
Herz
Die Unsicherheit der eigenen Geschlechtszuweisung führt bei den Halbwüchsigen zu einem umso heftigeren Erproben der Selbstdarstellung als geschlechtliches Wesen: „die Allerjüngsten bereits / mit Mode-, Marottenhaarschnitt, / das Affen-, das Ärmelfutter gestreift / der Damenjacketts bis zum Ellbogen aufgekrempelt“ („perforiertes Gelände“, DBA, S. 77), „und eingewindelt in ihre Miniröcke Bermudashorts / die jungen Frauen hochstöckelig behindert“ („Zeppelin oder Tropfen solch Formgeschöpf“, DBA, 78), und:
(Wonnefiguren der halben weiblichen
Kinder : leisten sich übererwachsenes
Schlendern, galantes Gleiten überbauschter
Hüftregion : die geräumigen Bündchenhosen, jenes
gnädig-gelassene Senken der Lider, gelangweilte
lässige Schwenken der Augen – desparater Sprach-
gebrauch, kontaktverdrossen, oder -versessen je nachdem, die
Erscheinungen sind mannigfaltig)
(„Abruf Knochen-Werk“, WG, S. 133ff.; 133).
Die Figur scheint angesichts solcher Beobachtungen in der Öffentlichkeit eine Distanzierung vorzunehmen, sie erscheint erschreckt oder zumindest verwirrt. Zugleich sieht sie sich von solchen Szenen und Bildern angezogen, ohne aber die Position eines Voyeurs einzunehmen, sich an der unbeholfen demonstrativen Geschlechtszuweisung oder -äußerung zu delektieren.
An anderer Stelle heißt es vielmehr distanzierend:
greise Onkel behaupten grinsend ENTFÄLLT
EINEM MÄDCHEN EIN GEGENSTAND, FALTEN DIE KNIE, DIE SCHENKEL SICH AUTOMATISCH AUF,
DIE BURSCHEN HINGEGEN SCHNAPPEN DABEI DIE SCHENKEL ZUSAMMEN –
(„Seepurpur, Monika Köhn“, DBA, S. 153f.).
In einer davon völlig verschiedenen Bewegung stellt die Figur angesichts ihrer Beobachtungen Parallelen zu sich selbst her und markiert sich in deren Umkreis heftig als sexuelles Wesen, als vollziehe sie die Erprobung der Geschlechtszuweisung im Übergang zum Mannesalter nach.
Auf den im Gedicht „Abruf Knochen-Werk“ in Klammem gesetzten Einschub folgt im weiteren Verlauf die Erinnerung an eine erotische Szene („wie damals : nicht einmal dieses warteten wir ab, ins / Innere des Hauses zu gehen, sogleich an der Eingangs- / tür fielen wir übereinander her, verbissen uns in / einander“), und ihm voraus gehen die zwei Verse: „automobile Fontäne nein brüllendes Kotz-Angebot / das Ausstoßen unerfahrenes Rülpsen der Seelen“. – Wiederum heftige Äußerung, Grobheit, wie sie an anderer Stelle von der Figur ähnlich in bezug auf sich selber erscheint: „das Spucken das Rülpsen das Masturbieren / die Sprüche oder Maximen am Morgen“, einige Verse weiter gefolgt von dem Einschub „(Päderast oder Kampfbonbon)“, woraufhin, noch einige Verse weiter, „ein Mädchenlachen im Hintergrund / des Straßenbahnwagens“ erscheint („etwas Kinder / oder / mehr ist nicht zu sagen / oder Versuch Inger Christensen und Andrea Zanzotto miteinander verknüpfend“, DBA, 94f.; 94).
Und wie ein aufgeschnapptes Wort verwendet die Figur einen Begriff aus dem Zusammenhang erster Liebe, der ebenfalls mit Aggressivität und Lautstärke besetzt ist: „verknallter / Junge (,bist wohl verknallt, oder was?‘)“ („die wetterleuchtenden Stimmen“, NAK, S. 63), und in dem Bild: „konstant tomatenrot zerknüllt / verknallt : verknalltes Herz / und Wangenrot auf der Kredenz die rote Stoffserviette“ („Anrichteschrank, Stilleben am Morgen“, NAK, S. 87).
In Friederike Mayröckers Arbeiten gibt es zahlreiche Momente einer Aufweichung, Veränderung oder Aufgabe der Geschlechtszuweisung. Dies kann auf der Ebene des Vokabulars stattfinden, das die Figur zur Selbstbeschreibung verwendet, zum Beispiel in Findungen wie „vergröberte Männin“ („von Lebens Tatzen“, DBA, S. 51) oder „(scheintüchtiger) Hausmännin Pflicht“ („Gründonnerstag 91“, DBA, S. 145ff.; 145), und, als eines der zentralen Motive in Reise durch die Nacht, die Formulierung:
Maja sei Burschin, Majo Bursche
(S. 9).
Es können Frauen als Männer bezeichnet oder beschrieben werden, wie „grüße / negroid gekrauste Mongolin mit / GUTEN ABEND MEIN HERR“ („1 desolater Flieder“, NAK, S. 104) und „Ein Mädchenkellner, nein – nicht Kellnerin – ein Mädchenkellner / spricht mich an oder lacht über mich“ („drei Traumwahrheiten oder : kein Wort mehr über Träume“, WG, S. 94–99; 95).
Vorstellungen, Darstellungen von Androgynität tauchen auf: „die sternige Frau gezeichnet (astray), die Frau / als sechszackiger Stern (androgynes Gestirn : mit / geöffneten Armen und Beinen, hoher Schädeldecke, imaginärem Glied – / Moustache im Himmel“ („süß ist das / tritt es ein, zwischen lüften und bedecken“, WG, S. 64f.).
Der Geschlechtswechsel kann imaginiert oder vorgenommen werden, „weil du kannst selber / alter Mann / sein weil ich kann selber / alter Mann sein“ („polyphone Spur“, NAK, S. 91), ebenso ist ein Geschlechtertausch möglich, zum Beispiel als zentrales Moment im Hörspiel die Umarmung, nach Picasso (MB II, S. 104–120). Nicht nur, daß die Figur eine hohe Aufmerksamkeit für den männlichen Bartwuchs hat und dieses Phänomen beschreibt, als erblickte sie es als junger Mann an sich selber, wie etwa in „Mannesalter : plötzliches Stoppelfeld“:
zerborsten kleiner stacheliger ich
mein blitzender zarter Kinnbart, zum
erstenmal sah ich den blonden
Ursprung von Flaum
(WG, S. 128).
Es finden sich auch Momente, da die Figur sich selbst mit einem Bart sieht, sei es, daß sie – ein Fleck, ein Schatten – dieses männliche Merkmal imaginiert oder sich tatsächlich zuschreibt, zum Beispiel:
Das schiere
Vagabundieren, die Vagabondage im eigenen Körper im eigenen Kopf. Dies
Armesünder Eckchen des Leibes, auf der rechten Wange ein Bart
(„die Knöchel der heiligen Anna, oder kirschrotes Krepp Papier Werk“, NAK, S. 86).
In der Öffentlichkeit, in Gegenwart anderer gilt das Ausspucken als eine männliche Geste: die Markierung des Reviers oder eine Abfälligkeit. Auch wenn die Figur allein im eigenen häuslichen Rahmen ausspuckt, geht dies, anders als vielleicht ähnliche Verrichtungen, die ein Mensch unbeobachtet vornimmt (wie zum Beispiel das Nägelschneiden) doch über das Ausspucken etwa beim Zähneputzen hinaus, bekommt es einen demonstrativen Zug dadurch, daß es von der Figur an sich selbst beobachtet wird.
Wenn die Figur auch nicht in Gegenwart eines Beobachters ins Becken oder auf den Boden spuckt, diese Geste aber, im Unterschied zu anderen, vermerkt, so erscheint das Ausspucken als eine Übung in Männlichkeit: Was damit vor dem Leser und eben auch vor der Figur selber als männliches Verhalten signalisiert wird, kann gleichermaßen als Identifizierung mit einem Mann wie auch als Ausdruck der Identität eines Mannes verstanden werden.
In Friederike Mayröckers Arbeiten findet sich der Verweis darauf, daß die Geschlechtszuschreibung zur Disposition stehe oder aufgehoben sei, auffällig häufig im Umkreis der Nennung von ausgeworfenem Speichel und von Nahrungsmitteln auf dem Fußboden. Letzteres etwa in übergangsloser Verbindung in déjà-vu:
keine
Trennung mehr zwischen Eigenschaften, Geschlechtern
und der staubverkrustete Fußboden wird nicht mehr gewaschen sondern
beiläufig mit Milch begossen und Mehl bestreut das ganze dann
in der Zimmerecke verscharrt
(DBA, S. 18).
Im Gedicht „Teekessel / Tunte / schwierig wie Rückenschwimmen“ (NAK, 40) hat es den Anschein, als werde die Geschlechtszuschreibung der Figur nicht durch biologische Bedingungen festgelegt, sondern mittels Gesten, Handlungen und Dingen vorgenommen. Dies geschieht im Zusammenhang zweier gegenläufiger Bewegungen, die aus entgegengesetzten Körperbereichen auf die Mitte hingehen: Aus dem Mund wird nach unten gespuckt, von den Füßen her wird die Strumpfhose hochgezogen.
Zuerst kann sich die Figur, aufgrund des Ausspuckens, als Mann begreifen:
verruchter Morgen : alles also Gespuckte im
Waschbassin
Im weiteren Verlauf des Gedichts kommt, auf die Fügung „überschwemmtes Parkett“ hin, durch den Ankleidevorgang und den dazu gebrauchten Gegenstand, die weibliche Zuschreibung zur männlichen hinzu:
schwarzer Spitzentanz jener Strumpfhosenhülle ehe sie,
übergestreift, männlich
weiblich, meine Beine umspannt
Mit dem Abschluß des Ankleidens endet die Möglichkeit einer doppelten Geschlechtszuschreibung und allein die weibliche bleibt bestehen. An diesem Punkt erscheint der Vorgang abwechselnder Zuschreibung im Rückblick wie ein Austausch von Intimitäten: „Leinenzofe Beschlafenheit“.
– die Gewißheit, plötzlich, die
Gewißheit: ICH LEBE!, und weinen
in Tränen ICH LEBE! – in der Straße
zwei Burschen handtellerklatschend (,roh‘?), in weißen
Tennisschuhen
(„Quell der Erbarmung / Paulanerblume“, NAK, S. 100).
Im Umgang mit Angst, Unsicherheit, Ohnmachtsgefühl zeigen sich in den Verhaltensweisen und Bewegungen Parallelen zwischen der Figur und Menschen im Übergang zum Mannesalter: Ein Jugendlicher mag Widerstand gegen den Übergang zum Mannesalter zu leisten versuchen und zugleich Gesten der Herausforderung eben dieses Mannesalters an den Tag legen durch ein demonstrativ erwachsenes Gebaren, durch das Zurschaustellen, Erproben einer fixierten Geschlechtszuordnung. Die Figur versucht, Widerstand gegen das Erlöschen der Lebenskraft, gegen den Verfall zu leisten, und zugleich vollzieht sie mutwillig Abwärtsbewegungen, schafft um sich herum eine Szenerie des Vergehens, indem sie etwa Gegenstände, vor allem Lebensmittel auf den Boden wirft und so demonstrativ Zerfalls- und Fäulnisprozessen ausliefert.
Parallel zu dem, was bei einem erwachsenwerdenden Menschen ein Lebensalter darstellt, das durchlaufen werden muß, versetzt sich die Figur darüberhinaus offenbar willentlich in einen für sie zeitlich nicht bedingten Bereich, in dem die Entscheidung für eines der beiden Geschlechter nicht festgelegt erscheint und als variabel dargestellt werden kann, um von dort aus die sexuelle Identität zu wechseln oder eine zweifache Geschlechtszuordnung vorzunehmen.
Dazu springt sie nicht hinter das Mannesalter zurück, sondern agiert außerhalb zeitlicher Abläufe, wodurch zum einen die Vergänglichkeitserfahrung ausgegrenzt wird, zum anderen die Intensität des Erlebens markiert. So kann die Figur verschiedene Positionen zugleich besetzen und sich in Zuständen gegeneinander verschobener Zuordnungen befinden, „das Bärtchen, sagt er, Ihr Narbenbärtchen, ein / ansehnlicher und bequemer Ort, Zebra / macht Handstand auf Tisch: unter gebauschter / Hose das aufgerichtete Geschlecht fiel nach unten das sei / deutlich zu sehen gewesen, bewegte sich dann wie eine Feder / über die Tischplatte undsoweiter“ („einkäfigen, Traum“, DBA, S. 109f.; 109).
So wie das Bild des zum Schreiben ansetzenden jungen Mannes in der Beschreibung von einer Schwarzweißabbildung zu einer kolorierten Zeichnung wird, wird auch Picassos Arbeit Paul beim Zeichnen in der intensiven Betrachtung durch die Figur zu einem farbigen Bild.
Das heißt, genau: Das einzige Detail, das im Gedicht „Picassos Bildnis eines Knaben mit braunem Haar, oder REPETITION“ eine auffällige Färbung annimmt, die über das Schwarz, über die Abstufungen des Grau und das mögliche Braun hinausgeht, ist sein Fußkleid:
die roten Fetische
seiner Pantoffel
(NAK, S. 138).
Es ist gerade jener von der Figur am stärksten erotisch besetzte Körperteil, der in der aufmerksamen Beobachtung eines versunkenen Kindes hervorsticht. Wo es in „während die Fußspuren : Füße auf dem Boden zurückbleiben“ im Umkreis der Formulierung „Diese Wippe, dieser Balanceakt : Fuß über Fuß, er hebt mich auf seine Füße“ heißt: „die Schenkel zerrissen“ (MB IV, S. 32), heißt es in bezug auf den zeichnenden Jungen: „die Schenkel gewalkt“. Es hat den Anschein, als vollziehe diese Betrachtung sowohl einer Grafik als eines Jungen eine Parallelbewegung zu der im Titel einer Sammlung von Texten zur Kunst von Michel Leiris liegenden Zweideutigkeit der Formulierung „Die Lust am Zusehen“.
Ob es sich bei den roten Fetischen um Fetische der Figur oder des Jungen handelt, ist nicht zu unterscheiden: Denn während dieses die Sammlung Notizen auf einem Kamel nach Entstehungsdatum und Position beschließende Gedicht von einer Bildbeschreibung ausgehend ein Selbstporträt der Figur darstellt, ist die Fixierung des Zeichnenden gleichermaßen unverwandt auf ein Gegenüber gerichtet: im selben Moment in sich versunken und von höchster Aufmerksamkeit.
Und so zeigen sich Unterschiede zwischen der Beobachtung eines zeichnenden Jungen und einem Mädchen auf dem Baum, zwischen dem Fetisch der roten Pantoffeln und der mit Staub oder Lehm behafteten Unterhose.
Die Figur befindet sich in der Ausgangsposition auf derselben Höhe wie der Junge, und um seine Pantoffeln betrachten zu können, muß sie den Blick senken, so wie auch der Junge den Blick auf das Zeichenblatt gesenkt hält. Das Mädchen im Baum aber wird von unten her betrachtet, in einer Aufwärtsbewegung, während seine Blickrichtung in der Horizontalen oder abwärts in der Schräge verläuft, um die Trauerfeier durch das Fenster beobachten zu können.
In beiden Fällen sind sich die Beobachteten keiner Beobachtung bewußt, in beiden Fällen erfolgt die Beobachtung durch Vertreter des jeweils anderen Geschlechts, die zudem älter als die Beobachteten sind. Voyeurismus und Obszönität der Beobachtung haben allerdings im Fall der Figur einen anderen Charakter, weil die Figur zugleich die Position des beobachteten Jungen einnehmen kann: Es sind sowohl seine wie ihre roten Pantoffeln, sie sind sowohl seine wie ihre Fetische.
Und während das Mädchen auf dem Baum in der Beobachtung durch die Fixierung auf seine Unterhose, wie die Redewendung heißt, ,mit den Augen ausgezogen wird‘, bleibt der Junge in „Picassos Bildnis eines Knaben mit braunem Haar, oder REPETITION“ bekleidet.
In brütt oder Die seufzenden Gärten (BSG) findet sich die das Gedicht auslösende Bildvorlage reproduziert (BSG, S. 271). Im Text erfolgt eine wiederholte Beschreibung, in deren Verlauf der Junge nun aber von der Figur entkleidet wird (BSG, 270ff.), wobei die „roten Pantoffeln“ als letztes „von seinen kleinen Füßen“ gestreift werden.
Die Figur hat sich inzwischen in das Bild hineinbegeben, hat sich auf den Boden gekniet und ihre Lippen an das Geschlecht des Jungen geführt. „Alles war völlig masturbiert“ heißt es, als meinte die Figur allein sich selber, doch nach dieser Bemerkung folgt eine zweite, die nicht als Korrektur oder Präzisierung zu verstehen ist, sondern als Ergänzung, Erweiterung:
ich habe ihn masturbiert
(BSG, S. 272).
Der von Michel Leiris als Kindheitserfahrung beschriebene Moment, da das Weltall nicht mehr vollständig in ihm selbst beschlossen gewesen sei und sich eine Aufteilung in Subjekt und Objekt vollzogen habe, kann von der Figur in derselben Bewegung hintergangen wie überschritten werden: Sie kann als weibliche Figur oder als junger Mann den am Boden sitzenden jungen Mann beobachten, wie er eine Abbildung betrachtet, auf der sowohl der junge Mann wie auch die Figur zu sehen sein mag. Und sie kann, als erwachsene weibliche Figur, den zeichnenden Jungen masturbieren und zugleich dieser zeichnende Junge sein, für den der Übergang zum Mannesalter in weiter Ferne liegt.
Marcel Beyer, in Gerhard Melzer und Stefan Schwar (Hrsg.): Friederike Mayröcker, Literaturverlag Droschl, 1999
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Thomas Zabka: Enzianschwermut: Glühendes hinter Verschluß
Frankfurter Rundschau, 2. 10. 1996
Franz Schuh: Anarcher Kunstverstand
Die Zeit, 4. 10. 1996
Klaus Kastberger: Boom der Gefühle
Wespennest, Heft 106, 1997
„Ich habe Verbalträume“
− Ein literarischer Kaffeehaus-Nachmittag mit Friederike Mayröcker. −
Touristenmassen quälen sich an einem schwül-heißen Julitag durch die Kärntner Straße in der österreichischen Hauptstadt. Ich bin unter ihnen, wenn auch mit einer anderen Intention, als mehr oder weniger detailgetreue Nachbildungen des Stefansdoms mit nach Hause zu bringen – ich treffe Friederike Mayröcker im Café Tirolerhof, vis à vis der Albertina. Das Café liegt zwar in unmittelbarer Nachbarschaft der Haupteinkaufsmeile, doch das Stimmengewühl dringt nicht bis dorthin.
Ich betrete das Kaffeehaus mit suchendem Blick – ist sie schon da? Aber ich entdecke die Dichterin noch nicht in der grün gepolsterten Kühle; es ist ja erst kurz vor halb fünf. Ich setze mich in eine Nische am Fenster und schaue mich um. Hat sie hier ihren Stammplatz? Und während ich noch meinen Gedanken über die passende Tischwahl nachhänge, betritt eine Dame das Café – ich weiß, das muss sie sein. Es folgt eine kurze Begrüßung, wir setzen uns – der Platz gefällt – und beginnen unser Gespräch.
Ja, ich bin ein Augenmensch, sagt sie. Sie erzählt mir von ihrer Angst, einmal ihr Augenlicht zu verlieren und somit nichts mehr wahrzunehmen. Dann könnte sie auch nicht mehr schreiben, denn sie saugt ihre Umwelt auf wie ein Schwamm, ständiger visueller Input. Das Gesehene wird sofort aufgeschrieben; ich habe ein Notizbuch immer bei mir und notiere alles. Das wird gesammelt. Ich kann mir das Sammelsurium an kleinen Zettelchen vorstellen. Da müssen sich fragile Papiertürme aus Impressionen, Wortfetzen, Sprachtrümmern und Zeitungsmeldungen in den Himmel ihres Arbeitszimmers erstrecken. Ach ja, das Arbeitszimmer; wichtig, weil sie nur dort richtig schreiben kann; da kann ich mich am besten konzentrieren. Ich frage nach der Kreidetafel mit der Aufschrift Es ist alles tabu, die dort am Fenster hängen soll. Sie sagt, das sei eine längere Geschichte. Für einen kleinen Moment befürchte ich, sie möchte sie mir nicht erzählen, aber ihre Worte unterbrechen meine Gedanken. Ich bin als achtjähriges Kind zum ersten Mal ins Kino von meinen Eltern mitgenommen worden. Und das war ein großes Erlebnis, weil ich vorher noch nie im Kino war. Und da hat es den Film Tabu gegeben. In der letzten Szene, erzählt sie, ragt eine Hand aus dem Meer, die langsam in den Fluten verschwindet. Die Leinwand wird schwarz – ein weißes Tabu leuchtet den Zuschauern entgegen. Sie sagt das so, als sähe sie dieses Tabu genau vor sich. Was auch immer das heißen mag, das weiß ich bis heute nicht. Aber das Tabu hab ich übernommen. Es fungiert bei Friederike Mayröcker zuhause als Diebstahlsicherung – ein moralisch bedacht handelnder Einbrecher ließe so vielleicht ihre Manuskripte in Frieden. Sind denn die Aufzeichnungen das Wichtigste in Ihrem Leben, frage ich. Sie nickt.
Was treibt noch zum Schreiben an, frage ich weiter. Neben der Fähigkeit zu sehen, durchzusehen, alles aufzunehmen? Sie erzählt vom ununterbrochenen Exzerpieren-Müssen. Und woraus gerade? Gertrude Stein, Jacques Derrida. Und jetzt bin ich gerade dran, Picasso-Bücher durchzusehen. Ihr lebenslanges Streben nach den Antworten anderer Menschen beeindruckt mich tief. Lebenslanges Lernen. Das möchte ich auch. Und ich nehme alles mit in den Urlaub nach Ischl. Nächste Woche fahr ich weg. Meine Bewunderung wächst weiter und ich überlege, welche Lektüre meinen letzten Urlaub begleitete, schiebe aber das Ergebnis aus Verlegenheit, es war ein Kriminalroman von Dürrenmatt, beiseite. Denn Kriminalromane gehören zur leichten Unterhaltungsliteratur – aber die ist nicht die ihre. Ich kann so was nicht lesen.
Der geplante Urlaub im Kurort bringt mich zu meiner nächsten Frage; ob Wien mal fad wird, ob man mal raus muss, aus der pulsierenden Stadt? Sie schüttelt den Kopf, energisch, wie ich finde. Haben Sie immer in Wien gelebt, also ohne Unterbrechungen, will ich wissen. Sie war zweimal für längere Zeit in Berlin, aber es zog sie in die österreichische Metropole zurück, die, wie ich erfahre, der deutschen gar nicht so unähnlich ist. Die beiden Städte haben etwas von einer gewissen Schlamperei. Oder einer gewissen Unordentlichkeit oder Legerheit. Vor allem Legerheit. Es geht alles langsamer. Sie kennt ihre Landsleute. Ich meine mich an das beschriebene Phänomen erinnern zu können: die Bedienungen in den Straßencafés schienen von dem all umgebenden Trubel keine Notiz zu nehmen. Als ich ihr meine Beobachtungen schildere, lächelt sie.
Ich bemerke die verschiedenen Schaffensphasen der Friederike Mayröcker – oft experimentierte sie mit dem Dadaismus und dem Surrealismus, aber auch ihren Lieblingsdichter Hölderlin bat sie um eine Stippvisite. Doch immer feuerten Verbalträume zum Schreiben an. Und wer ist gerade zu Besuch? Na ja, ich muss sagen, die Lektüre von der Stein hat mich schon sehr beeindruckt. Sie war mir ein bisschen zu abstrakt, aber jetzt bin ich draufgekommen, dass sie ganz großartig ist, und ich hab mich in den letzten eineinhalb Jahren nur mit ihr befasst. Sie entdeckt Gedanken und auch die Form in Steins Werken, die sie bis dahin verkannte: ein einfacher Stil, aber Mayröcker wäre nicht sie selbst, wenn auch dieser offenbar einfache Stil den Lesenden nicht mit den gewohnt gewaltigen Wortketten, den atemraubenden Assoziationen und den meisterhaften Metaphernschlangen herausfordern würde. Sie erzählt mir auch von ihrem neuen Buch, einer fast neunhundert Seiten starken Gedichtanthologie im Herbstprogramm bei Suhrkamp, dem Verlag schlechthin, wie ich lerne.
Ich lenke das Gespräch auf die neuen Medien. Schauen Sie fern, frage ich und denke mir eine Millisekunde später, warum künstlerisch begnadete Menschen dem audio-visuell strapazierenden Kommunikationsträger abgeschworen haben sollten. Nur die Nachrichten schaue ich mir an, sagt sie. Trotzdem enthielt sie sich meist jeder offensichtlich politischen Agitation in ihrem Werk; bis zu jenem Tag im September 2001, der die Welt ein Stück unberechenbarer werden ließ. Auf eine Woche nach den Anschlägen datiert – und mit dem Datum nimmt sie es genau −, entstand Aspekte der Malerei, ein poetisches Portrait von Blumenstrauss / im Milchglasfenster, von bittersüßem Schwermut in schattigen Wiener Hinterhöfen. Wenige Stunden vergehen und noch ein Gedicht entsteht, diesmal ohne Titel. Sie erzählt dort vom seligen Glücksgefühl des Gedichteschreibens – und endet so abrupt, fast hart: die / Welt zusammengebrochen. WeIche Welt da zusammenbricht, bleibt ungewiss. Eine Parallele scheint dennoch denkbar.
Sie schreibt schon eine lange Zeit, fast siebzig Jahre. Angefangen hat alles in der Wohnung der Eltern. Damals, um Pfingsten herum, ereignete sich im Hof der Mayröckers ein gar biblisches Szenario: die fünfzehnjährige Friederike blickt gerade aus dem Fenster, als ein Busch zu brennen beginnt. Das war für mich sehr symbolisch, irgendwie. Das war der Anfang allen Schreibens.
Zu jeder Zeit unterzogen allerlei Kritiker ihre Werke einer haarkleinen Prüfung. Hört man denen denn dann noch zu? Na ja, es ist ganz eigenartig. Sie erzählt von den miserablen Urteilen einer steinigen Anfangszeit. Und seit vielleicht fünfzehn Jahren gibt’s nur noch himmlische Besprechungen. Sie lacht, kann selbst den Wandel nicht begreifen, hält kurz inne und gibt zu bedenken, dass die Leute auch deshalb nicht MEHR kaufen. Aber trotz allem, sie freut sich immer über die lobenden Worte, vielleicht einer Iris Radisch, deren Nachfolge im Literarischen Quartett sie besonders schätzt. Das könnte man sich schon mal anschauen. Nickend stimme ich ihr zu.
Philosophieren beginnt mit Staunen, sagt Aristoteles. Und manchmal staunt auch Friederike Mayröcker, wenn Kritiker etwas herausschaufeln, das sie noch nicht über das eigene Werk gewusst hat. Sie findet das höchst interessant und gar nicht ärgerlich. Die Philosophie strebt nach Erkenntnis – die Literatur bisweilen auch. Und manchmal gerät die Leserin eines Gedichts ins Philosophieren. Ich versuche, die Dichterin ins Staunen zu versetzen, indem ich ihr mein Lieblingsstück interpretiere: Tonarten des Weiß aus dem Gedichtband Notizen auf einem Kamel. Ich habe die wunderbare Gelegenheit, es mit der Dichterin persönlich zu analysieren – vielleicht ein heimlich gehegter, aber innigst bejahter Wunsch aller Literaturinteressierten und Hobbyinterpretatoren – und für mich geht er in Erfüllung.
Das Mysterium der Mayröcker’schen Lyrik liegt in der Assoziation; kunstvoll webt sie ein Gedankenband, manchmal leicht und offensichtlich, manchmal dicht und unergründlich. Mancher Leser mag sich verstört nach dem Sinn dahinter fragen, aber Mayröcker will nicht verunsichern, sondern einladen in ihre Sprachwelt. Sie wünscht sich einen unvoreingenommenen Leser, der keine Angst hat, sich auf diese Reise zu begeben. Den Ausflug trete ich gerne an; mutig versuche ich es ihr gleichzutun und assoziiere fröhlich. Beim Titel des Gedichtbands sehe ich mich in eine Wüste versetzt: Ich gebe mich der rhythmisch-schaukelnden Bewegung des trittsicheren Tieres unter mir hin, um mich herum nur der Horizont, der in der Ferne zu flirren beginnt. Ich bin allein mit meinen Gedanken. Ich halte sie in einer kaum leserlichen Schrift auf meinem Notizblock fest, sinniere ich weiter. Friederike Mayröcker lächelt und lehnt sich ins grüne Plüschpolster zurück. Ja, sagt sie und macht eine Pause, es ist ganz was anderes. Marcel Beyer, ein junger Kollege, mit dem sie gut befreundet ist, schrieb ihr eine Ansichtskarte aus einem fernen Land. Darauf befand sich der klingende Satz, der sich in den Gedanken der Dichterin verfing. Und dann hab ich ihn angerufen und gefragt, ob ich das verwenden darf. Er hat mirs geschenkt, dieses Notizen auf einem Kamel. Sie lächelt wieder. Ich glaube, sie schätzt ihn sehr. Ich lächle auch und bemerke, dass wir uns nun genau in der Situation befinden, über die wir uns unterhielten: Manchmal interpretiert die Leserin mehr, als die Autorin intendiert. Wir lachen beide.
Tonarten des Weiß ist ein wunderbares Gedicht. Sie widmete es ihrer Mutter, einer besonderen Frau. Ich versuche zu assoziieren. Ich sehe eine Schneelandschaft, eine weiße Unendlichkeit, in der Himmel und Erde verschmelzen. In der weißen Weite verliert sich der Blick für alles Wesentliche; auf den Orientierungssinn ist kein Verlass mehr. Der Schnee bedeckt die Landschaft mit seinem zarten, aber eisigen Flaum. Er überdeckt Makel, die der Landschaft und die der Menschen. Er friert Gedanken und Gefühle – das Leben erstarrt. Sie mag den Schnee, sagt sie. Der Schnee in den Augen, Augenschnee, der die Sicht beeinträchtigt. EWIGEM SCHNEE. Kälte für die Ewigkeit? Abdruck der Hände im Schnee. Abdruck der Füße im Schnee. Menschen hinterlassen Spuren; zumeist unverkennbare, eindeutige Spuren. Sie hinterlassen Erinnerungen in unseren Köpfen, so authentisch wie eben der Abdruck der Hände und Füße nur sein kann. Gedichte, so Mayröcker, fungieren als auf Papier festgehaltene, gewidmete Erinnerungen, die den Menschen unsterblich machen. Das Gedicht hinterlässt Kälte, man will schwerlich an einen Lichtblick glauben, aber Friederike Mayröcker findet auch hier Worte der Hoffnung. Das Wunder lässt nicht lange auf sich warten: deine Spuren im Himmel. Der Aufstieg in den Himmel, jenem seligen Ort, an dem die immer währende Existenz gesichert scheint. Das Gedicht wirkt fast wie eine Art Dialog; denn im Klammersatz scheint die Mutter leise zu rufen.
Tonarten des Weiß ist auch ein Gedicht über das Alter, so Mayröcker. Über das Älterwerden, dem keiner von uns entrinnen kann. Es ist aber auch eine stille Entschuldigung bei der Mutter, für die Zeiten, in denen man zu beschäftigt schien, das Wesentliche zu erkennen und sich den Bedürfnissen des Gegenübers anzunehmen.
Darf ich Sie auf den Kaffee einladen, fragt sie mich, wobei sie, typisch wienerisch, die letzte Silbe des Wortes Kaffee betont. Gern, antworte ich. An unserem Tisch bemerke ich eine andere Dame, eine Freundin von Friederike Mayröcker, wie sich herausstellt. Sie bringt stapelweise Bücher mit, die Autorin muss signieren – Dichterpflichten, denke ich. Und zugleich Zeit, um aufzubrechen. Mit dem seligen Wunsch, jeder sollte die Möglichkeit erhalten, sein Lieblingsgedicht mit der Dichterin interpretieren zu können, verlasse ich die grüne Kühle des Kaffeehauses in Richtung U-Bahn Stefansplatz. Die lärmende Großstadt hat mich wieder.
Elke Muff: Frau Mayröcker, Sie sind schon als junges, 15-jähriges Mädchen zum Schreiben gekommen. Wie ging das vor sich?
Friederike Mayröcker: Ja, ich weiß. Das kann ich auch nicht sagen. Es war zu Pfingsten in der Wohnung meiner Eltern. Ich habe in den Hof hinuntergeschaut und da hat plötzlich ein Busch zu brennen begonnen. Das war für mich sehr symbolisch, irgendwie. Und da habe ich dann angefangen, mit der Hand [Anmerkung: Ansonsten schreibt Friederike Mayröcker immer mit ihrer Schreibmaschine] Prosa zu schreiben. Ein paar Jahre, genauer: zwei Jahre später begann ich dann Gedichte zu schreiben. Aber auch sehr früh. Die frühen Gedichte sind gesammelt worden. Und nach dem Erscheinen des ersten großen Buches Tod durch Musen bei Rowohlt habe ich mir gedacht, also, ich will nur schreiben, nichts anderes. Und dann ist es halt losgegangen. Dann hab ich das als Ziel vor mir gesehen.
Muff: Wie kam es dann, dass Sie zuerst in den Schuldienst gegangen sind?
Mayröcker: Na ja, es ist so, dass man vom Schreiben allein nicht leben kann. Und ich hab schon gewusst, dass ich einen Brotberuf brauch. Und ich hab das als meinen Brotberuf angesehen, das Unterrichten. Ich hab das nicht sehr gerne gemacht, obwohl die Kinder damals sehr nett waren, die waren sehr aufgeschlossen. Es war ja die Zeit nach dem Krieg. Niemand hat zu essen gehabt, nichts zum Anziehen und nichts zu heizen im Winter. Es war ziemlich arg. Und da hab ich also unterrichtet und das 24 Jahre lang. Das war dann schon zu viel für mich. Da hab ich schon nicht mehr können. Ich habe mich dann frühpensionieren lassen. Das war, glaube ich, 1968. Und dann habe ich halt nur Literatur gemacht.
Muff: War das eine Befreiung nur noch schreiben zu können? Auch davon dann leben zu können?
Mayröcker: Oh, ja, eine große Befreiung! Na ja, leben kann man davon nicht. Es kamen dann einige Preise. Später habe ich dann zusammen mit Ernst Jandl Hörspiele gemacht, die sich gut verkauft haben. Die sind im Radio gesendet worden. Da kriegt man dann schon ein Sendehonorar. Und dazu halt die Preise. Man kann sich über Wasser halten. Also richtig gut leben kann man von der Literatur nicht. Auch heute noch nicht. Es war ein bisschen schwierig, der Anfang war sehr schwierig.
Muff: Sie sagten, Ihre Arbeit begann mit Prosa. Aber auch Hörspielarbeit und Kinderbücher. Und natürlich auch die Lyrik. Was macht man denn selbst am liebsten? Haben Sie Präferenzen? Wird man da von der Lust geleitet?
Mayröcker: Ja, man spürt das.
Muff: Und gibt es ein persönliches Lieblingswerk von Ihren ganzen vielen ,Kindern‘?
Mayröcker: Ja, schon. Es sind eigentlich zwei Bücher. Und das, was voriges Jahr erschienen ist. Beides Prosa. Und von der Lyrik – ja, ich hoffe, dass das jetzt mein Lieblingsbuch wird; die gesammelten Gedichte kommen im Herbstprogramm bei Suhrkamp. Es ist ein sehr dickes Buch mit 800 oder 900 Seiten in einem Band. Eine Dünndruckausgabe. Das wird dann mein Lieblingsbuch werden, weil da alle Gedichte drin sind.
Muff: Wenn man zurückblickt, auf das eigene Werk, ist man dann stolz?
Mayröcker: Nein, stolz nicht. Es ist eine Gnade. Also, man kann eigentlich selber gar nichts dafür. Das…
Muff: … ist einem in die Wiege gelegt?
Mayröcker: … ja, das kommt von irgendwo her. Man weiß nicht, wo.
Muff: Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, dass ihre Tochter schreiben will?
Mayröcker: Die haben mich unterstützt.
Muff: Das ist schön, wenn man bei dem, was man tun will, nicht auch noch gegen die elterlichen Instanzen kämpfen muss. Gerade wenn man jung ist.
Mayröcker: Ja, natürlich.
Muff: Sie haben 1988 in einem Fragebogen der FAZ gesagt, den ich persönlich sehr schön fand, dass Ihre größte Angst darin besteht, erblinden zu können, nichts mehr sehen zu können. Nehmen Sie das, was Sie schreiben, nur über die Augen auf? Sind Sie ein reiner Augenmensch?
Mayröcker: Ja, ich bin ein Augenmensch.
Muff: Und wie darf ich mir das vorstellen; sitzen Sie irgendwo und speichern das, was Sie sehen?
Mayröcker: Nein, ich schreibe das dann sofort auf. Ich habe ein Notizbuch immer bei mir und notiere alles. Das wird gesammelt. Und wenn mir eher nach Prosa ist oder nach Lyrik, dann schaue ich die Sachen durch, die ich notiert hab, ob ich etwas davon gebrauchen kann.
Muff: Aber es passiert auch, dass etwas weggeschmissen wird?
Mayröcker: Ja, ja.
Muff: Ich habe gelesen, dass Sie manchmal Briefe verwerten und aus diesem Grund gerne Post bekommen. Gibt’s noch andere Quellen, aus denen Sie ,kopieren‘ oder etwas herauslösen und zusammensetzen?
Mayröcker: Na ja, ich exzerpiere aus Büchern. Ununterbrochen eigentlich.
Muff: Woraus gerade im Moment?
Mayröcker: Ja, Gertrude Stein, Jacques Derrida. Und jetzt bin ich gerade dran, Picasso-Bücher durchzusehen, auf seine Aussprüche und Gespräche mit der Stein. Es ist sehr interessant. Und ich nehme auch dies alles mit in den Urlaub nach Ischl. Jetzt nächste Woche fahr ich weg.
Muff: Muss man manchmal aus Wien weg? Wird es einem manchmal zu viel?
[Sie schüttelt den Kopf.]
Muff: Haben Sie immer in Wien gelebt, also ohne Unterbrechungen?
Mayröcker: Nun ja, ich war zweimal in Berlin, über längere Zeit.
Muff: Gibt es Parallelen zwischen den beiden Metropolen?
Mayröcker: Würde ich schon sagen. Na ja, ich glaube, die beiden Städte haben etwas von einer gewissen Schlamperei. Oder von einer gewissen Unordentlichkeit oder Legerheit. Vor allem Legerheit. Es geht alles langsamer.
Muff: Ich weiß, Sie hören klassische Musik bei der Arbeit. Ist das auch eine Ihrer Inspirationen?
Mayröcker: Ja, das ist auch eine Inspiration. Aber die größte Inspiration ist die bildende Kunst. Die alten und die ganz neuen Sachen. Ich habe viel mit bildenden Künstlern zusammengearbeitet. Das macht mir eine ganz spezielle Freude.
Muff: Was ist an dieser Arbeit das Besondere? Sind es die zwei Arten der Kunst, das Schreiben und die visuelle Darstellung?
Mayröcker: Ja, das Visuelle kommt halt da in den Vordergrund. Vor allem die Malerei. Das ist für mich eine unerschöpfliche Quelle.
Muff: Treibt das das Schreiben weiter an, wenn man sieht, dass das ein Bereich ist, der immer wieder Neues produziert, der sich nicht totläuft, der immer wieder Neues schafft. Wird man da selber mitgezogen?
Mayröcker: Ja, mitgezogen, eher noch mitgerissen.
Muff: Sie haben verschiedene Phasen in Ihrem Schreiben durchlebt. Experimentiert mit dem Surrealismus, mit dem Dadaismus. Befinden Sie sich im Moment auch in einer Phase, die man mit einem Überbegriff fassen kann?
Mayröcker: Na ja, ich muss sagen, die Lektüre von der Stein hat mich schon sehr beeindruckt. Weil – ich hab die Stein bisher nicht so geschätzt, wie ich sie jetzt schätze. Sie war mir ein bisschen zu abstrakt, aber jetzt bin ich draufgekommen, dass sie ganz großartig ist, und ich hab mich in den letzten eineinhalb Jahren nur mit ihr befasst. Ich hab verstanden, dass da sehr viel dahinter steckt. Ich hab Dinge entdeckt, die ich vielleicht in meine Werke aufnehmen kann.
Muff: Was übernehmen Sie da? Gedanken?
Mayröcker: Gedanken, und auch die Form. Eine gewisse Form. Eine genaue und geschlossene Form. Und ein Hingezogenwerden zu einem, unter Anführungszeichen, einfachen Stil, der mir bis jetzt gar nie so lieb war. Mir war immer der Stil viel lieber, der…
Muff: … komplexer ist?
Mayröcker: Ja, bei der Stein, da hab ich gemerkt, dass Einfachheit ein Stil ist, der einfach scheint, aber er ist ja nicht einfach. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Muff: Sie haben auch mit Jandl zusammengearbeitet, den Sie schon erwähnt haben. Aber auch ein wenig mit Okopenko und Hans Weigel…
Mayröcker: … ja, der Hans Weigel hat so eine Gruppe gehabt. Der hat sich damals mit jungen Autoren im Kaffeehaus getroffen und hat versucht, von den jungen Autoren Gedichte in die Zeitungen zu bringen…
Muff: … also in dem Sinn, dass die jungen Autoren ein Sprungbrett bekommen, eine Möglichkeit zu publizieren…
Mayröcker: Ja.
Muff: Möchten Sie mal wieder mit jemandem zusammenarbeiten? Planen Sie mal wieder eine Zusammenarbeit?
Mayröcker: Nein, die Zeit ist vorbei. Man kann eigentlich nur allein arbeiten. Das Zusammenarbeiten ist eine große Schwierigkeit, weil jeder ja von der eigenen Warte kommt. Man muss dann irgendwie zurückstecken, die eigenen Ansichten.
Muff: Ich habe gelesen, Sie arbeiten sehr diszipliniert. Da war von acht Stunden am Tag die Rede. Entspricht das der Realität?
Mayröcker: Nein, nein. [Sie schüttelt den Kopf.]
Muff: Wie sieht das dann aus? Wandern Sie in der Wohnung umher und setzen sich dann irgendwann an Ihre Schreibmaschine?
Mayröcker: Na ja, eigentlich überfällt es mich so. Meistens in der Früh. Ich träume, ich habe Verbalträume. Und mit diesen Verbalträumen steige ich dann ein in eine neue Arbeit. Also, das ist so das anfeuernde Element.
Muff: Ah, das kommt dann so von innen heraus?
Mayröcker: Ja, aber nicht acht Stunden. Das kann ja kein Mensch.
Muff: Wo geschieht dieses Schreiben? Ausschließlich in Ihrem Arbeitszimmer?
Mayröcker: Nun ja, da kann ich mich am besten konzentrieren.
Muff: Ich habe Bilder von Ihrem Arbeitszimmer gesehen. Da hing am Fenster eine Tafel ich weiß nicht, ob sie da noch hängt – mit dem Spruch „Es ist alles tabu“ darauf. Was bedeutet der Spruch?
Mayröcker: Na ja, das ist eine längere Geschichte. Ich bin als achtjähriges Kind zum ersten Mal ins Kino von meinen Eltern mitgenommen worden. Und das war für mich ein großes Erlebnis, weil ich vorher noch nie im Kino war. Und da hat es den Film Tabu gegeben. Das ist ein ganz alter Film. In der letzten Szene sieht man eine Hand, die aus dem Wasser ragt und allmählich untergeht. Zum Schluss steht dann noch, quer über die Leinwand, Tabu. Was immer das auch heißen mag; das weiß ich heute nicht. Aber das Tabu hab ich übernommen und zwar deshalb, weil ich mir gedacht hab, wenn also jemand in die Wohnung kommt, ohne dass ich es will oder weiß, oder vielleicht ein Einbrecher oder irgend etwas und der sieht das Tabu, dann wird er alles liegen lassen. Also ich hab immer Angst um meine Manuskripte. Ich hab immer Angst, dass jemand in die Wohnung kommt, wenn ich nicht da bin, und meine Manuskripte zerstört. Das war also die Vorgeschichte von Tabu. Aber diese Kreidetafel gibt’s noch.
Muff: Ich habe gerade den Eindruck gewonnen, als Sie erzählt haben, dass Ihre Manuskripte ihnen das Wichtigste sind, das Sie besitzen. Stimmt das?
Mayröcker: Ja, das kann man schon sagen. Das ist schon richtig.
Muff: Als nächstes würde ich gerne mit Ihnen über Literatur allgemein sprechen. Was halten Sie davon, wenn Literatur zum Unterhaltungsphänomen wird? Wird das der Literatur gerecht?
Mayröcker: Man tut ihr unrecht. Es gibt natürlich eine Literatur für Unterhaltungszwecke, aber das ist nicht meine Literatur. Ich kann auch so was nicht lesen.
Muff: Was fällt da Ihrer Meinung nach darunter?
Mayröcker: Na ja, alle Kriminalromane. Dann die so genannte leichte Literatur, Unterhaltungsliteratur. Ja, was noch?
Muff: Ist gute Literatur heute präsent genug?
Mayröcker: Ich glaub schon.
Muff: Lesen die Menschen dann genug gute Literatur?
Mayröcker: Ja, vor allem die jungen Leute.
Muff: Ah, die jungen Leute?! Warum gerade die?
Mayröcker: Das weiß ich nicht. Man darf die heutige Jugend nicht abtun. Da tut man ihr unrecht. Nein, also wenn ich lese, dann sind die Säle voll junger Leute, vor allem weibliche junge Hörer sind da.
Muff: Haben Frauen einen anderen Bezug zur Literatur?
Mayröcker: Wahrscheinlich. Ich hab das noch nicht richtig durchdacht, aber es fällt mir auf, dass vor allem junge Leute, also junge Frauen kommen, Studentinnen.
Muff: Kommen wir zu neuen Medien, zum Beispiel das Fernsehen. Schauen Sie fern?
Mayröcker: Nur die Nachrichten schaue ich mir an.
Muff: Und ist in diesen neuen Medien Literatur genug präsent?
Mayröcker: Nein, überhaupt nicht.
Muff: Es gibt ja diese Literatursendungen, Literarisches Quartett und solche Geschichten. Was halten Sie von denen?
Mayröcker: Ich habs eigentlich nie gesehen. [Sie lacht.] Ich hab mirs nie angeschaut.
Muff: Wie stehts denn um Ihre eigene Medienpräsenz? Ich war, um mich vorzubereiten, in der Augsburger Universitätsbibliothek und war darüber erschrocken, dass es so wenig Material über Sie gibt. Jandl, im Vergleich, füllte Regale. Liegt das an einer Unterrepräsentanz der Frauen?
Mayröcker: Ja.
Muff: Also, um auf die eigene Repräsentanz zurückzukommen…
Mayröcker: Eher nicht…
Muff: 2001 gabs den Büchner-Preis für Sie. Empfindet man da Stolz, wenn man so einen wunderbaren Preis entgegennehmen darf?
Mayröcker: Nein, Stolz ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist eher Befriedigung, dass man den höchsten Preis innerhalb des Literaturbetriebs bekommt, aber nicht Stolz; man kann ja eigentlich nichts dafür. Es ist ja ein Geschenk.
Muff: Aber auch auf der Basis des Geschenks – ist da das Gefühl, dass endlich andere Leute auch verstanden haben, dass man begnadet ist auf diesem Gebiet?
Mayröcker: Ja, ich hab mich sehr gefreut damals.
Muff: Ich möchte noch mal auf den FAZ-Fragebogen zurückkommen. Da stand zu der Frage: „Was möchten Sie sein?“ die Antwort von Ihnen: „Eine unüberhörbare poetische Stimme.“ Sind Sie unüberhörbar?
Mayröcker: Ich glaube nicht. Das liegt eben an der Nichtpräsenz, an der Nichtgenugpräsenz der Bücher. Man liest mich zu wenig.
Muff: Liegt das auch an Suhrkamp selbst?
Mayröcker: Nein.
Muff: Passiert das auch, wenn ein Werk oder ein Gedicht von anderen interpretiert wird, dass da Dinge herauskommen, die gar nicht von Ihnen intendiert waren? Was ist das Gefühl dahinter? Ärger?
Mayröcker: Nein, ich bin nicht verärgert. Ich staune eher. Das ist so interessant. Ich habs gern dann, wenn Kritiken etwas herausschaufeln, was ich überhaupt nicht gewusst hab. Das ist sehr interessant.
Muff: Vielleicht kommen wir gleich zu Ihrem Gedichtband Notizen auf einem Kamel. Mein absolutes Lieblingsgedicht ist „Tonarten des Weiß“.
Mayröcker: Ein Gedicht für meine Mutter.
Muff: War Ihre Mutter eine besondere Frau für Sie?
Mayröcker: Ja, sie war eine besondere Frau, die, Gott sei Dank, sehr alt geworden ist. Aber man kommt ja dann drauf, dass man vieles falsch gemacht hat. Man hat dann eben das Gefühl, heute würde man es anders machen, wenn sie noch leben würde.
Muff: Bezieht sich das auf Dinge, die man vielleicht mal im Streit gesagt hat…
Mayröcker: … nein, nicht im Streit, Streit hat es nicht gegeben, aber wo man nicht aufmerksam genug war, was sie eigentlich wollte, Hilfe, Verständnis. Das weiß man dann erst nachher und das tut einem dann sehr Leid.
Muff: Also, dass man das nicht mehr ändern kann. Dass man in dem Augenblick nicht sensibel genug war zu verstehen, was das Gegenüber möchte?
Mayröcker: Na ja, das lag halt auch daran, dass ich ununterbrochen geschrieben habe. Ich hab nicht zuhause gewohnt, ich habe in der Nähe meiner Eltern gewohnt. Und bin zweimal am Tag zu ihr gegangen, wie sie schon krank war. Und manchmal hätt sie es halt gerne gehabt, wenn ich länger geblieben wäre. Und das hab ich nicht können, der Antrieb zu schreiben war immer in mir und ich wollte wieder nach Hause. Und ich hab dann das Gefühl gehabt, nach ihrem Tod, ich hätte ihr mehr Zeit widmen müssen.
Muff: Fungiert das dann wie eine Entschuldigung?
Mayröcker: Ja, ja…
Muff: Sie haben auch oft eine Widmung verwendet. Verbindet das das Gedicht unmittelbar mit der Erinnerung an diese Person, dass diese im Gedächtnis bleibt?
Mayröcker: Na ja, ich glaub eher, dass man eine Widmung deshalb schreibt, um auch für Lesende hinzuweisen, für wen das war.
Muff: Sind die Gedichte eine Art Denkmal, bei dem die Erinnerung an die Personen wiederkommt?
Mayröcker: Ja, schon.
Muff: Wie kam es denn zu dem Buchtitel Notizen auf einem Kamel? Ich hab versucht, da ein bisschen zu assoziieren; Kamel, Wüste, Einsamkeit … Liege ich da richtig?
Mayröcker: Ja, es ist ganz was anderes. Es ist so, dass Marcel Beyer, mit dem ich befreundet bin, mir einmal eine Karte geschrieben hat aus einem fernen Ort, eine Ansichtskarte, und da ist draufgestanden unter anderem auch: „Notizen auf einem Kamel“. Und dann hab ich ihn angerufen und gefragt, ob ich das verwenden darf. Er hat mirs geschenkt, dieses „Notizen auf einem Kamel“. Und da hab ich mir gedacht, dass ist doch ein wunderbarer Titel für einen Gedichtband. Und war dann natürlich sehr froh, dass er da nichts dagegen gehabt hat. Im Gegenteil, er hat gesagt, es freut ihn, wenn ich das verwende.
Muff: Dann war das jetzt genauso, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass man manchmal etwas mehr hineininterpretiert, als eigentlich dahinter steht…
Mayröcker: … ja, ja, genau so ist es…
Café Tirolerhof (Wien), 7.7.2004
aus: Andrea Bartl (Hrsg.): Verbalträume. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Wißner-Verlag, 2005
GEMISCHT FASCHIERT
für (und nach) Friederike Mayröcker
dann heißt’s eben lächeln, bis der schneidezahn seinen zwilling deckt,
den gut gemeinten weggefährten, den sperrling. den hilfling,
dessen schnappendes material auf der zunge zergeht. dann nämlich:
sing sing hinter zahngittern, wo heftlinge ums wort raufen, ums
silbengestöhn, bis ein plastiklöffel zum ausbruch verhilft. bi-
polare naturen durchwandern die stimmungswildnis, den rotkehlen-
wald wie die ovationalen brachen. branches betouchen
kinn und skins unterwegs, dass auch mal blut tropft,
gesinnungsschnee färbt. wäre ich mode, würde ich schafe verstricken
vorm winter, versonnen/versponnen die blicke im freien, treidelnd.
aus herrischem oberstock flockt ein gewissensgrün abwärts,
wozwischen frau schadenzauber ihr schwarzpulver schnaubt,
berührungen ausheckt. jahre liegen zwischen den schultern,
dass die linke nicht weiß, was die rechte noch will.
taubentaub reicht die blinde patientin visionen aus:
gemischt faschierte hasen und rehe im licht, im schatten
dann heilsfritatten. alle beschwerden sorgfältig abgewischt,
im sink verklappt. sinkt nacht herab, ist es zeit,
den geldbaum zu pflanzen. die goldenen blätter
im kropf, fliegt der hase dann heimlich voraus.
Kathrin Schmidt
Michael Wurmitzer: Weltkonfrontation und Weltdistanz. Eine philologisch-kulturwissenschaftliche Untersuchung zu Friederike Mayröckers ,études‘.
Paul Jandl: Interview mit Friederike Mayröcker – „Ich bin ja eigentlich gegen den Tod“
Friederike Mayröcker im Interview mit Astrid Nischkauer am 8.3.2017 im Café Sperl
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Das Herzzerreißende der Dinge – In Erinnerung an Friederike Mayröcker
Hans Ulrich Obrist spricht über die von ihm kuratierte Ausstellung von Friederike Mayröcker Schutzgeister vom 5.9.2020–10.10.2020 in der Galerie nächst St. Stephan
Friederike Mayröcker übersetzen – eine vielstimmige Hommage mit Donna Stonecipher (Englisch), Jean-René Lassalle (Französisch), Julia Kaminskaja (Russisch) und Tanja Petrič (Slowenisch) sowie mit Übersetzer:innen aus dem internationalen JUNIVERS-Kollektiv: Ali Abdollahi (Persisch), Ton Naaijkens (Niederländisch), Douglas Pompeu (brasilianisches Portugiesisch), Abdulkadir Musa (Kurdisch) und Valentina di Rosa (Italienisch) und Bernard Banoun – im Gespräch mit Marcel Beyer am 6.11.2021 im Literaturhaus Halle.
räume für notizen: Friederike Mayröcker: Frieda Paris erliest ein Langgedicht in Stücken und am Stück, Juliana Kaminskajas Film das Zimmer leer wird gezeigt. Die Moderation übernimmt Günter Vallaster am 29.1.2024 in der Alten Schmiede, Wien
Fest mit WeggefährtInnen zu Ehren von Friederike Mayröcker Mitte Juni 2018 in Wien
Sandra Hoffmann über Friederike Mayröcker bei Fempire präsentiert von Rasha Khayat
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Oskar Pastior: Rede, eine Überschrift. Wie Bauknecht etwa.
Neue Literatur. Zeitschrift für Querverbindungen, Heft 2, 1995
Johann Holzner: Sprachgewissen unserer Kultur
Die Furche, 16.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004.
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Sabine Rohlf: Von der Lust des Worte-Erkennens
Emma, 1.11.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Maria Renhardt: Manische Hinwendung zur Literatur
Die Furche, 18.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Michael Lentz und Marion Poschmann: Verse, die ins Blut gehen
Die Zeit, 17.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Wilder, nicht milder. Friederike Mayröcker im Porträt
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Zum 100. Geburtstag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Zettels Träumerin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.2024
Michael Wurmitzer: Das Literaturmuseum lässt virtuell in Mayröckers Zettelhöhle schauen
Der Standart, 17.4.2024
Barbara Beer: Hier alles tabu
Kurier, 17.4.2024
Anne-Catherine Simon: Zuhause bei Friederike Mayröcker – dank Virtual Reality
Die Presse, 18.4.2024
Paul Jandl: Friederike Mayröcker: Ihre Messie-Wohnung in Wien bildet ein grosses Gedicht aus Dingen
Neue Zürcher Zeitung, 17.6.2024
Sebastian Fasthuber: Per Virtual-Reality-Trip in die Schreibhöhle der Dichterin Friederike Mayröcker
Falter.at, 9.7.2024
Roman Bucheli: Friederike Mayröcker war ihr eigenes Gesamtkunstwerk. In ihrer Wiener Papierhöhle schrieb und zeichnete sie ein Leben lang
Neue Zürcher Zeitung, 12.7.2025
Fabian Schwitter: Von Fetischen und Verlegenheiten
Kreuzer :logbuch, Oktober 2024
Cornelius Hell: Kreuz und quer durch Mayröcker-Texte
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und die Dorfwelt
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und der heilige Geist
oe1.orf.at, 17.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker und das Skandalon des Todes
relidion.orf.at, 20.12.2024
Cornelius Hell: Friederike Mayröcker ist der Frühling
relidion.orf.at, 21.12.2024
Martin Reiterer: Gegen den Strich gebürstet
Der Standart, 16.12.2024
Iris Radisch: Majestät am Campingtisch
Die Zeit, 18.12.2024
Bernd Melichar: Sie weidete in Poesie, sie war nicht von dieser Welt
Kleine Zeitung, 18.12.2024
Clemens J. Setz: Ihre Stimme macht alle Selbstgespräche tröstlicher
Süddeutsche Zeitung, 19.12.2024
Oliver Schulz: Darum war Friederike Mayröcker von Sprache besessen
Nordwest Zeitung, 19.12.2024
Lothar Schröder: Einfach mit Larifari beginnen
Rheinische Post, 19.1.2024
Bernhard Fetz: Zum 100. Geburtstag von Friederike Mayröcker
hr2, 20.12.2024
Joachim Leitner: Wie Friederike Mayröcker in Tirol den Mut zum „Mayröckern“ fand
Tiroler Tageszeitung, 19.12.2024
Marie Luise Knott: Engelgotteskind
perlentaucher.de, 20.12.2024
„Königin der Poesie“: 100 Jahre Friederike Mayröcker
Der Standart, 2012.2024
Martin Amanshauser: Durch ihre Welt tanzen die Blumen, Tiere und Gedanken
Die Presse, 20.12.2024
Gerhild Heyder: „Der Tod ist mein Feind“
Die Tagespost, 20.12.2024
Paul Jandl: Vor hundert Jahren wurde Friederike Mayröcker geboren: eine Dichterin, die mit ganzem Herzen an das glaubt, was von oben kommt
Neue Zürcher Zeitung, 20.12.2024
Richard Kämmerlings: Unaufhörlicher Dialog mit Lebenden und mit Toten
Die Welt, 20.12.2024
Peter Mohr: Den Kopf verlieren
titel-kulturmagazin.net, 20.12.2024
Michael Denzer: „Haben 1 Gedicht im Kopf“
salto.bz, 24.12.2024
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb + ÖM + IZA + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und Interview 1, 2, 3 & 4
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Dirk Skiba Autorenporträts + Galerie Foto Gezett + gettyimages + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Friederike Mayröcker: Bayern 2 1 + 2 ✝︎ BaZ 1 + 2 ✝︎ BR24 ✝︎ dctp ✝︎ der Freitag ✝︎ Die Furche ✝︎ FAZ 1 + 2 ✝︎ FR ✝︎ junge Welt ✝︎ Kleine Zeitung ✝︎ Kurier ✝︎ literaturhaus ✝︎ literaturkritik.de 1 + 2 ✝︎ NÖN ✝︎ NZZ 1 + 2 ✝︎ ORF 1 + 2 ✝︎ Poesiegalerie ✝︎ Presse ✝︎ Salzburger ✝︎ Spiegel ✝︎ SRF ✝︎ Standart ✝︎ Stuttgarter ✝︎ SZ ✝︎ Tagesanzeiger ✝︎ Tagesspiegel ✝︎ Welt 1 + 2 ✝︎ WOZ ✝︎ WZ ✝︎ Zeit 1 + 2 + 3 ✝︎
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.


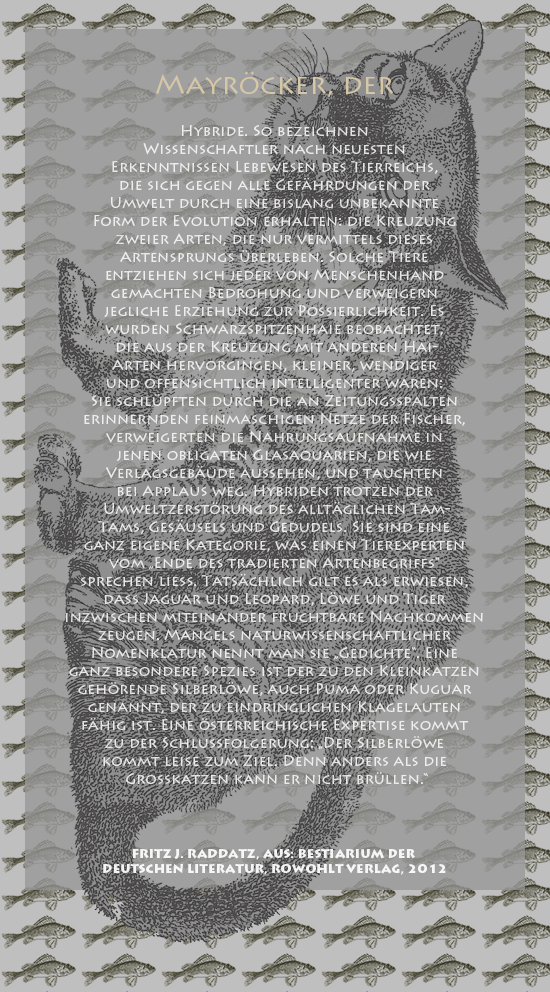












0 Kommentare