SOLCHE GESTALTEN KOMMEN VON WEIT HER,
vor allem die Gauner, Spieler und Komödianten, aus wievielen Zwischenräumen realer oder geträumter Biografie, aus wieviel Tagtraum, Nachttraum, Rêverie, aus wieviel Erinnerung an wieviel Zeit. Seit einem halben Jahrhundert schreibe und zeichne ich Figuren, sie besitzen nicht viel außer ihren Namen. Zum einen oder anderen gehört ein Gegenstand (von Connaisseuren als Attribut bezeichnet), der ihr Kennzeichen ist und ein Wert ohne Wertangabe, Chaplins Stöckchen, Pinocchios Hut. Diese Figuren sind ohne Herkunft, Stammbaum, Stammtisch, Verwandtschaft, Vorfahren und Nachfahren. Sie sind frei von Geburt und Tod, gehören keiner Organisation, keiner Gemeinschaft an (es sei denn der Geschwisterschaft aller Kunstfiguren), sie sind ohne Hierarchie, Nation, Gesetz, bestätigen keine Vormundschaft, keinen Chef, keinen Schinder und keine Religion. Sollten sie einer Nation angehören, ist das ein Zufall ohne Folgen, solange die Gendarmerie sie in Ruhe läßt. Gesetz kann für sie keine Vorschrift sein, es wird nicht befolgt, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ihre anarchischen Kräfte, zwielichtig, strahlend, unschuldig oder grausam, erscheinen märchenhaft, unerschöpflich, selbstverständlich wie Schlaf und Vogelschrei, und sind ein Immunsystem gegen Ideologie jeder Art und Abart. Ihre Rebellion kann heiter sein. Fortschritt ist für sie ein Aberglaube und Gewalt ein Irrtum. Sie erscheinen zum Duell mit der Spielzeugpistole und spucken, wie Puschkin, Kirschkerne auf den Gegner. Sie gehn aus Historie und Handlung frei hervor, immer wieder dieselben, DAS WÄRE WOHL JEDERMANNS ZIEL. Es ist schon viel, daß sie da sind und nichts bedeuten. Es genügt, daß sie angreifbar, aber unverwüstlich sind. DIE KERLE HABEN ETWAS AN SICH, sagt der König im Märchen, und läßt sie laufen. Eine Kunstfigur existiert allein, ohne Anspruch auf Einsamkeit, Tragik, Schicksal. Es zeichnet sie aus ein totales Unverständnis, was Ehrgeiz, Größenwahn, Mobbing, Karriere und Denunziation betrifft. Sie besitzt keinen Briefkopf und keine Adresse. Ihre Freiheit ist vogelfrei.
Die Romanfigur verkörpert das Gegenteil. Sie ist in Handlungen verwickelt, bestimmt ihren Verlauf, kann Träger einer Idee, eines Weltbildes sein. Ihre Existenz bewegt sich zwischen Geburt und Tod, ihr Alter nimmt zu und nimmt ab, sie lebt in Vergleich und Verhandlung mit anderen Figuren (der Erzählung, des Romans), kennt Triumpfe, Niederlagen, Sorgen, die einer Kunstfigur nicht verständlich sind. Die Romanfigur wird erzogen und ausgebildet, ihr wird Verantwortung übertragen, sie lebt in oder außerhalb einer Familie, verdient Geld, hat Untergebene oder Vorgesetzte, zahlt Miete, macht Ferien, stirbt im Spitalbett. Romanfiguren sind in der Regel Bürger (Teil eines Staates, einer Gesellschaft), wollen es sein oder nicht sein, sind dazu verpflichtet oder verdammt, tauchen unter, gehn daran zugrunde. Das alles betrifft eine Kunstfigur nicht.
Die Kunstfigur existiert in fast allen Literaturen. Sie heißt MONSIEUR TESTE (von Paul Valéry), PLUME (Henri Michaux), MALDOROR (Lautréamont), und GASPARD DE LA NUIT, in den sich Aloysius Bertrand aus Dijon verwandelte, das ist 170 Jahre her. Der eine ist der HERR KEUNER von Brecht, der andere der TUBUTSCH von Ehrenstein. Sie heißen ULENSPIEGEL, SCHWEJK, DON QUICHOTE und SANCHO PANSA, GULLIVER, PALMSTRÖM und KORFF, STRUWWELPETER und PINOCCHIO, DER VERRÜCKTE BATLEN des jiddischen Dichters Jizchak Lejb Perez, MALCOLM des Amerikaners James Purdy, MANIG von Reinhard Lettau, der PALMWEINTRINKER des Nigerianers Amos Tutuola, und KASPAR, den Hans Arp für alle Zeit dem Tod streitig machte:
weh unser guter kaspar ist tot.
wer verbirgt nun die brennende fahne im wolkenzopf
und schlägt täglich ein schwarzes schnippchen.
wer dreht nun die kaffeemühle im urfass … und entgrätet
die pyramiden…
![]()
In seiner Münchner Rede zur Poesie
widmet Christoph Meckel sich den „Kunstfiguren“, die, in Wort und Bild, schon ganz am Anfang sein Werk bevölkerten und heute noch immer – „wie vor 30 oder 7 Jahren“ – seine vertrauten Begleiter sind: Halblang, Windig, Jul Miller, Jasnando, Schurrigel, Dreckiger Jakob, Frierender Franz und viele andere mehr. Es ist ein eigener, vielgestaltiger Kosmos spezifisch Meckelscher Art, der aber zugleich tief verbunden ist mit Weltliteratur und -kunst, denn diesen Figuren und ihren zahlreichen Verwandten begegnet man nicht nur in der Literatur, bei Arp, Brecht, Ehrenstein, Michaux und Valéry, sondern auch in Commedia dell’Arte, Trickkiste, Karikatur und Comic. Das eigentliche Element dieser Figuren aber ist das Humane: „lhre anarchischen Kräfte, zwielichtig, strahlend, unschuldig oder grausam, erscheinen märchenhaft, unerschöpflich, selbstverständlich wie Schlaf und Vogelschrei, und sind ein Immunsystem gegen Ideologie jeder Art und Abart.“
Stiftung Lyrik Kabinett, Klappentext, 2007
Meckelianer und Meckeliaden Hut ab vor Christoph Meckel
Ich bin kein Kenner seines Lebens und Werks, aber seit ich Anfang der sechziger Jahre erstmals Gedichte von ihm las und ihn bald darauf persönlich kennenlernte, ist Christoph Meckel aus meinem Leben und meiner Arbeit nicht mehr wegzudenken. Trotzdem oder gerade deshalb fällt es mir schwer zu sagen, was mich mit ihm verband und was unsere sporadischen Kontakte – Besuche in Rémuzat sowie Begegnungen auf Lesungen und Vernissagen – zur stabilen Freundschaft werden ließ, die mehr als fünfzig Jahre überdauert hat. Vielleicht war es gerade unser beider Gegensätzlichkeit: Christoph Meckel ist ein Stiller im Lande, eine im Verborgenen wirkende Kraft, die der Gegenwart ihre Signatur aufprägte, obwohl oder weil (das ist fast schon ein Synonym!) er, unbeeindruckt von den Zumutungen des Zeitgeists, den eingeschlagenen Weg stur weiterging und unbeirrt festhielt an seinem Verständnis von Künstler- und Dichtertum. Meckel war und ist eine poetische Existenz, und vielleicht wirkte er darum zeit seines Lebens viel jünger, als er tatsächlich war. Es genügt, die von Renate von Mangoldt aufgenommenen Porträts aus verschiedenen Jahrzehnten zu betrachten: Mit dreißig sah Meckel aus wie ein Zwanzigjähriger, mit fünfzig wie ein Dreißigjähriger, mit sechzig wie ein Vierzigjähriger usw. usf. All das kann ich von mir nicht sagen, denn anders als Christoph Meckel, der sich aus allem heraushielt (was so nicht stimmt, wie wir sehen werden!), habe ich die Öffentlichkeit nicht gescheut und mich neben meiner literarischen Arbeit kritisch und essayistisch, politisch und journalistisch betätigt – ob ich mich dabei verzettelt habe, mögen andere beurteilen. Obwohl ich ursprünglich Jazzmusiker hatte werden wollen und jahrelang intensive Zeichenstudien trieb, bin ich kein Malerpoet wie Meckel, dessen Doppelbegabung ihn mit Günter Bruno Fuchs, aber auch mit Peter Weiss und Günter Grass verbindet.
„Peter Weiss war lange ein Künstler, der auch schrieb. Er war danach ein Schriftsteller, der kein Bild mehr machte“, sagte Christoph Meckel in seiner Laudatio auf Peter Weiss anlässlich der Verleihung des Bremer Literaturpreises kurz vor dessen Tod. Und er fährt fort:
Der Wechsel von Kunst zu Literatur, von der Bildwelt zu einer Welt aus Sprache, war nicht Bruch oder Abbruch – Bruch oder Abbruch finden sich vorher –, sondern Festigung und Gestaltung der Existenz.
Der zweite Teil des Zitats hat auch für Meckel Gültigkeit, der – anders als Peter Weiss – nie der Malerei den Laufpass gab zugunsten der Literatur. Er hielt beiden Künsten die Treue, auf die Gefahr hin, dass Kritiker die eine gegen die andere ausspielten; wie dies zuweilen geschah. Aber was ist das überhaupt – ein Malerpoet? Das Wort klingt herablassend, als sei von Sonntagsmalern die Rede, die auf Ärztekongressen oder in Arztpraxen ihre Bilder ausstellen. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um gehobenen Dilettantismus handelt, also um Kunstgewerbe – eine lobenswerte Bemühung, aber nicht mehr, weil dem Hobby nicht dieselbe Konzentration und Energie zufließt wie dem Hauptberuf. Obwohl Meckel wie auch Grass eine Akademie besuchten und Graphik bzw. Bildhauerei studierten, beklagten Kunstkritiker mangelnde Professionalität, so als könne ein Dichter oder Romancier bildende Kunst nur auf Sparflamme betreiben. Umgekehrt wurde die frühe Prosa von Peter Weiss, ähnlich wie die Dramen von Barlach, zunächst als Nebenprodukt seiner künstlerischen Arbeit eingestuft und gering geschätzt.
Obwohl Christoph Meckels Leben und Werk im Dreiländereck Südbadens wurzeln, genauer gesagt in Freiburg, wo er aufwuchs und wohin er stets aufs Neue zurückkehrt, ist Meckel kein Heimatdichter, sondern das Gegenteil: ein Kosmopolit, der in vielen Sprachen und Kulturen zu Hause ist, in der Toskana und der Provence ebenso wie in Nordamerika oder Westafrika. Sein Lebensmittelpunkt aber war und ist der Bayerische Platz in West-Berlin, wo er, einen Steinwurf entfernt von der Praxis und der Stammkneipe Gottfried Benns, den Bau und den Fall der Mauer erlebte, die in seinem nur scheinbar unpolitischen Werk deutlich sichtbare Spuren hinterlassen hat.
„Geschrieben 1976–1984 in Berlin, New York, Texas, Ohio, Mexico, Israel, Paris, Suzette, Rémuzat, Florenz, Bacchereto und wieder Berlin“, heißt es in einer Anmerkung zu dem Poem „Jasnandos Nachtlied“, das Meckel 1985 als Privatdruck publizierte. Die Entstehungsorte sind so charakteristisch wie die marginale Form der Veröffentlichung oder der Name Jasnando, eine von vielen Larven, mit denen der Autor, Lebensspuren verwischend, sich gerne maskiert. Manchmal tut er dabei des Guten zu viel und zerstört durch exzessives „name dropping“ die poetische Aura seiner Verse:
Kennen Sie das Old Haifa? Da müssen Sie hin.
(…)
Das Marco Polo in Tunis, paar ruhige Schuppen in Ägypten und Konstantinopel
(…)
das Globe in Algier
und das Globe in Palermo
(…)
YESSIR, hübsch
eine Wasserjungfer am Swimmingpool…
Das Wortgeklingel parodiert Meckels Weitläufigkeit, wie überhaupt der Dichter, besser gesagt sein lyrisches Ich, wenn Pegasus mit ihm durchgeht, manchmal Lametta statt Lorbeer produziert. Aber in seinem Werk findet sich immer auch das Gegenteil: Texte und Bilder, in denen der Autor sich abarbeitet und wundreibt am Widerstand der Wirklichkeit. Dabei denke ich nicht allein an Suchbild, den Roman über seinen Vater, den Schriftsteller Eberhard Meckel, den ich mit amerikanischen Studenten durchackerte – „close reading“ heißt der Fachausdruck dafür, sondern auch an Nachricht für Baratynski, Meckels Denkmal für einen russischen Dichter des 19. Jahrhunderts, der Puschkin und den Dekabristen nahestand. Ein zwischen Essay und Erzählung oszillierender Text, dem es mühelos gelingt, die historische Distanz zu überwinden und eine uns ferne und fremde Welt zu vergegenwärtigen, ohne fragwürdige Anbiederung oder falsche Unmittelbarkeit.
Meckels mir wichtigstes, bis heute kaum wahrgenommenes Werk aber ist seine Bilanz des Kalten Krieges, als eine Art Privatdruck an versteckter Stelle, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit publiziert. Schlammfang heißt das in der Eremiten-Presse erschienene, vom Autor selbst illustrierte Buch – statt einer Charakteristik eine Stilprobe:
Militärs, die abrücken, lassen nichts zurück. Ich entdecke Feuerstellen auf vielen Plätzen, verscharrte Vorräte in den Ödgebieten, Küchengeräte und Waffen, verjährte Konserven, verbrauchte Uniformen in stinkenden Haufen, viel wertloses Kleingeld unter Bretterböden, Amulette und Orden. In Spinden der Mannschaftsräume verschimmeln Bücher, orthodoxe Gebetbücher, russische Pornographen, zerfledderte Werke von Gorki und Puschkin, von Nadeln und Messern durchbohrt, zerfetzt von Scheren, mit Rasierklingen abgetrennte Vignetten und Namen. In leeren Sälen fliegen Papiere herum, Briefe zu hunderten in jeder Kaserne – verkohlte Ansichtskarten, entstellte Fotos – ausgestrichene Personen, verschmierte Gesichter – und Soldaten in Gruppenbildern, allein, mit Kindern, lachende Teams auf Sportplätzen und vor Panzern, dekorierte Kampfgeistvisagen, entblößte Frauen, eine nackte Mongolin mit einem Hund.
Dies ist keine Passage aus Wolfgang Hilbigs Roman Ich, dessen Protagonist in Kellerlöchern haust; auch nicht die Schilderung der verbotenen Zone in Tarkowskis Film Stalker, wo die Sowjetarmee Chemie- und Nuklearwaffen testete, eine No-Go-Area, durch die man sich hüpfend bewegt – wörtlich und nicht im übertragenen Sinn. Was der Text beschreibt, ist keine Fiktion, sondern Realität. Ich weiß, wovon ich spreche, nicht bloß weil ich zusammen mit Christoph Meckel die UdSSR bereiste, sondern weil ich die Sowjetkasernen und Manövergelände bei Nauen und Ludwigslust, die Meckel beschreibt, aus eigener Anschauung kenne und den Abzug der Rotarmisten vor Ort erlebt habe:
Hier wurden Materialschlachten inszeniert, Eroberungen und Untergänge gestaltet, Kriegsschauspiele der Russen ohne Vergleich, Opern aus Flammenwerfern, Schrapnell und Granate, hier wurde das Sterben der westlichen Welt exerziert. Ein Sanitätswagen steckt im Schlamm, eine Krankenbaracke hängt leer im schütteren Gras…
Spätestens hier wird klar, dass Christoph Meckel kein abgehobener Dichter ist, der sich vor den Herausforderungen der Politik ins Schneckenhaus der Poesie verkriecht, sondern ein teilnehmender Beobachter und unbestechlicher Chronist, der sich kein X für ein U vormachen lässt und Missstände anprangert mit den Mitteln der Kunst und Literatur.
Hans Christoph Buch
AN MECKEL
Deine Jacke paßt mir, Freund, aus grobem
Tuch, die Taschen groß für Hände
Blau wie die Arbeit. In die du/ich gehn
Uns ähnlicher, in der wir unsrer denken:
Soweitsogut. Was drüber ist, die Gegend
Südfrankreich oder China oder Preußen
Die ich mir anzieh, ist keine Lösung
Hast du sie? Welche Welt trägt man. Ich hörte:
Eine Frau vom Dorfe, wegen Fettsucht
Wurde vorgeführt im Hörsaal, der Arzt
Gab zum besten, daß sie Verse mache
Gelächter rings. Die Frau, auf ihrer Straße
Rennt, um das Lachen, das ihr, glaubt sie, folgt
Zu fliehn, wohin. In seiner Haut
Wer hat den Raum, alles zu fassen
Volker Braun
CHRISTOPH MECKEL
ROTKÄPPCHEN IM BERNSTEIN
Das hätte niemand gedacht
nicht der kühnste Prophet
das die Maid sich einst unwillig und doof
in das Grauen warf und nicht ins Vergnügen
die Zeit sich zufügt die es braucht
wenn eine Zeit lang nichts geschieht
nichts zu geschehen hat
Peter Wawerzinek
Bei poetenladen.de finden Sie Walter Fabian Schmids kurze Ausführungen zu Christoph Meckels Münchner Poesierede und die Veranstaltung vom 10.12.2007 im Lyrik Kabinett München zum nachhören.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Christoph Meckel – Am 29.10.2012 sprach er in der literaturWERKstatt berlin mit Christian Lehnert über sein Werk.
Robert Schindel: Nicht lange genug gestorben; Laudatio auf Christoph Meckel zum Schillerring 2005.
Zu Besuch bei Christoph Meckel
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Thomas Rietzschel: Das Schneetier
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.6.1995
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Hartmut Buchholz: Die Magie der Entstehung eines Gedichts
Badische Zeitung, 12.6.2015
Michael Braun: Meister der Melancholie
Der Tagesspiegel, 12.6.2015
Michael Braun: Schutzengel der Poesie
Park, Heft 68, 12.6.2015
Wulf Segebrecht: Christoph Meckels bildkünstlerisches und literarisches Werk
literaturkritik.de, Juli 2015
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Johanna Dombois: Nachgeholtes Zwiegespräch nach beider Tod
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.5.2025
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + Interview + Archiv 1 & 2 + Internet Archive + IZA + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images +Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Christoph Meckel: FAZ ✝︎ FR ✝︎ MDR ✝︎ RBB ✝︎ Sinn und Form ✝︎ SZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Christoph Meckel berichtet über sich und seine Arbeit, gibt Einblick in seine „Kopfwerkstatt“ und erklärt seine Poetologie.



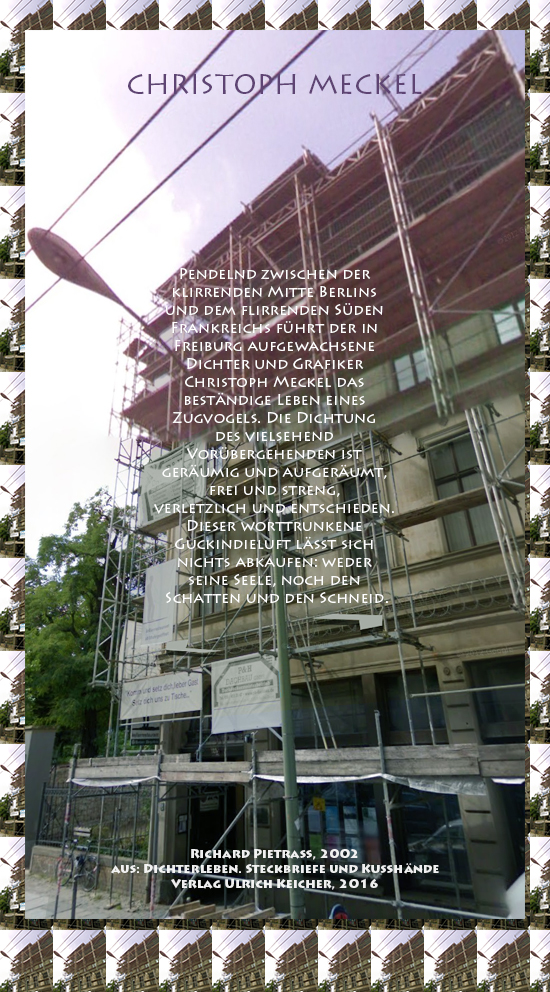












0 Kommentare