PSYCHOLOGISCHES GEDICHT
Vom Klirren der Gestirne unberührt,
von ihrer fernen Kälte nicht gefangen,
allein dahin, von nirgendwem geführt,
um nur nach Nirgendwohin zu gelangen:
Die Wege enden doch in Einsamkeit,
dem andern Land mit unsichtbaren Mauern,
wie außerhalb der allgemeinen Zeit,
als wolle es für ewig dauern:
Ein Reich, so recht von dieser Welt:
ein leeres Glas ist sein Erkennungszeichen,
es expandiert und steigt und fällt
durchs Universum sondergleichen.
![]()
Nachwort
„Erkenntnis die: Wir können uns nicht fassen“
Zusammengefügt zu einer Bildkomposition, ein kleiner Zirkel lebloser Gegenstände, Schnittblumen, Früchte in Schalen, ein aufgeschlagenes Buch dazwischen, ein totes Stück Wild, entsprechende Draperien: Das ist es, was wir gemeinhin mit dem aus der Malerei genommenen Stichwort ,Stilleben‘ verbinden. Die Franzosen haben dafür den Begriff ,Nature morte‘ – ,tote Natur‘ −, und besonders in dieser fremdsprachlichen Transformation mit ihrem spezifischen Assoziationshorizont ist der Titel, den Günter Kunert seinem 1983 ersterschienenen und rasch in zweiter und dritter Auflage vorliegenden Gedichtband gegeben hat, aufschlußreich. Zu Unterwegs nach Utopia und Abtötungsverfahren – den beiden vorauslaufenden Lyrikpublikationen von 1977 und 1980 – markiert er eine abfallende Linie insofern, als er auf eine vertiefte „Trauerarbeit“ verweist, wie es mit damals modischer Vokabel der Klappentext formulierte.
Schauen wir uns im ersten Kapitel des hier wiedergedruckten – also literarisch aktuell gebliebenen – Bandes, Auf dem Lande überschrieben, das Einzelgedicht mit dem nun hier auch tatsächlich aufgenommenen ,Nature morte‘-Titel an:
Fade Wiederholung:
Dieser Abend eines vorigen und
vorvorigen. Wieder täuscht Ruhe
Frieden vor. Die völlige Respektlosigkeit
der Bäume vorm Fenster verspricht
dir Dauer.
Aber am Horizont
die Bläue und das bläßliche Gold
das ist der ganze Gewinn.
Der Ausgangspunkt ist eine private Lebenserfahrung, die sich aber nicht zum sogenannten ,Erlebnis‘ verhärtet, sich nicht in der individuellen Lebenssphäre abkapselt, sondern durchlässig erweist für allgemeinere Sachverhalte. Im Ich-Moment mit seinem eigenen Erfahrungs-Interieur, wozu etwa die Gegensetzung von ,Innenraum‘ und ,Draußenwelt‘ gehört, vermittelt im Blick durchs Fenster, ist also der Zustand der Welt angedeutet. Der Schluß des Textes unterstreicht das nur:
Am Ende sind die Taschen leer
wie am Anfang. Und
über das Fensterbrett zieht
das apokalyptische Heer der Ameisen schon.
Die nächsten Herren der Erde marschieren
in gleicher Gedächtnislosigkeit
auf deinen Spuren voran.
„Ausgesetzte Fehlgeburt / verwaist von Grund auf“ oder „Aus Dreck mit Feuer eine Spottgeburt / die heillos durch das Universum tourt“ heißt es zur existenziellen Bestimmung des lyrischen Ichs und – parabelhaft – für alle Menschen: „So Göttern gleich, ohne Spur von deren Wesen“. Diese desillusionierte, pessimistisch-nihilistische Grundhaltung wird – motivisch unterschiedlich nuanciert – in einer Vielzahl der Gedichte variiert, eskaliert zum Typus des geschichtsphilosophischen Reflexionspoems, dem im vorliegenen Buch ein eigenes, ,Geschichtsbewußtsein‘ überschriebenes Kapitel gewidmet ist, und hat natürlich ihre Vorgeschichte in früheren Publikationen des Autors.
Günter Kunert ist 1929 in Berlin geboren. Die Diskriminierung seiner jüdischen Herkunft durch die Nationalsozialisten überschattete seine Kindheit und prägte ihn in seiner Welterfahrung. Nach einem Ausbildungsanlauf als Grafiker an der Hochschule für angewandte Kunst in Berlin-Weißensee und ersten literarischen Debüts in Zeitschriften – etwa im satirisch-karikaturistischen Ulenspiegel, im Frischen Wind – ist sein erster Gedichtband, Wegschilder und Mauerinschriften, 1950, in der frühesten Gründerzeit der Deutschen Demokratischen Republik im Ostberliner Aufbau-Verlag erschienen; ihm folgten: Unter diesem Himmel, 1955, Tagwerke, Gedichte und Balladen, 1960, und Das kreuzbrave Liederbuch, 1961. Hier und dort schlägt als lyrisches Vorbild Bertolt Brecht durch, den Kunert anfangs der fünfziger Jahre persönlich kennenlernte. Der Autor veröffentlichte in den sechziger Jahren in beiden Teilen Deutschlands – u.a. die Lyrikbände Erinnerung an einen Planeten, 1963, Der ungebetene Gast, 1965, Verkündigung des Wetters und Unschuld der Natur, beide 1966, und – 1970 – Warnung vor Spiegeln. Er gewann mit diesen Publikationen in dichter Folge zunehmend an eigener lyrischer Kontur, was lebendige Auseinandersetzungen mit der Tradition nicht ausschließt: Stellvertretend seien Lenau und Heine oder – hier expressis verbis als „Bruder“ apostrophiert – Heinrich von Kleist genannt. Immer wieder stößt man auch auf verdeckte und offene Auseinandersetzungen mit Goethe, Korrespondenzen, Zitat-Reminiszenzen und Anspielungen wie „Verweile doch“, so das Motto des vierten, abschließenden Kapitels in Stilleben: „Goethe – stark verbessert“ ist dann auch ein eigenes Gedicht-Kapitel in Berlin beizeiten überschrieben.
Gastaufenthalte in den USA und Großbritannien Anfang und Mitte der siebziger Jahre und verschiedentliche Reisen öffneten Kunert neue Erfahrungshorizonte, immer wieder eingestreute oder eigens gesammelte Reisegedichte gehören daher fest zu seinem lyrischen Repertoire; in Anerkennung seiner Geltung gerade auch im Westen Deutschlands ernannte ihn die Westberliner Akademie der Künste bereits 1976 zu ihrem Mitglied. Wachsende Widerstände und Restriktionen aufgrund zunehmender politischer Skepsis gegenüber dem DDR-Regime hingegen – gerade auch in seiner Lyrik dokumentiert, beispielsweise in indirektdirekten Epigramm-Versen wie:
ALS UNNÖTIGEN LUXUS
Herzustellen verbot, was Leute
Lampen nennen,
König Xantos von Tharsos, der
Von Geburt
Blinde.
AUCH DIE WÜRMER
Haben ein Reich: das Erdreich.
Wer
Sonst dort leben will, muß
Tot sein.
UNTERSCHIEDE
Betrübt höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Aufatmend
Höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen
−, sein Austritt aus der SED und seine couragierte, offen dokumentierte Parteiname für den ausgebürgerten Liedersänger Wolf Biermann schränkten seine Publikationsmöglichkeiten in der Deutschen Demokratischen Republik mehr und mehr ein; in den späten siebziger Jahren wechselte er definitiv in den Westen. Nach diversen Prosaveröffentlichungen und der Aufsatzsammlung Diesseits des Erinnerns, 1982, war Stilleben sein erster Lyrikband der achtziger Jahre. Ihm folgten 1987 Berlin beizeiten mit dem Spannbogen von „Gleisdreieck“ und „Landwehrkanal“ bis hin zum „letzten Gedicht über Berlin (…) Zum Abschied vielleicht eine Elegie / im Plusquamperfekt: Gewesen war. / Adressiert an den Wind. / Absender: Ein üblicher Narr“, und Lesarten, Gedicht der ZEIT, 1987, sowie zuletzt Fremd daheim, 1990. Über diverse Aspekte des bis dahin vorliegenden Œuvres informiert der von Michael Krüger herausgegebene Sammelband Kunert lesen, 1979; er enthält zum lyrischen Werk u.a. Aufsätze von Heinz Czechowski, Helmut Heißenbüttel, Fritz J. Raddatz, Hans Mayer, Rainer Kirsch, Gerhard Wolf und Gerald K. Zschorsch.
Vorbereitet ist in den vorauslaufenden Publikationen der sechziger und siebziger Jahre beispielsweise die Figuration Berlins als seltsam hermetischer Ort, hier nun – in direktem Vergleich mit dem alten Troja – fortgeführt zur „späten Totenstadt“, wie überhaupt eine starke Fixierung auf Endzeitliches und Apokalyptisches. Historische Lokalitäten wie „Etruskische Nekropole“ und der Pariser Friedhof Père Lachaise – mit Reminiszenzen an den niedergeschlagenen Aufstand der Commune – entfalten ein aktuelles Todes- und Sterbe-Signalement:
Dem rückwärts-gewandten Blick über die Zeit hinweg bis zum Horizont der Vergangenheit, wo schon nichts mehr so recht erkennbar ist, will es vorkommen, als sei der zurückgelegte Weg ein Irrweg gewesen, von Wegweisern bestimmt, die wir mißverstanden haben; ein Weg, den wir bis zum Ende zu gehen gezwungen scheinen.
,Positive Utopien‘, etwa die Hoffnung auf den ,Fortschritt‘ in der Geschichte, sind längst ausgetrieben; auf solche Weise ernüchtert, wandelt sich zwangsläufig die Selbsteinschätzung des Autors und mit ihr dann notgedrungen auch seine Auffassung vom Schreiben:
Gestern das Foto
in der Zeitung: Die Höhle
der Cumäischen Sibylle
leer:
Es gibt nichts mehr
zu künden.
Verloren gegangen ist der „gute Glaube“ an die Revolution und ihre Segnungen, zu viele Kinder – fremde wie eigene – habe sie schon gefressen. Statt wie einst als Friedensbringerin ,Taube‘ erscheint sie dem Dichter jetzt als ,Vampir‘, und er merkt an: Am bißchen eigenen Blut liege es ihm nicht, daß sie wieder aus dem Grabe steige, aber besser wäre es doch, wenn man wüßte, „wie man ihr auch den Rückweg zeigt“.
Das läßt sich zum Zeitpunkt der Niederschrift einerseits als fortgeführte Auseinandersetzung mit der realsozialistischen Wirklichkeit in der DDR lesen, deren Herrschaftsapparat trotz zunehmender Kritik von innen nach wie vor ,revolutionäre Ansprüche‘ reklamierte, und bezieht andererseits sowohl Position gegenüber der politischen bzw. politisierten Lyrik der frühen siebziger Jahre im Westen Deutschlands – während und nach der Studentenrevolte von 1968/69 – als auch gegenüber jenem restaurativen Umschwung, der sich dazumal mit dem Regierungsantritt der Konservativen das Signet einer ,revolutionären Wende’ zu geben suchte. Das apostrophierte Gedicht – „Stiefmütterchen Revolution“ −, das alles Zeug zu einem bleibenden literarischen Dokument unserer zeitgeschichtlichen Situation hat, wendet sich also gleichermaßen gegen die konkrete politische Bevormundung durch die in ihren Strukturen verhärtete SED im Osten wie gegen jenes „politische Bescheidwissen“ und den aus ihm ab geleiteten Allround-Aufklärungsgestus, die seinerzeit in der Tendenzlyrik der BRD grassierten; erst recht steht es in offener Distanz zum betont restaurativen, nur noch den leeren Begriff der Revolution schwenkenden Ressentiment derer, die meinten, alle Zukunft allein und immer wieder aus der Rückerinnerung an den Wiederaufbau-Aufschwung und den wirtschaftlichen Aufstieg der fünfziger und frühen sechziger Jahre ableiten zu müssen. Kunerts durchgehende Desillusion, die ihn „in den unseligen Gefilden unseres Erinnerns“ mit allen Geschlagenen, allen Opfern verbindet, „Schatten aus der Fremde“, und die Tatsache, daß er mit der Revolution Abschied von falschen Hoffnungen nimmt, die sich nicht erfüllen, ziehen eine deutliche Trennungslinie nach hier und dort und schützen ihn gegen jedwede falsche Inanspruchnahme von welcher Seite immer…
Kunert selbst kommt auf die Abkehr seiner weltanschaulichen Positionen von den Utopien der unmittelbaren Nachkriegsjahre, die er mit anderen teilte, und seine Wendung in die individuelle Skepsis und radikale Desillusion – werkgeschichtlich zu lokalisieren auf die „kopernikanische Wende“ des Gedichtbandes Der ungebetene Gast – in seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung des Jahres 1981 (gedruckt 1985) zu sprechen, der er den Titel Vor der Sintflut – aber als Untertitel, merke: Das Gedicht als Arche Noah – gegeben hat. Auf der einen Seite also ein zeitkritisches Statement wie das folgende:
Nach dem Krieg und seinen globalen Schrecken schien die Annahme berechtigt, die Menschen hätten eine Lektion erhalten, aus der sie unabweisliche Konsequenzen ziehen würden. Die Ungeheuerlichkeiten des Dritten Reiches und der erste Atombombenabwurf sollten genügt haben, um den Verzicht auf jede Gewalt selbstverständlich zu machen. Wir glaubten naiverweise, es müsse von nun an sofort alles ganz anders werden. Worauf es zuallererst ankam, war, den Zusammenbruch zu überwinden, wiederaufzubauen, und nicht nur die zerstörten Städte, sondern vor allem eine bessere, nämlich freiere, gerechtere, friedlichere Gemeinschaft. Man empfand es als moralische Verpflichtung, sich dem Gemeinwohl zu unterwerfen. Die Utopie schien sich verwirklichen zu wollen.
Und – auf der anderen Seite – als notwendige Korrektur und Ergänzung:
(…) die Verwandlung der vielen in viele einzelne, und wiederum des einzelnen in einen seelischen und geistigen Krüppel. Wovon das Gedicht von da an auch immer sprach, der Gesamtzustand von innerer Leere und äußerlichem leerem Betrieb war stets mitgemeint. Nur außerordentliche Momente, extreme Situationen durchbrachen die Monotonie, deren Ablauf und Tempo von der Maschine bestimmt wurde. Wir haben uns schon der ,Grande Machine‘ unterworfen und erkennen vielleicht für einen kurzen Augenblick durch die ungefärbte Optik des Gedichts, wie sie immer mehr zu einer ,Doomsday-Machine‘ wird. Sie produziert alle uns übergeordneten Systeme, von denen wir eingesponnen werden; zuletzt bleibt eine ausgeblutete Hülle übrig, deren Inhaltslosigkeit wir bejammern.
Das unabweisliche Resümee – mit Konsequenz für das literarische Schaffen:
Der Kampf um so etwas wie eine ,Bessere Zukunft‘, für die unzählige Leute in Deutschland sogar ihr Leben hingaben, scheint ausgekämpft. Zum Schweigen verurteilt, richtet sich das Denken auf das bedrohliche Ende ein. Die letzte Aussicht scheint das Unheil. Nur das scheint noch sicher.
Exakt hier, meine ich, liegt der Grund für jene eigentümliche Melancholie, die als „Phänomenologie des Absterbens, der Versteinerung, der Beziehungslosigkeit“ das lyrische Œuvre Kunerts so in der Tiefe fundiert, daß sie alle aufstiebenden Energien in sich verschlingt.
In dem Maß, in dem Gegenwart und Zukunft nur noch als Vernichtung, Vergessen und Zerfall konstruiert werden können, wird der einzelne hoffnungslos auf sich selbst zurückgeworfen; in dem Maß, in dem er die Träume aufgibt und fahrenläßt, wird er sich selbst rätselhaft und dunkel. Dem entspricht auf der formalen Ebene ein spröder lyrischer Lakonismus, der die Aufschwünge ins allzu Artifizielle meidet und das Gedicht der Alltagsprosa annähert; für die Mehrzahl der Texte gilt: keine abstrakten Metaphern, keine Reime, sondern frappierende Gegenständlichkeit im staccato – und Wort-Schnitte, welche die Bögen der Sätze brechen und die Versenden von Zeile zu Zeile markieren. Zwar hat es in den das Buch einleitenden Gedichten den Anschein, als seien vor so eingefinstertem Horizont auch bescheidene Erfahrungen von Glück doch noch möglich – im „Widmungsgedicht für M.“ fällt in diesem Zusammenhang sogar die leicht altmodische Vokabel „Zweieinigkeit“, in „Entrückt“ begrüßt der Autor den ländlichen Bezirk (bei Itzehoe), in dem er nun schon seit Jahren zu Hause ist, wie eine Geliebte, selbst im modernen Babylon-Berlin gibt es Momente „städtischer Frühe“ −, aber diese Augenblicke sind zu privater Natur und daher zu zerbrechlich, als daß sie wirklich als Gegensetzung fungieren könnten. Wenn es heute eine poetische Rechtfertigung für die ,Idylle‘ gibt – so das Gedicht dieses Titels −, dann nicht in Aussparung der Schrecknisse, deren die Welt von Anfang an so voll ist, sondern nur in ihrer intensiven Vergegenwärtigung: ,Idyllisch‘ in diesem Sinne sind nur die Stille nach der Zerstörung und die gespenstische Ruhe unmittelbar davor. Diese Auffassung führt – übers Inhaltliche hinaus gerade auch in stilistischer Hinsicht – zum Bruch mit der Tradition, der das Lyrik-Genre trotz aller formalen Neuerungen der avantgardistischen Moderne so zäh verhaftet zu sein scheint, und zeitigt – auch dies ein Merkzeichen dieses bemerkenswerten Buches, das über sein Ersterscheinen hinaus lesenswert geblieben ist – Kontrafakturen dessen, was man vormals unproblematisch ,Natur-‚ oder ,Erlebnisgedicht‘ genannt haben mag, nun aber nur noch als Leerstelle einkreisen kann:
Ein Kreis von Federn gibt zu wissen
hier bei den Bäumen sei es dann geschehen:
Als Beute eingefangen und zerrissen
was du vordem im Flug gesehen.
Was so geendet das verdient Bedauern
weil es auf eine Weise doch betrogen:
Du ahnst auch über dir das Lauern
von Schatten – eh du selbst verflogen.
Karl Riha, Nachwort
Das Buch
Günter Kunert veröffentlichte 1950 seinen ersten Gedichtband in der damaligen DDR. 1979 ging er in den Westen. Die über hundert Gedichte von Stilleben, die 1983 im Carl Hanser Verlag erschienen, sind ein Resümee seiner Erfahrungen mit dem anderen Teil Deutschlands, seiner Staatsbürokratie, dem neuen Leben und der langsam wachsenden Einsicht, daß unsere gesamte Welt bedroht ist. „In dem Maß, in dem Gegenwart und Zukunft nur noch als Vernichtung, Vergessen und Zufall konstruiert werden können, wird der Einzelne hoffnungslos auf sich selbst zurückgeworfen; in dem Maß, in dem er seine Träume aufgibt und fahrenläßt, wird er sich selbst rätselhaft und dunkel. Dem entspricht auf der formalen Ebene ein spröder lyrischer Lakonismus.“ (Karl Riha)
„Die hier beschriebene Hoffnungslosigkeit lähmt nicht, sondern gibt Kraft, und wenn es auch nur die ist, in Zweieinigkeit durch die hereinbrechende Finsternis zu gehen.“ (Süddeutsche Zeitung)
Deutscher Taschenbuch Verlag, Klappentext, 1992
Falsches Wissen schwängert die Erde
An die sozial-satte Utopie hatte er nie uneingeschränkt geglaubt. Schon in den 60er Jahren klang der poetische Vorbehalt in Kunerts Gedichten mit. Das berühmte Fluggedicht „Ikarus 64“ ermutigte zur hoffnungskühnen Zukunft aus sozialistischen Prämissen und persönlicher Vitalität. Undeutlich blieb der Horizont, das den tatsächlichen Zustand transzendierende Mehr.
Seit Unterwegs nach Utopia1 verdüsterte sich der sozialistische Horizont bedenklich. „Utopia“ ist ein Zielort, „wo keiner lebendig hingelangt / wo nur Sehnsucht / überwintert. // Das Gedicht bloß gewahrt / was hinter den Horizonten verschwindet / etwas wie wahres Lieben und Sterben / die zwei Flügel des Lebens.“ Der nachfolgende Band Abtötungsverfahren2 (1980) vermeldet den „Platzwechsel“ von Berlin-Buch nach Itzehoe. Über die ,Gesellschaft‘, die er verließ, urteilt der Sprecher:
Unerfüllt nach so langer Zeit
ist jede Hoffnung ausgebrannt
und an jedem Tag
das Dunkel darum unsere Gesellschaft
Die Zukunft
eine ferne Ruine am Horizont
unbewohnbar.
Gegen alle Anweisung des ,Amtes‘ hatte Kunert seine demonstrative Resignation geschrieben.
Nach seinem Fortgang aus Berlin-Ost war es für Kunert darum gegangen, seine Schreibfähigkeit außerhalb der DDR wiederherzustellen. Das Interesse befreundeter Redakteure erleichterte dem medienscheuen Autor den Zugang zur publizistischen Szene. In die in der Bundesrepublik ausgetragenen politischen Kämpfe (Atomkraft, Frauenrechte, Ökologie, atomare Nachrüstung) hat er sich bisher direkt nicht eingemischt. Bedeutet Stilleben das Gegenteil von Einmischung? Oder kommt die Provokation, nach dem Stumpfwerden des agitatorischen und leitartikelnden Gedichts, von der poetisch einzig gemäßen Seite?
Das Motiv der ,Stille taucht schon in Kunerts Warnung vor Spiegeln (1970) auf.
Es ist die Stille grün; ein leerer Raum:
betäubend grün und leer wie nichts zuvor,
darunter liegen alle Wünsche längst begraben.
Stille sickert aus den Bucher Elegien (1974). „Jeder Schritt / führt in die Stille“, sagt das Itzehoe-Gedicht aus Abtötungsverfahren. Der Leser begreift bald, daß ,Stilleben‘ in Kunerts Gedichten etwas anderes meint als die ästhetisierte ,nature morte‘ in der Malerei. „Alles still / unter dem Boden / Aus dieser Stille kommen wir / und wollen doch niemals zurück“ steht im ,Sommernachmittag‘ der neuen Gedichte „Auf dem Lande“. Die Stille atmet Geburt und Tod. An einem anderen poetisch wahrgenommenen Nachmittag ist die Stille „wie Fels im Felsen“. Die Stille der Erde, die Stille des Todes, die Stille der Zeit als innerste und härteste Art von Widerstand. Ihr müssen sich die Maschinen unterwerfen, und „die Salven der Erschießungskommandos“, die Rufe von Tieren, die Frage eines Menschen, „ob jemals / wieder nach alter Weise / die Erde töne“. Der Sprecher dieser Verse hört die den Lärm transzendierende Kraft. Seine Sätze warnen vor der nicht mehr gehörten Stille und vor der Totenstille, die der Mensch im Begriff ist, zu produzieren.
Kunerts Gedichte sind eine sehr persönliche und zugleich stellvertretende Bestandsaufnahme nach dem „Platzwechsel“. Natur, Stadt, Geschichtsbewußtsein, Gegenwart heißen die Stationen und Felder des hier ausgebreiteten lyrischen Bewußtseins. „Troja“ und „ Kassandra“ sind eine etwas hoch gegriffene mythologische Sprunglatte, um das Fortgehen aus der Heimatstadt zu stilisieren. Poetisch führt Kunert das Gespräch mit „meinen gewesenen Brüdern“, deren „endlose Reden“ „das unstillbare Weinen / zu übertönen“ versuchen. „Wer da mitfährt“, sagt der Sprecher in „Symbolisches Seestücke“ „ist in Gewahrsam. Die Aufstände / sind vergessen und nur ihr Verrat / lebt fort.“ Ironisch zählt sich der Fortgegangene mit den Ausgebürgerten zu den „verlorenen Söhnen“:
Ein Abschied für immer.
Obschon Kunert sich „nur“ im anderen Teil Deutschlands befindet, müssen Erfahrungen des Exils notiert werden.
Dein Blick wird fremd: er geht und fällt
und trifft die Dinge nur noch schwach…
Statt Hoffnung spricht zu dir das Schweigen.
Dem vor zwanzig Jahren ikarisch proklamierten poetischen Menschen sind die Flügel gebrochen. Flugwunsch und -wille stellen sich nicht mehr ein. Der zu idealischen Auffahrten unfähige Mensch verweigert jedes verordnete ,Geschichtsbewußtsein‘ der „Herrscher“, der „Prediger“, der „Philosophen“. Das „Sein und das Nichts“ sprechen eine andere Sprache. Sie „widerlegen knabbernd / die Unantastbarkeit des Geistes / den Widerstand des Wortes“. So das am meisten mit Begriffen arbeitende Gedicht. Im letzten, bildlich nicht mehr faßbaren Bereich konstituieren „Das Sein und das Nichts“ das nirgendwo harmlose oder unparteiliche ,Stilleben‘. Kunert schreibt die schon in den Verspäteten Monologen (1981) geäußerte Grunderfahrung weiter:
woran man stirbt, davon lebt man auch.
Pointe und Verfremdung stehen bei ihm nie in bloß rhetorischen Diensten.
Ein ,Deutscher Dichter, Güteklasse A‘ stellte „Fragen nach den Erbauern / des siebentorigen Theben / nach seinen Zerstörern keine.“ Provozierend die Absage an Brecht. Nicht nur rhythmisch, metrisch und gereimt, sondern auch in der Aussage nähert sich Kunert dem nihilistischen, wach- und sterbensrealistischen „Dr. Benn“. Keine aus Glaubenssätzen gespeiste Botschaft und doch die Suche nach „Sinn“.
Erkenntnis die: Wir können uns nicht fassen.
Und finden keinen, der uns Göttern gleicht.
Und keinen, der uns Hilfe reicht.
Wir sind uns ohne Gnade überlassen.
Das liegt aussagegemäß nahe bei Benns „Verlorenes Ich“. Kunerts „Götterdammerung“ (der Titel des Gedichts) ist nicht die Wagnersche, auch nicht eigentlich die Nietzeanische, sondern postaufklärerische. Nach der Entmythologisierung steht der Machtmythos von „uns Göttern“ in Frage. Den „Start der ,Columbia“ kommentiert der lyrische Autor:
So Göttern gleichen. Ohne Spur von deren Wesen.
Zur stilistischen Ironie tritt Satire. Kunert denunziert unsere Art von Wissen und Wissensweitergabe als „befleckte Empfängnis“
Das Wissen
das nichts weiß
schwängert unaufhörlich die Erde
Fehlgeburten und Nachgeburten
bevölkern mit der Zeit Kontinente
sorgsam angeschnallt
sozial gesichert politisch aufgeklärt…
Kunerts Stilleben gibt Kunde vom persönlichen Befinden nach dem „Platzwechsel“. Nachricht vom Zustand im anderen, unserem Land. Der Autor diagnostiziert unser bürgerliches Bewußtsein schreibt kritische Sätze gegen unsere politischen Festschreibungen. Nur einmal ruft er vom beschaulichen Ufer die lyrisch wenig beflügelnde Botschaft ins Land:
Heimkehren
in die biologische Wahrheit
Ehe das Mark zerfällt.
Paul Konrad Kurz, Bayerischer Rundfunk, 24.11.1983
Stilleben (1983)
Der Terminus technicus Stilleben, den Kunert für seinen zweiten, nach der Umsiedlung in die Bundesrepublik erschienenen Gedichtband wählt, indiziert die konsequente Weiterführung des in Abtötungsverfahren entwickelten ästhetischen. Prinzips. „Stilleben“ ist ein Genre der Malerei. Es geht um die realistische Darstellung lebloser und bewußt nach ästhetischen Kriterien arrangierter Gegenstände. Den spezifischen Assoziationshorizont eröffnet die Übersetzung von „Stilleben“ ins französische „nature morte“: Die Welt erscheint als tote Natur, als stillgestelltes Leben. Es ist die perfekte Verwandlung von Leben in Kunst:
Versuche die Kunst auch nur, sich aus dem Tod herauszuhalten? Sie zieht doch wacker an seinem Strick. Sie tötet auf ihre Art, geruchlos, aber nicht minder gründlich. ,Nature morte‘ ist kein leeres Wort.3
Das Frontispiz des Gedichtbandes zeigt das Mittelbild von William Hogarths Analysis of Beauty Bl. I. Hogarth diente diese Tafel, die eine Freilichtszene mit überwiegend antikem Statueninventar darstellt und im Original von einer Vielzahl von Detailstudien umrahmt ist, zur Erläuterung seiner kunsttheoretischen Reflexionen. Die Episode findet ihre literarische Quelle in Xenophons „Memorabilia“, in denen Sokrates beim Besuch eines Bildhauers am Beispiel der dort vorgefundenen Skulpturen seine ästhetischen Vorstellungen entfaltet. Die Frage des Bildhauers, ob auch die Dinge des Alltags wie Mörteltrog oder Mistkübel Schönheit besäßen, bejaht der Philosoph.4
Die Zusammenführung beider kunsthistorischen Begriffe beleuchtet Kunerts ästhetischen Grundsatz. Es geht ihm um die realistische Wiedergabe von Dingen und Ereignissen des menschlichen Alltags, die zwar in ihrer Mannigfaltigkeit erfaßt, die aber dem Kompositionszwang des Stillebens, der Perspektive des Todes unterworfen sin as Todesthema wird in den Gedichtbänden der achtziger Jahre zur Obsession. Bereits 1972 in „Warum schreiben“ konstatierte Kunert ein Zusammenschrumpfen „der Themen und Stoffe, an deren Unerschöpflichkeit ich einst geglaubt hatte“.5 Doch zu diesem Zeitpunkt war solche Unfreiheit, wie Kunert ausführt, der Selbstfindung des lyrischen Ichs und seiner ideologischen Emanzipation geschuldet, mittlerweile nötigt die Gegenwart zu dieser Reduktion:6 die Gedanken über die Todesverfallenheit und „über den in der Welt herrschenden Wahn nehmen zu und endlich überhand“ und damit erfolgt notgedrungen wieder eine Abkehr von dem, „was unser wichtigster Gegenstand sein sollte: Unser Selbst.“7
Auf das „Widmungsgedicht für M.“, das dem Lyrikband vorangestellt ist, folgen vier Zyklen. Der häufige Gebrauch des Reims entspricht den kompositorischen Prinzipien des Stillebens. Beatrice von Matt interpretiert ihn als „Bekenntnis zu fester Ordnung, die sich der drohenden Auflösung entgegenstellt“: die Fülle der festgefügten Verse scheint zumindest auf formaler Ebene „dem Leser Halt vermitteln zu wollen […] trotz apokalyptische[r] Inhalte[]“.8
Vordergründig herrscht im ersten Zyklus „Auf dem Lande“ eine besinnliche Stimmung vor. Das zentrale Wort ist „Stille“. Scheinbar handelt es sich um den Rückzug auf einen hortus conclusus, doch wird in diesen Gedichten deutlich, daß es nicht um eine Fortschreibung der traditionellen Naturlyrik geht. Doch Kunert kritisiert keine „grünen Lügen“ (Heinrich Heine), sondern im Gedicht „Wohnen auf dem Lande“ erfolgt vielmehr das resignative Eingeständnis:
Über die Natur gibt es ja
nicht mehr viel zu sagen
(Stilleben, S. 15)
Diese programmatische Aussage besitzt eine andere Qualität, als sie die Kritik an der Wiederholung der überlebten und damit unwahr gewordenen Topoi von Naturlyrik leisten könnte. Die Harmonie zwischen Mensch und Natur ist selbst im Gedicht für immer zerstört. Das Ausmaß der ökologischen Verletzungen verläuft proportional zur Entfremdung des Menschen von der Natur und seiner Überlegenheit über sie. Doch die Überhebung des Menschen über die Natur entlarven Kunerts Gedichte als reine Ideologie. Der Mensch bleibt selbst Naturwesen, und spätestens im Anblick des Todes bietet die zerstörte Natur keinen Trost und stellt in ihren Verheerungen die unaufhebbare Entfremdung zwischen sich und dem Menschen aus. Die Gedichte thematisieren diese schmerzhafte Erkenntnis und der Versuch, sich mit dem ernüchternden Tatbestanden abzufinden, verhindert jede Idyllisierung des Landlebens. Das lyrische Ich zieht sich dann auch zur Kontemplation in die Stille der anorganischen Natur zurück und nimmt Platz auf einem archimedischen Punkt, der es zwar dem Alltag entrückt, ihn aber um so besser beobachten läßt:
LEICHTER NACHMITTAG
Wie Fels im Felsen ist die Stille,
der See von Plagen ohne einen Hauch.
Nach Zukunft schaut nicht Wunsch noch Wille,
wo Schweigen lebt, da lebst du auch:
Wie unverhofft hat es durchdrungen
dich und die Weite ringsumher:
Als habest du dich aufgeschwungen
und triebst davon, die Flügel schwer.
(Stilleben, S. 9)
Für Kunert ist dies sei vorweg erwähnt – ist Stille meist ein positiv besetzter Zustand, der ein Gefühl von „Abgeschiedenheit“ hervorruft, „die eigentümlich glücksverheißend und überhaupt erwartungsvoll ist“9 und zudem notwendige Voraussetzung zum Dichten. „Wie Fels im Felsen ist die Stille“ indiziert ein Phänomen von Zeitlosigkeit, in der das lyrische Ich, das sich selbst als du apostrophiert, verharrt. Der Felsen als versteinerte Zeit symbolisiert Ewigkeit. Doch nicht nur in ihm stagniert die Zeit: in seinem Bann wird die Gegenwart für das lyrische Ich allgegenwärtig. In diesem Gedicht übernimmt Kunert Wittgensteins Auffassung, daß Ewigkeit nicht „unendliche Zeitdauer“, sondern „Unzeitlichkeit“ bedeutet, in der ewig lebt, „der in der Gegenwart lebt.“10 Die Kehrseite dieses erfüllten Moments, in dessen Zeitenthobenheit selbst der barocker vanitas-Dichtung entlehnte „See von Plagen“ gänzlich beruhigt ist, besteht in seiner Entwicklungslosigkeit und Erstarrung. Die Gegenwart, ins Schweigen und in die Stille gebannt, erscheint als ein „endgeschichtliche[s] Vakuum“11 oder als „[e]rstorbne Zeit, die in sich selbst verharrt“, um einen Vers aus Kunerts Gedichtband Berlin beizeiten (1987) zu zitieren. Vor diesem Hintergrund beginnt die Bedeutung von Stille zu changieren. In dem Gedicht „Wenig Hoffnung“ wird die Stille als eine Art Friedhofsruhe künstlich durch Maschinen erzeugt, „die alles und alle überkommend verhindert, daß Unrecht ruchbar wird:
Aus weit offenen Luken strömt sie [= Stille, d.V.]
ohne merkliches Anzeichen
Der Schrei des Neugeborenen
erreicht die Mutter nicht mehr
Die Salven der Erschießungskommandos
werden so unvernehmlich wie
die nächtlichen Rufe von Tieren
(Stilleben, S. 19)
Zudem wird die Beschaulichkeit des Gedichts „Leichter Nachmittag“ im weiteren Fortgang von einem durchgängigen Ton der Klage konterkariert, deren Ursache in der zunehmenden Funktionslosigkeit von Lyrik zu sehen ist. Im Vergleich mit der „Cumäischen Sybille“, deren kryptische Weissagungen wie Gedichte interpretiert werden mußten und die ihre Höhle im Küstengebiet Kampaniens verlassen hat, wird das Ende der Dichtkunst annonciert:
Es gibt nichts mehr
zu künden
(Stilleben, S. 11).
Der prekäre Zustand der Welt ist eindeutig und bedarf keiner weiteren Auslegung. Deutlich wird, wie sehr Kunert auf dem Ursprung der Lyrik im Mythischen beziehungsweise im Religiösen insistiert.12 Der Aufsatz „Der Schlüssel zum Lebenszusammenhang“, der die Literatur als eine Variante des Mythos begreift, hebt die Archaik gerade des Gedichts hervor:
Das Gedicht, bekanntlich aus großer zeitlicher Ferne kommend, eine sibyllinische, dem Gebet und dem Zauberspruch verwandte Redeweise, hat seinen Ursprung nie völlig eingebüßt.13
Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, thematisieren die Gedichte dieses Zyklus darüber hinaus die schmerzhafte Anstrengung des Menschen; seine Naturhaftigkeit zu akzeptieren. Während die Vögel selbst „in der Dämmerung fliegen“, als ob die Nacht nie käme, sie also keine Ahnung vom Tode streift, ist dem Menschen zu jeder Zeit bewußt, daß er keine Ausnahme bildet, sondern „[…] wie alle davor und danach / aus Lehm und Ton sich bildet / aus Mergel und Sand“ (Stilleben, S. 12). Er hadert mit seinem unspektakulären Schicksal:
Aus dieser Stille kommen wir
und wollen doch niemals zurück 14.
Die Natur ist kein Refugium wie noch in den Gedichten der siebziger Jahre, sondern sie ist zur terra incognita geworden:
Sowenig eine Rückkehr in die Kindheit möglich ist, während welcher man durch Vertrauen zur Mutter geborgen war, so wenig gibt es ein ,Zurück zur Natur‘, zu ihrer Unverdorbenheit, Wunderfülle und unüberschaubaren Vielfalt, die uns bei Bedarf tröstete und erhob, und mit der wir – geschichtlich gesehen – kurzen Prozeß gemacht haben.15
DAS FUNDAMENT
Sonne. Die Quelle. Photonen.
Langsam leben wir auf.
Wo wir auch immer wohnen,
sie bestimmt stets den Lauf
unseres verdämmerten Lebens
und streichelt zugleich unsre Haut:
An ihrem Leuchten vergebens
haben wir uns erbaut.
Durchstrahlend maßlose Räume:
Für niemanden sonst ein Fest
als für unsre ärmlichen Träume,
die wer uns träumen läßt:
Daß sie nämlich gezündet
für uns bloß ganz allein.
Wir haben es selber ergründet:
Es muß die Wahrheit sein.
So sind wir mit ihr eines
und können nicht untergehn.
Die Wahrheit des schönen Scheines
bleibt unberührt bestehn.
(Stilleben, S. 14)
In der ersten Strophe wird am Beispiel der Sonne deutlich gemacht, daß die Natur zwar als das Fundament, allen Daseins begriffen wird, doch gilt die Sonne dem Menschen nicht nur als reine Lebensspenderin, sie ist gleichzeitig zum Symbol für menschliche Errungenschaften und zur Metapher seiner selbstgewissen Rationalität geworden. Verlöre die Sonne diese symbolische Macht, hätte dies für das menschliche Selbstverständnis fatale Folgen. Die Verkennung der „Funktion von Symbolik als Ausdruckshilfe unserer Selbst“ ginge mit dem Verlust „existenznotwendiger Mittel der Selbstdarstellung“16 einher:
Wir benötigen aber solche, um uns selber begreifen zu können. Wechselnde „graue“ Theoreme führen nur zu einer wechselnden Verkleidung unseres Ichs, das unverwechselbare Symbole braucht, damit es Halt und Umriß erhält.17
Diesen Mechanismus der Selbstvergewisserung führt das Gedicht in der vierten und fünften Strophe in einer paradoxen Setzung vor, indem es eine Hypothese („Daß sie [= Sonne] nämlich gezündet / für uns bloß ganz allein“) als bewiesene Tatsache („Wir haben es selber ergründet: / Es muß die Wahrheit sein“) proklamiert und damit auch das menschliche Streben nach Erkenntnis verspottet. Keinesfalls zufällig wird diese die menschliche Selbstdarstellung in Frage stellende Kritik am Beispiel der Sonne ausgeführt. Die Sonne ist in diesem Kontext Paradigma für die Lichtmetaphorik der Aufklärung. Die Kritik ist also hier eine zweifache: Wissenschaftskritik und Ideologiekritik.
Doch selbst die Zurückgeworfenheit auf das naturhafte Dasein als primitivste Form menschlicher Existenz ist nicht der Schlußpunkt. Mit der Zerstörung der Natur kommt eine neue Dimension hinzu:
MUTATION
Steine wachsen aus der Erde
wo eben noch Brot keimte
Wälder atmeten
wo der einsame Falter seinesgleichen
suchend über das Gras strich:
Steine und immer mehr
Kein Erinnern
an die schlaftiefen Schatten
an die Gnade der Blätter
unbemerkt ihr Verschwinden
ihr Nachlass:
Ein fahles Reich aus Sand
Immer mehr erheben
ihre Schädel ohne Gesicht
aus diesem Boden
solche wie wir
(Stilleben, S. 16)
Die Erde ist durch die menschliche Ausbeutung in eine Sandwüste verwandele und ,unbewohbar wie der Mond‘ geworden. Doch zeitigt diese Abtötung der Natur schließlich ihre selbstmörderische Konsequenz. Die ,Mutation‘ des fruchtbaren Bodens in ein „Fahles Reich aus Sand“ läßt in diesem die Frucht des Todes aufgehen. Parallel geht diesem Prozeß die schockhafte Erkenntnis einer Entindividualisierung, in der „wir“, die scheinbar Lebenden, wie ein Sandkorn dem anderen und ein Totenschädel dem anderen gleichen.
1. Demontagen
Der dritte Zyklus18 des Gedichtbands Stilleben schließt an den negativen Befund an und fragt unter der Überschrift „Geschichtsbewußtsein“ nach den ideologischen Ursachen der konstatierten Katastrophe. In einem Querschnitt zeigt dieser Zyklus „die Schöpfungspotenz unserer Gattung auf, von den Bildern in der Höhle bei Lascaux bis zum Start der Raumfähre Columbia“,19 doch bilanziert er die menschliche Geschichte nicht als sinnhafte, wie die Geschichtsschreibung dies seit Herodot tut. Vielmehr entlarvt Kunert in Anlehnung an die Philosophie Theodor Lessings20 Geschichtsschreibung und damit Geschichtsbewußtsein als Produkt menschlicher Interpretation. Dieser „Akt der Selbsttäuschung“21 ist nach Kunert die Voraussetzung dafür, daß sich Geschichte überhaupt als strukturierte und damit sinngerichtete Bewegung erkennen läßt:
GESCHICHTSBEWUSSTSEIN
Raschelndes Pergament
Folianten: In den Schichten von Staub
Schleifspuren von Rattenschwänzen
die zarten Abdrücke ihrer Krallen
Bildungshungrig
verschlingen sie aufbewahrte Jahrhunderte:
Den eilfertigen Vers des Dichters
Den Imperativ der Herrscher
Den blumigen Adjektiv der Prediger
Steife Begriffe von Philosophen
Das Sein und das Nichts
unausrottbar
und widerlegen knabbernd
die Unantastbarkeit des Geistes
den Widerstand des Wortes
die sich am Ende doch
in schwärzliche Krümel verwandeln
trotz allen Lamentos
und trotz heftiger
chemikalischer Gegenwehr
(Stilleben, S. 51)
„Geschichte ist Selbstbewußtsein des Menschengeschlechts“,22 schreibt Theodor Lessing. Akzeptiert man diese Definition, entwirft Kunerts Gedicht ein schreckliches Szenario, in dem Ratten die aufgeschriebene menschliche Geschichte auffressen und damit vernichten und die Menschheit so der Orientierungslosigkeit und dem Chaos anheimfällt. Geschichtsverlust hat für den modernen Menschen die prekäre Folge des Identitätsverlusts, wie das Gedicht „Vorfall“ vorführt:
Sprachlos über die leeren Seiten
der Geschichte geneigt
wußte ich nicht mehr
was war was ist
wer ich bin
sein kann sein will
werde
(Stilleben, S. 52)
Kunert nennt in seinem Aufsatz „Der Schlüssel zum Lebenszusammenhang“ die Geschichte „[e]ine der Metamorphosen von Mythos“23 und die Nachfolgerin der christlichen Mythologie, deren „Überzeugungskraft und Einfluß“ mit der Entstehung der Aufklärung verloren ging. Die säkulare Deutung des Geschichtsprozesses verlieh der Historie die Dignität von Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit. Ihr erschien Geschichte als eine „Kette von Ursachen und Wirkungen“, in der den einzelnen Personen und Ereignissen ihr unverrückbarer Ort zukam. Diese retrospektive Legitimation alles Geschehenen nannte Theodor Lessing ,Sinngebung des Sinnlosen‘.
Die ständige Um- und Neuschreibung der Geschichte bezeichnet Kunert in einer Variation von Blumenbergs bekanntem Diktum als „Dienst am Mythos“, denn „der Sinn, den wir der Welt unterstellen, muß immer erst erfunden werden, denn in der Welt selber ist er nicht enthalten.“24 Neben dem „Imperativ der Herrscher“ stehen die Worte der ,Vertreter des Geistes‘, die in das zufällige Nacheinander der historischen Ereignisse Gerichtetheit und Fortschritt interpretieren:
Sie säen Meinung, verschänken Gesinnung, erwählen Völkerbrand und Massenuntergang, Millionenmord und Seelennot zum Stoff ihrer Rede und Dichtung, weil denn Darüberreden und Darüberschreiben den Beruf der alles könnenden, alles sagenden Sendungslosigkeit ausmacht.25
Doch Kunert kritisiert nicht nur Panegyrik und Geschichtsklitterung, selbst der „Widerstand des Wortes“, im Gedicht mit Jean-Paul Sartres „L’Être et le Néant“ angesprochen, dient ihm nurmehr als Projektionsfläche eines um historische Selbstvergewisserung strebenden Subjekts, auch wenn seine Philosophie auf der existentiellen Freiheit des Menschen gegründet ist. Was Kunert in diesen beiden Gedichten betreibt, ist „Erkenntniskritik der Geschichte“.26 In Anlehnung an Theodor Lessing, der vorschlug, Geschichte als eine „umdichtende Wissenschaft“ zu definieren, erkennt Kunert in der Geschichte zwar „das Selbstbewußtsein des Menschengeschlechts“, jedoch als ein phantasmagorisches Produkt der sie interpretierenden Menschen wie Herrscher, Dichter, Priester oder Philosoph. Geschichte in diesem Verstande existiert demnach nur als Geschichtsschreibung, als eine künstliche Stiftung und Konstruktion von Sinn. Zweifel an dieser .autoritären Ersatzreligion. werden, so folgert Rita Bischof in ihrem Nachwort, „als ein Frevel empfunden und als Frevel geahndet“.27 Das Eingeständnis, daß Geschichtsschreibung eine Camouflage unbedeutender Zufälle wäre, ginge mit der Entzauberung des Selbstbildnisses einher, das der Mensch von sich entworfen hat und das Kunert in dem Gedicht „Götterdämmerung“ radikal als geschönt entlarvt:
Du kannst die Einsicht nicht ertragen:
Aus Dreck und Feuer eine Spottgeburt,
die haltlos durch das Universum tourt,
stets auf der Flucht vor solchen Fragen.
(Stilleben, S. 53)
Wie sehr an der fatalen Interpretation von Geschichte gerade auch Schriftsteller mitgewirkt haben, macht Kunerts böse Abrechnung mit seinem einstigen Vorbild Bertolt Brecht deutlich:
DEUTSCHER DICHTER, GÜTEKLASSE A
Befaßt mir sich selber
wie mit der Revolution:
Glanzvolle Verse über die Notwendigkeit
des Schreckens
Heldenverehrung hymnisch
Reimloser Ruhm den Kämpfern
aller letzten Gefechte
Fragen nach den Erbauern
des siebentorigen Theben
nach seinen Zerstörern keine
Urteile am laufenden Wortband
Ein Spiel mit der Sprache
auf willigen Tasten
hinter dem Rücken der Welt
aber die Hand
zurückgezogen
ist blutig
(Stilleben, S. 65)
Die beiden ersten Verse: „Befaßt mit sich selber / wie mit der Revolution“ verknüpfen Brechts Egozentrik und sein Programm des eingreifenden Handelns in die Geschichte zu einer untrennbaren Einheit. Diese Verknüpfung psychologisiert Brechts Schreiben zu einem Akt der Egopflege. Indem Kunert Brechts poetisches Prinzip der reimlosen Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen als formale Struktur seines Gedichts übernimmt und mit der gezielten Brechung der Zeilen „Glanzvolle Verse über die Notwendigkeit / des Schreckens“ konterkariert, will er dessen wahres Anliegen, die Partizipation an der Macht, kenntlich machen. Der alludierte Vers aus dem zentralen Gedicht „Fragen eines lesenden Arbeiters“ erweise sich als ideologisches Kalkül, wenn an diese Frage diejenige nach den Zerstörern nicht angeschlossen wird. Mit der Frage nach den Erbauern des siebentorigen Thebens kritisierte Brecht die bürgerliche Historiographie, Kunerts Metakritik sucht deutlich zu machen, daß Brecht mit seinem Klassenstandpunkt lediglich anderen Machtstrukturen aufsitze: Für Kunert sind Erbauer und Zerstörer identisch. Die verblose Aneinanderreihung der Zitatbruchstücke zeitigt eine frappierende Verfremdung, die die Gefährlichkeit von Sprache als Herrschaftsinstrument („Urteile am laufenden Wortband“) intensiviert. Vor allem die Weiterführung des Verses „hinter dem Rücken der Welt“ soll das Prinzip der Durchleuchtung von Unterdrückungsmechanismen ad absurdum führen. Die Charakterisierung von Brechts Sprache als „Spiel […] auf willigen Tasten“ setzt sich zum Ziel, die Willkür von dessen Versen zu denunzieren. Brechts Auffassung von Sprache als „Werkzeug des Handelns“ macht ihn in diesem Gedicht zum Mittäter an einer verfehlten Geschichte:
aber die Hand
zurückgezogen
ist blutig
Der letzte Vers läßt eine Reminiszenz an Kunerts frühes Gedicht „Geschichte“ zu („Glücklich wer am Ende mit leeren Händen dasteht“) und ist gleichzeitig Kunerts eigene Rechtfertigung, seinem alten Lehrer abzuschwören.
Nach Jay Rosellini28 ist das Gedicht „Deutscher Dichter, Güteklasse A“ Kunerts einziges Portrait-Gedicht zu Brecht. Wie stark es unterschwellig auch eine ,Auseinandersetzung mit eigenen früheren weltanschaulichen Positionen enthält, macht van Ingens Definition dieses Genres deutlich. Das lyrische Portrait trage „häufig nicht nur die Züge des Porträtierten, sondern in gleichem Maße die des Porträtierenden“.29 Die radikale Anwendung von Brecht, die ich im Gegensatz zu Rosellini sehr wohl als einen „Bildersturm“ bezeichnen würde, findet bereits 1981 in einem Vorabdruck von Kunerts dritter Poetikvorlesung unter der Überschrift „Über das hartnäckige autoritäre Denken“30 statt, dessen Becher und Brecht – diese für Kunert nur „scheinbar“31 konträren Doyens der DDR-Literatur – bezichtigt werden. Die Ursache für deren ideologische Anfälligkeit macht Kunert an ihrem Verhaftetsein im autoritätsgläubigen 19. Jahrhundert fest, die für ihn in einer fatalen Ichschwäche manifest wird:
Das schwache und sich selber bezweifelnde Ich, welches die Fähigkeit errungen hat, die eigene Individualität in Frage zu stellen, sucht Halt und Ausgleich durch mächtige Schimären.32
Eine „Stützung des Selbstwertgefühls“ erreiche Brecht durch eine „Anleihe“ bei fremder Stärke, wie dies für Kunert Brechts Gedicht „Der Große Oktober“ vorführt. Mit diesem Gedicht werde Brecht zum Interpreten von Geschichte, und wie sehr auch in diesem Fall der Geschichtsschreiber ein Ereignis idealisiere, zeige sich in der ideologischen Verbrämung der tatsächlichen Verhältnisse:
Mitte der dreißiger Jahre, und Brecht wußte es nur zu gut, denn er wählte einen anderen Aufenthaltsort, war es mit der Fröhlichkeit und dem Siegesgefühl der Massen in der Sowjet-Union nicht mehr weit her.33
Bereits 197334 hatte Kunert darauf hingewiesen, daß es sich seines Erachtens bei Brechts Lyrik oft um „Wunschprojektion[en]“ handle. In seiner Festnote zu Brechts 75. Geburtstag befragt Kunert dessen Gedicht „Die Teppichweber von Kujan-Bulak ehren Lenin“ auf seine Aktualität. Kunert fürchtet nämlich, daß die zeitgenössische Rezeption Brecht zu einer „Autorität wie jede[n] andere[n] Klassiker auch“ hochjuble und ihm damit „[e]in postumes Schicksal von bitterer Ironie“ beschere. Doch gerade Brecht habe, so Kunert, in seinem Gedicht „Die Teppichweber von Kujan-Bulak ehren Lenin“ gezeigt, daß es ihm nicht um autoritäre Anweisung gehe, sondern um Einsicht und Verstehen. Diese Angst, daß Brecht ein Opfer der Verehrung und damit des „alten bürgerlichen Geniekult[s]“ werde, der nach Kunert in einem sozialistischen Staat nichts zu suchen hat, thematisiert auch das Gedicht „Vom Dorotheenstädtischen Friedhof“. Wenn „die Macht über die Ohnmacht des Wortes“ triumphiert, werden die toten Dichter zur „weiterwährende[n] Gebrauchsfähigkeit“ verdammt:
Die Neinsager von gestern werden nachträglich umgedeutet zu Jasagern, mit deren Hilfe die Macht die lebendigen Neinsager einschüchtern und belügen kann, damit sie es sich noch einmal überlegen. […] Durchschlagende Wirkungslosigkeit sogenannter Klassiker.35
Die Abwehr der drohenden Stilisierung Brechts zum Klassiker, seine Rettung „vor dem unseligen Schicksal auf dem Sockel“ ist nicht das zentrale Anliegen dieses Essays. Kunert insistiert in seiner Interpretation darauf, daß der Realismus des Teppichweber-Gedichts nicht darin bestünde, daß diese Leute in dieser „beneidenswert unseligen Lage“ wirklich existierten, sondern darin, daß die „einsichtsvolle[] Vernunft […] den armen Leuten im Gedicht wahrhaft angedichtet wird“.36 Indem Kunert das Gedicht vor einer einseitigen Interpretation als „sozialistische Gebrauchsanweisung“ in Schutz nimmt, bestehe er jedoch fälschlicherweise darauf, daß die Teppichweber in dieser historisch-sozialen Situation eine reine Erfindung Brechts sind:
[…] so sind die Teppichweber wahr und unwahr im selben Augenblick. Sie sind wahr als gestaltgewordener Vorschlag Brechts an den Leser [!] vernünftige Entscheidungen in seiner Lebenspraxis zu finden – unwahr, indem sie diese Entscheidungen als bereits aufgetretene allgemeine historische Qualität behaupten.37
Theodore Fiedler geht in seinem Aufsatz „The Reception of a Socialist Classic: Kunert and Biermann Read Brecht“ nicht von einem Lesefehler Kunerts aus, zumal bekannt war, daß Brecht sich auf einen authentischen Fall beruft, von dem 1929 in der Frankfurter Zeitung berichtet wurde.38
He insists, for example, that the weavers whose story the poem tells are fictions, that their decision to honour Lenin in a way different from the way he has been honoured by others is merely an embodiment of Brecht’s dialectical thinking, even through Kunert is aware that the poem evokes the real world as its frame of reference and that Brecht based it on an account of an incident entitled „A Monument for Lenin“ which appeared in the Frankfurter Zeitung 1929.39
Für Fiedler kündige diese durchgängig falsche Lektüre bereits Kunerts Abneigung gegen Brecht an, den er als den Exponenten der sozialistischen Literatur und Literaturtheorie ansah. Die Tatsache jedoch, daß Kunert in seinem Essay den Wirklichkeitsbezug ableugnet und auf der Fiktionalität des Gedichts bestehe, ist vielmehr der ernsthafte Versuch, Brecht vor einer okkupistischen Erberezeption und einer doktrinären Literaturkritik zu retten:
Ist darum das Gedicht von den Teppichwebern kein realistisches Gedicht, weil die evozierte Wirklichkeit dieser Zeilen unglaubwürdig ist?40
In seinen „Überlegungen“ verschließt Kunert die Augen davor, daß Brechts Gedicht anderes sein könnte als „pure Literatur“.41 Diese manipulierte Interpretation entspricht Kunerts eigener dichtungstheoretischer Position, die die „allen Gedichten innewohnende[] Eigenart, bedeutungsvoll und bedeutungslos zugleich zu sein“ nur erfüllt sieht, wenn „alle Fäden zur Wirklichkeit“42 gekappt sind. Die zunehmende Distanzierung von Brecht bezeugt 1981 Kunerts Poetik-Vorlesung, in der er sich durch die Kritik an dem rein propagandistischen Gedicht „Der Große Oktober“ demonstrativ von Brechts ideologischer Position43 absetzt, wie er es auch in der lyrischen ,Abrechnung‘ „Deutscher Dichter, Güteklasse A“ unternimmt.
Gegenübergestellt ist dem Brecht-Portrait das Gedicht „Bruder Kleist“, der Kunert, wie der Verwandtschaftsgrad andeuten soll, als positive Identifikationsfigur gilt. Obwohl sich durchaus der Kleistschen Ambivalenz, hier anarchischer Gerechtigkeitssinn eines „Michael Kohlhaas“, da die „Hermannschlacht“ und der martialische deutsche Patriotismus, bewußt, sieht Kunert in Kleists tragischem Schicksal den paradigmatischen Lebenslauf eines unangepaßten Schriftstellers:
Im Lande der Dichter und Denker bestand schon immer amtlicherseits eine vertuschte Aversion gegen eben diese Vertreter geistiger Tätigkeit – zumindest solange sie am Leben sind.44
BRUDER KLEIST
Legendenlast: du trägst sie schwer.
Du ahnst zuviel. Und wagst nichts mehr.
Die Welt verläuft. Du bist allein.
Und bist zugleich der Widerschein
von einem längst verwehten Geist
von dem du nur den Namen weißt.
Ein deutsches Schicksal: Was da tönt
ist stets ein Schuß. Bleib unversöhnt.
(Stilleben, S. 64)
Kunerts intensive Auseinandersetzung mit Kleist beginnt 1975, als er für einen von Peter Goldammer herausgegebenen Sammelband anläßlich des Gedenkjahrs zum 200. Geburtstag von Kleist sein „Pamphlet für K.“ verfaßte. Auch hier ist wie in den „Überlegungen“ der Aufhänger die sozialistische Erberezeption. Kunert geht es in diesem Essay nicht um Kleists schriftstellerisches Werk, sondern um dessen Leben,45 das dem eigenen wahlverwandt scheint:
Und bist zugleich der Widerschein
von einem längst verwehten Geist
Ein Phänomen, das sich auch für Kunerts lyrische Portraits von Heine und Lenau konstatieren läßt. Im Mittelpunkt seines Interesses steht „[e]in deutsches Schicksal“: die Vita Kleists und vor allem dessen Verhältnis zum preußischen Machtstaat. Kunert erklärt in seinen unveröffentlichten Tagebuchnotizen46 diese Analogie: Ebenso wie Preußen war die DDR ein „abgeteiltes deutsches Land im Zustand ökonomischer Zurückgebliebenheit mit einer streng abgeschlossenen Machtelite (vergleichbar dem Adel)“. Die von der Partei vertretene „wissenschaftliche Weltanschauung,, die Ideologie und Parteidisziplin, wiederum normsetzend und zwischenmenschliche Beziehungen restriktivem Ordnungsdenken unterwerfend“, hat den feudalen Verhaltenskodex ersetzt. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie wichtig und vorbildhaft für Kunert Kleists fehlende Autoritätshörigkeit ist:
Ich [= Kleist, d.V.] soll tun, [!] was der Staat von mir verlangt […] Zu seinen unbekannten Zwecken soll ich ein [!] Werkzeug sein – ich kann es nicht. Ein eigener [!] Zweck steht mir vor Augen, nach ihm würde ich handeln müssen, [!] und wenn der Staat es anders will, dem Staate nicht gehorchen dürfen.47
Kunert sieht in Kleists Schicksal ein Spiegelbild des eigenen Lebens, durch die Distanz der Vergangenheit zur Kenntlichkeit entstellt. Mit Kleists Ehrenrettung vor der sozialistischen Literaturgeschichtsschreibung bereitet Kunert seine eigene Rehabilitierung in der zeitgenössischen DDR-Kritik mit vor. Kleists Diffamierung in der deutschen Literaturgeschichte beginnt mit Goethes Verdikt, seine Dichtung trüge das Stigma von Krankheit und Hypochondrie, damit schien „jede Revision ausgeschlossen“.48 Noch 1972 bezieht sich das Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller, herausgegeben vom VEB Bibliographisches Institut Leipzig,49 auf dieses „schein-wissenschaftliche[] Vorurteil“:
K.s Werk wird bezeichnet als ,eigentümliche Vermischung von… Gesundheit und Krankhaftigkeit…‘ Auch wird ihm unterstellt, er ,streifte in den krisenhaften Zeiten seines Lebens und Schaffens nicht selten die Grenze zum Pathologischen‘.50
Die Beibehaltung dieser Argumentation ist für Kunert ein Rückschritt in die Barbarei, da die Verquickung von Medizin und Literatur spätestens „seit Hitler suspekt“ sein müßte, manifestiere sie doch ein „inhumanes Denken“,51 auf das vehement schon Peter Szondi hingewiesen hat, dessen Stellungnahme Kunert im folgenden zitiert:
„Krankheit, Unnatur: das sind Urteile, die übers Ästhetische weit hinausgreifen [!] und nicht bloß ein Kunstwerk als schlechtes verwerfen, sondern den Weg bahnen zu einem Verdikt, von dem das Lebensrecht des Künstlers selbst ereilt wird… Das beginnt mit der Verdammung der französischen Klassik als naturferner Kunst, führt zu Goethes Urteil über die Kleistsche Dichtung als Zeichen von Krankheit, von Hypochondrie, und mündet in die Barbarei, in der, was der eigenen Vorstellung vom Gesunden sich nicht fügte, als entartet verfolgt wird: die Kunst ebenso wie der Künstler, die eine wird verbrannt, der andere, im besten Fall, mit Berufsverbot belegt“.52
Vor diesem Hintergrund definiert Kunert die „seelischen und geistigen Voraussetzungen“ nicht nur des Kleistschen Schreibens. Literatur entstehe in einer mentalen beziehungsweise emotionalen Extremsituation, und es sei nicht der glückliche Mensch, der schreibt, sondern der Umstand,
daß erst einer erkranken muß an der Welt, um sie diagnostizieren zu können als das Heillose schlechthin; daß alle große Literatur, bewußt oder unbewußt, solche Diagnose enthält, wohingegen eine Welt, die sich als „gesund“ deklariert und ihren Diagnostiker für krank, soweit selber der Normalität enträt, daß sie ihre eigenen Leiden verkennt oder diese als ein Zeichen besonderer Vitalität sogar noch ausstellt.53
Diese Definition von Kunst und der unterschwellige Vorwurf, noch in faschistischen Bewertungskategorien befangen zu sein und dabei gleichzeitig Goethe „in die Ahnenreihe der präfaschistischen Ideologien“ einzugliedern, veranlaßten Peter Goldammer zur Ablehnung des Manuskripts. Kunert veröffentlichte seinen Essay versehen mit einem „Notwendige[n] Nachwort zum ,Pamphlet‘“54 1975 in Sinn und Form. Er sieht sich durch Goldammers „rigide[n] Zensurismus“ in seiner Kritik und darüber hinaus in der Beurteilung der zeitgenössischen „Literaturgesellschaft“ bestätigt. Ihre Exponenten huldigen einem „bürgerliche[n] Geniekult, welcher, abgestritten und zugleich ,sozialistisch‘ modifiziert, nicht enden will und immer zum Personenkult tendiert“,55 gleichzeitig dehnen sie ihre „dogmatische[n] Literatur-Verkennungen“ auch auf lebende Autoren aus, die mit derselben ideologischen Keule erschlagen werden. Kunert, dem selbst zum Beispiel von Kurt Hager eine „Atomkriegspsychose“ diagnostiziert wurde, hebt am Ende dezidiert hervor, worum es bei einer kritischen (Klassiker-) Rezeption gehen sollte. Der Leser soll „Bezüge zu sich und seiner Person“ herstellen, und die Literatur sollte ihn dazu anleiten, „all jene pathologischen Eigenschaften und Verhaltensweisen zu diagnostizieren, an denen die Welt leidet, und damit bis zu einem gewissen Grade zu ihrer Therapie beizutragen.“56
2. Am Rande des Scheiterns – Antifaustische Reflexion
Der vierte Zyklus des Gedichtbands Stilleben ist mit dem Zitatfragment „Verweile doch“ überschrieben. Diese Anspielung auf Faust verblüfft, gehört doch Goethe zu Kunerts bestgehaßten Klassikern. Seine Aversion beruht, so Kunert, auf einer psychischen Fremdheit, und er betont in seinem Aufsatz „Goethe, verfremdet“ noch einmal sein verwandtschaftliches Verhältnis zu Kleist:
Unser literaturzugewandtes Bewußtsein ist eher von Gestalten wie Büchner und Kleist affiziert, deren Schicksal uns, selber nicht gerade vom Schicksal Verwöhnte, nähergeht.57
Die Faustfigur gilt Kunert dann auch als paradigmatisches Vorbild seiner Zeitgenossen: ihre Fortschritts- und Wissenschaftsgläubigkeit erfüllt sie mit dem Wahn, sich der göttlichen Schöpfungspotenz angenähert zu haben:
ZUM START DER ,COLUMBIA‘
Der starre Blick der Basiliskenheere
vor jedem Aufstieg in die schwarze Sphäre:
Gleichgültig harrend auf die gleichen Worte
von den Gestalten in der engen Fähre:
Was immer – ob von ihrem fernen Orte
ob nur aus ihres Schlafes Todesschwere –
sie von sich geben an verbaler Leere:
Das als ein Ziel ist nie gewesen:
So Göttern gleichen. Ohne Spur von deren Wesen.
(Stilleben, S. 55)
Der Flug ins All dient als Bild der Selbstherrlichen, Überhebung des Menschen über sämtliche vorgegebenen Grenzen; doch diese göttliche Potenz wird durch den letzten Vers des Gedichts „Zum Start der ,Columbia‘“ „So Göttern gleichen. Ohne Spur von deren Wesen“ destruiert. Im technischen Know-how, also rein äußerlich, scheint die Entwicklung zum Gott gelungen zu sein, doch die humane Weiterentwicklung hat dieses Tempo nicht mithalten können. Die innere Leere spiegelt sich im „starre[n] Blick der Basiliskenheere“. Es ist ein todbringender Blick, der mit der „verbale[n] Leere“ zugleich die der technischen Entwicklung parallellaufende kommunikative Verarmung indiziert. Im perfiden Bestreben, Gott gleich zu werden, bleiben die genuin menschlichen Eigenschaften, wie die Fähigkeit zur Kommunikation, auf der Strecke. Der Basilisk muß in der Mythologie so lange töten, bis er durch magische Kräfte bezwungen wird. Da diese ,magischen Kräfte‘ jedoch von den ,aufgeklärten Basilisken‘ geleugnet werden, ist für sie eine Erlösung unmöglich geworden: durch die Entzauberung der Welt bleibt das menschliche Handeln als unendlicher Prozeß des Tötens der mythischen Determinierung unterworfen.
Welche fatalen Folgen die alleinige Orientierung an den menschlichen Erkenntniskräften hat, thematisiert das nachfolgende Gedicht „Befreiung“, in dessen Mittelpunkt noch einmal die Raumfahrt als „Aufbruch ins Ziellose“ (Frank) steht.
BEFREIUNG
Zwerge
in glänzende Folie gewickelt
haben die Kuppel des Ptolemäus
gesprengt: Wir schwankten
unter dem Anprall von göttlichen
Bruchteilen.
Jenseits des himmlischen Scheitelpunktes
die hohen Bewohner
fielen als Unsresgleichen zu Boden. Und
über den Tierkreis machten
Metzger sich her.
Alle sieben Schalen der Weisheit vergossen
in die Kanalisation ihren Inhalt. Wir
seien befreit hieß es
aus dem Kerker des alten Kosmos
und in einem endgültigen Universum
kardanisch aufgehängt
und zur alsbaldigen Sterblichkeit
bestimmt.
(Stilleben, S. 56)
Die gleiche todbringende Macht verbindet die beiden Gedichte. Das Ergebnis menschlichen Tuns ist die Zerstörung. Deshalb teilt Kunert die Euphorie des Aufbruchs ins All nicht. Die Helden der Neuzeit, als die die Astronauten gefeiert werden, faßt er ins Bild der mit Folie eingewickelten Zwerge. Die scheinbare Befreiung, die durch die Sprengung der „Kuppel des Ptolemäus“ initiiert wurde, ist, wie Hans Blumenberg ausführt, nicht nur ein wissenschaftliches, sondern ein „anthropologisches Ereignis“.58 Das ptolemäische Prinzip, das den Mensch als den Mittelpunkt alles Weltgeschehens und die Erde als das Zentrum des Alls ansah, wird durch ein abstraktes physikalisches System ersetzt. Das kopernikanische Weltbild reduziert den Menschen zu einer ephemeren Erscheinung. Mit der Geozentrik als Dogma mittelalterlichen Denkens wird aber auch die christliche Kosmologie verabschiedet und der endgültige Zerfall des religiösen Weltbilds als verbindliches Wertsystem eingeläutet:
[…] Wir schwankten
unter dem Anprall von göttlichen
Bruchteilen
Doch wurde dieser tiefe Bedeutungswandel nicht als Verlust verstanden, sondern als Entmystifizierung des Denkens und grenzüberschreitendes schöpferisches Handeln:
Jenseits des himmlischen Scheitelpunktes
die hohen Bewohner
fielen als Unsresgleichen zu Boden
Ebenso wie die moderne Wissenschaft die „antike“ Einteilung der Physik in Optik, Akustik usw. durch abstrakte Beziehungssysteme ersetzte, machten „über den Tierkreis […] Metzger sich her“. Die Astrologie als der Versuch, das Geschehen auf der Erde und das Schicksal der Menschen anhand der Gestirnkonstellationen zu deuten, wurde aus dem Bewußtsein verbannt.
Alle sieben Schalen der Weisheit vergossen
in die Kanalisation ihren Inhalt
Die Befreiung vom alten Aberglauben sollte eine Befreiung aus „dem Kerker des alten Kosmos“ bedeuten, doch sie entlarvte sich als die Etablierung eines noch größeren Gefängnisses. Die Entmystifizierung des Weltbildes hinterließ den Menschen in transzendentaler Obdachlosigkeit. Wenn Kunerts Gedicht sich in dieser Situation mit vorrationalem Wissen belädt, geht es nicht darum, ein geschlossenes metaphysisches Gedankengebäude zu errichten, sondern lediglich auf den Preis zu verweisen, den die Herrschaft zweckrationalen Denkens zu entrichten verlangt. Zudem will Kunert darauf aufmerksam machen, daß die Poesie sich nicht-rationale Bedürfnisse und Redeformen des Menschen zu eigen machen kann und damit tendentiell Funktionen übernimmt, die vorher der götterbewohnte Himmel erfüllte. Die Heillosigkeit des menschlichen Daseins benennt Kunert als „Vorwinter“ und beschreibt in „Symbolisches Seestück“ (Stilleben, S. 75) die Welt als Eisgebirge und wüstes Meer. Sie gelten in der literarischen Tradition als „Orte der Seelenlosigkeit“, die Manfred Frank in seiner Studie „Die unendliche Fahrt“ aufsuche. Kunert liest diese Stätten als Chiffren für ein „unmöglich gewordene[s] menschliche[s] Leben“.59 Seine lyrische Reise endet im Gedicht „Symbolisches Seestück“ mit einem Schiffbruch „am Kap / der guten Hoffnungslosigkeit“ (Stilleben, S. 75).
Der faustische Mensch hat das Prinzip Hoffnung durch das der Hybris ersetzt. Jean Améry führt diesen Antrieb zunächst einmal völlig wertfrei auf den „prometheische[n] Elan“ zurück, der für ihn im Gegensatz zum Blochschen Prinzip Hoffnung, das er der „religiöse[n] Heilserwartung“ zuordnet, „zu den großen Mythen und Triebkräften der modernen Zivilisation“60 gehört. In seinem Mittelpunkt steht die Naturbeherrschung beziehungsweise -bewältigung. In Amérys Augen bedeutet das keine Absage an die Utopie, sondern der faustische Mensch hängt paradox formuliert einer „pragmatischen Utopie“ an. Améry erklärt dieses Paradoxon am Beispiel von Thomas Morus’ Entwurf von Utopia:
Die großen Utopien der Vergangenheit waren zugleich technische und soziale. Thomas Morus fand die Grundlage seiner Utopie sowohl im urchristlich-sozialistischen Zukunftstraum als auch in der technisch-militärischen Tatsache einer mächtigen, die Insel der Seligen beschirmenden Flotte.61
Es geht also um die „Vision einer zugleich technisch und human entwickelten, durch eben das technische Mittel zur Humanität gelangenden Welt“62 Genau an diesem Punkt setzt Kunert – wie Herbert Marcuse, der ebenfalls die technische Utopie als unvereinbaren Gegenpol der sozialen verstand – mit seiner Zivilisationskritik an: die humane Entwicklung konnte mit dem Tempo des technischen Fortschritts nicht mithalten, spätestens jedoch in dem Moment, als die Technik autonom wurde und zum Selbstzweck verkam, hatte sie ihre Anbindung ans Humanum verloren. An diesem dialektischen Wendepunkt, an dem sich der Mensch dem Götzen „Technik“ unterwirft, spricht Günther Anders von der „prometheischen Scham“ und versteht darunter die „Scham vor der ,beschämend‘ hohen Qualität der selbstgemachten Dinge“:63 der Mensch dagegen ist seinen Fabrikaten unterlegen.
Kunert stellt in dem letzten Zyklus des Gedichtbands Stilleben dem faustischen Menschen den schreibenden entgegen:
[…] Du hältst
den Moment ganz fest
und er schleift dich schon mit
in Vergangenheit.
(Stilleben, S. 87)
Er spricht das „Verweile doch“ in dem Bedürfnis, die Schönheit der Welt zumindest für den Augenblick zu retten. Doch die zitierten vier Zeilen enthalten die ganze Unmöglichkeit, Gegenwart festzuhalten. Selbst ihrem schriftlichen Fixieren ist das Scheitern eingeschrieben, obwohl sich nur im Schreiben das ereignen könnte, „was jeder insgeheim wünscht: daß der Moment einen Moment lang Dauer behält und immer wieder erweckt werden kann.“64 Dieser Zeitverlust ist für Kunert in der „Verdinglichung und Veräußerung des Menschen begründet, durch die Fixierung auf die Schätze dieser Welt“ erfolgt der endgültige Verkauf der Seele an Mephistopheles, woraus die von Anders konstatierte Selbstverachtung und „immer widerspruchslosere Unterwerfung unter Zwecke“65 resultiert.
Doch hier gerät Kunert in die Gefahr der Redundanz. Immer wieder werden Geschichte und Gegenwart gleichermaßen als Kreislauf von Vernichtung, Vergessen und Untergang konstruiert. Roderich Feldes kritisiert einen „Bouvard-und-Pécuchet-Effekt“:
Die vermittelte Erkenntnis ist bekannt, ins allgemeine Bewußtsein abgesunken, ihr klassisch gefaltetes Gewand kann nicht verdecken, daß sie darunter hohl ist.66
Diese Kritik scheint den Gedichten selber immanent. Dominierend ist der Selbstzweifel – dem faustischen Menschen prinzipiell fremd – an der dichterischen Fähigkeit:
Zu allen irdischen Qualen
noch diese: Das Wort nicht zu finden
(Stilleben, S. 90).
Der Titel „Vergeblicher Versuch“ leitet eine Gruppe von Gedichten ein, deren klagender Ton an barocke memento mori-Texte gemahnt, denen jedoch ein ausgesprochen paränetischer Charakter fehlt. Ihr Mittelpunkt ist die der Erkenntnis des „vanitas vanitatum vanitas“ implizite Schwermut. Hier versammelt Kunert noch einmal Ikonen der Vergänglichkeit wie zum Beispiel die „Tierseemuschel“, von deren Leben nur noch die kunstvolle ästhetische Hülle zeugt und die damit wieder den Kreis zum Genre des Stillebens in der bildenden Kunst und zum Titel des Gedichtbands schließt.67 Gleichzeitig reagiert das lyrische Ich mit einem radikalen Rückzug auf sich selbst und seine persönliche Situation:
Jemand, der als erstes sein Ich in die Wagschale wirft, hat wohl kaum mehr zu bieten als dieses.68
Diese Konzentration des lyrischen Ichs auf sich selbst und seine „eigene Beschädigung“69 läßt Kunerts „Weltdiagnose“ – so Harald Hartung in seiner Rezension – einzig noch überzeugen. Angesichts der schonungslosen Selbstportraits verlören „die Einwände gegen die Formelhaftigkeit einiger Verse und Reime ihr Gewicht“.70
Kunert charakterisiere sein Schreiben in den letztveröffentlichten theoretischen Reflexionen als Akt der Desertion, als Fluche aus dem Dasein. Noch einmal gibt „Psychologisches Gedicht“ eine Zustandsbeschreibung vom Exil in der Bundesrepublik:
Die Wege enden doch in Einsamkeit,
dem andern Land mit unsichtbaren Mauern;
wie ausserhalb der allgemeinen Zeit,
als wolle es für ewig dauern:
(Stilleben, S. 88)
Der Verlust der Heimat hat einen Zeitverlust zur Folge, aus dem Orientierungslosigkeit resultiert, da die Stützpfeiler des Alltäglichen, Bekannten und Gewohnten verloren gegangen sind. Zeit- und Heimatverlust sind synonyme Empfindungen für den Exilierten. Das Einbüßen der gewohnten Umwelt, das Ausgestoßensein in eine fremde Welt korrespondiert mit dem Ungültigwerden eigener Erfahrungen, die Kunert als die Quelle jeden Schreibens begreift, deshalb muß der Schriftsteller „[m]ehr noch als um seine materielle Existenz […] um seine Identität besorgt“71 sein. Einzig im Schlaf findet das Individuum zu sich selbst:
NACHT
In manchen Nächten
trägt mich der Schlaf
wie ein Gewässer
von Welle zu Welle.
[…]
Zwischen verwehten Häusern und
seltsam klaren Ruinen
finden meine Füße wieder
festen Grund
bevor ich gleich aufwache
in völliger Dunkelheit.
(Stilleben, S. 103)
Die ersten vier Verse stellen im Bild der Welle der Styx die Nähe zwischen Schlaf und Tod her. Obwohl nur von Vergangenem (abgerissene Häuser und Ruinen) gesprochen wird, findet das lyrische Ich zu sich selbst und hebt für die Dauer des Schlafs den Zustand der Heimatlosigkeit auf. Diesen Prozeß kann in den Wachphasen einzig das Schreiben herstellen, wie Kunert in der Interpretation zweier Domin-Gedichte deutlich macht:
Die triste Wahrheit besteht für den Schreibenden darin, daß er nirgendwo daheim sein kann, außer in dem, was er schreibt; daß er nirgendwo landen respektive ankommen kann, als bei sich selbst.72
Kunerts Gedichte bleiben trotz allem Pessimismus Plädoyers für das Individuum. Zwar „paraphrasiert er [Kunert, d.V.] Benns Thema des verlorenen Ichs, aber er ist nicht der ästhetische Solipsist“,73 wie die paradoxe Auflösung der letzten Zeile von „Barockes Gedicht“: „Verloren: Ich. In aller Namen“ (Stilleben, S. 92) zeigt. Kunert ist „ein Dichter, der noch einmal für alle sprechen möchte“.74 Eingeschrieben bleibt seinen Gedichten die blinde Hoffnung, daß die persönlichen Sorgen dennoch den „Grundton / aller“ (Stilleben, S. 91) treffen mögen.
Dieser konstatierte Widerspruch des Gedichts als subjektivste Ausdrucksform, die trotzdem die Utopie in sich trägt, Sprachrohr vieler Individuen zu sein, verbindet diese Gattung mit dem Gebet. Damit wird die Paradoxie jedoch noch potenziere. Kunerts „Abendgeber“, das mit den Zeilen „Nichts mehr Nichts mehr / Gebete enden und beginnen immer wieder / mit solchem Schrei […]“ (Stilleben, S. 89) anfängt, ist an einen deus absconditus gerichtet. Daß es sich in diesem Zusammenhang nicht um einen Rückzug in den Schoß von ,Mutter Kirche‘ handelt, erläutert Kunert in seinem Vorwort zu „Dichter predigen“. Er bezeichnet sein Verhältnis zur Kirche als unbelastet:
Was habe eigentlich ich, ein ungetauftes, weltlich erzogenes Subjekt denn mit dieser Kirche zu tun? […] Ich, der Heide staatlich deklassierter Herkunft seiner jüdischen Mutter wegen […] In meinen (äußerst schlechten) Zeugnissen stand in der Spalte, wo das Bekenntnis eingetragen wurde, ein Fremdwort, das für mich erst viel später eine unerwartete Bedeutung erlangte: ,Dissident‘.75
Es geht vielmehr um die von Kunert oft hervorgehobene Gemeinsamkeit zwischen Gebet und Dichtung. Nach Kunert ist jeder Dichter „auf der Suche nach Transzendenz (wenn auch einer sehr irdischen)“,76 die Kunert in Anlehnung an Hugo Friedrich als „leere Transzendenz“ begreift, „das heißt, ein Transzendieren des Gedichts ohne entsprechendes Objekt, ohne Gott und Götter […]“.77 Wie Adorno begreift Kunert die Poesie als einen negativen Ort des Heils, und sie konnte zur „säkularen Statthalterin der alten Religion“78 werden, da sie der aufgeklärten und wissenschaftshörigen Gesellschaft gegenüber ethische Werte und eine Sinngebung des Daseins einforderte, die über das rationale Funktionieren des Menschen in einem szientistischen Prozeß hinausgeht, sich also anschickte, „[d]en Menschen über das pure Sein hinauszuheben, auf daß er nicht nur Fleisch sei, nicht bloßer Lehm […]“.79
Elke Kasper, aus Elke Kasper: Zwischen Utopie und Apokalypse. Dass lyrische Werk Günter Kunerts von 1950 bis 1987, Max Niemeyer Verlag, 1995
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Harald Hartung: Vorletzte Warnungen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.9.1983
Roderich Feldes: Ein anderes Exil
Süddeutsche Zeitung, 1./2.10.1983
Karl Riha: „Statt Hoffnung spricht zu dir das Schweigen“
Frankfurter Rundschau, 8.10.1983
Beatrice von Matt: „Meinem Leid aber habe ich treu gedient“
Neue Zürcher Zeitung, 14.10.1983
Jan Schulz-Ojala: Stillstand des Lebens
Tagesspiegel, 27.11.1983
„Schaffen heißt: seinem Schicksal Gestalt geben“
− Apokalyptische Aspekte in Günter Kunerts Gedichtsammlungen Unterwegs nach Utopia, Abtötungsverfahren, Stilleben und Fremd daheim. −
I Angelus Novus oder der Engel der Geschichte
Der Aufklärer Voltaire meinte nicht ohne Polemik gegen idealistische Überinterpretationen: „Wenn ein gesunder Kopf die Historie liest, ist es fast sein einziges Geschäft, sie zu widerlegen.“ Mit anderen Worten: es sieht nicht so aus, als würde die Geschichte von intelligenten Wesen „hervorgebracht“ (Schelling) oder „gemacht“ (Schiller). Der politische Zeitschriftsteller Ludwig Börne formulierte deshalb die nicht gerade optimistische Sentenz: „Dumme Geschichte ist ein Pleonasmus. Die Geschichte der Menschheit ist nichts als eine Geschichte der Dummheit.“
In einer Rede zum 1. Mai 1970 in Baden-Baden verkündete Günter Grass:
Die Geschichte bietet uns keinen Trost. Harte Lektionen teilt sie aus. Zumeist liest sie sich absurd. Zwar schreitet sie fort, aber Fortschritt ist nicht ihr Ergebnis. Die Geschichte schließt nicht ab: Wir befinden uns in und nicht außerhalb der Geschichte.
Mit dem ersten Teil der Äußerung scheint Grass die verschiedenen Ansichten von Voltaire bis Börne zusammenzufassen, mit dem zweiten ein kontinuierliches Ausgesetztsein des Menschen in der Geschichte zu behaupten. Einmal wird sie als selbständige Macht präsentiert, dann wieder als ein Raum bestimmt, in dem wir uns bewegen müssen. Dabei besteht der „Kollektivsingular“ Geschichte recht eigentlich aus Geschichten und Begebenheiten, die man sich nach Walter Benjamin allerdings nicht „durch die Finger laufen“ lassen soll „wie einen Rosenkranz“. Was für den Historiker gilt, läßt sich auch für den Dichter reklamieren: daß er nämlich die „Konstellation“ erfassen soll, „in die seine eigene Epoche mit einer ganz bestimmten früheren getreten ist“.
Ausgehend von Klees Bild „Angelus Novus“ beschreibt Walter Benjamin den „Engel der Geschichte“ so:
Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
Für einen Marxisten, der den Glauben an das Prinzip Hoffnung und die ständigen Fortschritte der Vernunft internalisieren soll, ist das eine zumindest widerspruchsvolle Metapher. Ist das ein Rückfall von Aufklärung in Untergangsmythologie oder Apokalypse, wie das mit anderen Worten auch Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung behaupten? Oder drückt Benjamin hier nur die beiden Seiten der einen Medaille Geschichte aus, die zugleich ein „Dokument der Kultur“ und „der Barbarei“ ist? Für Benjamins Bild vom „Engel der Geschichte“ trifft in der Tat beides zu. Benjamin bürstet „die Geschichte gegen den Strich“ und enthüllt die wachsenden Trümmerhaufen bei dem Flug des Engels in die Zukunft. Genau betrachtet, besteht der geschichtliche Fortschritt nur im Anwachsen der Trümmerhaufen. Ist das schon „zynische Vernunft“, wie das von Peter Sloterdijk verbreitete Schlagwort lautet, postmodernes oder bloß falsches Bewußtsein? In einem seiner Verspäteten Monologe (1981) erläutert Günter Kunert die schwierige Position von Benjamins Engel, der in „die Vergangenheit blickt und mit dem Rücken in die Zukunft fliegt“. Es gehe eben „schon nicht mehr darum…, auf widersprüchliche Weise rückwärts voranzukommen, sondern nur noch auf eines: nicht abzustürzen“.
An diesem Punkt setzt Kunerts Bewußtsein von der Geschichte ein. Dem Luftakrobaten Angelus Novus droht wie Ikarus der Absturz. Kunert entlarvt das dem „Fliegen einstmals zugeschriebene Freiwerden von Erdenschwere“ als Legende, als Irrtum. Kassandra ist ihm näher als Ikarus. Statt „Freiheit“ und „göttergleichen Aufschwung“ erlebt er die „totale Zerstörbarkeit“. Das Mythologem von Ikarus wird bei Kunert zur Chiffre für die Hybris der Aufklärung und ihres Fortschrittsglaubens.
In dem Gedicht „Ikarus 64“ aus dem Band Verkündigung des Wetters (1966) steht allerdings bei aller Skepsis gegenüber dem Vorgang des Fliegens immerhin noch die Aufforderung zu einem „Anlauf für das Unmögliche“. Die letzte Strophe meint fast optimistisch: „Denn Tag wird. / Ein Horizont zeigt sich immer. / Nimm einen Anlauf.“ In dem Band Unterwegs nach Utopia (1977) hat sich die Semantik der Chiffre allerdings verändert: Das Prinzip Hoffnung ist nun endgültig fragwürdig geworden. „Unterwegs nach Utopia I“ und „Unterwegs nach Utopia II“ lassen den Angelus Novus wie Ikarus enden. Das erste Gedicht spricht von Vögeln mit „ikarischen Zügen“, „mit zerfetztem Gefieder“, „gebrochenen Schwingen“ und charakterisiert ihren Flug als „ein blutiges und panisches / Geflatter“. Utopia, die Zielrichtung der „fliegenden Tiere“, existiert nur noch als Sehnsucht; denn „lebend“ gelangt dort „keiner“ hin. In dieser Chiffre von Ikarus ist schon der ökologische Tod des Zeitalters eingezeichnet, den das zweite Gedicht ausschließlich thematisiert. Die beiden Strophen von „Unterwegs nach Utopia II“ sind für Kunerts apokalyptische Vorstellung symptomatisch. Sie lauten:
Auf der Flucht
vor dem Beton
geht es zu
wie im Märchen: Wo du
auch ankommst
er erwartet dich
grau und gründlich
Auf der Flucht findest du
vielleicht
einen grünen Fleck
am Ende
und stürzest selig
in die Halme
aus gefärbtem Glas.
Auf dieser absoluten Schwundstufe der Natur existiert als Fluchtpunkt „vielleicht“ noch ein grüner Fleck. Aber auch er erweist sich beim ikarischen Absturz noch als Täuschung, als „Halme / aus gefärbtem Glas“. Die „Flucht / vor dem Beton“ ist deshalb von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das bedeutet freilich nicht, daß der Mensch, der diese Trümmerhaufen und Katastrophen im Sinne Benjamins veranlaßt hat, bei Kunert aus der Verantwortung entlassen wird. Das Endzeitgefühl läßt keinen Raum für metaphysische Ausreden.
In einem anderen Gedicht, „Unterwegs nach Utopia IV“, setzt Kunert der Illusion des linearen Fortschrittsdenkens, das sich an utopischen Vorstellungen orientiert, den blinden Kreislauf der Geschichte entgegen, in dem sich der Mensch mit seinem Ochsen bewegt, ohne es zu realisieren („durch seine eigne tiefe Spur / im Staube unbelehrt“). Die Hoffnung wird bei Kunert zu einem „unerträglich… eingewachsenen Fremdkörper“, zu einem „Unding / das mir nicht gehört und dem ich / nicht gehören will.“ So wie sich die Natur durch die Technik und ihre Folgen auf dem Rückzug befindet, fällt das innere und äußere Leben dem Prozeß der Versteinerung anheim. „Das Gestein deiner Tage / eine Nachgeburt aus Schutt / für Nachgeborene“, erläutert die letzte Strophe des Gedichts „Bauwerk“mit einem deutlichen Hinweis auf Brecht, dessen Fetischisierung der Vernunft Kunert übrigens früh kritisiert hat. In einem anderen Zusammenhang rückt Kunert die falschen ideologischen Voraussetzungen des Marxismus auf diese Weise zurecht:
Mit dem Prädikat ,instrumentell‘ ist der Vernunft die moralische Stellung fristlos gekündigt worden. Und die ,Dialektik der Aufklärung‘ hat ihr den Rest gegeben.
II Ideologisches Zwischenspiel oder die Katastrophe Prometheus
Auch in der DDR, die er erst 1979 verließ, war Günter Kunert ein kompromißloser, störrischer Außenseiter, der nicht selten den Parteiapparat und die Parteiideologie mit seiner Kritik herausforderte. Er sperrte sich früh gegen die Vereinnahmung durch sozialistische Schreibrezepte und ironisierte vulgärmarxistische Ansichten, denen zufolge man „nur die richtige Weltanschauung“ zu haben brauchte, um „die richtigen und bedeutenden Kunstwerke“ schaffen zu können.
Symptomatisch erscheint in unserem Zusammenhang eine Grundsatzdiskussion, die Günter Kunert 1979 in Sinn und Form mit Wilhelm Girnus führte. In einem Aufsatz über den griechischen Dichter Jannis Ritsos griff Kunert die in der DDR sanktionierte Utopie und den unkritischen Fortschrittsglauben an, so daß Girnus sich bemüßigt fühlte, gegen diesen angeblich „mittelalterlichen Obskurantismus“ und diese „apokalyptische Vision“ zu Felde zu ziehen, wobei ihm Kunert allerdings keine Antwort schuldig blieb. Er bezeichnete vielmehr die Ideologeme der Gegenseite als Seifenblasen und hielt Girnus ein Kolleg in Sachen Umweltverschmutzung. Nicht nur erklärte er die These, daß „Wissenschaft und Technik in der Hand ,fortschrittlicher Kräfte‘ keinesfalls die gleichen negativen Folgen wie im Kapitalismus zeitigten“, für Unsinn, sondern er fragte sogar den Kontrahenten gezielt, ob sich angesichts des schrecklichen Zustands der Welt „der Aufwand des sogenannten Fortschritts gelohnt“ habe.
In einem umständlichen Brief hält Girnus an seinem Glauben unbeirrt fest, obwohl man der mühsamen Argumentation anmerkt, daß ihn Kunerts Einwände offensichtlich getroffen hatten.
Man muß eben kämpfen. Resignation ist kein Programm. Zerknirschung erst recht nicht. Alle Erkrankungen als unheilbar hinstellen ist auch eine Krankheit. Die Krankheit der Panikmache und der Dogmatik.
So lautet ebenso hilflos wie widersprüchlich das Stenogramm der Vorwürfe. Als Fortschrittsgegner wird Kunert dann in die Nachschaft des „unterirdischen Quellhorizonts der nazistischen Ideologie“ gestellt, bis der schlimme Satz fällt: „Kategorische Verweigerung der Möglichkeit des Fortschritts führt heutzutage folgerichtig in die faschistische Gaskammer.“ Man kann verstehen, daß Kunert, der Sohn einer jüdischen Mutter, angesichts solcher Invektiven wenig später die DDR verlassen hat. Nach dem heutigen Kenntnisstand der Umweltverseuchung in der DDR klingt die Alternative von Girnus, die er Kunert vorhielt, geradezu gespenstisch. Er behauptete noch im Jahre 1979:
ständige Steigerung der produktiven Möglichkeiten des Menschen, ständige Steigerung des menschlichen Lebensprozesses, das ist das Grundgesetz der Gattung Mensch.
Offenbar hat sich Girnus nicht die Mühe gemacht, auf Kunerts biographische Erfahrungen im Dritten Reich Rücksicht zu nehmen. Auch scheint er kein intensiver Leser seiner Gedichte gewesen zu sein. Sonst hätte er in dem (freilich im Westen erschienenen) Band Unterwegs nach Utopia (1977), dessen Gedichte die apokalyptische Sorge in verschiedenen Bildern und poetischen Stilarten beschwören, deutlich eine Abwendung vom marxistischen Prinzip Hoffnung wahrnehmen können. Das Gedicht „Lagebericht“ spricht Kunerts Einstellung um diese Zeit beispielhaft aus:
Alles ist möglich und
gleichzeitig ist alles unmöglich.
Nur noch Natur
ist uns geblieben oder was
von ihr geblieben ist. Um uns
geruhsame Steine von seligen Vorläufern
deren Zukunft
bis zum Jenseits gereicht hat.
Unser ist der Tag
der keinem gehört. Wir sitzen
im schwarzen Licht
essen Gift trinken Säure
wir denken wir leben
und verschieben die Folgen
auf Morgen
wo wieder mehr möglich ist
und noch mehr unmöglich
wo wir alle so sind
wie alle sein werden:
fernerhin Stückwerk
trostlos unaufgehoben
endgültig unnütz
der Rest
der verschwiegen wird.
Man sieht hier, wie Kunert selbst noch das apokalyptische Pathos durch Argumentation unterminiert, um den Sachverhalt der Reflexion auszusetzen, Er deckt außerdem den Widerspruch der Situation in der Sprache auf. Die ursprüngliche Allmacht der Vernunft erweist sich als die absolute Ohnmacht. Jeder Satz mündet in seinen Gegensatz: „Unser ist der Tag / der keinem gehört.“ Je mehr die „Folgen / auf Morgen“ verschoben werden, desto größer wird die Ausweglosigkeit der Situation. Wenn Thomas Koebner von einem „Nahe- und Fernrücken apokalyptischer Gesichte“ in Kunerts Gedichten spricht und die Funktion dieser Verfahrensweise zum Teil als eine Art Profanisierung des „auraumwitterten Mythos“ versteht, so trifft das sicher einen Aspekt von Kunerts Arbeiten. Der andere scheint mir in dem Bemühen zu liegen, die überlieferten Untergangsbilder und apokalyptischen Visionen zu entideologisieren, d.h., ihre jeweilige ideologische Intention oder Programmierung zu destruieren und umzufunktionieren, jedoch ihren Menetekelcharakter zu bewahren.
In seinen Frankfurter Vorlesungen Vor der Sintflut (1981) hat Günter Kunert die Situation des Lyrikers in einer Endzeit beschrieben und von der Aufgabe gesprochen, „die Struktur des Gedichts vor der Durchdringung mit fremden Strukturen zu bewahren. Sich anderen Modellen und Theorien zu verschließen.“ Das Programm brachte er mit einer Gedichtzeile des Lyrikers Heinz Czechowski auf diesen Nenner: „kein Anspruch, der mich erreicht, außer den an mich selber.“ Das Problem des Lyrikers einer Endzeit besteht nicht zuletzt darin, die Katastrophen der Vergangenheit und der Gegenwart dergestalt in die unmittelbare Nähe zu rücken, daß sich alle von ihnen betroffen fühlen. Ansonsten „erscheinen fern“ im „Fernrohr“, wie es in dem symptomatischen Gedicht „Durchblick II“ heißt: „brennende Städte“. Doch „Feuer erlöschen“ wieder, aber „Ruinen bleiben“.
Das Gedicht handelt nicht nur von dem zeitlichen oder geographischen Abstand von der Katastrophe, sondern auch von dem Verdrängungs- und Projektionsmechanismus im Hinblick auf die Schuldfrage. Zur Entlastung können wir jederzeit auf Prometheus verweisen, dessen Feuerdiebstahl für die Katastrophen verantwortlich ist. Kunert setzt Prometheus neben Ikarus und Sisyphus als zentrale Metapher oder Chiffre ein. Es sind sicher im Sinne Alexander Demandts „Metaphern für Geschichte“, aber sie werden, wenigstens was Prometheus und Ikarus betrifft, aus dem Rahmen der Aufklärungsideologie herausgelöst und in denunziatorischer Absicht verwendet. Prometheus dient bei Kunert nicht nur als Ausrede für die eigene Verantwortung, sondern er stellt in seinen Gedichten dessen segensreiche Rolle für das Wohl der Menschheit grundsätzlich in Frage: Die Arbeit am Mythos wird hier zu einer Arbeit an der eigenen Geschichte.
Prometheus galt, wie Blumenberg ausführlich nachgezeichnet hat, vom 18. Jahrhundert an nicht nur als geschichtlicher Selbstfinder, als politisches Genie, als verkörperte Ichphilosophie, als Menschenhelfer, den dann die Götter ungehörig bestraften, sondern es stellten sich auch bald schon kritische Aspekte bei der Rezeption ein. „Aus der weiten zeitlichen Distanz, vom Ende der Geschichte her“, so urteilt Blumenberg im Kontext von Marx’ frühen Schriften, „nimmt er sich eher wie ein hinterhältiger Dämon aus, der eine Gabe unter die Menschen geworfen hatte, an der sie nicht nur wie die Satyrn, an die Rousseau erinnert, die Bärte verbrennen, sondern zum ersten Mal der Fremdheit des Sachzwangs unterworfen und in das Netz des Eigentums verstrickt werden“. Aber neben der Problematisierung der Menschenfreundlichkeit signalisiert Prometheus im 19. Jahrhundert auch das pathetische Schicksal des Menschen, sei es in politischer, sei es in existentieller Hinsicht.
Destruierte Kafka in einer ingeniösen Endspiel-Parabel Varianten der Prometheus-Sage durch rationale Strategie, um den Mythos dialektisch „wieder im Unerklärlichen enden“ zu lassen, so dient das Mythologem in einem der Verspäteten Monologe Günter Kunerts als Demonstrationsobjekt der ökologischen Katastrophe. Prometheus’ Gabe, das Feuer, bedeutet insofern ein Danaergeschenk, als dieser sogenannte Fortschritt mit einem entscheidenden Verlust erkauft wurde: mit dem Erlöschen der Zukunftserkenntnis, der Vorausschau „künftiger Katastrophen“. Statt dessen herrscht eine „lähmende… Wiederkehr“ des Gleichen. Kunert treibt seine parabolische Interpretation des Prometheus-Mythos ebenfalls zu einem kafkaähnlichen Paradox, wenn er die pointierte Alternative aufstellt:
Hätten wir die Prophetie behalten wollen, wir hätten auf das Feuer und damit auf andere Weise auf die Dauerhaftigkeit menschlichen Seins verzichten müssen.
Da Prometheus „uns unseres existentiellen Wissens beraubt“ hat, „um uns lebensfähig zu machen“, so führt Kunert in seinem Monolog „Prometheus II“ aus, bleiben wir „ohne solches Wissen… unserer eigenen Blindheit ausgeliefert, aus der heraus wir mit Hilfe des alle zivilisatorische Technik begründenden Geschenkes an der Aufhebung jeglichen Lebens arbeiten“. Es gibt keinen Ausweg: „Auf die eine wie die andere Art sind wir verraten und verkauft.“ Prometheus, so beschließt Kunert den Monolog, wurde „dafür zu Recht von den Göttern bestraft“.
An der Prometheus-Sage demonstriert Kunert die seiner Ansicht nach richtige Lesart, die zwar unsere Vorfahren schon erkannt hätten, aber wir in unserem „blinden Hochmut“ nicht mehr wahrnehmen. Wir deuteten die Sage, wie die Rezeptionsgeschichte zur Genüge beweist, als Chiffre für den technischen Fortschritt und verstanden Prometheus „als Kulturheros“. Kunert lenkt die Aufmerksamkeit bewußt auf den zweiten, in der Überlieferung oft verdrängten Teil der Sage, der signalisiert, daß das voreilige Geschenk des Prometheus mit der „Amputation der Kenntnis des Kommenden“ erkauft worden ist. Der Mythos wurde also nach Kunert durch Generationen „hindurch gehört, studiert, idealisiert und… endlich ,klassisch‘ genannt, ohne daß man ihn freilich richtig begriffen hätte. Prometheus war „das Symbol des revolutionären Geistes, des schöpferischen, weil wir immer überlesen haben, was wir nicht erfahren wollten“.
Gegen die vielen Lesarten der Vergangenheit und die eindimensionale Arbeit am Mythos interpretiert Kunert die alte Chiffre von Prometheus als einen Wegweiser mit den richtigen Zeichen, die wir allerdings mißverstanden haben. Er sieht darin den Quellpunkt eines Verhängnisses, das nicht wiedergutzumachen ist. Die Mythologeme von Ikarus und Prometheus werden bei Kunert zu Signifikanten einer Kritik dem Fortschrittsglauben der Aufklärung. Für ihn gründet die Idee des Fortschritts auf zwei falschen Voraussetzungen: „die eine ist psychologischer, die andere naturwissenschaftlicher Herkunft“. Die eine „resultiert aus einem Hochmut“, der den Höhepunkt in einer „technisch-instrumentalen Entwicklung“ sieht, die andere stammt aus der „Übertragung des biologischen Evolutionsmodells auf das Wissen von der Gesellschaft und der Geschichte“.
Thomas Koebner unterscheidet zwei Katastrophenprognosen bei Kunert: eine, die sich „auf den allgemeinen Zustand der entwickelten technischen Kultur“ bezieht, „die die Natur aufsaugt und unter sich begräbt“, eine andere, „die sich auf die Befindlichkeit der Person am ,Rand des Jahrhunderts‘“ richtet, die angesichts der „alltäglich praktizierten Menschenverachtung und Menschenvernichtung“ möglicherweise „zum Augenzeugen der eigenen ,Abtötung‘ wird“. Das läßt sich leicht an den Gedichtsammlungen Unterwegs nach Utopia (1977), Abtötungsverfahren (1980), Stilleben (1983) und Fremd daheim (1990) belegen. Aber neben dem Vorgang der Ent- und Verfremdung des eigenen Ichs im verhängnisvollen industriellen Prozeß kommt es in den Gedichten immer wieder zu Schuldzuschreibungen. Im Grunde gibt es bei Kunert keinen Ausweg aus diesem Teufelskreis der „Wiederholung eines ewigen Geschehens“, wie es in dem Poem „Programm“ heißt: „unsern Blick trifft nichts mehr. Nichts.“ Doch dieser Vorgang läßt sich auch umkehren: „Denn die Erde versinkt / hinter ihrem Horizont / nichts geht mehr auf“. Jede Hoffnung erweist sich als trügerisch. Die Bestandsaufnahme lautet ebenso pessimistisch wie epigrammatisch „Gebeine bilden unsern Lebensgrund / und geben keinen Anlaß mehr zur Klage: / Da hoffe du. Du hoffst dich wund.“ Die Zukunft wird mit einer manipulierten Anspielung auf das Kommunistische Manifest als Gespenst denunziert, das in Europa umgeht „in ihrem leidvollen / Namen“.
Führt die wachsende Zerstörung der Natur zu Schwundstufen der Umwelt, zur Versteinerung, so läßt sich ein ähnliches Phänomen im Innern des Menschen beobachten. Die Fremde des Daseins nimmt äußerlich und innerlich zu. Der Prozeß ist ein charakteristischer Teil des „Abtötungsverfahrens“. Die Einsicht in die „längst wuchernde Fremde“ gehört ebenso zu den wiederkehrenden Motiven der Gedichte wie der Vorgang der Versteinerung. „Steine wachsen aus der Erde / wo eben noch Brot keimte“ lauten die beiden Anfangszeilen des Gedichts „Mutation“ aus dem Band Stilleben, und in dem Text „Von Sommertagen“ wird die Fremdwerdung des eigenen Körpers inszeniert und mit der Schlußstrophe dergestalt kommentiert:
Ausgesetzte Fehlgeburt
verwaist von Grund auf
ohne Glauben
an deine Notwendigkeit
„In fremder Heimat“, einem für die biographische Erfahrung Kunerts vielseitigen Syntagma, bleibt auch „das eingefleischte fremde Ich“, das „schweigt schreibt und bleibt“ allein und „selbst unberührt“. Aber dieses Thema, das sich wie ein Leitmotiv durch Kunerts letzte Gedichtbände zieht, erfährt verschiedene Variationen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einem nicht bloß „Hören und Sehen“ vergeht, sondern man im wahrsten Sinne des Sprichwortes fühlen muß, was man nicht hören und sehen, verstehen und erkennen will. Man ist dann „betroffen / von soviel Aussichtslosigkeit“.
Die Frage ist legitim, warum Kunert die Welt verlorengibt und nicht mehr an eine Lösung glaubt. Er hat das selbst in dem Text „Gegenüber der Deponie“ erläutert und als Begründung auf das mangelnde Zukunftswissen des Menschen verwiesen. In der modernen Welt der Endzeit wurden sogar, wie Kunert feststellt, die alten Menetekel vergessen. Der Brandgeruch der vorindustriellen Welt signalisiert wohl noch „das alte Bild“, aber die Welt „brennt… sich selber langsam leer“. Die alten apokalyptischen Warnzeichen wie Kometen, Mythologeme und Bilder bleiben als „vollmundiger Sprachbrei“ funktionslos oder sie erreichen den Adressaten, zu einem Zeitpunkt, an dem er „schon abwesend“ ist „und mit Zerfallen / beschäftigt“. Mit anderen Worten: die Offenbarung ist zu Stein geworden, wie der Text „Heimlicher Hinweis“ in dem Band Fremd daheim nahelegt. „Das Sinnbild der Geschichte / Clio in einem Mantel aus Moos“ findet sich hier „versteckt hinter der Tonne mit Abfall“. In dem Gedicht „Vorfall“ aus dem Band Stilleben vergeht dem lyrischen Ich Hören und Sehen, „sprachlos über die leeren Seiten / der Geschichte geneigt“, und es weiß nicht mehr, „was war was ist / wer ich bin / sein kann sein will / werde“. Was auch geschieht an Katastrophen, der Mensch ist so angelegt, daß er auf die Sinnfrage nicht verzichten kann:
Wir können uns nicht fassen.
Und finden keinen, der uns Göttern gleicht.
Und keinen, der uns Hilfe reicht.
Wir sind uns ohne Gnade überlassen.
Die Situation des Menschen in der Endzeit faßt vielleicht am prägnantesten folgender „Achtzeiler“ aus dem Band Fremd daheim zusammen:
ACHTZEILER
Auf toten Flüssen treiben wir dahin,
vom Leben und dergleichen Wahn besessen.
Was wir erfahren, zeigt sich ohne Sinn,
weil wir uns selber längst vergessen.
Vom Augenblick beherrscht und eingefangen,
zerfällt der Tag, der Monat und das Jahr.
Und jede Scherbe schafft Verlangen
nach Ganzheit: Wie sie niemals war.
III Der Mythos von Sisyphos
Das moderne Menschenschicksal hat Kunert nicht von ungefähr mit „Sisyphos 1982“ illustriert. Die letzten beiden Zeilen bestehen in der Aufforderung: „Den Stein endlich zurückrollen lassen / wohin er gehört.“ Wie Prometheus haben die Götter auch Sisyphos verurteilt. Er galt als besonders listig und wurde deshalb nicht selten mit Odysseus assoziiert. Die aussichtslose Arbeit, in der seine Strafe besteht, legt Kunert in seiner Version als freiwilligen Verzicht des modernen Sisyphos auf Fortschritt aus. Ist Sisyphos bei Albert Camus der „Held des Absurden“, so knüpft Kunert dessen absurde Existenz an seine Hybris – oder wie er einmal in anderem Zusammenhang formuliert: an „die Vergottung naturwissenschaftlich geprägter Vernunft“.
Wir stehen „auf dem Gipfelpunkt unserer Entwicklungsgeschichte“ und „jeder Tag bringt ja im übrigen einen neuen“, stellt Günter Kunert 1990 in seiner Strafpredigt „Zur Apokalypse“ fest. Es ist der anhaltende Sisyphos-Augenblick, in dem der Stein schon längst hätte zurückgerollt werden müssen. Statt dessen häuft sich eine „Trümmerwüste“ hinter uns auf. „Seine geniale Erfindung“, so lautet Kunerts Urteil in bezug auf den Menschen, „räumlich frei zu werden, wie ein Vogel zu fliegen oder rascher als ein Pferd zu laufen, erwies sich mit der Zeit der Benutzung als Instrument für seinen Suizid“. Kunert sieht den Menschen als Opfer und Schuldigen zugleich. Er zitiert unter anderem folgenden Satz aus einer wissenschaftlichen Publikation: „Der kognitive Horizont des Menschen ist genetisch beschränkt.“
Nach Kunert ist der Mensch nicht in der Lage, die Apokalypse, die er heraufbeschworen hat, zu erkennen, zu benennen, zu verhindern oder wenigstens einzuschränken. Den doppelten Tod, von dem Ulrich Horstmann spricht, nämlich „der physischen Vernichtung und des Auslöschens der Erinnerung an sich selbst“, stellt Kunert auch in seinen Gedichten dar. Die Auskunft hier ist ebenso trostlos wie in einem Aufsatz, dessen letzter Satz nicht gerade aufmunternd lautet: „Denn von Menschen, egal von woher, ist nichts mehr zu erwarten.“
Im Hinblick auf diesen Pessimismus ist es nicht verwunderIich, daß man Kunert die Frage gestellt hat, warum er angesichts der vermeintlich aussichtslosen Situation überhaupt noch Gedichte schreibe. Selbst der ehemalige Genosse Wilhelm Girnus, der Kunerts Angriff auf die marxistische Fortschrittsgläubigkeit hinterhältig mit einem „gewissen Herrn Schicklgruber“ in Verbindung brachte, flüsterte ihm am Schluß der Epistel in Sinn und Form ins Ohr: „an Deinen zur Schau getragenen Pessimismus kann ich nicht recht glauben! Das kommt mir nicht echt vor. Warum schreibst Du dann noch Gedichte? Für wen veröffentlichst Du sie?“
Kunert kann solche Fragen leicht widerlegen. Seine Lyrik ist ebenso Selbstaussprache wie Menetekel. Es sind im besten Sinne des Wortes Warngedichte am Rande des Abgrunds. Die absurde Situation des Menschen, wie sie Kunert in seiner Endzeiterfahrung sieht, verlangt auch eine Art absurdes Kunstwerk, das Albert Camus im Mythos von Sisyphos folgendermaßen definiert hat:
Für den absurden Menschen geht es nicht mehr um Erklärungen und Lösungen, sondern um Erfahrungen und Beschreibungen. Alles beginnt mit einer scharfsichtigen Gleichgültigkeit.
In acht Epigrammen über „Geschichte“ hat Günter Kunert mit den mythologischen Figuren von Sisyphos und Polyphemos die hoffnungslose Lage des absurden Menschen dargestellt. Was die Reflexion auf sich selbst betrifft, so ergeben sich Parallelen in den Versen von Kunert mit der zitierten Auffassung von Albert Camus. „Die Kluft zwischen der Gewißheit meiner Existenz und dem Inhalt, den ich dieser Gewißheit zu geben suche“, meditiert Camus, „ist nie zu überbrücken. Ich werde mir selbst immer fremd bleiben.“ Auf der einen Seite heißt es bei Kunert in dem Gedicht „Geschichte“, wenn auch mit Einschränkungen: „dasein ist alles“, auf der anderen: „Fremd bis du dir / nur vom Sehen bekannt.“ Diese Einsicht „aus längst wuchernder Fremde“ in das „eingefleischte fremde Ich“ gehört zu Kunerts Grunderfahrungen, die in seiner Lyrik immer wieder aufs neue dargestellt werden. Das führt zu einem Mißtrauen selbst gegenüber den eigenen Bildern, die ebenso in Frage gestellt werden wie die überlieferten Sinnbilder.
Angesichts des geistigen Vakuums nach dem Ausverkauf der bürgerlichen Ideale muß sich nach Kunert gerade die Literatur der Forderung nach neuer Sinnproduktion entziehen. Ähnlich wie Camus in Der Mythos von Sisyphos konstatiert Kunert die Kapitulation der Literatur:
Ihre Antwort ist: Keine Antwort. Diese Unfähigkeit, die zudem ihre Eigenart ausmacht, begründet neben anderen Gründen ihre Krise.
Der Verzicht auf Sinnproduktion schafft aber andererseits eine ebenso überraschende wie folgenreiche Freiheit von Fremdbestimmungen. Eben die Befreiung von der Fremdbestimmung und die Entwicklung zur Selbstbestimmung hat Kunert deshalb in seinen Frankfurter Vorlesungen als ein positives Merkmal heutiger Lyrik beschrieben. Er sieht ihre Wirkung gerade darin, daß sie „auf jede Absicht verzichtet“. Doch stimmt das? Stecken in Kunerts Gedichten nicht auch noch in den verbalisierten Widersprüchen und Negationen deutlich fixierbare Absichten?
In seinen Frankfurter Vorlesungen veranschaulicht er die Funktion von zeitgenössischen Gedichten mit dem Stachel, „der sich in das vom Alltag und den Gewohnheiten schon halb betäubte Fleisch bohrt“. Mit anderen Worten: die Sache der Lyrik „ist die Verstörung“: „wenn das Gedicht [das] Einverständnis [des Lesers] mit der Welt erschüttert, dann hat es eine Leistung vollbracht, die für ein derart winziges Gebilde aus wenigen Zeilen gigantisch ist.“ Bei allem Zweifel wird in solchen Äußerungen zumindest eine Art Sisyphos-Überzeugung demonstriert, die keineswegs ihre klassischen Spuren verleugnen kann. Es geht Kunert allen Einwänden zutrotz immer noch um die „humane Substanz der Literatur“, um Restituierung der „verlorenen Totalität“, des „unverkrüppelten, vollkommenen, wenn auch ewig unvollkommenen Individuums“, um „die geistige und seelische Erleuchtung des Lesers“, um einen „Windhauch aus Utopia“.
Solche Vorstellungen weisen auf Kernpunkte des ästhetischen Programms von Herder und Schiller bis Thomas Mann zurück. Aber es soll nicht verschwiegen werden, daß die zuletzt zitierten Hinweise aus den siebziger Jahren stammen, in denen utopische Vorstellungen in Kunerts Arbeiten noch nicht ganz abgebaut waren. Doch selbst in Unterwegs nach Utopia (1977) gewährt das Gedicht noch, „was hinter den Horizonten verschwindet / etwas wie wahres Lieben und Sterben / die zwei Flügel des Lebens / bewegt von letzter Angst / in einer vollkommenen / Endgültigkeit.“ Wie sie mit der wachsenden Einsicht in die absurde, apokalyptische zeitgeschichtliche Situation auch auf Kunerts Poetik und Lyrik übergreift, mag zum Schluß folgendes Gedicht aus dem Band Abtötungsverfahren illustrieren:
EINE POETIK
Das wahre Gedicht
löscht sich selber aus
am Schluß
wie eine Kerze so plötzlich
aber was sie beleuchtet hat brennt
das abrupte Dunkel
der Netzhaut ein
Kahle Welten
Kahle Wände Tische und Stühle
ein Raum voller fremder Bekannter
unserer Zuneigung und Gleichgültigkeit
gewiß
Ohne Bewegung ohne Bedeutung
ohne Bestand.
Gedichte werden auf diese Weise zu Endspielen in der Endzeit. A tergo ist ihnen jedoch immer noch die existentielle oder existentialistische Forderung Camus’ eingeschrieben: „Schaffen heißt: seinem Schicksal Gestalt geben.“
Walter Hinderer, aus: Manfred Durzak und Hartmut Steinecke (Hrsg.): Günter Kunert. Beiträge zu seinem Werk, „Dieser Text ist verschwunden“, 1992
Wie depressiv sind unsere Poeten?
– Über Günter Kunert und ZEITgenossen. –
1. Nachtrag zu einer vorzeitig abgebrochenen Literaturdebatte
Plädoyer für Hans-Jürgen Heise
„In der Zeit“, schreibt Peter Sloterdijk in seinem Buch Zur Kritik der zynischen Vernunft, „streiten sich die Feuilletonisten nur noch um die richtige Weise, depressiv zu sein… Wir sind so weit gekommen, daß uns Glück politisch unanständig erscheint. Kürzlich überschrieb Fritz J. Raddatz seine begeisterte Besprechung von Kunerts morbiden Abtötungsverfahren (1980) mit den Worten:
„Glück- das letzte Verbrechen?“ – Sagen wir besser: Glück: die letzte Unverschämtheit!80
Es war demnach abzusehen, daß die vom 20. August bis zum 3. September 1982 in der Zeit geführte Literaturdebatte: „Wie depressiv sind unsere Poeten?“ mit einer öffentlichen Disqualifizierung desjenigen Autors enden würde, der sie mit einer beherzten Polemik eröffnet hatte. Der bekannte Lyriker und Essayist Hans-Jürgen Heise hatte es nämlich gewagt, die Zeit-genössische Depressivität und ihren aschgrauen Niederschlag in der derzeitigen Literatur, namentlich der Lyrik, einer kritischen Analyse zu unterziehen: Heise:
Es ist interessant, daß die lyrische Avantgarde ihr Selbstverständnis in dem Augenblick verloren hat, in dem die leitmotivische Idee des historischen Fortschritts zweifelhaft geworden war. Die progressistischen Poeten erlebten nach dem Bekanntwerden der Thesen des Club of Rome einen Schock, dessen Heftigkeit sich nur aus der relativen oder absoluten Ahnungslosigkeit erklären läßt, mit der glückverheißende Dogmen und gesellschaftsoptimistische Parolen in Umlauf gebracht worden waren… So konnte auf das Pathos der Politlyrik nur eine ideologische Aschermittwochstimmung folgen. Die Dichter, die ihr Ich so lange ausgespart und lediglich das Verfertigen vordergründig-plakativer Texte oder (,konkrete Poesie‘) ein kühles Laboratorium mit Worten praktiziert hatten, waren außerstande, die Farben der ganzen Gefühlspalette zu benutzen. In ihrer Ratlosigkeit entschieden sie sich für das Schwarz der Verzweiflung, einen Einheitsanstrich, mit dem sie alles grundierten. Natürlich kann man bei der heutigen Weltlage keine Poesie fordern, die durchweg heiter, transparent, luzide wäre. Doch man darf die helleren Töne der Dichtung auch nicht unterschlagen oder gar behaupten, es gäbe sie nicht… Warum, frage ich mich, kann man wohl einem bei seiner Arbeit pfeifenden Dachdecker begegnen, doch kaum noch einem fröhlich gestimmten Poeten? Gibt es im Kulturbetrieb Filter, die nichts Leichtes und Unbeschwertes mehr durchlassen – Ariel, sozusagen in der Strafvollzugsanstalt der Miesepetrigen?81
Als profiliertesten literarischen Repräsentanten der „neuen Düsterkeit“, durch welche die leitmotivische Idee des Fortschritts ersetzt wurde; nennt Heise Günter Kunert. Und völlig zu Recht stellt er die Frage:
Wie läßt sich der Stimmungsgehalt lyrischer Subjektivität verallgemeinern? Jeder Künstler hat das Recht, sich selbst zu realisieren. Und er hat auch das Recht, Freunde, Gleichgesinnte um sich zu sammeln. Die Situation wird jedoch problematisch, sobald die eigene Befindlichkeit und die bevorzugten Gefühlsvaleurs in den Rang von Richtlinien erhoben und zum Maß alles übrigen erklärt werden.
Heise spricht in diesem Zusammenhang von einem depressiven Stimmungskartell, das jede Poesie heute als „oberflächlich“ oder „unkünstlerisch“ abqualifiziert, die nicht seinen Wertsetzungen entspricht.
Wie sehr Heise mit seiner durchaus sachlichen Analyse und Trendbeschreibung zeitgenössischer Lyrik (daß es auch unter den Lyrikern Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen, versteht sich von selbst!) ins Schwarze des Zeit-Geistes getroffen hat, zeigen die überaus gereizten Reaktionen einiger Schriftsteller, die sich durch seinen Artikel provoziert fühlten. Obwohl Heise ausdrücklich betont hatte, daß „ihm nichts ferner liege, als anderen die Seelenregungen vorzuschreiben und einen Traurigen etwa daran zu hindern, traurig zu sein“, wurde er von Kunert als propagandistischer Kader einer „neuen Fröhlichkeit“ hingestellt, der sein „demagogisch gestimmtes Selbst… als Stimme des gesunden Volksempfindens empfehle“. Und er rückte Heises Kritik an der „genußverdrängenden Hirnlichkeit“ zeitgenössischer Intellektueller und Dichter sogleich in die Nähe von „Ideologemen aus der braunen Mottenkiste“.82
Ich fand es beschämend, daß keiner der Literaten (Michael Krüger, Peter Härtling, Adolf Muschg und Karl Krolow), die Kunert sekundierten, ihm in den Arm fiel, als er Heise mit der Keule eines nur schlecht getarnten Faschismusvorwurfes zu erschlagen suchte. Daß die Feuilleton-Redaktion der Zeit dem inkriminierten Heise, der teilweise an Rufmord grenzende Denunziationen einnehmen mußte, keinen einzigen Verteidiger beigesellte, spricht nicht gerade für ihren Liberalismus auf den sie sich sonst so viel zugute hält.
Da haben wir nun, seit etwa einem Jahrzehnt, eine Literatur die von sich behauptet, die eigene „Subjektivität“ und „Empfindsamkeit“ wiederentdeckt zu haben. In bezug auf die zeitgenössische Depressivität aber wird dieses gerade wieder zu Ehren gekommene Ich vollständig exkulpiert. Für die derzeitige Kater- und Aschermittwochstimmung in der Literatur soll nicht etwa auch die „Übellaunigkeit“, „Miesepetrigkeit“ und die „private Misere“ unserer Poeten, sondern einzig und allein der Weltlauf als solcher, der – so Kunert – „denkbar gewordene Untergang der Welt… die drohende militärische und ökologische Zerstörung des Planeten“ verantwortlich sein.
Der rituelle – um nicht zu sagen: routinierte – „Betroffenheits“- und „Erschrockenheits“-Gestus unserer depressiven Lyriker und Ich-Literaten erinnert mich an jenen „inflationären Gebrauch von Leidfloskeln“, wie ihn Botho Strauß für die „Szene“ beschrieben hat:
… eine Art hypochondrisches Display betreibt Werbung für die eigene Hochempfindlichkeit… Was werden sie erst sagen, wenn eines Tages der erhebliche Schrecken auftaucht?… Angst vor Atommüll, Überbevölkerung, Hungerkatastrophen usw.? Nein. Es gibt keine reale Angst vor einem kollektiven Schicksal. Das ist… immer nur die Reflexion von etwas wesentlich Abstraktem durch das eigene Gemüt. Was ist schon, im Empfindungshorizont des Einzelnen, ein Massentod?…83
Ist es nicht seltsam? Dieselben Lyriker und Ich-Literaten, die doch sonst, und mit gewissem Recht, am Marxismus zu beanstanden pflegen, daß er die Rolle der Subjektivität und der Persönlichkeit in der Geschichte sträflich vernachlässige – dieselben Leute denken und argumentieren auf einmal ganz streng deterministisch, ja, geradezu vulgärmarxistisch. Nach dem Motto: Das grauenhafte Sein bestimmt das Bewußtsein! Dabei ist es noch nicht einmal ein faktisches, sondern nur ein mögliches, ein futuristisches Sein, das unser Bewußtsein schon jetzt zur Depression verurteilen soll. Und wehe, es ist nicht depressiv! Dann ist es nämlich – o Kurzschluß! – ein „falsches“, ein „ideologisches Bewußtsein“, das sich in die Idylle, in eine „heile Welt“ davonstehlen will, oder noch schlimmer: ein latent faschistoides Bewußtsein, das im Namen des „Positiven“, des „gesunden Volksempfindens“ die Produkte unserer depressiven Lyriker auf den Scheiterhaufen der „entarteten Kunst“ zu werfen droht. – Darf man denn das Zeitgenössische Stimmungskartell, das die Literatur auf einen einzigen, nämlich den depressiven O-Ton verpflichten will, nicht mehr kritisieren, ohne mit dem Dekadenzvorwurf der Nazis gegen die damalige „Asphalt-Literatur“ gleichgeschaltet zu werden?
Folgt man den allergischen Invektiven gegen Heises Artikel, dann könnte man fast zu dem Schluß kommen, die ganze Ich-Literatur der letzten Jahre sei eine pure Maskerade gewesen. Denn hätten die Kunert, Härtling und Krüger wirkliche Ich-Forschung betrieben, dann müßten sie wissen, was heute längst psychoanalytischer Gemeinplatz ist: daß im Falle anhaltender Depression deren eigentliche Quelle weniger im Außen, vielmehr im Innen zu suchen ist; in der Subjektivität, der Lebensgeschichte des betreffenden Menschen. Bei aller gestörten Vitalität hat der Depressive freilich ein vitales Interesse daran, sich von seinen drückenden Versagens-, Schuld-, Haß- oder Ekelgefühlen zu befreien, indem er diese nach außen „projiziert“. Infolgedessen ist seine Wahrnehmung durchaus nicht objektiv, vielmehr im höchsten Grade subjektiv und selektiv: Im Extrem nimmt er von der Außenwelt überhaupt nur noch diejenigen Momente wahr, die mit seinem negativen Lebensgefühl korrespondieren. Vor einem blühenden Apfelbaum stehend, wird er mit Vorliebe nach jenen Äpfeln suchen, die faul und wurmstichig sind. Und wenn er ein Lyriker ist, dann wird er den faulen Apfel als Beweis und Metapher dafür nehmen, daß alles in der Welt faul und wurmstichig ist. Wenn daher der Lyriker und Lektor Michael Krüger eine „universelle Verstinkung“ registriert, dann darf man getrost annehmen, daß die primäre Stinkquelle in seiner eigenen Brust liegt.
Kunert hat es Heise offensichtlich am meisten verübelt, daß er es überhaupt wagt, zwischen dem „Dichter“, der gleichsam stellvertretend für die ignorante Menschheit leide, und dem „Dachdecker“ einen Vergleich herzustellen. Das ist für Kunert natürlich reinste Demagogie:
Anders läßt sich sein (Heises) Vergleich, der keiner ist, da er bewußt Inkommensurables als gleichwertig nebeneinanderstellt, um es mit einem falschen Gewicht abzuwägen, gar nicht verstehen… Statt zu fragen, wieso man vor Auschwitz und Hiroshima anders geschrieben hat als nach Auschwitz und Hiroshima, kommt er uns mit dem metaphorischen Dachdecker, als sei dessen fröhliche Ignoranz das verpflichtende Maß aller Lyrik. Wer so etwas schreibt, disqualifiziert sich selbst.
Ich möchte in diesem Zusammenhang an eine Geschichte Franz Kafkas erinnern, die wohl verdiente, zu seinen besten gerechnet zu werden: Ich meine seine späte Erzählung „Josefine, die Sängerin, und das Volk der Mäuse“, die für Kafkas Sicht auf den Künstler geradezu exemplarisch ist. Jedenfalls wird hier der elitäre Künstler- und Geniebegriff, dem Kunert und unsere Feuilletonisten anhängen, einer radikalen und höchst vergnüglichen Kritik unterzogen. Das Volk der Mäuse, durchaus vergleichbar unserem „pfeifenden Dachdecker“, steht Josefines Gesangskunst zwar durchaus wohlwollend gegenüber und spart nicht mit Applaus. Und doch erscheint es ihm immer wieder fraglich, ob ihr Gesang nicht bloß eine höhere Art des Pfeifens sei, ja, vielleicht sogar, über die Grenzen des üblichen Pfeifens gar nicht hinauskommt. Im Unterschied zu Kunert besteht Kafka gerade auf dem „Kommensurablen“ zwischen Josefines lyrischen Koloraturen und dem beifälligen Pfeifen der Mäuse; und bis zuletzt bleibt unentschieden, ob Josefines erlesene Gesangskunst nicht bloß auf einer Selbsttäuschung und der freundlich-nachsichtigen Projektion ihrer mausgrauen Zuhörerschaft beruht.
Ist es nicht merkwürdig? Vor fünfzehn Jahren gab es hierzulande etliche „Dichter“, die ihr hochgestochenes, vom bürgerlichen Geniebegriff des 19. Jahrhunderts abgezogenes Selbstbild in der Öffentlichkeit freiwillig zurückgenommen haben. Bescheiden, und in durchaus realistischer Einschätzung ihrer gesellschaftlichen Rolle, nannten sie sich fortan „Autoren“ und begriffen sich wie andere auch als arbeitende Menschen (der schreibenden Zunft). Ein Jahrzehnt später steht der „Dichter“, in der weihrauchgeschwängerten Luft des deutschen Feuilletons, wieder auf dem Kothurn und darf sich, wie gehabt, als „Priester“ und „Seher“ seines Volkes aufspielen. Dabei pfeifen die Spatzen jene Un-Heilbotschaft, die der Teiresias der deutschen Lyrik mit seherischer Gebärde verkündet, längst von den Dächern. Auch unser metaphorischer Dachdecker weiß längst um jene ökologischen und atomaren Bedrohungen, auf die Kunert sein Untergangs-Pathos gründet. Und trotzdem, Kunert zum Trotz, pfeift der gute Mann. Aus „fröhlicher Ignoranz“? Nein! Er pfeift, weil er, im Unterschied zu unseren depressiven Intellektuellen, im Hier und Heute lebt und sich wie ein Masochist vorkäme, wenn er, mit Blick auf eine bedrohliche Zukunft, auf sein bißchen Lebensfreude schon jetzt verzichten sollte.
Schon Adornos Forderung, daß man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könne, haftete – wiewohl unmittelbar nach dem Kriege verständlich – etwas Verquält-Masochistisches an. Genausogut hätte Adorno fordern können, daß man nach Auschwitz sich nicht mehr mit so esoterischen Fragen befassen dürfe, wie die Musikästhetik sie aufgibt. Aber natürlich schnitt sich dieser vorzügliche Musikkritiker nicht ins eigene Fleisch. – Daß, wie Kunert konstatiert, nach Auschwitz und Hiroshima andere Lyrik als davor geschrieben wurde, ist natürlich richtig. Aber daß der Lyriker nach Auschwitz und Hiroshima sein Haupt und seine Verse nur noch mit Asche bestreuen dürfe, halte ich für einen durch nichts gerechtfertigten Purismus.
Wenn Kunert heute seine lyrische Produktion vornehmlich in den Dienst des Weltuntergangs stellt, so folgt er noch immer jenem Gesetz der Ideologisierung von Kunst, das er ansonsten so scharf bekämpft. Hat sich die Lyrik der späten sechziger und der frühen siebziger Jahre zum Propheten eines blind geglaubten Fortschritts und einer ungebrochenen Aufklärung gemacht, wobei sie oft genug zur Gesinnungslyrik entartete, so macht sie sich nun, bei Kunert und anderen, zum Propheten einer ebenso ungebrochenen Anti-Aufklärung und Geschichtsverzweiflung. Das heißt, im Grunde haben wir es nur mit einer umgekehrten Gesinnungslyrik zu tun, mit Gesinnung ex negative, die nun alle Ideologien, Utopien und Hoffnungen von vormals zwanghaft negiert. Das Gemeinsame zwischen der damaligen (politischen) Gesinnungslyrik und der heutigen Untergangslyrik aber besteht darin, daß sich das lyrische Ich dem geglaubten Weltenlauf – damals dem linearen Fortschrittsgedanken, heute dem apokalyptischen Gedanken – subaltern unterwirft und zur selbstbewußten Entfaltung aller Stimmungsregister der Condition humaine gar nicht mehr kommt. Die eigene subjektive Befindlichkeit dermaßen rigide einem Abstrakt-Allgemeinen unterzuordnen, in dessen Namen die ganze Klaviatur der menschlichen Empfindungen nivelliert wird, so daß nur noch ein einziger, der depressive Dauerton (wie der zermürbend monotone TV-Summton nach Programmschluß) hörbar wird – dies scheint mir eher eine deutsche Intellektuellen-Krankheit denn eine poetische Tugend zu sein. Und genau dies meint Heise, wenn er vom „alten unfrohen Klima genußverdrängender Hirnlichkeit“ spricht und, auf Nietzsche Bezug nehmend, sagt, daß „ein Mensch, der durch und durch historisch zu empfinden trachtet, vital zu Schaden kommt“.
2. Die Entlassung des Menschen aus dem Gedicht.
Ideologiekritische Aperçus zu Günter Kunerts neuerer Lyrik
Wo sich der Erfolg eines Lyrikers nicht zuletzt den vielfältigen Ressentiments und schlechten Ideologiesurrogaten verdankt, die hinter der poetischen Verschalung sichtbar werden, da ist, neben der literarischen, auch Ideologiekritik angebracht; zumal die zum Verzweifeln schöne absteigende Tonfolge der Kunertschen Poesie geradezu zur Erkennungs-, ja Lieblingsmelodie des hiesigen Feuilletons geworden ist: Geschichtsverzweiflung in Versen – und zwar für den erlesensten Geschmack! Die Würdigung der unbestreitbaren artistischen Fähigkeiten dieses Lyrikers, seiner formalen Meisterschaft, seines virtuosen Umgangs mit der literarischen Tradition etc. überlasse ich daher für diesmal seinen zahlreichen Bewunderern auf der feuilletonistischen Galerie, die auch die allerneuesten lyrische Simulationen dieses Untergangs-Künstlers mit brausende Applaus bedacht haben.84
Wie uns der Klappentext der neuesten Gedichtsammlung Stilleben85 versichert, verweisen diese Gedichte auf eine vertiefte „Trauerarbeit“. In der Tat hat Kunert schon oft, zuletzt in seinem Essay „Deutsche Angst“, deutlich gemacht, wie sehr er an der Kardinalunfähigkeit der Deutschen, ihrer „Unfähigkeit zu trauern“, leide:
Sicher sind die Deutschen die Tüchtigsten, aber sie haben dafür, indem sie ihre Ängste verdrängten und kompensierten, im romantischen Wortsinn mit – ihrem Seelenfrieden – bezahlt… Unsere ,Unfähigkeit zu trauern‘ beruht auf der Angst vor der Trauer, vor der Hingabe an das Leid der Welt, obgleich eine derartige Hingabe zum inneren Gleichgewicht gehört. Der durch Alexander Mitscherlich beinahe zum geflügelten Wort gewordenen Trauerunfähigkeit der Deutschen korrespondiert dialektisch jene zur Fröhlichkeit und zum Glücklichsein. Wer nicht weinen kann, wird kaum je lachen können.86
Dies ist gewiß eine richtige Diagnose bezüglich „deutscher Mentalität“. Und lange Zeit ließ sich Kunerts Poesie als dichterischer Gegenentwurf zur Trauerunfähigkeit seiner Landsleute verstehen. Der schmückende Beiname „Dichter der Traurigkeit“, mit dem Kunert alsbald geadelt wurde, verwies denn auch auf die besondere Empfindlichkeit und Verletzbarkeit dieses Poeten, der die von seinen Zeitgenossen verdrängten Ängste und Leiden in seinen Gedichten formulierte. Vor allem in seinen frühen Prosastücken lagen die Bruch- und Wundstellen der eigenen Biographie noch offen zutage. Kunerts Bedrohungs- und Ohnmachtsgefühle waren hier an konkrete Menschen, vor allem an Frauengestalten gebunden, die zumeist in der Doppelgestalt als Verursacher wie als mögliche Erlöser von diesen Ängsten erschienen.
Anders in Kunerts neuerer Lyrik: Die persönlichen Anlässe seines Unglücks, seines Leidens sind fast vollständig weggeblendet; dieses wird vielmehr zum Leiden an der Welt, am Weltzustand als solchem stilisiert und ideologisiert. Angst und Verzweiflung, die in Kunerts früheren Dichtungen noch aus einem bedrängten Herzen kamen, das sich seiner seelischen Folterknechte zu entledigen hoffte, gehören nun gleichsam zum liebgewordenen Inventar seines seelischen Besitzstandes. Kunerts Angst, seine Angst zu verlieren, ist mittlerweile so groß, daß ihm nun jedes Gelächter als Flucht vor der Angst, jedes Moment von Glück als verlogene Bemäntelung eines allumfassenden Unglücks erscheint: „Neben der Hülle aus Luft / und Dampf und Gift / umfängt aus Unglück eine / die Kugel… unstofflich sich verbreitend und sich verbindend jedem Wort / des Bedauerns / jedem Lächeln wie ein Krampf / jedem Händedruck verräterisch / “ – so hieß es schon im „Beitrag zur Geologie“ aus dem vorletzten Gedichtband Abtötungsverfahren.87 Die Angst, hat Wilhelm Reich einmal gesagt, spielt in der psychischen Ökonomie dieselbe Rolle des Äquivalents wie das Geld, der materialisierte Tauschwert, in der kapitalistischen Ökonomie. Wie dieses alle Gebrauchswerte nivelliert, so nivelliert jene alle Gefühlswerte. Die Angst verwandelt gleichsam alle Farben der Gefühlspalette in ein uniformes Grau-Schwarz. Demnach ist Kunert schon lange kein „Dichter der Traurigkeit mehr, der ja (wie er selber sagt) dialektisch die Fähigkeit zur Fröhlichkeit und zum Glücklichsein korrespondiert, vielmehr der Verseschmied einer chronisch gewordenen Depression.
Er ähnelt jenem Prinzen der Sage, den der Blick zurück, d.h. in die eigene Vergangenheit, versteinern ließ. So nämlich geht es Kunert mit seiner DDR-Vergangenheit. Sein Abschied von der DDR war keiner in Trauer, es war vielmehr eine eisige, ja, haßerfüllte Trennung von dem Land, das ihm einst nicht nur politische Heimat, sondern auch Gegenstand seiner patriotischen Verehrung gewesen ist. Davon zeugen manche seiner früheren Gedichte, die im Westen, versteht sich, nie publiziert worden sind. So viele Belege Kunert für die bürokratisch erstarrten und versteinerten Verhältnisse der DDR anzuführen weiß, es ist nicht zuletzt sein eigener gorgonischer Blick, unter dem sich seine Vergangenheit in eine einzige „tote Zone“ verwandelt:
Da ist nichts mehr
zu beschreiben. Statt dessen
verhöhnt Beton alles Eingedenken.
Wo die eigene Vergangenheit zum „Niemandsland“ erklärt wird, da muß auch die Gegenwart zum „Stilleben“ im Sinne von stillgestelltem Leben, ja, zur „Nature Morte“ werden, wie eines der Leitgedichte der neuen Gedichtsammlung heißt:
Fade Wiederholung:
Dieser Abend eines vorigen und
vorvorigen. Wieder täuscht Ruhe
Frieden vor… Am Ende sind die Taschen leer
wie am Anfang. Und
über das Fensterbrett zieht
das apokalyptische Heer der Ameisen schon…
Wer aus seiner Vergangenheit nichts mitzunehmen weiß, dem wird auch die Gegenwart „leer“. Kein Wunder, daß sich in den neuen Gedichten die Metaphern der Leere, des Nichts und der Stille stereotyp häufen. Fast könnte man sagen, Kunert kokettiere mit dem Nirwana-Gefühl. Seine einzig noch erkennbare Euphorie scheint dem Horror vacui zu gelten: „Statt eines Traumes lauter leere Taten“… „Sprachlos über die leeren Seiten der Geschichte gebeugt“… „Es brennt die Welt sich selber langsam leer“… „und dabei hatte ich einstmals / die ganze Erde im Griff / und nun: Nichts in der Hand“.
Zwischen „Alles oder Nichts“ gibt es bei Kunert kein Etwas. Es ist dieser teutonische Absolutismus seines Denkens und Fühlens, der seine Verzweiflung, die doch erhaben sein möchte, unfreiwillig in die Nähe gekränkter Omnipotenz-Phantasien und pubertärer Sinnkrisen rückt. Wer die Hand immer gleich nach der „ganzen Erde“ ausstreckt und den Blick immer gleich ins Kosmische richtet, dem müssen Hand und Blick natürlich leer werden. Und wer „den Sinn“ hinter den Sternen sucht, statt im konkreten Menschlichen und Geschichtlichen, der wird freilich nichts finden.
Mit der Geschichte jedoch, vor allem mit der des „realen Sozialismus“, ist Kunert schon lange fertig. Warum der DDR-Sozialismus, unter den gegebenen historischen Umständen des postfaschistischen Erbes und der stalinistischen Umklammerung, degenerieren mußte – diese Frage stellt sich auch der Essayist nicht. Statt dessen projiziert der Lyriker seine Enttäuschung am „realen Sozialismus“ nun auf die ganze Weltgeschichte zurück.
Heraus kommt dabei – wie könnte es anders sein – ein stockkonservativer Sozialdarwinismus (nämlich daß der Mensch dem Menschen übler ist als ein Wolf) und die Menschheits- als verfehlte Fortschrittsgeschichte, als ununterbrochene Geschichte der „Aberrationen“. Nur Kunerts lyrische Ideologiegeschichte ist natürlich von dieser universalen Aberration ausgenommen. „Der“ Mensch ist ihm eine „ausgesetzte Fehlgeburt“, ein „Wesen, das sich selbst verschlingt“. Zuweilen glaubt man zwischen den misanthropischen Zeilen herauszuhören, daß diese anthropologische Mißgeburt ihren Untergang eigentlich verdient hat.
Wo die Natur nur noch als „Nature Morte“ und die gesellschaftliche Natur des Menschen als bloße Maskierung seiner Raubtiernatur gesehen wird („Du bist ein Tier. Und bist es stets geblieben“), da bleibt die Einsamkeit als einziger Modus des (dichterischen) Existierens übrig. Wer diese Daseinsweise freiwillig oder notgedrungen wählt, dem wird niemand einen Vorwurf machen können. Wo aber, wie bei Kunert und seinem feuilletonistischen Anhang, die Einsamkeit zur höheren Daseinsweise, ja, geradezu zum Signum des poetischen Geburtsadels verklärt wird, da ist Einspruch geboten. Daß der vereinsamte und dem Tod geweihte Dichter eigentlich der „wahre Dichter“ sei – diesen romantischen Edelkitsch hat Kunert erst kürzlich wieder in einer FAZ-Besprechung von Borns Lyrik verbreitet:
Allein es gehört zu den psychischen Implikationen dieser besonderen Gattung, daß ihre Schöpfer dem Tode auf gewisse Weise näher sind als andere Autoren.
Und im gleichen Artikel rühmt er Borns Lyrik als eine „Evolution der Einsamkeit“, ja, Einsamkeit sei hier „zu sich selbst gekommen“.88 Aus dem „Gift des dunklen Insichseins“, wie Ernst Bloch die Einsamkeit charakterisiert, mixt Kunert einen lyrischen Cocktail, und nur wer diesen Giftbecher bis zum Grunde geleert hat, gilt ihm und dem deutschen Feuilleton offenbar als „Dichter“.
Kunerts vielzitierte Hoffnungslosigkeit, seine verzweifelten Abgesänge auf einen zweifelhaft gewordenen geschichtlichen Fortschritt sowie seine expressionistische Beschwörung des drohenden Weltenendes konnte man anfangs vielleicht noch als lyrischen Auf- und Protestschrei gegen eine Zivilisation begreifen die – im Namen des Wachstums und des Wettrüstens – auf ihre eigene Zerstörung hinarbeitet. Inzwischen ist seine Menschheitsverzweiflung längst zur misanthropischen Pose, seine Hoffnungslosigkeit zur feuilletonistischen Phrase geworden, die nun genauso doktrinär daherkommt wie die von ihm attackierten Fortschrittsideologien. Es ist schon fast gleichgültig, wo man den neuen Gedichtband aufschlägt, überall ertönt dieselbe Litanei:
Einmal ergreift jeden
die schwarze Woge
und schleppt ihn mit
und wirft ihn nieder
am Kap
der guten Hoffnungslosigkeit.
Oder:
Ein Name fiel: Du warst betroffen
Was es bedeutet, weißt nur Du allein:
Das Gegenteil von allem Hoffen
Ein Synonym für Einsamsein.
Und an anderer Stelle, fast schon Hamletartig:
Statt Hoffnung spricht zu Dir das Schweigen.
Lauter schöne Kalendersprüche, die sich der Zeitgenössische Spießer übers Bett hängen kann. Wo nämlich das Kapital der Hoffnung aufgezehrt ist, da kann man die Hände getrost in den Schoß legen und auf das Weltenende warten, derweil man sein Kapital für sich arbeiten läßt.
Ein einziges von diesen mehr als neunzig Gedichten ist an einen konkreten Menschen gerichtet: an des Dichters Frau M. Alle anderen handeln von „der“ Menschheit. Das macht mißtrauisch zumal selbst die in diesem Gedicht beschworene „Zweieinigkeit“ den Dichter in seiner globalen Verlorenheit nicht zu trösten vermag. „Kein Traum, kein Denken und kein Samen / Verloren ich: In aller Namen“, heißt es bald darauf in einem anderen Gedicht. Zu großspurig wirkt solcher Verlassenheitsgestus, als daß sich die gewünschte Anteilnahme mit dem „poète maudit“ wirklich einstellen würde. – Wo, wie in diesen Gedichten, kaum ein menschliches Verhältnis mehr aufscheint, das (wenigstens kurzfristig) Vertrauen, Nähe und Sinn stiften kann, da stellt sich der Verdacht ein, daß es die eigene Eiseskälte ist, die – als nach außen projizierte – macht, daß einem die Welt nur noch als Gletscherlandschaft erscheint. „Ach, leugne nicht, daß kalt Dein Herz und leer / Da selbst für Dich es jeder Sorge bar / Gesteh’, Dich liebt so mancher, nimmermehr / Liebst einen Du, das ward mir offenbar. / Du bist so ganz von Eigenhaß besessen / Daß Du Dich selber gegen Dich verschwörst / Das herrliche Gebäude pflichtvergessen / Statt es zu schützen, freventlich zerstörst.“ – Nein! Dieses Sonett ist nicht von Kunert. Es ist von Shakespeare.89
Womit wir beim vielbesprochenem Hauptmotiv der Kunertschen Lyrik wären: dem Todesmotiv, das dem Feuilleton als todsicheres Indiz für poetische Qualität und Tiefgründigkeit gilt. Was gibt es auch Tiefgründigeres, als in schön gedrechselten Versen das Leben als ununterbrochenen Totentanz, die Geschichte als ein einziges Gebeinhaus darzustellen? Den Tod, den Goethe einmal einen „Kunstgriff des Lebens“ nannte, hält Kunert nämlich für das einzig wahre Sein, während für ihn die Vielfalt des Lebendigen – barock gesprochen – nur eitles Blendwerk, kolorierter Schein ist. Kunert teilt zwar die Todessehnsucht des späten Barock, ohne jedoch – Puritaner, der er ist – an dessen überbordender Lebens- und Sinnenlust teilzuhaben. Auf der anderen Seite scheint Kunert an nichts mehr zu leiden als an seiner Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Zuweilen hat man den Eindruck, daß er nur deshalb mit der Schöpfung hadert, weil sie ihm das endliche Schicksal all seiner Artgenossen bereitet hat. Und er zahlt es ihr über den Tod hinaus heim, indem er sich weigert, den kostbaren Stoff, aus dem sein unvergleichlicher Corpus delicti gemacht ist, mit der übrigen Materie in Tuchfühlung treten zu lassen:
Hinauslaufen in die bodenständigen Wolken
und nicht wiederkommen
und nicht mehr aufgefunden werden
nicht als vermißte Person
als fehlende Zahl
als Kadaver
als Reprise ewigen Unkrauts
auch nicht
als unwägbare Anzahl
von Mineralien und Spurenelementen…
Kunert scheint sich nicht damit abfinden zu können, daß er Unsterblichkeit höchstens mit seinen Gedichten erreichen kann. Zum Beispiel mit diesem:
Die Kugel soll verfliegen
auf der wir alle stehen
Ich bin an Deiner Seite
und laß es doch geschehen.
Soll man es Leicht- oder Hintersinn nennen, daß der Dichter ausgerechnet die ehemalige Reichshauptstadt, vierzig Jahre nach dem „Endkampf“, noch einmal dem apokalyptischen Feuerteufel überantworten will?
Berlin du späte Totenstadt
vergraut und still wie nie zuvor…
Du wirst versinken und vergehn
wie andre Städte einstens auch:
Berlin – auf Nimmerwiedersehen. Verfall zu Staub, steig auf in Rauch.
Günter Kunert – oder das klammheimliche Einverständnis mit dem Weltuntergang.
Kunerts mönchisches Starren auf das Weltenende (das ihm als sicher gilt, obwohl er sonst alle Sicherheiten ablehnt) kommt mir vor wie eine umgekippte Jenseitserwartung. Die Apokalypse wird ihm gleichsam zum Religions- und Ideologieersatz. Und es ist bezeichnend für alle adventistischen Ideologien, ob sie nun die baldige „Erlösung“ durch das Jüngste Gericht oder die „Endlösung“ durch einen Atomkrieg erwarten, daß die Lebensspanne vor dem visionierten Ende für sie keinerlei vitalen Wert mehr besitzt. Entsprechend wird Gegenwart, menschliches Da-Sein in seiner Unmittelbarkeit und Widersprüchlichkeit auch nicht mehr zum Gegenstand der Kunertschen Poesie
„Dem schlecht Entzauberten“, hat Ernst Bloch einmal gesagt, „schickt das Jenseits einzig Kälte herüber, ein doppeltes Memento mori, das Leben, das Handeln total entwertend.“ Auch Kunerts Endzeit-Lyrik steht (für mich) in jener Tradition christlicher Unfröhlichkeit, deren Blick von allem magisch angezogen wird, was sich als Beweis für die Negativität des Daseins auffassen läßt. Kunert negiert alles – nur nicht seinen eigenen Negativismus. Denn die „Negation der Negation“ wäre ja wieder eine Bejahung, und die fürchtet er wie der Teufel das Weihwasser.
Wenn sich der klassische Kitsch, sei es in der Malerei, sei es in der Literatur, durch eine widerspruchlose Darstellung, durch Schönfärberei und Vergoldung seines Gegenstandes definierte, so läßt die monotone Schwarzmalerei der Kunertschen Endzeitlyrik den Umkehrschluß zu: Daß wir es hier mit schwarzem Kitsch in edelster Form zu tun haben.
Der Begriff des Kitsches wird zumeist als Synonym für ein falsches und unechtes Gefühl benutzt. Dies stellt eine unzulässige Vereinfachung dar. Dem Kitsch liegen immer auch echte Gefühle zugrunde, im Fall des goldenen Kitsches etwa die Sehnsucht nach Harmonie und Glück, im Fall des schwarzen Kitsches die Erfahrung von Angst, Unglück und Schrecken. Das Falsche und Unechte am Kitsch entspringt allein dem Ausklammern und Wegblenden der Widersprüche sowohl der eigenen Gefühle als auch des Objekts, welches zum Gegenstand der Sehnsucht oder der Angst wird. Kitsch entsteht immer dann, wenn ein einziger Gefühlsvaleur zum Lebensgefühl schlechthin stilisiert, ein einziger Bildausschnitt zum Weltbild ideologisiert wird. Darum möchte ich Günter Kunert die Echtheit seiner Depression gar nicht absprechen. Es ist nur die falsche Verabsolutierung seiner depressiven Gestimmtheit zum „Wesen“ der Menschheit und zum „Geist“ der Geschichte, die seine jüngsten Produktionen meines Erachtens zum schwarzen Kitsch werden lassen.
Kunerts Menschheitsverzweiflung stellt aber nicht nur ein schlechtes Ideologie-Surrogat dar; aus ihr läßt sich auch bedenkenlos ideologisches Kapital schlagen. So fehlt in keinem Kommentar zu Kunerts neuerer Lyrik der Hinweis, daß seine Geschichtsverzweiflung auf dem Boden der DDR gewachsen sei. Nicht zuletzt seinen lyrischen Ab- und Grabgesängen auf das andere Deutschland verdankt Kunert seinen düsteren Ehrenplatz im westdeutschen Kulturbetrieb. Seltsamerweise hat kein Rezensent bisher die Frage gestellt, warum Kunerts Depression nachweislich zugenommen hat, seit er das „totalitäre Regime der DDR“ mit dem „Land der Freiheit“ vertauscht hat. Wenn Kunerts DDR-Erfahrungen hauptsächlich an seinen Bedrückungen schuld sind, dann hätte man nach seiner Übersiedlung in die BRD eigentlich einen Aufschwung seiner Lebensgeister erwarten dürfen. Das genaue Gegenteil ist indessen eingetreten, wie seine letzten Gedichtbände bezeugen.
Es stellt sich daher die Frage, ob nicht auch und gerade Kunerts Emigrantenschicksal mitursächlich für seine wachsende Depression ist. Die Umarmung durch den westdeutschen Kulturbetrieb hat, soweit ich sehe, für viele DDR-Emigranten etwas Tödliches; gilt sie doch in den meisten Fällen weniger dem Dichter und seinem Werk, vielmehr dem DDR-Flüchtling, der (oft, ohne sich dessen bewußt zu werden) als literarischer Kronzeuge einer gegen die DDR gerichteten Propaganda benutzt wird. Und gewöhnlich geht seine Karriere hierzulande nur so weit voran, als er in diesem kulturpolitischen Spiel mitspielt. Das Unglück vieler DDR-Emigranten rührt zum Teil daher, daß sie gleichwohl spüren, daß sie selbst und ihr Werk eigentlich gar nicht gemeint, sondern primär Mittel zum Zweck sind. Hinzu kommt, daß sie (nach meinen Erfahrungen) den abrupten Wechsel der kulturellen Klimazonen seelisch meist nicht verkraften. Der Kulturbetrieb der DDR gleicht einem streng patriarchalisch geführten Familienbetrieb, der Geborgenheit, Zusammenhalt und kulturelle Identität um den Preis stiftet, daß die künstlerische Freiheit entschieden eingeengt und jeder ernstliche Verstoß gegen die Richtlinien der Partei mit schweren Sanktionen (vom Publikationsverbot bis zum Ausschluß aus dem Schriftstellerverband und der Zwangsausbürgerung) geahndet wird. Der bundesrepublikanische Kulturbetrieb dagegen gleicht einem anonymen Dschungel, in dem zwar im Prinzip alles erlaubt ist, aber um den Preis, daß selbst die entschiedenste literarische und politische Opposition früher oder später vermarktet und vereinnahmt wird (und so letztlich wenig bewirkt) und jede kulturelle Identität im Strudel der immer schneller wechselnden Trends und Moden zerstört wird. Und so fallen die aus der DDR emigrierten Schriftsteller und Künstler, ist der erste Empfangs- und Verkaufsrausch erst einmal vorbei, gewöhnlich ins Bodenlose, kommen nicht mehr zurecht, fühlen sich als Fremdlinge in einem Kulturbetrieb, in dem jeder gegen jeden kämpft und in dem man bei Strafe, sofort in Vergessenheit zu geraten, jeden Trendwechsel, jeden literarischen oder Bewußtseinswandel mitvollziehen muß. Just in dem Deutschland ihrer Wahl fallen sie dann oft jener Depression anheim, der sie durch die Emigration aus dem anderen Deutschland zu entkommen suchten.
Auch auf dem Grunde der Kunertschen Menschheitsverzweiflung lassen sich unschwer die Züge dieser gesamtdeutschen Symptomatik erkennen; die wechselseitige Paranoia einer geteilten Kulturnation, die – hüben wie drüben – ihre Schriftsteller und Künstler vornehmlich als Stellvertreter im ideologischen Abgrenzungskrieg und Grabenkampf benutzt. Wird ihre künstlerische Freiheit östlicherseits sofort beschnitten oder aufgehoben, wenn sie gegen die Richtlinien der Partei verstoßen, so werden sie westlicherseits zumeist sehr schnell fallengelassen, wenn sie nicht die Rolle des Denunzianten gegenüber dem Land spielen, das sie verlassen haben (oder mußten). So gesehen, spiegelt der depressive Dauerton der Kunertschen Lyrik auch die gesamtdeutsche Misere wider.
Michael Schneider, aus Michael Schneider: Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Essays, Aphorismen, Polemiken, Kiepenheuer & Witsch, 1984
Dagmar Hinze: Der Bruch mit der Utopie. Die Lyrik der 80er und 90er Jahre von Günter Kunert
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Thomas Combrink: Sich den Bewegungen der eigenen Hand überlassen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.2025
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993 – Lesung: Günter Kunert. Moderation: Hajo Steinert. Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb + DAS&D + Archiv + Internet Archive + IZA + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: AA ✝ FAZ ✝ FR ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ NDR 1 + 2 ✝ NZZ ✝ Sinn und Form ✝ SZ 1 + 2 ✝ Tagesspiegel ✝ Welt ✝ Die Zeit 1 + 2 ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


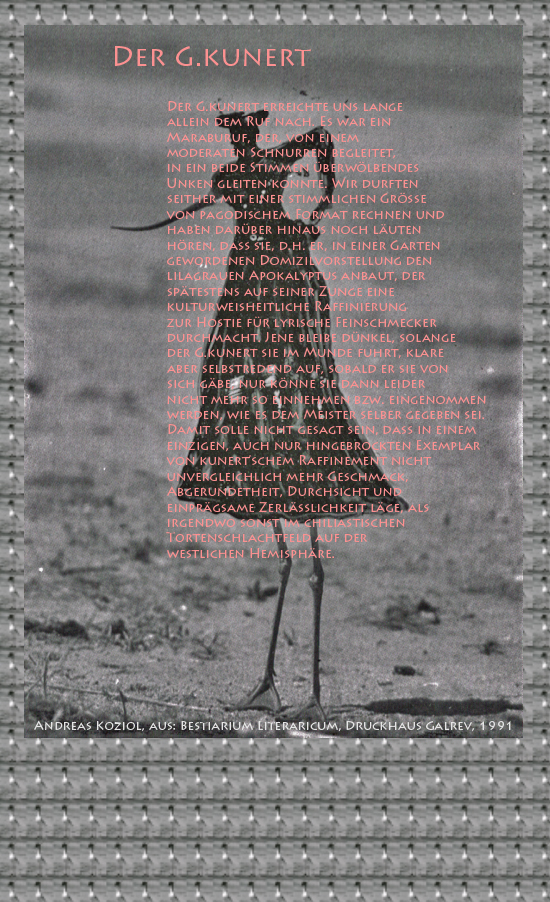
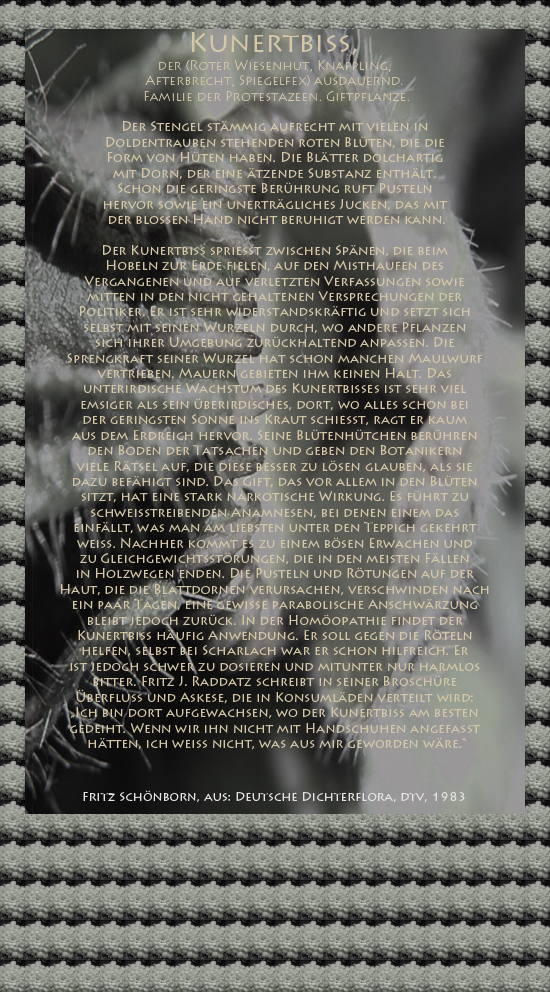
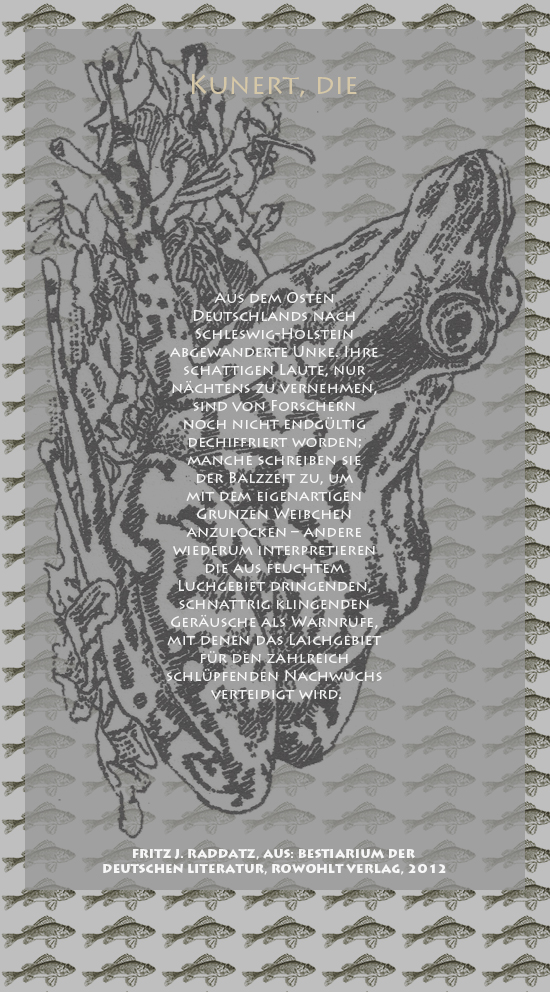
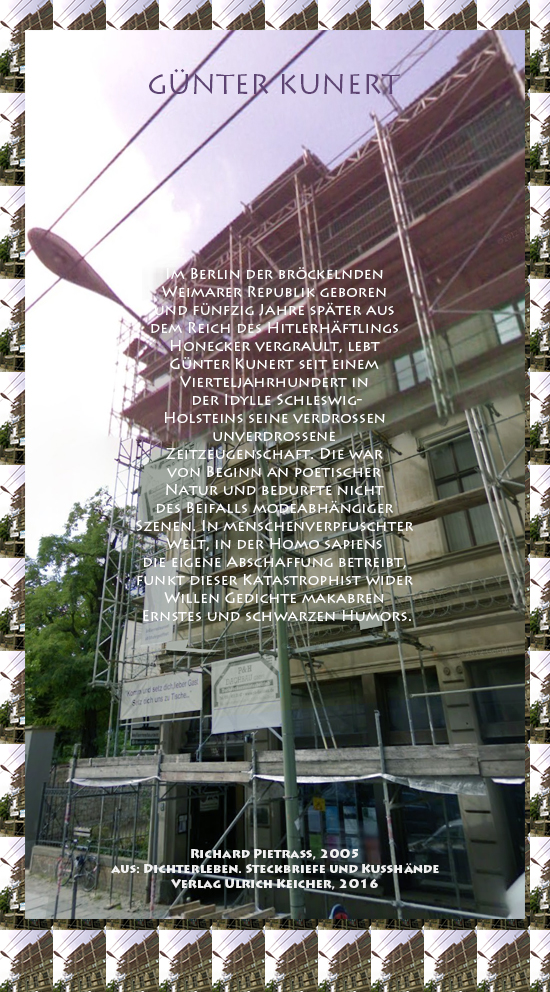












0 Kommentare