KOSMISCHES ZWISCHENSPIEL
Ein Doppelmond
kommt unter schwarzen Schleiern vor.
Rücklings rückt
unabwendbar dringlich ins Gesichtsfeld
das gepaarte Gestirn: Angebot
teilzunehmen teilzugeben
an gewöhnlicher astronomischer Vervielfältigung
heftig bemühter Thermodynamik
sekundenverschlungenem Weltuntergang.
Bei der Geburt der Nova
auf Wiedersehen
vielleicht im Meridiankreißsaal.
![]()
Günter Kunert: denkender Dichter
– Laudatio zur Verleihung des Friedrich-Hölderlin-Preises an Günter Kunert am 7.6.1991. –
Er singt nicht, wie der Vogel singt. Dies sei vorerst einmal festgehalten.
Falls man sich trotzdem im Bereich der Ornithologie nach Mustern umsehen wollte, käme man eher auf die Eule oder den Raben, diese sehr einzelnen Wesen, die bei den erfahrenen Hexen, den Zauberern und weisen Göttinnen wohnen und die selber in Abständen ein bedeutsames Wort fallen lassen. Auch bringen sie nach der Überlieferung Nachrichten aus abgelegenen Weltgegenden, unbekümmert über den erfreulichen oder unerfreulichen Inhalt. Das hat insbesondere die Raben bei den Optimisten und Frohnaturen in Verruf gebracht. Wer hingegen gewohnt ist, mit dem Schlimmsten zu rechnen, und eine rauh geknarrte Wahrheit über die melodiöse Lüge stellt, fühlt sich ihnen verbunden.
Es ist anzunehmen, daß Günter Kunert nach dieser Richtung neigt. Eine Frohnatur im engeren Sinne scheint er nicht zu sein, und wenn es auch nicht knarrt in seinen Versen, weiß Gott nicht, so darf man doch zu Zeiten von einem vernehmlichen Knurren sprechen.
Er ist ein denkender Dichter, war es von Anfang an, und sein Kopf, die unverwechselbare Gegebenheit dieses ansehnlichen Kopfes, ist an jedem seiner Verse beteiligt.
Daß daraus keine Mißachtung anderer Körperteile abzuleiten ist, geht aus etlichen seiner lyrischen Arbeiten ebenfalls hervor. Diese sind, was man einst als gewagt bezeichnete, und wenn gewagte Gedichte heute kein eigentliches Wagnis mehr darstellen, so müssen sie um so mehr gekonnt sein. Kunert kann es. Es kennzeichnet lange Jahrzehnte seines Arbeitslebens, daß das tatsächlich gewagte Gedicht, der Vers als Risiko, für ihn von politischer, nicht von erotischer Natur war – und daß er das Risiko einging, kennzeichnet den Autor. Er war in diesen Dingen allerdings nicht frei. Als denkender Dichter war er der Wahrheit verpflichtet, jener Wahrheit, zu der er in seinem arbeitenden Kopf gelangte. Die Verse und Strophen, die sich daraus ergaben, tragen auch in ihrer erscheinenden Gestalt die Charakterzüge des strengen Denkens. Sichtbar streben sie nach der knappsten zu erlangenden Form. Kunert zählt zu den wenigen genuinen Epigrammatikern der Nachkriegszeit. Eines seiner ganz frühen Gedichte, eines seiner bekanntesten zugleich – es gehört zur Handvoll lyrischer Klassiker, die wir ihm verdanken –, zeigt dies beispielhaft:
ÜBER EINIGE DAVONGEKOMMENE
Als der Mensch
Unter den Trümmern
Seines
Bombardierten Hauses
Hervorgezogen wurde,
Schüttelte er sich
Und sagte:
Nie wieder.
jedenfalls nicht gleich.
Man könnte auf dieses Gedicht die Maxime anwenden, die Friedrich Dürrenmatt für seine Theaterstücke formuliert und gefordert hat: zu finden sei die schlimmstmögliche Wendung. Diese tritt hier wahrhaftig ein. In der Saloppheit des „Jedenfalls nicht gleich“ steckt die ganze Unfähigkeit der Menschen, aus der Geschichte zu lernen, mehr noch: der Vers entlarvt diese Unfähigkeit als einen willentlichen Akt. Ein schwieriger, unheimlicher, immens komplexer Zusammenhang erscheint hier auf wenige Worte verknappt. Das setzt nicht nur voraus, daß es einer kann, es setzt weit mehr noch voraus, daß es einer der Sprache zutraut, daß er die Sprache als das Mittel anerkennt, das die Gedanken so genau und so vollständig wiedergibt, wie sie dem autonomen Kopf entsprungen sind. Epigrammatiker können sich keine Sprachkrise leisten. Wenn sie nicht verstanden werden, sind sie geliefert, so glattweg geliefert, wie die hermetischen Dichter geliefert sind, wenn sie verstanden werden. Wenn Günter Kunert der Menschheit nicht mehr traut, dem Fortschritt nicht und nicht der Geschichte, wenn er den Philosophen nicht traut, die alles zu erklären, und nicht den Maschinen, die alles herzustellen versprechen, wenn es von Mißtrauen förmlich hallt und schüttert in seinen Texten, dann bleibt doch großartig bestehen das Vertrauen in die Verständlichkeit des Worts und in die Tauglichkeit der Sprache. Allerdings waren ihm dafür auch stets Beweise genug zur Hand: die Wut, beispielsweise, der Betroffenen; die Rachsucht, unter anderem, jener, die sich um das Verstehen seiner Zeilen nicht herumdrücken konnten. Wie sollten sie auch so bösen und präzisen Gedichten wie den folgenden ausweichen, Sprachdingen, die kühl und hart und flugbereit daliegen wie der kleine Kiesel in der Schleuder des jungen David:
WEIL ICH GESAGT HABE:
Hier stinkt’s
wurden über meinem Kopf
einige Nachttöpfe entleert:
als Gegenbeweis.
UNTERSCHIEDE
Betrübt höre ich einen Namen
aufrufen:
Nicht den meinigen.
Aufatmend
Höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Der erste Text, der aggressivere, ist der jüngere von beiden. Er wurde geschrieben in der DDR, zur Zeit der Biermann-Ausbürgerung, die in ihrer Konsequenz auch zur Ausreise des Dichters Günter Kunert, der Dichterin Sarah Kirsch führte: der Rabe und die Nachtigall flogen traurig über den Todesstreifen.
Möglich, daß er es von Brecht hat, dieses unerschütterliche Zutrauen zum Wort, die Überzeugung, daß die Sprache so, wie sie geäußert wird, auch ankommt und vernommen wird. Auch bei Brecht gibt es ja diese Bewegung der Verkürzung auf eine letzte Einfachheit hin, eine japanische Simplizität, die strahlt von Bedeutung. Wenn Kunert einen Zyklus „Bucher Elegien“ schreibt, 1974, in jenem Gedichtband, der seinen bisher heftigsten Schub von Verdüsterung und schwarzem Sehen markierte, dann ist in diesem Titel der Gleichklang mit Brechts Buckower Elegien nicht nur nicht zu überhören, sondern bildet ein offenkundig gesetztes Zeichen, das das Unternehmen zuhanden der Leser näher bestimmt. Brecht hatte in jenen Gedichten aus dem Jahr 1953 – das Datum fallt ins Gewicht – von seinem Garten gesprochen, von der Silberpappel und den „monatlichen Blumen“, und er hatte so deutlich von seinem Garten gesprochen, daß es möglich wurde, darin auch jenen „jardin“ Voltaires mitzuhören, das bittere letzte Wort des Candide. „Il faut cultiver notre jardin“ – das ist die resignative Parole, auf die Voltaire den Zusammenbruch seines Glaubens an eine unaufhaltsame Verbesserung der Welt am Ende seiner Erzählung bringt. In den fünfziger Jahren hätte der junge Kunert das versteckte Zitat wohl noch nicht begriffen, da war er selbst noch zu sehr Candide, und sein Verhältnis mit der Zukunft war noch ungetrübt, eine stürmische Liebschaft unter blauem Himmel. „Unter diesem Himmel“ heißt ein Gedicht aus jener Zeit. Es ist durchweht von schöner Hoffnung und Aufbaufreude, vom Glauben an „diesen Himmel“, das heißt: an diese Hälfte des „geteilten Himmels“:
ABENDS GEHE ICH
Leichten Schrittes durch
Meine Stadt.
Tief atmend den Duft von
Nassen Bäumen, von feuchtem
Mörtel.
(…)
Federnd laufe ich über
Den Beton. Vorwärts durch die
Weiten Straßen.
Einem Ziel zu.
Zwanzig Jahre später, in den „Bucher Elegien“, scheint ihm der unheimliche Doppelsinn deutlich geworden zu sein, der in Brechts Lob der Gärten und Silberpappeln steckte. „Verlassene Gärten“ heißt jetzt eines seiner eigenen Gedichte, und da geht es sich nicht mehr federnd auf gepriesenem Beton einem gemeinsamen Ziel entgegen, sondern es tönt voltairianisch verschattet:
Aber was da gesät wird, geht am Tage nicht auf:
Weisheit pflanzt sich nicht fort: sie ist
das fruchtlose Ende, zu dem
jeder nur einzeln gelangt
auf seinem einsamen Weg.
Von jetzt an lebt der Dichter mit der Zukunft in einer zerrütteten Beziehung. Nichts will mehr stimmen in dem Verhältnis der beiden, und die einstige Liebschaft schleppt sich hin, als war’s ein Stück von Strindberg. Grimmig redet er weiterhin von ihr, setzt das Wort „Zukunft“ mit hundert bösen Untertönen aufs Papier, und ruinensüchtig, wie er nun zusehends geworden ist, weist er vor den eingestürzten Palästen, den Tempeltrümmern und Säulenstümpfen, zu denen es ihn über den ganzen Kontinent weg zieht, mit ausgestrecktem Finger auf den Schutt und ruft: Seht her, auch das war einmal eine Zukunft! So bitter benimmt man sich nur, wo man einst sehr geliebt hat.
Kunerts Reden von den Ruinen, von Scherben und Schotter der zerfallenen Metropolen, einer der Grundklänge seiner Kunst, ist die dunkle Gegenmusik zu allem, was einst Aufbruch war und Aufrichtung und Aufbau – die marche funebre einer verlorenen Hoffnung. Im Gedicht „Atlantis“ stehen die Verse:
Als es unterging Sklaven
sollen geschrien haben in dieser Nacht
wie ihre Eigentümer
(…)
Präzedenzfall
für alle Zukunft wo wir geschrien haben
werden.
Wenn es stimmt, daß der Mund übergeht, wes das Herz voll ist, dann müßte man auf gewaltige Landschaften von Stein im Innern dieses Dichters schließen. Seine Gesänge von pompejanischen Szenerien im Schatten grollender Vesuve sind aus der deutschsprachigen Lyrik der letzten Jahrzehnte nicht mehr wegzudenken. Ihre Inständigkeit, die Genauigkeit des Blicks und die Unerschrockenheit der Gedanken, die diese dokumentarischen Visionen begleiten, zeigen, daß es sich hier um eine Hauptsache in der Welt-, Geschichts- und Lebenserfahrung des Autors handelt. Schrecklich, könnte man da sagen, schlimm: all diese Steine, all das Gefels und Geröll und Gemäuer! Man darf indessen nicht übersehen, daß der Stein und das Steinerne in der seelischen Erfahrung der Menschen von einer viel reicheren und hintergründigeren Bedeutung sind, als der alltägliche Sprachgebrauch es wissen will. Wohl steht der Stein für das Tote, aber er steht auch für das Dauernde, für die Erinnerung, die Wiederkehr. Er liegt auf den Gräbern als Zeichen für die Anwesenheit des Abgeschiedenen. Im Stein ist das Vergangene gegenwärtig und ragt die Gegenwart in alle Zukunft. Solche Dialektik, von der unsere Träume wissen und unsere Wünsche nach dem Besitzen, dem Berühren, dem Betreten von Steinen, waltet dichterisch vielsinnig in allen Trümmerliedern Günter Kunerts. Die elementare Zuverlässigkeit der Steine ist in seinem Werk untergründig verwandt mit der ebenso elementar erlebten Zuverlässigkeit der Sprache. Redend von den Steinen läßt er die Steine reden. Und wenn sie ihm dann unerbittlich das Ende der Hoffnung bestätigen, die kaputte Liebe zur Zukunft besiegeln, wenn sie bildmächtig zur Hand sind, wo er schwarz und schwärzer sieht, versichern sie ihn im gleichen Zug doch auch wieder seiner eigenen Gegenwart, der sagbaren Wirklichkeit des gelebten Tages, des gelebten Denkens und der gelebten Liebe. „Ruinenstätte“ heißt ein Gedicht. Es entspringt dem Anblick von Trümmern, beschwört einmal mehr Pompeji herauf. Und düster, rabendüster redet es vom Sterben, auf das auch alles Neubelebte und Auferstandene wieder hintreibe. Aber nun schaue man zu, welch ein wunderbares Bild dem Autor gelingt, als er diesen Übergang in den Tod zu veranschaulichen sucht, ein Bild, so warm von Leben, so kostbar als lyrische Entdeckung, ein Bild, das nur einer finden kann, der liebt und lebt und dem die Steine blühen:
Umkleiden mit Fleisch
die Skelette. Wiederaufrichten
der Mauern. Atem einblasen
allem Toten und zuschauen
wie es neu lebt
um zu sterben: Unhaltbar
so wie im Schlaf deine Hand
der meinen entgleitet.
Und nun müßte man eigentlich neu ansetzen und ausgreifen und lang, umständlich, detailreich von Berlin reden, Berlin bei Kunert und Kunert in Berlin. Da würde alles wieder heranschießen, völlig neu und gänzlich unverändert: Pompeji, die Trümmerlandschaften und die Untergänge, die gescheiterte Hoffnung (nicht nur von Caspar David Friedrich), Verfolgung und Ermordung in der Geschichte, das hinhuschende Leben in den vergänglichen Häusern und das Reden der ausdauernden Steine, die Kindheit mit ihren hohen Hinterhöfen und das Mannesalter mit Grenzen, Mauern, Todesstreifen – wenn der lyrische Dichter je Geschichtsschreiber sein kann, dann ist er es hier, in Kunerts Berlin-Gedichten. Über alle seine schreibenden Jahrzehnte hin hat er sie gemehrt und nie aufhören können, sie zu mehren.
Ein Ort Ein Name Ein Feuer
das hinter dir herläuft.
Auf diesen verdichteten Laut hat der erfahrene Epigrammatiker einmal die Stadt, und was sie ihm ist, gebracht. Er ist ihr entlaufen, aber nie entkommen. Das hat nicht nur mit Biographie zu tun, viel mehr wohl mit Geschichte. Der Berliner, Sohn einer jüdischen Mutter, der 1933 vier Jahre alt ist und sechzehn, als Berlin verbrennt, zwanzig als die DDR gegründet wird, fünfzig, als er sich aus ihr absetzt, sechzig, als sie ein Ende nimmt, wie soll er, sprachmächtig und aufs Denken versessen, je ein Wort äußern, das nur privat, nicht auch politisch wäre? Was immer er anschaut, kann ihm zum Gedicht werden, aber was immer in seinem Gedicht erscheint, wird allegorisch, bedeutet mehr, als es vorzeigt. Und die zweite Bedeutung meint stets die Geschichte, das verzweifelte Unternehmen der Menschwerdung der Menschen. Vom denkenden Dichter stammend, verlangt Kunerts Gedicht den denkenden Leser und die denkende Leserin. Schön im Spiel der Farben, schön im Gleichmaß der Klänge, will es dennoch nicht nur schön sein, sondern klug, vielleicht auch weise. Was nun wieder an die Raben denken läßt, deren schimmerndes Gefieder, nach übereinstimmender Meinung der Kenner, von ausnehmender Schönheit sein soll.
Peter von Matt, aus Peter von Matt: Die verdächtige Pracht, „Dieser Text ist verschwunden.“, 1998
Die fortwährenden Gleichschaltungsversuche in den fünfziger Jahren
(…) Günter Kunert (*1929) hatte als rassisch Verfolgter eine staatlich verpfuschte Kindheit hinter sich, als er 1947, noch ganz unterm Trauma des Faschismus stehend, dem Ulenspiegel seine ersten satirischen Gedichte anbot. Er hatte sich in Heine, Tucholsky und Ringelnatz hineingelesen und war von Becher begeistert. Er schrieb seine Texte lapidar auf eine Pointe hin und liebte einen ironischen, aggressiven Ton. Von Brecht hatte er die lakonische Sprache des Besserwissers, der Unterweisungen zu erteilen hatte. So legte er – zuweilen bewußt kanzleisprachlich überanstrengt – Widersprüche frei, badete in Paradoxen und verteilte Zensuren. Es sah fast so aus, als machte sich da ein hämelnder Volkserzieher auf den Weg. Sein erster Gedichtband (Wegschilder und Mauerinschriften, 1950) steckte noch voller lakonischer Didaktik:
Als der Mensch
unter den Trümmern
seines
bombardierten Hauses
hervorgezogen wurde,
schüttelte er sich und sagte: Nie wieder.
Jedenfalls nicht gleich1
Und Kunert bekannte sich unumwunden zur Agitation:
Nach dem Krieg und seinen globalen Schrecken schien die Annahme berechtigt, die Menschen hätten eine Lektion erhalten, aus der sie unabweisliche Konsequenzen ziehen würden. Die Ungeheuerlichkeiten des Dritten Reiches oder der erste Atombombenabwurf sollten genügt haben, um den Verzicht auf jede Gewalt selbstverständlich zu machen. Wir glaubten naiverweise, es müsse von nun an sofort alles ganz anders werden…2
1955 leitete er seinen zweiten Gedichtband (Unter diesem Himmel) per Vorwort so ein:
Wegen seiner bekannten Gefährlichkeit wird hier Gefühl nur in geringen Dosen verabreicht…
Und dann standen da Balladen und Lieder im Stile Brechts, und manchmal ging es peinlich banal zu:
Die farbigen Leute ziehn heraus.
Die Fesseln haben sie abgestreift.
Die Saat ist endlich ausgereift.
Die alte Zeit ist aus3
Während aber bei Brecht oftmals die ganze dialektische Erfahrung eines widersprüchlichen Lebens in einem basic-German-Satz steckte, trieb Kunert die aphoristische Komprimierung mit intellektualistischer Wonne oft direkt auf den Agitationspunkt.
Doch schon im Abrechnungsjahr 1956 (unmittelbar nach Stalins Tod) kam er zu erster öffentlicher Besinnung, die noch halbe Rechtfertigung war:
Die Tragik der jungen Schriftsteller oder Dichter ist, daß sie zuviel geglaubt und zu wenig gewußt, zu viel gefühlt und zu wenig gedacht haben. So wurden ihre Gedichte zu Behauptungen, die den Beweis schuldig blieben, weil die Dichter auch keinen hatten.4
In dem Maße, wie sich Kunert von seiner aphoristischen Lakonie freimachte, erlangten seine Texte nun poetischere Substanz. Dabei kultivierte er die Paradoxie weiter, machte sie schließlich zu einer Art schwarzen Magie, ging die Probleme gern von der Kehrseite her an und entblößte sie auf diese Weise ihrer Irrationalität. Seine Texte nannte er daher schwarze Lehrgedichte, etwa seinen „Bericht über ihn“:
1
Wenig bekannt vor allen anderen
ist ein Wesen besonderer Art: Überzogen
mit bläßlicher Haut, kaum behaart und gefüllt mit
Gedärm, Knochen und etwas Gehirn. Aufrecht sein
Gang, doch nicht sein Verhalten.
2
Kurz von Gedächtnis, denn bevor
an seinen Händen das Blut noch getrocknet,
weiß er schon nicht mehr, von wem her es stammt.
5
Voller Schwächen, hat er eine Stärke, die
ihn unüberwindbar macht: Er paßt sich an.
8
Vergangene Götter anzubeten
ist ihm lange Gewohnheit, doch stellt er sich um
auf gegenwärtige, wenn sie Macht haben,
diese so zu mißbrauchen und
ihn dazu.
12
Er selber nennt sich: Mensch.
Selten ist er es. Es zu sein, danach strebt er
manchmal.
Daß er es werde,
treibt ihn an.5
Da war Kunert bereits auf der Höhe seiner Anerkennung. Den apodiktischen Gestus hatte er zum Kult erhoben. Er setzte auf verschliffene Sprache, die er aus sang- und klanglos tingelnden dinglosen Wörtern, aus schwabbelnder Gallerte, die aus öffentlichen Mündern quoll, wieder zu Recht und Sinn führen wollte:
Und hebe sie auf
und nehme sie an mich: Die beste mir
der nichts besseres hat…6
Kunert war viel zu sehr Kyniker (im Sinne P. Sloterdijks7) und Zweifler aus Passion, um der sozialistischen Doktrin länger aufzusitzen. Sein widerborstiger dialektischer Esprit ließ ihn immer wieder wider den Stachel löcken. Er verstand seine Texte schließlich als Beiträge zur Topographie des Menschen, und das meinte doch wohl eine Art politische Zoologie über das zoon politikon Mensch. Kunerts ironische Scharfsicht ließ ihn die politischen Verkehrtheiten und Entgleisungen drastisch erleben: ein kynischer Intellektueller unter den Poeten, der sich stolz einen Ruhestörer, Unruh- und Unfriedenstifter nannte, ein Alternativer und Provokateur, der die ständig per Gebetsmühlen propagierten ewigen Wahrheiten ad absurdum führte, ein intellekueller Aufklärer mit scharfem Biß:
Es kommt der Tod als Zeitungsblatt:
dein Urteil,
hier wird es amtlich dir gemeldet:
ein Krieg ist gegen dich im Gange,
die Heere deiner Freunde marschieren schon,
es werden Ovationen angestiftet,
da drohen Ehren, Orden, Lorbeer…8 (229/10)
M. Reich-Ranicki über jenen Kunert:
Ein Ostberliner Autor ohne Scheuklappen, ein deutscher Lyriker mit Verstand, ein Artist mit Phantasie und Verantwortungsgefühl. Im Osten wird er geachtet und beargwöhnt, im Westen geschätzt und wenig gelesen.9
K. Hager sah es auf dem V. Parteitag der SED anders:
Günter Kunert schrieb eine Reihe von Gedichten, die – kaum noch versteckte – Angriffe gegen unsere Republik enthalten. Seine nihilistische Auffassung vom Menschen, die der unsrigen völlig entgegensteht, durchzieht viele seiner Gedichte.10
Und mit gutem Grund getroffen werden sollten solche herrschaftskritischen Texte wie dieser:
Als unnötigen Luxus
Herzustellen verbot was die Leute
Lampen nennen
König Tharsos von Xantos der
Von Geburt
Blinde.11
Das ihm vom Hitlerfaschismus aufgedrückte Trauma bedrückte Kunert nachhaltig. Es rettete ihn aber vor weiteren Verführungen. Wo andere Hymnen sangen auf die neuen Zuhälter der Macht, sprach er von den Akademien des Irrtums, protestierte er gegen die Lawinen der Gleichgültigkeit, sah er abgeholzte Träume wälderweit, pries er den alleinseligmachenden / Den Widerspruch, rügte er die fortwährende Vergiftung durch Worte, sprach er vom Stolpern von einer in die andere Finsternis. Er wollte die allzu Geruhsamen aufstören. Er setzte auf ätzende Argumente und auf verblüffende Gleichnisse. Doch er vertraute keiner / und keiner Geschichte. Die Geschichte selber ist ein Beispiel / für den mangelhaften Nutzen aller Beispiele, und aus dem Steinbruch der Geschichte / stammen stets die Quader / für neue Kerker.12 Was er zu bieten hatte: Sicherheit / Keine. Der Mensch lebe in bloßer Vergeblichkeit und sei dazu permanent gefährdet. Besonders seine Liebe.
Und für seine Person machte Kunert geltend:
Zur Unterdrückung nicht brauchbar!
Da war sein Traum von einem Kampf um eine bessere Zukunft, für die unzählige Leute in Deutschland sogar ihr Leben hingegeben, längst ausgeträumt, die Vision von einer weltverändernden Revolution war zum Stiefmütterchen geschrumpft:
Zur Neige ist der gute Glaube
an deine Güte: und an dich13
Da war ihm auch die DDR schon nur noch ein Ort unter vielen anderen möglichen und keines Aufhebens mehr wert. Als man W. Biermann aus diesem Staat ausbürgerte, setzte sich Kunert für dessen Wiedereinbürgerung ein. Das war den Ausbürgerern Mitleid vor dem Feind. Kunert wußte nun:
Dein Imperium umfaßt
1470 Quadratmeter
Baraberen klingeln schon am Gartentor:
Hier
bist du nicht mehr sicher. Wechsle
den Glauben und errichte
dein Reich anderswo.14
(273/105)
Er verließ die Partei, und man ließ ihn gerne seiner Wege ziehen. 1979 übersiedelte er nach Norddeutschland. Die DDR hatte einen Kanaken weniger – so wurden damals von Funktionären jene Spinner genannt, die es wagten ihr System zu kritisieren. Den DDR-Lesern aber fehlte er fortan.
Doch seine Poesie – nun jenseits der Mauer geschrieben – zeigte: seine fatalen Erfahrungen hatte er in der DDR gemacht. Hier hatte er einst naiverweise den guten Glauben an die Revolution eine Weile lang mitgeträumt. Nach seiner kopernikanischen Wende aber dann der endgültige Abschied von den falschen Hoffnungen auf irgendein Heil
Am Ende sind die Taschen leer
wie am Anfang. Und
über das Fensterbrett zieht
das apokalyptische Heer der Ameisen schon.
Die nächsten Herren der Erde marschieren
in gleicher Gedächtnislosigkeit
auf deinen Spuren voran.15
(274/116)
Ausgesetzte Fehlgeburt / verwaist von Grund auf. Der Kopfsprung in die Ratlosigkeit, in die als existentiell erkannte Not. Die Texte wurden immer dichter. Die Melancholien eines Lenau und eines Bruder Kleist prägten zunehmend die geschichtsphilosophischen Reflexionen und befrachteten den bitter-elegischen Gestus. Harte Zeilenbrüche frakturierten die Aussagen, invertierten den Gedankenfluß. Irgendwo doch noch einmal die Vokabel Zweieinigkeit, aber sie wurde längst übertönt von Todes- und Sterbe-Signalements:
Ein Kreis von Federn gibt zu wissen
hier bei den Bäumen sei es dann geschehen:
Als Beute eingefangen und dann zerrissen
was du vordem als Flug gesehen…
Was so geendet das verdient Bedauern
weil es auf eine Weise doch betrogen:
Du ahnst auch über dir das Lauern
von Schatten – eh du selbst verflogen.16
Die letzte Erkenntnis: Unheil. Das Gedicht, das nur noch eine Leerstelle umkreist. Vom schwarzen Lehrgedicht zum Leergedicht – die Erfahrungen eines, der dieses Jahrhundert erlebt hat und in ihm zum Dichter geworden ist.
(…)
Edwin Kratschmer: Dichter · Diener · Dissidenten. Sündenfall der DDR-Lyrik, Universitätsverlag – Druckhaus Mayer GmbH Jena, 1995
Melancholischer Kalkül
– Zu den Gedichten Günter Kunerts. –
In dem 1964 veröffentlichten Prosa-Text „Donnerstag, zehnter April“ von Günter Kunert heißt es über die Sprache:
(…): ein Gerät nämlich, die Worte im Munde herumzudrehen; einen Stumpfstein, Beckmesser zu entschärfen; eine Maschine, Todesröcheln in Sonette zu übersetzen; ein Elektronengehirn, das an das gleiche denkt wie alle Leute, also an sich und an nichts sonst, zum Schluß eine kleine Wahrheit, perforiert, selbsthaftend, rosafarben und über die Wunden zu kleben, die so schwer heilen.17
Das ein Jahr später entstandene Gedicht „Meine Sprache“ lautet:
1
Ich spreche im Slang aller Tage derer
Noch nicht Abend ist
In der verachteten und verbissenen der
Sprache die jedermann entspricht.
2
Diese
Von Erstellern entstellte die von Betreuern
Veruntreute von Durchführern früh schon
Verführte die
Mehr zur Lüge taugt denn zur Wahrheit
Ach welche
Unter der erstarrten Syntax sich regt
Wie unter Abfall wie unter Schutt wie
Unter Tonnen von Schlacke.
3
Sprache
Die mehr scheinen will als sein
Aufgebläht
Von sang- und klanglosen tingelnden
Dinglosen Dingwörtern;
Schwabbelnde Gallerte
Quillt sie aus den öffentlichen Mündern
Und Mündungen tropft von
Den Lippen der Liebenden
Trieft aus Radios
Triumphiert.
4
Nichtssagend und blutleer und kraftlos
Ein Kind des Landes finde ich sie
Darniederliegend.
5
Und hebe sie auf
Und nehme sie an mich: Die beste mir
Der nichts besseres hat
Und ein Vermögen dem der durch nichts sonst
Zu leben vermag
Als durch sie.18
Eine vor diesen beiden Texten liegende, frühere Formulierung aus dem Gedicht „Vom Vergehen“, noch ein wenig programmatischer gesetzt, besagt:
(…) Worte
Setzte ich aneinander, so daß sie
Mehr wurden als Worte und
Einen Sinn ergaben und den:
Es ist möglich,
Die Erde bewohnbar zu machen für
Menschen.19
Abgesehen von der Reflexion auf die Sprache und das Gedicht, auf die dichterische Sprache und die Konkretisierung und Thematisierung ihrer Funktion vor allem im dritten, hier zitierten Beispiel, verdeutlichen alle drei Belege die Variationskala der lyrischen Verfahrensweise Kunerts: zusammengesehen ergeben sie so etwas wie die ,ars poetica‘ des 1929 in Berlin geborenen und heute in (Ost-)Berlin lebenden Lyrikers,20 eine Poetik freilich und ein Programm, die sich unausgesetzt in der Aufhebung ihrer selbst ins Gedicht bringen, „inschriftlich“, wie es bei Kunert heißt,21 im Bewußtsein des „Alleinseligmachenden“: des „Widerspruchs“,22 auch und gerade als Wider-Spruch der Sprache, der Wörter selbst aufgefaßt: Sprache, „die mehr zur Lüge taugt denn zur Wahrheit“, Nietzsches Wort „aber die Dichter lügen zuviel“ rekapitulierend. Sprache als Reflexion auf ihre Wortwörtlichkeit, ihr Wort-Sein bestimmt, in spielerisch-präziser Frontstellung zum angewachsenen Bedeutungsballast, zum schönen Schein und einer gefügigen Verwendbarkeit: in der Reduktion auf das Wort legt das Sprechen die Variabilität seiner Bedeutungen und ihrer Anwendungsmöglichkeiten gleichsam spielerisch frei. Wie sorgsam Kunert diese Situation differenziert und ironisierend transparent macht, zeigt der Einsatz des zitierten Gedichtes „Meine Sprache“:
Ich spreche im Slang aller Tage derer
Noch nicht Abend ist
In der verachteten und verbissenen der
Sprache die jedermann entspricht.
Die Ausgangsversicherung „Sprechen im Slang aller Tage“, hintergründig abgehoben von der sich einstellenden Evokation ,Slang‘ (,der Straße‘), ihre Überführung und Placierung in die eben erst erreichte Spruchhaftigkeit („Noch ist nicht aller Tage Abend“), setzt sich ab im Schlußvers in die „Sprache die jedermann entspricht“: die ausgangs intendierte Formel „Sprache, die jedermann spricht“, Alltagssprache, wird gekennzeichnet als eine Sprache, die dem Alltagsgebrauch ent-spricht, also bereits Modell-Funktion hat, als organisierte, von ihrer Struktur her formulierte Sprache verstanden wird. Der im zweiten Abschnitt des Gedichtes gesetzte Versblock verdeutlicht den Befund: aus dem Wort wird eine Variation abgeleitet, die seine generelle Verfügbarkeit, damit den potentiellen Mißbrauch unter Vorgabe des ,Scheins‘ von Wörtlichkeit, thematisch macht:
Diese
Von Erstellern entstellte die von Betreuern
Veruntreute von Durchführern früh schon
Verführte
Die gesteuerte Ableitung – aus „Ersteller“ wird „entstellt“, „Betreuer“ zu „veruntreut“ entwickelt, „Durchführer“ über „früh“ zu „verführte“ gebracht –, die im Rahmen der unmittelbaren Wort-Nachbarschaft, gleichsam „inschriftlich“, vollzogen wird: „Worte / setze ich aneinander, so daß sie / mehr wurden als Worte und / einen Sinn gaben“, dieses Verfahren wird intensiviert, rhythmisch dynamisiert durch die Verwendung eines aus der Rhetorik stammenden, in der Barock-Lyrik häufig genutzten Stilmittels, des Trikolons: hier zwei ineinander gefügte und auseinander entwickelte Trikola, die die Modellhaftigkeit des Sprechens, die „Ent-Sprechung“ deutlich zu erkennen geben. Die Verwendung dieses Stilmusters ist ein bei Kunert unverhältnismäßig oft zu beobachtender Vorgang:
In den Träumen
Der noch Niedergedrückten und in den
Gedanken der bereits Aufrührerischen, wie
In den Taten
Der sich schon Erhebenden?23
Der von der rhetorischen Figur gesetzte Rhythmus deckt sich genau mit der im Dreitakt entwickelten, fast teleologisch vorangetriebenen Logik des Gedankens:
Träume – noch Niedergedrückte
Gedanken – bereits Aufrührerische
Taten – schon Erhebende
Eine Sprachbewegung, die sich in der die Parallelität betonenden, die Zeit- und Geschichtsdimension gleichsam auf die Sprechzeit reduzierenden rhetorischen Figur vollzieht. Diese Verkürzung im Modus der Addition, der Stauung eröffnet dem Gedicht die Wendung in die absolut, oft apodiktisch gesetzte (Schluß-)Sequenz, die häufig als Sentenz, bestätigend beziehungsweise kontrapunktisch erscheint:
Auf der Schwelle des Hauses
In den Dünen sitzen. Nichts sehen
Als Sonne. Nichts fühlen als
Wärme. Nichts hören
Als Brandung. Zwischen zwei
Herzschlägen glauben: Nun
Ist Friedens.24
Oder:
Leichter mal mal schwerer mal unerträglich:
Die währende Bürde.25
Der Tod der Tod der Tod:
Dreimal gesagt und es gilt nichts.26
Das solcherart aufgehobene Sprechen, die Auskunft, daß das Gesagte, zumal in der insistierenden Wiederholung, „nichts gilt“, belegt Kunert deutlich da, wo der Boden (scheinbar) gesichert ist: wo er präzise technische Daten ins Gedicht bringt, die in der dialektisch gegengesetzten Kommentierung ihre Verläßlichkeit einbüßen oder durch Aussparen eines Details als Fixierung geradezu ungreifbar werden: so beginnt das Gedicht „Wie ich ein Fisch wurde“ mit den Versen:
Am 27. Mai um drei Uhr hoben sich aus ihren Betten
Die Flüsse der Erde, und sie breiteten sich aus27
Das Weglassen der Jahresangabe relativiert den präzis angeführten Zeit-Ansatz aus der Position der Gewißheit, der „Faktenwahrheit“ – so der Titel eines anderen Gedichts – in die Position des jederzeit noch Möglichen; das auch trotz des Erzählcharakters der Verse, trotz der Vergangenheitsform. Das Gedicht „Hinab zu den Fischen“ setzt ein mit einer additiven Reihung technischer Daten:
Im Kontobuch der White-Star-Linie stand
Eingetragen das Schiff Titanic:
32 Millionen Dollar Kosten.
18 Kessel für den Dampf.
800 Tonnen Kohle täglich.
50 000 PS, die es trieben.
3000 Passagiere zur Beförderung
Von Southampton nach der Stadt New York.
Stand alles eingetragen.
Der nächste Verseinsatz bringt dann die ,Auflösung‘ der Daten, vorbereitet schon durch die lakonische Mitteilung im letzten Vers: „stand alles eingetragen“:
Bis Nebel sank. Bis Nacht aufkam und
Aufkam Eis, (…)28
Das Verfahren, durch Stauung und serielle Häufung die Schlußpointierung, die deiktische Geste der angehängten Moral hervorzuheben, erfolgt zuweilen innerhalb der rhetorischen Figur selbst, die nicht selten anaphorisch bzw. epiphorisch gesetzt ist. Zäsur und Text-Absetzung verdeutlichen diese Intention:
(…)
Ein großes Schauspiel: Bestaunt
Beklatscht und
Angstvoll angesehen.29
Oder:
7
(…)
Der (…)
Wie ekelhafter Aussatz ist und lauscht. Und
Lauscht.
8
Und lauscht.30
In diesem Zusammenhang ist auf eine weitere, häufiger zu beobachtende Stileigentümlichkeit Kunerts hinzuweisen: die Verzögerung des Aussage-Objekts und das Auseinanderbrechen kompositer Verben, deren ,Zwischenraum‘ additiv gefüllt wird:
Aber tausendmal vernommen stumpft es
Da drinnen das gefangene
Da hinter dem Rippengitter das
Vielnamige Ding ab31
In dem Gedicht „Notizen in Kreide“ heißt es:
(…) Ewiges Provisorium:
Ich.32
Oder:
in der „Legende von zwei Silben“:
(…) Anker senken
In ihre Ozeane alle Schiffe. Fernspruchmaschinen
Und Koffer für Musikempfängnis
Stoßen aus
Nicht mehr als dürres Knistern.33
Kunerts Tendenz, die Modellhaftigkeit der Sprache, die „Ent-Sprechung“ durch bewußte Nutzung des Modells, der ,Ent-Sprechungen‘ lyrisch-reflexiv zu vergegenwärtigen entspricht jener Position, die das lyrische Ich – wenn es überhaupt sichtbar wird – einnimmt: die Distanz. „Ich schreibe entprivatisiert“ heißt es in einem Brief.34 Die Hinweise in seinen Gedichten sind erkennbar gesetzt:
Wenn (…)
Das Licht stirbt und schwarze Skelette
Zeitweilig „Baum“ genannt
Den Himmel tragen35
Daß ich und sie und sie und ich
In eines fremden Hauses stummer Nacht
Betrieben was der Liebe glich.36
Die direkte Benennung ist fragwürdig, trägt nur eine Zeit lang, ist austauschbar: „zeitweilig“ gültig. Benennung in der Abweichung, in der Akkumulation und seriellen Gestik tritt an ihre Stelle:
Die Klingel gellt. Das Telefon. Die Wohnungstür.
Das Haustor. Die Hinrichtung. Die ganze Welt.
Sie bimmelt rasend schrillt und schreit
Und gellt – und stirbt37
Neben die Benennung tritt unmittelbar die Frage nach ihrem Wirklichkeitsgrad:
Von der Decke sinkt an einem Faden
(Wer weiß denn an was für einem)
Eine Spinne (wer weiß schon welcher Art)38
Auch der Erzählduktus vieler Kunertscher Gedichte, ausgeprägt durch den häufigen Gebrauch epischer Konjunktionen: – und, als, nachdem – und die Wiederaufnahme balladesker, chronik- und legendenhafter Momente, wird in diese Dialektik einbezogen, anschaulich gemacht etwa in dem Gedicht: „Film – verkehrt eingespannt“. Die epische Konjunktion „als“, die das Gedicht eröffnet, löst gleichsam einen Rücklaufmechanismus aus, der seine raffiniert gesetzte Pointierung im letzten Wort des letzten Verses des Gedichts findet: „rückwärts“:
Als ich erwachte
Erwachte ich im atemlosen Schwarz
Der Kiste. Ich hörte: Die Erde tat sich
Auf zu meinen Häupten. Erdschollen
Flogen flatternd zur Schaufel zurück.
Die teure Schachtel mit mir dem teuren
Verblichenen stieg schnell empor.
Der Deckel klappte hoch und ich
Erhob mich und fühlte gleich: Drei
Geschosse fuhren aus meiner Brust
In die Gewehre der Soldaten die
Abmarschierten schnappend
Aus der Luft ein Lied
Im ruhig festen Tritt
Rückwärts.39
Eigentlich sind alle Gedichte, ich meine realistische Gedichte, Lehrgedichte. – Lehrgedichte heute müßten schwarze Lehrgedichte sein, die mit schlechtem Beispiel vorangehen, das Negative (was ist das?) als Ziel zeigen – auf eine Art aber, die aus dieser ,Lehre‘ eine Gegenlehre ziehen läßt. Kurzer Sinn dieser Umständlichkeit: Alles direkte Vermitteln ist unmöglich geworden. Das klassische Lehrgedicht, wie es noch Brecht gemacht hat, immerhin schon mit einem Augenzwinkern, ist heute unmöglich.40
Kunerts Hinweis auf Brecht kommt nicht von ungefähr. Gerade seine frühen Gedichte, vor allem die des ersten, in der DDR erschienenen Bandes Wegschilder und Mauerinschriften,41 belegen diese Affinität zum Gedicht Brechts sehr deutlich. Aber, abgesehen von dieser auch nie verleugneten Herkunft,42
Zwei nur und kurz und enden die Epoche in der
Das tägliche Gespräch über alltägliche Verbrechen
Schweigen über Bäume häuft.
Vgl. auch den kurzen Prosa-Text „Erinnerung an Bertolt B.“ in: Tagträume, S. 67 wichtiger erscheint Kunerts Entwicklung des Brechtschen Ansatzes in Richtung auf das „schwarze“ Lehrgedicht und seine Definition als realistische Lyrik:
Ich rede von der realistischen Lyrik. Und damit meine ich nicht diese, in der es so zugeht, wie auf einem Foto oder wie in der sichtbaren Realität; realistische Lyrik ist für mich eine, deren Spannungsmoment oder Grundmotiv oder Absicht oder Erkenntnis in der Wirklichkeit, in unserer gegenwärtigen Wirklichkeit liegt. Der Realismus liegt im Gleichnis, in der Gesamtmetapher, im Gestus – nicht unbedingt in dem, was da auf dem Papier steht.43
– Diese Definition entspricht genau jenem „Ent-Sprechungscharakter“ der Sprache, der modellhaft-distanzierten Formulierung der Sprache als Sprach-Modell, der Formulierung des Bezuges zwischen Sprache, Wort und Wirklichkeit als Gleichnis, als „Gesamt“-Metapher und der Angabe dieses Bezugs als dialektisch strukturiert. Nur der indirekte Zugriff beziehungsweise Rückgriff auf Hauptworte wie Mensch, Geschichte, Zeit, Ewigkeit, Liebe oder Wirklichkeit ermöglicht ihre Präsenz im Gedicht:
Auf unzeitgemäß verfertigtem Papier
Schreibe ich
Eine kleine fossile Wahrheit
In der Schrift
Welche vor den täglichen Weltuntergängen
Verständlich war.44
Das Schreiben der Wahrheit, seit Brecht als „Schwierigkeit“ ausgiebig thematisiert und beschrieben, erfolgt bei Kunert, indirekt, verdeckt, „schwarz“: unter Verzicht auf die direkte, gleichsam mit erhobenem Zeigefinger vorgenommene Ausschreibung der (moralischen, politischen) Konsequenz, die eine dialektische Gegenüberstellung nahelegt. Das Schreiben der Wahrheit geschieht in der Reduktion auf die Formulierung des Gegen-Über:
Betrübt höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.Aufatmend
Höre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.45
Das Gedicht „Gesetze“, den Kantischen Imperativ abwandelnd-abhandelnd, lautet:
Erstes der wilde Himmel
In uns
Mit Gestirnen denen wir folgen.über unseren Schädeln
Wo immer man sie einschlägt
Als sanftes das zweite:
Sinnvoll vergehen.46
Einen vollkommenen Beleg für das „schwarze Lehrgedicht“, für ein internes, verdecktes Sprechen, das in der Verdeckung erst als Gleichnis und als dieses übertragbar auf bestimmte Realitäten erscheint, stellt das folgende Gedicht dar:
Als unnötigen Luxus
Herzustellen verbot was die Leute
Lampen nennen
König Tharsos von Xantos der
Von Geburt
Blinde.47
Die verdeckte Aussage-Relation, die Möglichkeit, das in der Metapher Gesagte in eine bestimmte Realität zu transportieren, deckt sich mit dem Verfahren der Verzögerung des Aussage-Objekts bis an den Schluß des Gedichts: beschrieben ist die Möglichkeit des Transports, der Übertragung, nicht die Realität selbst; beschrieben ist die „Ent-Sprechung“: der „Realismus liegt im Gleichnis, im Gestus – nicht unbedingt in dem, was da auf dem Papier steht“.
In der „Legende von zwei Silben“ heißt es:
Zu Tisch: Zwei Silben.
Als Trank: Die zwei. Als Gute Nacht
Als beßrer Morgen: Sie
Die ein Wort ausmachen das von selber
Gar nichts macht.48
Das Gespannt-Sein des Kunertschen Gedichts in die ,Ent-Sprechung‘ von „Faktenwahrheit“ und Wortwahrheit, von Realität und Gleichnis, von Gedicht und Gegen-Gedicht, „gestempelt / Mit dem verachteten veralteten verlogenen / Abwaschbaren Wort Mensch“ erfüllt die Formel, der seine Gedichte zwischen Melancholie und Kalkül sich immer wieder aussetzen: melancholischer Kalkül.
Gregor Laschen, aus Gregor Laschen: Lyrik in der DDR. Anmerkungen zur Sprachverfassung des modernen Gedichts, Athäneum Verlag, 1971
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Thomas Combrink: Sich den Bewegungen der eigenen Hand überlassen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.2025
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993 – Lesung: Günter Kunert. Moderation: Hajo Steinert. Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb + DAS&D + Archiv + Internet Archive + IZA + Kalliope + Bibliographie
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: AA ✝ FAZ ✝ FR ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝ NDR 1 + 2 ✝ NZZ ✝ Sinn und Form ✝ SZ 1 + 2 ✝ Tagesspiegel ✝ Welt ✝ Die Zeit 1 + 2 ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


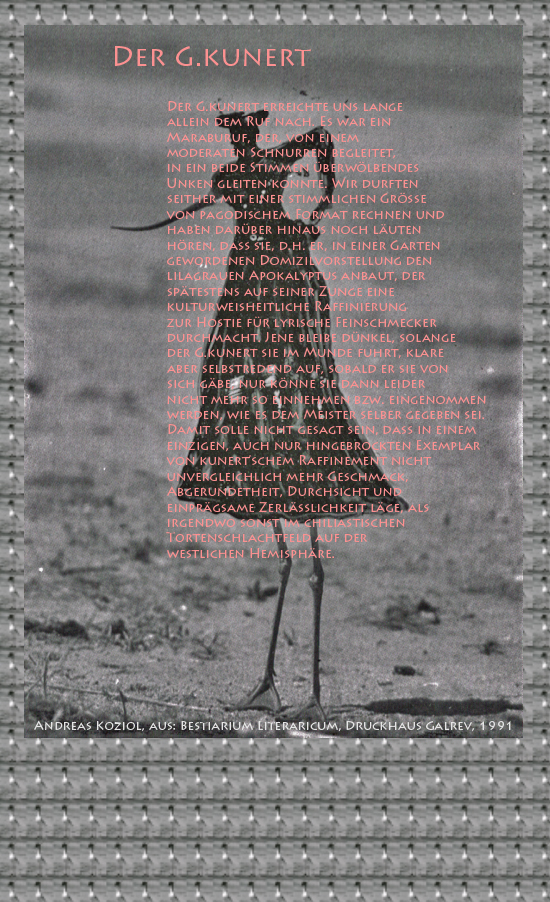
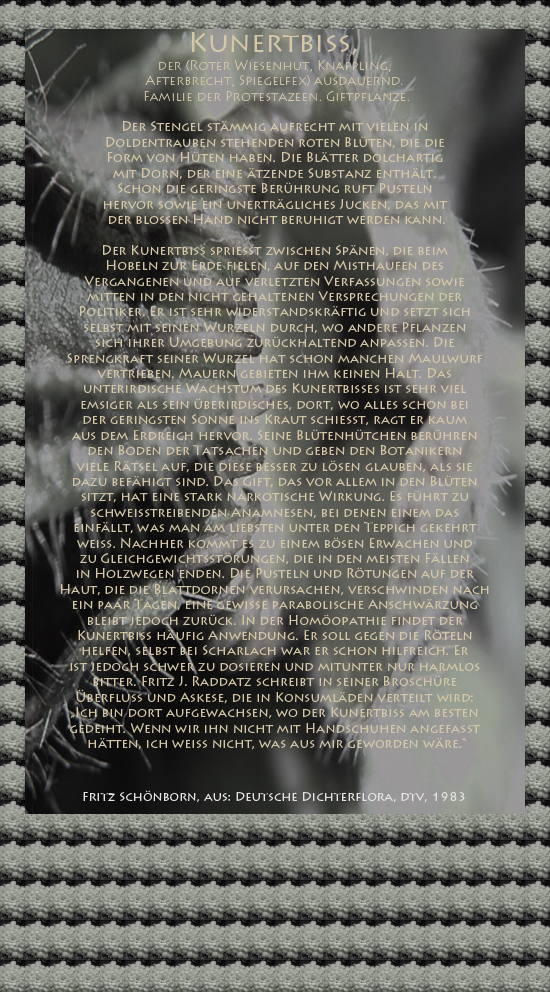
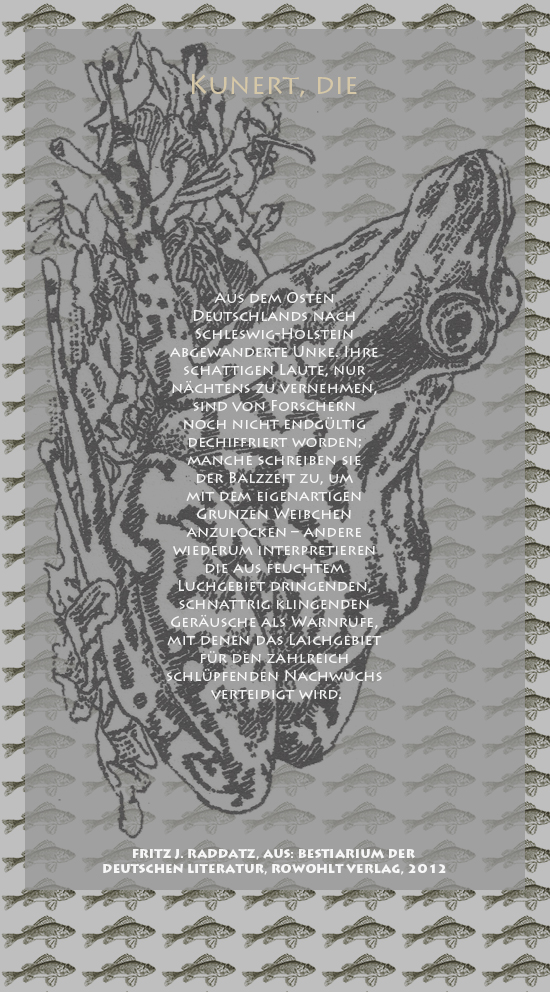
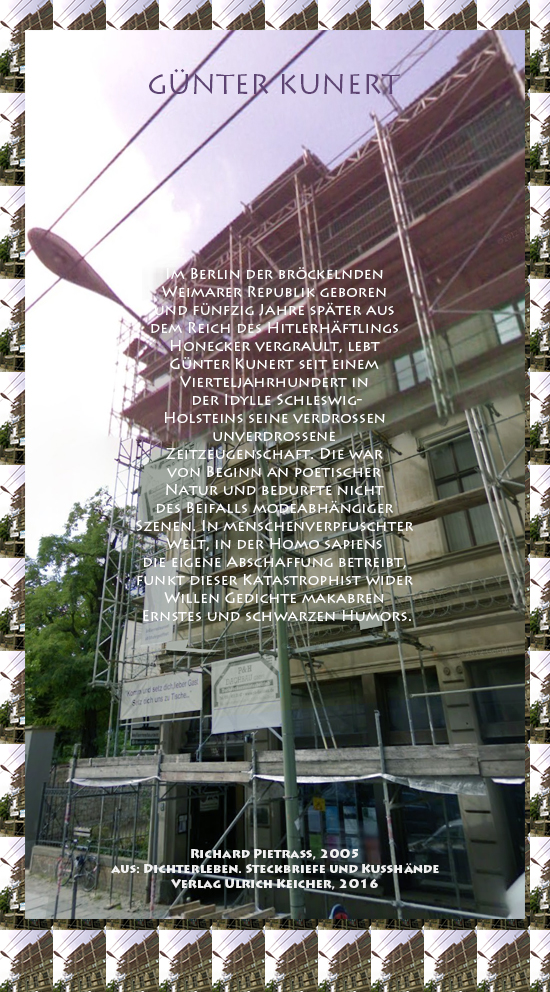












0 Kommentare