PEPPINO PORTIERE
Er erfand Blätter, die er
Mit einem Strohbesen vom Kies-
Weg fegte.
Er hatte eine Mütze.
Er hatte eine Tasche.
Er hatte ein Fahrrad.
Gegen Mittag bestellte er
Die Sonne, damit er
Im Schatten sitzen konnte.
Er gab Ratschläge.
Er sprach mit seinen Hühnern.
Er telefonierte in alle Welt.
Um Alter und Weisheit wett-
Eiferte er mit einem
Eukalyptusbaum.
![]()
Poetisches Paradox
Auf seinen Büchern steht Rolf Haufs, was sonst, aber irgendwer, vielleicht ich selber, hat irgendwann den klingenden Namen Malte ins Spiel gebracht, weiß der Himmel warum. Der Name ist an ihm haften geblieben, und bald wurden die Gespräche über seine Gedichte, über Gedichte überhaupt, über Bücher, Literatur und verwandte Künste fast ausschließlich mit Malte geführt. Malte ist ein eloquenter Gesprächspartner, der sich in der deutschsprachigen wie der internationalen Lyrik auskennt wie nur wenige. Obwohl die beiden sich zum Verwechseln ähnlich sehen, habe ich doch den Eindruck, daß Malte meist um einige Jota freier denkt, sich unbefangener, sozusagen freihändiger äußert, eher mal eine argumentative Pirouette riskiert oder einen logischen Mäander, daß er neugieriger auf ungesichertes Denkterrain losgeht als Haufs. Der gibt prinzipienfest keine Interviews, meint, daß der Autor zu verschwinden habe hinter seinem Werk, für die Leser vollkommen uninteressant sei mit seinen Meinungen und Ansichten auch noch über das eigene Werk. Was er zu sagen habe, stehe in seinen Gedichten, jeder Selbstkommentar müsse unterbleiben, zu schnell werde man auf etwas festgelegt, moniert er, was man so nicht gemeint, in der Suchbewegung beim Bedenken einer Antwort dann vielleicht ungeschickt oder zu schnell formuliert habe, nein, keine Interviews bitte.
Malte hingegen läßt mit sich reden, er kann Haufs’ Interviewabneigung verstehen, ohne sie mit diesem zu teilen, und war bald einverstanden, über Haufs und seine Gedichte zu sprechen, mit beschränkter Haftung freilich, denn hie und da, sagte Malte, könne es durchaus sein, daß Haufs und er verschiedener Meinung seien, oder jedenfalls nicht genau der selben.
Wie auch immer, habe ich gedacht, ist mir sehr recht, wenn der Malte Auskunft gibt, nächteweis hab ich’s mit ihm über Gedichte gehabt, über Haufs-Gedichte, über die Gedichtbände, die ich in den dreizehn Jahren als Hanser-Lektor betreut habe, Felderland (1986), Selbst Bild (Prosagedichte, 1988), Allerweltsfieber (1990) und Vorabend (1994) sowie die zwei Lyrikjahrbücher, die Haufs mit mir herausgegeben hat (1980, claassen Verlag, Düsseldorf, und 1989, Luchterhand Verlag, Neuwied). Und immer wieder über Sprache, Poetik, rettbare und unrettbare Gedichte.
Diesmal haben wir uns auf einen Nachmittag verabredet, um aus Anlaß der Aufgehobenen Briefe, einer handverlesenen Auswahl aus publizierten und neuen Gedichten, über ein paar wesentliche Fragen zu sprechen, Fragen des Handwerks, der Machart und Ästhetik der Gedichte. Das Gespräch fand am 15. April 2001 an einem vollkommen unpoetischen Ort statt, in einer unstillen Ecke einer lauten Kneipe in der Berliner Meinekestraße. Ich habe es nachstehend anhand meiner Stichworte sinngemäß wiedergegeben, das mitlaufende Tonband hat vor allem die nicht abzustellende Soundtapete aufgezeichnet, das heißt, statt unsres Gesprächs vor allem die in der Kneipe abgespielte Plastikmusik.
In Haufs’ Werk, sage ich zu Malte in die Soundtapete hinein, fällt zuallererst dreierlei auf: Die Gedichte sind auf diskrete und hintersinnige Weise autobiographisch, enthalten zweitens eine Unmenge zeithistorischer Details, als wollten sie auch noch die Gerüche einer Epoche aufs Papier bringen, und versammeln drittens zahllose Schnipsel, Piksel, Fragmente zu einem Landschaftsporträt vom Niederrhein. Mit welchem literarischen Techniken transportiert, transponiert, transzendiert Haufs nun seine privaten und subjektiven Erfahrungen, die, wie er findet, niemanden etwas angehen, in etwas Allgemeines, „Überpersönliches“ – wie werden die zu Erfahrungen der condition humaine?
Techniken, sagt Malte, sind ihm per se fremd. Er habe, meine der Haufs, nur das Wissen, oder eine Ahnung davon, was ein Gedicht idealiter sein könnte. Das Autobiographische, das Biographische, die pure Beschreibung von Geschichte oder Landschaft, das sei alles nicht sonderlich interessant in einem Gedicht, und vor allem brauche es dazu kein Gedicht.
Im Gedicht, sagt Malte, muß etwas zum Ausdruck kommen, das andere Formen der sprachlichen Fixierung nicht auf der Palette ihrer Möglichkeiten haben. Schwer, begrifflich zu benennen, was das eigentlich genau ist. Haufs behilft sich gern mit der „Sichtbarmachung einer anderen Ebene“, mit „etwas, das dazukommen muß, damit man überhaupt von einem Gedicht sprechen kann“. Natürlich kennt er die literarischen Techniken und rhetorischen Figuren von der Alliteration bis zum Enjambement und von der Antonomasie bis zum Zeugma ganz genau, aber all das hat für ihn mit dem Wichtigsten wenig zu tun: mit der Sprache und dem Bewußtsein, daß es hinter den sichtbaren Dingen auch noch etwas anderes gibt, etwas Unsichtbares, oder wie auch immer man es nennen mag, das via Assoziation, Rhythmus, Reim, Zeilenbruch sichtbar, spürbar, anwesend wird im Gedicht, obwohl es de facto nicht explizit da steht, auf dem Papier. „Metaphysisch“ oder „transzendental“, das wäre, sagt Malte, dem Haufs sicher zu hochgestochen, zu esoterisch kontaminiert, aber etwas davon, sagt nun Malte, müßte seiner Meinung nach in jeder Zeile zu spüren sein. Etwas, das in den Wörtern, in den Begriffen nicht aufgehoben oder nur partiell enthalten ist und nur mit den ganz spezifischen Möglichkeiten des Gedichts überhaupt zur Sprache zu bringen ist. (Wenn das in der Form eines Essays oder einer Predigt besser zu bewerkstelligen ist, sind der Essay oder die Predigt die angemessenen Genres.)
Haufs, sagt Malte, gehört nicht zu denen, die pro Tag fünf Gedichte aufs Papier sudeln (das haben auch routinierte Titanen wie Goethe nicht hingekriegt). Die Gedichte entstehen sehr langsam, bleiben oft wochenlang als Rohling liegen, durchlaufen viele Stadien der Verdichtung und Verknappung. Am Anfang gibt es manchmal nicht mehr als den Klang eines Wortes, einer Redewendung, ein Sprachbild, und darum herum „wächst“ etwas, setzt andere Wörter an, schlägt andere Richtungen ein als gedacht oder erhofft, das Gedicht „weiß“ sozusagen noch gar nicht, wo es hinwill. Manchmal gibt es hinreißende Zeilen und Wendungen, und darum herum leeres Stroh, dem sich Haufs aber schnell mit einem Streichholz in der Hand nähert, es schon auf den zweiten Blick als solches erkennt. Anders als in seinen lyrischen Anfängen, sagt Malte und tut, als sei er der Dichter persönlich, geht Haufs heute eher von Sprache und Sprachklang aus als von einem Inhalt. Wenn einem der Inhalt unabhängig von seiner Form von Anfang an als Botschaft, Mitteilung oder Meinung formulierbar ist, sagt Malte – und da wird ihm der Haufs, wie ich ihn kenne, sofort recht geben –, dann brauchts kein Gedicht, sondern eine Aktennotiz oder einen Leitartikel oder einen Leserbrief.
Den Haufs Rolf übrigens interessiere heute mehr denn je die Sprache selbst, die Sprache mit all ihren historischen Ablagerungen, Nebenbedeutungen, Echo- und Assoziationsräumen, Un- und Schreckenswörtern. Wenn man erst einmal angefangen habe, sich mit diesem Material als Material auseinanderzusetzen, sei man lebenslang beschäftigt, zitiert der Malte den Haufs, und alle sprachliche Unbefangenheit sehe plötzlich aus wie eine strunzdumme Naivität.
In den Gedichten, sage ich zum Malte, der uns schnell zwei Bardolino riserva bestellt, spielt die Geschichte, spielen datierbare Ereignisse aber nun eine unübersehbare Rolle, wie sich das denn nun mit der Materialidee, mit dem Ausgehen von einem Wortklang, den gerade erwähnten lautlichen Ereignissen vertrage?
Ich glaube, sagte Malte überraschend schnell, daß die Geschichte per se den Haufs immer nur vordergründig interessiert hat. Aber da sie nun mal „parallel“ zum Leben, zur Biographie mitläuft, kann man sie nicht ausklammern, ohne im Esoterischen oder Belanglosen zu landen, Biographie hat immer auch mit Geschichte zu tun, in ihr bekommt sie ihre spezifische Einfärbung. Haufs hat nie historische Gedichte im traditionellen Sinne geschrieben, keine Balladen über Barbarossa, Fritz Walter oder den Golfkrieg. Trotzdem sind sie im Zusammenhang mit seiner konkreten Biographie historisch. Kindheit, Krieg, Nazis und Kriegsgewinnler, die Auseinandersetzungen mit dem Vater, der Niederrhein (Haufs kommt aus Düsseldorf), das geteilte Berlin, die 68er-Ideale, die 80er und 90er Jahre sind spürbar anwesend.
Wenn man das Œuvre chronologisch Revue passieren läßt (was der vorliegende Band ganz bewußt nicht tut und statt dessen thematische Kapitel vorzieht, weil so Ästhetik, Sprachvermögen und Denkbewegungen der Gedichte in ihrer Vielschichtigkeit viel erhellender sichtbar werden), fällt freilich eine fast kontinuierliche Verlagerung oder Akzentverschiebung auf. In den frühen Gedichten ist die Zeitgenossenschaft deutlicher angesprochen, dort verhält sich ein Individuum zur Gesellschaft als dem Zentrum. In späteren Gedichten dann ist es eher umgekehrt, da ist das wahrnehmende Individuum das Zentrum, die Zeitgeschichte drischt von allen Seiten auf es ein und es muß darauf reagieren, ob es will oder nicht, und dieses „Verhältnis“ ist natürlich voller Enttäuschungen, Verletzungen und Widersprüche.
In jungen Jahren, sagt Malte, sind wir expliziter, gehen auf die Zeitgenossenschaft zu, suchen sie, um sie zu erfahren, zu riechen, zu schmecken, vielleicht sogar, um etwas zu gestalten, zu verändern. Doch das tritt mit den Jahren deutlich in den Hintergrund, das Individuum erscheint mehr und mehr auf sich selbst zurückgeworfen und muß sehen, wie es mit dem zurechtkommt, was da auf es eindrischt, Zeitgenossenschaft hin oder her. Und es sind später andere Erfahrungen, Einsichten, Gefühle, die sich in den Vordergrund schieben: die Endlichkeit des Lebens, die Erfahrungen mit Krankheit und Tod, Verlust, Angst – das sind auf einmal ganz tiefgreifende innere Geschehnisse, die man in jüngeren Jahren nicht sieht oder nicht sehen will, weil anderes wichtiger ist. Diese Veränderung drückt sich zwangsläufig auch in Gedichten aus. Wenn sie was taugen.
Wobei mir, sagt Malte in den anschwellenden Lärm der Feierabendtrinker hinein, das sogenannte Haufs’sche Paradox besonders gefällt. Es besagt, sagt Malte und freut sich, ungefähr folgendes: Du kannst, meint Haufs, in deinem Leben so viele Erfahrungen machen wie du willst, letzten Endes weißt du gar nichts, nothing, null, nada, du strampelst wie ein Käfer im Marmeladeneimer und versuchst irgendwie nochmal hochzukommen, um nachzusehen, was da eigentlich los ist, aber je mehr du strampelst, desto tiefer kommst du in die Marmelade. Dieses Paradox ist so alt wie die Spezies Mensch, und vielleicht muß es deswegen immer wieder neu beschrieben werden. Auch die Dichtung in 500 und 1500 Jahren wird sich damit noch beschäftigen. Es ist wahrscheinlich der Antrieb für alle Kunst. Jede Generation, und das über die Jahrhunderte hinweg, steht immer wieder vor den gleichen Fragen und Problemen und versucht sie zu lösen, obwohl sie letztendlich nicht zu lösen sind.
Alexander Kluge, sage ich zu Malte, würde in diesem Zusammenhang wohl von Orientierung sprechen: das Kunstwerk als Orientierung, als Wegmarke, als Leuchtfeuer an der Küste. Malte nickt. Haufs? Hätte sicher auch genickt und sofort hinzugefügt, daß das jedoch nichts mit Lebenshilfe zu tun habe, sondern vor allem mit Erkenntnis. Und die sei der Lebenshilfe ja wohl nicht eben förderlich, da sie auf unser Wohlbefinden grundsätzlich keine Rücksicht nehme. Orientierung, sagt Malte in meine Abschweifung hinein, verdankt sich bei Haufs vor allem einem Erfahrungs- und Erkenntniszuwachs, und manche Philosophen würden sogar von Glück sprechen, vom „Glück der Erkenntnis“. Aber da wird’s Haufs terminologisch zu romantisch.
Welche Kunst, malträtiere ich den Malte weiter, hat den Haufs hinsichtlich seiner Kunst, der Poesie, am meisten herausgefordert?
Bewußt, sagt Malte jetzt beinah mit Haufs-Stimme, sicher die Dichtung selbst, und unbewußt hat wohl auch immer die Musik eine Rolle gespielt. Wenn man seine Gedichte liest und vor allem laut liest, hört, merkt, spürt man, wie musikalisch sie sind.
Beim zweiten Bardolino riserva bin ich versucht, an (schöne) Landschaften zu denken und frage gleich bei Malte nach: mir sei aufgefallen, daß Landschaften in den Gedichten eine sichtbare Rolle –. Aber nie um ihrer selbst willen, knurrt Malte dazwischen, als müßte er die Gedichte in Schutz nehmen gegen den Niederrhein, der sich da heimlich eingeschlichen hat in die Poesie, der Haufs ist kein Landschaftsmaler. Landschaften sind bei ihm stets nur Ausdrucksfarben oder -chiffren, die benutzt werden wie andere Weltpartikel auch. Seine Landschaften haben immer mit Zeit und Biographie zu tun, mit sehr konkreten Zusammenhängen, aber nie mit einer Ästhetik, die sich darauf beschränkt, eine schöne oder häßliche Landschaft zu beschreiben.
Gibt es, will ich von Malte wissen, in der Lyrik, in der Geschichte der Lyrik eine „Erfindung“, die den Haufs als Dichter besonders herausgefordert hat? Eine Form, ein Gefäß, das sich angeboten hat, all dem Schwer-zu-sagenden, dem bis dato Unsagbaren Gestalt und Farbe zu geben?
Schwer zu sagen, sagt Malte, und nachdem er aufgestanden ist und einmal um den Tisch gelaufen und sich wieder gesetzt hat: Die Bekanntschaft mit der amerikanischen Lyrik nach dem Krieg, damit sei bei ihm (und anderen) etwas aufgebrochen, etwas ganz neues sei das gewesen, etwas, das es bis dahin in Deutschland so nicht gegeben und das gezeigt habe, daß man über alles ein Gedicht schreiben könne. Was den Autor und Literaturprofessor Walter Höllerer in Beantwortung einer Frage zu der schlicht-schönen Formel verleitet habe:
Im Gedicht hat alles Platz.
Die Türklinke und der Strumpf der Nachbarin, die Haselmaus, die Stromrechnung und das Dantezitat.
Wie sich wohl eine Gedichtlektüre nach vier Bardolino riserva von einer nach fünfen unterscheidet, schweife ich ab, aber bevor ich mich in zu aufwendige rezeptionsästhetische Spekulationen versteigen kann, höre ich mich, und es klingt sehr nüchtern, den Malte fragen, wie der Haufs das wohl schwierigste geschafft habe: einerseits einen ganz eigenen Ton zu entwickeln, der in dem großen gemischten Chor der Dichter deutlich herauszuhören sei, und andererseits diesen Ton im Laufe der Jahre auch zu modulieren, und zwar in den Dur-, den Moll- und den Kirchentonarten.
Wenn man einen Gedichtband abgeschlossen hat, höre ich den Haufs sagen, sagt Malte, muß man vergessen, was ein Gedicht ist, um dann eines Tages wieder ganz von vorne anzufangen. Man hat natürlich alles parat, was den eigenen Ton ausgemacht hat, aber man darf sich um Himmels willen nicht wiederholen. Wenn es gut geht, kommt eine neue Ebene hinzu. Und trotzdem bleibt es derselbe Ton, und das Ganze ist mehr als nur eine Variation.
Was denn nach Kohlhasenbrück und den beiden folgenden „verwandten“ Gedichtbänden in der, sagen wir, zweiten Œuvre-Phase hinzugekommen sei, will ich, nachdem ich nochmals die zwei Riserva-Finger gehoben und unsere Kellnerin darauf Last orders, Freunde, gerufen hat, nun von Malte wissen.
Das, sagt Malte, sollen die Œuvrephasenfetischisten herausfinden. Sicher ist, daß Haufs das Gedichteschreiben nach dem Kohlhasenbrück-Erfolg deutlich schwerer fiel. Irgendwann habe ich gemerkt, hat er mal gesagt, daß ich ein Gedicht nicht mehr wie in jungen Jahren einfach so hinschreiben konnte. Die Anstrengung wurde größer, aber ich habe wohl auch bewußter gearbeitet. Nicht, daß die Spontaneität bei späteren Arbeiten ab- und die Skrupel zugenommen hätten, nein, es wurde einfach alles ernsthafter, komplexer, auch die lustigen Zeilen. Das Schreiben insgesamt war ernster geworden und hatte sehr viel mehr mit der eigenen Existenz zu tun, mehr, als man in jungen Jahren annimmt oder zuläßt, und manchmal so viel, daß man weggelaufen ist vor dem Schreiben, ausgerissen ist, um nicht schreiben zu müssen.
Malte nimmt einen vollen Schluck, und bevor er sich zurücklehnen und strecken kann, frage ich ihn schnell noch, welches Bild von der Welt denn ein jüngerer Leser bekäme, der zum erstenmal einen Haufs-Gedichtband zur Hand nehme.
Malte schaut mich an, als wollte er fragen, ob ich sonst keine weiteren Sorgen hätte, zieht einen Hunderter aus der Hosentasche, hält ihn in die Höhe, bis die Kellnerin ihn schnappt wie eine Meise den Wurstzipfel, und sagt dann, wieder ganz bei der Sache: Auf den ersten Blick kein sehr positives. Auf den zweiten aber, bei genauerer Lektüre, vielleicht eine Ahnung davon, daß es jenseits von Fun und Spaßkultur Fragen gibt, über die nachzudenken sich lohnt, weil sie ein Schritt sind hin zu einem Leben, das sich seiner selbst bewußt ist, vielleicht auch produktiver und befriedigender ist als eines, das in schönster Unbewußtheit oder Seinsvergessenheit auf der Oberfläche dahintreibt.
Gibt es, frage nun vorsichtshalber ich die Kellnerin und nehme die beiden Riserva-Finger zu Hilfe, noch zwei Mineralwasser für zwei, die dann auch wirklich umgehend das Lokal verlassen?, und schiebe das gesamte Wechselgeld in ihre Richtung. Nicht nur in Gedichten geschehen Wunder: Die Kellnerin nickt.
Gibt es, frage ich den verdutzt dreinblickenden Malte, deiner Meinung nach einen deutschsprachigen Dichter aus dem 20. Jahrhundert, der unsere Fragen zu Welt, Zeit und Existenz auf besonders beeindruckende Weise zu fassen gekriegt hat?
Das war für Haufs lange Zeit Gottfried Benn, weicht da der Malte zum Schluß noch aus, und bis heute Georg Trakl. Du mußt nur mal hören, wie emphatisch der Haufs den Namen aussprechen kann. Vor allem das Gedicht „Grodek“ hat es ihm angetan, weil keiner, sagt der Haufs, diese heikle Balance zwischen Trauer und Lebenswut so hat ausdrücken können wie Trakl. Es gibt keinen anderen Text, in dem diese beiden Elemente, Trauer und Lebenswut, so innig ineinander verschlungen sind wie in „Grodek“. Überhaupt die Expressionisten, sagt der Malte quasi wie eine Haufs-Redensart, hatten eine Ausdrucksmöglichkeit und Ausdruckskraft, die einmalig ist in der deutschsprachigen Poesie. Darüber kann man auch heute nur staunen.
Amen, sagte die Bardelino-Fee und schiebt den Malte und mich zum Ausgang, als gäbe es für heute zur Lyrik aber auch gar nichts mehr anzumerken, und draußen, auf der Meinekestraße, sagt Malte, so, und jetzt gehn wir zum Haufs.
Christoph Buchwald, Nachwort, Juli 2001
Seelenwagen mit Reifenpanne
– Ein Gedicht ist nicht nichts: Rolf Haufs zieht lyrische Bilanz. –
Vor fast vierzig Jahren, im Jahr nach der Mauer, erschien Straße nach Kohlhasenbrück, der erste Gedichtband eines siebenundzwanzigjährigen Rheinländers, der seinen Job als Exportkaufmann aufgegeben und beschlossen hatte, in Berlin als freier Schriftsteller zu leben. Den jungen Rolf Haufs interessierten die Wundränder der geteilten Stadt, darunter ebenjene Straße nach Kohlhasenbrück, von der aus Steinstücken erreicht werden konnte. In dem Gedicht „Steinstücken“ heißt es:
Wir sind nicht viele. Doch berühmt.
Willy Brandt braucht einen Passierschein.
Die Pappeln sind spitz. Die Schranke
sieht aus wie eine Kanone.
Unter dem Text steht heute die notwendige Anmerkung: Steinstücken: „ehem. Westberliner Exklave“.
In seinem dritten Gedichtband Vorstadtbeichte (1967) stehen die Zeilen:
Über der schwarzen Havel
gehorchen auch die Wälder.
Dieses Wissen hat Haufs davor bewahrt, in den Aufgeregtheiten der außerparlamentarischen Bewegung auf Schlagworte zu setzen und das Gerede vom Ende der Literatur mitzumachen. Aber wenn es ein Gedicht gibt, das den Beginn des politischen Aufbruchs anschaulich und plausibel macht, dann ist es Haufs’ „Ein Augenblick im Juni“. Es beginnt:
Sie gab mir eine rote Tomate
Ich aß sie statt sie zu werfen
Ich sagte jetzt schießen sie
sie lachte weil sie nicht wußte
Wie leise Pistolenschüsse sind
In einem Hof.
Mi der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg verbanden viele junge Leute ihre politische Initiation.
Haufs widerstand der Versuchung zur ideologischen Radikalisierung. Was er in den siebziger Jahren schrieb, demonstrierte eher die sukzessive Distanzierung des Autors von Freunden, die sich in dogmatischen Positionen eingeigelt hatten und verbissen schwiegen. Es war für den Dichter eine Größer werdende Entfernung. Unter diesem Titel faßte Haufs Jahre später seine Gedichte 1962–1979 zusammen. Ein sprechender Titel für Sichtung und Abschied, die erste große Bilanz des Lyrikers. Aber sie enthielt auch Verse, die die Zukunft offenhielten und ein Weitermachen des Lyrikers ermöglichten:
komm wir reden, sagst du.
Aber jetzt.
Heute, gut zwei Jahrzehnte später, haben wir mit dem Band Aufgehobene Briefe die Bilanz eines Mannes Mitte Sechzig und damit so etwas wie ein Lebenswerk oder doch dessen Extrakt aus dreizehn Bänden Lyrik und lyrischer Prosa. Dazu ein knappes Dutzend neuer Gedichte. Nicht der Autor selbst hat ausgewählt, sondern ein befreundeter Lektor, Christoph Buchwald. Er hat dem Band ein gutgelauntes Nachwort beigegeben, die Nachzeichnung eines Kneipengesprächs. Da versucht er, bei fünf Bardolino Riserva, dem auskunftsscheuen Poeten das eine oder andere Bekenntnis zu entlocken. Er bringt „Malte“ ins Spiel, ein scherzhaft so genanntes alter ego des Dichters: Was der strenge Haufs nicht aussprechen mag, darüber ist von Malte durchaus etwas zu hören – etwa:
Anders als in seinen lyrischen Anfängen, sagt Malte und tut, als sei er der Dichter persönlich, geht Haufs heute eher von Sprache und Sprachklang aus als von einem Inhalt.
Malte behauptet sogar, „daß die Geschichte per se den Haufs immer nur vordergründig interessiert hat. Aber da sie nun mal ,parallel‘ zur Biographie verläuft, kann man sie nicht ausklammern, ohne im Esoterischen oder Belanglosen zu landen.“
Ob Malte, ob Haufs – dem kann sich der gegenwärtige Leser durchaus anschließen. Er möchte auch nicht den „Œuvrephasenfetischisten“ herauskehren und darauf insistieren, daß sich nach dem Sammelband von 1979 ein gelösterer, souveränerer Haufs zeigt. Denn er muß zugleich einräumen, daß es einen unverwechselbaren Ton gibt, der von Anfang an da ist. Das zeigt sich in der Komposition des Bandes. Aufgehobene Briefe ist nämlich nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet.
Interessant aber sind die Mischungen und Übergänge. Nicht erst seit „Kinderjuni“ (1984) gibt es die lyrischen Stenogramme einer durch den Krieg traumatisierten Kindheit:
Brandroter Himmel über den Steinen
Schrie daß die Seele
Beschädigt lebenslang.
Es gibt wenige Lyriker, die so unsentimental und genau über Kindheit im Nazireich geschrieben haben wie Haufs. Etwa über die Verschüttung nach einem Bombenangriff, über einen autoritären Vater oder die Erziehung in Kinderheimen:
Ich trat
In eine Scherbe mein Fuß
Blutete Hitler
Sah weg.
Biographie hat immer mit Geschichte zu tun. Auch in den Gedichten, in denen das Berliner Lokalkolorit der Hintergrund ist, vor dem sich das bekannte lyrische Ich mit den Problemen von Liebe und Sex, Ehe und Partnerschaft herumschlägt. Der flotte Titel „Rote Stiefel“, der über der einschlägigen Abteilung lockt, sollte uns nicht täuschen. Haufs ist ein Meister in der Darstellung von Frust und Resignation. Etwa in jenem Gedicht, in dem das frisch miteinander bekannte Paar eine Ausstellung aufsucht („Salon Imaginaire“), miteinander zu Abend ißt und zu diesem Schluß kommt:
Als es dann endlich soweit war
Sagte sie wir könnten doch
Auch eine Platte anhören
Bob Dylan auf CBS S 62739.
Die schönsten und wichtigsten Gedichte des Bandes finden sich in dem Kapitel „Galerie“. Es sind Hommagen auf Kollegen wie Franz Schonauer, Günter Grass, Erich Arendt, Günter Bruno Fuchs, Johannes Bobrowski und Peter Huchel. Aber auch auf die rheinische Großmutter oder den legendären „Peppino Portiere“ aus der Villa Massimo. „Galerie“ beginnt mit einem Gedicht, das „Was ist eigentlich das Glück“ überschrieben ist. Ohne Fragezeichen, denn es gibt ja keine Antwort. Auch das Ich des Gedichts, das Probleme mit einer Frau hat, findet sie nicht.
Das ist das „Haufsche Paradox“. Malte erklärt es so:
Du kannst in deinem Leben so viele Erfahrungen machen wie du willst, letzten Endes weißt du gar nichts, nothing, null, nada.
Letzten Endes, meint Buchwald, ist es der Antrieb für alle Kunst. Um aber auf „Was ist eigentlich das Glück“ zurückzukommen – das erwähnte lyrische Ich, das im Café „unauffällig“ ein wenig verzweifelt, macht – am Ende des Gedichts – eine Erfahrung, die das Nihil transzendiert: „Dann kommt sie zurück“, die Frau nämlich. Ob in Wirklichkeit, ob in der Phantasie? Auf jeden Fall aber im Gedicht von Rolf Haufs.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.2.2002
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber+ Instagram + Facebook + Kalliope
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
TROIS HOMMAGES
In Erinnerung an Rolf Haufs
(„Aus der Rheingegend müßte noch was kommen“)
I.
Oktoberglast,
die Kähne
nehmen die Möwen
ins Schlepptau
auf den Kämmen
schilfiges Haar
und die Prismen der Ufer
wo um den nachblühenden Efeu
Satelliten im Safranpanzer summen:
gib mir Honig.
Noch einmal das Harren
auf den querenden Einbaum
des Schamanen
der im Luchsfell
die Hasen ins Bild setzt
ihnen auf der Schiefertafel
das welkende Gaukelspiel
KUNST
langmütig erklärt.
II.
Novembermilch,
wiegende Schemen
grau gegen grau
gleiten gischtend
ins Nirgendwo.
Ufergesäumt die Pappeln:
zart gekalkte
Herzkranzgefäße
himmelwärts wedelnd.
Unweit stand die Brücke
für seinen Sturz errichtet
uferlos.
Nach der Rheinischen
Gehöraffektionen –
im Crescendi-Strudel
und Dissonanzen-Wirbel:
Hetaeras Sarabande
und die Romanzen Claras.
III.
Nebensonnen im Dezember,
die Krüppelweiden
sammeln rares Gold
auf ihren blanken Schädeln.
Schleppend kämmt der Kahn
die goldenen Fluten
kämmt sie wie Diese –
weitweit flußaufwärts und felsoben –
ihr goldenes Haar.
Den Schiffer
im schwankenden Schiffe
schert nicht Kamm noch Haar
er hört nicht das alte Lied
des freieren Sohnes –
verstopft das Ohr
wie des Odysseus Gefährten
eilt eilend dahin
mit seiner Fracht –
eingedenk des ultimativen
Liefertermins.
Walter Müller-Jentsch
Erich Jooß: Wiedergelesen – Folge 29: Die Gedichte von Rolf Haufs oder wie das Leben verrinnt
Klassiker der Gegenwartslyrik: Rolf Haufs – Am 3.4.2012 stellt die Literaturwerkstatt Berlin in der Reihe Klassiker der Gegenwartslyrik den Dichter Rolf Haufs vor. Mit Wulf Segebrecht sprach er über sein Werk.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jürgen Becker, Günter Grass, Walter Höllerer, Michael Krüger, Günter Kunert, Peter Rühmkorf, Hans Joachim Schädlich: Rolf Haufs zum Sechzigsten
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 137, März 1996
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: „Der Planet friert. Still!“
Badische Zeitung, 30.12.2005.
Auch in: Neue Zürcher Zeitung, 31.12.2005/1.1.2006
Martin Lüdke: Immer größer werdende Entfernung
Frankfurter Rundschau, 31.12.2005
Nico Bleutge: Vertikale Poesie
Süddeutsche Zeitung, 31.12.2005/1.1.2006
Richard Pietraß: Im Glashaus
Der Tagesspiegel, 31.12.2005/1.1.2006
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Martin Lüdke: Nebel kommt auf Katzenfüßen
Frankfurter Rundschau, 30.12.2010
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IZA + KLG + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Rolf Haufs: FAZ ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Der Tagesspiegel


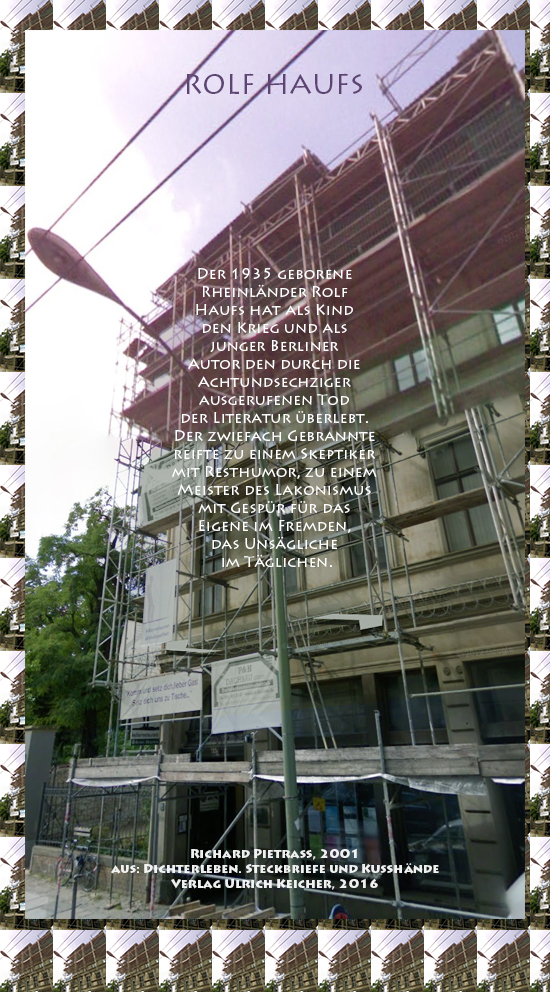












0 Kommentare