GOETHES GARTENHAUS
als ich in goethes gartenhaus war,
stand ewig ein aufseher in der nähe,
starrte gelangweilt in goethes garten
und paßte auf, daß ich nur ja nichts
von goethes sachen anfaßte.
da habe ich noch schnell vor goethes
spiegel eine grimasse geschnitten,
(als der andere wieder aus dem fenster guckte)
bin in goethes garten gegangen
habe mich auf eine gartenbank gesetzt,
die füße auf den steinernen gartentisch gelegt
und während goethes gartenvögel zwitscherten,
habe ich eine geraucht und
das hier aufgeschrieben.
weimar, 4.4.78
(für Sascha Anderson)
![]()
Thomas Kling liest am 11.9.1991 aus seinem Band brennstabm.
Studio LCB am 23.6.1992 im Literarischen Colloquium Berlin. Lesung: Thomas Kling; Moderation: Hajo Steinert; Gesprächspartner: Hubert Winkels
Flaggensignal zur zweiten Auflage
brennstabm ist der jetzt in zweiter, unveränderter Auflage vorliegende Gedichtband, der die Wende von den 80er zu den 90er Jahren in meinem Schreiben markiert. An zahlreichen Orten recherchiert und geschrieben, berührt brennstabm ebenso zahlreiche Traditionen des Dichtens; dabei beschränken sich die Bergungsarbeiten nicht auf die Stauräume des klassisch-alteuropäischen Schrifttums, ebensowenig wie es mir allein um die Sichtung, Aus- und Aufräumung der Archive einer ausbuchstabierten Moderne ging (und geht): stets bin ich mir bewußt, daß Verschriftlichung von Dichtung bedingt ist von älteren, oralen Traditionen der Sprachwiedergabe, die der Alphabetisierung vorausgehen.
In der Poetik des Isländers Snorri Sturluson aus dem 13. Jahrhundert meint stafr denn auch im wesentlichen zweierlei, Buchstabe und Laut; daneben bedeutet es Unbeweglich-Steifes, Pfeiler und Säule, Regelmaß und Formular, weist ins altindische, wo stambha – als (Baum-)Stamm, als stützen, an- und festhalten, aber auch als höchstbeweglich-fließendes, als schimpfen und stampfen uns entgegentritt – als Stampfen des Rhythmus, versteht sich; zu diesen indoeuropäischen Wurzeln gehört, nicht zuletzt, dann auch das Staunen. Und: es gehört das histrionische Element des lauten Sprechens der Verse – keineswegs nur von brennstabm! – zum Lesen, durch welches das Gedicht seine körperliche Rückkehr, ein anderes Aufglühen von Sinn, erfährt.
Thomas Kling, Vorwort zur 2. Auflage, Juni 1997
Mit seinen beiden Gedichtbüchern
erprobung herstärkender mittel (1986) und geschmacksverstärker (1989) hat Thomas Kling die ästhetisch vorwärtsweisenden Gedichtsprachen der achtziger Jahre konsequent befördert und im Dialog mit der Tradition den zeitgenössischen dichterischen Suchbewegungen entscheidende Impulse mitgegeben. Thomas Klings Gedichte wollen eher Geschmacksverstärker sein denn traditionell Gereimtes vorstellen, seine Gedichte sind lyrische brennstabm, die unsere Sprachgewohnheiten explosiv aufschmelzen, verflüssigen und neu zusammensetzen.
Lyrische und kritische Zeitgenossenschaft sowie historische Vergegenwärtigung sind das, was Thomas Kling beim Arbeiten in – und nicht nur mit – der Sprache bewegt, vorgeführt in vielfach phonetischer Schreibweise. Zeitgenossenschaft bedeutet für seine Gedichtsprache Skepsis gegenüber den „sprachplacebos“, den Stereotypen, Phrasen und Floskeln, die unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit verstellen und gewalttätig verfestigen. Darauf reagiert die lyrische Spracharbeit von Thomas Kling, indem sie Sprache neu inszeniert. Als „Terraingewinn im Unbesprochenen“ verzeichnete die literarische Kritik den Gewinn solcher Sprachinszenierung: kein Wort, kein Satz, denen nicht nur Verwandlung zu neuem Klang und neuer Bedeutung verholfen würde; kein Interpunktionszeichen, das bei Thomas Kling nicht gesprächig wird.
Das Gedicht als spiegelnder Resonanzkörper von Außenwelt bringt die Wirklichkeit neu zur Sprache und verhilft dieser zu überraschender Kenntlichkeit und sinnlichem Erleben.
Im dichterischen Sprachlabor der brennstabm erlernen wir unsere Sprache wie neu.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1991
Wortgestöber
Dem Dichter Thomas Kling eilt der Ruf des wilden, ungebärdigen Exzentrikers voraus. Dieser Berserker der Poesie, so versichern Eingeweihte, flüstert nicht, wie gehabt, blattvergoldete Verse mit erstickter Stimme ins Publikum, sondern schreit in hysterischer Klaus-Kinski-Manier seine zerfetzten Wortgebilde heraus: ein Sprachbesessener, dem die Worte nicht wie modrige Pilze im Mund zerfallen, sondern lautstark zerplatzen. Glaubwürdigen Gerüchten zufolge hat sich bereits eine „post punk poetry“ Schule gebildet, die in Thomas Kling ihr heimliches Oberhaupt verehrt. Hubert Winkels hat in der ZEIT (8. Dezember 1989) diesen Gerüchten Nahrung gegeben, als er die Gedichte Thomas Klings mit der Musik der „Einstürzenden Neubauten“ verglich.
Wer, wie der Rezensent, noch kein Ohrenzeuge des Klingschen Furors gewesen ist, bleibt, ganz traditionell, auf die Lektüre von dessen Gedichten angewiesen. Solche Lektüre stößt rasch auf erhebliche Widerstände. Denn wer sich auf Thomas Klings Gedichte einläßt, gerät in eine vokabulare Trümmerlandschaft, in der, so scheint es, kein Sprachbaustein auf dem ändern geblieben ist.
Es sind Gedichte, vor denen zumindest traditionelle literaturkritische Kennmarken versagen. Im virtuos inszenierten „wortgestöber“, charakteristisch schon für Klings vorigen Gedichtband geschmacksverstärker (1989), geht jeder rote Faden verloren. Man mag, zur eigenen Beruhigung, die mit disparaten Sprachbruchstücken vollgestopften Montagegedichte in die Tradition der „experimentellen Lyrik“ einordnen. Aber diese bequeme Rubrizierung greift zu kurz, hat doch Thomas Kling die methodische Strenge und serielle Ödnis der „Konstellationen“ und „Permutationen“ längst hinter sich gelassen.
Wenn hinter seiner anarchischen Montage- und Collagewut irgendeine Methode auszumachen ist, dann ist es allenfalls die der Überraschung, ja Überrumpelung des Lesers durch einen raffiniert inszenierten „Wortüberfall“ (Bert Papenfuß Gorek). Was zählt, ist die Dynamisierung der Sprachbewegung um jeden Preis. Schon Klings Gedichttitel erweisen sich als Wortbildungen von bizarrer Schönheit: „frustfunk, gurknmaskierung“, „mezzogiorno:luparamond“ oder „valkyrir.neuskaldisch“ heißen seine Texte, die ihren Reiz aus der Kollision solcher dissonanten Wortelemente beziehen.
Auf die provokativ antipoetischen „geschmacksverstärker“, dieses synchron montierte Wörtergebräu aus den Sprachen des Alltags und dem Stimmengewirr der audiovisuellen Medien, folgt nun der Band brennstabm, der, als Ergebnis einer fast schon beängstigenden Produktivität, über hundert Gedichte aus den Jahren 1988 bis 1990 versammelt. Er setzt ein mit einem düsteren Totengesang des Nachgeborenen Thomas Kling auf die Generation der Vorväter, die soldatischen Männer des Ersten Weltkriegs. Diese „aufpflanzer von bajonetten“, heißt es an einer Stelle, blicken „aus schwer zerlebtn trauma-höhlen“ auf ihre Lebensgeschichte. Auch der Blick des Dichters Kling auf die Welt scheint traumatisiert. Was diesen Blick in Bann schlägt, sind Bilder des Schreckens. So trifft im Gedicht „blikk durch geöffnetes garagentor“, das eine Kindheitserinnerung heraufbeschwört, der Blick des Elfjährigen auf einen ausgeweideten Hirschkadaver. Im darauffolgenden Text „augenwohnun’“ sind es Totenschädel, an denen sich die Aufmerksamkeit des lyrischen Subjekts (das, trotz aller sprachzertrümmernden Anstrengungen, heil geblieben ist) entzündet. Zu den enigmatischen Bildern des Schreckens zählt auch die Photographie eines brennenden Schiffs, die den Umschlag von brennstabm ziert.
Immer wieder sind es solche blitzhaften visuellen Wahrnehmungen oder akustische Bewußtseinsreize, Stimmen oder der Klang eines Wortes, die den poetischen Prozeß in Gang setzen „Das künstlerische Material muß kaltgehalten werden“: An diese poetologische Maxime des von ihm heißgeliebten „dokter benn“ mag sich Thomas Kling nicht halten, im Gegenteil. Die Sprache, die er in unserem Alltag vorfindet und nach Maßgabe spontaner Assoziationen umbaut, verdreht und deformiert, versucht er durch die ganze Temperaturskala von extremer Kälte bis zur äußersten Gluthitze zu jagen, bis sich die Worte des Gedichts gewissermaßen selbst entzünden. Mit Hilfe der lyrischen „brennstabm“ sollen nicht nur die Sprachgewohnheiten und kommunikativen Routinen, sondern auch die literatursprachlichen Codes eingeschmolzen oder verflüssigt werden.
Herauskatapultiert aus den Lesegewohnheiten wird man zunächst durch exzessive orthographische Verfremdungen. Kling verfaßt seine Gedichte in einer Art poetischer Lautschrift, die sich, unterstützt durch ein ganzes Heer von Satzzeichen, an den phonetischen Eigenheiten der einzelnen Wörter orientiert.
Was Arno Schmidt in der Prosa virtuos vorgeführt hat, wird auch in den Gedichten Klings zur Methode: der Versuch, Orthographie und Interpunktion semantisch aufzuladen und sie zu poetischen Bedeutungsträgern zu machen, die die Phantasie des Lesers in eine bestimmte Richtung lenken sollen:
ENTKEHLTE PAPIERE; tannen entkehlt
da zik-zik-ziks: ihr reines schnikkern!,
zimmer mit kehle, verandakehlenraum!
frechrotes buschig, dat eichhörnchn am
turnen, gekehltes zimmer! flockn-flockn-
flokkn zimmer mit meise, zimmer mit ko
hlmeise (2), zimmer mit landndm kleiber.
zimmer mit ring mit ringeltaube, mein un-
beringtes zimmer zimmer mit brüstung,
brust rostrot: ihre kehle-kehle! nachz+
früh, na, N.A.C.H.T.I.G.A.L.L zimmer mit
eingebauter nachtigall…
Wie in diesen Zeilen aus dem Gedicht „ornithologisches zimmer“ wird die Sprachbewegung sehr oft onomatopoetisch weitergetrieben. Manchmal freilich ist die Banalität solcher orthographischen Verfremdungsprozeduren nicht zu übersehen: Wenn etwa der „Eskimo“ zum „esquimaux“ oder das „Bankenviertel” zum „bankn/4″ wird, ist das eher ein um Originalität bemühter Kalauer als ein Ausweis sprachschöpferischer Genialität.
Hinter der Fassade dieser anarchischen Montagetechnik, die punktuelle Wahrnehmungen, Erinnerungsbruchstücke, Sprachlaute, frei flottierende Gesprächsfetzen und Zitate ineinanderschneidet, verbergen sich oft ganz konventionelle Themen und Motive, die der Lyrik von jeher eigen sind: Momentaufnahmen aus Städten und Landschaften, Naturempfindungen, Tagträume.
Sogar das gute alte lyrische Ich tritt als biographisches Autor Ich gänzlich unmaskiert auf und berichtet – wie einst die redselige Alltagslyrik von Erlebnisaugenblicken an „grölenden theken“, von bedrohlichen Momenten zwischen Schnellimbiß und Autobahn. Freilich ist dieses lyrische Ich in den Sog von „fulminantn stirngewittern“ geraten und befindet sich in einem permanenten Reizzustand, so daß es nur noch bruchstückhaft zu sagen vermag, was es leidet.
Michael Braun, Die Zeit, 3.5.1991
Placebos, Kwehrdeutsch, Vaterlandkanal
(…)
Thomas Kling ist schon so etwas wie ein Star dieser Szene. Sein zweiter Gedichtband geschmacksverstärker verleugnet nicht das Synthetische seiner Intention: einem verbrauchten Reiz soll offenbar aufgeholfen werden:
UND DER LETZTE KONKRETE KALAUER
KOMMT DANN „BITTE MIT GESCHMACKSVERSTÄRKER“.
Man ergänze: der letzte Kalauer der Konkreten Poesie. Ihn wendet Kling methodisch gegen die zeitgenössische Realität, um ihre Banalität zu würzen. Der Titel des neuen Bandes brennstabm zielt auf eine weitere Forcierung: Sprachgewohnheiten und Realitätsauffassungen sollen gleichsam erhitzt und aufgeschmolzen werden. Das geht seit Arno Holz nicht ohne Polemik gegen die Lyrikkonvention ab. „von sprach- / placebos sind di szenen überfoll“, diagnostiziert Kling, und wendet sich gegen „jauche-permanenzn. im grenz- / gang ertaubte claims. die abgegrastn / ausgegrenztn schädel!“
Solch ein Rundumschlag verpflichtet; und Kling ist viel zu gewitzt, um nicht seine Kritik unter einen mentalen Vorbehalt zu stellen:
den sprachn das sentimentale
abknöpfn, als wär da nicht schon so gut
wi alles im eimer; bausch der im
hohn bogen in ein op-behältnis
fliegt.
Wo alles im Eimer ist, läßt sich der Gestus des Wegwerfens als artistische Leistung bewundern. Deshalb sind Art und Unart dieser heftigen Lyrik an Beispielen zu prüfen. Etwa an „di zerstörtn, ein gesang“, einem mehrteiligen Gedicht, das die Kriege unseres Jahrhunderts als einen Albtraum von Bildern und Sprachsplittern („aus schwer zerlebtn trauma-höhlen“) zu fassen sucht. Es zeigt vielleicht am deutlichsten, worin Klings Begabung liegt. Ich zitiere Nr. 5 von 9 Teilen:
hart umledertn herznz. unsere schwere.
geschüzze so bricht der tag an die rattnnacht.
nachte nachte rattrimachte im böschunx-, im
ratten-mohn. wir sind noch WIR WAREN UNTER DER
WEISZN (jiddisch, di mond) da waren wir,
DAS WARNEN WIR. UMSONST-GESANG.
Das ist von einer kruden Schönheit. Der Autor schließt hier an gewisse Möglichkeiten Celans, das Schlimme im grotesken Sprachduktus einzufangen.
Rolf Dieter Brinkmann dagegen (es ist ja erlaubt zu lernen) ist Klings Vorbild in seinen Alltagsszenen. Immer wieder einmal findet man im Sprachschotter Details, in denen etwas aufblitzt. Etwa:
ich lecke di
achsel des sommers; der sommer ist eine frau.
Oder Kling gelingen Blicke auf „gestockte“ Bilder oder eine satirische Szene wie „taunusprobe. lehrgang im hessischen“:
kajalflor zu heavy metal sounnz (vorher-
sage: grölender stammtisch), gerekktes
hinterzimmer-, jetzt gast-stubn-,heill!!‘
di theknmannschaft, pokalpokal, trägt
501 trägt wildleder-boots, drittklassiger
western den sie hier abfahrn HEILHEILHEIL!!!!
Vorerst aber ist der sprachliche Furor bei Thomas Kling größer als der Zugewinn an poetischer Realität.
Harald Hartung, Merkur, Heft 513, Dezember 1991
brennstabm
Die Tiroler Literatur wird meist recht einseitig dargestellt. Immer wieder kommen jene zum Zug, die aus Tirol etwas in die Welt hinausposaunen, ganz selten hört man etwas von jenen, die über das Tiroler-Landl schreiben. Thomas Kling, der irgendwo in einem magischen Dreieck zwischen Wien, Finnland und Köln lebt, hat mit dem Teil „TYROLTYROL“ für die alpinen Patrioten ein Gedichtmonument mit hinterlistigen Maßstäben gesetzt.
In einer sogenannten „123-teiligen landschafts-photographie gibt es allerhand zu lauschen und zu lernen; daß der Grundton lyrisch ist, ist Ehrensache. So gibt es etwa eine Schneehöhe aus dem Jahr 1817, die unanständig in ein Gedicht übergeht. Ein Tyroler Haiku der zweiten Art lautet:
links flankierender pfeil.
bei kopfschuß in die knie gehen.
sebastian löscht (S. 112)
Andreas-Hofer-Stüberl, Kaiser und Kaiserjäger, Stamperl und Lawinenlicht geben genügend Stoff für ein wahrlich zerhacktes und neu zusammengeknetetes Tirolbild ab.
Thomas Kling scheißt sich auf den ersten Blick recht wenig um seine Lyrik, oft fehlen Teile einer Zeile, dann gibt es wieder einen Felssturz, der das Gedicht zu verschütten droht, an einer sinnlosen Stelle ist eine Leitschiene aufgestellt.
Kurzum, die Lyrik Thomas Klings gleicht einer Tiroler Gebirgsstraße nach einem Unwetter. Scheinbar ist alles vernichtet, aber siehe, immer wieder kommt etwas Tragfestes zutage!
Helmuth Schönauer, aus Helmuth Schönauer: Tagebuch eines Bibliothekars, Bd. I, 1982–1998, Sisyphus, 2015
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Heinrich Vormweg: So geht die tichterey vonstattn
Süddeutsche Zeitung, 15./16.6.1991
Dieter M. Gräf: Der Hardcore-Lyriker Thomas Kling im Kampf mit Wespe und Hirsch
Basler Zeitung, 21.6.1991
Matthias Politycki: Schwerer Honig aus hohlen Waben
Stuttgarter Zeitung, 21.6.1991
Wulf Segebrecht: Gezuck und Lendenwunsch
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.7.1991
Sieglinde Geisel: Sprachpurismus im härtesten Sinn
Neue Zürcher Zeitung, 27.9.1991
Annette Brockhoff: Sinnfielteilung. Neue Gedichte von Bert Papenfuß-Gorek und Thomas Kling
die tageszeitung, 6.12.1991
Was bleibt mir von Thomas Kling
am eindrücklichsten in Erinnerung, was war das Besondere an ihm? Vielleicht so: etwas Hellwaches, äußerst Aufmerksames, immer zum kompromisslosen Kommentar Bereites, eine fordernde Ungeduld. Andererseits etwas sehr Behutsames, fürsorgliches, fraglos Offenes, eine hinter messerscharf arbeitendem Verstand getarnte seismografische Sensibilität. Beides in seinem Gegensatz eine kostbare, aber auch explosionsgefährdete Mischung.
Kennengelernt habe ich Thomas 1990 im Druckhaus Galrev, in dem ich damals arbeitete. Der frischgegründete Verlag residierte in einer umgebauten Erdgeschosswohnung im nördlichen Ende der Lychener Straße mitten im Prenzlauer Berg. Eine Mauer beendete hier die Lychener abrupt, von einigen unkundigen Besuchern als Berliner Mauer bestaunt. Tatsächlich trennte sie aber nur die S-Bahn Trasse ab.
Thomas Kling, Gerhard Falkner und Peter Waterhouse waren die gleichaltrigen Antipoden der Ostberliner Dichtergeneration vom Prenzlauer Berg, unter ihnen Bert Papenfuß, Stefan Döring, Andreas Koziol, Sascha Anderson, Gino Hahneman und Rainer Schedlinski. Nach all den Jahren unabhängiger Untergrundliteraturzeitschriften, Künstlerbüchern und Wohnungslesungen hatte die Künstlerszene vom Prenzlauer Berg nach der Wende erstmals einen eigenen, kommerziell arbeitenden Autorenverlag gegründet, das Druckhaus Galrev, das ausschließlich Lyrik verlegte.
Thomas Kling kannte ich bis dato noch nicht. Eines Tages drückte mir Sascha einen kleinen schmalen Band in die Hand, hier, lies mal. Ich wollte ohnehin gerade im benachbarten verlagseigenen Café Kiryl eine Kaffeepause machen, nahm also das in der Eremitenpresse Düsseldorf erschienene Buch mit dem bizarren Namen erprobung herzstärkender mittel in die Hand, setze mich im Café an den Tresen… und hörte erst wieder auf zu lesen, als ich auf der letzten Seite anlangte. Thomas’ Gedichte hatten mich so unerwartet getroffen, betört und fasziniert mit ihrer sprachlichen Finesse und ihrem subtilen Scharfsinn, dass ich rings um mich herum alles vergaß, selbst meine Arbeit. Das Buch, inzwischen vergriffen, habe ich mir damals sofort kopiert, die zusammengehefteten Blätter bewahre ich bis heute im Bücherregal. Kurze Zeit später lernte ich Thomas selbst kennen, im Verlag wurde ein Buch vorbereitet, Proë, es enthielt Gedichte und kurze poetische Statements von Falkner, Papenfuß, Anderson, Kling, Döring, Waterhouse und Grünbein.
Die intensiven Gespräche mit Thomas und den anderen Autoren des Verlages begannen, sobald sie durch die Glastür in den Verlagsraum traten, die Gespräche trafen ohne Umschweife sofort das Zentrum, die Literatur, die Dichtung. Ost oder West, das spielte keine Rolle. Wichtig war der Umgang mit Sprache, die verschiedenen individuellen Ansätze ihrer Dichtung, die jeweiligen Poetiken.
Von den insgesamt zehn Verlagsmitarbeitern, sämtlich Autoren oder Herausgeber von Untergrundzeitschriften, besaß ich damals eine Sonderrolle, denn ich zog als einzige neben der Arbeit auch noch Kinder groß, beide waren damals knapp dreijährig. Es existierten zwar auch bei anderen Nachkommen, diese spielten aber im Verlagsalltag keine Rolle und lebten bei externen Ex-Partnerinnen. Ich war es gewohnt, dass meine Kinder in diesem Literaturbetriebsablauf mehr oder weniger mein Privatplaisier waren. Umso erstaunter registrierte ich Thomas’ Anteilnahme an meiner Situation, seine Nachfragen nach den Töchtern, selbst ein Kindergeburtstag hatte ihn einmal nicht abschrecken können. Immer wieder ermunterte er mich, meinen Weg zu gehen, neben der Verlagsarbeit Eigenes aufzubauen, eine eigene Stimme zu behaupten. Er tolerierte als einer der wenigen meine nicht ganz umkomplizierte Lebenssituation in diesem gut und gerne Tagundnachtjob und sprach mir auf eine ganz normale, fast unbemerkte Weise Mut zu. Ich kann nicht genau sagen, warum mich das neben all dem literarisch Grossartigen bis heute am tiefsten an Thomas berührt, vielleicht weil sein Zuspruch für mich damals etwas sehr Existenzielles war. Thomas hatte das irgendwie erkannt.
Cornelia Jentzsch
bei geschminktem Äther, oder wie der Dichter Thomas Kling hypnotisiert
wie hat es begonnen, frage ich ihn, ich will mich besinnen, ich will die Erinnerung zurück gewinnen. Während er mir Einzelheiten über einen ersten Auftritt in den WIENER MARGARETENSÄLEN am 24.1.1983 und eine erste Begegnung im Café Museum am 25.1.1983 ins Gedächtnis zu rufen sucht, kritzele ich auf einen neben dem Telephon liegenden Schreibblock VERMUTLICH SIND DIESE TEXTE SO ETWAS WIE EIN HOLOGRAMM UNSERER WELT. Ich glaube er sagt dann noch : zu den glücklichsten Konstellationen der letzten zwanzig Jahre gehört es, daß FM und ThK einander wahrnehmen konnten.
Er meint womöglich wechselseitige Potenzierung, wechselseitige Bestätigung eingeschlagener Prozessionsrouten, Prozeduren, etc., also wechselseitige Kontaminierung. Er meint Multivalenz, „gelbe Skala“ (Kupka), knirschende Sprachbeschleunigung, er meint Hagebutten Delirium, er meint Herzdolmetsch, halbe Flora −
Thomas Kling: Poesie Gratwanderer, Poesie Lunatiker, mit dem Selbstauslöser Sprachbilderkataloge generierend, er selbst in kunstanarchischer Pose davor, nämlich als Magier einer ins nächste Jahrtausend weisenden Sprachverwirklichung: mit diesen seinen Fata Morganen eines abgehalfterten Alphabets, eines geschundenen Sprachregisters, den Ruten- und Hagelgewittern schräger Phantasmagorien, dem zerstückelten Wort Kanevas, dem steilen Slang der Achtziger-, Neunzigerjahre, der Multivalenz seiner ritualen Phonetik. Und wie zauberhaft er Historisches, Futuristisches, Strukturalistisches, Klinisches, Gentechnologisches zu instrumentieren versteht, indem er, geläufige Sprachästhetiken zerhackend, eine neue Ahnung von Schönheit beschwört, die uns ZERFETZT, wie uns jene aufreizend gräßlich schönen Gemälde eines Francis Bacon ZERFETZEN, lidaufreißend uns martern, entzünden, erschauern machen.
In Posterformat hagelt es gegen die Stirn : ein kreischendes Grün, ein Dschungelgezeter, im zustechenden Schneeregen eine Scherenschnitt Kindheit, Saufeder am Kragenaufschlag. Ein Lichtzerhacker, ein Hirnstrudel, ein Autopilot dieser Dichter!, sein hinreißender Argot, dieser den Atem verschlagende glamour-drive, diese Eternitstirnen, Lichtbegängnisse, Dezibelschübe, Limogläser, Schiebermützen, Infarktlippen!, diese zerschrammten Wortmarkierungen, türkischen Schlehengegenden!, so daß die Ketchup Wunde am Schläfenbein platzt und wir als getroffen Betroffene, als Gezeichnete, fortan uns ausweisen können.
Diese Löschblattlosigkeit.. er ist mit dem Fahrrad gekommen, und ich habe ihn für einen alten Mann gehalten, erst die Augen ein Blick in seine wasserhellen Augen : da erkannte ich einen Jüngling, notiere ich während unseres zu Ende gehenden Telephongesprächs.
Friederike Mayröcker, Die Zeit, 12.11.1993
Ein schnelles Summen
− Thomas Kling im Gespräch mit Hans Jürgen Balmes und Urs Engeler (April 1994). −
Hans Jürgen Balmes: Thomas Kling, du hast einmal erwähnt, du wärst eigentlich Wörterbuch- und Lexikonkritiker. Bezogen auf das Wörterbuch gibt es da zwei Funktionen: einmal die Sprachkritik, die „notgrabun’“, um entlang von verschüttetem Sprachmaterial eine ganz bestimmte Erfahrung heranzuholen und, wie es im gleichnamigen Gedicht heißt, „schatten herauszuröntgen“, und die andere Funktion, daß die Arbeit mit solchem Sprachmaterial das Gedicht in seiner Produktion vorantreiben kann: „satzwingert ausm kopfwingert zu erzeugn“, wie in „trestern“ steht.
Thomas Kling: Ich hab tatsächlich ziemlich früh damit angefangen, mich mit Lexika und mit Wörterbüchern zu befassen. Als Schüler habe ich sehr viel im Kluge/Götze gelesen, einfach so Entdeckungsreise: Wo kommt der „Schlachtenbummler“ her? Und dann merkt man ja schon diese Verselbständigung, dieses Schneeballsystem, das Aleatorische, was ja auch wieder eine Gefahr in sich birgt, wenn man eigentlich das nachgucken wollte, und nachher ist man wo ganz anders gelandet. Da muß man sich dann schon, so schön solche Ausflüge auch sind, eine Disziplin auferlegen. Wenn ich an einer bestimmten Themengruppe arbeite, dann benutze ich die Lexika halt als Recherche-Instrument, das ist für mich sehr wichtig. Und dann hat mich, der ich Anfang der 70er Jahre anfing zu schreiben, von vornherein nicht eine streng serielle, im Sinne der Konkreten Poesie, eine strenge, permutative Textvorgehensweise interessiert, sondern ganz bestimmt das Erzählerische, was ich mir lange verboten habe. Ich habe also erzählerische Texte, wie ich sie verstanden habe, geschrieben.
Urs Engeler: Geschichtstexte also auch, in denen sich das erzählerische Moment mit Geschichte verbindet?
Thomas Kling: Ich wende meine Aufmerksamkeit schon einem geographischen Geschichtsraum zu, wo es für mich dann egal ist, ob es das Rheinland ist als deutsches Thema, was aber im „mittel rhein“ ja auch schon wieder in einem kulturhistorischen Rundumschlag gezeigt wird, was das für ein melting pot gewesen ist. Und genauso interessiert mich jede andere Land- oder Stadtschaft.
Engeler: Und das interessiert dich dann immer ausdrücklich als melting pot?
Kling: Aber natürlich, eben als eine Riesen-summende-Insektengesellschaft, wo man die einzelnen Stimmen dann herauspräparieren muß, und das ist eben viel Material, und dann wirft man genügend weg, so ungefähr.
Balmes: Wenn du die Vorgehensweise beschreibst, kommen oft Metaphern wie „präparieren“, „herausröntgen“. Die Recherche, die ja auch Teil dieser Operation ist, wann setzt die ein?
Kling: Das ist ganz unterschiedlich, so wie ich im Kopf habe, irgendmal da und da hin zu reisen oder mich mit dem und dem Gebiet zu befassen. Das kann sein, daß ich über mehrere Jahre Material sammle und weglege, und wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, wo ich von der Botanik bis zur Geologie was wissen möchte, also quasi Bodenproben entnehme, dann sind die Zeitabschnitte eben kurz und komprimiert.
Balmes: Du hast eben vom Erzählerischen gesprochen. Mir ist aufgefallen, daß ich die Gedichte in geschmacksverstärker oft als Mikroerzählungen lesen kann, mir kamen sie manchmal vor als eine Art von Rollenlyrik, die Gedichte sind sehr stark auf eine Stimme hin instrumentalisiert.
Kling: Das ist richtig.
Balmes: brennstabm hat mich dann sehr überrascht. Eine der Stärken des Bandes, des Weiterschreibens, ist, daß der ganze Band eigentlich eine epische Struktur hat, die durch die Komposition der Gedichte entsteht, und daß sich diese epische Struktur im Ablauf entwickelt, wobei dann die „Blaumach“-Gedichte am Anfang stehen, aber sofort schon ineinanderlaufen mit den Gedichten, die den Düsseldorfern, Beuys, Palermo, gewidmet sind, wo sich dann nahtlos eigentlich Bayer, Warhol, Mayröcker und Celan anschließen. Wie weit kommt diese erzählerische Struktur von der Kunst her?
Kling: Ich habe von Schulzeiten an eigentlich immer Kontakt zur bildenden Kunst und zu bildenden Künstlern gehabt, was in Düsseldorf unvermeidlich ist, so akulturell sich die Stadt auch immer schon gezeigt hat. Aber ich habe von bildenden Künstlern gelernt, auf genaue Komposition des Bandes zu achten. Daher diese nicht auf Zufall beruhende Kapiteleinteilung gerade in brennstabm. So Begriffe wie „petersburger hängun’“ sind ja der bildenden Kunst entnommen, und die Raumausnutzung, neben der Sprachraumausnutzung, die Räumlichkeit und die Anordnung im Buch, eben auch wie in brennstabm unter Zuhilfenahme einer alten anonymen Fotosequenz, das sind für mich Sachen, die habe ich schon aus der bildenden Kunst gelernt.
Balmes: Was ich immer spannend fand, ist, daß dich der frühe Kontakt mit Figuren wie Beuys, wo man ja vielleicht damals, Anfang der 70er Jahre, noch nicht deutlich wissen konnte, wohin das führt, doch aber irgendwo auf eine Kunstfährte gesetzt hat, die dich immunisiert hat gegen das, was Ende der siebziger Jahre in der Lyrik passiert ist, die Neue Subjektivität, gegen deren Vereinfachungen du ja von Anfang an die Komplexität des Schreibens und der Sprache gesetzt hast. Ist es gerade der Kontakt zu Künstlern dieser Düsseldorfer Szene, der diese Vereinfachung für dich abgeschnitten hat?
Kling: Man muß so sagen: Beuys galt ja, für Nichtkünstler zumindest, so wie für die Düsseldorfer Marktfrauen, die ihn alle gekannt haben, als Original. Das war der Mann mit dem Hut und der Anglerweste, und der war präsent. Ich habe ihn ’77 auf der documenta in Kassel, Installation der Honigpumpe, mitgekriegt. In dieser Zeit war ich ja schon mit einem Bein auf dem Sprung nach Wien. Das ist eben ein Gebiet, ein Literaturgebiet gewesen, Österreich, was mich viel mehr interessiert hat. Viel mehr interessiert hat insofern, als die Weiterforschung und Erarbeitung der Klassiker der Moderne eben in Österreich, gerade in Wien geleistet worden ist, und ich hab das als persönliche Frechheit und als Frechheit gegenüber der Sprache verstehen müssen, was in Deutschland ab Mitte der sechziger Jahre, die ganzen siebziger Jahre bis weit in die achtziger Jahre für Gedichte geschrieben wurden. Das ist ein Riesenausfall für die Literatur, für die deutschsprachige Literatur. Die Österreicher sind natürlich näher dran gewesen, die haben quasi sieben Jahre „nur“ Rezeptionsstop gehabt, und in Deutschland waren das ein Dutzend Jahre. Das darf man nicht vergessen.
Balmes: Von daher ist es sicherlich auch kein Zufall, wenn dieser Neuansatz der Lyrik, den man Mitte der achtziger Jahre feststellen kann, also Kling oder Peter Waterhouse, die Wiederentdeckung auch von Friederike Mayröcker, deutlich aus dem Wieder-zum-Vorschein-Kommen dieses verborgenen Impulses geschehen ist.
Kling: Richtig. Und das geht auch deine vorherige Frage an, nämlich die Frage nach der Erzählverweigerung, ja, also eine gegenläufige Bewegung zu einer schalen Bauchnabelbetrachtung. Das kam bei mir durch frühe Beschäftigung mit den hermetischen Klassikern des 19. und 20. Jahrhunderts, gerade Spanier und Italiener, und das ist natürlich eine wichtige Sache, und wenn dann via Österreich die über meinen Großvater begonnene Beschäftigung mit dem deutschen Expressionismus passierte und dann um 1980 durch Manfred Peter Hein der baltisch-skandinavische Raum für mich erschlossen wurde, dann konnte man natürlich erst mal anfangen zu arbeiten.
Balmes: Das ist sicherlich dann auch die Brücke gewesen für die eigentlich erstaunlich deutlich positive Anknüpfung bei dir an den späten Celan, der ja damals weitgehend abgelehnt worden ist als zu hermetisch, als eine Sackgasse, und der mit seiner grammatikalisch immer nackteren Sprache über eine Inkubation quasi in dieser Wiener Gemengelage für dich lebendig bleiben konnte.
Kling: Da ich Historiker bin und mich mit altösterreichischen Themen sehr viel befaßt habe, also eben auch mit Vielvölkerstaatsgeschichte sozusagen, ist es für mich eine vollkommen klare Sache, daß mich so eine sprachschöpferische Linie von einem, sagen wir mal, Oswald von Wolkenstein, der ja auch in verschiedenen Texten bis zu einem halben Dutzend verschiedener Sprachen miteinander komprimiert, über Jean Paul bis zu Paul Celan, der ja auch ein hohes Interesse an Spracharchäologie gehabt hat, das mich das also da ganz sicher verbindet, und das ist in jedem Fall die positive Linie der deutschsprachigen Literatur. Ich sehe schon, daß es da weitergehen kann. Das zeigen ja auch die Ergebnisse bei einigen Dichtern in den vergangenen Jahren.
Balmes: Was mich damals besonders überrascht und auch gefreut hat, ist, daß dann über diese jungen Autoren, ich nenne jetzt wieder dich und Waterhouse, damals zum ersten Mal wieder sichtbar wurde, was in den siebziger Jahren in kleinen Verlagen abgedrängt war: Oskar Pastior, Friederike Mayröcker…
Kling: Richtig, in beiden Fällen muß man schon von einem Skandal sprechen, daß diese beiden Dichter, die mit Jandl zusammen die wichtigsten ihrer Generation sind, erst so spät rezipiert werden. Der für meine Begriffe aus der mittleren Generation bedeutendste Dichter Reinhard Priessnitz, der ist dazu verurteilt, der ewige Geheimtip zu sein, das ist ähnlich wie mit Konrad Bayer, den kennt man eben auf der Szene, diese 300 Leute, die sich mit dem Gedicht beschäftigen, und danach ist es aus. Und wenn man sich überlegt, daß die FAZ in ihrer sehr schmal ausgefallenen Gratulation zum sechzigsten Geburtstag von Oskar Pastior von einem Geheimtip spricht, dann muß man nachfragen, was wäre dann bei Reinhard Priessnitz der Fall.
Balmes: Für den Wiener Raum war er, wie du mal gesagt hast, ein ganz wichtiges Bindeglied, weg von der sich verknöchernden Wiener Schule, wie sie jetzt noch so weiter tradiert wird wie in Bielefeld, hin zu einer jungen Generation, Franz Josef Czernin oder Ferdinand Schmatz, die das aufgreifen und die ja auch verlegerisch dafür gesorgt haben, daß das Werk überhaupt präsent geblieben ist.
Kling: Das Verdienst von Ferdinand Schmatz als Editor muß man da auch mal klar herausstellen. Ich habe im vergangenen Jahr in Wien festgestellt, als ich mit Germanisten, Mitte Zwanzig, zusammentraf, daß Priessnitz jetzt, knapp zehn Jahre nach seinem Tod, zum Wiener Stadtmärtyrer avanciert ist. Es ist eine tatsächlich sich sprichwörtlich wiederholende Literaturverhinderungskatastrophe. Jetzt wird er ja sehr rezipiert, auch in Deutschland. Ich habe 1986 in Köln an der Universität auf Einladung eines Professors eine Lesung gemacht und habe da die Erwartungshaltung gekippt, indem ich über Reinhard Priessnitz gesprochen habe.
Balmes: Vielleicht noch mal zurück zum Sprachraum. „beabsichtigter sprach- / raum“ heißt es in „notgrabun’“. Diese Absicht, ist die schon Reflex auf die Arbeit, oder ist es der Sprachraum, der sich immer wieder aufdrängt und von dem nicht abzusehen ist?
Kling: Ich sehe mich als jemanden, der der Sprache im Positiven wie im Negativen verfallen ist, der sexuelle Aspekt also, den Artmann einmal erwähnt, zwischen Sprache und Dichter oder Dichterin. Der ist sehr wichtig: Die Sprache meinen und von der Sprache gemeint werden. Da ergibt sich das Unabsehbare und gerade Unabsichtliche eben durchaus, und das ist ja nun nicht am Reißbrett zu entwerfen. Insofern natürlich zum ursprünglichen Programm der Dichtung, eben dem Hermetischen stehend.
Balmes: Dann aber auch getrieben von einer sehr starken Liebe zur Sprache, wenn ich in deinem Motto zu nacht.sicht.gerät. lese von „den zu bodn ge- / hendn landschaftn und sprachräumn“, wo es ja eigentlich immer darum geht, diesen Fall zu notieren, aber auch zu versuchen, der Sprache durch das Röntgen Schatten abzunehmen, diese zu notieren und der Sprache dadurch auch weiter etwas Schwebendes zu lassen. Ich fand es sehr schön bei „notgrabun’“, wenn die Nähe beschrieben wird: „mündung endung schlehen, winters, di / im luftzug stehen als höbe sich etwas / ab:…“, und das ist ja dann die Arbeit.
Kling: Das kann man so sagen, ja. Es ist mir wichtig, ich stamme aus einer Stadt der Werbeagenturen, und über die schnelle Vernutzung durch die Agenturen, also das Cliphafte, auch im Film, darüber habe ich mich nie beklagt, das war ganz klar immer Teil der Entwicklung ab Ende der siebziger Jahre. Ich würde diese Entwicklung niemals bejammern. Ich bin nur dafür, der Sprache dann tatsächlich ihren Raum, wie ich ihn und sie verstehe, einzuräumen.
Balmes: Und vor allen Dingen auch daran zu mahnen, daß es ja gerade in der deutschen Literatur Techniken gibt, die die höhere Geschwindigkeit, die von den Werbern angepeilt wird, ja längst vorgemacht haben, und daß die Werber das nur noch adaptieren. Der Expressionismus war eigentlich kein Thema mehr, und seit geschmacksverstärker ist er wieder eines. Bei dir ja auch sehr stark durch die Beschäftigung mit der Biographie deines Großvaters.
Kling: und seiner Generation.
Balmes: Dieser Rückbezug ist sicherlich auch Ausdruck einer Protesthaltung. Es ist ja die Protesthaltung, die dich an Beuys so interessiert, diese Figur, die einfach im Einbaum über den Rhein paddelt, und es geht ja eigentlich eher um diese Haltung, die da eingenommen wird, um diesen Widerstand, der da agiert wird, als um ein ästhetisches Modell.
Kling: Wobei man natürlich sagen muß, daß mir das Messianische eines Beuys suspekt gewesen ist. Mich hat seine Bodenhaftigkeit, seine Materialarbeit interessiert.
Engeler: Entsteht nicht daraus vielleicht ein ästhetisches Modell, daß es einerseits diese Sache mit der Geschwindigkeit gibt, die du nicht bejammerst, sondern positiv aufnimmst, und daß es auf der andern Seite die Materialhaftigkeit und Sinnlichkeit der Sprache gibt, von der du sagst, daß man ihr ihren Raum einräumen muß, wobei das dann eigentlich ein gegenläufiges Moment ist, ein beharrendes, ein haftenbleibendes Moment, so wie diese Lexikoneintragungen ja auch Einfrierungen sind von einem gewissen Wissensstand an einem bestimmten Punkt, und kombiniert mit der Geschwindigkeit erzeugt das dann eine seltsame Spannung.
Kling: Man sollte in jedem Fall in einer Zeit, wo sich das Covern so verselbständigt hat, in immer kürzeren Abständen geschieht, sollte man in jedem Fall sehen, daß man da in andere Sprachschichten einsteigen kann, ohne jetzt auf den Kalender zu gucken, wer in zwei Jahren wiederentdeckt wird. Da macht sich ganz einfach bemerkbar, daß man seit zwanzig Jahren liest, fertig.
Engeler: Ist das dann die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Sprachschichten, die du bei der Arbeit erlebst?
Kling: Natürlich, genau das interessiert mich.
Balmes: Wie du einmal zu Wolkenstein gesagt hast: „polylingual“.
Kling: Ja, eben das Einsetzen jeder Fachsprache und jedes Jargons, der existiert. Man müßte einfach heute das 1879 ausgerottete Tasmanisch wieder erfinden. Bumm.
Balmes: Diese ganzen Kurzfilme aus Gefrierschnitten, die du manchmal vorzuführen scheinst, besitzen aber immer wieder Punkte aus Stille, die die Mitteilung fast wie einen Kranz umgeben. Mir war das zum ersten Mal aufgefallen bei dem Andy-Warhol-Gedicht, wo es heißt: „lag / da die zeitung foto / kreuz ich / brauchte nichtmehr nachzu / fra“.
Kling: Wenn ein Kritiker mir vorwirft, daß in brennstabm die Herkunft einer Fotosequenz nicht genannt wird und dabei nicht erkennt, um was es sich dabei überhaupt handelt, nämlich um nichts anderes als ein Gemäldegedicht, was um eine ganz bestimmte und sehr bekannte Fotografie geht, dann hat ein Kritiker einer führenden Zeitung da nicht zu schreiben.
Balmes: Gerade dieses Gedicht, „Aufnahme Mai 1914“, bei dem die Abstoßpunkte in diesen anonymen Fotografien so deutlich sichtbar sind, war für mich einer der Drehpunkte in der Lektüre des Buches, weil da optisch noch einmal deutlich wird, welcher Reichtum an Bildern hinter dieser Lyrik steht, die diese Gedichte immer sehr stark so verknappen und zusammenstauchen, daß es den Leser, der zum ersten Mal damit konfrontiert wird, in der Geschwindigkeit überfordert und ihm eigentlich zuviel gibt. Diese Stauchung des Bildrhythmus hat für mich sehr viel damit zu tun, was du einmal bei Wolkenstein als einen „durchrhythmisierten realismus“ benennst. Wenn es um Situationen geht wie die Straßenbahnfahrt im geschmacksverstärker, ist das als Vorstellung wohl am ehesten noch nachvollziehbar, weil da der Erlebnisgrund des Gedichtes in der Straßenbahnfahrt noch mal dargestellt wird. Das ist nicht immer so und wird immer mehr in den Text einverlagert. Dieser Rhythmus, dieses schnell hintereinander geschaltete Sprechen mit verschiedenen Zungen, die Stauchung der Bilder bis hin zum Enjambement, das auch die Regeln der Silbentrennung überspringt, damit es noch augenfälliger wird, das sind ja die zentralen neuen Errungenschaften, mit denen deine Bände aufgetreten sind.
Kling: Ich folge da eigentlich sprachgeschichtlich dem Faktum, daß Rhythmus vor Metrik da ist, und es ist ja so, daß in der griechischen Klassik der Rhythmus drei Dinge umfaßt: zunächst mal die Sprache, dann erst die Musik und dann den Tanz. Diese Partiturhaftigkeit, das sind wirklich Zäsuren im Text, wie ich sie dann auch spreche. Das geht also über eine optische Irritation hinaus. Diese Sprachflußunterbrechung, das wäre eine Ebene.
Balmes: Das ist ja das, was man am Anfang nicht so deutlich gesehen hat, wo man einfach den Verdacht gehabt hat von O-Ton und das Gedicht zu sehr als ein Hörstück begriffen hat und dann nicht so sehr in den Blick bekam, wie weit das selbst zur Produktion gehört.
Kling: Nein, das ist ein Mißverständnis, das mir immer noch zu folgen scheint. Es wird einfach nicht erkannt, daß es sich zu 90 Prozent immer um inszenierten O-Ton gehandelt hat. Es ist also nicht so gewesen, daß ich zu Düsseldorfer Zeiten an der Theke vom Ratinger Hof gestanden und mir dann nachher die Bierdeckel in die Tasche gestopft hätte. Das ist eigentlich sehr ulkig, daß das von vielen Seiten nach wie vor nicht gesehen wird. Es gibt nach wie vor in meiner Wohnung keinen Fernseher, und Radio gibt es auch nicht mehr. Das muß man sich alles selber ausdenken, na klar.
Engeler: Das Enjambement ist also eine Unterbrechung des Sprachflusses.
Kling: Es ist im gleichen Atemzug als Pausenzeichen gedacht, wie es Zeichen ist für Zerstörung der Zeichen.
Balmes: Es kann ja auch Dehnung produzieren, z.B. „das rei / ne wohnzimmer-voodoo“.
Kling: Das entspräche dem, was man mit elektronischen Mitteln an Sprachverfremdung, an Fading reinbringen würde, die Dehnung als Zerdehnung.
Engeler: Eine Funktion der Sprachverfremdung kann dann ja sein, daß was anderes aufscheint.
Kling: Das kann passieren, ja. Und wenn im „russischen digest“ eine Pause entsteht, wenn es um Servierpersonal geht, das sich Zeit läßt, den čaj zu servieren, dann ist es einmal eben ein ironisches Stilmittel. Es gibt also ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Balmes: Bis hin zum Nachvollzug des Bildes: „wr / akk“, eines der härtesten.
Engeler: Was ich an deinen Gedichten immer sehr interessant fand, ist die Zerdehnung, die es bei dir auf verschiedenen Ebenen gibt. Es gibt die Zerdehnung auf der phonetischen Ebene, wo sich aus einem Wort ein anderes ergibt, oder auf der akustischen Ebene, wo im Mißverstehen eines Wortes oder im undeutlich Sprechen ein neues Wort auftaucht, und mit diesem neuen, diesem andern Wort arbeitest du dann ja auch weiter, das nimmst du auf.
Kling: Das trivialpsychologische Moment des Verlesens, auf das Friederike Mayröcker hingewiesen hat, ist natürlich manchen Akademikern ein Graus. Für mich ist das eine absolute Delikatesse. Da ist sehr viel Brauchbares dabei, und das setz ich zum Teil dann schon eiskalt ein, was wie vieles andere wohl in meinen Texten diesen Akademikern ein Graus ist, wenn ich das richtig sehe.
Engeler: Mit dem Versprecher kommt auch die Frage nach der Kontrolle mit rein, indem sie im Versprecher ja gerade ausgesetzt ist. Wie gehst du mit dieser Frage im Arbeitsprozeß um? Du scheinst sehr kontrolliert zu sein, das aber wiederum erlaubt dir den Versprecher nicht.
Kling: Da geht es aber los, daß man sich dann zügelt. Ich bin ein sehr spielerischer Mensch, und es gibt eben dann die Arbeitsphasen, wo ich mir von meinem Nervenkostüm her nicht erlauben kann, nicht kontrolliert zu arbeiten, vielmehr hochkontrolliert am Terminal sitze, sozusagen.
Balmes: Das ist ja alles auch eine Arbeit hin zu einer größeren Anreicherung von Sprache. Wir sprachen vorher vom Rhythmus, der vor der Metrik kommt. Ich hatte aber oft auch den Eindruck, daß der Rhythmus der Gedichte noch vor der Sprache kommt in dem Moment, in dem das Stürzen der Wahrnehmung Bilder produziert, die dann auch in Sprache übersetzt werden müssen, und ich glaube, dieses In-Sprache-Übersetzen ist dann die kontrollierte Arbeit, wo das ganze Material als Instrumentarium, als Werkzeug eingesetzt wird.
Kling: Es entsteht da schon, auch heute noch zum Teil immer wieder, ein schnelles Summen, eine Rhythmisierung von Realien, die mir sehr wichtig ist und vom Leser eigentlich mitgehört werden sollte. Das wäre ein idealer Leser.
Balmes: Das könnte dann auch erklären, daß der Rhythmus manchmal gegen die Sprache agiert, gegen die Sprache in ihrem Verlauf, und sie so zu neuen Wendungen auch zwingt.
Kling: Richtig, ja.
Engeler: Dabei kommen dann auch wieder Realien heraus, mit diesem Widerstand der Neukreation.
Kling: Ein dummes Mißverständnis wäre, meine Literatur als eine geschredderte aufzufassen. Das ist vollends daneben.
Engeler: Es geht ja eigentlich um eine Synthetisierung von Erfahrung, die wieder aus dem Sprach bild rausspringt, das meinte ich mit den Realien…
Kling: … unter Umgehung von Allegorie im klassischen Sinne und einer saturierten Metaphernhaltigkeit im Sinne von einer seit Dekaden sehr kompliziert gewordenen Genitiv-Metapher…
Engeler: … weil die nur noch Konvention ist und nicht mehr Erfahrung?
Kling: Die Metapher eignet sich nicht, daß sie runterkommt zum Ornament.
Balmes: Dann gelte es, dem Rhythmus zu folgen und ihn vor jeder Zuschüttung zu bewahren. Das ist ein Verfahren, das du in einem Gedicht auch mal ansprichst als „einzelbildschaltung“. Du hast eben das Enjambement erläutert mit dem Hinweis auf verzerrende Techniken. Aber das sind für dich eigentlich Metaphern, um dein Verfahren zu zeichnen, du hast nicht selber mit Videos oder Sprachverzerrern experimentiert?
Kling: Nein, das hab ich nicht gemacht, ich hab mich in meinem Metier immer auf das Schriftliche verlassen, und dann natürlich auf den Vortrag. Aber Film ist natürlich eine interessante Angelegenheit, besonders der frühe Film für mich, der große epische Stummfilm, insofern als mir da eben damals neue Erfindungen wie die Überblendungstechnik begegnen. Als Jugendlicher habe ich sehr viel Kurzwelle gehört, andere Kontinente, und dann hat man so Frequenzspiel, da hat man auch die Feinschaltung. Das ist ja so, als würde der Cartoon-Gangster den Tresor aufschrauben, denn sonst ist man schon wieder weg, ist man schon wieder in einer anderen Zunge gelandet.
aus: Zwischen den Zeilen, Heft 4, 1994
Thomas Kling
Ebenso verhält es sich mit den Dichtern. Den Sprachkörper, höret, sie mögen ihn roh. Das Fell; über die Ohren ziehen sie es. Hände und Füße abgetrennt knabbern sie Silben. Haut für Haut schichten sie. Sprachlage um Sprachlage pressen sie zwischen Buchseiten. Trockenfleisch. Sprachhaut. Sprache fressen, in sich Sätze bergen, alles schlucken und anverdauen, was zu bekommen ist. So jedenfalls verstehe ich mich, lass mich beschimpfen, lebe am Gesellschaftsrand gequetscht, übe die Sprache der vielerlei Zungen, die aus mir schreien, halte ich den Mund verschlossen.
Fazit also: In unseren Sprachgefilden, Sprechwäldern, Literaturgebirgen, Wortgebieten würde Rotkäppchen nie auf einen Wolf stoßen, noch könnten sie sich verstehen. Sie würden sich nichts angehen, noch er es angehen.
Peter Wawerzinek
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest „Oh Nacht“ [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb + PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D + Internet Archive + IZA + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: Berliner Zeitung ✝ Der Freitag ✝ Der Tagesspiegel ✝ Die Welt ✝ einseitig ✝ FAZ ✝ FR ✝ KSTA ✝ Neue Rundschau ✝ NZZ ✝ Perlentaucher ✝ text fuer text ✝ Schreibheft ✝ Die Zeit ✝ Grabrede ✝
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


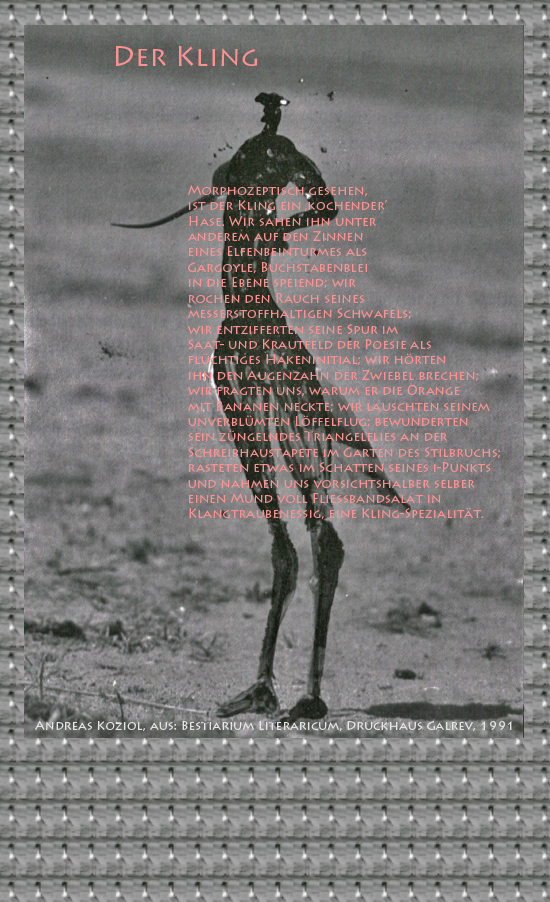












0 Kommentare