Durs Grünbein: Vom Schnee oder Descartes in Deutschland
7. SELBSTPORTRAIT ALS LEERER TELLER
Wie kann das sein? Derselbe Spiegel, der mir früh
Im Winterlicht am Kinn die schwarzen Stoppeln zeigt
aaaaa–
Jetzt steht er grau, ein Glas halbvoll, am Fensterbrett.
Und nichts verrät, wie eben noch im
aaaaaStreichholzglühn,
Was er enthielt: mein Bild, die Psyche, tief verzweigt.
Mein Konterfei, herausgeschält aus Nacht und Bett.
Jetzt scheint er blind. Im Staub ein bloßer Scherben dort
In meinem Rücken. Dabei weiß ich nur zu gut:
Sein Glas schöpft weiter, heimlich, aus der Bilderflut.
Nur ich bin hier – an einem ungenannten Ort.
Ich weiß genau, ich bin. Auch wenn er mich verschluckt
Mit Haut und Haar. Wie ich verschluckte fast vor Lachen
Den Rebhuhnknöchel. Beinah wär ich dran erstickt.
Ein Spiegel hat, wohl wahr, kein Liderpaar, das zuckt.
Nichts sticht ihm je ins Auge. Diesen klaren Schacht
Muß jedes Bild hinab. Du brichst dir das Genick
Beim Sturz kopfüber in den kalten Silbersee.
Merkwürdig nur, wenns ihn nicht gäb, Ihr wüßtet kaum:
Wie sieht er aus, der zu Euch spricht? Wie dort im Schnee
Die Hasenspur wärt Ihr nur Ornament im Raum.
Und doch, es schmerzt. Wundherde, Eingeweide sind,
Zahnhälse, freigelegt, kaum schauriger als dies.
Jetzt gähnt ein Tisch, ein Teller blinkt, wo sonst die Stirn
So unerforschlich leuchtete – mein eigenes Gesicht.
Es ist nur Glas, scheints. Und doch droht es dir: verschwinde.
Es ging zu Bruch, als sie beim Putz dagegen stieß.
Nun schneidet es die Schneelandschaft, in der das Hirn
So weich versinkt. Du drehst dich um – es gibt dich nicht.
Dein Kragen glänzt, der Schopf, wie Schweineschmalz. Brutal,
Ein Zacken Glas, hält die Materie über dich Gericht
Sub specie aeternitatis – aus dem Hinterhalt.
Im Gleichgewicht, wie auf den schilders aus dem Norden,
Stehn Ding und Mensch. Es schneit. Merkt Ihr was, Philosoph?
Was man im Süden klangvoll chiaroscuro nennt,
Das Hell und Dunkel, hilft es nicht, Euch zu verorten?
Gefangen sitzt Ihr, Euer Doppelgänger, in den Strophen
Von einem, der Euch schlecht aus Euren Büchern kennt.
Die Wette gilt: ob wohl die Nachwelt Euer Bild verzerrt?
Für alle Zeiten hält demnächst Franz Hals Euch fest,
Im Ölportrait. Ihr wurdet, Meister, weit verehrt,
Als die Visage dort längst Abgrund war und Palimpsest.
Ihr seid nun dort… wo Zeit nur heißt – Gespiegeltsein.
Der Abstand wächst. Von Euch zu Euch, von Euch zu mir.
Schatullen schimmern da, Goldknöpfe, Rembrandts Augen,
Wie die Reflexe auf dem Schlüsselbund, mit sich allein.
Und wie der Schnee, posthum, strahlt Ihr aus dem Papier
Mit jedem Wort, vom Sand der Sanduhr aufgesaugt.
Nun könnt Ihr, von der Welt verlassen, Euch entziehn.
„Mitnichten, Freund. Die Weltflucht geht mir contre cœur.“
Ihr gleicht dem Arzt von Dou, der dort den Kolben voll Urin
Im Taglicht prüft. Den im Gefäß die Trübung stört.
Ein klarer Fall. Man sieht die Schärpe, das Diplom,
Und ahnt, das Schicksal kommt aus einer ruhigen Hand.
Der Anschein trügt. In der Karaffe geht mit jedem Schluck
Zur Neige das Portrait. Sein eigenes Arom
Hat jeder Augenblick und jeder Tag. Äquidistant
Bleibt eins zum anderen, und jedes Ding ist sich genug,
Auch wenn A’ und A im Spiegelglas sich decken –
Zum Greifen nah. Ihr wißt, sie sind doch weit entfernt.
Der Rock am Haken, unterm Tisch das Kohlebecken,
Und selbst der Weidenkorb kreist um den eignen Kern.
Lehnt Euch zurück. Charakter heißt – man balanciert
Auf schmalem Grat. Tritt aus dem Schatten für Momente.
Ein Teil von Euch bleibt immerfort im Dunkeln, blind.
Der andre wird, bei Licht, von lauter Spiegeln filetiert.
Mehr ist da nicht. Daß Euch kein Fensterkreuz je kennt,
Nehmts hin. Es ist ein Vorgeschmack auf das Verschwinden.
Der Schemel dort, der Krug sagt Euch: Ihr kehrt nie wieder.
„Fort mit dem Ding!“ „Eh Ihr Euch auflöst ganz in Schrift,
Geht an die Luft, Monsieur. Was Euch das Glas erwidert,
Ist nur der Blick, in dem ein Leib auf sein Bewußtsein trifft.“
Inhalt
„In welchem schneebedeckten Jahrhundert, mit Fingern / Steif / auf bereifte Scheiben gemalt, erschien dieser Plan / Zur Berechnung der Seelen?“, schrieb Durs Grünbein vor Jahren in einem Gedicht mit dem Titel „Meditation nach Descartes“. Der Held und das Leitmotiv des Gedichts sind nun zurückgekehrt in Form einer langen Eloge auf den Philosophen. Mehrere Winter lang hat der Autor an einem Poem gearbeitet, das nun vollständig vorliegt mit 42 Cantos, die den Kapiteln eines Romans entsprechen. Vom Schnee umkreist jenen Moment im Leben des René Descartes, da dieser im Winter des Jahres 1619 in einem süddeutschen Städtchen, einer Vision gehorchend, zu philosophieren beginnt. Das Erzählgedicht endet in einem anderen Winter, 30 Jahre später, mit dem plötzlichen Tod des Philosophen. In fortlaufenden Szenen werden Jugend und Reife des großen Denkers an der Schwelle der Neuzeit ineinandergespiegelt nach der Regie eines Traums.
Vom Schnee oder Descartes in Deutschland ist vieles. Ein Bilderrätsel; eine Unterhaltung in Versen, eine Hommage an die kälteste Jahreszeit und die Lehre von der Brechung des Lichts. Ein Bericht von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges und von der Geburt des Rationalismus aus dem Geist des Schnees.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Vom Schnee
1
Vom Schnee oder Descartes in Deutschland ist nur auf den ersten Blick ein Stück Poesie, das aus Alexandrinern besteht. Tatsächlich hat der Vers hier die Funktion einer Variablen. Wie stellt man Philosophieren dar? Es geht um die Frage, wie aus Logik Rhetorik werden konnte, aus Inspiration Begriffsgeschichte und darum, wie es sich angehört haben mochte, als das Denken zum ersten Mal jede Gewißheit des Denkens aufgab. Auf eine Gattungsbezeichnung ist von seiten des Autors bewußt verzichtet worden. Wie hätte er auch nennen sollen, was sich da unter der hand zu einer Studie von annähernd dreitausend Verszeilen auswuchs? Einen Roman in Strophen? Ein langes Erzählgedicht? Eine Versnovelle? Vom Schnee ist vielerlei, doch zuallererst ein Werk lyrischer Stereoskopie. Die Überlagerung verschiedener Gedankenschichten soll im Kopf des Lesers einen räumlichen Effekt erzeugen. Darüber hinaus ist es ein Bilderrätsel, ein Stück Gedankenmusik, eine philosophische Unterhaltung, auch ein Lobgesang auf die kälteste Jahreszeit sowie auf die Lehre von der Brechung des Lichts. Es ist ein Bericht von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges und ein Traktat vom neuen Menschen, das Protokoll der Geeburt des Rationalismus aus dem Geist des Winters oder – weiter nichts als eine Schneeballschlacht in Versen.
2
Warum Descartes? Weil er der Initiator ist neuzeitlicher Erkenntnisphilosophie. Den Vater des Rationalismus hat ihn Nietzsche genannt. Und Hegel streut in seiner Phänomenologie des Geistes die anerkennende Bemerkung ein, daß wir, bei Descartes angelangt, wie der Schiffer nach langer Fahrt, endlich Land-in-Sicht rufen können. Descartes gilt als der Erfinder des Subjekts. Sein methodischer Zweifel war es, der die Kettenreaktion ausgelöst hat. Mit ihm fängt in Europa ein neues Zeitalter an in den Wissenschaften von Weltall und Erde, Natur und Mensch. Als Denker ist er etwa so originell, so einflußreich wie vor ihm Luther und nach ihm Darwin, Marx oder Freud.
Ossip Mandelstams kühner Vergleich trifft, was das zarte Nervengeflecht aus Poesie und Philosophie angeht, ins Zentrum. In seinem Essay Gespräch über Dante aus dem Jahr 1933 heißt es bezüglich der Metapherntechnik des Autors der Göttlichen Komödie:
Ich vergleiche, also bin ich, hätte Dante sagen können. Er war der Descartes der Metapher. Denn für unser Bewußtsein (und wo ein anderes hernehmen?) offenbart sich die Materie nur über die Metapher, es gibt kein Sein außerhalb des Vergleichs, denn das Sein selber ist Vergleich.
3
Der Vergleich, das Gleichnis, schmiedet die endlose Kette der Wesen und Dinge. Ob Poesie oder Philosophie, das Verfahren bleibt ein und dasselbe. Rene Descartes hat in seinem Discours de la Méthode gezeigt, wie man es anwenden kann im Dienst der Vernunft. Cognitio (der Denkakt) ist jene Lichtung, die man aus zwei Richtungen kommend betritt, ein Ort, wo die beiden Hauptwege des Denkens seit dem Mittelalter sich kreuzen. Deductio der eine (die schrittweise logische Ableitung), intuitio der andere (die wundersam unmittelbare Einsicht ins Ganze). Ihnen voraus geht perceptio (Erkenntnis als sinnliche Wahrnehmung). Sie könnte ebensogut auch poiésis heißen – handelnde Anschauung, Dichtung als gestaltende Phantasie.
Das Gute an Vergleichen ist: Sie lassen sich jederzeit umpolen. Mandelstams Spruch, um 180 Grad gedreht, lautet dann: Wenn Dante der Descartes der Metapher war, dann war Descartes – der Dante der neuzeitlichen Wissenschaft. Ein Philosoph, der wie jeder gute Dichter sein Werk mit Selbstbeobachtung begann. Bei ihm sagt das Denken, jenseits von Platon und Augustinus, zum ersten Mal radikal ich. Mit ihm beginnt die Autobiographie des modernen Geistes. Der Geist besinnt sich, unterm Schuppenpanzer der Scholastik in seiner ganzen Willenskraft auf sich selbst. Er spielt fortan nach eigenen Regeln. Intellekt und Imagination stehen einander nicht länger im Wege. Vollkommen unpassend ist daher die Schmähung, mit der Gottfried Benn den französischen Philosophen bedachte. Vom „Intellektualverbrecher“ sprach er und wiederholte damit doch nur das Vorurteil über den eigensinnigen Denker, als wäre die Selbstermächtigung des Geistes eine Sünde wider die Schöpfung und nicht vielmehr Teil ihres Programms. Es ist das Zerrbild vom Vivisekteur, der in kalter Neugier die Schleier zerreißt. Übersehen wird dabei das Wundersame: Daß der Weg zu den modernen Naturwissenschaften über Traumpfade führte.
4
Ein Wort noch zur Poetik des Raumes in dieser Verserzählung. Ort der Handlung ist jene schlichte Kammer (ein Bett, ein Kachelofen, ein Schreibtisch, ein Lehnstuhl), in der ein zeitreisendes Kind augenblicklich zu Hause ist. Genauer: in der jeder Mensch, der als Kind unter der Bettdecke nachts die ersten Bücher verschlang, sich so gleich heimisch fühlt. In dieser Zelle, klösterlich still, die Wände vom Schnee gedämpft, währt ein Jahrhundert so lang wie ein Tag. Das Gedicht kreist um die Aufhebung der Zeit, es liefert ein Abbild des innersten Raumes, in den der Mensch sich so gern verkriecht, um mit sich allein zu sein und ungestört seinen Gedanken nachhängen zu können. Dabei hält es sich, allem Zeitreisen spielerisch aufgeschlossen, streng an die aristotelische Einheit von Ort, Handlung und Ablaufzeit.
In seiner Poetik des Raumes hat Gaston Bachelard, der französische Literaturanthropologe, das Geheimnis beleuchtet, wie Phantasie sich ihr ideales Nest selbst erbaut. Er spricht es mit den Worten des Dichters Baudelaire aus:
Macht eine hübsche Wohnung nicht den Winter poetischer, und vermehrt der Winter nicht die Poesie des Wohnens? Das weiße Cottage hockte im Grunde eines kleinen Tales, von genügend hohen Bergen abgeschlossen; es war mit Gesträuch gleichsam umwickelt.
Die Stelle findet sich in Baudelaires Aufzeichnungen mit dem sonderbaren Titel Die künstlichen Paradiese. Dieser liefert uns den Schlüssel für die hier angesprochene Eigenschaft literarischer Räume: ihre Außerweltlichkeit und glückhafte Intimität, das Wunschbildhafte und Urvertraute an ihnen, das sie zu idealen Orten des Rückzugs macht, wie jeder noch von den kindheitsfrühen Stunden des Schmökerns her weiß. Doch worauf bezog sich die kleine Szene im Tal? Baudelaire verrät uns viel, indem er mit ihr auf einen seiner exzentrischen Geistesbrüder anspielt, den englischen Bewußtseinsreisenden Thomas de Quincey, der im Opiumrausch und vom Winter eingekesselt (in doppelter Isolation von der Welt also) sich der Lektüre Immanuel Kants hingab. Dieselbe Versuchsanordnung, könnte man sagen, dieselbe winterliche Philosophiestunde, nur viele tausend Träume später und an einem ganz anderem Ort.
„Jenseits des bewohnten Hauses“, folgert Bachelard, „ist der winterliche Kosmos ein vereinfachter Kosmos.“ Und weiter:
Durch ein Wort, das bloße Wort Schnee, wird für das geschützte Wesen das All ausgedrückt und zugleich ausgelöscht.
Descartes selbst spricht im Discours von den „espaces imaginaires“, die ihm die Einbildungskraft zaubert. Vom Schnee spielt in einem dieser heimeligen imaginären Räume, wo alle Menschheitsferne zu familiärer Nähe schrumpft. Dort wird im Kerzenschein das bereifte Fenster zur Laterna magica.
Das Bett erscheint dort, als was es immer schon war, die Wiege frischer Ideen, und der Schreibtisch wird zum Schlitten, mit dem ein Mensch nachts selig durch die Finsternis saust.
5
Aber Vorsicht: Auch dies ist noch lange nicht das letzte Motiv. Ein böses Glitzern und Funkeln geht von der Schneedecke aus, die jenes siebzehnte Jahrhundert bedeckt. Noch war Europa bis in südliche Breitengrade fest im Griff eines Kälteeinbruchs, dem spätere Meteorologen den Namen Kleine Eiszeit gaben. Religionskriege zerrissen den Kontinent, stürzten Herrscherhäuser und schufen die erste Republik (in der Descartes sich die längste Zeit seines Lebens aufhielt – Amsterdam, das Zentrum dieser unerhörten Liberalität, war ihm „ein Inventarium des Möglichen“). Le dixseptième siècle: Damals fuhr die Menschheit auf den Weltmeeren ihrer ersten Globalisierung entgegen, mit Koggen und Galeonen, Dschunken und Dreimastseglern. In Südostasien und Südamerika waren Handelsstützpunkte entstanden, an denen das Silber Perus gegen die Luxusgüter Chinas getauscht wurde, Seide und Porzellan. Es gab Schiffe wie die holländische Sperwer, die mit einer Ladung Pfeffer und 20.000 Rehfellen unterwegs war von Taiwan nach Nagasaki. Es war das Zeitalter der Schiffbrüche in tropischen Gewässern, an Javas Küste oder vor Madagaskar, fern im „Oceanus Orientalis“, wie der Erdglobus auf einem Gemälde Vermeers ihn verzeichnet. Abenteurer, mit Musketen bewaffnet, holten aus den Wäldern Kanadas die begehrten Biberfelle und dezimierten zum Dank die dortigen Ureinwohner. Die Passagiere der „Mayflower“ brachten ihre ersten Ernten ein, auf Indianerland. Descartes’ große Entdeckung traf mit der Geburt einer neuen Welt zusammen, und was aussah wie Koinzidenz, wird uns erst heute als Abgrund sichtbar. Der Geist war nun los, der große Ordner und Zerstörer, und er drang in alle Lebensbereiche vor. Mit leichtem Gerät, empfindlichen Meßinstrumenten schuf er neue, unsichtbare Fronten, streckte die Fühler aus mit Sextant und Himmelsfernrohr, Tasterzirkel und Mikroskop. Er war nun unwiderstehlich geworden, ließ nichts mehr ungeschoren, auch nicht den Glauben. Er hatte sich, in all seiner wankelmütigen Schönheit, der Welt als weltzerstörerisches Prinzip offenbart.
Durs Grünbein, aus Durs Grünbein: Aus der Traum (Kartei). Aufsätze und Notate, Suhrkamp Verlag, 2019
Dann leg im Geist dich in die Kurve
– Wie René Descartes das moderne Denken erfand: Vom Schnee, ein kongeniales Langgedicht von Durs Grünbein. –
Bald wird man Durs Grünbein in Schutz nehmen müssen. Zu bereitwillig war er in die Rolle des ebenso jungen wie gelehrten Dichters geschlüpft, als dass nun, da man ihn für reichlich erwachsen halten muss, nicht mancher auf den Gedanken käme, im offensiven Bekenntnis zur Gelehrsamkeit vor allem die Technik des persönlichen Erfolgs zu erkennen. Zu sehr war dieser Dichter zum Helden der Bildungsbeflissenen geworden, zum neunmalklugen Tausendsassa, der einen nickelbrilligen Hasen nach dem anderen aus den tiefen Taschen der Philosophie, der Naturwissenschaften oder der Literaturgeschichte holte. Doch kommt gegenwärtig der Grobianismus gut voran, er will Durs Grünbein für seinen frühen Aufstieg büßen lassen. Dem Dichter geschieht dabei Unrecht, und den Banausen ist ein solcher Triumph nicht zu gönnen. Schon gar nicht aus Anlass dieses langen Gedichts. Ein Virtuose der lyrischen Form hat es geschrieben, der in beliebigen Rhythmen durch die Verse zu staksen, zu stolpern oder zu rauschen vermag, ganz wie es ihm gefällt. Er findet seltene Reime, und wenn ihm das Register der lautlichen Parallelen in den deutschen Endsilben zu klein dünkt, dann erweitert er es, indem er die männlichen mit den weiblichen Reimen mischt. Oder er lässt ein paar Reime aus, kaum dass man dies bemerkte.
Wo war das noch und wann?
Grünbein ist ein Meister der leicht angeschrägten, aber um so präziseren Assoziation:
Das Jahr ist alt geworden und vergeßlich. Niemand zeugt
Für all die Vielfalt, die vor Tag im Schnee verschwand.
Zwei Männer, selbstvergessen, trotten wie betäubt
Vorbei an Weiden, die wie Keulen, Morgensterne drohn.
In diesem Langgedicht in zweiundvierzig Cantos oder Kapiteln, ein jedes aus sieben Strophen zu je zehn Zeilen bestehend, hat der Dichter einen so großartigen, hinreißend schönen und erstaunlich lebendigen Stoff gewählt, dass ein paar Peinlichkeiten der jüngeren Zeit, die Übersetzung der „Sieben gegen Theben“ von Aischylos etwa, sofort aus dem Gedächtnis verschwinden.
Kaum zweiundzwanzig Jahre alt ist der französische Edelmann René Descartes, als er in der Armee des Prinzen Moritz von Nassau-Oranien in den Dreißigjährigen Krieg zieht. Im Herbst 1619 schlägt seine Einheit in Neuburg bei Ulm ihr Winterquartier auf. Dann fällt der Schnee, in Massen, die Wege werden unpassierbar, kein Brief kommt mehr durch. In einer „Ofenstube eingeschlossen“, die Tage vertrödelnd, soll den jungen Soldaten hier, dem autobiographischen Bericht des Discours de la méthode von 1637 zufolge, der Einfall überkommen haben, mit dem die neuzeitliche Philologie beginnt:
Auf einen Schlag, so sagt Ihr, mitten in der Nacht
Hat Euch ein Geistesblitz erweckt.
Gelten soll fortan nur, was der Zweifel übriglasse, lautet die neue Maxime. Gewiss sein soll nur, was klar und deutlich erkennbar sei. Wahr sein soll nur, was man in mathematischer Form darstellen könne. Die Geistesgeschichte lehrt, dass so das rationalistische Zeitalter beginne, wobei man sich den Verstand in diesem Fall als eine sehr mechanische Einrichtung vorstellen muss. Tatsächlich aber beginnt so vor allem die moderne Metaphysik: das Denken über das Denken.
Wo war das noch und wann? In einem hellen Augenblick
Hat er das Gleichgewicht der Welt gespürt – im Schnee.
Diese Zeilen sind von tiefer, allzu begründeter Zweideutigkeit. Denn der radikale Skeptizismus, den René Descartes mit einem „Heureka“ entwirft, ist ein durch und durch negatives Programm. Er ist, anders als der Philosoph erhoffte, ein tatsächlich unendliches Ausschließen. Anstatt dass nach einer Weile hartnäckigen Zweifelns etwas zweifellos Verbürgtes übrig bliebe, ist am Ende gar nichts mehr da. Der Schnee ist eine kühne, aber überaus treffende Metapher für das, was dieser methodische Zweifel seinen Gegenständen antut. Er raubt ihnen die Kontur, er deckt sie zu, bis von ihnen nichts mehr zu sehen ist, er schickt sie in die endlose, weiß-graue Leere eines langen Winters:
Vom Frost geputzt der Zeichentisch – ein idealer Boden
Für den Discours, Monsieur. Allez! Für die Methode.
Empathie scheint der Dichter für seinen Helden zu empfinden, doch gemeinsame Sache mit ihm macht er nicht.
Grünbein hat sein Gedicht zweigeteilt. Die ersten einunddreißig Cantos siedelt er in Neuburg an der Donau an, Sprünge in andere Zeiten und an andere Orte eingeschlossen:
Man ist in Deutschland. Es herrscht Krieg. Im Frost erstarrt,
Steht vor dem Fenster schwarz, ein Bataillon, der Wald.
Bestimmt wird dieser Teil von Dialogen mit dem erfundenen Diener Gillot, einem frühen Verwandten des fatalistischen Jacques, der stets nur den Körper im Sinn hat, wenn sein Herr vom Geist reden will. Der zweite, kürzere Teil spielt dreißig Jahre später im winterlichen Stockholm, wohin Königin Christine von Schweden das „Murmeltier“ gerufen hat, um sich morgens um fünf Unterricht in Philosophie geben zu lassen:
Hier heißt er snö. Ein Laut der in der Nase kitzelte
Wie eine Prise frischen Tabaks. Dieses ,Hö, hö, hö‘
Klang sehr vulgär.
Der Philosoph überlebt die Lektionen nicht. Der Tod, sagt der Dichter, unterliegt keinem Zweifel.
Es passiert viel in diesem Gedicht. Gustav Adolf von Schweden stirbt in der Schlacht bei Lützen. Der Blutkreislauf wird erläutert. Galilei Galileo scheitert am päpstlichen Gericht. Der Diener bewahrt eine Magd davor, ins Feldbordell verschleppt zu werden. Die Philosophen Thomas Hobbes, Pierre Gassendi und René Descartes trinken Burgunder. In den Niederlanden werden Winterlandschaften gemalt, die später im Museum hängen. Durs Grünbein geht ins Detail, so sehr, dass der Leser sich zuweilen einen Kommentar wünscht, der ihm die weniger selbstverständlichen Anspielungen erschließen könnte.
Auch dieser Reichtum ist beabsichtigt. Nicht nur, weil er wirkt, als dränge von überall her die Konkretion herbei, die das Denken in mathematischen Formen ausschließen soll. Sondern vor allem, weil der methodisch operierende Zweifel ein fahriges, unsystematisches, von Einfall zu Einfall, von Szene zu Szene, von Prüfung zu Prüfung springendes Denken zur Folge hat, ohne doch je zur Ruhe kommen zu können, allen Idealen einer skeptischen Gelassenheit zum Trotz.
Kippfiguren der Unsicherheit
Die Poesie bekommt hier etwas zu fassen, was sich die Geistesgeschichte gern entgehen lässt, wenn sie René Descartes zur Gründergestalt des neuzeitlichen Rationalismus erhebt. Die Maxime „Im Zweifelsfall – halt dich am Zweifel fest“ bietet alles andere als Gewissheit, und das cogito ergo sum, der größte Gassenhauer der Philosophie, lässt sich auch als Fluch verstehen: als Verpflichtung zum Grübeln. Vielleicht ist das Leben nur ein Traum? Vielleicht leben wir nur im Traum eines anderen? Und wer träumt den anderen? René Descartes ist nicht deshalb zur Gründergestalt des modernen Denkens geworden, weil er ihm ein paar Antworten gefunden, sondern weil er seine Probleme erfunden hat – denn so, wie er seine Fragen stellt, müssen sie unlösbar sein.
Durs Grünbein bietet nun sein ganzes, großes lyrisches Können auf, um den raschen Wechsel zwischen methodischem Zweifel und sinnlicher Gewissheit, diesen Kippfiguren radikaler Unsicherheit, sinnfällig werden zu lassen:
Ja, ja. Nein, nein. Habt ihr nicht oft geklagt, wie rasch
Eins umschlägt in das andere? Ein jedes Ding
Zeigt, lang genug besehn, uns bald sein Hinterteil.
In der Wechselrede verliert der Leser schnell die Kontrolle darüber, wer spricht. Zuweilen stürzen die Bilder eher übereinander, als dass sie wanderten, und jede Figur ist hin und wieder moderner, als sie im siebzehnten Jahrhundert hätte sein können. „Dann leg im Geist dich in die Kurve“, sagt der Dichter, und diese poetische Schräglage ist der philosophischen Erkenntnis ausgesprochen förderlich. Geschrieben hat Durs Grünbein sein Gedicht mit hohem formalen Aufwand, in Alexandrinern, im bevorzugten Versmaß des Barock, auch wenn seine Verse selten in reiner Gestalt daherkommen. Manche haben sieben Hebungen, manche fünf, und mit der Zäsur nach der dritten Hebung nimmt es der Dichter nicht so genau. Konsequenter gebraucht er den Jambus, der seine Rede in einen zuweilen mäandrierenden, doch regelmäßig und sehr melodisch plätschernden Bach verwandelt. Und schließlich liebt er die Stanze, die Strophe mit den gewöhnlich drei, hier aber vier wechselnden Endreimen und einem Reimpaar am Schluss. Sie treibt er voran bis hin zur gelegentlich albernen Pointe:
Vorbei die Weihnacht. Im Regal der Speck wird ranzig.
Es geht aufs Ende zu. Bald schreibt man 1620.
Jeden, der in der Schule noch auf Reste humanistischer Bildung gestoßen ist, müssten die starken musikalischen Effekte an die deutsche Klassik erinnern, an die „Zueignung“ etwa in Goethes Faust. Durs Grünbein will die Vergangenheit der Dichtkunst lebendig werden lassen – und in diesem Klassizismus ist der einzige ernsthafte Einwand begründet, den man diesem langen Gedicht machen kann. Es fühlt sich wohler in der alten Form, als es ihm und seinem abgründigen Gegenstand gut tut. Längst hat die strenge Form einen exquisiten Nebensinn bekommen, längst sagen Alexandriner oder Hexameter „klassisch“, „souverän“ und „alt“, noch bevor ein Wort ausgesprochen ist. Schon das achtzehnte Jahrhundert hat sich dem Reim verweigert, Friedrich Gottlieb Klopstock allen voran, es hat zugleich die Versmaße ins Extrem des Artifiziellen getrieben. Durs Grünbein erzählt eine wunderbare, große, ernste Geschichte, und er erzählt sie in bewegender Schönheit und mitreißenden Bildern. Aber er kann nicht verhindern – wenn er es denn überhaupt wollte –, dass dem poeta doctus, der mit Begeisterung von seinen Lektüren erzählt, der Schatten des poeta laureatus über die Schulter fällt, der im Namen kultureller Selbstgewissheit zu sprechen scheint.
Ob Durs Grünbein diesen Effekt beabsichtigt, ist indessen alles andere als gewiss. Er möchte ein gelehrter Dichter sein, er will etwas Ernstes und Großes sagen. Es bleibt ihm also gar nichts anderes übrig, als das alte Podest des autonomen Dichters vom Dachboden zu holen und sich darauf zu stellen. Aber das Pathos der alten Form wirkt befremdlich, der Dichter auf seinem Podest sieht aus, als trage er ein Kostüm, und das Gedicht klingt, als habe es jemand zu stark geschminkt. Aber auch dies Risiko, zuweilen in beklemmende Nachbarschaft zum Kitsch zu geraten, ist Grünbein vermutlich bewusst. Eine Wahl hatte er nicht.
Thomas Steinfeld, Süddeutsche Zeitung, 8.11.2003
Jäger im Schnee
– Ein Kabinettstück: Durs Grünbeins Winterbuch der Poesie. –
Der Philosoph dachte und schrieb in einer Kleinen Eiszeit: keine schlechten Produktionsbedingungen für den Begründer des neuzeitlichen Rationalismus! Um 1560 setzte in Mitteleuropa eine epochale Klimaverschlechterung ein: Die Temperaturen sanken spürbar, die Winter wurden kälter, der Schnee lag länger, Seen und Flüsse vereisten häufiger und dauerhafter, die alpinen Gletscher rückten bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts markant voran. In den Niederlanden, in denen der Philosoph die besten Jahre seines Lebens verbrachte, war die Durchschnittswintertemperatur, wie die Klimaforschung gezeigt hat, im ersten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts besonders niedrig.
Die Kunst reagierte rasch auf diesen Klimawandel. Im Februar 1565 schuf Pieter Bruegel der Ältere mit seinen berühmten Jägern im Schnee das erste Gemälde, dessen eigentliches Thema eine Winterlandschaft bildet. In der Nachfolge Bruegels, von dessen noch im selben Jahr entstandener Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern und Vogelfalle nicht weniger als 127 Kopien entstanden, wurde die Winterlandschaft zu einer höchst populären Gattung in der niederländischen Landschaftsmalerei. René Descartes (1596 bis 1650) war ein Zeitgenosse von Hendrick Avercamp, Jan van Goyen und Aert van der Neer, denen wir viele der schönsten Darstellungen in Schnee und Eis versunkener Landschaften verdanken. Es ist von hohem Reiz, sich Descartes als den idealen Betrachter dieser unter dem Pinsel des Malers eingefrorenen Landschaften vorzustellen.
Der Dichter als Ruisdael
Durs Grünbein erzählt vom Leben und Sterben des René Descartes in Form von 42 Winterbildern, und oft will es dem Leser scheinen, als hätten die Schöpfer der niederländischen Winterlandschaften des siebzehnten Jahrhunderts dem Dichter dabei die Hand geführt. „Ruisdael als Dichter“ hat Goethe seinen schönsten Aufsatz zur Landschaftsmalerei betitelt; ein Aufsatz über das neue Buch von Durs Grünbein aber könnte den Titel tragen: Der Dichter als Ruisdael. Dies Buch ist ein Meisterwerk: eine Galerie aus 42 Kabinettstücken, zumeist Interieurs, in die das kalte Licht des Winters fällt, dazwischen Schneelandschaften, durch die sich einsame Spaziergänger ihren Weg bahnen.
Die Bilder haben alle dasselbe Format: sieben Strophen mit jeweils zehn alexandrinerähnlichen Versen. In dieses formale Schema wird das Leben des Descartes gebannt und dichterisch damit auf kunstvolle Weise ins Enge gezogen. Seine Welt reduziert sich auf das beleuchtete Zimmer inmitten der Eiswüste einer durch die Schneedecke reduzierten Landschaft, auf das Bett als Schneelandschaft sui generis, auf den kühlen eigenen Kopf. In dem aber hat bekanntlich die ganze Welt Raum. Und so auch in den engen Formaten der Grünbeinschen Kabinettstücke: Genreszenen aus dem Leben eines Philosophen, in denen eine ganze Welt Platz findet:
Momentlang wird ein Mensch im Schnee
Zum Ebenbild, wie er dort stapft und trägt in sich das All,
Bevor ihn Zeit schluckt, Landschaft, und sein Ruf verweht.
So werden im poetischen Bild Augenblick und Ewigkeit, Landschaftsausschnitt und All ineinandergeschaltet.
Mit der Virtuosität eines Feinmalers – tatsächlich wird an einer Stelle Gerrit Dou erwähnt – kostet Grünbein als Schöpfer von Winterbildern die Effekte aus, die ihm die Affinität seines dichterischen Verfahrens zu demjenigen eines Malers eröffnet. Das zehnte Bild oder Kapitel trägt den Titel „Landschaft mit Zeichner“. Es stellt den jungen Descartes und seinen Diener Gillot zu Ende des Jahres 1619 bei einem Spaziergang durch eine tiefverschneite und bitterkalte Winterlandschaft dar – und siehe da, hierbei erweist sich, wie in unserem eingangs angestellten Gedankenspiel erwogen, Descartes tatsächlich als ein genauer Kenner der zeitgenössischen niederländischen Winterbilder.
„Glühendes Eis, flambierter Schnee“: in solchen petrarkistischen Oxymora faßt Descartes den Eindruck einer gleißenden Winterlandschaft zusammen, deren „Zeichner“ der Teufel ist. Aber in Wahrheit kennt er diesen „flambierten Schnee“ aus der Malerei: „Man sieht ihn manchmal auf Gemälden.“ So verwandelt sich die Winterlandschaft, die Herr und Knecht durchwandern, vor ihren Augen nun selbst in eine Serie von Bildern, die klar und deutlich von ihnen wahrgenommen werden:
Nur ihre Augen absorbieren weiter Bild um Bild.
Die Leinwand blendet.
Aber so, wie ihnen die Winterlandschaft als Bild erscheint, werden auch sie selbst als Staffage eines Winterbildes vom Leser klar und distinkt wahrgenommen. Und hier nun meldet sich so plötzlich wie unvermutet ein Ich zu Wort, das keine der erzählten Figuren repräsentiert. Es ist das Ich des Autors, das sich hier einmal – und nur an dieser Stelle! – selbst ins Bild setzt. Denn er ist der „Zeichner“ dieser Landschaft, der mit seiner Einbildungskraft Zeit und Raum überwindet:
Ich seh sie noch. Was sind schon drei-, vierhundert Jahre?
Im hohen Schnee wird alles Bild. Als Winterlandschaft
Gerahmt, kehrt jede Szene wieder, die einst war.
So inszeniert sich der Dichter als Landschaftsmaler in sein eigenes Bild hinein: wie ein Vedutist des siebzehnten oder achtzehnten Jahrhunderts auf seinem Repoussoir.
Durs Grünbeins Buch Vom Schnee, das in dieser Zeitung vorabgedruckt wurde, gliedert sich auf eine Weise in zwei Teile, die von ferne an Petrarcas Canzoniere mit seiner Aufteilung der Gedichte „in vita“ und „in morte di Madonna Laura“ erinnert. Der 31 Szenen umfassende erste Teil der Verserzählung spielt in jenem Winter 1619/20, den der junge Descartes, der seit 1618 in den Diensten des Statthalters Moritz von Nassau und Tillys stand, im Winterlager bei Ulm verbrachte: in dem entscheidenden Abschnitt seines Lebens also, als sich bei Descartes jene innere Revolution vollzog, die in die Ausbildung der Gewißheit des „cogito ergo sum“ und seiner Methode, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, mündete.
Der zweite, mit elf Kapiteln sehr viel kürzere Teil erzählt vom Tod des alternden Philosophen im kalten Winter 1649/50, den er am Hof der Königin Christine in Stockholm verbrachte. Vita et mors, Leben und Tod: auf diese beiden Pole konzentriert Grünbein seine Erzählung – dazwischen aber erstreckt sich die weite Todeslandschaft des Dreißigjährigen Krieges, der in Erwartung und Erinnerung des skeptischen Rationalisten beständig gegenwärtig ist. Von der riskanten Welt dieser europäischen Eiszeit, in der der Schnee vom Krieg „flambiert“ wurde, spricht Durs Grünbein wie ein Andreas Gryphius des 21. Jahrhunderts:
Die Wette gilt – der nächste Tag zertritt wie Gras
Die heile Welt von gestern, die das Kindchen wiegt.
Was einmal jung war und begehrt, wird schließlich Aas.
Träg ist der Leib, Not macht erfinderisch. Der Krieg
Tritt rasch ins Haus – so ungebeten wie die Pest.
Das Epos Leben zehrt davon, daß keiner sich recht freut.
Hier reift ein Held heran, da ein Verrat, dort ein Abszeß,
Nach dem Prinzip der isolierten Bilder – täglich neu.
Es macht die Größe dieses philosophischen Winterbuchs als Poesie aus, daß es nie die Gedankenwelt des Descartes referiert, sondern sie ganz und gar aufgehen läßt im poetischen Bild: in den Träumen des Denkers, in seinen Empfindungen und Wahrnehmungen, im Wechselspiel von Figur und Landschaft, in den Dialogen des jungen Herrn mit seinem Faktotum Gillot. Darin erinnert Grünbeins dichterisches Verfahren an dasjenige des herrlichsten philosophischen Sommerbuchs, Diderots Jacques le fataliste, in dem aller Ernst der Philosophie aufgehoben wird in der schwerelosen Heiterkeit der Erzählung. Grünbeins Erzählung aber ist von schwerelosem Ernst – und dies nicht allein deshalb, weil sie, anders als diejenige Diderots, grundiert ist von der Allgegenwart des Krieges und weil sie schließlich in den Tod mündet, während Diderots Roman mit komödiantischer Verehelichung schließt. Sondern dieser Ernst resultiert auch daraus, daß Grünbeins Erzählung, ihrem Gegenstand gemäß, immer in den Grenzen des einsam denkenden Ich verbleibt.
„Ich war nur Kopf und Handschrift“: so beschreibt Descartes in dem 21. Kapitel, das die Mitte des Buches bildet, seine Situation in dem verschneiten süddeutschen Dorf in jenem Augenblick der Inspiration, da ihm die erlösende Gewißheit zuteil wurde:
Ich war erlöst. Ich war ein neuer Mensch. Erst jetzt
War ich mir sicher: ja, René – du bist, du bist.
Aber die Wiedergewinnung der Gewißheit, in die der bis an seine äußerste Grenze geführte Skeptizismus umschlägt, hebt die Einsamkeit des Ich nicht auf, sondern bestätigt sie:
Ich seh ihn noch, die Stirn gesenkt,
Den jungen Mann im Zimmer: mich. Der Winter hält
Den Tag mit Eisenpranken. Und ein Menschlein überdenkt
Die große Unbekannte draußen – jene Glitzerwelt.
,Tabula rasa‘ murmelt er, der dort noch immer sitzt.
Er atmet ruhig. Er scheint weit weg. Er lacht verschmitzt.
Die vom Schnee in ihrem Formenreichtum reduzierte Naturszenerie ist nicht allein die Spielfläche der analytischen Geometrie und einer Vernunft, für die die Welt berechenbar wurde – „Schnee abstrahiert. Nehmt an, er hat das Bett gemacht / Für die Vernunft.“ –, sondern sie ist in Grünbeins Buch zugleich eine allegorische Landschaft, in der sich die Situation des denkenden Ich im Zeitalter des neuzeitlichen Rationalismus poetisch vergegenwärtigt. Die Welt als Tabula rasa, ihr Zentrum: das einsam denkende Ich.
Kleine Eiszeit des Denkers
Daß dieses ernste Poem in jedem seiner Verse dennoch nahezu schwerelos erscheint, dafür sorgt eine Sprache von solcher Biegsamkeit, solcher Geschmeidigkeit und solchem Variationsreichtum, wie sie in der deutschen Gegenwartsliteratur ohne Beispiel sein dürften. Das historische Versepos hat seine letzte große Blüte in der deutschen Literatur während der Biedermeierzeit erfahren: in „Die Schlacht im Loener Bruch“ der Droste etwa oder in Lenaus „Albigensern“-Texten. An diese Tradition läßt sich nicht mehr anschließen. Der historisierende Duktus, in den Grünbein seinen Text kleidet, wird denn auch auf virtuose Weise ironisch gebrochen durch eine Vielfalt von Stilzitaten, die sich vom Balladenton („Bei Lützen wars“) über das Geschichtsdrama bis zum historischen Roman erstrecken, und manchmal klingt, willentlich oder unwillentlich, auch ein wenig Wilhelm Busch hervor:
Ein Thermometer mißt zum ersten Male hohes Fieber.
Der Logarithmentafel folgt der Rechenschieber.
Dies alles aber fügt sich einem poetischen Duktus ein, der vor allem durch eines charakterisiert wird: durch jene Entspanntheit und Unangestrengtheit eines dichterischen Zugriffs, die allein Meisterschaft gewährt. So formt sich dem Dichter als Landschaftsmaler das Bild des Denkers in der Kleinen Eiszeit aus der Präzision der Wahrnehmung, des künstlerischen Gedankens und der sprachlichen Vergegenwärtigung zu einer Winterlandschaft, in deren Unwirtlichkeit auch der Betrachter des 21. Jahrhunderts sich zu spiegeln vermag.
Ernst Osterkamp, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.12.2003
Descartes und der Schnee
– Durs Grünbeins neuer Roman über den Schöpfer des Rationalismus. –
Was der Schnee mit dem Rennaissance-Philosophen René Descartes zu tun hat, mag für die Philosophie nebensächlich sein, aber wenn ein Autor wie Durs Grünbein in seinem neuen Buch Vom Schnee oder Descartes in Deutschland diesen Zusammenhang herstellt, darf man gewiss sein, dass es bei der Klärung der Beziehung durchaus philosophisch zugehen wird.
Während die Jahreszeiten in der Literatur häufig nur am Rande Erwähnung finden, gibt es jene klassisch gewordenen Beispiele, in denen sie von außerordentlicher Bedeutung sind, und es zu den erzählten Geschichten keine jahreszeitliche Alternative gibt. Innerhalb der deutschen Literatur ist es vor allem der Winter, auf den die Autoren gern in seiner metaphorischen Bedeutsamkeit zurückgreifen. Von Maler Müllers lyrischen Gebilden, von Schubert in der Winterreise vertont, ließe sich ein Bogen zu Hans Castorp schlagen, der, von Kälte umgeben, aus Schuberts Liederzyklus in dem Kapitel „Fülle des Wohllauts“ gerade den „Lindenbaum“ erwähnt. Der Schnee ist im Zauberberg so zentral, dass ihm Thomas Mann ein eigenes Kapitel vorbehalten hat und nicht zufällig lässt Thomas Bernhard in dem Roman Frost den Maler Strauch zu den messerscharfen Einsichten über den Zivilisationsstumpfsinn auf Wanderungen in der Eiseskälte des Winters gelangen.
Der Schnee und Descartes, für Durs Grünbein kommen sie in der Kältemetapher zusammen. Die Kälte gilt als Ausdruck für nüchternes und berechnendes Kalkulieren, wie es auch die Mathematik erfordert, die als ein kalte Wissenschaft angesehen wird. Und nicht von ungefähr wird der Winter mit dem Tod in Verbindung gebracht, er läßt die Herzenswärme erkalten.
Decartes ist sozusagen die Ursprungsfigur, Stifterfigur des modernen, abendländischen Rationalismus. Was ich geschrieben habe, ist ein Erzählgedicht in 42 Kapiteln oder Cantos, dessen Hauptheld eben jener Descartes ist. Und eines ist auch noch wichtig zu sagen: Decartes ist keineswegs ein Beweis für das moderne, zerrissene Subjekt. Im Gegenteil, seine Philosophie war der Versuch, Körper und Geist und sämtliche Phänomene und Naturerscheinungen und bis dato ungelösten Probleme der Philosophiegeschichte auf einen unbezweifelbaren Grund zurückzuführen und der lässt sich bündeln in dieser berühmten Formel des „cogito ergo sum“. Also Descartes entwickelt eine Methode des Zweifelns, führt vor, wie man alle diese Wege des Zweifelns durchläuft und kommt am Ende bei einem Unbezweifelbaren an, nämlich bei der Tatsache, dass der, der das alles denkt und bezweifelt, als solcher ja existieren muss. Das ist sozusagen die Aussage der Formel des „cogito ergo sum“. Das Blasphemische lag sofort darin, dass damit auch Gott eigentlich nur existiert in dem Moment, wo irgendein Mensch von sich sagen kann, er existiert.
Descartes wird für Durs Grünbein gerade auch deshalb interessant, weil in den Lebensbeschreibungen des Philosophen einem Ereignis zentrale Bedeutung zukommt, dass so gar nicht zu dem auf die ratio vertrauenden Denker passen will. Während des dreißigjährigen Krieges erlebt Descartes 1619/20 in der Nähe von Ulm einen extrem kalten Winter. In diesem Winter soll er eine Tagtraumvision gehabt haben und in der folgenden Nacht drei Träume, die er als göttliche Offenbarung seines Auftrages ansah, die verschiedenen Wissenschaften unter dem Dach der Mathematik zusammenzubringen. In seiner berühmten Schrift, der Abhandlung über die Methode, erinnert sich Descartes an diesen extremen Winter, der ihm die Möglichkeit eröffnete, in der gut geheizten Stube intensive Zwiesprache mit den eigenen Gedanken zu halten.
Also dazu zwei Erklärungen. Die erste ist: diese Winterepisode im Leben des René Descartes, der 1619 in einem kleinen Städtchen in der Nähe von Ulm an der Donau überwintern musste, weil dieser Winter so streng war, dass er nicht weiterreisen konnte und dann mehrere Wochen in einer kleinen Kate verbringt, das hat mich über viele Jahre beschäftigt. Das war ein Urbild für die Phantasie und darauf zurück gehen eigentlich auch die ersten Aufzeichnungen. Ich weiß noch, dass ich vor vielen Jahren eines Tages auf ein Blatt schrieb: „Monsieur wacht auf, es hat geschneit die ganze Nacht.“ Das ist die erste Zeile in dem ersten Kapitel. Ich hab inzwischen einen interessanten Hinweis von Klimaforschern erhalten, das es ab Mitte des 16. Jh. und bis weit ins 18. Jh. hinein etwas gab, was die Klimaforscher heute die so genannte kleine Eiszeit nannten. Angeblich seit den letzten zehntausend Jahren hatten wir damals die strengsten Winter überhaupt. Das heißt, einer der Gründe, weshalb in der holländischen Tafelbildmalerei derart viele Winterbilder auftauchen, lässt sich darauf zurückführen. Der Winter war eine Sensation, eine neue Geisel der Menschheit. Es gab tatsächlich sehr, sehr strenge Winter. Zugleich – und das ist im Falle der Lebensgeschichte Descartes sehr wichtig, ist das die Voraussetzung für seine Klausur. Descartes hatte hier – durch diesen klimatischen Zufall – zum ersten Mal die Gelegenheit, in sich zu gehen, zum Eremiten zu werden. Darauf nahm er dann später in der berühmten Schrift von der Methode Bezug. Also die entsteht viele Jahre später erst, aber in diesem Winter 1619, 1620 kam ihm dieses Urerlebnis. Und nun kommt noch ein Nächstes hinzu, was mich immer fasziniert hat, dass diese, sozusagen im Kern absolut rationalistische Philosophie ausgelöst wurde durch verschiedene Träume und Visionen. Also, sozusagen, die Geburt des Rationalismus einerseits aus verschiedenen noch ungeklärten Visionen und Traumbildern und auf der anderen Seite – und das ist sozusagen eines der Motive, die durch das ganze Erzählgedicht gehen – aus dem Geist des Winters.
Also wir alle wissen ja, wie spontan die Reaktionen sind in punkto rationale Philosophie: sie sei kalt, gefühlsfern, logisch streng, abweisend, hart usw. Das interessante ist ja nun tatsächlich, diese Art von Philosophie konnte nie unter tropischen Verhältnissen entstehen. Also ein Descartes, der unter Palmen wandelt, ist schlicht undenkbar.
Doch noch etwas macht dieses Wintererlebnis interessant. Als Unzeitgemäßer versucht Descartes inmitten eines verheerenden Krieges, während um ihn herum Menschen abgeschlachtet werden, es große Not gibt und Hunger herrscht, die Frage zu beantworten, ob sich die Existenz des Menschen beweisen lasse. Permanent mit dem Tod konfrontiert, rückt diese zentrale Frage ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit.
Also der Moment, auf den sich der ganze erste Teil des Erzählgedichts bezieht, ist gleichzeitig der Beginn des 30jährigen Krieges und D. Lebensende ist unmittelbar nach dem Westfälischen Frieden. Darin liegt auch eine gewisse Ironie, also der Krieg spielt in die Jahrzehnte seines Erwachsenenlebens voll hinein. Interessanterweise stirbt er ja 1649/50 in einem weiteren strengen Winter am Stockholmer Hof – von Königin Christina der Tochter Gustav Adolf dahin gelockt, nach langem Widerstreben – binnen weniger Wochen an einer Lungenentzündung. Er war ein Mensch, der über viele Jahre hin eigentlich immer erst um Mittag aufgestanden ist. Er hat seine Vormittage im Bett verbracht, war aufgewacht, hat in den Federn weiter philosophiert, erste Entwürfe notiert, ist wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht, d.h. er war ein absoluter Spätaufsteher. Das war sehr wichtig für ihn und das kommt in jenem Winter sehr deutlich zum Vorschein. Und als er gegen Ende seines Lebens am schwedischen Königshof als philosophischer Berater und Gesprächspartner der Königin Christina arbeiten sollte, musste er immer schon früh, also um fünf, in der Bibliothek auftauchen. Das ist ein sowohl tragisches wie komisches Element in der Lebensgeschichte D. also, dass ihm das innerhalb von fünf Wochen den Rest gegeben hat.
Aber der 30jährige Krieg ist die Folie, vor der sich sein ganzes Leben abspielt. Und nun muss ich sagen tatsächlich war es so, ich habe vor etwa sieben Jahren die ersten Entwürfe geschrieben und hab das Manuskript lange liegengelassen und hab die Vorstellung gehabt, ich kann es nur in einem weiteren Winter weiter schreiben. Irgendwann ging es dann doch auch im Sommer weiter und was mir sehr geholfen hat ist die Tatsache, dass wir heute wiederum Zeugen verschiedener Kriege waren. Das hat absolut, so zynisch das klingt, dem Projekt geholfen. Mir war völlig klar, dass die Menschheit noch lange nicht, also auch in ihren westlichen Vertretern, jenseits der Kriege angelangt ist. Und nun würde ich sagen, also die Ausgangsbedingungen des Descartes, diese Art von abstraktem, quasi zeitentrücktem Denken zu etablieren, die kann man nicht trennen von der Tatsache, dass er mitten in den historischen Wirren stand. Und genau so geht es uns heute und geht es natürlich auch dem Verfasser dieses Erzählgedichts.
Mich interessiert vor allem diese Spannung. Also, wie kann es sein, dass ein Mensch mitten aus seiner Lebenszeit, aus seiner Epoche heraus, plötzlich diese Art von Sehnsucht nach dem weißen Licht hat, nach dem Neuschnee – diese Metapher kommt da nicht nur als Metapher vor. Also Neuschnee ist kostbar wie die Diamanten, um die damals Kriege geführt wurden heißt es mal. Für mich ist auch gerade deshalb der Winter als Folie für dieses Leben sehr, sehr wichtig, was überhaupt keinen Abbruch tut der Tatsache, dass natürlich D. – wie wir alle – determiniert war von lauter Milieueinflüssen und unsinnigen Bildungselementen.
René Descartes erscheint in dem Erzählgedicht Vom Schnee als jemand, der nichts dem Zufall überlässt, der sich aber als mathematisch denkender Philosoph auch von Träumen und Visionen leiten lässt, der den Müßiggang kennt, der sich interessiert für die Dinge des Alltags, sich also einerseits um scheinbare Nebensächlichkeiten wie die Mode kümmert und zugleich mit wachem Interesse die neuesten Entdeckungen in der Dioptirie verfolgt. Dieser sich in Extremen bewegende Denker erweist sich in der Perspektive Grünbeins als ein Mann, der zwar zu Hause ist in seiner Haut, aber es ist eine Haut aus Papier.
Ich glaube, dass sich ein großer Teil dieses Erzählgedichts genau darum dreht – zu sagen, dass hier jemand gelebt hat, der absolut gewillt war, von allen Zufälligkeiten menschlichen Daseins frei zu machen, d.h. der sozusagen alles Gedachte und Erfahrene in präzise Lehrsätze verwandeln wollte und damit Schrift – also das wäre sozusagen die Metapher Papier. Und der zugleich dünnhäutig genug war, so dass dieses Papier für ihn wie eine Membran funktioniert hat. Es hilft einfach weiter, wenn wir uns einen Menschen wie Descartes als höchst empfindsamen und facettereich, was seine Intellegibilität vorstellen und nicht zu einem Marmordenkmal stilisieren.
Facettenreich sind auch die lyrischen und theoretischen Texte von Durs Grünbein. Sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie sich von den modernen Naturwissenschaften nicht abkehren, sondern den Kontakt zu diesen Wissenschaftsbereichen immer wieder suchen. Besonders interessieren ihn dabei neueste Ergebnisse der Gen- und Hirnforschung, denkt er in diesem Zusammenhang über die Zerbrechlichkeit von Körpern nach, über Einschreibverfahren und damit Steuerungsmöglichkeiten, denen Körper ausgesetzt sind. In dem 1996 erschienenen Band Galilei vermisst Dantes Hölle spricht er von den „traurigen Körpern“ und von der Sprache als einer „harten Grammatik, als [einem] Werkzeug für die vom Herzen amputierte Intelligenz“. Solche Überlegungen finden in Grünbeins neuem, vor wenigen Wochen in der edition suhrkamp erschienen Band Warum schriftlos leben, ihr Fortsezung. In dem Titelaufsatz ist vom Gehirn als großem Zufluchtsraum die Rede, das in den unwegsamsten Ausläufern nur schriftlich bereist werden kann. Es ist auffällig, dass diese theoretischen Überlegungen mit dem Erzählgedicht über Descartes korrespondieren.
Also mir ist ziemlich früh klar geworden, dass es zwei Königswege in dieses unwegsame Gelände hinein gibt: der eine ist die Philosophie und der andere war die Poesie. Ich bestehe eigentlich nur darauf, dass Dichtung und Philosophie weiterhin im Gespräch bleiben. Obwohl mir klar ist, dass dieser Dialog immer wieder unterbrochen wurde und es dadurch hegemonische Vorgänge gibt. Auf der einen Seite glaube ich, dass sehr viele Geheimhöhlen und Kavernen überhaupt nur mit der poetischen Grubenlampe ausgeforscht werden – eine Voraussetzung für die Psychoanalyse, für den Begründer der Psychoanalyse, Freud, war bekanntlich die Mythologie und die Literatur als solche – und auf der anderen Seite weiß ich sehr wohl, dass in punkto Systematik, Begriffsbildung, Kristallisationen immer nur die Philosophie weiterhilft. Und mich interessiert dieses Dreieck eigentlich aus Philosophie, naturwissenschaftlichem Denken und Literaturpoesie. Und dafür ist Descartes sozusagen der geeignete Protagonist, um das alles wieder in einer Person zu bündeln.
Der Zufluchtsraum Gehirn darf auch als ein Raum verstanden werden, in dem keine Zeitgrenzen existieren. Deshalb kann Grünbein Schreiben als eine Möglichkeit ansehen, der Gegenwart zu entkommen, wie er es in Warum schriftlos leben formuliert hat, doch handelt es sich dabei nach seinem Verständnis nicht um eine Fluchtbewegung. Vielmehr sieht er darin eine Möglichkeit, verschiedene Zeitebenen miteinander ins Gespräch zu bringen. Im Kopf des Dichters können auf diese Weise Ereignisse, Themen und Figuren miteinander in einen Dialog treten, die auf Grund von real existierenden historischen Zeitschranken keine Möglichkeit hatten, miteinander in Kontakt zu treten. Nur so ist zu verstehen, daß Dichtung, wie es Grünbein formuliert, hoch isoliert und dennoch mittendrin geschrieben wird. Ihm geht es gerade um Gleichzeitigkeit: Das Schreiben braucht das Abseits und vollzieht sich dennoch im Zentrum des Gegenwärtigen, wenn sich Orte und Zeiten miteinander verschränken.
Im Grunde handelt es sich um ein Interferenzproblem. Es geht darum, verschiedene andere Gegenwarten für sich zu erobern, so dass sie eines Tages gleich gegenwärtig sind wie die eine historisch und von der Geburt her gegebene Gegenwart gegeben ist. Und dann kommt eines Tages diese Interferenz zum Tragen, dass man sozusagen von Stunde zu Stunde feststellt, es kehren verschiedene historische Momente wieder, man versteht erst besser, was einen selber ausmacht. Es geht gar nicht darum, diese eigene Gegenwart zu entwerten, es geht darum, sie in allen ihren prismatischen Bedingungen wahrzunehmen. Alles andere, dieses Echoloten in verschiedene, signifikante historische Zeiträume hinein, hat eigentlich nur zu tun mit der Sehnsucht, besser zu verstehen, woraus wir gemacht sind. Ich hab da gar keine Hierarchie. Ich weiß genau, dass es ebenso nützlich ist sich unmittelbar hinauszubegeben in das Alltagsleben mit dem wachen Blick eines Reportagejournalisten wie sozusagen die Peilung aufzunehmen in diese anderen Zeiträume. Also das eine alterniert immerfort mit dem anderen, zumindest in mir. Auf dem selben Schreibtisch liegen die verschiedenen Texte, die die verschiedensten Interessen verfolgen. Aber es geht sozusagen um eine ganz große Parallelaktion. Wir haben das bei vielen Dichtern, dass sie in ihren Zeilen kunterbunt hin und her springen, zwischen den verschiedenen Zeitaltern und so viel ich weiß ist das überhaupt das, was den Dichter kennzeichnet: dass er diese Gabe hat oder auch diesen Makel – mag ja sein, dass es zugleich auch eine Schwäche ist. Aber es ist auch eine gewisse Chance.
Mir scheint aber auch, wir leben zum ersten Mal in einer Zeit, die sozusagen eifersüchtig über alles Bisherige wacht und die ein Problem damit hat anzuerkennen, dass sie von einer gewissen Herkunft bestimmt ist. Also es ist offenbar stark erklärungsbedürftig, verteidigungsbedürftig, darzustellen, warum es dieses Schweifen im Geist gibt in andere Zeiten und Räume. Es ist sehr interessant und spricht durchaus für einen sehr großen Eigensinn unserer Gegenwart, vielleicht aber auch nur für eine gewisse konstitutionelle Schwäche. Also nie zuvor – meine ich – sind Autoren derart in Frage gestellt worden dafür, dass sie diesen Reisetrieb in andere Zeiten und Räume haben.
Man soll Zeugnis ablegen über das was in seiner Lebenszeit geschieht und man unterschlägt dabei, dass es eine ebenso wichtige Zeugenschaft gibt nämlich darüber Auskunft zu geben, was in seinem Gehirn im Verborgenen eigentlich abläuft. Und nicht nur in seinem, sondern in dem aller anderen auch.
Michael Opitz, Deutschlandfunk, 22.10.2003
Ich denke und bin: im Schnee
– Haben wir es etwa mit der Renaissance einer Gattung zu tun? Durs Grünbeins sinnlich-klares Versepos über das Leben des Philosophen Descartes. –
Krieg ist auch Mathematik. Niemand wusste das besser als der 1596 geborene René Descartes. Der Jesuitenschüler aus der Touraine fiel schon als eigenständiger Denker auf, als ihn sein Vater zur militärischen Ausbildung nach Holland schickte. Der Kriegs-Volontär behielt so viel Freiheit, sich einer Leidenschaft ganz hinzugeben: der Mathematisierung der Erkenntnis. Im „Buch der Welt“ will er studieren, aus dem Garnisonsleben drängt es ihn heraus. Er reist nach Dänemark und Danzig, durchquert das halbe Habsburger Reich, ungeachtet des aufziehenden, dreißig Jahre währenden Krieges. Auf dem Wege von der Kaiserkrönung Ferdinands II. in Frankfurt wird Descartes im Dezember 1619 bei Ulm eingeschneit, zwölf lange Wochen. Da ist er dreiundzwanzig und noch weit entfernt vom Ruhm.
Hier setzt Durs Grünbein ein, der poetische Enzyklopädist. Vom Schnee oder Descartes in Deutschland heißt sein Erzählgedicht in betitelten Perikopen mit fast dreitausend Versen. Der Blankvers trägt die Form, einiges wird szenisch, der Texthintergrund bleibt episch. Wie Heiner Müller in seinem Langgedicht Mommsens Block fasst Grünbein die Höhenflüge eines Gelehrten und seinen unerwarteten Absturz, doch Stoff-Fülle und Formstrenge gehen hier weiter. Der Schnee wird für den Dichter zur Leitmetapher:
Schnee abstrahiert. Nehmt an, er hat das Bett gemacht
Für die Vernunft.
Grünbein entwirft eine Welt im Schnee wie ein Pieter Brueghel auf seinen Bildern. Der Schnee schafft Tabula rasa. Jede Spur wird Algebra, Hyperbel oder Sinuskurve. Ausdehnung und Gestalt, Bewegung und Dauer wirken geometrisch und klar, alles scheint dem ausgewilderten Philosophen „kräftegleich“ zu schweben. Die Anmut der Geometrie, die schöne Klarheit der Mathematik befreien ihn aus der unerträglichen Gleichzeitigkeit von Kriegsgräuel und Normalität.
Auch das Diktat der Zeit, der Krieg, wird aufgehalten vom Schnee. Der Vorlauf zum Tod scheint unterbrochen. Die Zeit steht still, der Krieg hält Winterschlaf, ein Kopf ordnet sich. In unbeirrbarer Ruhe und Isolation, als „Murmeltier“, findet Descartes seinen Weg als Mathematiker und Philosoph. Für ihn bleibt Widerspruch die normale Umgangsform – ein freier Geist, niemandem verbunden als sich selbst. Allerdings: „Für Häresie war er zu fein. Zu sehr – als Christ – mit Gott allein.“ So hält er die Flanken seines Diskurses klug bedeckt, Giordano Bruno wurde erst zwanzig Jahre zuvor als Ketzer verbrannt. Aber immer geht Descartes von seinem Zweifel an allem bisherigen Wissen aus. Wie die Ideen werden auch Raum und Zeit zu Visionen. Der einzige Satz, der sich nicht wegzweifeln lässt, heißt: „Cogito, ergo sum. – Ich denke, also bin ich.“ Das ist die Geburtsstunde des Rationalismus.
Descartes kann eine Wahrnehmung kühl und kritisch erwägen, ohne ihr zu verfallen. Er weiß sehr früh, wie schnell ein Weltbild auseinander fällt. Denken ist für ihn ein Prüfen erfahrbarer Wirklichkeit.
Der Zweifel steht im Denken für die heiße Spur,
Die zeigt, wohin die Reise geht.
Nur so wird es ihm möglich, etwas von Wert, also einen Gedanken oder eine Abstraktion, nicht zu entstellen oder zu verschleudern. Nicht immer ist Descartes hier einem Ergebnis nahe, wohl aber einem Ursprung. Grünbein spiegelt diese Genese im Selbstgespräch, im Dualismus des Denkens mit Traum und Trieb. Aber für den Diskurs gibt es nur den klugen Famulus Gillot, fast scheint es, als teilen sie sich auch die schöne Magd Marie. Man ist hier nicht in Port Royal, die Jansenisten sind noch weit. Es gibt das pralle Leben, und Grünbein feiert es in vollen Zügen. Dann ist er wieder der Chronist der Schrecken. Ein Canto-Titel kann „Ein schönes Augenpaar“ heißen und doch die Kriegsgräuel ausmalen. Gillot berichtet:
Da lag ein Mädchen, das Gesicht von einem Federhut
Bedeckt, zerfetzt die Strümpfe, neben einer toten Ziege.
Lag da, als schliefe sie, in einem Nest von braunem Haar.
Ich, wie berauscht, greif mir den Hut – da schwirren Fliegen
Aus ihrem Rock, und da erst seh ich, starr, das Augenpaar
Oder es heißt „Lob der Pferde“, man nimmt das Ross mit in die warme Stube. Eben noch Pferdedampf, gleich ist Descartes wieder in scheinbar abwesender Versenkung, schon sprudeln präzis durchdachte Sätze hervor – wie nebenbei, rigoros und schnell. Wenn für den Rationalisten gilt, „vom Sinnbild frei macht dich erst der Begriff“, gewinnt Dichter Grünbein aus der philosophischen Begrifflichkeit wieder das poetische Bild.
Gottnah, ein Punkt, so flammt sie auf im Flockenfall,
Die Existenz…
Momentlang wird ein Mensch im Schnee
Zum Ebenbild, wie er dort stapft und trägt in sich das All,
Bevor ihn Zeit schluckt, Landschaft, und sein Ruf verweht.
Kaum schmilzt der Schnee, schon dröhnen Kriegstrompeten. Descartes findet sich für ein langes Jahr im bayerischen Heer unter General Tilly wieder. Die Königsdisziplin der Kriegswissenschaften ist die Mathematik. Descartes bewegt sich wieder inmitten der Duplizität von Schwedentrunk und barockem Saus und Braus.
Du folgst dem Heer. Du siehst dich um bei Hof, auf Reisen.
Du lernst die Menschen kennen, die humeurs et conditions.
Du lernst zu schweigen, hinzusehn, dich durchzubeißen.
Inmitten des Geschehns bist du – ein doppelter Spion,
Und in dir kreuzen sich Begierden, Interessen.
Venedig, Rom, Florenz, Paris. In Holland endlich gelingt Descartes ein Gelehrtendasein. Er wird disputieren, unterrichten, seine Werke schreiben. Der große Krieg findet für ihn dann nur noch am Rande statt. Descartes ist in einem anderen Orlog, im Kampf mit großen Köpfen. Im Streit mit Thomas Hobbes, Petrus Gassendi und Blaise Pascal verschenkt er nichts. Aber nach dem Westfälischen Frieden wird der Philosoph unachtsam, er macht den Fehler seines Lebens und Grünbein kommt in seinem Versepos zum zweiten Teil, dem Absturz. Die Königin der Schweden, Christine, lockt Descartes nach Stockholm. Die Tochter des Kriegskönigs Gustav Adolf will Schweden geistigen Glanz verleihen. Der Hof auf Staden als Bildungshort, schon lachen alle Kriegsbären. Descartes hält man mit dummen Fragen zum Narren. Man spottet seiner wie hundert Jahre später Jakob Paul Gundling am Hof des preußischen Soldatenkönigs. „Erlaubt, dass ich Euch frage, was Ihr wirklich wisst,“ heißt es, bevor es tagt bei Schwedens erster Frau, die immer noch Griechisch lernt. Verse, Expertisen, königliche Briefe soll er schreiben. Und ein Ballettlibretto, das den Westfälischen Frieden feiert und Majestäts Geburtstag. „Ich denke, also bin ich,“ hilft nicht weiter. Missgunst und Demütigung beschleunigen den Weg zum Tod. Da ist er keine vierundfünfzig. Eine letzte Klarheit zeigt sich, als der Königshof im Schnee versinkt. Doch Grünbein bricht das Bild:
da plötzlich stand – im Schnee ein Haufen Pferdemist,
Das Nonsenswort: du bist ein Nichts.
Als sei das Versepos zurückgekehrt: Eine Gelehrtengeschichte in ihren Auf- und Abschwüngen, ohne dass etwas stockt. Mit Grünbeins klarschöner, auch sinnlichen Sprache kann man nicht lassen von einem genialen Denker. Es ist, als könne man Descartes neu entdecken, ja, sogar verstehen. Und das bleibt das Besondere an dieser Verserzählung des Dichters Durs Grünbein.
Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 26.11.2003
Der Poet Durs Grünbein begegnet dem Philosophen Descartes
– Im Winter des Denkens. –
Durs Grünbeins neuer Gedichtband handelt, der Titel kündigt es an, vom Schnee. Ein eher eintöniges Motiv; zu abstrakt, so scheint es, um eine 144 Seiten lange Verserzählung von fast 3.000 Zeilen zu füllen. Warum also entschließt sich der Autor zu einem artifiziellen historisierenden Langgedicht aus 42 Cantos mit je sieben Strophen à zehn Zeilen? Und warum spricht er ausgerechnet vom Schnee in einer nicht gerade zeitgenössischen lyrischen Form: im barocken Versmaß des Alexandriners? Grünbeins Ambition ist nicht unbescheiden: Vom Schnee ist eine Eloge an die Geburtsstunde der Moderne. Das alles nivellierende Weiß steht für den geistesgeschichtlichen Nullpunkt.
Folgerichtig verortet der Autor die Handlung im Dreißigjährigen Krieg, in jener Phase der Zerstörung, des Umbruchs und des Neuanfangs, die wie keine andere das neuzeitliche Denken prägt. Buchstäblich logisch erschließt sich auch die prominente Besetzung seines Historienspiels mit René Descartes, dem Mathematiker, Physiker und Begründer der modernen Philosophie, sowie seinem Diener Gillot. Ort ist ein Dorf bei Ulm, in dem der erst 23-jährige Descartes im Winter 1619 eingeschneit wird. Von einem Tag auf den anderen stellt er hier das mittelalterliche Denken auf den Kopf. Über den methodischen Zweifel gelangt er zur einzig sicheren Erkenntnis: „Ich denke, also bin ich.“
Im Bruch mit der gesamten philosophischen Tradition entsteht aus dem Nichts des Axioms ein neues Denkgebäude. Mit Descartes’ erkenntnistheoretischem Zweifel beginnt ein Jahrhunderte währender Kampf zwischen Rationalismus und Empirismus, der Grünbeins Verserzählung durchzieht. Dem Geist-Körper-Dualismus entstammen auch die beiden Hauptfiguren, der Philosoph und sein Alter Ego. Grünbein lässt Herrn und Diener – Cervantes’ Don Quichotte und Sancho Pansa persiflierend – in endlosen Diskussionen miteinander streiten. Ein lyrischer Disput, der gelingt, solange er ironisch und augenzwinkernd daherkommt, der bisweilen aber wie eine hölzerne Imitation des literarischen Vorbilds wirkt.
Diener Gillot steht stellvertretend für Descartes’ körperliche Bedürfnisse, und diese fordern täglich ihr Recht. So stören die Notdurft oder der knurrende Magen des Burschen die gemeinsamen philosophischen Schneespaziergänge. Und immer wieder konterkarieren sexuelles Begehren – Herr und Diener buhlen um die Bauernmagd Marie –, schnöder Zahnschmerz oder Fieber die geistige Sphäre der Philosophenkammer. Auch der ständig präsente Allesvernichter, der Krieg, stellt die Ratio infrage. Und schließlich unterläuft der Tod – das Langgedicht endet 1650 mit Descartes’ Sterben am schwedischen Hof – die rationalistische Argumentation.
Der Schnee, in Benjamin Lee Whorfs linguistischer Abhandlung „Sprache – Denken – Wirklichkeit“ das Musterbeispiel sprachlicher Relativität, steht bei Grünbein für die Erkenntnis der Moderne, dass eine objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit – und damit Wahrheit – nicht möglich sei. Denn Wahrnehmung erweist sich als subjektive Konstruktion des Bewusstseins; Wirklichkeit wird als sprachlich vorstrukturierte Projektion des Geistes entlarvt.
Poetisches Ziel ist es daher, dichterisch die immanente Ambivalenz des Schnees als Symbol der geistesgeschichtlichen Tabula rasa zu evozieren. Durs Grünbein beschwört die Macht des Schnees in suggestiven poetischen Metaphern und leuchtet all seine Facetten mit Bildern von starker Assoziationskraft aus. So entwerfen die barock intonierten Verse einmal gewaltige Schneelandschaften, in denen der Mensch, auf winzige Schattenrisse reduziert, sich aufzulösen scheint. Ein andermal gleißt der blendende Schnee so stark, dass er den Betrachter auf sich selbst und Grünbein den Leser auf die schlichte Kammer Descartes’ mit dem bescheidenen Interieur aus Bett, Tisch, Stuhl, Tintenfass und Papier zurückverweist. Oder der Autor malt üppige, barocke flämische Winterszenen mit Schlittschuhläufern, Eisfischern und wärmenden Reisigfeuern auf die frostige Leinwand.
So fungiert der Schnee einerseits als Projektionsfläche für neue Gedankenkonstrukte, andererseits aber bedroht er als übermächtiges, nivellierendes Nichts das fragile, erst neu zu kreierende Individuum. Diese paradigmatische Konstellation spiegelt musterhaft die in jedem kreativen Akt wiederkehrende Konfrontation des originär Schaffenden mit seinem Medium, dem weißen Blatt Papier oder der unbefleckten Leinwand.
Hier treffen sich Dichter, Philosoph und Maler, hier spiegelt sich auch Grünbein, nicht ganz frei von Affektiertheit, in dem großen Philosophen. Sein dichterischer Impetus wirkt insbesondere dann, wenn er allzu sehr mit dem Spiegelbild kokettiert, aufgesetzt und hypertroph. Auch die formstrenge Verwendung der barocken Sprechweise und des alexandrinischen Rhythmus erzielt nicht immer die intendierte Wirkung. Die historisierende Sprache verkommt teilweise zum manirierten Reimsport. Die hohe poetische Form, gebrochen nur durch den nicht immer überzeugenden Humor, wirkt dann anachronistisch. Auch wenn Qualität und Dichte der mit enormer assoziativer Kraft geschaffenen Bilder und starken Metaphern immer wieder versöhnen.
Michaela Schmitz, Rheinischer Merkur, 11.12.2003
„Mich umkreisen Dämonen“
– Hinter tausend Gedichten eine Welt? Durs Grünbein, bedeutendster deutscher Lyriker der Gegenwart, kämpft Tag und Nacht mit Versen. –
„Gedichte sind Zeitreisemaschinen. Sie bieten die Möglichkeit, mit wenigen Worten immense Räume zu durchqueren“, sagt Durs Grünbein, bestellt im Berliner Restaurant Pan y Tulipan Fisch-Carpaccio und Chardonnay – und schweigt erst einmal. Dann geht’s weiter:
Die Verfügbarkeit der Lyrik entzieht sich dem Willen. Man muss in splendider Einsamkeit auf die Begegnung mit diesen merkwürdigen Mächten warten.
Seine Worte sind schwer verdaulich – wie die Gedichte, mit denen der gebürtige Dresdner berühmt geworden ist: poetische Miniaturen mit bizarren Titeln wie „Cerebralis“, „Schädelbasislektion“, „Mensch ohne Großhirn“, in denen der Büchner-Preisträger von 1995 historische Erschütterungen und persönliche Schocks in prägnante Sprachbilder bannte, seit er, ein Jahr vor dem Mauerfall, nach Westdeutschland kam und auf Empfehlung Heiner Müllers bei Suhrkamp seinen ersten Lyrikband veröffentlichte: Grauzone morgens.
Jetzt erschien sein bislang umfangreichstes Werk, Vom Schnee, ein Versepos über den französischen Edelmann, Philosophen und Mathematiker René Descartes (1596–1650), der das moderne Denken erfand. Ihm verdankt die Welt den philosophischen Gassenhauer: „Cogito ergo sum“ – die Anleitung zum Grübeln. Der Barockmensch, der unruhig durch Europa streifte und den Ich-Bezug zur Basis der philosophischen Selbstgewissheit erklärte, ist Grünbeins Bruder im Geiste. Von der Leidenschaft des Denkens ist auch der Lyriker besessen, von der Poesie der Erkenntnis handelt sein Gedicht in 42 Gesängen – ein Wintermärchen, wie von Pieter Brueghel gemalt. Die Kälte der Welt, die Fragilität des Subjekts und die Einbildungskraft, die Raum und Zeit überwindet, verwandelt Grünbein in Verse, die sich in ihrer kantigen Schönheit ins Gedächtnis fräsen:
Ich seh sie noch. Was sind schon drei-, vierhundert Jahre?
Im hohen Schnee wird alles Bild. Als Winterlandschaft
Gerahmt, kehrt jede Szene wieder, die einst war.
Früher hat Grünbein Diktatur, Wiedervereinigung und die Zeit danach, Vereinzelung und Ich-Zersplitterung, den postmodernen Zustand des Seins in schrägen und metaphernreichen Gedichten reflektiert. Viele wimmeln von naturwissenschaftlichen und medizinischen Vokabeln, von Aphasie und Skalaren, Tensoren und Gödelschen Oden.
Kein Wunder, dass ihm neben dem „Götterliebling auf den Spuren Hugo von Hofmannsthals“ (FAZ) das Etikett des „kühlen Sprachingenieurs“ angeheftet wurde. Und dazu das des Poeta doctus, wegen seiner Gelehrsamkeit. Klischees, die an ihm abperlen. Durs Grünbein ist klug und macht kein Geheimnis daraus.
Als Kind las er Karl May, dann ziemlich schnell Kafka und später die lateinischen Klassiker Horaz und Juvenal – Freiheitsoasen in der Diktatur. Mit Utopien war er schnell am Ende:
Zu viele haben sich verbraucht, und wenn man eingesperrt ist, klingt schon das Wort hohl.
Ezra Pound brachte ihn zur Lyrik:
Durch ihn wurde mir klar, dass die moderne Poesie längst die Summe ihrer eigenen Geschichte ist.
Bis heute treibt sich Grünbein, Vater einer kleinen Tochter, die er kürzlich in Schüttelreimen besang, am liebsten in den Korridoren der Vergangenheit herum und ringt täglich um Ausdruck für „das existenziell Schwierigste“. „Die Dichtung hat mir die Therapie erspart“, sagt er, guckt tief ins Glas und bricht plötzlich in Gelächter aus.
Inzwischen habe ich keine Möglichkeit mehr abzuschalten, denke nonstop in Versen und bin ständig mit der Revision von Zeilen und Positionen beschäftigt. Mich umkreisen Dämonen. Das wird noch böse enden. Goethe möchte ich nicht gewesen sein.
Grünbein reicht ja auch. Der besteht auf Klarheit, proklamiert Dichtung als Form der Erkenntnis, hält Begriffe wie Seele oder Intuition für unpräzise und will den Gehirnprozessen auf die Spur kommen, die in seinem Kopf Gedichtzeilen, Rhythmen, Assonanzen auslösen. Die überfallen ihn, erzählt er, und es klingt weniger wissenschaftlich als magisch, plötzlich beim Spaziergang – Erinnerungsfetzen, wie bei Prousts „Madeleines“, aus denen vielleicht irgendwann ein Gedicht entsteht. Wie gesagt: Gedichte sind für ihn Zeitreisemaschinen. Aber: „Poesie dreht auch den Zeitpfeil im eigenen Leben um. Über Gedichte ist man schnell mit historischen Momenten verbunden“, sagt er und stochert gedankenverloren im Carpaccio. Kein Wunder, dass er die grassierende Ostalgiewelle, diese selektive Erinnerung, „lächerlich“ findet.
Längst aber genügt es ihm nicht mehr, „Denken in einer Folge physiologischer Kurzschlüsse“ vorzuführen. Er will „Gefühle frisch übermitteln und dabei feinfühlig kapitulieren“.
Auch von der Macht der Emotionen handelt sein Descartes-Buch – von seelischen Aufschwüngen und Abstürzen. Schon lange geistert der französische Edelmann durch Grünbeins Versspeicher und Erinnerungskorridore. Jetzt besingt er ihn in biegsamen Alexandrinern und fokussiert zwei Stationen des Gelehrtenlebens: den Jahrhundertwinter 1619, als der junge Descartes, Soldat im Dreißigjährigen Krieg, in einem Kaff bei Ulm festsaß und seinen subversiven Geistesblitz hatte: „Im Zweifelsfall – halt dich am Zweifel fest.“ Und den eisigen Stockholmer Winter, 30 Jahre später, als der kranke Gelehrte und passionierte Langschläfer der schwedischen Königin Christine morgens früh um fünf Lektionen erteilen musste, die er nicht lange überlebte. „Wo ich bin, wird nie ein andrer sein“, lässt Grünbein seinen Helden auf dem Totenbett sinnieren:
Auf engstem Raum, gottlob, bin ich nicht kleinzukriegen,
Solang ich denke.
Der Tod unterliegt keinem Zweifel.
Grünbein spielt virtuos mit methodischem Zweifel und sinnlicher Gewissheit. Sein winterliches Versepos wird zum raffinierten Vexierspiel aus cartesischen Metaphern und biografischen Fakten, barocken Visionen von Krieg, Vanitas, Fäulnis und Tod, historischen und naturwissenschaftlichen Exkursen – ein Kosmos voll Melancholie, Situationskomik und Sarkasmus. Einsam und gemeinsam mit seinem Faktotum Gilot sinniert Descartes über die Welt oder stapft durch den Schnee, der alles nivelliert. Und in der frostigen Welt von gestern spiegelt sich die heutige.
Es scheint, als habe Durs Grünbein, der unermüdliche Zweifler, zu einer neuen Heiterkeit gefunden. Das will er so nicht akzeptieren: „Früher, als meine Gedichte düster waren, ging es mir sehr gut. Jetzt, wo sie allmählich heiterer klingen, geht’s mir immer schlechter“, sagt er, grinst und wird abrupt wieder ernst:
Das Elegische überwiegt, weil Dichtung schon im Höhenflug den Verlust ahnt. Die Balance ist das Schwierige: Sobald man sich der Trauer hingibt oder sich in eine Humoroffensive begibt, fängt man an zu lügen.
Susanne Kunckel, Die Welt, 4.1.2004
Mit seinem Eisenbesen fegt der Winter uns
Durs Grünbein erzählt. Er malt und er unterhält. Er beginnt zu forschen und er prüft und dann irgendwann erzählt er einen Witz. So geht dieses große Verswerk in romanhafter Weise mit dem Winter um, mit Deutschland und mit Descartes. Dieser bedeutende Physiker und Mathematiker, der im „Cogito ergo sum“ sich selbst, seine Selbstgewißheit also fand und dennoch (deshalb?) immer auch auf der Suche war, „Gottesbeweise“ zu finden, dieser bedeutende Mann ist sein Protagonist hier in seinem großartigen Werk. Und so geht es hinein in diese unsere Welt, daß es ein Vergnügen ist. Dennoch werden wir ab und zu an etwas erinnert, daß wir wohl schon einmal erlebt oder gelesen haben. Historie und Mathematik, Erinnerung an Gespräche zwischen Faust und Mephisto, eigene Gefühle, alles ist verarbeitet und zwar kunstvoll bis zur Erschöpfung oft. Viele Stunden werden wir benötigen, und das soll und wird uns trösten, bis wir dieses Buch zur Seite legen werden. Denn immer wieder können wir es zur Hand nehmen und dann, ja dann werden wir hineingenommen in eine Welt nicht nur der geistigen Bilder, der Ideen, nein auch in unsere körperlichen Bezüge trifft der Strahl der Erkenntnis einmal mehr und einmal freundlich, wie es sich gebührt für einen, der ein Dichter ist, ein poeta doctus eben.
Klaus Grunenberg, amazon.de, 29.1.2004
Fröhliche Eiszeit
Lesung und Gespräch am 29.4.2004 im Literaturhaus Stuttgart
Autor: Durs Grünbein
Gesprächspartner: Friedrich Kittler
EINLEITUNG
Florian Höllerer stellt Durs Grünbein und Friedrich Kittler vor
GESPRÄCH I
Friedrich Kittler und Durs Grünbein führen in das Langgedicht Vom Schnee oder Descartes in Deutschland ein
LESUNG I
Durs Grünbein liest den Anfang von Vom Schnee oder Descartes in Deutschland
GESPRÄCH II
Friedrich Kittler und Durs Grünbein sprechen über die Rolle der Geometrie im Werk von René Descartes
LESUNG II
Durs Grünbein liest aus dem zweiten Kapitel von Vom Schnee oder Descartes in Deutschland
GESPRÄCH III
Friedrich Kittler und Durs Grünbein sprechen über den Ort des zuletzt gelesenen Abschnitts
LESUNG III
Durs Grünbein liest aus dem siebten Kapitel von Vom Schnee oder Descartes in Deutschland
GESPRÄCH IV
Friedrich Kittler und Durs Grünbein sprechen über die Motive des Urins und des Spiegels sowie über die Rolle von Frans hals im zuletzt gelesenen Abschnitt
LESUNG IV
Durs Grünbein liest aus dem achten Kapitel von Vom Schnee oder Descartes in Deutschland
GESPRÄCH V
Friedrich Kittler und Durs Grünbein sprechen über die Rolle von Marie und Winterbilder der flämischen und niederländischen Maler
GESPRÄCH VI
Friedrich Kittler spricht mit Durs Grünbein über die Unmittelbarkeit seiner Poesie und Möglichkeiten der Kommentierung
LESUNG V
Durs Grünbein liest aus dem 22. Kapitel von Vom Schnee oder Descartes in Deutschland
GESPRÄCH VII
Friedrich Kittler und Durs Grünbein sprechen über das lyrische Ich und die Dichtung von Descartes Leben in philosophischem Kontext
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Florian Berg: Die Kunst im Zeitalter der Wissenschaft
Sprache im technischen Zeitalter, Heft 183, September 2007
Angelika Overath: Schneeräume des Denkens
Neue Zürcher Zeitung, 7.10.2003
Thomas Wild: Das Auge unbewaffnet
Der Tagesspiegel, 8.10.2003
Andreas Nentwich: Die Landschaft dreht sich auf den Rücken
Die Zeit, 9.10.2003
Ingeborg Harms: Ich lese und schreibe, also bin ich
Literaturen Heft 11, 2003
Jürgen Verdofsky: Descartes’ Weg
Tages-Anzeiger, Zürich, 31.12.2003
Nico Bleutge: Ein Liderpaar, das zuckt
Badische Zeitung, 3.1.2004
Unter dem Titel „Kühl wie am Morgen nach der Schöpfung“
Stuttgarter Zeitung, 23.1.2004
Michael Opitz: Landschaft in Weiß
Neues Deutschland, 15.3.2004
Peter Geist: Zwischen Himmel und Erde
der Freitag, 10.9.2004
Die Stimme des Denkers
– Dankrede zum Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt am 27.8.2004 in Naumburg. –
Lassen Sie mich mit den geflügelten Worten beginnen. Sie sind es, die einem als erstes um die Ohren schwirren, sobald die Rede auf Friedrich Nietzsche kommt. Sie sind bis heute in aller Munde, und keiner kann sie je mehr vergessen. Kaum einer, der nicht schon vom Willen zur Macht geraunt hätte, von der blonden Bestie oder vom Übermenschen, der leider sofort sein elendes Gegenteil, den Untermenschen heraufbeschwört. Kaum ein Stammtisch, an dem das Wort von den Frauen und von der Peitsche, die man mitnehmen solle, wenn man zu ihnen geht, nicht genüßlich wiederholt würde. Seltsamerweise ist noch jedesmal vom Weibe die Rede, wo das Original von den Frauen spricht. Aber wie Heinrich Heine in der Harzreise sagt:
Solche Corruption des Textes ist beim Volke etwas Gewöhnliches
Will einer recht streng und entschlossen auftreten, deutet er an, dies oder das bewege sich jenseits von Gut und Böse. Gewiß, das meiste ist aus der Mode gekommen, so das Sprüchlein „Menschliches, Allzumenschliches“ und ganz sicher das Verdikt von der sogenannten Herdentier-Moral. Denn Nietzsche zu zitieren, ohne ihn gelesen zu haben, mag noch angehen; seine Bosheiten auf sich zu beziehen kommt schwerlich in Frage.
Dagegen ist es noch immer guter Ton, eine Sache zu hinterfragen, und schon der Pennäler kommt sich sehr wichtig vor, wenn er auf die Schulbank kritzelt: Gott ist tot. Ich weiß, wovon ich rede – auch ich habe das hingekritzelt. Und da ich einmal dabei bin: Jahre später las ich an einer Hauswand eine Art von Replik, die mir, verglichen mit jener Aussage, nun wirklich brutal und herzlos erschien. Jemand hatte da, in schreienden Graffiti-Farben, hingesprüht: Nietzsche ist tot. Gott. So also geht es zu im Reich der Philosophie, dachte ich damals; Auge um Auge, Argument gegen Argument. Dann aber geschah es, daß ich zum ersten Mal den Riß sah, den Nietzsches Satz im allgemeinen Bewußtsein (auch in meinem) hinterlassen hatte, und mir fiel auf, wieviel wirksamer sein negatives Gebet war als jedes dahingeplapperte Vaterunser. Sein kalkulierter Sarkasmus, immerhin, konnte jederzeit wie ein Sprengsatz hochgehen, während das tägliche Credo auf Neutralisierung hinauslief.
Auch Friedrich Nietzsche ist davon nicht verschont geblieben. Gerade an seinen geflügelten Worten kann man den Abnutzungseffekt studieren, wie allzu häufiger Zitat-Gebrauch ihn mit sich bringt. Am Ende läuft alles auf Sinnentleerung hinaus, hier geht es den brillanten Einsichten kaum anders als den schönen Gedichten. In der Zeit seiner höchsten schriftstellerischen Produktivität war er die unangefochtene Nummer eins auf dem Gebiet deutscher Gedankenprosa, der Sprachbilddenker, ein Meister aller idiomatischen Klassen. Dieser einsame Sachse hat so gut wie alles gewußt, was es im Deutschen nach Goethe und Schopenhauer, Kleist und Heine zu wissen galt über Stil, Satzbau, Rhythmen und Tempi. Das trifft sowohl auf die formale Meisterschaft zu, die Beherrschung des Metiers, als auch auf die besondere Intonation – das Pendant zur Handschrift, die spontane, lyrische Beweglichkeit im Medium der Sprache.
Es ist seine Stimme – man erkennt sie auf Anhieb, die Wort für Wort als gebündelte semantische Energie auftritt. Die Stimme, verstanden als Instrument von Vernunft, Instinkt, Musikalität, Urteilskraft, persönlicher Strategie, und – Erotik. Diese Stimme zieht alle Register, vom Täubchengurren der zarten Seele bis zum schneidenden Kasernenhofton. Alles wird in die Diktion verlagert. Raffinierte Tonlagen- und Perspektivenwechsel sorgen dafür, daß die Grundspannung von der ersten bis zur letzten Zeile nie nachläßt; seine Ansichten ändern sich, manchmal innerhalb eines Jahres, bis exakt das Gegenteil gilt – aber jede von ihnen beansprucht die gleiche Dringlichkeit, die gleiche Brisanz. Es ist die poetische Stimme, die erzwingt, was wir denken und fühlen, sie gibt den Grundton an, auf den sich der Leser einstimmen wird.
Friedrich Nietzsche, soviel ist sicher, hat gewußt, was Gesangskunst heißt. Er hat mehr von der Zauberkraft der Intonation verstanden als die meisten seiner Denkerkollegen. Seine Ausdrucksfähigkeit testet die Übergänge von der Literatur zur Musik. So ist seine Prosa, laut Selbstauskunft, „eine Art Musik, die zufällig nicht mit Noten, sondern mit Worten geschrieben ist“. Verräterisch ist daran allenfalls das „zufällig“, es plaudert den geheimen Unterschied aus, unter dem dieser Künstler-Philosoph gelitten hat wie kein zweiter. Sein Ohr war geschult durch die tägliche Klavierimprovisation. Er fängt mit Stilkritik an, sobald er sich in die Philosophiegeschichte vertieft. Alle Parameter seiner Prosa weisen in dieselbe Richtung. Da ist das eigentümlich Alliterierende seiner Redeweise, die häufige Verwendung stabreimähnlicher Konstruktionen (Wahn, Wille, Wehe). Da ist das Vielsagende seiner Interpunktion. Man muß nur einmal probeweise eine beliebige Seite Nietzsche weit genug von sich halten, um zu sehen, wie da mit den Kommata, Pünktchen und Gedankenstrichen gearbeitet wird. Vor allem der Gedankenstrich, er ist die Muskalatur dieser Prosa, – während der Sperrdruck ihr als optisches Sensationsmittel dient.
Alles in allem ist hier eine Sprache am Werk, die auf maximale rhetorische Wirkung berechnet war. Nietzsche verstand sich auf das Umgarnen des Lesers, wohl wissend, daß Lesen auf Selbstverstrickung hinausläuft, zumindest im Idealfall, dem einer komplexen seelischen Intrikation. Dies war seine Verführerseite, der Redner mit Engelszungen, der Bewußtseins-Belletrist. Er konnte aber auch anders, immer dann, wenn er auf Widerstand stieß oder fürchten mußte, vereinnahmt zu werden. Dann wechselt der Ton schlagartig ins Kalte, Herrische. Dann häufen die Selbstzitate sich, werden dem Leser die eigenen Thesen solange eingebleut, bis sie Gesetzeskraft haben. „Wie man mit dem Hammer philosophiert“, nannte Nietzsche das, und er erwies sich darin als Erfinder einer Reklametechnik, die sehr bald Karriere machte: in den modernen Diktaturen als Propagandawaffe, in der freien Marktwirtschaft als Rekursprinzip aller Werbeindustrie. Die Überredung, die zwingende Wiederholung, die autoritäre Pointe und Pose, dies sind, neben der garantierten Prägnanz, die typischen Stilmittel, mit denen Nietzsche aus dem Philosophieren eine Kunstform gemacht hat. Und zwar so gründlich, daß sich mitunter schwer sagen läßt, wo hier das Denken aufhört und die schöne Sentenz beginnt. „Dann kommt Nietzsche“, sagt Gottfried Benn, „und die Sprache beginnt, die nichts will (und kann) als phosphoreszieren, luziferieren, hinreißen betäuben.“
Der spezifische Nietzsche-Stil, was war das? Jedenfalls mehr als nur eine Bewegung innerhalb der Grenzen des Satzes; in Wirklichkeit jedoch ein Entfesselungsakt, eine Dynamik, ins Krankhafte gesteigert, den Satzbau sprengend, ihn von allen Seiten zugleich angreifend – um das Diktat der Zeit (in Form der Grammatik, der Logik) zu überwinden. Seine Mittel hierfür sind dieselben, wie die Poetik sie kennt: Assoziationssprung, Enjambement, der Einsatz von Echo und Evokation, in den späteren Texten das strikte Staccato und Dacapo. Das Neue an seiner Philosophensprache war dabei gleichzeitig das Allerälteste, die Annäherung im die Orakelsprache der Vorsokratiker. Was hier stattfand, war eine Ausdruckserneuerung aus dem Geiste der Sprache selbst – auf Kosten des Sprechers, der bei dieser Übung zugrunde ging. Kennzeichen dieses Stils ist die äußerste Verkürzung, die Mitteilung innerer Zustände, inszeniert als dramatische Abbreviatur. Das Genre ist eher begrenzt oder vielmehr hochkonzentriert; seine Konstanten sind der Gedankenmonolog, die Koloratur der Affekte und Leidenschaften, eine Variation auf das sehr cartesische Thema „Passions de I’âme“ – nach dem Muster von Richard Wagners „unendlicher Melodie“. Was nach außen oft unfreiwillig komisch erscheint, diese ganze herzzerreißende Orgie in Narzißmus, ist in Wahrheit ein Paroxysmus des Selbstbewußtseins.
Man weiss vor mir nicht, was man mit der deutschen Sprache kann, – was man überhaupt mit der Sprache kann.
Der vertraute Nietzscheton: Liegt in ihm vielleicht jene Verwandtschaft zur Dichtung begründet, die man dem Philosophen bis zum heutigen Tag attestiert? Philosophie und Dichtung, im Grunde ist es die Geschichte einer unglücklichen Liebe. Nietzsche selbst war darüber völlig im Bilde. In seiner Abhandlung über „Schopenhauer als Erzieher“ gibt er, merkwürdig einfühlsam, eine Briefstelle wieder, in der Heinrich von Kleist davon berichtet, wie er zum ersten Mal Immanuel Kant las. Sie ist es wert, im Ganzen zitiert zu werden.
Vor kurzem, schreibt er einmal in seiner ergreifenden Art, wurde ich mit der Kantischen Philosophie bekannt – und dir muss ich jetzt daraus einen Gedanken mittheilen, indem ich nicht fürchten darf, dass er dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich. – Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Ist’s das Letztere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nichts mehr, und alles Bestreben, ein Eigenthum zu erwerben, das uns auch noch in das Grab folgt, ist vergeblich. – Wenn die Spitze dieses Gedankens dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken und ich habe keines mehr.
Ich kenne da jemanden, dem es später ganz ähnlich erging, nur daß Wahrheit zu seiner Zeit, einer durch und durch politisierten Zeit, Utopie hieß; und so schrieb er, in beinah derselben ausweglosen Lage, in einem frühen Gedicht die Zeilen:
… man
sah uns nicht an wie
uns zumute war beim
Verlöschen der Ziele
Dieser Jemand bin ich gewesen, aber das gehört schon nicht mehr hierher. Sowenig wie die Schilderung der Umstände, unter denen ich, ein ostdeutsches Schattengewächs, auf Friedrich Nietzsche stieß, damals im Tal der Ahnungslosen. Oder vielleicht doch? Aufgewachsen bin ich mit den blauen Bändchen des Alfred-Kröner-Verlags, Beutestücke von meinen Streifzügen durch diverse Dresdner Antiquariate. In der DDR gehörte Nietzsche, was heute längst vergessen ist, zu den streng verbotenen Autoren, wie lange Zeit auch Sigmund Freud und Franz Kafka ein Fall für die Giftschrankabteilungen der staatlichen Bibliotheken. Insofern erfüllt mein Auftritt hier mich mit einer gewissen Genugtuung. Zumindest hilft er mir über einige heikle Erinnerungen hinweg, Anekdoten wie jene von der einzigen Nietzschepublikation zu Lebzeiten der DDR. Als in der Bertolt-Brecht-Buchhandlung zu Berlin, anderthalb Jahre vor dem Mauerfall, die Prachtausgabe ausgerechnet des Ecce homo im Schaufenster auslag, stand im strömenden Regen der Marxist Wolfgang Harich, ein Schüler des Nietzscheverächters Georg Lukács, und versuchte sich in der garstigen Kunst der Agitation, indem er jeden potentiellen Käufer, der den Laden betreten wollte, warnte vor diesem faschistischen Scheusal, dem Hofnarren Adolf Hitlers und heimlichen Mordkomplizen der Himmler und Goebbels. Die peinliche Szene, ich nahm sie damals als Menetekel. Ich weiß noch, wie ich frohlockte und dachte: Nun ist es vorbei. Nietzsche in Ostberlin, in unmittelbarer Nähe zu Hegels Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, das ist der sozialistische Weltuntergang. Doch zurück zu Kleist und seinem todtraurigen Geständnis. Nietzsches Kommentar:
Ja, wann werden wieder die Menschen dergestalt Kleistisch-natürlich empfinden, wann lernen sie den Sinn einer Philosophie erst wieder an ihrem heiligsten Innern messen?
Wohlgemerkt, hier spricht ein Denker von einem Dichter, und dies im Ton innigster Mitleidenschaft, als Bruder im Geiste. Wer so eindringlich von der Verzweiflung an der Wahrheit schreibt, von den Risiken schöpferischer Einsamkeit, die beim vulkanischen Menschen manchmal zur Implosion aller seiner Kräfte führen, der weiß Bescheid über die Künstlernatur. Die Einsamkeit des Metaphysikers unterscheidet sich, so gesehen, wenig von der des Dichters. Insofern mag gerade in Nietzsches Fall unangebracht sein, was ich jetzt sage. (Es ist dies der heikelste und schwierigste Teil meiner Rede, aber er führt mich zu einigen Schlußfolgerungen und damit zum Schluß.)
Philosophie und Dichtung – es war ein Euphemismus, zu sagen: die Geschichte einer unglücklichen Liebe. In Wirklichkeit war es die eines Verrats, eines Liebesverrats. Vergessen wir nicht: Die Philosophie ist, zumindest in unsren Breiten, eine griechische Pflanze, und sie wuchs, zunächst als dunkles Unkraut am Wegrand, später in den Gewächshäusern der Platon und Aristoteles, aus dem Boden des weitaus älteren Epos – das heißt aus der fruchtbaren Text-Erde homerischer Heldengesänge, dem Humus der Lehr- und Welterschaffungsgedichte des Hesiod. Anders gesagt, sehr verkürzt und brutal: Sie ist ein Nebenprodukt der großen Erzählungen, die lange vor ihr da waren und das meiste schon wußten. In ihrem Schatten gedeiht sie als Arabeske und Kommentar, bevor sie sich eines Tages als Spruchweisheit emporreckt und in den Rätsel- und Orakelreden der Vorsokratiker zur wilden Sonnenblume erblüht.
Den Fragmenten des Parmenides sieht man ihre Herkunft noch an, die Hexameterform bezeugt noch die Nähe zu universeller Bildlichkeit und Gesang. Sie beginnen mit einer Anrufung der Musen, den Inspiratorinnen aller Erkenntnis, und auch Homers „vielwissender Mann“, dem Athene die Augen öffnet, hat seinen Auftritt in ihnen. Aus den Prosafetzen des Heraklit dagegen spricht bereits eine andere Sprache, die der bewußten Vieldeutigkeit, auch Rätselhaftigkeit, der Lossagung von allerlei lexikalischen Zwängen, beste Voraussetzung für jede zukünftige semantische Hegemonie (vulgo: der Wille zur Macht). Was war geschehen? Nichts geringeres als eine vollständige Usurpation. Im Grunde hat alles Philosophieren ganz harmlos angefangen als kluge Textauslegung und -deutung. Bald aber wurde aus solcher Hermeneutik der Diebstahl der Botschaft durch ihren Überbringer – in diesem Fall Hermes, den flinken Götterboten. Er wird zum Schutzgott der Denker, indem er die Dichter um die Früchte ihres Schaffens bringt. Es mußte so kommen: „Das Mehr nämlich ist die Erkenntnis“, wie es bei Parmenides verräterisch heißt. Und so nimmt eine Konfliktgeschichte ihren Lauf, die bis heute fortwirkt. Sie beginnt mit der Enteignung der Poesie und endet mit ihrer totalen Entmündigung. Nach der öffentlichen Infragestellung der angestammten Erzählerautorität war es nur noch ein Katzensprung bis zu Platons perfidem Vorschlag, die Dichter selbst, diese Bande von Lügnern und Illusionisten, aus dem Staat zu verbannen. Aus Fabulierern wurden Verlierer. Jahrtausendelange Gewöhnung und Disziplinierung half den Gewaltakt vergessen zu machen. Aber immer noch spricht aus dem Gewissen einzelner redlicher Philosophen (von Empedokles über Vico und Schelling bis zu Benjamin und Deleuze) die Erinnerung an den Verrat. Durch die Ursünde ihrer Entzweiung sind sie bis heute aneinandergekettet geblieben – zu ihrem beiderseitigen Glück.
Über all das kann man bei Nietzsche Auskunft erhalten. Angenommen, es gäbe sie wirklich, die Demarkationslinie zwischen Dichtung und Philosophie (zwischen Dichtung und Wahrheit, um genauer zu sein), dann war Nietzsches Leben ein Tanz auf der Grenze, besser: im Niemandsland zwischen den beiden Reichen. „Ich will der Dichter meines Lebens sein…“, lautet seine Devise. Er träumte davon, so gelesen zu werden, wie die Schriftsteller von ihren Philologen. Er vergaß nie, was er der Poesie (und der Musik natürlich) zu verdanken hatte; mehr noch, als einer der wenigen Philosophen wußte er, was Poesie überhaupt war – eine Sonde für die noch unbekannten Bewußtseinszonen. „Denken in sichtbaren und fühlbaren Vorgängen, nicht in Gedanken ist das eigentlich Dichterische“, schrieb er 1875 in einem Brief aus Turin. War es nicht eben das, was Nietzsche auf seine Weise geleistet hat? Liegt nicht sein größtes Verdienst genau darin: Wiedergutmachung an der Poesie? Nicht umsonst tauchen bei ihm, wie aus der Trickkiste, die griechischen Götter wieder auf – an einer Stelle, wo kaum ein ernstzunehmender Philologe sie mehr erwartet hätte. Mit einer Intensität, zu der Hölderlin, sein Lieblingsdichter aus frühen Schulpfortatagen, ihn ermuntert hat, läßt er sie abermals auftreten, und zwar als physische Kräfte – inmitten der Metaphysik. Und dies, die Wiederbelebung der Mythen für den Diskurs, hat ihn, jenseits der Romantik, zu einem der folgenreichsten Denker aller Zeiten gemacht.
Drei Eigenschaften sind es, die einen Menschen zum Dichter prädestinieren. Der Verfasser von Jenseits von Gut und Böse hat sie alle drei gut gekannt. Erstens: die enorme Fähigkeit, zu staunen – dem Augenblick hingegeben, Fragen zu stellen, wie nur das Kind sie sonst stellt. In dieser Hinsicht bestand zwischen Nietzsche und seinen Favoriten kein nennenswerter Unterschied. Und das waren immerhin Leute wie Leopardi und Baudelaire, Byron, Poe oder Gogol. „Die Welt ist für ihn ein Urwald, den es zu erforschen gilt, nur so ist sie interessant“, hat sein Herausgeber Giorgio Colli ihm bescheinigt. Das Zitat erinnert an einen Ausspruch der russischen Dichterin Marina Zwetajewa:
Wir alle sind Wölfe im Urwald Ewigkeit
Das zweite Charakteristikum ist etwas vertrackter, es betrifft den Umgang des Dichters mit seiner Muttersprache. Hier kann als eine Art Faustregel gelten: Im Gedicht ist das Wort in einen höheren Schwingungszustand versetzt. Ein Gedicht wird – über die bloße Wortkombination hinaus – zum Gedicht, weil in ihm unzählige andere Gedichte mitschwingen. Weil es die Relationen von Wort und Welt, Ding und Definition zum Klingen bringt. Weil es das Sprachempfinden des Lesers elektrisiert. Die Mittel sind dabei denkbar mannigfaltig. Die Stromstöße sind nicht beschränkt auf das, was man gebundene Rede genannt hat, oder gar auf ihr Gegenteil etwa, den freien Vers. Eine der besten Begründungen für die Metrik allerdings stammt von Nietzsche. Er nennt es „in Ketten tanzen“ und deutet hier an, daß es womöglich Techniken gibt, die einem helfen, über sich selbst hinauszugelangen durch Disziplinierung des Ausdrucks. Die dritte Qualitätsforderung, vielleicht die wichtigste überhaupt, ist: Du sollst ein Primärautor sein. Du sollst dich nicht kümmern, wie andere vor dir dasselbe schon einmal dachten, du sollst es auf deine Weise sagen. Bleibe immun gegen die Gifte der Sekundärliteratur. An dieser Stelle kommt Nietzsches Stimmbegabung zur Geltung. In puncto Originalität des Selbstausdrucks war er den meisten seiner dichtenden Zeitgenossen turmhoch überlegen. Man lese nur einmal im Zarathustra, Zweiter Theil, das Kapitel mit der Überschrift „Von den Dichtern“, wo es heißt:
Aber gesetzt, dass Jemand allen Ernstes sagte, die Dichter lügen zuviel: so hat er Recht, – wir lügen zuviel
Aber Vorsicht! Es heißt dort auch:
Ich wurde der Dichter müde, der alten und der neuen: Oberflächliche sind sie mir Alle und seichte Meere.
Ach Nietzsche…
Der Dichter gehört einem Nichtstand an, meint Novalis. Und längst ist das Frohlocken darüber, oder sagen wir besser: die Schadenfreude, einem Unbehagen gewichen, seit sich herumgesprochen hat, daß niemand mehr, in keiner Profession, einem festen Stand angehört. Alles ist ins Wanken geraten auf diesem globalisierten Erdball, und die meisten Leute fliegen nun wie die Hummeln umher zwischen kurzfristigen Tätigkeiten, die ihnen immer weniger Befriedigung verschaffen. Nur der Dichter steht dort, wo er immer schon stand, am Rand der Gesellschaft. Nur er tut das, was seinesgleichen seit zwei, drei Jahrtausenden immer schon tat. Im übrigen, was heißt es denn, sich als Dichter durchs Leben zu schlagen? Die Ansichten hierüber gehen unter den Betroffenen weit auseinander. Eine der schlüssigsten stammt von der russischen Dichterin Anna Achmatowa:
Ein Dichter ist jemand, dem man nichts schenken und dem man nichts nehmen kann.
Da ist es wieder, nicht wahr, sie trösten sich selbst? All sein Sehnen, all sein Streben, alles Denken hebt so ein Vögelchen auf in diesen kleinen Sprachgebilden, die man Gedichte nennt. Sie sind es, die ihn Zeile für Zeile hinaustragen über alles, was bis dahin gedacht und gefühlt wurde. Unbekümmert singt das und tiriliert vor sich hin, verantwortungslos – oder vielmehr verantwortlich nur vor sich selbst. Der Preis für solchen Eigensinn, Eigensingsang ist mitunter recht hoch. Das Wort Elfenbeinturm sagt es, er kann zur Einzelhaft führen, zu Käfig und Isolation. Doch er ist noch viel höher für den, der wie Nietzsche durchschaut hat, was die Dichter da treiben… „mit ihren Aufflügen Vergessenheit suchend vor einem allzutreuen Gedächtniss“, wie er in Jenseits von Gut und Böse orakelt. Er selber war ja nicht frei von solcherlei Elevation. Er war das, was mancher von ihnen sich unter dem idealen Leser vorstellt. Man hat es hier mit einem Menschen zu tun, der in einem ungeheuren inneren Echoraum lebte. Entsprechend groß war sein Resonanzboden für alles, was zwischen Himmel und Erde auf Schallwellen daherkam, für jedes fordernde Dichtertimbre, jede orphische Schwingung. Nietzsche, der Resonator, die einmalige Erscheinung eines schwingungsfähigen philosophischen Systems. Der Mensch als Frequenzverstärker, als wandelnde Luftsäule unterwegs durch die Wüste, die wächst. Er kann einem leid tun mit seiner hypernervösen Empfänglichkeit für alle Schwingungen, Strömungen, Zwischentöne, physischen und metaphysischen Dissonanzen. Wie vor ihm Hölderlin hat er tief in den Knochen den Schlag des Apollon gespürt; doch in der Blutbahn rauschte Dionysos, der Gott der Entgrenzung, der Trunkenheit. Dies und sein Sensorium für alles, was direkt zu ihm sprach, erzeugte in ihm eine Stimmenvielfalt, die ihn zuletzt gesprengt hat. In diesem Kopf mit der mächtigen Schädelwölbung muß es zugegangen sein wie in einer Voliere voller exotischer Papageien. Alles ging gut, solange die Tiere in ihm das Gleichgewicht hielten. Er feiert die Welt, schreibt Gedichte wie jene wundervollen „Idyllen aus Messina“, wo es heißt:
Du ein Dichter? Du ein Dichter?
Stehts mit deinem Kopf so schlecht? –
Auf dem Höhepunkt beherrschte er wie kein zweiter die Kunst, das Auftauchen der Worte im rechten Augenblick zu inszenieren. Was dann geschah, wissen wir. Etwas zerbrach, und übrig blieb nur mehr der einsame Schrei des Ara. Hier kommt nun leider das schlimme Wort von der Schizophrenie ins Spiel, und es verbietet sich, weiter zu spekulieren. Doch diese Stimme, noch im Moment des geistigen Zusammenbruchs war sie deutlich vernehmbar. Es ist dieselbe noch immer, die in den Turiner Wahnsinnsbriefen um Worte ringt. Man darf mit ihr weiterträumen, auch wenn es zu spät ist und alle zukünftige Geschichte längst uneinholbar. An Franz Overbeck, einen der alten Freunde, schreibt er:
Ich lasse eben alle Antisemiten erschießen… Dionysos.
Hätte man nur auf ihn gehört, ein anderer Stimmgewaltiger wäre uns möglicherweise erspart geblieben. Das Phänomen Stimme ist, soweit ich sehe, das einzige, was die beiden verbindet. Wie hat Mazzino Montinari, der zweite seiner Herausgeber, gesagt?
Durch Hitler wissen wir, was Nietzsche nicht war; durch Stalin wissen wir, was Marx nicht war.
Ich betrachte die Totenmaske des Friedrich Nietzsche, aufbewahrt im Marbacher Literaturarchiv, dieses schiefe Gesicht, zerrüttet von der Psychose, und der Mann tut mir unendlich leid. Daß einer so weit davonlaufen mußte vor der Menschheit, um bei sich selbst anzukommen, erfaßt mich mit Furcht und Schrecken. Doch es hat nichts von Katharsis, wenn ich mir sage: ein Denker, ja, beinah ein Dichter, so nackt mit all seinen geflügelten Worten, so unverstanden, so populär.
Durs Grünbein, Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 2005
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM +
Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Orden Pour le mérite + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


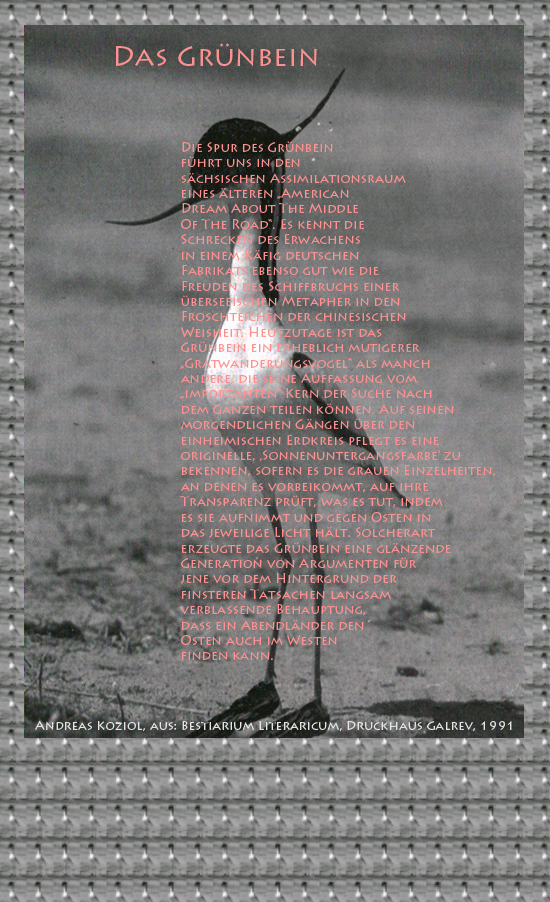
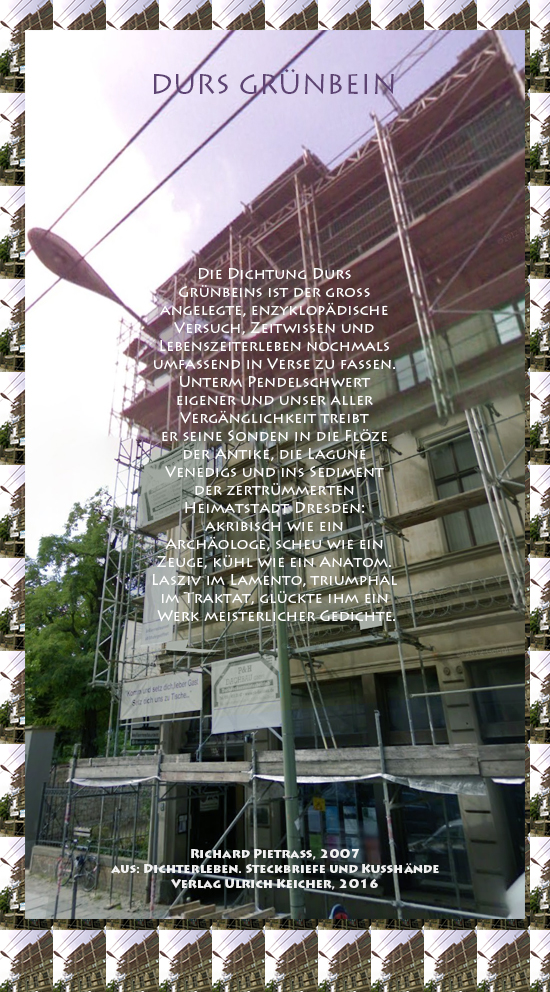












Schreibe einen Kommentar