Stephan Hermlin: Poesiealbum 64
DIE ZEIT DER WUNDER
Die Zeit der Wunder ist vorbei. Hinter den Ecken
Versanken Bogenlampensonnen. Ungenau
Gehen die Uhren, die mit ihrem Schlag uns
aaaaaschrecken,
Und in der Dämmrung sind die Katzen wieder grau.
Die Abendstunde schlägt für Händler und für Helden.
Wie dieser Vers stockt das Herz, und es erstickt der
aaaaaSchrei.
Die Mauerzeichen und die Vogelflüge melden:
Die Jugend ging. Die Zeit der Wunder ist vorbei.
Es war die gute Zeit der Schwüre und der Küsse.
Verborgen warn die Waffen, offen lag der Tod.
Die Schwalben schrien in einem Abend voller Süße.
Man nährte sich von Hoffnung und vergaß das Brot.
Die halben Worte, die im Dunkel sich verfingen,
Waren so unverständlich wie Orakelspruch.
Hörst du es noch: Wenn wir die Zeit der Kirschen singen…
Ich weiß noch heut der blauen Nebel bittren Ruch.
Ich weiß die tückische Leere noch der Rückzugsstraßen
Und nachtschwarz die Minuten vor dem Drahtverhau.
Der Treue Farben brachen durchs Gewölk der Phrasen.
Zweitausendmal begann das Alphabet mit V.
Und der Bedrohten Rüstung schimmerte von Tränen.
Ich weiß noch, wie im Strom das Boot der Liebe sank.
Ich hab im Ohre noch die Lockung der Sirenen,
Wenn mit dem letzten Wein den Rest der Furcht man trank.
Die Kinder kannten jäh den Sinn der alten Bücher.
Das Messer auf dem Tisch wurde an Worten scharf.
Und Abende zog man sich ins Gesicht wie Tücher,
Wenn man das Stelldichein der Mörder suchte. Darf
Man sich der bittren Racheschwüre noch entsinnen…
Ich hör im Nachtwind brausen noch den wilden Schwan.
Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen.
Die Zeit der Wunder schwand. Die Jahre sind vertan.
Es gehört zu den Eigentümlichkeiten
der klaren und formstrengen Dichtung Stephan Hermlins, daß sie gerade durch die Kühnheit ihres sprachlichen Temperaments die Höhe der zündenden politischen Proklamation erreicht. Die Freiheit der Sprache und die Sprache der Freiheit haben sich in Hermlins brüderlichen Gedichten vereint. Sie rühmen die „Unsichtbar-Sichtbaren“, die Kämpfer des Widerstands gegen jegliche Erniedrigung des Menschen: Leidenschaftlich und beschwörend sprechen sie vom Kexholmer Regiment, von der Asche von Birkenau und immer wieder von der Hoffnung. Mit den großen Leistungen sowohl der deutschen als auch der älteren und neuen Welt-Poesie aufs beste vertraut, die sie eigenwillig verschmolzen und weitergeführt hat, unternimmt es diese Dichtung, der Gleichgültigkeit das Wort abzuschneiden.
Bernd Jentzsch, Verlag Neues Leben, Klappentext, 1973
Wir sind ganz das Werk der Zeit
– Erinnerung an Stephan Hermlin. –
Biographen, deren primärer Schreibimpuls Enthüllungsjournalismus ist, bescheinigte Max Frisch „eine dilettantische, kunstfremde, kleinbürgerliche, langweilige Dorfschnüffelattitude“. Zur „Schriftstellerei“ notierte Frisch in seinem Tagebuch mit Marion:
Was wichtig ist: das Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten, und immer reden diese Worte von den Nebensachen, die wir eigentlich nicht meinen. Unser Anliegen, das eigentliche, läßt sich bestenfalls umschreiben, und das heißt ganz wörtlich: man schreibt darum herum. Man umstellt es. Man gibt Aussagen, die unser eigentliches Erlebnis enthalten, das unsagbar bleibt.
„Die biographische Wahrheit ist nicht zu haben“, gab Sigmund Freud warnend Arnold Zweig zu bedenken, als dieser ihm ankündigte, seinem Leben ein Buch widmen zu wollen. Es ist „unsere Gier nach Geschichten“, die uns bisweilen für die biographische Selbsttäuschung anfällig macht, und auch der Schriftsteller selbst, räumte wiederum Max Frisch ein, erliegt ihr:
Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann, oft unter gewaltigen Opfern, für sein Leben hält, oder eine Reihe von Geschichten, die sich mit Ortsnamen und Daten durchaus belegen lassen, so daß an ihrer Wirklichkeit nicht zu zweifeln ist.
Frischs Roman-Ich in Stiller bekennt:
Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben.
Und die erzählerische Bilanz der Erzählung „Montauk“ lautet:
Ich lebe nicht mit der eigenen Geschichte, nur mit Teilen davon, die ich habe literarisieren können. Es fehlen ganze Bezirke.
Das Zugleichsein von gewesenem und ersehntem Leben, die Dialektik von Geschehenem und Fiktion, von tatsächlichem Tun und Traum, machen erst die Wirklichkeit eines Menschen aus.
Diese Vorbemerkungen sollen an das Recht eines Schriftstellers erinnern, den Mut zu dem Verdacht, daß „Menschen ihre Geheimnisse haben, die sie manchmal nicht einmal den Nächsten anvertrauen“, haben zu dürfen. Die Penetranz, mit der Karl Corino einem Schriftsteller von Rang wie Stephan Hermlin das Recht, seinen Lebensstoff wahrzulügen, abzusprechen versucht hat, ist nicht nur Ausdruck einer unanständigen, menschenverachtenden Schnüffelmethode, sondern auch ein literaturwissenschaftlich unhaltbares Verfahren. Es gibt keine Legenden des Stephan Hermlin, die zerstört werden müssen; nur Mutmaßungen, Geschwätz, Presseerklärungen, amtliche Eintragungen, Fragebögen, Waschzettel, lexikalische Vermerke, Interviews. Das Bild eines großartigen widerspruchsvollen Lebens wird bleiben; an den Stellen, wo zu dick aufgetragen wurde, mag gekratzt werden. Aber man entferne auch den Dreck, der auf das Bild geworfen wurde. Wie Hans Mayer in seinem Nachruf kann ich sagen:
Ich denke an Stephan Hermlin zurück: an einen wirklichen Dichter und einen redlichen Menschen.
Die distanzierte, aber immer vertrauensvolle Freundschaft mit ihm hat mir sehr viel bedeutet.
Zwei wesentliche Gründe bestimmten 1959 meine Entscheidung, von der Frankfurter Universität nach Berlin zu wechseln: der Dozent, von dessen Vorlesungen und Seminaren ich am meisten profitiert hatte, Walter Höllerer, war nach Berlin berufen worden, und diese Stadt, damals nur ideologisch und verwaltungsmäßig, aber noch nicht durch eine Mauer geteilt, lockte mit ihren vielen Theatern, von denen mir das Berliner Ensemble das vorbildhafteste war, wenn sich auch die Schüler Brechts, die ich dank Hans Bunge (der bei unserer Studententheateraufführung des Antigone-Modells beratend mitgewirkt hatte) bei ihrer Probenarbeit beobachten konnte, allmählich abzunabeln begannen; Benno Besson jedenfalls und C.M. Weber inszenierten inzwischen am Deutschen Theater, verkehrten aber weiterhin im Stammhaus, weil die Vorstellungen des DT damals im Schiffbauerdammtheater stattfanden.
Stephan Hermlin, obwohl am Theater großen Anteil nehmend, aber nicht für die Bühne schreibend, als Lyriker eher nur an der Form der szenischen Kantate oder der Einrichtung einer klassischen Vorlage für die Zwecke des Musiktheaters interessiert, nahm auf der Bühne des Berliner Ensembles Platz, wenn der in Spanien gefallenen Kämpfer gedacht wurde, er und Helene Weigel Gedichte lesend, Ernst Busch sang Lieder und Jeanne und Kurt Stern zeigten ihren Film über Spanien. Im Theater, bei Proben oder Premieren, konnte man Stephan Hermlin nicht begegnen, doch war er über die Angelegenheiten des Theaters bestens informiert und versäumte es nicht, seine Gäste nach ihren Eindrücken und Meinungen über neue Stücke und Inszenierungen zu fragen. Hermlins geschiedene Frau Lily arbeitete als Dramaturgin am Deutschen Theater und beider Tochter Cornelia ließ Interesse für die Schauspielerei erkennen; sie besuchte dann die Staatliche Schauspielschule in Schöneweide und konnte ihre höchst sensible, streng-intelligente Spielweise, mich an Maria Wimmer erinnernd, bisher am überzeugendsten im Dresdner Ensemble Wolfgang Engels entfalten.
Als „Spanienkämpfer“ hat sich Stephan Hermlin mir gegenüber nie bezeichnet; da er sich mit dem republikanischen Spanien identifizierte und mit den meisten Schriftstellern, die in Spanien gekämpft oder sich für die Unterstützung der Republik publizistisch engagiert hatten, befreundet war, gehörte er für uns Jüngere unbedingt „dazu“. Auch die als Spanienkämpfer offiziell geehrten Schriftsteller Erich Arendt, Willi Bredel, Kurt Stern, Bodo Uhse und Ludwig Renn zweifelten nicht an seiner Zugehörigkeit. War der Lyriker Paul Eluard, der die Leiden des spanischen Volkes im Gedicht beklagte, wirklich an der spanischen Front? Pablo Neruda, Freund des von den Faschisten ermordeten Dichters Lorca, bewirtete in seinem Madrider Haus die Kämpfer für die Republik und mußte wegen seiner Parteinahme sein Amt als Konsul aufgeben und Spanien verlassen, ehe er dort Brigadier hätte werden können. Er konnte nur noch beim notwendigen Untertauchen der vor Franco Fliehenden in Frankreich und später in Chile helfen, wo ab 1938 für einige Jahre ein progressiver Wind wehte. Nerudas Name wird immer genannt werden, wenn vom Spanischen Bürgerkrieg die Rede ist; eines seiner wichtigsten Gedichtbücher heißt Spanien im Herzen. In bewegenden Versen stimmt der chilenische Dichter Gesänge der Trauer über die Leiden der spanischen Bevölkerung an, über die Gräber und Ruinen, die Angst und das Entsetzen, die dem „Hinrasen von Bestien“, den Truppen der Generäle Franco und Mola zu verdanken waren. Muß man Augenzeuge gewesen sein, um ein Gedicht wie „Die Schlacht am Jarama“ schreiben zu können? Oder „Ankunft der Internationalen Brigaden in Madrid“:
voller Feierlichkeit und mit blauen Augen von weither kommend, aus eurer Ferne, aus euern ganz verlorenen Ländern, aus euern Träumen… um die spanische Stadt zu beschirmen, in der die belagerte Freiheit fallen könnte und sterben von Bestien zerrissen.
Und Neruda steigert die Verbrechen benennende Klage in „Erklärung einiger Dinge“ zur emphatischen Anklage:
Banditen mit Flugzeugen und Marokkanern,
Banditen mit Ringen und Herzoginnen
Banditen mit segnenden schwarzen Mönchen
kamen vom Himmel, um Kinder zu töten,
durch die Straßen das Blut der Kinder
floß einfach, wie das Blut von Kindern.
Generäle
Verräter:
seht mein totes Haus,
seht mein zerbrochenes Spanien:
doch aus jedem toten Haus schießt brennendes Metall
anstelle von Blumen,
aus jedem Loch in Spanien
springt Spanien empor,
aus jedem ermordeten Kind wächst ein Gewehr mit Augen,
aus jedem Verbrechen werden Kugeln geboren,
die eines Tages den Sitz
eures Herzens finden werden.
Ihr fragt, warum seine Dichtung
uns nichts vom Traum erzählt, von den Blättern,
den großen Vulkanen seines Heimatlandes?
Kommt, seht das Blut in den Straßen,
kommt, seht
das Blut in den Straßen,
kommt, seht doch das Blut
in den Straßen!
Anna Seghers schrieb im Vorwort zu dem von Stephan Hermlin übersetzten Neruda-Gedichtband Beleidigtes Land (der 1949 im Verlag Volk und Welt erschien und bereits die von Hermlin übersetzten Gedichte aus Spanien im Herzen enthält):
Daß aber diese Nachdichtung möglich wurde, mit so viel Schwung und mit so viel Treue, das ist ein Geschenk an Neruda, das aus demselben Stoff kommt, aus dem er gemacht ist.
„Das spanische Blut“, erklärte Neruda in seiner Autobiographie, „übte solche Anziehungskraft aus, daß es die Dichtung einer großen Epoche zum Tönen brachte.“ Auch heute besteht kein Anlaß, die „naive“ Erklärung Nerudas für die Reinheit und Größe dieser vom „Spanienerlebnis“ inspirierten Kunst eines Picasso, Eluard, Aragon, Buñuel, Max Aub, Auden, Stephen Spender und eben auch von Stephan Hermlin verächtlich zu belächeln.
Der Name Stephan Hermlins, des Übersetzers der Spanien-Gedichte Nerudas und Paul Eluards, war mir sehr früh vertraut, denn der Spanische Bürgerkrieg und die Gedichte, Romane, Bilder und Filme der von ihm Zeugnis ablegenden Künstler war die Triebfeder meines politischen Engagements im Widerpart zur mich belastenden deutschen Tradition, wo die Poesie nach dem Mief der vernaziten Deutschlehrer roch, jedes Lied nur den Frohsinn von Gesangvereinen, den Stechschrittrhythmus besoffener Soldaten oder die anzügliche Sentimentalität deutschtümelnder Stammtischrunden ausstrahlte.
Bei zwei oder drei Veranstaltungen habe ich Stephan Hermlin 1960 persönlich erlebt, aber nicht näher kennengelernt; das Vorurteil, er sei ein „englischer Lord“ und eher unnahbar, hatte auch ich mir unwillkürlich angeeignet, andererseits interessierte mich der Vorwurf nicht, weil allgemein beliebte Autoren, die „zum Anfassen“ sind und ihre Leser höflich wie Kunden bedienen, selten mein Interesse zu wecken vermögen. Erich Fried zum Beispiel war so ein allseits geschätzter Poet und Redner, der mir zu banal, „gut“ und hemdsärmelig daherkam, über dessen papierene Vietnam-Gedichte oder solenn-smarte Liebesgedichte ich mit Elias Canetti ernsthafte Kunstdebatten in herzlich spöttischem Einverständnis führen konnte. Stephan Hermlin dagegen schätzte Frieds Lyrik, widersprach meinem Mißfallen und entschuldigte selbst die einfältigsten Kommentare dieses Dichters, die er erklärend jedem Gedicht bei Lesungen hinzuzufügen pflegte, was jedes germanistische Hausfrauenherz (und besonders die Bremer Studentenhausmännerherzen) höher schlagen ließ.
Im Gegensatz zu der mir imponierenden geschliffenen, an intelligenter Polemik nicht mangelnden Formulierungslust Stephan Hermlins in der Öffentlichkeit war er privat sehr „vorsichtig“, zurückhaltend und darauf bedacht, die Überspitzungen seines Gegenübers zu relativieren. Mit größtem Respekt begegnete er zunächst jeder Art von dichterischer Hervorbringung, er war ein mehr als verständnisvoller Anwalt der Poeten; am Rednerpult, wenn es um politische Stellungnahmen, Standpunkte und klare Abgrenzungen ging, wurde er glasklar und eindeutig, stolz und bekennerhaft. Öffentlich konnte er jemand in die Schranken verweisen, Haß bekunden, Entschiedenheit an den Tag legen. Es fehlte ihm nie der Mut, Haltungen zu bekunden.
Einer der eindrucksvollsten Auftritte Hermlins in dieser Hinsicht war im Dezember 1962 die Verteidigung der Lieder und Gedichte Wolf Biermanns sowie des Gedichts „Meinen Freunden, den alten Genossen“ von Rainer Kirsch in der Akademie der Künste gegen die Anwürfe eines vom ND abgesandten Literaturverhinderers namens Wessel, der an ordinärer intellektueller Rempelei seinem Namenspatron Horst alle Ehre machte; dieser Wessel sah durch Biermanns und Kirschs Verse und deren Befürwortung durch Genossen Hermlin die Riege der politischen Amtsinhaber unerhört beleidigt, den Staat schon aus den Angeln gehoben und dem Klassenfeind Tür und Tor geöffnet; Stephan Hermlin erhob sich, verbat sich das „Du“ und schloß jede Art von Gemeinsamkeit aus, das Maß an Unterstellungen und Zumutungen gegenüber der Sprache von Dichtung und der Haltung junger, der DDR gut anstehender Dichter sei voll, seine Geduld mit derartig propagandistischer Verunglimpfung sei hier am Ende, weil aus der Nazizeit ihm hinlänglich bekannt. John Heartfield ließ sich von Hermlins Empörung anstecken und steigerte sich in ermunternde Zurufe an diese jungen poetischen Stimmen, die „unser Staat“ so nötig habe. Selten endete eine Dichterlesung so gelöst, endlich waren freie und befreiende Worte gesprochen, die Weichen für eine lang ersehnte Wende waren gestellt worden.
Zurück in meiner Westberliner Wohnung, schrieb ich noch in der Nacht einen begeisterten Glückwunsch zu dieser Veranstaltung: „Den ganzen Abend – bei den Gedichten wie bei der Diskussion – hatte ich nie das Gefühl, das geht mich nichts an, laß die doch ihren Mist unter sich abmachen, im Gegenteil, ich bedauerte eifrig, daß ich nur Zuschauer bin und somit ,unbefugt‘, in der Diskussion etwas zu sagen.“ Im Übereifer schloß ich mit einem Leninzitat: „Wer Klippen fürchtet und im Hafen bleibt, dem passiert nicht viel, aber er wird niemals zum anderen Ufer gelangen, dem Ziel unserer Sehnsucht.“ – „Nun, wir werden sehen“, meinte dann, meinen Enthusiasmus dämpfend, Stephan Hermlin. Daß die DDR, für die er sich entschieden hatte, mit der er verbunden war und an der er trotz aller Widrigkeiten festzuhalten entschlossen war, für mich kein Ziel sein könnte, wußte er mir deutlich auseinanderzusetzen.
Einladungen in den „Waitzkeller“, wo sich 1960 bis Anfang 1963 jeden zweiten Donnerstag in Berlin lebende Autoren zu Lesungen, Vorträgen und Debatten einfanden und ich die Rolle Hans-Werner Richters spielte, lehnte er ab, er mochte keine literarischen Gruppierungen, Künstlercafés, Literaturgesellschaften. Er wollte Einzelgänger bleiben und akzeptierte nur die offiziell anerkannten Interessengemeinschaften wie Akademien, Schriftstellerverbände, wo grundsätzliche Fragen, gewerkschaftliche und politische Ziele verhandelt wurden. Gelegentlich trafen wir uns im Club der Kulturschaffenden, aber vorzugsweise bat er mich, in seine Wohnung in die Kurt-Fischer-Straße zu kommen.
Das vertraute Verhältnis ergab sich durch meine Interessen für neuere französische Literatur und einen gemeinsamen Freund, François Lachenal, der mich mit den Pataphysikern bekannt gemacht und mit dem ich Boris Vians Stück Die Reichsgründer oder Das Schmürz übersetzt hatte. Lachenal, ein unermüdlicher Vermittler von Kunst und Literatur über alle Grenzen und Hemmnisse hinweg, hatte Hermlin als Mitarbeiter für die Zeitschrift Traits angeworben, den in einem Arbeitslager bei Genf Internierten zum Übersetzen von Gedichten Paul Eluards angeregt und en revanche Paul Eluard mit Hermlins Gedichten bekannt gemacht. Parallel zum Erstdruck der „Ballade von den Städteverteidigern“ in Traits erschien denn auch im Sommer 1944 die französische Übersetzung von Jean Tardieu in der L’Eternelle Revue. 1940, unmittelbar nach der Kapitulation der französischen Armee, hatte der damals 22jährige Jurastudent Lachenal mit Freunden Traits gegründet, eine schweizerische Zeitschrift, die sich den Widerstand gegen die Nazis und deren Verbündete und gegen Opportunismus und Zensur im eigenen Land zur Aufgabe stellte. François Lachenal, der ab 1942 bei der in Vichy akkreditierten Schweizerischen Botschaft arbeitete, nutzte seinen diplomatischen Status für eine umfassende literarisch-subversive Tätigkeit. In seinem Reisegepäck befördere er Manuskripte französischer Autoren der Résistance, die in Genf bei Kundig gedruckt und bei der Edition des Trois Collines (deren Mitinhaber und späterer Alleininhaber Lachenal war) verlegt wurden; die Bücher wiederum wußte er auf Schleichwegen nach Frankreich zurückzubringen. Ein wichtiger Verbindungsmann bei diesem Literaturaustausch war auch der französische Germanist Pierre Bertaux, Hölderlin-Forscher und ein höchst befähigter Regierungsbeamter. In den dreißig er Jahren war er Pariser Polizeichef und Direktor der Nationalen Polizeibehörde, zeitweilig auch Geheimdienstleiter, in der Vichy-Zeit Widerstandskämpfer. „Unter Freunden“, schreibt Bertaux in seinem Opus magnum, „die einander aus Zufall begegneten, konnte es vorkommen, daß irgendein Ausspruch Hölderlins als Erkennungszeichen diente, selbst ohne daß sein Name genannt zu werden brauchte. Am Ton erkannte man gleich: ,Hölderlin‘!“ Sein Hölderlin-Buch widmete er „meinen deutschen Freunden im Namen Hölderlins“, und zu diesen deutschen Freunden gehörte auch Hermlin, der den französischen Hölderlin-Kenner um die einzigartige Fähigkeit beneidete, eine so selbstverständliche und intime Allianz von Literatur und Politik leben zu können.
François Lachenal, wie gesagt, war ein Meister im Vermitteln von Bekanntschaften, des Zusammenführens der richtigen Leute im passenden Moment; seinem anarchischen Charme erlag am Ende auch der sturste Grenzbeamte, die paragraphenseligste Polizistenseele. Als ich Billy Wilders genialen, 1961 in Berlin gedrehten Film One, two, three viele Jahre später erstmals zu sehen bekam, mußte ich an unsere turbulenten Taxifahrten, die Kontrollen am Brandenburger Tor und ein Tagesprogramm denken, das eine Begegnung mit Peter Palitzsch im Berliner Ensemble, ein Mittagessen im Kreis der Familie von Professor Theodor Brugsch in Niederschönhausen, Gespräche über Munchs Graphik mit Werner Timm im Kupferstichkabinett und einen Besuch von Weisenborns Illegalen im Deutschen Theater zu umfassen pflegte. Das Wiedersehen mit Pierre Bertaux, den wir an einem Abend Anfang Juli 1961 mitbrachten, beglückte Stephan Hermlin sehr, aber bestimmt hätte er sich lieber mit Bertaux in ein Gespräch „Wozu Dichter in dürftiger Zeit?“ vertieft und sich unserem nur wie Tennisbälle hingehauenen Disput über Jarry, Jünger oder den in Kuba die Revolution begrüßenden Sowjetdichter Jewtuschenko entzogen.
Viele meiner Freunde, die dem SDS nahestanden oder sich ihm angeschlossen hatten, überlegten 1960/61, ob sie nicht in das „andere“ Deutschland übersiedeln sollten, wo eine sozialistische Gesellschaftsordnung erprobt oder wenigstens doch angestrebt wurde. „Geh’n Sie doch rüber, wenn Sie solche Ansichten haben“, wurde einem entgegengehalten, wenn man gegen die Wiederbewaffnung, gegen Atomrüstung oder gegen die Notstandsgesetze protestierte. Ich argumentierte oft sehr emotional, leidenschaftlich in eine Idee, in einen Vorschlag, ein Stück oder auch nur einen Vers vernarrt, ich versuchte politisch orientiert zu sein und eine Meinung zu haben, aber es ging mir immer um Dichtung und Kunst, nie um Politik. Wir aus dem Westen, die wir doch in den Osten gehen sollten, störten dort enorm mit unserer Renitenz und Angewohnheit, die Welt mit kritischen Augen zu sehen, eher zu zweifeln als blind zu folgen. Einer meiner Freunde blieb auch nach dem 13. August 1961 bei seinem Entschluß, in die DDR zu gehen; der Philosoph Wolfgang Heise hatte erreicht, daß er in Leipzig studieren konnte, aber nach wenigen Wochen bereits mußte er zurückreisen, er war zu „links“, also ungeeignet für das uniforme Stillhaltebewußtsein, das den DDR-Bürgern lediglich abverlangt wurde.
Der Bau der Mauer war für viele Künstler und die junge wissenschaftliche Intelligenz der DDR auch eine Hoffnung; Stephan Hermlin begrüßte in diesem Sinne „die Maßnahme“ seiner Regierung, nachdem er und namentlich auch Anna Seghers, Arnold Zweig, Ludwig Renn, Peter Huchel, Franz Fühmann, Peter Hacks u.a. von Günter Grass und Wolfdietrich Schnurre ausdrücklich zu einer Stellungnahme aufgefordert worden waren:
Das Unrecht vom 13. August? Von welchem Unrecht sprechen Sie? Wenn ich Ihre Zeitungen lese und Ihre Sender höre, könnte man glauben, es sei vor vier Tagen eine große Stadt durch eine Gewalttat in zwei Teile auseinandergefallen. Da ich aber ein ziemlich gutes Gedächtnis habe und seit vierzehn Jahren wieder in dieser Stadt lebe, erinnere ich mich, seit Mitte 1948 in einer gespaltenen Stadt gelebt zu haben, einer Stadt mit zwei Währungen, zwei Bürgermeistern, zwei Stadtverwaltungen, zweierlei Art von Polizei, zwei Gesellschaftssystemen, in einer Stadt, die beherrscht war von zwei einander diametral entgegengesetzten Konzeptionen des Lebens. Die Spaltung Berlins begann Mitte 1948 mit der bekannten Währungsreform. Was am 13. August erfolgte, war ein logischer Schritt in einer Entwicklung, die nicht von dieser Seite der Stadt eingeleitet wurde. Ich habe meiner Regierung am 13. August kein Danktelegramm geschickt, und ich würde meine innere Verfassung auch nicht als eine solche ,freudige Zustimmung‘, wie manche sich auszudrücken belieben, definieren. Wer mich kennt, weiß, daß ich ein Anhänger des Miteinanderlebens bin, des freien Reisens, des ungehinderten Austausches auf allen Gebieten des menschlichen Lebens, besonders auf dem Gebiet der Kultur. Aber ich gebe den Maßnahmen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik meine uneingeschränkte ernste Zustimmung. Die hat mit diesen Maßnahmen, wie sich bereits zeigt, den Antiglobkestaat gefestigt, sie hat einen großen Schritt vorwärts getan zur Erreichung eines Friedensvertrages, der das dringendste Anliegen ist, weil er allein angetan ist, den gefährlichsten Staat der Welt, die Bundesrepublik, auf ihrem aggressiven Weg zu bremsen…
Die Mauer war das Ergebnis der Politik des Kalten Krieges, und sie war eine Maßnahme, über die es zwischen der Sowjetunion und den westlichen Besatzungsmächten eine Verständigung gegeben hatte. Triumphierend wiesen alle Anhänger der Frontstadt-Politik auf die Lächerlichkeit der Politik der Linken hin, daß Diskutieren besser als Schießen wäre:
Der Traum von der Literaturrepublik, in der jede Partei an ihrer eigenen Regierung herummäkelt, bis man sich bei einer mittleren Linie getroffen hat, ist ausgeträumt. Diskutieren statt Schießen wollte die Linke. Nun kann sie es nicht mehr. Denn ihre Gesprächspartner verweigern ihr die Passierscheine.
Die Mauer in den Köpfen der Scharfmacher war ein gefährlicher Sprengsatz. Alle, die so gerne geschossen hätten damals, gehörten zu den Miterbauern des nunmehr sichtbar gemachten Eisernen Vorhangs. Man hätte sich diese Mauer sparen können, wenn man Westberlin die Rolle als Stachel im Fleisch der DDR gestrichen und für die Stadt Berlin eine Sonderstatus-Lösung unter alliierter Kontrolle gesucht hätte.
Die Erwartung, durch die Mauer sähe sich die Regierung der DDR nun ermutigt, einen Anfang mit sozialistischer Politik zu machen und den Bürgern als Äquivalent für die Einschränkung der Bewegungsfreiheit geistige Freiheit und Abbau der Funktionärsbürokratie anzubieten, erfüllte sich nicht. Sie nutzte die Mauer lediglich zu einer restriktiveren Politik, sie verschloß sich allen Forderungen nach offener Aussprache, weniger Zensur und mehr Basisdemokratie. Das Verbot der Umsiedlerin von Heiner Müller im Herbst 1961, deren Uraufführung ich miterlebte, empörte mich, ich konnte nicht einsehen, warum sogar die angekündigte Diskussion über die Aufführung verboten und selbst das Programmheft beschlagnahmt werden mußte. Das Berliner Ensemble, das allen Anlaß gehabt hätte, auf dieses Stück stolz zu sein und es auf den Spielplan zu setzen (um nicht auf dem harmlos-opportunistischen Gewitzel der „Frau Flinz“ sitzen zu bleiben), distanzierte sich. Nur Peter Hacks ließ sich sein positives Urteil nicht ausreden und blieb bei seinem Lob auf den Vers der Umsiedlerin. Und Hans Bunge verkannte bewundernswert die Lage, indem er sein enthusiastisches Gutachten mit dem Bekenntnis schmückte, Müllers Stück veranlasse ihn, das Gesuch um Aufnahme in die Partei zu stellen. Heiner Müller sollte verhaftet werden, er mußte Typoskripte und Kopien des Textes abliefern, lediglich sein Handexemplar durfte er behalten; ein zweites Exemplar hatte er entgegen der Anordnung einbehalten und übergab es mir mit der Bitte, es niemand zu geben, es aber sicher zu deponieren, „für alle Fälle“. Stephan Hermlin schrieb ein Gutachten ohne Wenn und Aber, er setzte sich für Heiner Müller bis an höchster Stelle ein; bei einem Telefonat, dessen Zeuge ich war, gab er schimpfend zu verstehen, man solle doch endlich damit aufhören, „unseren besten Schriftstellern“ staatsfeindliche Tendenzen zu unterstellen. Ich bin sicher, daß im wesentlichen Hermlins Intervention verhindert hat, daß die Empfehlung der Stasi-Leute, Müller zu verhaften, nicht befolgt wurde. In einem Brief faßte ich mein Unverständnis über die mangelnde Solidarität der Künstler und über die vertane Chance, dem Gegner zu bekunden, daß ein neuer, sozialistisch erfrischender Wind weht, noch einmal zusammen.
Am 25. Oktober antwortete mir Stephan Hermlin:
Ich begreife Ihre Reaktion, Sie ist nicht so unendlich weit von meiner eigenen. Wir tragen ein teils grandioses, teils jammervolles Erbe mit uns. Aber ich plädiere für diesen meinen Staat, die DDR. Ich weiß: wir könnten mehr Freunde haben, als wir jetzt besitzen, wenn wir klüger, differenzierter, reicher, toleranter und ich weiß nicht was noch wären. Sollte man den Sozialismus aufgeben, weil in ihm Dummköpfe und Engstirnige auftreten? Wie lautet die Alternative zum Sozialismus? Sie lautet Barbarei. Und wenn innerhalb der Barbarei vielleicht manche jener Klügeren, Differenzierteren, kurz mir durchaus sympathischen Leute zu finden sind, die ich lieber hier sehen würde an Stelle gewisser Dummköpfe – es ändert nichts daran, daß diese mir sympathischen Leute nichts am Faktum der Barbarei ändern und hier, Dummköpfen zum Trotz, sich Sozialismus entwickelt. Sie wissen, ich habe mich seit langem entschieden: ich kann mich nicht anders entscheiden, weil man nicht gegen sein Gewissen an kann.
Im Moment geht es um Krieg oder Frieden. In solchen Momenten wird besonders simplifiziert. Das ist manchmal bitter. Und schädlich. Aber dieser Staat kämpft verzweifelt um den Frieden. Das darf man nie vergessen.
Lesen Sie im zweiten Brecht-Sonderheft von Sinn und Form das Gedicht „Nicht so gemeint“. Da liegt der Schlüssel zur Lösung unserer Frage.
Kommen Sie bald vorbei. Rufen Sie mich an. Ihr St. H.
Es ist leicht, aus heutiger Perspektive über die „Nöte“ solcher Rechtfertigungen und Bekenntnisse zu einer einmal getroffenen Entscheidung, zur Partei und zum Staat dieser Partei zu lächeln; im Gespräch bedurfte es der Simplifizierung nicht. Ich zeigte Stephan Hermlin eine Reihe unpublizierter Gedichte Brechts, die deutlich sagten, wie es „gemeint“ war:
Appelle an die Politiker des Landes, den neuen Staat nicht für die Statistik, sondern für die Geschichte und damit für die Menschen zu bauen. Die Chancen, eingreifende Veränderungen zu schaffen, bedauerte Brecht, würden nur unzulänglich genutzt, den „Westen“ in den eigenen Reihen gelte es zu bekämpfen, die ideologische Heuchelei und die verhängnisvolle Mißachtung der „Weisheit des Volkes“.
Stephan Hermlin zählte zu den unbeirrt die Verständigung suchenden Künstlern, die keine Gelegenheit ungenutzt ließen, die Mauer, die ihrem Verständnis nach das Existenzrecht eines anderen, sozialistischen und dem Frieden verpflichteten Deutschland zu sichern hatte, überwinden zu helfen und sie passierbar zu machen. Gedichte oder Prosa schrieb Hermlin in diesen Jahren so gut wie nicht. Die Funktionäre fürchteten, spottete er einmal, in seinen Schubladen stapelten sich die Manuskripte mit Texten, in denen er sich Luft machte und seinen dekadenten Leidenschaften freien Lauf ließ. Er argwöhnte, daß sie ihn lieber heute als morgen loshaben wollten. Den Wunsch, nützlich zu sein, mußte er sich abgewöhnen. Warum blieb er dennoch? Der „Privilegien“ wegen? Von dem Geld, das die Akademie der Künste ihm zahlte, konnte er leben, die Miete für das bescheidene Haus in Niederschönhausen bezahlen. Das „schnelle“ Auto war ein Geschenk seiner Mutter. Kein Vermögen, keine Datscha. Ein Jagdgewehr und die Lizenz, zu gewissen Zeiten Wild zu jagen, das vom Förster zum Abschuß freigegeben worden war. Mir ist jede Art von Jagdleidenschaft fremd, ich teile von ganzem Herzen die Gefühle, an die Jean Renoir appellierte, als er die Treibjagd seines Films Die Spielregel drehte. Stephan Hermlin schätzte diesen Film wie ich, und dennoch hielt er an seiner Lust fest, auf Tiere anzulegen, zumal wenn sie das Gleichgewicht der Natur zu schädigen drohten.
Was Heinrich Böll nach einem freundschaftlichen Treffen mit Stephan Hermlin über ihn und Eduard Claudius (die er unter Anspielung auf ihre Zeit in schweizerischen Arbeitslagern „Tessinomanen“ nannte) in der „Zeit“ als „Erfahrungen während eines Besuchs bei Kollegen in Ostberlin“ schrieb, war keine Satire mehr, sondern niedrige Häme und offenbarte eine kleinbürgerliche Spießergesinnung, die den denunziatorischen Pamphleten der Kurellas verblüffend ähnelte:
Ich betrachte A.’s Tweedjacke. Sie sieht nach London aus und riecht auch danach. (Seine Mutter lebt in London; ich wage die Behauptung, daß er den Tweed auch trüge, wenn seine Mutter nicht in London lebte.)
Von Heinrich Böll hatte Hermlin solchen Hieb nicht erwartet. Angriffe dieser Art schmerzten ihn mehr, als er sich eingestand, sie verstärkten seinen Rückzug auf die Position des stigmatisierten Außenseiters.
Der Kommunist Hermlin blieb bei seiner Entscheidung, seine dichterische Existenz in der Aufgabe aufgehen zu lassen, für eine menschlichere Welt zu kämpfen und an dem schriftstellerischen Auftrag, die Welt als eine änderbare darzustellen, unbedingt festzuhalten. In vielen Gedichten hatte Brecht von den Kämpfen dieser Zeit berichtet, die „Mühen der Gebirge“ beschrieben und die „Mühen der Ebenen“ als die schwierigere Phase revolutionärer Prozesse geschildert:
Du sagst: Du hast zu lange gehofft. Du kannst nicht mehr hoffen. Was hast Du gehofft? Daß der Kampf leicht sei? Das ist nicht der Fall. Unsere Lage ist schlimmer, als Du gedacht hast.
Der Auftrag verlangte, nicht „müde“ zu werden, trotz lästiger Auseinandersetzungen und ärgerlicher Borniertheiten nicht zu kapitulieren, nicht den „üblichen Weg“ zu gehen.
Auch Peter Huchel und die von ihm alleinverantwortlich redigierte Zeitschrift Sinn und Form war den kleinkalibrigen SED-Kunstpolizisten zu elitär, zu welthaltig. Die Akademie, unter deren Dach die Zeitschrift erschien, wurde immer wieder aufgefordert, für die nötigen Änderungen zu sorgen. Noch 1961 hatte mir Peter Huchel erläutert, wie bindend für ihn der Auftrag Brechts gewesen war, Sinn und Form als richtungweisendes Leitschiff nicht nur zu betreiben, sondern in dieser Funktion gegen alle Versuche der ordinären Lukácsianer zu „halten“. Denen den Krempel einfach hinzuschmeißen, würde Verrat heißen. Stephan Hermlin setzte sich 1962 mit viel Geduld und Emphase in erschöpfenden Debatten für Peter Huchel ein und bedauerte mir gegenüber nur die für ihn unbegreifbar nachlassende Lust des Freundes, weiterhin mit Geschick die Holzköpfe in der Akademie (die Abuschs, Kurellas, den „schrecklichen“ Girnus) zu überlisten und in die Schranken zu verweisen. Daß die Freundschaft von Peter Huchel und Stephan Hermlin dann zerbrach, war tragisch für beide. Denn Hermlin hätte sich nie, wie andere Autoren, verbieten lassen, den in Wilhelmshorst isolierten Dichterkollegen zu besuchen. Ein Mißverständnis besiegelte 1963 das Ende ihres kollegialen Zusammenhalts und Zusammenwirkens. Peter Huchel hatte den von der Westberliner Akademie der Künste verliehenen Fontane-Preis zugesprochen erhalten und sollte ihn ablehnen. Als er erfuhr, daß außer Kurella und dem Verlagsmann Erich Wendt auch Hermlin mit ihm sprechen wollte, unterstellte er, daß ihm letzterer ebenfalls die Ablehnung schmackhaft zu machen vorhatte. Diese Unterstellung kränkte wiederum Hermlin, weil er sich gerade als Freund berechtigt fühlte, das Für und Wider einer solchen Angelegenheit mit Huchel zu erörtern. Selbstverständlich hätte er, auch wenn er anderer Meinung gewesen wäre, Huchel nach außen hin nicht „verraten“. Er war viel zu stolz, auf eine altmodisch-sympathische Weise zu „edel“, um sich in solchen Dingen mit Funktionären der Macht gemein zu machen, für die er nur Verachtung übrig hatte, deren Genosse zu bleiben für ihn jedoch Verpflichtung blieb.
Der bewegende Nachruf Hermlins auf Peter Huchel 1981 gibt ein wenig von seinem Stolz preis, jenem Schutzpanzer, über den seine Feinde das verächtlich gemeinte Urteil „außen Marmor, innen Gips“ fällten, was angeblich Brecht im Hinblick auf Hermlins Gedichte gesagt haben soll, die er indessen gegenüber Experten wie Peter Huchel oder Hans Mayer ausdrücklich würdigte und in Sinn und Form gedruckt sehen wollte. Aus Solidarität mit Peter Huchel verließ Hermlin nach dessen Absetzung als Chefredakteur, alle taktischen Argumente in Akademie-Diskussionen nun beiseite schiebend, sofort den Beirat der Zeitschrift, und sein Name stand künftig nicht mehr im Impressum.
Eine bittere Zeit begann. Hermlin, dem man die signalhaft wirkende Lyrikveranstaltung und parteischädigendes Verhalten bei der Diskussion über diese Lyrik vorhielt, erfüllte schließlich die Parteipflicht der Selbstkritik, erklärte aber zugleich, daß er vor der Wiederholung seiner Fehler nicht gefeit sei; er wurde als Sekretär der Abteilung Dichtkunst der Akademie abgesetzt. Darüber verlor der mit seiner eigenen Verletzung genug beschäftigte Peter Huchel kein Wort, er wollte von all diesen Vorgängen nichts mehr wissen und redete doch von nichts anderem mehr in seinen letzten Lebensjahren.
Einer auf ihn einst gehaltenen Lobrede Huchels gedenkend, schrieb Hermlin 1981 in der Zeit:
Nicht ohne Verlegenheit durchlebe ich noch einmal einen Augenblick des Zuspruchs, der die Versicherung enthielt, man sei nicht umsonst hier gewesen. Aber gerade er, der mich geehrt hatte, tat mir später Unrecht, und gerade zu einer Zeit, da ich seiner Hilfe besonders bedurfte. Vielleicht bedurfte er auch der meinen, aber auf unbegreifliche Weise war eine Freundschaft zerbrochen, die fest gegründet schien. Gemeinsame Freunde suchten uns zusammenzuführen, es fruchtete nichts. In bitteren Momenten erwachte in mir die Vermutung, sein Verhalten mir gegenüber sei nur die Fortsetzung dessen, was ich in diesem Land in fünfzig Jahren erfahren hatte. Es kam vor, daß ich ihn solcher Vermutungen wegen entsetzt und lautlos um Verzeihung bat. Ich hörte in mir seine Stimme: „Aber wir sind doch Brüder“…
Beide erwarteten voneinander die besondere, die erlösende Geste. Aus dem Dilemma, daß frei nach Oscar Wilde von zwei Wahrheiten die falsche immer die richtigere ist, fanden sie nicht heraus. Erst nach dem Tod von Peter Huchel konnte Stephan Hermlin feststellen:
Jetzt, da ich ihm ins Nichts nachschaue, finde ich keinen Rest des langen, sinnlosen Grolls in mir.
In Würdigungen von Werk und Leben Stephan Hermlins wird gern auf den Essay über Chateaubriand und auf dessen Bekenntnis verwiesen:
Bin ich auch aufrichtig, so mangelt es mir doch an Offenheit des Herzens: meine Seele strebt immer danach, sich zu verschließen.
Die Zeit, in der Hermlin auf die „Hilfe“ seines Freundes Huchel wartete, war die erste Jahreshälfte 1963. Damals versuchte er, sich seines Dichtertums wieder zu vergewissern, aber es gelang ihm nichts; so „offen“ sprach er mir gegenüber sonst nicht von seinen Träumen, Erfahrungen, leidvollen Erlebnissen, Alpträumen. Ich plante damals ein Buch, das Schriftsteller in Berlin vorstellen, ihre Arbeit, ihr Verhältnis zur Stadt und zur politischen Situation dokumentieren sollte. Ich wollte Querverbindungen aufzeigen, von Kontroversen und Freundschaften berichten, die Stadt, wie sie ist, wie sie war, wie sie sein könnte, im Spiegel von Texten, Graphik und Fotos zeigen. Die Fotos machte Roger Melis. Ich versuchte sehr hartnäckig, für dieses Buch Stephan Hermlin einen Beitrag abzuverlangen. Am 5. März schrieb er mir:
Es tut mir furchtbar leid, aber es geht nicht. Es geht zumindest nicht im Augenblick. Wenn ich etwas versuche, zerläuft es mir auf dem Papier. Es ist nicht meine Schuld. Wessen Schuld es ist, wissen Sie. Der Zustand, in dem ich lebe, ist kein Zustand für Literatur; auch wenn ich äußerlich der alte zu sein scheine. Ich hasse jedes Wort, das ich zu Papier bringe. Es steht Ihnen nach wie vor frei, mein Gedicht „Ballade von einer sterbenden Stadt“ (1944) zu bringen. Ich halte es für ein gutes Gedicht, aber Sie schienen keine große Lust zu haben. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.
Im übrigen: Ob ich da drin stehe oder nicht, macht nichts weiter aus. Ich gehöre sowieso nicht dazu: denn ich gehöre nirgendwohin. Schon gar nicht zu den modischen Namen, und sie sind ja alte vertreten. Mir tut es leid um Sie, und auch um die Mühe, die unser Freund Roger sich gab. Aber vielleicht nehmen Sie doch das Gedicht. A la prochaine… Ihr St. H.
Die richtige Hilfe für Stephan Hermlin war dann die Begegnung mit Irina Belokonewa, Schülerin des Moskauer Germanisten Samarin, Dolmetscherin bei einem internationalen Schriftsteller-Treffen in Leningrad, an dem er teilnahm. Hans Magnus Enzensberger erwähnte bei seiner Rückkehr aus der Sowjetunion, daß Hermlin dort wieder zu heiraten gedenke und die DDR verlassen würde. Am 23. September 1963 schrieb der auf dieses Gerücht Angesprochene:
Ich selber bin seit zwei Wochen wieder hier. Was den Mann aus Tjome angeht, so stimmt seine Information nicht: ich denke nicht daran aus Berlin wegzugehen, vielmehr siedelt meine Frau hierher über. Nur hat sie noch kein Visum, das wir täglich erwarten. Sollte es nicht in den nächsten zehn Tagen kommen, so fliege ich am 5. Oktober noch einmal hinüber – da hat sie nämlich Geburtstag. Ich habe einen sehr guten Sommer verbracht, teils in Moskau, teils in Leningrad, teils in Tallinn. Na, das weitere mündlich. Wenn Sie mich besuchen wollen, dann am besten, wie gesagt, in den ersten Oktobertagen, da ich später vielleicht wieder weg bin. Bestens Ihr St. H.
1963 war das Jahr, in dem sich abzeichnete, was dann 1965 offenbar wurde: daß die Hoffnung auf Erneuerung des sozialistischen Systems und auf eine freie Entfaltung der Kunst eine trügerische Illusion bleiben sollte. Leugnen ließ sich nicht, daß eine im wesentlichen durch Brechts Arbeit beeinflußte großartige Theatererneuerung stattgefunden hatte, daß sich eine junge Literatur der DDR, die etwas zu sagen hatte, entwickelte, die nun auch im Westen Anerkennung fand. Die Parteispitzen und die Kulturbürokratie taten viel, um die bewußtseinsverändernde Kraft von Literatur und Kunst zu bremsen; sie entdeckten sie schließlich als devisenbringenden Exportartikel. Im eigenen Lande aber wollte man möglichst keine Bewegung, keine Diskussionen, keine Veränderungen. Es ging nur noch um die Sicherung des Status quo. Unbeirrt schossen die Dogmatiker ihre ideologischen Worthülsen ab und installierten die totale Stasi-Überwachung. Ihr Traum war nicht der Sozialismus, sondern „Westniveau“. Man verkündete, der Zug, in dem wir sitzen, fährt unaufhaltsam zum sozialistischen Ziel; man wußte aber längst, daß an ein Weiterkommen nicht zu denken war, daß keine Gleise gelegt waren, auf denen der Zug hätte fahren können; die guten Genossen wurden genötigt auszusteigen und kräftig am Zug zu rütteln, „damit niemand merkt, daß es nicht weitergeht“.
Diesen von Heiner Müller gerne ausführlich erzählten und ausgeschmückten „Witz“ kannte auch Stephan Hermlin, er belachte ihn auch, er entsprach aber nicht seinem Denken und Fühlen, seiner Auffassung von Treue zu Entscheidungen, die er an allen Kreuzwegen künstlerischer und politischer Auseinandersetzungen im Laufe seines Lebens getroffen hatte. Für ihn fuhr der Zug immer noch wie zu Lenins Zeiten weiter, „aussteigen“ ließ er nur gelten, wenn es dem Zweck diente, die Weiterfahrt tatsächlich in Gang zu setzen.
Um seinen literarischen Standort zu bestimmen, haben Kritiker Hermlin oft einen Schüler Eluards genannt. Hermlins dichterische Vorbilder, die „Tradition“, der sich seine Dichtungen verdanken, sind jedoch viel mehr Hölderlin, John Donne, Shelley, Keats, vielleicht auch Georg Heym und Ernst Stadler. Aber Eluards und Hermlins gemeinsame Lehrmeister sind Erschütterungen und leidvolle Erfahrungen in Zeiten von Krieg, Gewalt, Verfolgung und Illegalität. Und beide Dichter empfanden ihre literarische Arbeit in hohem Maße eben auch als „sozialen Auftrag“. Peter Huchel hat etwas sehr Richtiges und Schönes über die Eigenart der Hermlinschen Lyrik gesagt:
Die „Ballade von den Großen Städten“, wie auch der größte Teil der späteren Gedichte, haben einen autobiographischen Hintergrund, wenn auch der Dichter als Person sich fast verborgen hält. In zwei großen Städten, in Berlin und Paris, hat Stephan Hermlin ein illegales, ein bedrohtes Leben führen müssen. Und aus Leningrad, Stalingrad, Sewastopol hallten die Stimmen der Städteverteidiger an sein Herz, aus Oradour und Birkenau die Schreie der Opfer. Nicht Traumverlorenheit war die Schwester der Inspiration, es war die rauhe und harte Realität, aus der sich der Dichter die Bausteine für seine Sprache brach. Nur ein klarer und wacher Geist konnte bestehen. Und dort, wo die wahren Märtyrer und Helden der Zeit lebten, suchte er leidenschaftlich das Wort:
Drum gebt mir eine neue Sprache!
Ich gab euch die meine her.
Sie sei Gewitter, Verheißung, Rache,
Wie ein Fluß, ein Pflug, ein Gewehr.
Drum gebt mir eine neue Sprache!
Was Peter Huchel hier über den Realitätsgrad und den Sprachgrund der Gedichte Hermlins bemerkt, gilt ebenso für die Verse Paul Eluards. Die Verwandtschaft, die Nähe ihrer poetischen Konfession, hat nicht nur Hermlin beschworen, auch Eluard ist sie bewußt gewesen. Ihre gegenseitige Wertschätzung stützte sich zunächst ausschließlich auf die Kenntnis der Texte des anderen; ihr persönliches Kennenlernen erfolgte erst 1947. Dem Lektor des Mundus-Verlages in Basel, Otto Morf, der für die Reihe „Erbe und Gegenwart“ einen Eluard-Band plante, schrieb Paul Eluard am 18.8.1945:
Monsieur Hermlin me paraît en effet tout indiqué pour la traduction de mon texte et des poèmes, J’ai pour ses poèmes une très vive admiration, et des amis, plus compétents que moi, m’ont fait de grands éloges de sa traduction des „Armes de la Douleur“.
Da Hermlin zu diesem Zeitpunkt die Schweiz verließ, kam der geplante Band nicht zustande. Die bereits übersetzten Gedichte erschienen dann 1946 in Hermlins erstem deutschen Verlag, der Oberbadischen Verlagsanstalt in Singen.
An Eluard schätzte Stephan Hermlin vor allem, „daß er auch in den furchtbarsten Momenten des Krieges sich selber treu blieb“. Im Nachruf auf den 1952 verstorbenen Dichterbruder schrieb er:
Immer hatte er für die Vereinigung von Mensch und Dichtung gelebt – dies ist die Quelle nicht nur seiner Poesie, sondern auch seiner Entscheidungen. Der Dichter der Liebe starb auf der Höhe einer Woge von Vertrauen, Zuversicht, Glückssehnsucht.
Stephan Hermlins Dichterschicksal war, nicht nur Zeuge des Aufbruchs, der heroischen Kämpfe, der Niederlage Nazideutschlands und des Neubeginns mit vielen Schwierigkeiten, aber voller Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Welt gewesen zu sein, sondern auch, nach einer Zeit größter Anstrengungen, quälender Zugeständnisse und harter Auseinandersetzungen das weltweite Scheitern der sozialistischen Revolution sowie der Staaten, die Sozialismus verwirklichen wollten, miterleben zu müssen.
In den Kämpfen der Zeit erblickt der Schriftsteller die Zeit selbst zuweilen als einen Verbündeten, als ein hohes Segel, unter dem er mitgerissen in die Zukunft fährt. Es sind glückliche Momente; ich habe sie erlebt. Aber die Zeit kann ein anderes, ein mehrdeutiges, ein gefährliches Antlitz zeigen.
Als Schriftsteller ist Stephan Hermlin vielen Verführungen seiner Zeit erlegen. Er hat jedoch immer Rechenschaft abgelegt, seine Irrtümer nicht achtlos verdrängt; er hat nach außen die Wunden, die die Zeit nicht heilte, nie vorgezeigt; er hatte keine Begabung zum „Beichten“, um dann in andere Richtungen hin gefällig zu sein. Sich von der Zeit mitreißen zu lassen war dichterische Schwäche, eine Unvorsichtigkeit „inmitten der schwierigen Strategie der Dichtung“. Kein Opportunismus:
wie ich auch die Worte siebe:
Da war kein Wort, das mir nicht Liebe lieh.
Durch Frost und Flammen trug mich diese Liebe.
Auf Hermlins „Stalin“-Gedicht von 1949 wird anklagend immer gern hingewiesen, der Epilog zu diesem Gedicht, ein Sonett von 1956, aber nie erwähnt. Es endet mit den Zeilen:
Nie reimt sich Liebe auf Beflissenheit,
Und liebend gibt sich Liebe keine Blöße.
Was sie gemeint, wächst herrlich mit der Zeit.
Hinlauschend in der Klassenschlacht Getöse,
Seh ich die künftige Gemeinsamkeit,
Gedenkend seines Irrens, seiner Größe…
Auch dieses Sonett ist angreifbar, es wird Zynikern nur ein höhnisches Lachen wert sein. Hermlin hielt am „Sinn“ von Geschichte fest, er weigerte sich, Stalin und Hitler gleichzusetzen. Wie Brecht im polemischen Disput mit militanten Antikommunisten à la Sidney Hook bestand Hermlin auf „Geschichtsbewußtsein“ und verstand darunter wirkliches Bewußtmachen von Geschichte, das ja mit der Kenntnis geschichtlicher Ereignisse zu beginnen hat. Es ist ein Unding, ein abschließendes Urteil abzugeben; Isaac Deutscher zitierend, meinte er, man sollte Stalin eher in die Reihe der revolutionären Despoten wie Cromwell, Robespierre und Napoleon einordnen und beobachten, wie die Geschichte das Werk Stalins sichten und neu formen wird, „wie sie einst das Werk der britischen Revolution nach Cromwell und das Werk der französischen Revolution gereinigt und neu geformt hat“. Für die Ausgabe der Gesammelten Gedichte 1979 überarbeitete er das Epilog-Sonett noch einmal. Die abschließenden sechs Zeilen lauten jetzt:
Nie reimt sich Liebe auf Beflissenheit,
Und liebend gibt sich Liebe keine Blöße.
Sie scheitert, doch sie meint Gemeinsamkeit.
Geschwisterlich auftretend im Getöse
Der Klassenschlacht erscheint zukünftige Zeit
Mit Bruder Irrtum und mit Schwester Größe…
„L’art est mort, libérons notre vie quotidienne“, „Nie mehr Claudel“, „Wozu Literatur?“ oder „Die Kunst ist eine akademische Neurose“ lauteten die Kampflosungen, die die Mauern der Universitäten, Akademien und Theater nicht nur in Paris 1967/68 zierten. Stephan Hermlin verfolgte die heißen Debatten über den Tod der Literatur oder zumindest ihre Unnützlichkeit und mangelnde politische Relevanz sowie die radikalen Verdammungsurteile sogar über Sympathisanten und Verteidiger der Studentenbewegung wie Sartre, Barrault, Th.W. Adorno zunächst mit Gelassenheit, bald aber mit kopfschüttelnder Ablehnung, kamen ihm doch die meisten Argumente und Polemiken gegen Kunst schlechthin nur allzu bekannt vor. Der radikale Vandalismus war nur ein Aufwärmen vieler überspitzter proletkultistischer Thesen oder der dogmatischen Richtlinien von Vertretern des sozialistischen Realismus. Wir diskutierten sehr intensiv über diese kunstfeindlichen Begleiterscheinungen revolutionärer Bewegungen, über Scheinradikalität, über die bedenkenswerte Kritik, die ein passionierter Linker wie Pasolini an der „hedonistischen“ Ideologie der Protestbewegung übte.
Statt „schwierigere“, sprachmächtige Literatur den Massen nahezubringen, belebten die eher lesefaulen linken Germanisten längst nicht mehr überzeugende proletarische Romane von Klaus Neukrantz, Karl Grünberg oder Theaterstücke von Berta Lask, für deren Verbreitung Hermlin 1931/32 selbst gesorgt hatte. Jetzt hätte er lieber Interesse und Begeisterung der jungen Lyriker für die Bücher von Anna Seghers, Ladislav Mňačko (Der Tod heißt Engelchen), Jerzy Andrzejewski (Asche und Diamant, Warschauer Karwoche), Miroslav Krleža (Beisetzung in Theresienburg, Der kroatische Gott Mars), Erwin Sinkó (Roman eines Romans), Louis Aragon und Tibor Déry gesehen. Oder wenigstens aufmerksame Lektüre und genauere Auseinandersetzung mit einem zur Zeit der Studentenbewegung in Deutschland leider völlig mißachteten Schriftsteller erwartet, mit dem Verfasser des proletarisch-revolutionären Romans Schluckebier (1932), der, ein roter Rädelsführer und Marxist, 1933 fliehen mußte, französischer Soldat wurde, in deutschen Lagern war und nach 1945 nach Paris zurückkehrte, den aber die Sehnsucht an sein altes Vaterland stärker fesselte als irgendeinen, der die Heimat nie verloren hatte. Daß man statt dessen Franz Jungs Der Weg nach unten (1961) feierte – Hermlins Meinung nach ein lediglich zynisches, unaufrichtiges und von Selbsthaß durchtränktes Bekenntnisbuch eines treulosen Menschen – und nicht den erschütternden, künstlerisch maßgeblicheren Lebensbericht Geheimnis und Gewalt von Georg K. Glaser, fand er bedauerlich und bezeichnend, wobei er die DDR nicht ausnahm, wo ja das Buch nicht mal die Chance erhalten hatte, nicht gelesen zu werden. (Geheimnis und Gewalt war in deutscher Sprache 1952 zunächst in der Schweiz erschienen, 1953 in Stuttgart und 1954 in billigen Ausgaben bei Ullstein und bei der Büchergilde Gutenberg.) Hermlin blieb lediglich die Genugtuung, Georges Glaser, dem dann mit seinen Büchern und Neuauflagen von 1979 an in Westdeutschland ein wenig Beachtung zuteil wurde, nach dem Fall der Mauer in der Ostberliner Akademie der Künste begrüßen und als einen großen deutschen proletarischen Autor würdigen zu können.
Als ich 1969 aus Zürich, wo ich mittlerweile lebte, Hermlin einen Aufsatz des zu einer Art christlich verbrämtem Maoismus konvertierten Konrad Farner schickte, den wir beide als Verfasser einer Doré-Monographie und eines Buches über den Schweizer Maler Hans Erni schätzten, antwortete er:
Dank für die Übersendung der Farner-Schrift, die ich enttäuschend oberflächlich, überflüssig finde. Wir sind in einer gräßlichen Zeit der Konfusion, die aus Verzweiflung kommt – da kann man eigentlich nur abwarten. (Obwohl man das natürlich nicht tut…)
In einem Brief zu Stephan Hermlins 60. Geburtstag schrieb ich 1975:
Sie haben immer betont, daß Sie nichts ,für die Schublade‘ schreiben (wie die Kurellas seinerzeit befürchteten), dennoch hoffe ich sehr, daß Sie inzwischen damit begonnen haben, Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Begegnungen in literarischer Form festzuhalten. Da Sie zu den Schriftstellern gehören, für die Kommunismus und Kunst sich nicht ausschließen, sondern einander bedingen – und da Sie dabei waren, als die ,Mühen der Berge‘ bewältigt wurden, sollten Sie zu denen als Zeuge sprechen, die an den ,Mühen der Ebenen‘ verzweifeln und ungeduldig sind. In diesem Sinne habe ich immer „Die Zeit der Wunder ist vorbei“ als Ihr Lehrgedicht aufgefaßt.
Hermlin schrieb keine Memoiren, aber 1979 veröffentlichte er die in gestochener Prosa abgefaßte autobiographische Erzählung Abendlicht. Über dieses Buch schrieb ich in der Frankfurter Rundschau:
Die sozialistische Zukunft am Horizont ist nicht mehr zu sehen. Aber der Dichter wird von ihr als Vermächtnis zu kunden wissen. Das Scheitern mit gutgemeinten, nur noch ehrlichen Versen führte zum Schweigen des Lyrikers… Mit der Erzählung Abendlicht hat nun Stephan Hermlin zur Dichtung zurückgefunden. Der Titel geht auf ein Zitat von Robert Walser zurück: „Man sah den Wegen am Abendlicht an, daß es Heimwege waren.“ Hans Mayer hat daran erinnert, daß Blochs Prinzip Hoffnung mit dem Wort ,Heimat‘ endet: Die wirkliche Genesis, heißt es in seiner Rezension der Erzählung in der Zeit, „ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen.“ Hermlins Erzählung ist Resultat solcher Radikalität. Ohne Selbstmitleid bekennt der Autor: „Ich war nicht besser und nicht schlechter als die Bewegung, der ich angehörte, ich teilte ihre Reife und ihre Unreife, ihre Größe und ihr Elend.“ Der Kommunist und Dichter, der sich auf das ,Beste‘ in sich zurückzieht. Peter Weiss nennt es: Ästhetik des Widerstands.
Abendlicht überreichte mir Stephan Hermlin im November 1979 in Bremen „in alter Freundschaft“, und in die Ausgabe seiner Ende 1944 in Zürich gedruckten Zwölf Balladen von den großen Städten, die ich in der Schweiz aufgetrieben hatte, schrieb er mir „Für Klaus Völker, unter alten Zürchern, mit erheblicher Verspätung, Bremen, 26. März 1980“.
In der Notiz „Musik hören“ in seinem 1983 publizierten Buch Äußerungen 1944–1982 kommt die dialektische Spannung seiner Kunstauffassung am schönsten zum Ausdruck:
Erster Syllogismus: Große Kunst ist reaktionär; sie liquidiert notwendige, mühsam erreichte Frontstellungen. Sie fördert die ewige Illusion des Allgemein-Menschlichen. Zweiter Syllogismus: Große Kunst ist revolutionär. Sie löst anachronistische Erstarrungen und macht erst die eigentliche Auseinandersetzung möglich. Die geht um das Allgemein-Menschliche. Es wird als realisierbar empfunden. Aber wie? Aber wann?
Wird die Zeit es uns lehren? Mit August von Platen, an dem, wie er meinte, das Unrecht, das Heinrich Heine ihm in schrecklicher Verkennung angetan hatte, noch immer gutzumachen wäre, mit Platen hätte Stephan Hermlin folgendes entgegnet:
Die Zeit, denke ich, lehrt Alles; was wir sind und wissen, sind und wissen wir durch die Zeit. Die Zeit ist ja nichts anderes als das Aufeinanderfolgen der Dinge, wodurch Alles geschieht. Wir sind ganz das Werk der Zeit, denn wir können durchaus nicht seyn, was wir sind, wenn nicht alles so vor uns gewesen wäre, wie es wirklich gewesen ist.
Wenn ich Stephan Hermlins dichterische Existenz auf eine Formel bringen müßte, würde ich sagen, daß sie eine wunderbare Mischung aus August von Platen und Georges Glaser war, wissend, daß „was die Flächen wärmet / Die Tiefe wärmt es nicht“, und bekennend, „daß sie geringschätzten, wenn einer offen am hellichten Tag aussprach, wofür andere heimlich in der Nacht das Leben verlieren“.
Doch wer vermag schon das Wesen eines Menschen ganz zu erschließen oder gar endgültig zu beurteilen? Hölderlin hat Diotima die passende Antwort geben lassen:
Du sagtest mir einmal, Hyperion: es sei Entwürdigung, von irgend einem Menschen zu sagen, man hab’ ihn ganz begriffen, hab’ ihn weg.
Klaus Völker, neue deutsche literatur, Heft 516, November/Dezember 1997
Herkünfte einer faszinierenden Dichtung
Stephan Hermlins Lyrik der vierziger Jahre ist gemeinhin als „Städteballaden-Dichtung“ bekannt, obgleich das Frühwerk auch andere lyrische Genres, vor allem das Sonett, einschließt. Diese Balladendichtung – deren poetisches Verfahren in den zu Anfang der fünfziger Jahre, also in der DDR, geschriebenen Gedichten seine im wesentlichen unveränderte Fortsetzung erfuhr – stellt eine spezifische Variante der sozialistischen Lyrik dar, eine Variante, die zumindest innerhalb der deutschsprachigen Zeugnisse einen Sonderstatus beansprucht.
In der 1941 entstandenen „Ballade vom Land der ungesprochenen Worte“, die, zwischendurch ausgespart, interessanterweise in Hermlins jüngste Auflage seiner gesammelten Gedichte, in die Auflage von 1981, aber wieder aufgenommen worden ist, heißt es:
Entsinnst du dich, als die Flucht begann
Durch Geröll und Sand,
Wie wir die Sonne vergaßen? – „Wann
Betraten wir jenes Land?“ –
Frage nicht, denn ich weiß nicht mehr,
Wann uns der Fluch befiel.
Nur: wir vergaßen uns und das Heer
Der Sterne, der Herden Spiel.
Auffällig daran ist, daß das lyrische Ich seine von den finsteren Zeiten, von Faschismus, Illegalität, Exil und Krieg verursachte seelische Not, den Verlust von Bindungen, durchweg in Bilder kleidet, die, ungeachtet der schmerzlichen Empfindungen, durchweg „schön“ sind. Die Worte verströmen eine Aura des Immergültigen, des Von-weit-her-Gekommenen, das sinnfälligste Daseinssignale auszusenden vermag: ,,Geröll“ und „Sand“, der merkwürdig erweiterte Infinitiv „die Sonne vergessen“, ,,Fluch“, ,,das Heer / Der Sterne“ (mit nachgestelltem), „der Herden Spiel“ (mit vorangestelltem Genitiv). Metrische Raffinesse (zur Hervorkehrung wichtiger Satzpartikel – „Wann“, „Nur“) und reizvolle Zeilenbrüche ergänzen den bildsprachlichen Aufwand. Erschütternde historische Realität und politischer Alltag sind eingebunden in eine Reflexion über „das Leben“, über Elementares.
Ähnlich stilisiert begegnet uns auch die 1943 geschriebene „Ballade von der Überwindung der Einsamkeit in den Großen Städten“, ein Schlüsselgedicht, das folgendermaßen beginnt:
Ihr alle, die ihr mit uns in die Großen Städte versanket
Und vom Golde des Abends vor Kathedralen berauscht:
Wenn ihr vom Gifte tödlicher Einsamkeit tranket,
Fühltet ihr einen Schatten, und gleichsam belauscht
Verließet ihr eure Wollust, und eure Gedanken
Fielen ab von Lippen und sterbenden Blüten und Wein
Und aus den Wäldern eurer Augen begannen zu schwanken
Schwarze Sonnen, Trompeten, und ihr wart nicht mehr allein.
Erneut eine Fülle von Bildern, von Worten mit „Hintergrund“, feierliche, teilweise verfremdend-ungewöhnliche Formulierungen:. „vom Gifte tödlicher Einsamkeit“ trinken, wieder ein merkwürdig erweiterter Infinitiv: „seine Wollust verlassen“, das Wort von den schwankenden „Wäldern eurer Augen“, die melancholische Kulisse von „Lippen“, „sterbenden Blüten“ und „Wein“, das verheißungsvolle Arsenal „Schwarze(r) Sonnen“ und „Trompeten“. Auch hier überraschende Enjambements (von der vierten zur fünften, von der fünften zur sechsten Zeile), auch hier ein wohlkalkulierter, diesmal drängender Rhythmus, der der übermächtigen Erinnerung Raum zu schaffen sucht. Und auch hier das Verfahren, selbst die Veränderung individueller und kollektiver Haltungen, Wendemarken der Geschichte also, durch elementar-symbolischen Anstrich kundzutun: Der antifaschistische Widerstandskampf, in den sich Hermlin einreihte, Keimform revolutionärer Aktionen – selbst dies wird mittels der zitierten „Schwarze(n) Sonnen“ und „Trompeten“ poetisch attraktiv überhöht.
Die über zwanzig stets vielstrophigen Balladen der vierziger Jahre enthalten dramatische Handlung in der vermittelten Form einer inneren Bewegtheit, die auf ein in sich widersprüchliches Subjektgeschehen verweist, wobei dieses Subjekt im näheren den Autor verkörpern, die Zielgruppe der Städtebewohner umgreifen oder aber im weitesten Bezug den vor die gesellschaftliche Entscheidung gestellten Menschen unseres Jahrhunderts meinen kann. Dabei wird erkennbar, daß jene innere Bewegtheit wesentlich von der mitreflektierten welthistorischen Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen Faschismus und Friedenskräften verursacht ist und die Entwicklung an den militärischen Fronten des zweiten Weltkrieges in diese Dichtung hineinspielt, was sich, konkret für die Jahre 1942 und 1943, am Aufkommen solch neufundierter Balladen wie der „von den Städteverteidigern“ und der „von unserer Zeit mit einem Aufruf an die Städte der Welt“ ablesen läßt, die ihr Pathos wie ihre Streitbarkeit vor allem aus den Kämpfen um Moskau und Leningrad beziehen.
Typisch für Hermlins Lyrik ist die Fähigkeit seines lyrischen Ichs, durch verschiedenartigste existentielle Lagen sozusagen hindurchzugehen und damit alle denkbaren Spannungszustände und Konfliktsituationen des Zeitgenossen zu tangieren, wobei, wie erwähnt, das poetische Subjekt meist empirisch uneindeutig und gewissermaßen überpersonal agiert. Das weltanschauliche Ringen um einen von Verzweiflung und Skepsis nicht mehr gefährdeten Standort in den Kämpfen der Zeit wird keinesfalls einer linearen Lösung zugeführt; man kann sogar sagen, daß Hermlin generell gegen die Erwartung einer mechanischen Ablösung des Verfalls durch den Triumph, des moralischen Elends durch die menschliche Größe anschreibt. Auch innerhalb der späteren Sammelbände ergibt die Anordnung der Gedichte nirgendwo eine geradewegs aufsteigende Linie: Hermlins Verfassung beziehungsweise die Verfassung seines lyrischen Ichs unterliegt fortwährend Erschütterungen; der „Zeitenschaum“ – ein Wort aus der „Ballade von einem Städtebewohner in tiefer Not“ und eine äußerst sinnträchtige Umschreibung der Antagonismen, in denen der Städtebewohner ertränkt zu werden droht – läßt anderes gar nicht zu. Erst die „Ballade von den Unsichtbar-Sichtbaren in den Großen Städten“ (1944), mit der Hermlin die Fundierung seines Volksbegriffs gelingt – das Volk als der die Opfer wie die Werte bergende „wandernde Strom“ „seit Memphis und Rom“ –, erst diese Ballade scheint eine realoptimistische Perspektive zu befestigen, wie sie zuvor in den visionären Bildern der Städte im „Licht“ und des Tages, der „im Osten geboren“ wird („Ballade von einer zu bebauenden Ebene“), aufgeschienen war.
Hermlins Gedichte variieren, genau betrachtet, identische widersprüchliche innere Geschehnisse; als Ganzes gestaltet sich seine Lyrik – laut Karl Krolow (1950) – „zu einer jener ,ununterbrochenen‘ Poesien“, „in denen das eine Gedicht das andere auf sehr bestimmte Weise fortsetzt, indem sogleich der nämliche Schwingungston erreicht und aufgenommen“ wird. Offenbar hatte Krolow bei dieser Charakterisierung Verwandtschaften im Auge: 1946 war Paul Eluards „Poésie ininterrompue“ erschienen.
Fragen wir nun, welche Voraussetzungen den frühen Hermlin zu einer derart faszinierenden, genauer: zu einer derart auf Faszination hin angelegten Dichtung führten, wie sich diese Dichtung ausprägte und welche – zum Teil problematischen – Weiterungen sich dabei ergaben, so läßt sich folgendes festhalten:
Aus Hermlins autobiographischen Bekenntnissen in der Publizistik seiner mittleren und in den Erzählungen seiner reifen Schaffensphase geht hervor, daß die machtgeschützte Kindheit im großbürgerlichen Elternhaus ihm von früh an solche Gelegenheiten schöner Anschauung vermittelte, dank denen er schon in jungen Jahren die Fähigkeit zum Verwandeln des Wirklichen in Vorstellungen von etwas, in Leitbilder und Tagträume sich erwarb, die auf die besseren Möglichkeiten des Menschen und das historisch Wünschbare ausgerichtet waren. Hermlins gleichwohl von Muße wie von den Musen regiertes Aufwachsen zeitigte ein Wirklichkeitsempfinden, das frühzeitig ästhetisch funktionierte und ihm die Welt in „präformierten künstlerischen Bildern und Gestalten“ zuführte. Das symbolische oder auch symbolistische Anverwandeln der Realität bewährte sich auch dann, als Hermlin durch seinen 1931 erfolgten Eintritt m den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands einem sozialen Milieu „entkommen“ war, dessen wohlmeinende Lebenskunst unter den sich zuspitzenden politischen Widersprüchen untauglich, ja anrüchig zu werden schien. Die im Elternhaus zu eigen gemachte Kultur, die das Daseinsgefühl steigernden Einstellungen und Sehweisen wurden dabei aber keineswegs mitverabschiedet, sondern richteten sich nun auf das – wie Hermlin später in anderem Zusammenhang sagte – „ganze, wirkliche Leben, die unablässige, schreckliche und grandiose Überwindung des Alten durch das Neue“, dem der jetzt politisch engagierte Hermlin mit seinen Schreibversuchen würde beizukommen haben. Seine frühe Lyrik sollte sehr bald zeigen, daß die Verheerungen ebenso wie die Forderungen des Tages eine über das Zeitgenössische merkwürdig hinausweisende, das Zeitgenössische ideell überhöhende Behandlung erfuhren.
Dank der liberalen Atmosphäre in seinem Elternhaus hatte sich Hermlin frei in den humanistischen Stoffen bewegen können. Seine unkanalisiert erfolgende Lektüre – „Nie wurde mir ein Buch verboten“ – machte ihn früh empfänglich für die Weite und Vielfalt künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten. (Um die Ausdrucksspanne zu bezeichnen, sei vermerkt, daß er nebeneinander die expressionistischen Dichter – zum Teil „fanatisch“, wie er bekennt und die von ihm als gegenständlich kühn empfundene sowjetische Prosa der zwanziger Jahre las und sich ebenso den großen Vertretern des deutschen und außerdeutschen literarischen Erbes, und zwar der älteren wie der jüngeren Vergangenheit, zuwandte.) Wichtig ist, daß diese so unterschiedliche Lektüre ihm nahelegte, bedeutsame Literatur mit jenem „menschliche(n) Eigensinn“ gleichzusetzen, der sich nicht davon abbringen läßt, „neue Verhältnisse zu schaffen, koste es, was es wolle, gegen die eigene Natur gewissermaßen, gegen einen Wust alter schlechter Gewohnheiten und Überlieferungen“. Das erklärt im übrigen auch, weshalb er später die Vertreter einer politischen und poetischen Erwägungen standhaltenden Literatur zu einer „Gesamtheit der Entdecker“ verband und sich gegenüber allen gestalterischen Neuerungen offenhielt, so daß er dazu neigte, von den Unterschieden zwischen der die Autonomie der Kunst anstrebenden „Moderne“ und der stärker auf die Lebenspraxis orientierenden künstlerischen „Avantgarde“ (der zwanziger und dreißiger Jahre) und zwischen bürgerlichen und sozialistischen literarischen Neuerem zu abstrahieren.
Als Hermlin in den Jahren seiner illegalen Berliner Tätigkeit und in den Anfangsjahren seines viele Etappen umfassenden Exils sich zum Dichter auszuformen beginnt, sieht er sich auf die durch die Aneignung unterschiedlichster Literatur gewonnenen Impulse, auf äußerst widerstreitende Dichtungsstrategien bei der Ausprägung einer eigenen künstlerischen Haltung, eines eigenen poetischen Stils geworfen. Daß er, umständebedingt, gerade während seiner ästhetischen Reifejahre von potentiellen deutschen Dichtergefährten kommunistischer Überzeugung getrennt ist – in einer Zeit, in der die weitere Herausbildung der sozialistischen deutschen Lyrik in besonderem Maße das Zusammengehen, den schöpferischen Dialog ihrer Repräsentanten und Debütanten erforderte –, bezeichnet des jungen Hermlins unfreiwillige Chance zu einem eigenständigen Beitrag bei deren Profilierung.
Hermlin hatte die gefahrvolle Praxis des antifaschistischen Widerstands als Dienst im Interesse menschheitsgeschichtlicher Ziele empfinden gelernt; es hatte sich seine Überzeugung herausgebildet, unverrückbar in die historische Pflicht genommen zu sein:
Ich lebte in dem Gefühl, einer Vorhut anzugehören, die der Menschheit den einzig möglichen Weg wies…
Ohne daß er den Garanten des antifaschistischen und antiimperialistischen Kampfes, die deutsche und internationale Arbeiterklasse, aus dem Blick verloren hätte, nährte dieses In-die-Pflicht-genommen-Sein Hermlins Auffassung, daß jede historisch begründete Bewegung die Doppelnatur von Geist und Tat besitzt. Wann immer aber Hermlin an den „Geist“ einer Bewegung dachte oder von „Intellektuellen“ sprach – gemeint war auch hier ein Strom, in dem das geistige Blut, „sang spirituel“, der Dichter und Denker aufgefangen ist und in dem sich gleichermaßen „die plebejische Intelligenz“ der Arbeiterführer wie die weitschauenden „Augen meines Volks“ spiegeln.
Hermlin entwickelte ein Verständnis von Intellektualität, das auf der Notwendigkeit des Klassenkampfes und des Beteiligtseins an ihm aufbaut und die Erkenntnis von dessen „Ästhetik“ einschließt. Kommunismus und emanzipierte, kunstsinnige Menschheit werden identisch gedacht, woraus folgt, daß für Hermlin der von den Positionen der Arbeiterklasse geführte Widerstand gegen die Unnatur der gesellschaftlichen Verhältnisse zugleich das Freisetzen der humanen Kräfte des Menschen, ein Einüben in eine erstrebenswerte Kultur zwischenmenschlichen Umgangs bedeutet, deren Gradmesser das Ideal „des Gemeinwesens der Gerechtigkeit“ (Peter Weiss) ist. Es steht außer Frage, daß diese den Geist stets mit solcher Selbstverständlichkeit und Unvorbelastetheit einbeziehende Sicht auf die Dialektik der revolutionären Bewegung einhergehend mit einer von Herablassung freien Wertschätzung des Volkes dem bislang nur vage angesprochenen Einfluß der damals führenden französischen Schriftsteller, vor allem Aragons und Eluards, zugeschrieben werden muß, die Hermlin seit den dreißiger Jahren gelesen hatte und mit denen er in den vierziger Jahren in direkten Kontakt trat. Das von diesen Autoren entworfene und verwirklichte Haltungs- und Schreibkonzept mußte Hermlin plausibel und reizvoll vorkommen, zumal es seiner eigenen kulturellen Ausgangslage und seinem Literaturideal, dem „schönen“, attraktiven, symbolistischen Anverwandeln der Realität, entgegenzukommen schien: Aragon und Eluard hatten von der leninistischen Kulturstrategie der Französischen Kommunistischen Partei unterstützt, als künstlerisch aktive Volksfrontpolitiker vorgeführt, wie avantgardistische Gestaltungselemente einer klassenkampforientierten Dichtung organisch einverleibt werden können. Es kann – ungeachtet Hermlins gelegentlich abgegebener gegenteiliger Kommentare zur dieser Standortbestimmung – kein Zweifel daran bestehen, daß ihm in der französischen sozialistischen Lyrik eine Bestätigung dessen widerfuhr, was ihm selber vorschwebte: die Bestätigung einer revolutionären Dichtung, die volkstümliches Empfinden und Intellektualisierung, Ein- und Vieldeutigkeit, Direktheit und Verdunkelung vereinigt, einer Dichtung, die ihren jeweiligen konkreten Anlaß mühelos übersteigt und die Politische an die menschheitliche Thematik bindet (in der Art, wie es Eluard später an seinem Gedicht „Freiheit“ erklärte). Damit ist keiner Nachahmung der französischen Autoren durch Hermlin das Wort geredet – Hermlin steht, wie Rudolf Leonhard 1948 anläßlich der Verleihung des Heinrich-Heine-Preises des Schutzverbandes Deutscher Autoren sagte, auch ganz in der deutschen Tradition und in der ganzen deutschen Tradition (ist doch seine Dichtung gleichsam auch ein innerpoetisches Zitat vom Barock bis zum Expressionismus) –, doch dürfte der Rezeptionsbezug auf die französische Volksfrontlyrik den konzeptionellen Rahmen von Hermlins Lyrik der vierziger Jahre am genauesten abstecken.
Kehren wir zu den eingangs zitierten Strophen zurück: Versuchten wir eine kritische Wertung dieser, wie wir sagten, auf große Art hergerichteten Dichtung, kämen wir um die Einschränkung nicht herum, daß sie dort partiell fragwürdig wird, wo ihr Vokabular und ihre Bildsprache sich allen Zeitverhaftetseins so auffällig entledigen, daß sie kaum noch imstande scheinen, dem reflektierten Subjektgeschehen als einem Ereignis beizukommen, dem die beispiellos dimensionierte und mithin kaum herkömmlich verkleidbare Kriegs- und Faschismusrealität zugrunde liegt. Hermlins poetisches Bewußtsein formt Menschliches, Dingliches, Geschichtliches fortwährend zu existentiellem, sozusagen schwebendem, atmosphärischem Ausdruck um. Die Bildhaftigkeit scheint oftmals eher einer naturmagisch-anthropologischen Weltschau verpflichtet, als auf eine bestimmtere Verallgemeinerung von Individuellem und Gesellschaftlichem hinauszuwollen: So spielt sich in Hermlins Lyrik das spannungsreiche Ich-Geschehen vor den – es folgen Schlüsselwörter aus den Gedichten – ewig währenden „Morgen“ und „Abenden“ ab, vor dem Hintergrund der Jahreszeiten, der Vogelflüge und „Bienengluten“. Gesucht und erkannt werden „Weg“ oder „Pfad“ innerhalb einer vielfach monolithisch anmutenden Menschenwelt; erahnt wird ein „Künftiges“, und zwar in einer Konkretheit, wie es die Begriffe „Saat“ oder „Frucht“ gerade zulassen. Hermlins Sprache neigt zu archetypischen Konstruktionen, ist expressiv, ohne unmittelbar verbindlich zu sein: Sie geht als „Frau Wahnsinn“, „Bruder Tod“ oder „Königin Bitterkeit“ durch die Jahrhunderte, berührt damit zwar stets auch den Boden des 20. Jahrhunderts, doch schlägt sie in ihm keine Wurzeln; sie bewahrt einen schier unendlichen Assoziationsradius. Peter Hacks erklärt derartige sprachliche Präferenzen – nicht ohne tieflotende Ironie – aus einem unveränderlichen Entstehungsgrund von Poesie: „Das Alte“, sagte er, „wenn es die Schwelle des Ungewohnten und Bedenkenswerten überschritten hat, läßt sich… erleben, und es hat, durch langen Umgang, eine Art von Einfachheit gewonnen, die es anschaulich macht. Worte wie Sachen müssen, um poetisch zu werden, lagern. Lokomotiven sind poetisch, Raketen sind es nicht. Öfen sind es, Fernheizungen nicht.“ Dessenungeachtet sei die Frage aufrechterhalten, ob das Praktizieren solcher Ansicht, das zwar auf weite Strecke verhindert, daß Sprache banal wird, nicht auch Gefahr laufen kann, den Aussagen ihre situierbaren Momente zu nehmen. Wie unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, der Verträglichkeit von Sprache und Sache heute Celans ästhetisch großartige „Todesfuge“ in leisen Zweifel gezogen und gefragt wird, ob ihr artistischer Glanz nicht eher die Sinne auf sich ziehe (und gezogen habe), als das Gewissen aufzurühren, so daß – als Wirkungs- und Rezeptionseffekt – hauptsächlich das „interesselose Wohlgefallen“ an der Kunstgestalt übrigbleibe, genauso scheinen Bedenken angebracht gegenüber Hermlins alt-schönen, ihren Gegenstand aber möglicherweise verfehlenden Worten des „Mohns“ und der „Asphodelen“, der „Zisternen“ und (siehe Hacks!) ,,Öfen“ („Kranke schrein die in den Öfen / Des Fiebers vom Irrsinn genascht“).
Und dennoch sagt der viel, der Abend sagt,
Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt
Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.
Hofmannsthal hatte mit seinem berühmten Balladenschluß auf den magischen, aber auch befreienden und kräftigenden Zauber insistiert, der von einer Versöhnung der Widersprüche im Wort auf den Menschen ausgeht und dessen humane Reserven zum Schwingen bringt. Will man diesen Schluß verteidigungshalber für Hermlin bemühen, ist allerdings zu berücksichtigen, daß Hofmannsthal primär auf das Einzelwort, auf Worte „um der Worte willen“ zielte („Das Gespräch über Gedichte“), die – im Sinne Novalis’ oder Eichendorffs – uns mit ihrem Urbann belegen. ,,Schwäne“, zum Beispiel, bedeuten im Gedicht „nichts als sich selber“, es sind Schwäne, „aber freilich gesehen mit den Augen der Poesie, die jedes Ding jedesmal zum erstenmal sieht, die jedes Ding mit allen Wundern seines Daseins umgibt“. Eine Poesie ist beschrieben, die von immanenter Symbolik lebt, während Hermlin das Symbolische überwiegend metaphorisch herstellt: „Abend“, Abende grundieren, wie wir ausführten, auch bei ihm die Befindlichkeiten des Ichs und hellen den Dämmer von dessen Bewußtsein urplötzlich auf, doch geschieht dies häufiger noch in Verwandlungen wie „Abendschein“, „Abendbaum“, „Abendschoß“ und ähnlichem. Dieser Abgestuftheit eingedenk, kann jedoch sehr wohl festgestellt werden, daß Hermlins Balladen das gleiche ontologische „Dekor“ besitzen wie, zum Beispiel, Hofmannsthals „Ballade des äußeren Lebens“. Wie bei diesem durch „Setzung“, verheißt es bei Hermlin in metaphorischer Kombination Tiefsinn, Trauer, Daseinserkenntnis. Rilke, dessen Sprachgebung gleichfalls Hermlins Empfinden traf (nicht zuletzt in Gedichten wie „Denn, Herr, die großen Städte sind…“ oder „Die Städte aber wollen nur das Ihre…“), schrieb in „Malte Laurids Brigge“:
Um eines Verses willen muß man viele Städte sehen, Menschen und Dinge, man muß die Tiere kennen, man muß fühlen, wie die Vögel fliegen, und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Man muß zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwartete Begegnungen und an Abschiede, die man lange kommen sah…
Obwohl Rilke hiermit den „Dingen“ auf der Spur blieb, die er in ihrer konkreten Gegenständlichkeit dem Gedicht zurückgewonnen und zu unverrückbaren Lebensbildern ausgeformt hatte, belegt auch dieses Zitat allein von seinem Wortvorrat, seinem „existenz“ orientierten Material her, daß sich Hermlin dem prägenden Einfluß beider Autoren nicht entzogen haL (Hofmannsthals „Gespräch über Gedichte“ steht sicher nicht zufällig in Hermlins Deutschem Lesebuch von 1976, dem für die Zeitgenossen gedachten Schatzkästlein der Poesie.)
Zur beeindruckenden, aber nicht immer treffsicheren Suggestion durch das Wort kommt bei Hermlin der zu ähnlichen Relativierungen Anlaß gebende Umstand hinzu, daß er einen bestimmten Wiederholungsmodus bei der Darbietung von Spannungsmomenten des lyrischen Ichs nicht überspringen kann. Hermlin handhabt ein „relativ begrenztes… Netz von Antinomien, das immer neu in die Wirklichkeit ausgeworfen wird, sie durch Assoziation anzuverwandeln“ (Hubert Witt). Tatsächlich beobachten wir bei Hermlin nicht selten in ein und demselben Gedicht austauschbare Metaphern-Varianten, derentwegen die zustande kommenden Wortkopplungen einer gewissen Beliebigkeit anheimfallen und gelegentlich zu einander ausschließenden Wertungen führen. Auch hierfür könnte verteidigungshalber ein Kronzeuge herangezogen werden: Franz Fühmann hat in seiner Trakl-Studie das Setzen unvereinbarer Wendungen und Wertungen in einem Gedicht mit dem Interesse des Dichters in Verbindung gebracht, die „widersprüchliche Einheit menschlicher Erfahrung“ zum Tragen zu bringen, und er hat ferner den Eindruck, daß Vertreter der modernen Lyrik die Substitutionsmethode nicht nur nicht zu verschmähen, sondern bewußt in Anspruch zu nehmen scheinen, mit dem Hinweis zu beantworten versucht, daß sie auf diese Weise die jeweiligen „Pole einer Widerspruchseinheit“, also gerade die ganze „Spanne und Spannung“ des Daseins erfassen würden. Dennoch wollen wir in bezug auf Hermlin auch hier von unserer Auffassung nicht ohne weiteres abrücken, daß er der sprachlichen Kalkulation durchaus nicht immer versichert war und ihm aufgrund der Überdisponibilität seines Wortschatzes gelegentlich die Besonderheit der poetischen Aussage verlorenging.
Müßten wir das Spezifische von Hermlins sozialistischer Lyrik der vierziger Jahre bezeichnen, würden wir auf den Terminus des „öffentlichen Gedichts“ zurückgreifen. Der schon zitierte Karl Krolow schrieb 1961 in seinen „Aspekten zeitgenössischer deutscher Lyrik“, daß das zu „öffentlicher“ Aussage schreitende Gedicht an die Stelle chronistischer Elemente, an die Stelle rein politischer Aktualität eine allgemeinere, höhere Aktualität rücke, das heißt: zeitgeschichtliche Anlässe wie Krieg und Frieden, Unterdrückung und Widerstand zu gleichsam immergegenwärtigen Lagen von Krieg und Frieden, Unterdrückung und Widerstand sublimiere. Auf dem 1. Deutschen Schriftstellerkongreß 1947 hatte Hermlin diese Charakteristik im Grunde vorweggenommen, als er sagte, daß die in einem Gedicht reflektierten „dialektischen Veränderungen einer Landschaft oder eines menschlichen Gefühls Metamorphosen einer höheren, allgemeinmenschlichen Art aufleuchten“ lassen müßten.
Klaus Werner, neue deutsche literatur, Heft 4, April 1985
Traum Tragik Trotz Trauer – Stephan Hermlin
Das allgemein Richtige, ein Gezücht unserer konsensitiv geschlossenen Öffentlichkeit, ist dennoch ein am Boden schleifendes träges Ungetüm, wie sehr es sich auch selbst gefallen mag. Einige andere aber müssen in der Höhe sich härter ausbilden und werden selbst aus einer Verrannt- oder Verstiegenheit heraus mehr Gutes unter die Menschen bringen als je tausend Richtige zusammen.
Botho Strauß1
Speisekarten sind keine Literatur. Aber immerhin erzählt der suchende, prüfende Blick eines Menschen in eine solche Karte, auf welche Weise überhaupt zu lesen sei: nämlich so, wie man eben Essen und Trinken danach abwägt, was einem bekömmlich ist. Mitunter erweist sich die Erwähnung auf einer Speisekarte sogar als Ausdruck einer äußerst praktikablen Unsterblichkeit. So schreibt Stephan Hermlin 1969 über einen Botschafter des Staates Frankreich, dessen Name in politischen und literarischen Dingen zwar weitgehend verblasst war, der aber doch eine andauernde gastronomische Karriere geschafft hatte – als Bezeichnung für eine spezielle Art von Rinderfilet: Chateaubriand.2
In den nur wenigen Essay-Seiten über die Erinnerungen des Vicomte, eines Schülers Rousseaus und Begründers der französischen Romantik, gelangt Hermlin zu präzisen Charakterisierungen, die punktgenau auf ihn selbst zurückzielen. Er braucht diesen Chateaubriand, einen ausgewiesenen Feind der Revolution, bloß zu zitieren, und schlagartig wird offenbar, was den DDR-Schriftsteller an diesem Manne bewegt:
Bin ich auch aufrichtig, mangelt es mir doch an Offenheit des Herzens: meine Seele strebt immer danach, sich zu verschließen.3
Das Memoirenwerk des Franzosen zeige auch, „wie in ihm ein Verfasser sich stilisiert“.4 Unaufrichtigkeit und Verklärungen habe man daher dem Lebensbericht des Diplomaten und Essayisten vorgeworfen, Hermlin aber – Jahre nach seinem 1979 erschienenen Buch Abendlicht5 würde er selbst in derartige Nachrede geraten – verteidigt Chateaubriand; er glaubt, „daß das durchgehaltene sotto voce dieser Bekenntnisse, dieses ,Mir war das Leben auferlegt‘, und eine unüberwindliche, nie abwesende Traurigkeit durchaus authentisch sind“.6
Der Schriftsteller Hermlin ganz bei sich: Auch er ist mit Kraft und (lange Zeit) mit staunenswert federnder Grazie jenem besonderen inneren Alleinsein verpflichtet gewesen, das den Eigensinn des Charakters ganz der Poesie übergeben hatte. Aber zugleich besaß der Autor eine Dienernatur, die doch so gar nicht zu seinem geistigen Adel passen wollte. Einen Bund mit dieser dienenden Neigung hatte der unbeugsame Hochmut freilich nur unter einer einzigen Voraussetzung gestattet: Es musste eine Dienerschaft sein, die unbedingt dem Edelsten, dem Höchsten, gleichsam dem Olymp humanen Strebens gewidmet bleibt – der klassenkämpferischen Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Krieg und überhaupt von all jenem Überdruck der Geschichte, der zu massenhafter Entwürdigung und sozialpolitischem Elend führt. Wahrlich in keiner Phase seines Lebens ein Mensch der Masse, ist Hermlin doch ein unerbittlicher Diener der Klasse geworden und geblieben. Er diente konsequent: dem kommunistischen Geist, dem antifaschistischen Kampf, dem stalinistischen System. Ersterem mit hymnischem Gesang, Zweiterem mit entschiedener Stimme, Drittem mit zusammengepressten Lippen. Ein Leben, das nicht schlechthin gelebt wurde, sondern, wie bei Chateaubriand gelesen: auferlegt war. Nach Hermlins Auffassung Folge einer Grundentscheidung: nicht unbeschädigt durch härteste Zeiten kommen zu wollen.
Ich hatte mich – man könnte sagen: unvernünftigerweise – sehr eng an politische Gruppierungen gebunden, die einen teilweise bewaffneten Kampf zu führen hatten, in dem es keine Nachsicht gab und kein Differenzieren.7
Selbstaufgabe eines Dichters
Dieser Schriftsteller der DDR, ohnehin Schöpfer eines eher schmalen Œuvres, hat zum Ende des Staates hin kaum noch Prosa geschrieben, und sein bedeutendes, anfangs zwischen expressionistischem Pathos und elegantem Fluss vibrierendes, später melodisch streng gebändigtes, höchstens elegisch noch ausschwingendes Gedichtwerk gehörte da längst schon einer vollendeten Vergangenheit an. Der Poet hatte beizeiten jene Art Selbstjustiz vollzogen, bei welcher der Dichter in ihm aus Einsichten in bitterste Notwendigkeiten des politischen Kampfes gleichsam sterben musste: Dichtung und politische Disziplinierung schlossen einander wohl aus, Imagination als wahrer Ausdruck seines Wesens vertrug sich für Hermlin irgendwann nicht mehr mit dem, wozu er sich aus Gründen biographischer Fügung verpflichtet hatte: zur bewusst treuen Mitgliedschaft in der Partei der Kommunisten, also auch zur bewusst treuen Teilnahme an den „Lügen des Pseudo-Sozialismus“.8
Der Konflikt zwischen Individualität und kollektiver Order ließ sich für ihn auf Dauer nicht mehr schöpferisch lösen. So opferte er die Ästhetik eines lyrischen Werks der Ästhetik einer militant anmutenden Stirnbietung, die nichts von jener ideologischen Kapitulation wissen wollte, die doch seit langem nicht mehr zu leugnen war. „Der Tod des Dichters“ heißt das Gedicht von 1958, in memoriam Johannes R. Becher. Darin die Zeilen:
Ihn aber ruft es weit.
Was auch ohne ihn blühet
Preist er künftigen Glücks gewiß.9
Was in diesen Versen scheinbar so aufbauend klingt, wird letztlich und bleibend von jener Wahrheit verdrängt, die Hermlins Leben den harten Kern gab: Nicht Siege des Glücks werden davongetragen, sondern Tote.
Hermlin steht somit für Situationen im Leben, da paradoxer- und tragischerweise ausgerechnet das Überindividuelle, das Allgemeine, das Abstrakte, ausgerechnet also das, was Individualität sprengt und zerstört, zum letzten Halt des Ichs gerät, nur damit nicht alles (fast alles) im Leben falsch war. Günter Gaus hat den Dichter 1984 in einem Fernsehinterview auf dieses Problem aufmerksam gemacht,10
Hermlin antwortete:
Daran kann auch etwas Richtiges sein – an diesem Gedanken. Das zeigt aber allenfalls nur, daß meine Begabung nicht von härterer Art war, (…) daß sie nicht genug ertragen konnte.11
Er wollte Einfassung sein dort, wo kriegerisches Chaos heranschwappte, er träumte von Einfriedung dort, wo faschistische Entfesselung so Vieles durcheinanderwarf. Weil er sich in den eisernen Forderungen der Zeit, in den damit verbundenen Verwerfungen des kommunistischen Glaubenszwanges nicht als charakterlich Versagender sehen wollte, versagte er sich die konsequente Ehrlichkeit wider den defizitären Kollektivismus und zahlte den hohen Preis: Er wurde ein poetisch Versiegender. Denn mag sich ein Leben (der Not still gehorchend), auf die Maske beschränken können, Dichtung (die Not erzählend) kann es nicht. Und eine Maske war es, die Hermlin tapfer trug. Tapfer und hoffend, sie werde nicht erkennbar als Ausdruck einer unvermeidlichen Selbstverleugnung. Fritz J. Raddatz erinnert ihn 1995 im Interview an eine frühere Begegnung:
Sie haben mir in einem privaten Gespräch, etwa Ende der siebziger Jahre, einmal gesagt: „Dieses ist nicht mehr meine Partei. Und wenn Sie das je veröffentlichen, werde ich leugnen, es gesagt zu haben.“ Kürzlich sagten Sie mir nun: „Es war nicht nur damals, sondern es war schon seit 1950 nicht mehr meine Partei.“[footnote]Raddatz: „Was wissen die Jüngeren“, S. 180
Raddatz nennt das „ein Stück Religiosität“, Hermlin antwortet:
Sie haben absolut recht.12
Religiosität? Predigerdienst in einer leergeräumten Kirche. Was dem Schriftsteller eine Ästhetik des erhebend Kathedralen werden sollte, eine Poesie des epochalen Aufschwungs im Geiste edelster Erbschaften, es hätte sich mehr und mehr in der Schönfärbung des Ruinösen genügen müssen. Gläubigkeit, von Gott verlassen und gezwungen, an Halbgötter delegiert zu werden – das war Hermlins Trauer, die zwar mit beharrlicher Taktik zu leben war, aber doch nicht bedichtet werden konnte, ohne die Dichtung zu vergewaltigen. Hermlin erfuhr den Sozialismus seiner Partei als falsches Gebot zur Konsequenz: das Utopische nicht nur zu denken, sondern so zu tun, als lebe man es bereits. Aber wer das Utopische leben will, der muss es versklaven. Er muss es auf das Maß jeweiliger Gegebenheiten herunterdrücken. So wurde in der DDR-Apologetik all das Enge bereits als Berührung mit dem Erhabenen vorgefühlt. Die Bereitschaft, das mit zu verwirklichen, was Marx dichtete, log sich um zur künstlichen Identität mit dem, was die Partei überschießend programmatisch oder panisch pragmatisch beschloss.
Der Dichter Hermlin verweigerte sich spätestens nach dem XX. Parteitag der KPdSU mehr und mehr solcher Parteilichkeit, bei der die Zukunft klar, aber die Vergangenheit gleichsam jeden Tag eine andere war, je nach erlaubter Dosis Wahrheit. Er erfror poetisch, denn ihm sollten eigene Verse nie wieder als Werbung für diese Parteilichkeit missgedeutet werden können. Nie jedoch hat er sich ob seiner frühen rauschhaften Stalin-Hymnen oder der propagandafeurigen Rechtfertigungen des Mauerbaus zu reumütigem Knirschen hinreißen lassen. Er ließ sich stets stehen als der, der er im jeweiligen Moment gewesen war. Es schien ihm zu genügen, dass er genau wusste, warum er so war. Er lebte erhabenen Blicks die Folgen jenes frühen geistigen Höhenflugs und zugleich jenes niederreißenden Fluchs, der sein Leben in den Kampf gegen den Faschismus gezwungen hatte.
Da löscht ein Dichter beizeiten das falsche Licht in sich aus, um mythisch schwarz zu glänzen. Mit Fragen, die der Antwort vielleicht gar nicht bedürfen.
Sonnen, wohin vergangen
Ist euer tönendes Rad?13
Der Leidenston als höchstes Refugium der Lebenslust. Leicht noch zu verwechseln mit den verzweifelt zynischen Mentalitäts-Spielen einer kriegsgetroffenen Moderne. Spielen, das wäre immer auch Lachen. Lachen aber kann dieser Dichter nicht, er wird es nie können. Heiterkeit steht ihm unter Verdacht. Bloß nichts, was aufweicht! Also muss dem Wort irgendwann unausweichlich ein schweres, wertvolles Ziel eingeschrieben sein. In der „Ballade von den alten und den neuen Worten“ (1945) wird dieses rigorose Wünschen Vers:
Genügen können nicht mehr Worte,
Die mir eine Nacht verrät
er fleht:
Darum gebt mir eine neue Sprache!
Ich geb euch die meine her.14
Er gibt her. Weil er sich hingibt und immer weiter hingibt. Und: Sich treu bleibend, gibt er sich auf. Er wird sich mit leuchtender Kälte betrügen, um einer politischen Weltformel willen; das poetische Bild aber sperrt sich diesem Betrug.
In Abendlicht wird dieses Ende eines Dichters sehr berührend selbstversunken aufgerufen:
Mittlerweile verschwanden allmählich aus meinem Leben die Verse, die ich schrieb. Sie verloren sich wie ein leiser Schmerz, an den man sich schon gewöhnt hatte und ohne den man eines Morgens ein wenig verwundert, auch nicht ohne ein Gefühl der Leere, erwacht.15
Er habe, so Hermlin im Fernsehgespräch mit Gaus, „nie das Opfer gebracht, das andere gebracht haben, das Opfer des Lebens. Und um mich herum haben Millionen dieses Opfer gebracht. Ich habe gar nicht das Recht, mich zu beklagen, daß ich vielleicht zehn oder zwanzig oder hundert Gedichte zu wenig geschrieben habe.“16
Es bleibt bewegend, dem mählichen Verstummen eines Poeten nachzusinnen, als sei es selber Werk. Und ist es nicht Tat? Einem Jahrhundert gemäß, das alle Ausdrucksarten von Verständigung, Sprache und Gespräch in Zerreißproben zwang? Was blieb vom Sagbaren, wo Unsägliches die Kehlen zudrückte? Und waren die Massen nicht in Gräber gestürzt, weil sie gerufen wurden von jeweils flammender Sprache, die zum Engagement aufrief? In seinen Noten zur Literatur schreibt Theodor W. Adorno:
Die politische Unwahrheit befleckt die ästhetische Gestalt.17
Und ist alle Ideologie nicht immer auch Botschafterin der Unwahrheit? Adorno: „Den Satz, nach Auschwitz noch Lyrik zu schreiben, sei barbarisch, möchte ich nicht mildern“, indes habe auch Hans Magnus Enzensberger recht, Poesie solle sein und „so also sein, daß sie nicht durch ihre bloße Existenz nach Auschwitz dem Zynismus sich überantworte“.18
So trägt engagierte Literatur a priori das Adelszeichen der ehrenwerten Gegenwehr, der Leidenschaft für Gegengewichte, aber zugleich schimmert in jeder politischen Fürsprache das Kainszeichen des Missbrauchs und der wahrhaftigkeitsfeindlichen Vernutzung durch. Ja, der Dichter darf sich bereichert sehen, wenn er aus Rückzugsgebieten hervortritt zur Barrikade hin, seine Dichtung jedoch verliert: Noch die progressivste künstlerische Wortnahme kann nicht die Waage umstimmen: Am schwersten wiegen in der Kunst die Verlustanzeigen, nicht die Emphase des Aufbaus; die Schmerztöne zählen, nicht die Verheißungen; die Spielarten des Geworfenseins, nicht die Siegesbilder der Vernunft. Stephan Hermlins Lyrik stand am Scheideweg. Sie ging nicht weiter. Sie blieb stehen. So ist sie bleibend geworden.
Aus der Zwangslage, die aus hohem Anspruch erwächst, geriet Hermlin freilich nicht in ein Schwanken, das ihm ans Leben hätte greifen können. In sich selber trug er weite Räume zu einsamer Grabespflege – nach außen hin blieb er ein aktiver, ein intelligenter, mutiger, in all seiner Statuarik durchaus auch wendiger Vollstrecker des politischen Glaubens: Er steigerte sich zum eingreifenden kulturpolitischen Beobachter, zum Bewahrer und mahnenden Besinnungscharakter. Die Prosa, die er schrieb, war weiterhin pure Sprach- und Opferrettung, jenseits aller proklamatorischen Direktheit. Die Essays, die er verfasste, riefen Weltliteratur ins öffentliche Bewusstsein einer eher kleinkarierten Kulturdoktrin. Er propagierte Form, wo politisch und ästhetisch die Vergröberungen Zunahmen. Er versuchte zu vermitteln, wo Einheits- und Geschlossenheitsrituale der Altvorderen auf Ungebundenheitssehnsüchte Jüngerer trafen. Er kämpfte in Aufsätzen und Auftritten gegen das offizielle Desinteresse am Widerspruch, er erzählte vom Verwobensein mit allem, was aus jenen Zeiten herüberrief, die man auf sozialistischem Wachtposten abschätzig als Vor-Geschichte bekämpfte und deren Kultur man angeblich überwunden hatte.
Die Wahrheit: Ein Schweigen
Abendlicht ist dann nach langen Jahren wieder das erste (und letzte) „rein literarische Werk“19 gewesen. Ein Buch, überragend in jenem sprachlich bezaubernden Gleichgewicht, zu dem Elemente eines Satzes finden können. Wie ein Schluss-Stück. In poetischer Hinsicht betrat Hermlin, nach dem Ende der DDR, das freie Feld in den Westen also schweigend. Vielleicht betrat er es nie wirklich. Er hatte ganz anderen Spuren nachzugehen. Spuren und Spurverwischungen. Wenn er sich nach dem Herbst 1989 überhaupt noch öffentlich äußerte, dann war den Interviews vor allem eine neue Tragik anzumerken: Hermlins prägende urkommunistische Not, nicht alles sagen zu dürfen und dies fortwährend zur Tugend schmieden zu müssen, war zwar vorbei, aber doch nurmehr von einer neuen Not abgelöst worden. Jener Not nämlich, mit einer komplizierten existenziellen Wahrheit weiterhin allein zu bleiben. Denn konnte man diese Not des soldatischen Ethos, das sich Jahrzehnte panzernd über alles geworfen hatte, nun zwar unbehelligt gestehen, so blieb doch das spezielle Elend der Standfestigkeit in immer stärkerem Maße unvermittelbar.
Das, was mich von vielen […] trennt, ist ihr Standpunkt, sie müßten um Absolution für die schweren Sünden bitten, die sie begangen haben, indem sie Kommunisten geworden sind, oder Anti-Faschisten. Diese Büßerrolle billige ich nicht.20
Dass er deshalb angegriffen wurde, aus dem Westen wie von ostdeutschen Oppositionellen es belegt einen Defizitbestand moderner Verständigungskultur: Wer das 20. Jahrhundert aus Zentren der Verstrickung erzählt, liefert sich größer und größer werdendem Unbegreifen aus. Also moralischen Entwertungen, die jeden größeren Hoffnungsgedanken als unbelehrbare Gebundenheit ans missratene sozialistische Experiment missdeuten. Als sei, wer in der geistigen Tradition eines Ernst Bloch denkt, nur ein verstockt bleibender DDR-Kaderphilosoph. Hermlins besagter Hochmut, also Treue zu sich selbst, und besagte Dienernatur, also Treue zum Prinzip, hielten fortan einander wie der Lahme und der Blinde. Das ist sie, die in diesem Dichterleben so seltsam, so fremd, so ungeheuerlich, so tragisch anmutende Dualität von Gebrechen und Geheimnis.
Hermlin steht, inzwischen aus größerer Entfernung betrachtet, wie eine Art Gegenpol zu einem Schriftsteller, der ihm in silbergrauer Eminenz sehr ähnlich scheint: Jorge Semprún. Zwei Feingeister an der roten Front, deren Werdegang belegt: Es ist wahrscheinlich etwas, das den Intellektuellen, den Künstler noch ganz anders durchfährt als andere Menschen – dieses Gefühl, gebraucht und auf abenteuerliche Weise für den Geschichtsauftrag praktisch werden zu dürfen. Praxisanspruch – das war doch das Erlösende des Marxismus gewesen. So wurde er das Werkzeug zur Überwindung religiös gegründeter Feudalverhältnisse. Intellektuelle wie Hermlin und Semprún verloren angesichts solcher Kraft die Freude daran, bloß sich selbst genug zu sein. Dies jetzt notiert – in einer Zeit, da an Praxis scheinbar erneut so Wenige interessiert sind, so Viele eher befasst sind mit virtuoser Verzweiflung oder mit ironischer Bewirtschaftung der Spiegelglasfestungen für das verunsicherte Ich – in der „zur Toleranz verklärten Gleichgültigkeit der bürgerlichen Gesellschaft“,21 wie Hermlin es sagte. Es sind immer nur ein paar Geister, die sich so hoch aufschwingen können, wie es eine Idee verlangt, und die sich gleichzeitig so tief beugen können, wie es eine Partei fordert. Daraus erwuchs Hermlin die soldatische Verlässlichkeit, Semprún aber, der Renegat aus stalinistischer Erfahrung, zahlte den Preis, links als Verstoßener zu gelten. Er verriet lieber. Denn, so Heiner Müller:
[W]as du heute nicht verrätst, wird dich morgen töten.22
Dass es links kein unschuldiges Gedächtnis gibt, erfuhr und wusste auch Hermlin beizeiten. So, wie er zunehmend darunter litt, einst alle dialektische Fertigkeit zusammengerafft zu haben, um sich selbst ideologisch hinters Licht zu führen.
Mit fortschreitendem Alter wächst einzig eine Gewissheit, und sie ist möglicherweise schon das höchste Gut an möglicher Erkenntnis: Nimm dich in acht vor eilfertigem Urteil über Welt und Mensch.23
Seine Erfahrungen mit dem 20. Jahrhundert presst der Schriftsteller am Ende in den bittertraurigen Satz:
Ich habe mich mit einer Barbarei gegen die andere Barbarei verbündet.24
Und blieb doch verbündet – weil er stets unter dem Blick der vielen Opfer litt, die einst für eine geträumte Freiheit starben.
Spätbürgerlich unter Genossen
Stephan Hermlin gelang nie wirklich eine unmittelbar poetische Beteiligung am Aufbau der DDR. Er schrieb Erzählungen von makelloser, metallen klingender, tonpräziser Prosa, etwa „Der Leutnant Yorck von Wartenberg“ (1946),25 in denen deutsche Geschichte als menschzerreißendes Bewährungsfeld offenbar wird; der Surrealismus gleitet da sicher hinüber ins erschütternd Maßvolle. Nie verfasste Hermlin Handhabungsliteratur fürs sozialistische Hausbuch. Er zog sich eine Haut Spott unter die unbewegliche Miene, dass jede Tugend eben auch ihre Schundromane in die Welt wirft – und damit denkt, so besser verstanden zu werden vom Volk. Hermlins ästhetischer Klassizismus half den antifaschistischen Charakter des ostdeutschen Staates und dessen Literatur mit zu begründen, aber dann stand sein Werk wie ein Gedenkstein in der neuen, sozialistisch ausgeschilderten Landschaft.
Dieser Mann wirkte noch als Grandseigneur des ostdeutschen Literaturbetriebes bisweilen wie eine angeschlagene Statue, aber sein umschatteter Stolz war gleichsam der des Marmors, der noch beschädigt eine bezwingend wertvolle Materialkraft darstellt. Als Hermlin 1978 auf dem Schriftstellerkongress betonte, ein „spätbürgerlicher Schriftsteller“26 zu sein, war dies der rhetorische Höhepunkt einer stetig gewachsenen Entfernung von der eigenen Truppe – einer Entfernung freilich nicht vom Frontabschnitt jenes kalten Krieges, in den er sich eingezogen fühlte. Denn parteilich ist Hermlin stets geblieben. Eine Parteilichkeit, getaucht in klare kritische Noblesse, die sehr wohl um ihre Wirkungsspielräume wusste. Hermlin protestierte gegen den sowjetischen Einmarsch 1968 in Prag, und 1976 war er es, der die Initiative zur folgenreichen Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung ergriff. Schon als Sekretär der Sektion Dichtung und Sprachpflege bei der Akademie der Künste hatte er Anfang der 1960er-Jahre maßgeblich die junge Lyrikwelle in der DDR befördert – eine legendäre, von ihm inspirierte und behütete Lesung in der Akademie kostete ihn damals den Sektionsposten; Wolf Biermann hatte sein Lied „An die alten Genossen“ vorgetragen und damit einen Rumor der offiziellen Empörung ausgelöst. Auch gehörte Hermlin zu den Gegnern jenes widerwärtigen Tribunals, das 1979 neun Autoren aus dem Berliner Schriftstellerverband ausschloss. Für den staatlich infam bedrängten Reiner Kunze setzte er sich ein, Thomas Brasch und Günter Kunert half er, den tristen, mürbenden Staat zu verlassen.
Er war ein Förderer junger Dichtung, aber er begründete keine Schule. Der erwähnte legendäre Leseabend in der Akademie gab das Aufbruchsignal für eine Lyrik der existenziellen Wachheit, die den gesellschaftlichen Boden danach abklopfte, ihn als Startbahn zu nutzen – ins Abenteuer offener Horizonte. Hermlin war Anstoßender, aber eine gewisse Zeitferne umflorte ihn, wo die Jüngeren ins Gegenwärtige drängten – um schneller als befürchtet auf abgebrochene Zukunft zu stoßen. Er gab Impulse, ohne sich hinreißen zu lassen. Er lehrte Maßstäbe, aber er setzte sich nicht zu den Lernenden. Er unterschied sich da gewiss von einem Geistmäzen wie Gerhard Wolf, der ebenfalls junge Dichterinnen auf den Weg brachte, ihnen Halt gab, aber den Impuls für Nachhaltigkeit stets mit gelebter Nähe zu diesen Jungen verband.
Wolf saß mit im Kreis, Hermlin blieb der wichtige, feldbereitende Mann von draußen. Der, gestreift von „Selbstherrlichkeit“,27 wie es Friedrich Dieckmann formulierte, die negativen Wirkungen seiner Art nicht immer einzuschätzen wusste. Dieckmann erinnert an einen Abend Ende Oktober 1989 in der Berliner Erlöserkirche in Rummelsburg, es war eine Protestveranstaltung gegen die Übergriffe der DDR-Staatsgewalt auf friedliche Demonstranten, Hermlin vor den Versammelten „mit der Kundgabe ,Ich bin auf eurer Seite!‘ In diese Botschaft der Erhabenheit gellten die Pfiffe eines jugendlichen Publikums, das an den Redner bestimmte Anforderungen stellte. Der stutzte, erschrak, begriff seinen Fehler; er änderte seinen Ton und gewann das Auditorium.“28
Mit provokantester Offenheit, so der Schriftsteller Rolf Schneider, habe Hermlin seinen bürgerlichen Kunstgeschmack vertreten, „sich gleichwohl für fast jede Regung der politischen Dissidenz interessiert und im Konfliktfalle verwendet […]. Der seelische Spagat, den seine Handlungen ihm abnötigten, war außerordentlich und ohne Deformation wohl nicht zu haben.“29 Diese Widerspruchsdichte von Ergebenheit und Kritik, die Hermlin zu einem Parteigänger für demokratischen Sozialismus auch nach dem Ende der SED werden oder besser bleiben ließ, verweist auf ein markantes Moment des damaligen Systemsturzes: die komplizierte Verflechtung nämlich von konfrontativer Dissidentenschaft mit jenen Menschen, die innerhalb der SED-Funktionalität und sehr wohl in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den Zielen und Mechanismen des Systems für eine Erneuerung der politischen Praxis eintraten. Die dafür im ständigen Widerstreit von Einsicht, offener Kritik und versteckten Winkelzügen aufrecht und loyal zugleich zu leben versuchten – und die letztlich die eigentliche Erklärung dafür sind, warum diese DDR so beiläufig verschwand.
Eine Unterschrift und die Folgen
Hermlin wird 1915 als Sohn wohlhabender großbürgerlicher Eltern in Chemnitz geboren, er heißt Rudolf Leder; erst später: Hermlin – erinnernd an den Hermelin: die nie erfüllte Sehnsucht nach dem weicheren Stoff. Der Vater: ein Jude. Als Halbwüchsiger, 1931, schließt sich Stephan den Kommunisten an, als einziger Gymnasiast seiner Schule. Nimmt den familiären Unfrieden in Kauf, verlässt seine Klasse am Vorabend jener Zeitenwende, deren furchtbares Gesetz ihm und vielen anderen zunächst verborgen bleibt: dass nämlich der Schritt nach links ein Schritt zur Todesgefahr hin ist. Denn wer kann damals mit Gewissheit prophezeien, dass Neigung zur Rebellion, die sich unter dem Kürzel KPD organisierte, in Bälde womöglich in Konzentrationslager führen würde?
Hermlin stößt nicht aus erlittener Not zu den Kommunisten, sondern aus Mitgefühl und Entdeckerlust; ihn treiben antiautoritäres Pathos und aufrührerischer Überschwang. Er kommt nicht aus den Kerkern des Hungers, nicht aus den Verliesen der Knechtung, sein Leben hatte bislang nichts gespürt vom Fluch der sozialen Wertlosigkeit. Er erfuhr Unterdrückung nicht am eigenen Leib, aber er hat doch ein Herz für das Bedrückende. Radikale Kritik des gesellschaftlichen Status quo: ein Kunst- und plötzlich auch Lebenselixier, das dem jungen Intellektuellen Kräfte zuschaufelt.
Eine Unterschrift auf dem Antrag zur KP-Mitgliedschaft wirft ein ganzes Leben in eine Bahn, deren eiserne Gleise kein Entrinnen erlauben. Exil in Palästina, Untergrund in Spanien und Frankreich. Kriegsende in der Schweiz, Neuanfang in Deutschland.
Es gibt das Bewusstsein, Mitkämpfer einer Bewegung von Unterdrückten und zugleich Träger einer Utopie zu sein. Aus diesem Konflikt rettet uns kein höheres Wesen, kein Kaiser, noch Tribun, sondern nur das eigene Gewissen.30
Ein Satz von Hermlin. Er benennt jene schwersten Prüfungen, in die ein Mensch geraten kann: das Gute just in einem Moment verteidigen zu wollen, ja zu müssen, da es plötzlich unaufhaltsam umstellt ist von Mordgier, da also der Handelnde begreift, dass er untergehen kann. Und er trotzdem handelt.
Vom Gewissen war des Öfteren die Rede, nachdem der Literaturjournalist Karl Corino 1996 sein Buch Außen Marmor, innen Gips31 veröffentlicht hatte: Hermlin als Fallbeispiel für die Spannung autobiographischer Literatur zwischen Fakt und Fiktion. Corino deckte auf: Hermlin war kein Spanienkämpfer, sein Vater starb nicht in einem Konzentrationslager. Plötzlich erschien Abendlicht, bislang allgemein verstanden als zweifelsfreies Erinnerungswerk, als bewusste Irreführung. Am Ende einer erbitterten, für Hermlin zweifelsfrei demütigenden Kontroverse in den Feuilletons steht sein leiser Satz, zu einigen Details, die Corino offenlegte:
Das war gelogen.32
Aber: Schon vor Erscheinen von Abendlicht hatte Hermlin in einem Brief an den Komponisten Tilo Medek geschrieben, das Buch werde „ein Stück belletristischer Prosa, Dichtung und Wahrheit also auf meine Art“.33 Hermlins Art: als junger Mensch Elite gehasst zu haben und ihr doch geistig nutznießend immer anzugehören. Elite ist Besitztum über das Krude, Zwingende der Realität; Elite ist: der Kunst zu nahe gestanden zu haben, um nicht ihre Lockrufe zur Selbststeigerung sehr unmittelbar aufzunehmen. Zumal das eigene Leben plötzlich ein Zufallsding wird, ein von fremden Mächten geformtes Material. „Als er die antisemitischen Ausschreitungen des Stalinismus wahrnahm, mochte er von seiner Welt nicht lassen, da die Welt, der er sich dann hätte zuwenden müssen, auch bloß bewohnbar war von gewöhnlichen Antisemiten“,34 so Rolf Schneider.
Hermlin, der Jude. Der Dichter. Der Kommunist. Es summierten sich wohl diese nicht mehr tilgbare Angst des Juden vor der Vernichtung, dieses panzerungsbemühte Ego des Überlebenden, diese mythische Veranlagung des Poeten und diese fahrlässige Selbstüberhebung des geistig und politisch Privilegierten, summierten sich zum konsequenten Gemüt des Gegenweltlers. Und Gegenwelt hieß Beteiligung am Klassenkampf wie auch Verteidigung seiner heroischen Möglichkeiten, die quasi das antifaschistische Heldentum mit der Bewusstseinshelle des Antikischen verband. Besaß Kunst eine weltverändernde Funktion, dann bestand sie in gemeißelten Bildern, darin das Ideal sicher und zukunftsfest existieren konnte. Und sollte das eigene Leben, wenn man denn von ihm zu erzählen sich entschloss, nicht auch für diese Wirkung quasi eingesetzt werden dürfen? Volker Braun sprach einmal von der „abenteuerlichen Uniform“, die Hermlin sich anzog, „nicht zur Täuschung, sondern um sich kenntlich zu machen“.35
Von der Ersten Reihe zum 20. Juli
Es war gewiss nicht die stilvollste, nicht die wichtigste Erzählstrecke, auf die sich Hermlin begab, aber in Bezug auf seine ästhetisch-moralische Grundverfasstheit hat diese eher marginale und fast schon vergessene literarische Produktion ihre erwähnenswerte Bewandtnis: 1951 nämlich erschien im FDJ-Verlag Neues Leben der Porträtband Die erste Reihe.36 Mit dokumentarischer Präzision erzählt Hermlin vom Widerstandskampf kommunistischer, jüdischer und bürgerlicher junger Menschen. Männer und Frauen, die mit ihrem Mut bekannt wurden oder andere, die namenlos blieben und erst mit dieser literarisch-publizistischen Würdigung in ein öffentliches Gedächtnis fanden. Das Buch prägt hohe Konzentration auf das Leiden. Leiden als Preis des Kampfes. Der Kampf, der mit dem Tod endet, darf wie der Vorschein eines Sieges betrachtet werden. Dieser Sieg wäre: ein besseres, nämlich von sich selbst belehrtes Deutschland.
Hermlin schildert antifaschistischen Widerstandskampf geradezu lakonisch. Die Sprache ist klar, sie mutet an, als wolle der Autor just dort, wo sich Pathos doch keinesfalls verböte, noch grausamer sein als eine Akte, die Hinrichtungen vorbereitet. Der Autor übergibt Schicksale dem Bericht. Klingt wie Gericht. Dies hier ist ein Jüngstes Gericht: Freispruch! Literatur errichtet nun Denkmäler, für die gleichen Leute, denen reale Geschichte gestern Schafotte baute. Die Gerechtigkeit von Literatur kann grausam sein – wenn sie mit der Würdigung wartet, bis die Toten diesen Blick bekommen, den wir nicht mehr los werden.
Was hat dieses Stück Literatur, dass man es in heutigen Zusammenhängen noch für betrachtenswert halten darf? Es rückt zurecht. Denn es sagt, wer die Ersten waren. Die Ersten, die nicht von schlimmer Fügung getroffen wurden, sondern eine eigene Entscheidung trafen. Die ersten Opfer wussten, dass sie es werden würden. Das ist für Hermlin wesentlich geblieben: Sie konnten etwas dafür, dass das, was mit ihnen geschah, eintrat. Sie lehnten es ab, unbehelligt zu bleiben. Sie handelten, auch wenn sie Kommunistinnen waren, als reinste DemokratInnen: Sie wählten nämlich frei. Danach blieb keine Wahl mehr, nicht mehr für den Einzelnen, nicht mehr für den Kommunismus als zunächst illegale und später staatsbeherrschende Parteipraxis.
Chateaubriand: Leben, das einem aufgelegt wird – und wahre Ungebundenheit, indem man genau dies akzeptiert. So begegnen einander die menschliche Sehnsucht, sinnvoll zu existieren, und die Unmenschlichkeit, diesen Sinn einer Überforderung opfern zu müssen. Hermlin war der vom Schicksal erzwungene ethische Extremist, der bedauerlicherweise mit der Gnade eines poetischen Talents geschlagen war, das sich diesem Extremismus zu beugen hatte. So entsteht verletztes Werden, und Hermlin ging inmitten der Freundesaura eines Paul Eluard, Louis Aragon oder Pablo Neruda durch die Zeiten, die friedlicher, aber nicht besser wurden. Es schien fortan seine letzte Aufgabe zu sein: im Auftrag der Toten zu reden und zu schweigen. Noch im Schweigen zu sagen, wer damals die ersten Mutigen waren, die ersten Erschütterten, die ersten Unfähigen zur Tatenlosigkeit.
Dies zu sagen, täte es nicht aufs Neue Not? Es tut immer Not, weil zynischerweise die Opfer stets die Ersten sind, die sich ausgerechnet dann legitimieren müssen, wenn ihnen die Zeit endlich Recht gibt. So geht es den Opfern jedes Systems: Sie müssen sich damit abfinden, dass die Täter mit dem Abstand zum Geschehen interessanter werden. Die Täter sind unserer allgemeinen Unnatur einfach näher. Die haben meist nicht diese Geradlinigkeit, die einen hohen Wert hat, aber einen geringen Unterhaltungswert. Arterhaltung schleicht krumme Wege. Jede erste Reihe aber schleicht nicht, sie geht ihren Weg. Ihr geht es nicht um Arterhaltung, sondern um Arterziehung. Alle diese jungen Kämpferinnen starben, fürs ewige Gesetz: Ein paar wenige sind anständig, und auf sie beruft sich später der millionenstarke Rest.
Jene erste Reihe, über die Hermlin schrieb, ist auch unter einem anderen Aspekt erwähnenswert. Sie scheint in ihrer Bedeutung randständig geworden zu sein unter der Wirkungskraft dessen, was deutsche Offiziere gegen Ende der Naziherrschaft an Widerstand leisteten. Der 20. Juli 1944 hat es in Sachen Erinnerung besser als die Zeit unmittelbar nach dem 30. Januar 1933. Eben deshalb ist zu sagen: Hermlins Buch rückt zurecht. Es ruft Menschen auf, an denen sich Deutschland versündigte. Der Titel des Buches assoziiert eine Formation. Aber geschrieben hat Hermlin erschütternde Geschichten letztlich von Einsamkeit. Weil Gewissen nichts Verallgemeinerbares, nichts Teilbares ist. Gewissen muss, wenn es denn eines ist, einsam machen. Zugleich strahlt dieses Buch Unschuld aus; der ersten Reihe fehlt noch das, was danach kam, was aus dem Kampf gegen den Krieg eine geschichtliche Weltbewegung machte, in deren Siegesglanz schnell wieder ein gewalttätiges Elend der Macht eingehärtet sein würde. Der Stalinismus machte es allen Antikommunisten leicht, die neue sowjetgeprägte und -befohlene Ordnung zu verachten – aber wie stand es um das Aufarbeitungsethos der westdeutschen Demokratie? Günter Gaus schrieb:
Die Art, wie in Westdeutschland das verbrecherische System zu den Akten gelegt wurde – überwunden mag ich nicht schreiben –, verwies diese Fragen in die Unverbindlichkeit der Bewältigungsliteratur.37
Unverbindlichkeit? Ein Schreckwort für Hermlin. Eine allwaltend abstoßende Umgangsart gerade auch nach dem Ende der DDR. Freiheit als Freiheit von etwas, nicht mehr so sehr Zuständigkeit für etwas. Und alles Unbehagen lief ihm auf die Grundfrage zu: Sind die Frauen und Männer jener ersten Reihe also letztlich doch umsonst gestorben? Die Frage, die den Schriftsteller zeitlebens quälte. Sie heute zu beantworten heißt nicht, auf die Welt und ihre weitenteils misslichen Zustände zu zeigen. Die Frage beantworten heißt, in dieser Welt fragend auf sich selbst zu schauen. In Hermlins Erzählung „Die Zeit der Gemeinsamkeit“ (1949) heißt es, und es ist Sprache aus dem Kern der Hermlinschen Prosa:
Mit dem Heimischwerden in der Welt, sagte ich mir, ist es nicht so leicht. Zugleich war mir, als müsse ich aufbrechen, ohne Verzug, irgendwohin, um die suchen zu gehen, die feurige Türen hinter sich zugemacht hatten.38
Es ist aufschlussreich, an „Die erste Reihe“ zu denken und an ein Interview zu erinnern, das Hermlin 1988 der FDJ-Tageszeitung Junge Welt gab. Er spricht darin von „höchstens eins bis zwei Prozent“39 der Bevölkerung, die einst Widerstand gegen Hitler leisteten. Dies damals gesagt im Staat, der sich als Heimstatt deutscher AntifaschistInnen verstand. Ein bis zwei Prozent – aus welchem Geist kamen denn dann Millionen Menschen der DDR-Bevölkerung her? Hermlin zerstörte mit seiner Bemerkung, just in einem Zentralblatt sozialistischer Propaganda, einen ideologischen Mythos.
Am 16. Juli 1994 veröffentlichte Stephan Hermlin einen Essay: „Der 20. Juli 1944“. Es ist, als schlösse sich ein Bogen. Hatte „Die erste Reihe“ literarisch den Beginn seines Biographieteils DDR eingeleitet und jenes Thema kräftig angeschlagen, das des Autors Leben nie loslassen würde, so beschloss der 1994 aktuell verfasste Text den schriftstellerischen Existenzgrund. Hermlin wehrt sich gegen den Versuch bundesdeutscher Geschichtsschreibung, „Stauffenberg und seine Mitkämpfer zur deutschen Widerstandsbewegung schlechthin“40 zu erklären. Noch einmal beschwört er das Andenken an Tausende Tote an der „Schafottfront“,41 spricht aber auch von der langjährigen „Unfähigkeit oder dem fehlenden Willen, die schweren inneren Kämpfe nachzuempfinden, die die Angehörigen des preußischen Adels auszutragen hatten“,42 bis das Attentat zustande kam:
In dieser Hinsicht, wage ich zu sagen, hatten es Angehörige der Arbeiterklasse leichter, entscheidende Entschlüsse zu treffen. Einander gleich wurden Arbeiter und Adelige im Angesicht des Todes […].43
Die Geschichte, so Hermlin, frage „nicht nur nach dem Erfolg eines Handelns. Es gibt eine Größe im Scheitern, die sich den Nachkommen, den Kindern mitteilt.“44 Die trotzige Hoffnung. Das beharrliche Sehnen wider jede Erfahrung. Das stolze Behaupten, das sich um die Zumutungen der Vergeblichkeit nicht schert. Abendlicht wird eingeleitet von einem Satz Robert Walsers:
Man sah den Wegen am Abendlicht an, daß es Heimwege waren.45
Hermlins Heimwege: Er hat den rotscheinenden Feuerkreis seiner Jugend nie verlassen, unter allen Umständen nicht. Dass man auch an neuen Ufern nur strandet, hielt ihn nicht ab vom erhabenen, erhobenen Blick auf den Horizont, und sei dieser verschleiert, weit über eine menschenerträgliche Dauer hinaus.
Das Schöne in der Sprache der Deutschen
Stephan Hermlin. Er wirkte – so Günter Gaus, der ihn als einen Fast-Freund bezeichnete – wie jemand, dessen Haar noch in geschlossenen Räumen zu wehen schien.46 Da war ein junger Mensch in aufmöbelnden Konflikt mit dem Narzissmus „auf der Seite des höheren Aufwandes“47 geraten, wie die Schauspielerin Inge Keller einmal ihre bourgeoise Herkunft bezeichnete. Da kämpfte ein Sensibler gegen die eigene Natur, vergewaltigte sein Feingefühl, verurteilte sich selber, wollte dekadent sein gegen das Bestehende, hätte wohl auch Klosterschüler werden können – wurde aber Jungkommunist. Entwand sich jeder Ironie, reihte sich ein, züchtigte sich mit Anerkennung einer höheren Warte. Hermlin steht für die normative Vorstellung, dass ein Mensch seinen Überzeugungen so treu wie möglich bleibt. Diese Vorstellung ist nicht das non plus ultra, sie bleibt anfechtbar, sie hat ihre geschichtlichen Überspitzungen und Perversionen erfahren. Aber indem Selbstachtung und Wertschätzung heute, in bürgerlichem Freiheitsgefilde, weniger an das gebunden sind, was der Mensch sein soll, eher an das, was er in sich wandelnden Kontexten sein kann, verlor das auf Kontinuität setzende Konzept der Treue an gebietender, verpflichtender Kraft. Hermlin gemahnt an den Gewinn wie an den Verlust, der mit diesem ethischen, geistigen, ästhetischen Paradigmenwechsel verbunden ist.
Es ging diesem Schriftsteller um die Aristokratie der Distanz, der Selbstüberwindung, und so hätte er auch früh bei Ernst Jünger endigen können, den er zeitlebens für einen großen Schriftsteller hielt.
Ein Mensch, der einen sehr bedeutenden Stil schreibt, kann nicht mein Feind sein […].48
Nun, es wurde nicht der Kreis um Ernst Jünger, es wurde Thälmanns Partei. Und der Gedanke der Selbstverbesserung wich dem besseren Gedanken: die Welt zu ändern. Er hat sich nicht angemaßt, von einem weltanschaulichen Programm Vollkommenheit zu erwarten, er sagte 1984:
Ich bin Teil einer Bewegung, also trage ich mit Verantwortung für sie. Und ich kann nur darauf drängen, dass diese Bewegung auch mit meiner Hilfe ihre Irrtümer überwindet. Aber ich kann mich nicht von ihr trennen.49
Auch wo er funktionierte, wirkte er nie wie ein Funktionär. Das unterschied ihn von manchem. Er stand im Klassenkampf, aber kultiviert. Vielleicht ist auch dies ein Ausdruck wahrer bürgerlicher Freiheit: Ein Mensch sucht sich seine Feinde sorgsamer aus als seine Freunde.
Seine letzte Erzählung, nicht einmal zwei Buchseiten lang, heißt: „Der Baum“ (1994).50 Es ist die Mosbacher Line in Thüringen, in der Nähe der Wartburg, ein Ort des Träumens vor der Wand eines Gewitters. Zwei Worte, deren kostbares Altertum Hermlin besonders betont, prägen diesen kurzen Text: „hold“ und „seelenvoll“. Sanfter, inständiger Aufruf des Schönen, des Schönen in der Sprache der Deutschen. Eine einzige Gedichtzeile seines Werkes hat der Dichter immer wieder zitiert, durchaus mit Anklang, sie sei vielleicht seine einzig gültige Zeile:
Was ich ganz scheine, dessen bin ich bar.51
Acht Worte für Trauer und Tragik, Zweischneidigkeit und Zerrissenheit einer poetischen Konfession, ja eines ganzen Lebens.
Hans-Dieter Schütt, aus Mirjam Meuser, Janine Ludwig (Hrsg.): Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland Band II, fwpf, 2014
Nicht beendetes Gespräch über Stephan Hermlin
zwischen Christa und Gerhard Wolf
– Mit dem Dichter Stephan Hermlin (1915–1997) waren wir befreundet. Ich gab 1962 eine Auswahl seiner Gedichte im Reclam-Verlag Leipzig heraus.
Nach seinem Tod sprachen wir bei einer Feier zu seinem Gedenken.
1975, zu seinem 60. Geburtstag, als abzusehen war, dass man in der Öffentlichkeit nicht allzu viel Notiz von diesem Anlass nehmen würde, hatten wir unter befreundeten Autoren eine Mappe mit Beiträgen angeregt, als Grüße gedacht, mit Texten von Schriftsteller-Kollegen: „Aus Manuskripten von Freunden“.
Zu den von uns angesprochenen Autoren gehörten neben Erich Arendt Volker Braun, Eduard Claudius, Adolf Endler, Elke Erb, Franz Fühmann, Stefan Heym, Bernd Jentzsch, Hermann Kant, Rainer Kirsch, Günter Kunert, Reiner Kunze, Christoph Meckel, Anna Seghers, Jeanne und Kurt Stern. Es grüßten neben Vladimir Pozner auch aus Paris die Freunde der „action poétiquee mit Charles Dobzynski und Alain Lance.
Christa und ich verfassten damals einen fiktiven Dialog „Nicht beendetes Gespräch“. –
Werden unserer Literatur die Briefwechsel fehlen – „bei diesen postalischen Verhältnissen“ –, werden die Tagebuchzeugnisse wegfallen? Da die öffentlichen Aussprachen meist durch Schattengefechte ersetzt sind – man kennt, was die Redner X in Sachen Y vorzubringen haben, und weiß, was sie heimlich trinken –, scheinen auch die Gespräche zwischen Personen seltener zu werden.
Jedes Mal aber, zumindest oft, wenn wir ihn verlassen – zu manchen Zeiten, nicht den ruhigsten, häufiger, zu anderen seltener, und auch darüber geben wir uns wenig Rechenschaft –, immer reden wir weiter. Übereinstimmend oder streitend, besänftigt oder erregt; so dass wir die Rollen im Gespräch oft tauschen, indem einmal sie, das andere Mal er zustimmt oder Einwände macht.
G Warum geht man immer wieder zu ihm?
C Ein Ort, um Urteile zu hören, an denen man die eigene Meinung überprüfen kann.
G Wie kommt das, ist er besonders klug, mutig, gebildet?
C Natürlich, aber –
G Aber er hat noch einen Vorteil, der immer seltener wird: Politisches und Künstlerisches treffen bei ihm nicht nur zusammen, sie sind beide, mit der gleichen Leidenschaft durchlebt, in seiner Person verschmolzen. Die authentische Erfahrung ist es, die man akzeptiert, manche sagen, er nimmt ja alles persönlich.
C Wegen des apodiktischen Tons, der manchmal angeschlagen wird, der subjektiven Empörung…
G Du meinst, man ahnt vorher, was er sagen wird?
C Schließlich kennen wir uns inzwischen ein wenig. Ihm wird das mit uns ähnlich gehen.
G Ich werde noch immer überrascht durch prononcierte Urteile, Abneigung, ja Widerwillen, die er autoritativ äußern kann. Wir tauschen dann unseren Blick: Er ereifert sich. Nennt einen Vorgang, einen Missstand, den wir schon „normal“ finden wollten, auf einmal wieder „ungeheuerlich“ – und oft ist er es. (Übrigens: „ungeheuerlich“ ist eines seiner Lieblingsadverbien, vor allem, um Perfides abzuqualifizieren.)
C Aber er kann auch loben, ausschweifend, maßlos, neidlos. Ein Mensch, in manchem sein Widerpart, kann als „sehr guter Schriftsteller“ von ihm respektiert werden…
G Selbst wenn er auf einer dieser Sitzungen aus vorhersehbarem Anlass mit ihm aneinandergerät, schneidend: Herr. Man wartet darauf. Ich möchte ihn nicht zum Feind haben.
C Wenn ich unter seinen Wörtern eins nennen müsste, ich glaube, ich würde „nobel“ nehmen. Wer gebraucht sonst noch solche Wörter? Und wenn ich ausdrücken müsste, was ihn von Grund auf treibt oder lähmt, jenen Grund-Widerspruch, an dem man wächst, leidet, sich bewähren muss – ich glaube, es ist eine ungeheure, unstillbare Sehnsucht nach Vollkommenheit.
G Die er wohl nur in der Kunst für möglich hält (übrigens: er schreibt oft das Adjektiv „ungeheuer“ und weiß um seinen Doppelsinn), in der Kunst…
C Die ja, ungeheures Zusammentreffen, auch sein Metier ist.
G Du spielst auf seine Verletzlichkeit an. Die fällt einem ja auf, wenn man in Disput kommt. Er hört in Meinungen, unschuldigen Äußerungen oft Untertöne heraus, die man selbst nicht wahrgenommen hat. Man will ja nicht verletzen, schon gar nicht ihn, und ist dann bestürzt über empfindliche Reaktionen.
C Mir scheint, diese Art von Verletzbarkeit entsteht, wo ein absoluter Anspruch – der nach Vollkommenheit – sich an der Einsicht reibt, dass dieser Anspruch nicht zu erfüllen ist. Erzählte ich nicht von jenem Abend in Stockholm? Von dem psychologischen Sprachspiel, das eine Holländerin mit uns machte? Es waren spontan drei Wörter zu nennen. Er nannte „Schatten“ und „Abendlicht“. Das dritte habe ich vergessen. Die zweite Spielstufe erforderte einen rhythmischen Zusammenschluss dieser Wörter – er machte sogar einen Reim, „a la Conrad Ferdinand Meyer“, sagte er. Als nun die Wörter durch Vokalverschiebungen verwandelt werden sollten, verweigerte er strikt die Mitwirkung: diese Binnenreime habe er niemals für gut gehalten. Ich provozierte ihn durch den Vorwurf, er wolle nur nicht unter sein Niveau gehen. Aber er sei doch schon ganz schön unter sein Niveau gegangen, antwortete er. „Zweitrangig“ ist eines seiner ätzenden Worte.
G Seine Großzügigkeit gegenüber Leistungen von Zeitgenossen überträgt er kaum auf sich. Er ist in dieser Hinsicht – es mag manchem unwahrscheinlich klingen – bescheiden, wenn es um die eigene Leistung geht; was er von sich gelten lässt…
C Weiß aber wiederum, was es gilt.
G Lässt sich aber zu einer Rigorosität hinreißen, die schon das Maß übersteigt, das man anerkennen könnte (von dem man manch anderem wenigstens eine Ahnung wünschte). Das schließt – seltsames, aber nicht unverständliches Paradoxon – nicht aus, dass es ihn maßlos erbost, sich und seine Arbeit missachtet zu sehen – was ihm nicht selten geschehen ist. Sein Zorn darüber steht auf einem anderen Blatt.
C Er kann, schreibend, nicht leichtsinnig sein. Ich fühle ihm die Hemmung nach, die entstehen muss, wenn der Zwang, im ästhetischen Sinn gültig zu sein, dem Zwang begegnet, vollkommen wahrhaftig zu sein. Die Produktion, die ja oft genug ein gewagter Prozess der Annäherung an das Ideal ist, kann einem unmöglich werden.
G Das absolute Diktat Brechts: Du sollst produzieren!, hat er für sich so wenig akzeptiert wie vieles andere an der Haltung dieses Antipoden. Er sucht keine Schüler und hat nichts von einem weisen Lehrer (wenn manche auch von ihm lernen). Von den Jüngeren wird er, soweit ich sehe, bewundert oder misskannt; bewundert wegen der kühnen Attitüde des Dichters, die sonst hier nicht vorkommt. Er sagte einmal: Ich bin eigentlich ein Pathetiker, und deutete damit an: Nun stellt euch einen solchen heutzutage vor!
C Was mir nachgeht, als er einmal sagte: Wenn von allen meinen Gedichten nichts übrig bleiben sollte, eine Zeile habe ich geschrieben, die vollkommen wahr ist:
„Was ich ganz scheine, dessen bin ich bar.“
Die Ahnung dieser Wahrheit geht durch seine Gedichte, durch die Prosastücke, die mich am meisten bewegen. Wir zitieren ihn ja oft…
G Und sagen ihm auch nichts davon. Denken wir, das sei nicht angängig?
C Es ist auch Scheu dabei von unserer Seite, die man überwinden muss.
G Ich lasse sein oft berätseltes, ja missbilligtes „Schweigen“ (das man höchstens dem Lyriker vorwerfen könnte) ohnehin nicht gelten. Er hat, wie ich es sehe, wie kaum ein anderer seiner Generation und Art sich unserer Vergangenheit gestellt. Auf schmerzhafte Weise. Es ist ihm nicht gegeben, sich blind oder taub zu stellen oder gar nicht betroffen. Wo es für ihn nichts mehr zu sagen gibt, ist er sprachlos. Aufzubessern, umzudeuteln, umzukehren, zu verdrängen ist er nicht der Mann.
C „Nie reimt sich Liebe auf Beflissenheit“ – eine Zeile, die mich seit Jahren begleitet hat.
G „Die Zeit der Wunder ist vorbei.“
C „Und in der Dämmrung sind die Katzen wieder grau.“
G „ Der Treue Farben brachen durchs Gewölk der Phrasen.“
C „Ich weiß noch, wie im Strom das Boot der Liebe sank.“
G „ Die Worte warten. Keiner spricht sie aus“
C „Aus ihrem Säumnis ist mein Traum gemacht“
G „Wenn falsche Worte sprach mein Mund,
C Mein Herz blieb wahr und wahr mein Mühn.“
G Das traf unser Gefühl, das wir ja aus Selbstverleugnung so gern mit dem Präfix Leben verbunden haben. Lebensgefühl…
C Es hat dazu beigetragen, es zu bilden. Diesen schrecklich schweren Bogen vom Glauben zur Nüchternheit, ein Gang, auf dem alles möglich ist, Trauer, Zweifel, Melancholie (Verzweiflung will er nicht nennen), nie aber: Zynismus, Gleichgültigkeit, Versteinerung, Resignation.
G Und du fragst, warum wir zu ihm gehen?
C Warum?
G Das ist vielleicht noch ungesagt.
C Ungern stelle ich mir vor, diese Begegnung hätte nicht stattgefunden, wäre nicht immer neu weiterhin möglich…
G Die Zeit der Wunder
Die Zeit der Wunder ist vorbei. Hinter den Ecken
Versanken Bogenlampensonnen. Ungenau
Gehen die Uhren, die mit ihrem Schlag uns schrecken,
Und in der Dämmrung sind die Katzen wieder grau.
Die Abendstunde schlägt für Händler und für Helden.
Wie dieser Vers stockt das Herz, und es erstickt der Schrei.
Die Mauerzeichen und die Vogelflüge melden:
Die Jugend ging. Die Zeit der Wunder ist vorbei.
C Es war die gute Zeit der Schwüre und der Küsse.
Verborgen warn die Waffen, offen lag der Tod.
Die Schwalben schrien in einem Abend voller Süße.
Man nährte sich von Hoffnung und vergaß das Brot.
Die halben Worte, die im Dunkel sich verfingen,
Waren so unverständlich wie Orakelspruch.
Hörst du es noch: Wenn wir die Zeit der Kirschen singen…
Ich weiß noch heut der blauen Nebel bittren Ruch.
G Ich weiß die tückische Leere noch der Rückzugsstraßen
Und nachtschwarz die Minuten vor dem Drahtverhau.
Der Treue Farben brachen durchs Gewölk der Phrasen.
Zweitausendmal begann das Alphabet mit V.
Und der Bedrohten Rüstung schimmerte von Tränen.
Ich weiß noch, wie im Strom das Boot der Liebe sank.
Ich hab im Ohre noch die Lockung der Sirenen,
Wenn mit dem letzten Wein den Rest der Furcht man trank.
C Die Kinder kannten jäh den Sinn der alten Bücher.
Das Messer auf dem Tisch wurde an Worten scharf
Und Abende zog man sich ins Gesicht wie Tücher,
Wenn man das Stelldichein der Mörder suchte. Darf
Man sich der bittren Racheschwüre noch entsinnen…
Ich hör im Nachtwind brausen noch den wilden Schwan.
Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen.
G Die Zeit der Wunder schwand. Die Jahre sind vertan.
1975/2020
Christa Wolf und Gerhard Wolf, Beitrag zum 60. Geburtstag von Stephan Hermlin am 13.4.1975. Erstveröffentlicung in Freibeuter, März 1995
Richard A. Zipster: DDR-Literatur im Tauwetter. Band III. Stellungnahmen
ZEUGE IN ÜBERGANGSZEITEN
für Stephan Hermlin
In Übergangszeiten
ziehen es manche vor
den Kopf einzuziehen
und Tadel wie Beifall zu meiden
Sonst droht das Wohlwollen
der Übelwollenden
oder das Übelnehmen
der Wohlmeinenden
Aber einige meinen wie du
man muß sprechen wenn Übergang
der Übergang
zu etwas Besserem sein soll
Loyalität
meinen diese
kann nicht
Verzicht auf Kritik sein
denn solcher Verzicht
sieht nur
ganz von oben
wie Loyalität aus
In Wirklichkeit brauche ihr Staat
und brauchen ihre Genossen
nicht einfach Gefolgschaft
sondern kritische Loyalität
So bist auch du manchen Freunden
zu kritisch – und heimliche Feinde
enttäuschst du weil deine Kritik
nur Fehlern gilt
Erich Fried
Hans Richter: Laudatio auf Stephan Hermlin, Sinn und Form, Heft 2, 1985
Klaus Werner: Stephan Hermlin und die literarische Tradition, Sinn und Form, Heft 2, 1975
Hanjo Kesting: Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen. Der Lyriker Stephan Hermlin, Merkur, Heft 401, November 1981
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Stephan Hermlin
Gespräch & Interview: Stephan Hermlin und ein unbekannter Gesprächspartner. Sammlung „Verlag Klaus Wagenbach“: Tonkassetten 31 und 32 und Tonband 13.
Gespräch Alexander Reich mit Andrée Leusink über ihren Vater Stephan Hermlin:
Teil 1: „Ein beliebtes Wort war: Lies!“
Teil 2: „Auf einmal war er wie Stein“
Teil 3: „Klein beigeben wäre Verrat gewesen“
Peter Huchel | Stephan Hermlin Zeitzeugen des Jahrhunderts. Literarischer Salonabend im Haus Dacheröden, Erfurt mit Lutz Götze (Manuskript) und Franziska Bronnen (Lesung).
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Zum 75. Geburtstag von Stephan Hermlin: Sinn und Form 1 + 2 + 3
Nachrufe auf Stephan Hermlin: Der Spiegel ✝ Sinn und Form
Zum 100. Geburtstag von Stephan Hermlin: junge welt + der Freitag +
Kölner Stadt-Anzeiger
Zum 25. Todesstag von Stephan Hermlin: nd
„Welch eine Abendröte“ Stephan Hermlin – zum 100. Geburtstag eines spätbürgerlichen Kommunisten

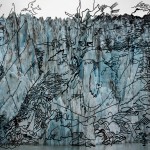
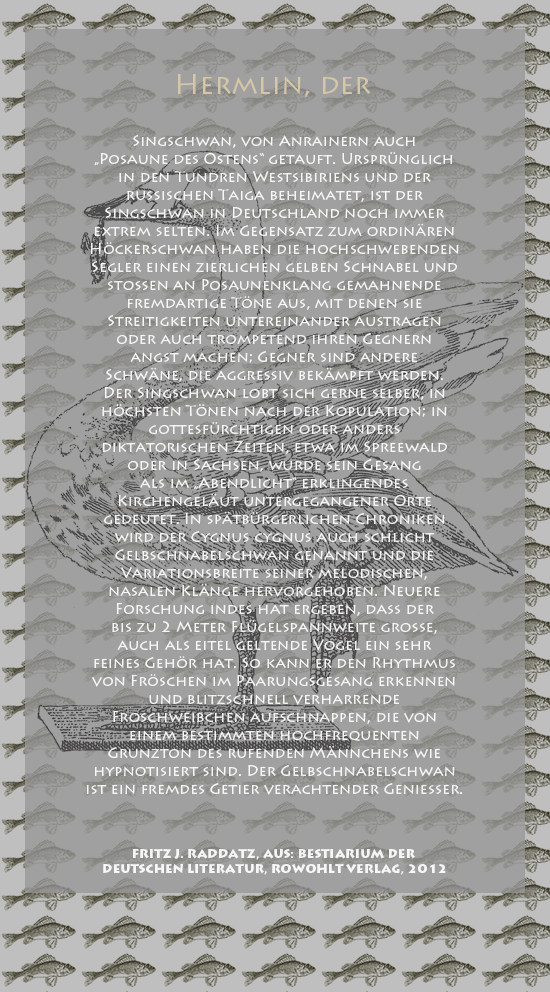












Schreibe einen Kommentar