QUANTENSCHAUM
Nicht nur die Dinge selbst, ihre Erscheinung,
auch die Bedeutungen, die sie seit langem
haben, lassen sich wenden
ins Unvorstellbare.
Ein Mandelbaum, schau,
in voller Blüte, in einer Ecke entdeckt
des Botanischen Gartens, ist nicht nur Topos
in einem Lied, einem Liebesgedicht,
sondern reine organische Materie auch.
Näher betrachtet, im extrem kleinen Maßstab,
unsichtbar für Auge und Mikroskop,
ist er ein Tanz von Blasen aus winzigsten
Teilchen in einem Abstraktum – Raumzeit
genannt in der Neuen Physik, die alles im All
in Relation setzt, relativistisch vernetzt:
eine gekrümmte, vierdimensionale Struktur.
Wenn Blasen das Wort ist, Momentum,
und nicht nur Metapher, die schnell zerplatzt.
Jeder Mandelbaum ist ein Quantenschaum.
![]()
Durch Geschichte und Gegenwart
verfolgt Durs Grünbein in diesem neuen, seinem zwölften Gedichtband seinen Kurs des Poetisch-historischen Gedichts. Als Spurensicherung, Ortsbestimmung versteht der Dichter seine Streifzüge durch Zeiten und Räume, in denen er dem Norden, Deutschland, wie auch dem Süden, Italien, und in beiden Ländern sich selbst begegnet.
Immer, hier wie dort, kreuzt Vergangenheit den Weg des Wanderers. Durch Mörderreviere führen seine Verse ebenso wie über Lichtungen, auf Inseln im Mittelmeer wie auf gesamtdeutsche Sandpfade und betonierte Magistralen, entlang der Ost-West-Achse des unruhigen, wieder mit Kriegen konfrontierten Kontinents. Daß bei solchen Eindrücken auch Europa Konturen gewinnt – als Realität und Utopie –, wird niemanden wundern, der Grünbein auf seinen Wegen gefolgt ist. „Für alle Fälle kann Dichtung auch das sein: ein Gerät zum Einfangen der Zukunft.“
In seinen Versen verbindet sich die genaue Betrachtung kleiner Dinge mit der feinen Ironie eines Beobachters, dem gerade das unter den großen Themen oft Verschüttete am Herzen liegt. Mit wenigen Strichen ein Gedicht zu zeichnen, ist seine mit den Jahren gereifte Kunst.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2022
Streifzüge auf Walter Benjamins Spuren
– Durs Grünbeins neuer Lyrikband ist ein nachdenklicher Kommentar zur Lage der Schrift heute. –
Sicheres Anzeichen für das Hinwelken einer Kultur ist ihr bemächtigender Umgang mit Schrift. In Durs Grünbeines neuem Lyrikband Äquidistanz, seinem mittlerweile zwölften, ist es sogar der gefürchtete Widersacher Gottes, der am Wuchern der Papierberge entscheidenden Anteil hat. „Das war ein großer Tag für den Teufel, / als die Personenkennkarte aufkam…“, lautet der Auftakt des Gedichts „Menschen, gestempelt“. Aus dem Bestand der „verstörten Rehe“ schöpften, wie es weiter heißt, nicht erst die Nazis das „künftige Freiwild der Bürokratie“.
Die Geschichte des modernegemachten Unheils umfasst eine stetige Verkettung von Personenkenndaten. Sie führt entwicklungstechnisch von der Liste zur Zählkarte, zur Kontrollmarke, schließlich zu Formular und Melderegister. Gegenüber allen Vorschlägen der Dichterinnen und Denker macht die moderne Bürokratie ihren Anspruch auf „totale Erfassung“ geltend: Sie füllt Menschen in Sortieranlagen und scheidet die von ihr für minderwertig erkannten als abzusondernde wieder aus.
Tatsächlich wirft der Autor auch Postkartenblicke auf das Dritte Reich: Zeugnisse einer Alltagskultur, die – prekär genug – auf die Unschuld der an ihr Beteiligten pocht. Er schildert dann in „Strandbad Wannsee“ selbigen Ort als verkommenen Uferstreifen.
Sind das die Badefreuden der Toten?
Die einleitende Frage gilt den Jahren um 1940. Zwischen „Liegestühlen und Badetüchern“ halten Strandkörbe, in Stellvertretung der verschleppten Menschen, „die Stellung“. Irgendwo hinterm Blattgrün müssen die Villen versteckt liegen, die Tummelplätze der „Goldfasane, / Orte für manche Geheimkonferenz“. Auf der Wannseekonferenz wurde 1942 bekanntlich die industrielle Massenvernichtung der europäischen Juden beschlossen.
Der letzte Vers in Grünbeins „Menschen, gestempelt“ enthält somit das Eingeständnis eines Schrifttrunkenen, der klein beigibt:
Immer gingen Papiere dem Sterben voraus.
So schließt der Einzeltext lapidar, mit einer Art Kapitulationserklärung.
Wieder und wieder wurde an Grünbein – der bald 60-jährige Dresdner lebt heute abwechselnd in Berlin und Rom – in der Vergangenheit sein allzu kniefälliger Umgang mit den Schriftwerken der Alten bekrittelt. Man machte ihm seine Gelehrsamkeit regelrecht zum Vorwurf: sein „auf Du und Du“ mit den Vorfahren im antiken Rom, mit Büchner, mit Benn. In Vergessenheit geriet darüber Grünbeins Engagement: seine beherzten Widerworte gegen Uwe Tellkamp, seine Ablehnung der Pegida-Bewegung.
Äquidistanz bildet jetzt eine Art poetischen Vielfältigkeitsparcours, das vorzeitige Fazit zum Stand der dichterischen Dinge. Sollte Grünbein, der notorische Alleskönner, tatsächlich jemals im Elfenbeinturm gehaust haben, so muss man sich dieses Quartier mittlerweile zwar als strukturierte, aber streng auf Funktionalität getrimmte Kammer vorstellen. Der lyrische Ton nähert sich vorzugsweise der Alltagssprache an. Grünbein dichtet zumeist daktylisch-erzählend. Er behauptet die Schrift des Poeten als stets wechselnden Transit-Ort: als jene „krumme Straße“, auf der einst Walter Benjamin und Siegfried Kracauer zu ihren „klirrenden Höllenpassagen“ fanden.
Entlang der Fluchtlinien von Wasserarmen, Promenaden, Kanälen und Chausseen wird in diesem prachtvollen Band in neun Abschnitten eine Art Hebewerk sichtbar, ein Austauschgeschehen zwischen Weimarer Vergangenheit und Berliner Gegenwart.
Aber Grünbein besingt mit derselben Gelassenheit auch Italien, die tyrrhenische Insel Ventotene. Selbst Bertolt Brechts Exilbäumchen wird gegrüßt:
Steht eine Birke im Hinterhof, erinnert daran
wie es war, als die Barbaren endlich kamen.
Dieser „Poeta doctus“ kann auf Zuruf auch Paul Celan. Vor allem legt er ein wohltönendes, niemals vollmundiges Bekenntnis zum lebenslänglichen Zwischen(auf)halt ab:
… mehr bei den Dingen als bei den Worten
zu sein oder zwischen den Worten
und den Dingen, in einem Niemandsland
zwischen den allzeit vibrierenden Gehirnen.
Eben in Äquidistanz, in strikter Opposition gegenüber allen Besserwissern und Lückenfüllern. Distanzlos gesprochen: Dieses Buch ist ein Wurf.
Ronald Pohl, Der Standard, 26.8.2022
Wieder Weltmeister
– Richtet sich zwischen den Symbolen der Bildung und des Erinnerns womöglich etwas zu gemütlich ein: Durs Grünbein in seinem Gedichtband Äquidistanz. –
Unheimlich, wie wenig wir von der allernächsten Zukunft wissen.
So beginnt ein titelloses Gedicht im neuen Lyrikband des vielfach ausgezeichneten Dichters und Essayisten Durs Grünbein, und ein wenig unheimlich wirkt es tatsächlich, wie sehr diese Zeile sich als Prophezeiung des Lesegefühls erweist, das über neun Kapiteln nach und nach aufkommen wird.
Äquidistanz ist ein elegisches Buch, das sich in weiten Teilen dem Erinnern und Rückschauen widmet: Grünbein, der in Dresden aufgewachsen ist, viel Zeit in Berlin verbracht hat und seit Jahren (auch) in Rom lebt, gedenkt noch einmal der Wendezeit, besucht wohlbekannte Postkartenmotive des Mythos „Wildes Berlin“ und spaziert durch die Kulissen der deutschen Italiensehnsucht. Zwischen diesen Nostalgieschauplätzen tauchen gelegentlich sprachliche Stolpersteine auf: die Toten der Fluchtrouten nach Europa, ein KZ am Rande des hübschen Wanderwegs durch den Brandenburger Wald. Das Seltsame an diesen Störfaktoren aber ist, dass sie kaum stören – zu bequem fügen sie sich ein in den stellenweise fast staatstragenden Ton, der sich durch den ganzen Band zieht, unterbrochen von einigen bemerkenswerten Kalauern: „Durch die Baumstämme glänzen sah man ihn: den Wannsee, den Wahnsee“; oder, in einem Gedicht über den Schnee:
An den Rändern der Welt ist Weiß die beherrschende Farbe, an den Polen. Was hat Polen damit zu tun?
Offenbar nichts, jedenfalls wird diese Frage im restlichen Gedicht nicht weiterverfolgt.
„Unheimlich, wie wenig wir von der allernächsten Zukunft wissen“: Vermutlich konnten weder Verlag noch Dichter in der Vorbereitung dieses Bandes etwas vom nahenden Krieg in der Ukraine ahnen. Und natürlich lässt sich trefflich darüber streiten, welche Art von Gedichten es nach dem 24. Februar 2022 braucht – oder ob es diese gerade überhaupt braucht, wie die ukrainische Lyrikerin Halyna Kruk vor Kurzem zum Auftakt des Poesiefestivals Berlin fragte. Aber selbst wenn man von der Notwendigkeit von Lyrik gerade in Zeiten des Krieges und der Katastrophe überzeugt ist, kann man eine gewisse Irritation beim Lesen gleich mehrerer Grünbein-Gedichte, die sich vornehmlich mit der Ärgerlichkeit von Insektenstichen beschäftigen, nicht ganz beiseiteschieben:
Man hört das Summen, ein Bombergedröhn.
Der Dritte Weltkrieg der Insekten ist ausgebrochen.
Die ganze Nacht wird kein Auge zugetan.
Morgens sind die Handrücken, die Füße
mit roten Wundmalen bedeckt, die brennen, brennen.
Abgesehen von der Metaphorik, die angesichts der aktuellen Weltlage schmerzhaft unangemessen erscheint, schleicht sich bei Gedichten wie diesen, die zudem größtenteils umgeben sind von bildungsbürgerlichen Reminiszenzen auf griechische oder lateinische Klassiker, das Gefühl ein, hier schreibe einer, dessen größtes Problem ein Mückenstich ist.
Brauchen Dichter Probleme, um schreiben zu dürfen? Nicht unbedingt. Aber ein gewisses Maß an Dringlichkeit und Bereitschaft, dorthin zu gehen, wo es auch für einen selbst unbequem wird – das ließe sich erwarten von einem Autor wie Grünbein, der andernorts engagiert in den öffentlichen Diskurs eingreift und in der Vergangenheit etwa Position gegen die Pegida-Bewegung in seiner Heimatstadt oder antisemitische und rassistische Aussagen anderer Schriftsteller bezogen hat.
„Gedichte sind nicht dazu da, die Dinge unverständlich auszudrücken, sondern, um das Unverständliche auszudrücken“, hat der Lyriker Ramy Al-Asheq einmal gesagt. Von den vielen Definitionsversuchen dieser notorisch schwer zu definierenden Gattung ist dies vielleicht einer der überzeugendsten: Lyrik kann es gelingen, zur Sprache zu bringen, wofür es zuvor keine Sprache gab. Sie ist ein Modus des Erkennens, des Begreifbar- und Besprechbarmachens, des wortwörtlichen In-Worte-Fassens.
Ein solcher Modus des plötzlichen Sichtbarmachens gelingt Grünbein in einigen Gedichten im zweiten Teil seines Bandes, in denen er Postkartenmotive aus den 1930er-Jahren mit dem Text auf der Rückseite ebendieser Postkarten kombiniert. Diese objets trouvés erlauben eindrückliche Zuspitzungen, zum Beispiel in Form einer Postkarte, auf der die Allee Unter den Linden im Festschmuck zu sehen ist und auf deren Rückseite eine Ilse an ihre Freundin Irma in Wien schreibt, die deutsche Hauptstadt interessiere sie „nicht die Bohne“, während Grünbein, das sonnendurchflutete Motiv auf der Vorderseite der Karte beschreibend, hinzufügt:
August 36 […]
Deutschland zeigt sich
von seiner Schokoladenseite.
Berlin grüßt die Welt.
Ansonsten aber wiederholt Grünbeins gesetzte Sprache hauptsächlich, was man schon weiß. Gerade an Stellen, an denen es darum ginge, das zu tun, was eben vielleicht nur Lyrik kann – dem Unsagbaren trotz allem sprachliche Konturen zu geben –, werden Allgemeinplätze gebraucht, die gut und lange eingewohnt sind. Dort, wo es unheimlich werden könnte, versichert der Text sich selbst und seinen Lesern, auf der richtigen Seite zu sein: als Erinnerungsweltmeister, deren Vergangenheit gründlich aufgearbeitet ist. Dazu trägt auch bei, dass Grünbein beispielsweise das Ende der Zwanzigerjahre als eine Zeit beschreibt, „als die Blindenführer Europas beschlossen / ihre Bevölkerungen als Geiseln zu nehmen“. Dass die Bevölkerungen Europas keinen aktiven Anteil am kommenden Faschismus hatten, ist zumindest im Hinblick auf Deutschland eine gewagte These.
„Kein Vergleich, das hieß: / Nur ein Mythos wird bleiben. / Wie schlachtet man einen Mythos?“, fragt eines der Gedichte in Bezug auf das Dritte Reich. Eine gute Frage. Äquidistanz bleibt leider das Gegenteil einer Mythenmetzgerei; vielleicht eher ein gemütlicher Museumsbesuch am Sonntagnachmittag oder ein um dreißig Jahre aus der Zeit gefallener Mottoband zum Thema „Ende der Geschichte“.
Lea Schneider, Süddeutsche Zeitung, 25.7.2022
Was die Toten des letzten Jahrhunderts und ein Funkloch mit Durs Grünbeins neuen Gedichten zu tun haben
– Der Autor möchte zwar unentwegt nach vorne schauen, sein Blick aber geht hartnäckig zurück. Grünbeins Gedichtband Äquidistanz ist ein langes Gedenken an die Verstorbenen. –
Der Dichter Durs Grünbein lebt in verschiedenen Welten. Das ist nichts Aussergewöhnliches. Die meisten Menschen verbringen ihren Alltag in unterschiedlichen Sphären. Und die meisten machen darum wenig Aufhebens. Auch Durs Grünbein nicht, nur schöpft er daraus sein dichterisches Werk. Die Matrix seiner Lebenswelten spannt sich allerdings in die unterschiedlichsten Richtungen. So lebt er zum einen abwechselnd in Rom und in Berlin. Das klingt attraktiv, doch kann man sich auch denken, dass es mit vielerlei Anstrengung verbunden ist.
Da ist anderseits seine Geburtsstadt Dresden, wo er vor bald sechzig Jahren zur Welt gekommen ist. Er hat die Stadt in den achtziger Jahren verlassen und nomadisiert seither bald mehr, bald weniger durch die Welt. Dennoch lebt die Stadt in ihm fort, und immer wieder taucht sie in seinen Texten auf: als ein Monument der Kindheit. Das hat mit Empfindungen zu tun, die ins Sentimentale reichen. Die Stadt, die er als Kind erlebt hat, gibt es nicht mehr. Dass sie inzwischen schöner geworden ist (und zugleich älter), ist mit ein Grund für das schwierige Verhältnis.
Noch schwerer allerdings wiegen die politischen Bedenken, die Grünbein mit seiner Geburtsstadt verbindet. Sie ist ihm fremd geworden in dem Mass, wie manche Dresdner das Fremde auszuschliessen versuchen aus ihren Kreisen. Davon zeugte vor vier Jahren eine Diskussion mit dem Schriftstellerkollegen Uwe Tellkamp, ein Dresdner auch er, die über Fragen der Flüchtlingspolitik vollkommen entgleiste.
Und schliesslich öffnet sich in Grünbeins Gedankenkosmos noch ein weiteres, das vielleicht produktivste Spannungsfeld: Es ist das Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen realer und imaginärer Welt oder auch jenes zwischen Traum und Wirklichkeit. Aus diesen widerstrebenden Kraftströmen bezieht sein Gedichtband Äquidistanz seine poetische wie gedankliche Energie.
Es braucht dabei nicht zu verwundern, dass ihm aus Rom andere, sagen wir: lichtere Bilder zufliessen als aus Berlin. Erstaunlich hingegen ist es durchaus, dass er hier wie dort, ob er es will oder nicht, unentwegt den Toten begegnet. Sein neuer Gedichtband entwickelt sich in dieser insistierenden Bewegung zu einem Requiem für die Verstorbenen der jüngsten wie der früheren Zeit.
Nur vordergründig werden dabei die Unterschiede zwischen den Toten verwischt. So notiert der Dichter, dass in Berlin „die Stolpersteine vor jedem zwölften Haus“ mit ihrem Flüstern an die deportierten Juden erinnern. In Rom bemerkt er:
Die halbe Stadt ist unterkellert.
Die sieben Hügel seien „ein einziger Untergrund“, und die U-Bahnen „stören donnernd die Totenruhe, bringen Skelette, / Tonscherben, Münzen in Krügen zum Rasseln“.
Das heisst nicht weniger als: Die Toten bleiben den Nachgeborenen eine Aufgabe. Das hat in einer Stadt mit der Vergangenheit Berlins eine andere Dringlichkeit als in Rom, wo die Toten eine archäologische Konstante sind. Hier wie dort gehen die Lebenden stets in den Spuren ihrer näheren oder ferneren Vorfahren. Und man kann sich dann gut vorstellen, dass dieses Gedenken in Rom leichterfällt als in Berlin, wo die Geschichte schwerer lastet.
Und vielleicht brauchte es das römische Refugium, vielleicht musste einem erst in Rom bewusst werden, dass Städte Schicht um Schicht wachsen und dass in jeder Schicht die Toten das Fundament alles Kommenden schaffen. Rom wurde Grünbein zu einer neuen Sehschule. Auf einer Etappe dorthin, in Parma, notiert Grünbein:
Es ist wahr
in der Fremde erst kommt man sich nah.
Es könnte auch bedeuten, dass er in Rom einen anderen, neuen Blick gewinnt auf Berlin – und, wieso nicht: auch umgekehrt.
Nicht immer werden die Gedankengänge so eindringlich transparent in Durs Grünbeins neuen Gedichten. Das hat auch mit der etwas disparaten Sammlung zu tun, die vieles zusammenträgt, da und dort aber eine innere Ordnung vermissen lässt. Und so wie das Ganze nicht immer zwingend wirkt, so fehlt auch manchen Texten die poetische und sprachlich-sinnliche Stringenz.
Ein Feldpostbrief eines Wehrmachtsoldaten aus dem besetzten Warschau scheint da entbehrlich. Nicht weniger eine kleine Reflexion auf die von den Nationalsozialisten eingeführte „Personenkennkarte“ mit dem Fazit:
Das war ein grosser Tag für den Teufel.
Der Erkenntnisgewinn und die poetische Ausbeute halten sich in solchen Betrachtungen in überschaubarem Rahmen. Eine strengere Auswahl hätte dem Band jedenfalls keinen Schaden zugefügt.
Man liest diese Gedichte dort mit besonderem Gewinn, wo der Dichter an die Schmerzpunkte der eigenen Widersprüche herangeht und die Verse vom Reibungswiderstand erhitzt werden. Das geschieht zuverlässig immer dann, wenn Grünbein die unterschiedlichen Sphären seiner Lebenswelt aufeinanderprallen lässt. Da provoziert er gelegentlich auch vehementen Einspruch.
Für alle Fälle kann Dichtung auch das sein: ein Gerät zum Einfangen der Zukunft.
Nein, möchte man dem Dichter zurufen: So ist es doch gerade nicht. Dichtung ist kein prognostisches Instrument. Sie ist nicht näher bei den Dingen, das Gedicht ist nicht die Wünschelrute in der Hand des Propheten. Sogar die Gegenwart ist dem Gedicht bisweilen zu nah, um sie zu deuten. Vielmehr bezieht das Gedicht sein Licht aus der Vergangenheit. Es gedenkt der Toten – und schafft Raum für die Lebenden.
Vor allem ist das Gedicht ein Vehikel für den Austausch in den Topografien der Seele. Mitunter steht das Gedicht dem Traum näher als der kühlen Vernunft. Oder vielleicht müsste es heissen: Es hat gleichermassen Zugang zu beiden Sphären. Es ist angebunden an den Kreislauf der Gedanken wie auch an die tiefer liegenden Schichten des Unterbewusstseins oder der Traumwelten.
„Nachts wird die Psyche regelmässig zum Funkloch“, schreibt Grünbein. Sie ist dann dem rationalen Zugriff entzogen und interagiert mit anderen Kräften. Auch das Gedicht muss durch die Askese eines solchen Funklochs. Es muss den Anschluss finden an Bewusstseinsströme, die in alle Richtungen laufen.
Äquidistanz heisst dieser Gedichtband nicht ohne Grund. Das Titelgedicht fasst am Ende das Disparate und alle losen Enden dieser in viele Richtungen laufenden Gedankengänge noch einmal zusammen. Es ist eine Art Autobiografie in Versen, eine kleine Konfession. Er habe sich, so gesteht der Erzähler des Gedichts, vielfach den empörten Vorwurf eingehandelt, ganz weit weg oder nicht ganz da zu sein, unbeteiligt jedenfalls und in Gedanken versunken.
Dabei habe er bloss versucht, näher bei den Dingen zu sein als bei den Worten oder vielleicht gar „zwischen den Worten / und den Dingen, in einem Niemandsland“. Nicht Partei zu sein, zwischen den Fronten zu bleiben, sich nirgendwo anzuschliessen, nur darum sei es gegangen: „anderswo, anderswo!“, lautete seine Devise.
Genauer als so könnte man den Ort eines Gedichtes nicht benennen. Immer hält es sich auf im Niemandsland zwischen den festgefügten Gedanken, immer verbindet es die unterschiedlichsten Sphären. Es horcht in die Vergangenheit und spricht in die Gegenwart, es lässt die Toten zu Wort kommen und geht als ihr Bote unter die Lebenden. Durs Grünbeins Gedichte sind Funklöcher im besten Wortsinn: Sie sind empfänglich für anderes als die tosenden Datenströme.
Roman Bucheli, Neue Zürcher Zeitung, 19.7.2022
Ohne Girlanden und Fußnoten
– Durs Grünbeins Antifaschismus ist humanistisch und hellwach. –
Das erste Gedicht heißt „Nicht der Specht“. Nein, es war nicht der Vogel, der allein „einen ganzen Wald verhexen konnte / mit seinem kleinen Maschinengewehr“. Und es war auch „nicht die Stille in den Wartezimmern / bis die Schwester einen beim Namen rief“. Stattdessen: Narbe, Krater unterm Jochbein, Muttermal, die werden wichtig. Nicht als Verheißung einer Leibesbespiegelung, sondern als Ankündigung eines Sichinsverhältnissetzen. Zu den Lebenden und Toten, rumorender Geschichte, beharrlicher Natur, labyrinthisch-morbider Architektur.
Das ist schon mal ein guter Ansatz im Land der Mehrfachvergesslichkeiten, wo noch jeder Holzweg, jede tödliche Siegerstraße, jedes Paktieren mit dem Grau mit den Zeitläuften, einem Hätten-Wir-das-eher-gewusst oder gutem Glauben entschuldigt, schwammgedrübert und ad acta gelegt wird. Im Zweifel sind immer andere schuld. Der eloquente Österreicher, der verschmitzte Georgier mit Schnauz und Tabakpfeife, der rheinische Spitzkopf oder der sächsische Spitzbart. Oder der Mann aus Übersee.
Die Mehrfachvergesslichkeit hält die geflickte Fahne hoch und beschwört Traditionen, ob erfunden oder nicht, trompetet ihre Wahrheiten heraus wie eine Janitscharenkapelle vor dem Sturm. Rinks und lechts verwechsern sich, es wird gehobelt, und die Späne fallen reichlich. Aber Durs Grünbein verlangt nach Äquidistanz. So heißt der diesjährig erschienene Gedichtband des gebürtigen Dresdners, der wahlweise in Berlin und Italien lebt und vergangene Woche 60 wurde. Und Äquidistanz scheint die grundanständige Position eines Dichters zu sein, der Loblied, Schmähung und billigen Beifall verachtet, politische Haltung aus Deduktion und Analyse gewinnt.
Neun unbenannte Kapitel und das Dichtercredo Äquidistanz erwarten den Leser in knappem vers libre, gelegentlich doch gebundenen Versen. Ohne Girlanden, ohne Fußnoten. Man darf, man muss das Fleisch um das Gerüst selbst beisteuern, aus eigenen Lektüren, eigenem Leben und Hören, Sehen und Imaginieren von Landschaften. Man darf, man sollte dazu Grünbeins 573-Seiten-Essayband Aus der Traum (Kartei) von 2019 lesen, den Stoff, aus dem ostdeutsche Biografien sind, die sich nicht trotzig in einer ostdeutschen Identität vermauern. Die mit den quälenden Widersprüchen und Schuld ringen, die Fühmann, Bobrowski, Müller und die Wolf quälten, die nicht mit einer formelhaften deutsch-sowjetischen Freundschaft zu bannen waren. Die Polen sahen, Litauen, die Ukraine et al., die Verheerungen durch Faschismus, Stalinismus und Nationalismus. Das böse Spiel wiederholt sich im zerfallenden Jugoslawien, als low warfare im Einzugsbereich der Russkij Mir, Faszination des gnadenlosen Futurismus, Technik über alles, Appeasement im pragmatischen Westen. Kein Stoff für den Stammtisch, wohl aber für lange Küchentischgespräche.
Die Tour beginnt in Berlin, in unfreundlichster Jahreszeit, am „Spreekanal“:
Historische Wasser, aus vielerlei Zeiten legiert,
mit Toten gefüttert, Revolutionen, von Industrie satt.
Gleichgültig fließen sie an Lagerhallen, Fabrikruinen,
neuen Reihenhäusern vorbei von Schloss zu Schloss.
Yvan Golls Nachtgestalten meint man durch die Stadtlandschaften gespenstern zu sehen, Johann Ohneland reitet unter den S-Bahnbögen. Husch und vorbei, wer schaut schon drauf in der geschichtsverlorenen Stadt?
Januar wieder. Der Kanal
windet sich durch die Nacht,
tiefschwarz und tiefblau,
eine frische Reptilienhaut.
Rosa, dein Rot ist verblasst.
Sie hatten, sie hatten die Wahl
und haben den Brand entfacht
und riefen die Asche, das Grau.
Und rissen das Land entzwei
und wohnten sich ein im Verlust…
Und dann weiter zum Reichstagsufer, Straße des 17. Juni, Schlachtensee, Dreilinden und Teufelsberg. Der Beobachter läuft durch diese Stadt, durch lärmende Gleichgültigkeit; Brandspuren und Brachen, auf denen Unkraut und Clubs gedeihen, die Staffage einstiger Helden auf Flohmärkten verscherbelt, ein paar Stolpersteine, es könnte etwas gewesen sein. Jacob van Hoddis, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, hier könnten sie gewesen sein.
Bauschutt, Betontrümmer, Flocken
Asbeststaub, Gedächtnisschwund.
Staub, und der Mund ist trocken,
das Auge ein wehrloses Rund.
Berlin, die Stadt des permanenten Verlustes.
Hinterlistig das zweite Kapitel: Postkartentexte der Dreißiger, Heil Hitler! das Wetter ist schön, Olympia, die Moskauer Sperlingsberge.
Es war ein unauffälliger Tag,
als ein paar untersetzte Männer, inferiore Typen, Tyrannen,
unter sich ganze Völker austauschten,
als die Blindenführer des Jahrhunderts beschlossen,
ihre Bevölkerungen als Geiseln zu nehmen,
mit den Grenzen zu spielen, den Landschaften.
Stunde der Kartographen in ihren Büros,
Stunde der Aktenkonzentration (NKWD, Gestapo),
Erfassung der Menschen im eigenen Reich
wie in allen besetzten Gebieten
mit Kenn-Nummern, Photos, Fingerabdrücken
zur Weiterverwendung (Arbeit oder Tod)…
Und dann der Übersprung: Das italienische Meer. Pax Romana, Wellen, Fische, Krebse, Circus Marxismus. Anarchistische Utopien, Horaz und Papageien in Rom. Tyrannen, Konsuln, Gottkaiser, Soldatenkaiser, Verdämmern ins Mittelalter. Es gibt Abgeklärtheit, Demut, Widerständigkeit, das Beharren auf dem Nachdenken, Wissenwollen – das ist unzeitgemäß und Gebot der Stunde. Grünbeins Antifaschismus ist humanistisch und hellwach, unplakativ. Der Mann gehört ins Gespräch, unbedingt, ein Antidot gegen die Simpels, die Prechts, gegen Sloderdijk und Konsorten.
Mario Pschera, nd, 16.10.2022
Bereit für die Zukunft!!!
Äquidistanz – From a Book of Weaknesses. Werkstattgespräch am 21.9.2022 in der Stiftung Lyrik Kabinett zur Lyrikübersetzung mit Karen Leeder, Artist in Residence in der Villa Waldberta, und Durs Grünbein (deutsch / englisch)
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Walter Delabar: Abstand halten
literaturkritik.de, August 2022
Frank Dietschreit: Zirkus Marxismus
Mannheimer Morgen, 30.8.2022
Michael Braun: Der Lyriker Durs Grünbein wird 60 und meldet sich mit neuen Gedichten eindrücklich zurück
Badische Zeitung, 9.10.2022
Karin Großmann: Neues vom Dresdner Stardichter Durs Grünbein
Sächsische Zeitung, 8.11.2022
Peter von Becker: Der Natur des Menschen auf der Spur
Der Tagesspiegel, 27.12.2022
Claus Clemens: Ein Sprachmächtiger im Heine Haus
Rheinische Post, 6.9.2022
Ruthard Stäblein: Das Studium der Flechten
faustkultur.de, 24.2.2023
Ulrich Rüdenauer: Gedichte aus den Zwielichtzonen
Schwäbisches Tagblatt, 9.8.2022
Durs Grünbeins neuer Gedichtband „Äquidistanz“
Märkische Allgemeine
Nils Kahlefend: Der Assoziations-Generator steht nicht still
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.9.2022
Christian Schlüter: Durs Grünbein sieht auf sein Berlin – dieses „alte Mörderrevier“
Berliner Zeitung, 16.7.2022
Roland H. Dippel: Fremdes aus gebundener Prosa
crescendo, 19.2.2023
„Der Dichter ist der Clown, der nirgendwo wirklich hingehört“
– Wie nimmt einer, der Lyrik schreibt, unsere Zeit, unser Land und das Weltgeschehen wahr? Durs Grünbein über das Dichten als Existenzform und die Gründe, warum er von Olaf Scholz enttäuscht ist. –
Tobias Haberl: Herr Grünbein, Sie sind Deutschlands größter Dichter, haben mit 33 Jahren den Georg-Büchner-Preis bekommen, wurden von der Kritik als „Junggenie“ gefeiert. Gibt es etwas Banales, an dem Sie Freude haben?
Durs Grünbein: Eine große cineastische Leidenschaft. Ich schaue fast jeden Abend einen Film – im Heimkino.
Haberl: Verzeihung, Sie haben die Frage falsch verstanden. Gemeint war: Schauen Sie so was wie Germany’s Next Topmodel?
Grünbein: Als es anfing, habe ich mir das mal angeschaut, mit den Augen meiner Töchter sozusagen, ich wollte begreifen, was da auf sie zukommt. Inzwischen wurde der Fernseher abgeschafft, als sich zeigte, wie jede Sendung einem gewissen Format entsprach, dass alles von vornherein formatiert war, der Wettkampf, das Quiz, die Talkshow. Es ist schrecklich mit uns, wir langweilen uns alle so schnell. Was ich mag, sind ausführliche, konzentrierte Interviews, Hannah Arendt im Gespräch mit Günter Gaus, so was könnte ich mir stundenlang anschauen.
Haberl: Aber das war in den Sechzigerjahren. Fällt Ihnen wirklich nichts ein?
Grünbein: Lassen Sie mich überlegen. Vielleicht ist am Ende gar nichts banal und alles soziologisch interessant. Früher habe ich Fußball geschaut, die legendären Boxkämpfe, das war was. Die Wahrheit ist: Surrogate genügen mir nicht, ich muss etwas erleben. Wahrscheinlich bin ich so auch an die Dichtung geraten. Kleine kompakte Einheiten, hochkomplex in ihrer Ökonomie, mit wenigen Worten wechselnde Gedanken und Gefühle zu kodieren. Das hält mich bis heute aufrecht, wie andere diese Logikrätsel, Sudoku.
Haberl: Was antworten Sie, wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden?
Grünbein: Ich verrate nur, dass ich schreibe. Meistens fragt das Gegenüber dann, was ich schreibe, und ich sage: Gedichte. Und dann kommt eigentlich immer: Kann man davon leben? Und ich sage: Ich schon. Dabei stimmt es gar nicht, weil ich das meiste Geld mit Artikeln und Prosatexten verdiene. Vom Dichten allein kann man in keiner Gesellschaft überleben, das hat nicht mal Hans-Magnus Enzensberger geschafft.
Haberl: Wie geht das: dichten?
Grünbein: Wer das wüsste. Es geschieht permanent und meistens ungewollt, unterwegs. Ich warte auf den Zug, plötzlich sind da zwei Zeilen, und die lassen mich nicht mehr los. Zum Beispiel steht da ein Bekannter, den man vor einiger Zeit erst begraben hat, und unterhält sich mit einer Frau. Es ist, als ob man von einem Reich in ein anderes übertreten würde, ein unheimlicher Vorgang. Der Mensch ist längst tot, aber nun sieht man ihn da auf dem großen Bahnhof, und ein Schock geht durch die Halle. Dann fliegen noch ein paar Tauben auf, und alles tauscht seine Plätze. In solchen Momenten entsteht ein Gedicht. Das kann auch mitten in einer Unterhaltung sein. Auf einmal bin ich woanders und versuche, höflich den Schein zu wahren. Ich muss aufpassen, dass ich mit dieser Manie niemanden verletze. Gottseidank haben sich meine Bekannten längst daran gewöhnt, oder sie tun so, als hätten sie nichts gemerkt.
Haberl: Dichten als Existenzform?
Grünbein: Das kann man so sagen. Ich würde auch Gedichte schreiben, wenn sich kein einziges Buch je verkaufen ließe.
Haberl: Was daran lässt Sie nicht los?
Grünbein: Mit den Gedichten bist du auf einer Expedition ins Unbekannte, du kannst dich verirren, und keiner folgt deinen einsamen Wanderwegen. Wer sagt dir, ob ein Gedicht gelesen wird, gar wiedergelesen wird, welche Halbwertszeit es hat? Von Anfang an war das Gedichteschreiben eine Auszeit für den Einzelnen. Es beruht auf Vereinzelung, selbst da, wo es sich an ganze Kollektive wendet und mit dem Publikum flirtet Das ist sehr seltsam. Im Familienkreis wird nie über Gedichte gesprochen. Das ist etwas anderes als der Brauch in der berühmten Familie Mann, wenn Thomas Mann Proben aus seinem Manuskript vorlas. Bei denen war das Usus, der Patriarch probierte an den Seinen aus, ob sein Erzählen funktionierte – deshalb haben sie ihn den Zauberer genannt. Ich muss meine Gedichte wildfremden Menschen vortragen und weiß nie, ob irgendeines davon jemals ankommt.
Haberl: Sind der Dichter und der Prosa-Autor Durs Grünbein zwei verschiedene Personen?
Grünbein: Eine gespaltene Person, ja. Einen Essay für eine Zeitung gebe ich ab und denke nicht mehr daran. Ein Gedicht dagegen ist nie abgeschlossen. Wenn ich in einem älteren Band etwas entdecke, was ich heute anders machen würde, das kann ein Satzzeichen sein, trage ich mit Bleistift meine Korrekturen ein. Als Maler wäre ich eine Zumutung. Ich würde ständig mit dem Pinsel ins Museum rennen und meine eigenen Bilder ausbessern.
Haberl: Was sieht jemand, der Sie heimlich in Ihrem Arbeitszimmer beobachtet?
Grünbein: Nervöses Umherlaufen, Hinsetzen, Aufstehen, in Büchern nachschlagen, auf Papieren herumkritzeln, Dinge streichen, Zeit gewinnen.
Haberl: Haben Sie eine Kleiderordnung?
Grünbein: Ich weiß, worauf Sie abzielen. Dichter, die sich in Schale warfen oder parfümieren mussten, bevor sie ans Schreiben gingen, Typ Oscar Wilde. Der Dichter-Darsteller. Damit kann ich nicht dienen. Ich könnte auch halbnackt schreiben, wenn mir was Dringendes einfällt.
Haberl: Alkohol?
Grünbein: Kann nicht schaden. Rauschmittel führen zu einem Entriegelungsprozess im Gehirn, die inneren Wörterbücher werden durchgeschüttelt.
Haberl: Leiden Sie darunter, dass Lyrik in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen wird?
Grünbein: Ist das so? Eigentlich erzeugen Gedichte doch immer noch viel Resonanz. Das schlägt sich nicht unbedingt kommerziell nieder. Von einem Gedichtband verkaufen sich manchmal hundert oder auch tausend Stück, je nach Bekanntheitsgrad. Trotzdem begegne ich selten Menschen, die nicht irgendeine Beziehung zu Gedichten hätten. Gerade in jungen Jahren schreiben doch viele Menschen Gedichte, sie verstecken es meistens nur. Es braucht ja nicht viel, um ein paar versartige Zeilen zu entwerfen, für einen Song vielleicht oder um Eindruck zu schinden bei einem geliebten Menschen. Das können zwei, drei Sätze sein, die man jemandem aufs Handy schickt. Ob das dann schon ein Gedicht ergibt, ist gar nicht so entscheidend.
Haberl: Aber es lässt sich doch nicht leugnen, dass die meisten von Homer und Rilke keine Ahnung mehr haben.
Grünbein: Man kann auch unbewusst eine Ahnung von Poesie haben. In Russland sagte mal jemand, Poesie gedeiht wie Unkraut. Sie wächst am Rand der Städte, an Bahndämmen, auf Brachland, auf den Müllkippen, die Unverwüstlichkeit ist ihr Wesen. Sie ist eben keine gezüchtete Blume. Manchmal stoße ich auf einen Vers und denke: Wow! Wie kann man das so gut ausdrücken? Ich bin dann glücklich, bekomme einen kleinen Adrenalinstoß, ein Zustand körperlicher Erregung.
Haberl: Haben Sie ein Beispiel?
Grünbein: The ant’s a centaur in his dragon world. / Pull down thy vanity, it is not man / Made courage or made order, or made grace“. Aus einem der Cantos von Ezra Pound. Diese umgekehrte Perspektive, dass das Kleine, die Ameise, auf einmal in einem größeren Kontext erscheint, zum Drachen wird in ihrer Welt und den Menschen infrage stellt. So etwas nützt sich nicht ab, das bleibt immer wahr und frisch.
Haberl: Ernst Jünger hat geschrieben: „Der Dichter ist überflüssig in der technischen wie in der ökonomischen Welt – das macht sein Elend und seine Größe aus.“
Grünbein: Der Gedanke ist nicht triftig, weil wir in der technischen Welt alle überflüssig sind.
Haberl: Außer dem Programmierer.
Grünbein: Das mag sein. Trotzdem ist Dichtung nie überflüssig, sondern im Gegenteil lebenserhaltend. Für jemanden wie mich sowieso, aber auch für viele andere Menschen. Gerade in Krisenzeiten halten sich viele an Versen fest, das kann auch ein Bibelspruch oder eine Songzeile sein. In Versen steckt die gesammelte Menschheitserfahrung sämtlicher Völker und Kulturen, das Prisma der Einzelsubjekte. Das Besondere an der Poesie ist, dass sie etwas Allgemeines, das jeden Menschen betrifft, in höchstpersönlicher Form reflektiert, es geht um Liebe, Verlust und Tod.
Haberl: Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt hat Ihr Gesicht einmal als „in einer gesteigerten Art ernst“ bezeichnet: „Als hätte der Mann sich eines Tages zum Ernst entschlossen. Er will nicht zu den Lustigen gehören, und man soll es wissen.“
Grünbein: Das ist die Wirkung der Fotografie. Ich mag es nicht, auf Knopfdruck zu lächeln. Aber Sie sehen doch, wie schwer es mir fällt, ernst zu bleiben. Ich wundere mich, wenn mir die Leute sagen: Das hätten sie nicht gedacht, wie fröhlich ich in natura bin. Einmal ist mir etwas passiert, bei einem dieser Volksfeste mit Politikern. Da wurde ich der jungen Lebensgefährtin des ehemaligen SPD-Vorsitzenden vorgestellt, die hatte in der Schule von mir gehört, und es rutschte ihr heraus: „Ach, und ich dachte, Sie sind längst tot.“
Haberl: Als Kind mussten Sie oft Prügel einstecken. Die ideale Voraussetzung, um Dichter zu werden?
Grünbein: Auf dem Schulhof gab es die Kräftigen und die Schwachen. Ich gehörte zu den Letzteren.
Haberl: Waren Sie ein Außenseiter?
Grünbein: Ein paar Freunde hatte ich schon, aber eigentlich waren das alle nur Außenseiter wie ich. Ich bin aus jeder Gang bald herausgeflogen, viel allein herumgezogen.
Haberl: „Der Lyriker ist immer ein Freak“, haben Sie mal gesagt.
Grünbein: Du bist nicht ganz da, war so ein Vorwurf in meiner Kindheit, du bist so weit weg. Ich weiß nicht, ob das stimmt, so gut kenne ich mich nicht. Aber ist es so schlimm, wenn man mit einem Bein immer außerhalb der Wirklichkeit steht? Beim Röntgen hatte ich Angst, dass man das auf dem Röntgenbild sieht – dass man mich sozusagen durchschaut.
Haberl: Wären Sie gern gewöhnlicher, als Sie sind?
Grünbein: Aber das ist es ja gerade. Ich bin in meiner Art vollkommen gewöhnlich. Der Philosoph Kierkegaard war der Meinung, der Dichter sei ein Ausgezeichneter, der in der Allgemeinheit als Ausnahme dastehe. Das war vielleicht einmal so – denken wir an Novalis, Hölderlin, Rimbaud. Aber so ist es doch längst nicht mehr. Einzigartig ist er höchstens in einer Hinsicht – dass er ins Blaue lebt, und es macht ihm nichts aus. In Wahrheit ist er der Clown, der nirgendwo wirklich hingehört, von dem sie aber ahnen, dass er alles beobachtet. Ich fühle mich beinahe überall wohl unter den sogenannten Normalmenschen und eher unwohl bei denen, die sich für die Elite halten. Ich frage mich nur manchmal, wie ich von da nach dort gekommen bin.
Haberl: Haben Sie ein Beispiel?
Grünbein: Zum Beispiel von den Straßen Ostberlins als Demonstrant in der Masse 1989 ins Schloss Bellevue unter mehreren Bundespräsidenten. Oder von einem Hiphop-Konzert in New York, frühe Neunzigerjahre, und plötzlich sitze ich in den Akademien fest, in Berlin, Hamburg, Darmstadt, in irgendeiner Sektion, oder muss Gedenkworte für Imre Kertész sprechen.
Haberl: Als Sie 1995 den Georg-Büchner-Preis erhielten, schwärmte die FAZ von einem „hinreißenden Götterliebling“ vom Range des jungen Enzensberger, ja vielleicht sogar Hugo von Hofmannsthal.
Grünbein: Mit diesen bürgerlichen Zuschreibungen konnte ich lange nichts anfangen. In der DDR hatte ich in Untergrundmagazinen publiziert, und auf einmal wurde ich mit bildungsbürgerlichen Etiketten beklebt. Dabei definiert sich ein Dichter erst im Laufe der Zeit, und zwar hoffentlich durch seine Verse. Sie führen irgendwann in der Summe dazu, dass ein Bild entsteht, das in der Regel ein Suchbild bleibt. Heiner Müller hat mir einmal erzählt, wie er in einem Café in Venedig saß, und auf einmal kam Peter Handke quer über den Markusplatz auf ihn zu, setzte sich an den Tisch und fragte ihn: „Sind Sie ein Dichter?“ Und Müller überlegte kurz und meinte dann: „Das weiß man immer erst hinterher.“
Haberl: Sie haben sich von der überschwänglichen Literaturkritik kein bisschen geschmeichelt gefühlt?
Grünbein: Nein, Ich wusste nicht einmal, was eine Rezension ist.
Haberl: Jetzt kokettieren Sie.
Grünbein: Nein. Der ganze Literaturbetrieb im Westen war mir fremd. Ich kannte keinen der wichtigen Namen. Beim Kritikerempfang zur Buchmesse im Haus in der Klettenbergstraße wurde ich den Herren präsentiert, und nachher hieß es: Haben Sie den Herrn in der ersten Reihe denn nicht gesehen, der da saß und immer zu Ihnen herüberblinzelte durch seine Brillengläser? Das war Marcel Reich-Ranicki. Den Namen hörte ich da zum ersten Mal. Ich weiß noch, wie mich Thomas Kling, mein Dichterkollege, mit dem ich bei Suhrkamp einstieg, über die Buchmesse führte, in seinem Mantel steckten schon allerhand Tageszeitungen. Und er fragte mich, ob ich die Rezensionen denn schon gelesen hätte. Und ich: Rezensionen? Daraufhin erklärte er mir, dass Neuerscheinungen in den Zeitungsfeuilletons besprochen werden. Das war mir alles neu. Das System habe ich erst nach und nach begriffen: Daumen rauf, Daumen runter.
Haberl: Bei ihnen ging der Daumen meistens rauf.
Grünbein: Dabei habe ich früh verstanden, dass weder Lobeshymnen noch Verrisse etwas daran ändern können, wie ich arbeiten muss. Es ist egal, ob man gefeiert oder verrissen wird – man macht einfach sein Ding. Picasso soll einmal dazu gesagt haben: „Gespräche mit dem Piloten während des Fluges sind verboten.“ Und ich fliege eigentlich immer.
Haberl: Der Kritiker Fritz J. Raddatz kritisierte Sie damals vernichtend: Es handle sich um „Verse ohne Rätsel, ohne Geheimnis, ohne Erschütterung für den Leser“. Waren Sie gekränkt?
Grünbein: Nicht wirklich. Ich sah ihn später einmal in Hamburg vor einer Kaufhalle stehen, und da tat er mir leid. Kritiker zu sein ist auch kein einfaches Geschäft. Ich habe mich gefragt, was eine Kränkung ist, und dann entschieden: Ich bin unkränkbar. In der Kunst darf man vor nichts Angst haben, nicht vor der Banalität, nicht vor Kitsch, nicht vor Dummheit, am Ende werden es alles Züge einer Person gewesen sein, die dadurch interessant wird, dass sie so ist, wie sie sich dargestellt hat.
Haberl: Was ist der Unterschied zwischen dem, was Sie machen, und dem, was Ferdinand von Schirach oder Benjamin von Stuckrad-Barre machen?
Grünbein: Das sind alles Textperformer. Sie wissen, sie können ein großes Publikum unterhalten. Eben erst war ich in Bielefeld, und da hing ein Plakat von Herrn von Schirach, mit dem Versprechen, er würde wiederkehren, weil vor Kurzem alles ausverkauft war. Ich stand lange davor und habe diese Nachfrage bewundert. Was soll ich sagen? Wir leben in verschiedenen Welten.
Haberl: Nehmen Sie deren Bücher wahr?
Grünbein: Selbstverständlich. Panikherz von Stuckrad-Barre habe ich gern gelesen, die Hommage an Udo Lindenberg, den ich genauso bewundere – nur hätte ich es nie so ausdrücken können. Wer weiß, vielleicht wäre ich auch in der Spex-Redaktion gelandet, wenn ich nicht dummerweise in der DDR, sondern in Göttingen aufgewachsen wäre.
Haberl: Fühlt sich der Dichter gekränkt beim Anblick des Popstars?
Grünbein: Niemals. Die Frage ist, ob sich der Popstar beim Anblick des Dichters gekränkt fühlt. Ich weiß nicht, warum die Dinge immer so gegeneinander ausgespielt werden. Können die Bücher, egal wie erfolgreich sie sind, nicht friedlich im Regal nebeneinander stehen? Wir Autoren beschnuppern uns doch auch wie die Hunde. Christian Kracht saß in Leipzig mal bei einer meiner Lesungen in der ersten Reihe, ich werde nie vergessen, wie er mich forschend angestarrt hat. Was ich damit sagen will: Ich habe da nie Grenzen gespürt.
Haberl: In der Fernsehwelt kommen sie praktisch nicht vor.
Grünbein: Ich bin ins Fernsehen gegangen, solange Fernsehen noch interessant war. Wie immer, von Neugier getrieben. Sternstunden, Nachtstudios, Philosophenquartette, was so ging. Wie gesagt: Der Fernseher ist abgeschafft. Ich wüsste nicht, wo ich mich da noch sehen könnte.
Haberl: Sie wohnen abwechselnd in Berlin und Rom. Wovor flüchten Sie, wenn Sie nach Rom aufbrechen?
Grünbein: Die politische Landschaft in Deutschland, in diesem riesigen und doch so engen Land, belastet von seiner Geschichte, kann zu einer Bedrängnis werden. Man kann ihm nicht entgehen als Deutscher, der man nun einmal ist. Egal, wie viele Identitäten man noch abschüttelt, die Soziologen erklären dir, wo du hingehörst. Aber ich bin, seit ich aufgebrochen bin, Europäer. Ich bin, seit ich mit einigen Gleichgesinnten die DDR aufgesprengt, zumindest einen Staat überwunden habe, ein Mauersegler, hoffnungslos. Ich will immer nur weiter, nach draußen. Am liebsten ist mir der Luftraum, wenn ich mit einem Flugzeug aufbreche, egal wohin. Von Rom aus kann ich mir Europa von außen anschauen – und ich sehe den Grundriss, die Herkunft, das antike Gelände.
Haberl: Können Sie die Enge, die Sie in Deutschland empfinden, genauer beschreiben?
Grünbein: Die Medien- und die Parteienlandschaft sind überschaubar geworden.
Haberl: Aber es gibt doch mehr Sender und Parteien als jemals zuvor.
Grünbein: Leider weiß man immer schon vorher, was als Nächstes gesagt werden wird. Nachdem die einen das gesagt haben, sagen die anderen jenes, und so fort. Ich verspüre einen Überdruss an diesem Politikspiel. Bei aller Diversität habe ich den Eindruck einer allgemeinen Gleichschaltung. Alle starren gebannt auf ein Phänomen namens Demokratie und können es nicht begreifen. Die Kommentatoren sind ratlos – wir schalten zurück ins Studio.
Haberl: Schreiben Sie in Rom anders?
Grünbein: Es spielt keine so große Rolle, wo ich schreibe. Rom hat den Vorteil, das dort alles schon einmal geschah – und das seit vielen Jahrhunderten. Man bewegt sich in einem Strom, der aus älteren Zeiten kommt. Gerade bauen sie dort ein paar neue U-Bahn-Stationen, und plötzlich stoßen sie wieder auf Zeugnisse aus der Antike, und es gibt einen Baustopp. Das Alte und das Neue stehen in einer dauernden Spannung.
Haberl: Sie werden der Schönheit nicht überdrüssig?
Grünbein: Mehr als das zeitlos Schöne fesselt doch das zeitlich Schöne, gerade an einem solchen Ort. Bei Paul Celan findet sich die Zeile: „Die Ewigkeit altert.“ Das ist es! Auf der einen Seite der Ewigkeitsanspruch, Roma aeterna, auf der anderen bröckelt, runzelt, altert alles, was einmal mit dem Römischen Imperium zu tun hatte. Rom ist selbst nur ein Organismus, der sämtliche Stadien des Verfalls durchläuft. Das zu erfahren, rührt mich unendlich.
Haberl: Die vielen Touristen stören Sie nicht?
Grünbein: Doch, aber auch sie rühren mich.
Haberl: Inwiefern?
Grünbein: Ich beobachte sie und spüre, eine tiefe Sehnsucht hat diese Menschen nach Rom getrieben. Vielleicht ist es das einzige Mal, dass sie dort sind. Mir fallen immer die jungen Paare aus aller Welt auf, die Verliebten. Es gibt eine Sehnsucht, an so viel gesammelter Zeit teilzuhaben.
Haberl: Wenn Sie im Sommer 2024 an Deutschland denken, was quält Sie besonders?
Grünbein: Dass die Reaktion – so nannte man das in der Weimarer Zeit – auf dem Vormarsch ist. Der Rechtsextremismus ist im Bundestag angekommen und zerstört Europa. Diese Kräfte liefern das Land, in ihrer Furcht vor der Globalisierung, feindlichen Mächten aus. Wir haben es gesehen, sie sind korrupt – ein Paradox, die sogenannten Patrioten werden zu Landesverrätern. Mich frustriert zutiefst, dass ihre Wähler das nicht wahrhaben wollen. Sie ahnen nicht einmal, was die Zerstörung dieser fragilen Demokratie für ihre eigenen Existenzen bedeuten würde.
Haberl: Wissen Sie es besser, weil Sie in der DDR am eigenen Leib erfuhren, wie es sich ohne Demokratie lebt?
Grünbein: Zumindest kenne ich die Unfreiheit. Für mich waren der Fall der Mauer und das Ende des Kalten Krieges die größten Erlebnisse meines Lebens. 1989 hatte ich das Gefühl, das erste Mal frei atmen zu können. Damals war ich mir sicher, dass Europa zusammenwächst. Und jetzt ist aus dem europäischen Projekt ein Sauhaufen hervorgekrochen, der Europa zerstört und es den Tyrannen ausliefert.
Haberl: Können Sie nachvollziehen, wenn Nationen im Zuge von Globalisierung und Migration Angst um ihre nationale Identität haben?
Grünbein: Wenn sie doch nur begreifen könnten, wer von ihren Ängsten zuletzt profitiert. Mir hat die Europa-Idee immer gefallen und erst recht die Vorstellung von einem Europa der Regionen. Dass Menschen, die in gewissen Regionen zusammenleben und zusammenarbeiten, eine gemeinsame Identität haben, ist keine schlechte Sache. Aber deswegen muss man doch keinen nationalistischen Eisenring um das Ganze legen. Ich kann die Angst um das Eigene, den Heimatverlust, schon nachvollziehen, aber der Rückschritt in eine wie auch immer geartete Isolation ist der falsche Weg, weil er mit Gewalt, Ausgrenzung und Grausamkeit verbunden ist. Schon Goethe hat vor dieser kläglichen Option lange vor dem Auftauchen der Nationalstaaten gewarnt: „Der Patriotismus verdirbt die Geschichte.“
Haberl: Haben Sie im Frühjahr an einer der Demonstrationen gegen den Rechtsruck teilgenommen?
Grünbein: Es kam nicht dazu, ich war wieder einmal auf Reisen. Aber als politischer Romantiker glaube ich daran, dass die Versammlung auf der Straße manches ändern kann. Ich war dabei am 7. Oktober 1989 in Berlin, als es hieß, man solle sich am Alexanderplatz an der Weltzeituhr treffen. Das ging damals über die Flüsterpropaganda. Am Anfang waren wir höchstens 200 Leute, davon mindestens ein Drittel Stasi, aber es wurden immer mehr, und irgendwann sind wir in Richtung Palast der Republik marschiert, wo der 40. Geburtstag der DDR gefeiert wurde, mit Gorbatschow als Staatsgast. Ich werde nie vergessen, wie der kleine Mielke mit seinem Hütchen auf dem Balkon erschien und herunter spähte und verblüfft war, was da vorging. Von da an sind wir jeden Tag marschiert, man hat uns verprügelt, die Ausweise abgenommen, wir galten als Konterrevolutionäre. Aber ich wollte, dass dieser Staat kaputtgeht. Und wie es ausgegangen ist, wissen wir: Der Staat wurde zu Fall gebracht durch die Kraft einer Opposition, die aus der Bevölkerung kam.
Haberl: Sie haben mal gesagt, es sei unfassbar, wie wenig in den westlichen Demokratien darüber bekannt sei, was sie in den Grundfesten bedrohe. Wissen die Deutschen ihre Freiheit nicht zu schätzen?
Grünbein: So pauschal würde ich das nicht sagen. Die besten Demokratielehrer habe ich im Westen getroffen. Ich kannte die Schriften aus der Frankfurter Schule, nicht nur Adorno, auch Habermas. Ich hatte auch nie ein Problem mit der Saturiertheit mancher Westler. Erst seit dem russischen Angriffskrieg bin ich bestürzt, wie wenig diese Demokratie bereit ist, sich zu verteidigen, als wären alle guten Lehren vergessen.
Haberl: Inwiefern?
Grünbein: Ich weiß nicht, was diese Regierung tut. Ob der regierende Kanzler auch nur ahnt, was auf uns zukommen würde, wenn wir uns nicht ausreichend verteidigen. Über die Westlinke habe ich mir nie Illusionen gemacht, die Ostlinke ist sowieso verloren. Nun aber die Rechten – wissen die eigentlich, was sie tun? Oder sind sie alle politisch derart korrumpiert, dass sie dieses Land höheren Mächten ausliefern? Und diese schrecklichen Pazifisten, die anscheinend nie wussten, dass man um diese Insel der Demokratie kämpfen muss, um auch nur ein Friedensgebet in Ruhe sprechen zu können.
Haberl: Das klingt, als hätten Sie überhaupt keine Angst vor einer Eskalation des Krieges.
Grünbein: Dazu gibt es ein Schlüsselerlebnis. Ich saß mit Freunden beim Essen, wenige Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Putin hatte gerade mit dem Einsatz der Atomwaffe gedroht. Und ich fragte in die Runde: Habt ihr jetzt Angst? Es wurde still, alle schauten mich an, und einer sagte: Du etwa nicht? Das war die Wirkung der psychologischen Kriegsführung – siehe, sie funktioniert. Ganz ehrlich, ich lasse mich von Russland nicht mehr beeindrucken, lieber gehe ich unter, als mich noch mal von irgendeiner Macht in die Unfreiheit treiben zu lassen. Meine Enttäuschung über die Reaktion der deutschen Regierung, als es losging und die ersten Raketen ukrainische Städte zerstörten, war grenzenlos. Eine wirksame Luftverteidigung hätte den Krieg vielleicht schnell beendet. Tausende Tote hätten vermieden werden können, auch auf russischer Seite, wo junge Männer zwangsrekrutiert für ein sinnloses imperiales Projekt sterben.
Haberl: Viele haben den Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Besonnenheit gelobt.
Grünbein: Das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist das eine Politik der halben Schritte. Mir mangelt es auch an Kooperation mit den französischen Verbündeten. Dem Wort von der Zeitenwende folgten nur zögerliche Taten. Im Grunde hatte man die Ukraine schon aufgegeben. Erst nach und nach hat man begriffen, dass da ein ganzes Volk zur Landesverteidigung bereit war und sich mit großer Tapferkeit einer Übermacht entgegenstellte. Viele scheinen aber immer noch nicht verstanden zu haben, dass dieser Krieg auch um die Zukunft Europas geführt wird. Stattdessen wurde ständig nachgerechnet, wie weit man mit der Unterstützung der Ukraine gehen konnte. Dabei müssen wir uns klarmachen, was passiert, wenn Putin diesen Krieg gewinnt.
Haberl: Was denn?
Grünbein: Wir haben es am Untergang der Stadt Mariupol gesehen. Ohne Rücksicht auf Zivilisten wurden ganze Landstriche plattgemacht. Ein grausames Regime der Vertreibung und Unterwerfung ist da am Werk – Zustände wie im Spanischen Bürgerkrieg. Was das für die Besiegten heißt, können wir uns im Westen gar nicht mehr vorstellen. Sobald das Baltikum bedroht ist, erwarte ich von Westeuropa eine starke Reaktion. Denn was kommt danach? Polen? Der Einmarsch durchs Brandenburger Tor? Wer das lächerlich findet wie Sahra Wagenknecht, hat keine Fantasie.
Haberl: Sie glauben, dass Deutschland angegriffen werden könnte?
Grünbein: Auch davon war schon die Rede. In Bundeswehrkreisen geht man davon aus, dass Russland das westliche Bündnis in fünf bis acht Jahren angreifen könnte. Ist man dafür gerüstet? Ich fürchte, nein. Russland wird angetrieben vom nagenden Ressentiment, keine Weltmacht mehr zu sein.
Haberl: Putin behauptet, man sei von der NATO eingekreist worden.
Grünbein: Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, eine Art Feuerwehr, keine Angriffsarmee. Und sie ist von den baltischen Ländern und von Polen aus eigenem Entschluss ins Haus geholt worden, zu ihrem Schutz. Man müsste doch immerhin den souveränen Entschluss dieser Staaten anerkennen. Wer hier von „Osterweiterung“ spricht, stellt die Sache auf den Kopf. Russland hat unter Jelzin eine Grundakte unterzeichnet, die den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes die freie Bündniswahl zusicherte. Alles vergessen? Nein, ich bin überzeugt, das kommt alles aus dem Inneren, aus einem tief sitzenden Ressentiment. Putin hat es selbst gesagt: Der Untergang der Sowjetunion sei eine geopolitische Katastrophe gewesen. Natürlich war Präsident Obamas Bemerkung von der Provinzialmacht Russland töricht, aber glauben Sie mir, dieser Komplex sitzt tief bei den Machteliten im Putin-Staat, und jetzt bricht er sich militärisch Bahn.
Haberl: Wie schätzen Sie den Menschen Wladimir Putin ein?
Grünbein: Derselbe Putin, der heute die Ukraine und den sogenannten kollektiven Westen bedroht, war schon einmal Teil eines Unterdrückungssystems, als kleiner KGB-Spitzel damals in Dresden. Ich kenne diesen Herrn und seine Herrschaftsform. Es ist die vom Geheimdienst gelenkte Demokratie. Von außen muss es so aussehen, als würde das Volk regieren, aber in Wirklichkeit hält eine Elite von Geheimdienstleuten alle Fäden in der Hand. Sie kontrollieren die Gesellschaft, provozieren Terrorakte, töten Oppositionelle, zetteln Kriege an, verfolgen ihre Gegner bis ins Ausland. Die Gegner der Freiheit sind nicht mehr die alten Betonköpfe des Kommunismus, sie haben sich dem Kapitalismus angepasst und sind nun milliardenschwer dank des Welthandels und ihrer enormen Rohstoffquellen. Sie kaufen sich nicht mehr nur Luxusjachten, sie wollen sich nun ganze Länder kaufen und die freiheitliche Ordnung des Westens untergraben. Das ist die Gefahr der Stunde.
Haberl: Naivität, Feigheit, Ignoranz – was werfen Sie dem Westen vor?
Grünbein: Leider hat der Westen beim Kampf um die Demokratie in Syrien oder Weißrussland den Völkern nicht beigestanden. Auf einmal galt das Prinzip der Nichteinmischung. Aber da ist nichts zu relativieren, Menschenrechte sind moralisch universell, sie müssen überall gleich gelten, unabhängig von Ethnien und Religionen, da für stehen die Vereinten Nationen. Niemand will gefoltert, vergewaltigt und politisch mundtot gemacht werden.
Haberl: Woran machen Sie das Zurückweichen des Westens fest.
Grünbein: Auf einmal war die dieser Kulturalismus nach dem Motto, man solle mehr Respekt vor anderen ethischen Entwicklungen haben – andere Länder andere Sitten. Aber genau das ja die Logik der Französischen Revolution: dass die Menschenrechte für alle gelten. Auf dem Papier ist das bis heute die Haltung der deutschen Außenpolitik, leider muss sie sich der Realpolitik beugen. Da geht es dann nur noch um Handel, auch ohne Wandel. Viele würden am liebsten schon morgen wieder damit anfangen, Handel mit Russland zu treiben, einem Kriegsverbrecherstaat, unbekümmert über die Tausenden von Toten in diesem Krieg.
Haberl: Welche deutschen Politiker machen in bedrohlichen Zeiten wie diesen Hoffnung?
Grünbein: Man wird ausgelacht, wenn man an der grünen Politik festhält, aber ich finde Robert Habeck nach wie vor die richtige Besetzung. Ein Mann mit literarischem Hintergrund – das kann nicht schaden. Er hat ein Amt übernommen, in dem es sofort um die einzelnen Haushalte ging, und musste Maßnahmen durchsetzen, die sehr unpopulär sind. Aber er findet die richtige Sprache, das ist das Wichtigste, denken Sie an seine Videoansprache nach dem Massaker vom 7. Oktober. Es ist ein Jammer, dass die Grünen nun bei den Wahlen abgestraft werden.
Haberl: Fällt Ihnen auch ein nicht-linker Politiker ein?
Grünbein: Norbert Röttgen ist eine interessante Erscheinung, er denkt europapolitisch. Und dass ich Marie-Agnes Strack-Zimmermann für ihre Haltung in der Verteidigungspolitik schätze, hat man wohl herausgehört.
Haberl: Was ist das Gebot der Stunde?
Grünbein: Im Moment steht die westliche demokratische Kultur vor ihrer härtesten Bewährungsprobe. In solchen Zeiten geht es nicht darum, sich von den neuen Imperien gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern darum, gemeinsam daran zu arbeiten, dass diese freiheitliche Ordnung ausreichend geschützt ist. Zwischen Trumpismus im Westen und Putinismus im Osten stecken wir in der Mitte fest. In einem Kontinent, der in seinem Einigungsprozess auf halbem Wege stehengeblieben ist. Für Europa muss wieder geworben werden. Es müsste, gerade bei den Jüngeren, ein Bewusstsein entstehen für die Notwendigkeit dieses Bündnisses, im Sinne des eigenen Überlebens.
Haberl: Wie soll das funktionieren? Bei der Europawahl haben viele Jüngere die AfD gewählt.
Grünbein: Das wäre der wichtigste Bildungsauftrag, den die Schulen und Universitäten zu erfüllen hätten. Über jeder dieser Bildungsstätte sollte die Europafahne wehen. Ich trage sie übrigens immer mit mir herum in meiner Reisetasche, seit ich mir auf einer kleinen italienischen Insel mit Namen Ventotene mal eine gekauft habe. Die Insel war ein Verbannungsort in der Zeit des Faschismus, dort hatten einige der Gefangenen ein Manifest ausgearbeitet für ein freies und einiges Europa. Das waren Linke, die als Antifaschisten ihre Streitigkeiten überwanden und ein Konzept für einen europäischen Bundesstaat entwarfen – die Magna Charta für das, was dann mit dem Straßburger Parlament Wirklichkeit wurde. Ein kleiner blauer Fetzen Stoff, er ist schon ganz abgewetzt.
Süddeutsche Zeitung Magazin, 5.7.2024
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb + ÖM + Facebook + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + PIA
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein bei Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


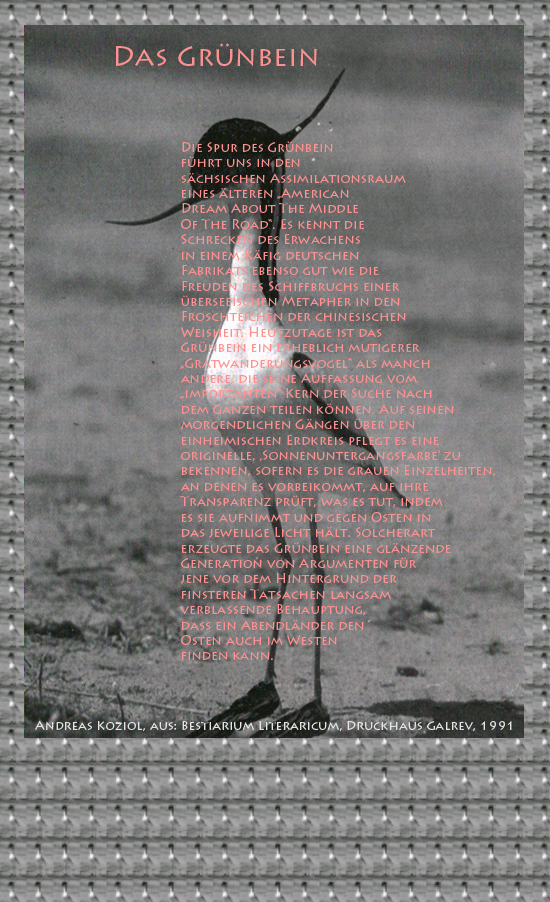
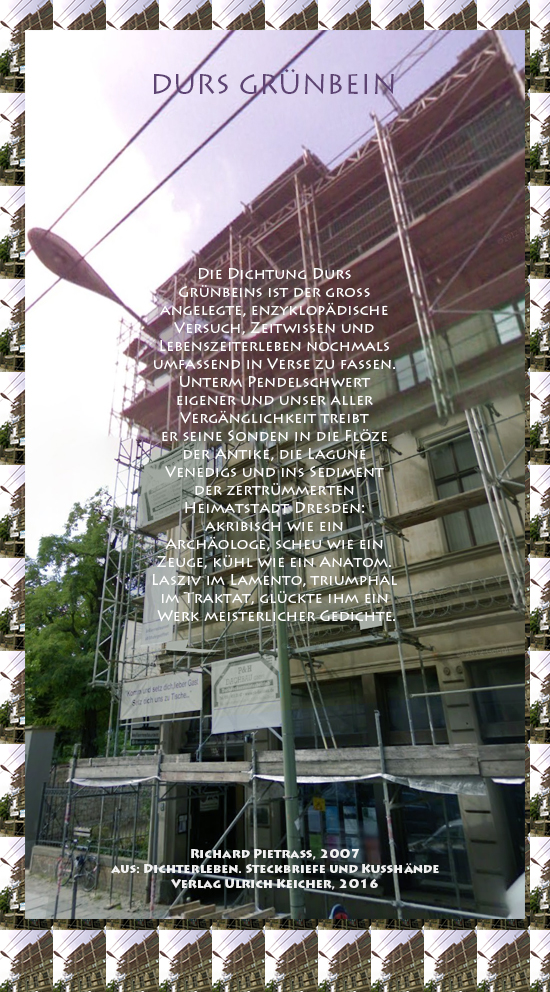












0 Kommentare