MISANTHROPISCHER HUMANIST
Das Gehirn ist eine Rumpelkammer, nicht wahr?
Das Gehirn hält Kurs, egal, was geschieht, wer regiert.
Das Gehirn weiß im voraus um jede neue Gefahr.
Ich hatte mir vorgenommen, nicht unterzugehen.
aaaaaNun
Bin ich da angelangt, wo die Schwächen sich
aaaaatummeln.
Sie spielen verrückt, suchen Anschluß, ringen, sehr familiär,
Um Anerkennnung – wie Kinder, die Süßes erbetteln.
Versuch, sich selbst zu beschreiben: Du bist
Misanthrop aus Geselligkeit, aus Einsamkeit Humanist.
Kein Fragebogen erfaßt dich. Du selbst faßt es kaum,
Dazusein, mitten im Irrsinn – meistens am falschen Ort.
Das Gehirn ist kein Bunker, aber draußen herrscht Krieg
Um alles, was maßlos ist: Glaube, Geschlechterglück, Geld.
Das Hirn gibt nie Ruhe, es protestiert, prozessiert immerfort.
![]()
Zündkerzen
ist eine Sammlung von 83 Gedichten in den unterschiedlichsten Formen, variierend in kurzen und langen Zeilen. Es sind Traumstücke, Redepartikel, Prosagedichte, zerbrochene Sonette, Sequenzen wie aus Unfallprotokollen. Jedes dieser Stücke entzündet sein eigenes Leuchten, seine kleine oder größere Epiphanie. Hier schreibt ein Dichter, der keiner Schule angehört, keiner modischen Strömung – ein Beobachter des Realen, neugierig auf die diesseitigen Dinge, hellwach für ihr Verschwinden.
Zwei Langgedichte ziehen mächtige Stützpfeiler in die Struktur der Sammlung – reine Anschauung einer südlichen Metropole: „Das Photopoem“, Elegie vom musealen Leben: „Die Massive des Schlafs“. Es gibt Liebesgedichte, erotisch direkt, ebenso wie Momente der Verlusterfahrung als Demontage der Sonettform. Ein Gedichtzyklus über die Pinie nähert sich reiner Lautmusik und wird zum Verbarium, in dem die Buchstaben tanzen.
Zündkerzen sind Dinge, keine Ideen und erst recht keine Konzepte.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2017
Die inneren Zeitalter
– Durs Grünbeins Gedichte erzählen von Unter- und Übergängen. –
Die Existenz? Durs Grünbein hat sie als „Quadratur der Zufälle mittels Atemzügen“ bezeichnet. Daraus entstehen Schwermut und Furcht, und also keimt die Frage aller Fragen: „Ist Lebensfreude nicht ein Mysterium?“ Ist sie!, so könnte man auch diesen neuen Gedichtband zusammenfassen. Sie ist das Unergründliche, das nicht gänzlich Logische, das nicht absolut Herleitbare.
So wie unergründlich bleibt, was wir bereisen, besprechen, berühren. Landschaften, Lektüren, Lustgegenden und Leidensorte – dieser Dichter durchquert das uns Umfassende mit Augensinn für die geringen Dinge, für rosa Wölkchen, geflügelte Kraken, Tattoos und Artischocken – gleichsam als Tropfenforscher überquert er Ozeane, er steht als Verwandter des Staubkorns am Fuße der Kathedralen. Das Leben?
Die Hälfte ist Stolpern, an falsche Türen Klopfen,
Weil von außen ein Herz aufgemalt ist.
Er ist ein heiterer Fremder im nichtigen Heute aus Partnerschaftsagenturen und einer Weltenweite, die lügnerisch auf Postkartenständer passt.
Hier schreibt ein Aufgeklärter, dem der hohe Stand des Poetischen, in Jahrtausenden gesät und geerntet, sehr viel bedeutet. Er ist ein Dichter des langen Blicks zurück, wo die Formstrenge des Antikischen herübergrüßt.
Rom ist die Bruchform, die nicht mehr zerbricht:
In ihr liegt die Gegenwart aufgebahrt…
Mit jedem Jahr wiegt die Ewigkeit schwerer.
Ein „Photopoem“ ruft die italienische Hauptstadt auf, ein Langgedicht feiert „Sieben Pinien“ – der Baum lehrt uns:
Bleib allein inmitten
Der Parallelen,
Beug dich dem Wind,
Paktiere nie.
Pazifismus pur.
Illusionslos, aber mitfühlend, schaut Grünbein auf den Menschen, der sich durchs rissige Reale windet und vor einer zumeist verhangenen Welt einfach nur zurechtzukommen hat – und den alle ideologischen Beruhigungsmühen und hybriden Vorwärts-Hymnen schlichtweg verhässlichen.
Technik, der kleine titanische Irrtum, ist
Nichts, was den Menschen vor sich bewahrt.
Wir entkommen unseren Blößen und Schwächen nicht, nicht der Wahrheit unserer Unwichtigkeit.
Die Kinder,
Die damals im Zirkus lachten, sind heute Beamte.
Ein armseliger Bettler ist unsereins, wie Luther sagte. Aber in den Versen Grünbeins wirkt der Mensch mitunter doch, als habe er sich sein Gesicht – sehnsüchtig nach Erhabenheit – für stolze Momente aus einem Altarbild entwendet.
Bedichtet werden die Reifenpanne und ein Spatzenpulk, der sizilianische Sommer und Geografie. Ljubljana, Jerusalem, Piräus. Die Sprache schwingt, breitet Flächen aus, schlägt Assoziationsbögen. Diese Lyrik spielt mit der Klugheit, der Belesenheit ihres Autors; der bekennt sich souverän und immer wieder überraschend gleichniserregt zu einer enzyklopädisch befestigten Lust am Denken, am Durchstreifen der Bildungsgüter, so, wie man Weingüter zu deren schönster Zeit durchwandert. Lebensfreude: Sie hat hier schwebende Gründe – so verwandelt Grünbein seine Wahrnehmungen zurück ins Geheimnis.
Besagte antikische Verfasstheit ist nichts weiter als Trotz. Vielleicht sogar Unbelehrbarkeit. Sie nimmt den Vorschlag nicht an, einzig und allein in laufender Gegenwart den entscheidenden Sinnboten zu sehen. Der Alltag, der sich allmorgendlich für neu hält, ist doch nur die kleinste Provinz eines Immerdar. Und also, sagt Grünbein, wächst mir alle Fantasie, wächst mir all mein Bewusstsein zu aus bereits tief Eingelagertem; alles Wesentliche, was sein wird, war doch längst. Ich kehre zurück, sagt die antikische Verfasstheit. Aber nie zu euch Jetzigen, nicht in die „Bananenrepublik des Realen“. Nicht in eure Schnelldurchläufe des sich so rasend Verbrauchenden – sondern dorthin, wo die Inspiration ganz zu sich kommt. Wo überhaupt nur ein Kommen geschieht, einer Quelle ähnlich. Was sprudelt, ist freilich immer auch banges Fragen:
Wissen wir, wo wir erwachen in einer Nacht,
Tief in der Zukunft?
Grünbeins Verse bauen keine Bilder, sie philosophieren. Sie provozieren: „Glück ist das Funktionieren“ oder: „Es sind die Gewohnheiten, die uns töten“ oder: „Einsamkeit war die Menge, die jeder teilte“. Der Dichter tastet sich durch „die inneren Zeitalter“ im Menschen, „jedes / Ich ist zwischen den Zeiten, den Zeilen / Ein Übergang lebenslang.“
Ein Prosatext ruft Zoobesuche mit der jüngsten Tochter auf (Unsere Jahre im Zoo hießen die Kindheitserinnerungen des Dresdners); aus der Ansicht des Affenhauses etwa erwächst bezwingendes Nachdenken über Menschwerdungen. „Manchmal fühle ich stark mein eigenes Zootierdasein“, im „Gehege der großen Städte“. Was wir bauen, entwickeln, festlegen, kombinieren (auch in Paarungen): „Präzision der Verfehlung“. Er bleibt der Glaubwürdigste, der vom Leben erzählt: der Vergänglichkeitskenner.
Hans-Dieter Schütt, neues deutschland, 10.10.2017
Durs Grünbein übt sich im Kunsthandwerk
– Der einstige Götterliebling unter den deutschen Lyrikern veröffentlicht einen neuen Gedichtband. Doch das Aufregende und Waghalsige ist aus seinen Versen geschwunden. –
Die literarische Entwicklung des Ausnahmedichters Durs Grünbein wird seit einiger Zeit als stark abfallende Formkurve beschrieben. Als er vor nunmehr drei Jahrzehnten mit einer Empfehlung Heiner Müllers im Gepäck als lyrischer „Götterliebling“ (Gustav Seibt) auf der Bühne des deutschen Literaturbetriebs auftauchte, begrüsste ihn sein Verleger Siegfried Unseld noch mit einem enthusiastischen „Ecce poeta“.
Die literarische Welt zeigte sich verblüfft über die hellwache Weltaneignungsgeschicklichkeit des jungen Dichters aus Dresden, der mit klugen „Schädelbasislektionen“ die Schocks der poetischen Moderne reaktivierte und leichthändig die neuesten Erkenntnisse aus Neurobiologie und der Genetik in seine Gedichte einstreute. Mit seinem Band Nach den Satiren von 1999 folgte dann Grünbeins demonstrative Rückwendung zur Geisteswelt der römischen Antike, die er seither in immer neuen Variationen als poetischen Stoff nutzt.
Aber so voreilig der 1995 angestimmte Jubel über den jungen Büchnerpreisträger Grünbein gewesen sein mag, so skeptisch sollte einen auch die Routine der Kritik stimmen, mit der die Bücher des Dichters seit einiger Zeit bedacht werden. Kann denn ein Autor seine ästhetischen Potenzen so nachlässig handhaben, dass ihm kaum noch substanzielle Gedichte gelingen?
Die Probe aufs Exempel kann man nun mit Durs Grünbeins Zündkerzen machen, seinem mittlerweile siebzehnten Gedichtband. Wo findet man hier den kühnen Schwung seiner zersprengten Oden, wie ihn etwa sein „Biologischer Walzer“ von 1994 vorführte:
Zwischen Kapstadt und Grönland liegt dieser Wald
Aus Begierden, Begierden, die niemand kennt.
Wenn es stimmt, dass wir schwierige Tiere sind
Sind wir schwierige Tiere, weil nichts mehr stimmt.
In den acht Abteilungen des Zündkerzen-Bandes, in denen der Dichter die unterschiedlichsten Formen und Verstechniken durchexerziert, klingt nun vieles deutlich verzagter und simpler als in den naturwissenschaftlich inspirierten Bänden Schädelbasislektion (1991) und Falten und Fallen (1994). In den Vergänglichkeitsphantasien des ersten Kapitels findet sich etwa eine „Gespenstersonate“, die in eine plane Pointe mündet:
Nachts im Wasser der Badewanne schrumpft
Die Welt (res extensa) zum gurgelnden Loch.
Mit solchen bleichen Räsonnements und gedankenlyrischen Dürftigkeiten sind etliche Gedichte ausgestattet, die den Weg des geringsten Widerstands gehen und sich auch konventionellster Reimfügungen bedienen. In einem seiner zahlreichen Rom-Gedichte sendet Grünbein eine Reminiszenz an den Kulturphilosophen George Steiner, die sich nicht nur „Ungereimtheiten“ gestattet, sondern auch das sehr strapazierte Bildungsrepertoire der „ältesten Weltstadt“ bemüht:
Schön ist hier vieles, manches christlich-brutal,
Neben dem Müllcontainer der weisse Marmorfuss.
Touristen und Flüchtlinge, es wächst ihre Zahl.
War ein Zeichen für Krise nicht – Überfluss?
Totes Altertum lockt die müde Jugend an.
Flugzeuge schweben herein übers nahe Meer.
Dein Smartphone erklärt dir: Wer, wo und wann.
Mit jedem Jahr wiegt die Ewigkeit schwerer.
Solche Verse, in etwas holprigen Kreuzreimen verfasst, bewegen sich in ihrer Geläufigkeit doch dicht am bildungstouristischen Gemeinplatz entlang. Aufregend ist derlei poetisches Kunsthandwerk nicht. So verwundert es auch nicht, wenn im Schlusskapitel das lyrische Ich des Dichters eine wenig schmeichelhafte Bilanz zieht:
Mein Kopf ist ein Kognakschwenker. Der letzte Tropfen
Verdunstet bei Sonnenaufgang. Es ist, als hätte ich nie
Eine Zeile geschrieben. Vielmehr, sie sind alle vergessen.
Durs Grünbein, der mittlerweile 55-jährige Dichter, hat schon sehr viele geschmeidige Zeilen geschrieben in seinem Dichterleben, Sprachzweifel indes sind nicht seine Stärke. Als „hinterlassungsfähige Gebilde“ im Sinne Gottfried Benns können im Zündkerzen-Band nur einige Strophen aus den „Sieben Pinien“ gelten, einem sprachschöpferischen Exerzitium, in dem der Dichter jene Bilderfrische und metaphorische Originalität zurückgewinnt, die ihn in seinen frühen Bänden ausgezeichnet hat. „Aufgepasst!“, heisst es verheissungsvoll zu Beginn des sechsten Kapitels, „Wir verschärfen jetzt das Gedicht.“ Leider bleibt es bei der Ankündigung.
Michael Braun, Neue Zürcher Zeitung, 17.11.2017
Wider den bigotten Zirkus
– Durs Grünbeins neuer Band Zündkerzen zeigt, dass Lyrik gegenwärtig, provozierend und politisch engagiert sein kann. Diese Gedichte sollte man mehr als zweimal lesen. –
Kaum ein Dichter wird so rasant unterschätzt wie Durs Grünbein. Und zwar gleichermaßen von den wohlmeinenden Fans wie von den missgünstigen Ignoranten. Die einen schwärmen für den poeta doctus in Toga, der unangreifbar hoch über den Mühen der Proletenpoeten schwebt. Die anderen lästern über läppische Lyrik, die sich der weltabgewandte Kollege fern der tatsächlichen Sprachenschlachten erlaube. Für beide Seiten gilt: weit gefehlt. Durs Grünbein ist einer der wirklich Großen auf dem Feld der deutschsprachigen Dichtung und dabei vollkommen gegenwärtig, provozierend souverän, sogar politisch engagiert, wenn man daran denkt, dass er als einer der wenigen prominenten Dresdner schon im Februar 2015 deutliche Worte gegen die Dresdner Demonstranten fand.
Wie klug er Gegenwärtiges, Geschichtliches und auch Persönliches in die Überzeitlichkeit der Literatur zu bringen versteht, zeigte er vor zwei Jahren mit seinem faszinierenden Prosa-Kaleidoskop Die Jahre im Zoo, ein dichterisch gedachtes, ernstes Spiel über Kindheit und Erinnerung. Man tut also gut daran, mehr als zweimal über die Gedichte in seinem neuen Buch nachzudenken. Das Buch heißt programmatisch Zündkerzen, nach seinem sechsten Kapitel, das in verdrehten Sonetten Minipoetiken versammelt.
„Zündkerzen sind Dinge, keine Ideen und erst recht keine Konzepte“, heißt es im Klappentext. Diese Ansage dürfte vom Dichter selbst stammen, so vehement setzt sie seine Gedichte von einer Dichtung ab, die den Gedanken vor die Anschauung stellt. So klar das Plädoyer für ein dichterisches Denken in Bildern, durch das Gedichte zu mehr als Experimenten am Sprachmaterial, zu eben auch sinnlich erfahrbaren Gegenständen werden. Im Eingangsgedicht „Aus einem Buch der Schwächen“ klingt das so:
Gigantische Agenda, dieses Leben –
Das so ganz anders kam und dann doch so.
Wir sehen uns, wenn wir die Augen schließen,
In einem Fahrstuhl, der die Jahre wie Etagen zählt.
Das Leben, durch das wir hindurchfahren. Das Leben als Fahrstuhl, ein simples Bild, das gleich komplizierter wird, wenn man merkt, dass auch das Gedicht in Vers-Etagen auf der Seite steht. Wir sind gemeint, wenn wir lesen. Wir als Leserinnen sind buchstäblich in der Situation desjenigen, der da im Fahrstuhl steht und sich schließlich selbst kommentiert:
(…) haltloser Vers.
Und Haltlosigkeit heißt: Wir sterben.
Ein Bild des Schreckens: dass der Fahrstuhl an seinem Ende ankommt. Ein Bild der Freiheit: zu wissen, dass kein Halt versprochen war. Das sind Verse, die mit den existentiellen Fragen eines Dichters umgehen, der sich selbst in diesem Buch als einen entwirft, der stets ins Freie strebte und doch – wie alle – im Gehege der Großstadt und auch des Gedichts die programmierten Wege abschreitet: Freiheit und Beschränkung, Leben und Tod, Form und Spiel, die Kunst und das Ich.
„Die Massive des Schlafs“ heißt das zentrale Gedicht dazu. Es ist eines von zwei langen elegischen Poemen, die miteinander korrespondieren. Das andere, das „Photopoem“, bündelt die Lichtmetaphern, von denen der Band insgesamt schon fast aufdringlich durchzogen ist, zu einer Reflexion über die „Spur des Abwesenden / In der Schlacht um Präsenz“, ausgehend von gar nicht originellen Szenen und Bildern aus der ewigen Stadt, in der Durs Grünbein einen Teil des Jahres verbringt. Es ist vielleicht das persönlichste Gedicht in diesem Band. „Die Massive des Schlafs“ ist aber das sprachmächtigste, wichtigste, weil sich von hier aus alle anderen lesen lassen, von Versen wie diesen:
Wir sind,
Wenn wir träumen und uns als Zeugen
Im Traum erkennen, längst auf dem Rückzug
Von diesen unvordenklichen Wanderungen
Durch die Zentralmassive des Schlafs.
Geröll unterm Schnee, das ist die Zone,
In der es falsch ist, zu sagen: ich denke – ein Feld,
Aus dem keine Information dringt,
Vom Tiefschlaf beschützt, ein Sperrgebiet.
Damit entwirft Durs Grünbein das Wesen des Menschen als unerreichbar in der Absenz von Erinnerung und Vernunft. Und die Kunst und das Ich? –
Was erzählbar ist, scheint gerettet. Es wird
Integriert in das Märchen vom chronischen Ich,
das der Traum um uns schlägt wie einen Mantel.
Das Märchen vom Ich in der Zeit. Das Märchen von der Rettung durch Literatur. Das Märchen vom Traum und vom Unbewussten als Schlüssel zum Ich. Jenseits dessen schlägt das Herz der Kunst, die dem Zentralmassiv der Existenz mit ihren „Dramaturgien des Traums“ jedoch auch vorgelagert bleibt. Dies im Sinn, kommt man weit, auch bei der Lektüre scheinbar platter Gedichte wie „Die Ausgestoßenen“. Ein Text aus dem zweiten Kapitel, der bereits die Gemüter von Durs Grünbeins Kollegen erhitzt hat. Der Anfang geht so:
Ich habe Gespenster gesehen im Park –
Afrikaner. Sie lagen verstreut auf dem Rasen
Unter unnahbaren Pinien wie Breughels Bauern
Im Schlaraffenland. Sie schliefen dort draußen
Bei Wind und Wetter, hängten die nassen
Kutten und Hosen aus den Caritas-Containern
Zum Trocknen an Bauzäune, Büsche.
Sie machten früh Katzenwäsche, putzten
Die weißen Zähne in den dunklen Gesichtern
Am Brunnen mit dem eiskalten Wasser
Der Aquädukte, von römischen Sklaven erbaut.
Selbstverständlich ist der erste Reflex auf diese Verse, sich über naive Fortschreibung rassistischer Klischees zu echauffieren. Man kann solche Vorbehalte nicht mit der verächtlichen Rede von politischer Korrektheit abtun, wenn man ein Minimum an Sensibilität für den Zusammenhang von Sprache und Realität hat. Andersherum sollte man Lesern und Leserinnen aber auch genaue Lektüre abverlangen dürfen. Wer nämlich über den Reflex hinauskommt, sich Breughels Schlaraffenland anschaut und tatsächlich liest, welche Bezüge Grünbein herstellt, wird feststellen, dass schon in dieser ersten Strophe auf komplizierte und kluge Weise Obszönität ausgestellt wird.
Die Obszönität europäischer Fantasien. Die Obszönität, mit der in Europa seit 2014 von Menschen geredet wird, die über das Meer kommen. Die Obszönität der Bedingungen auch, unter denen sie in Europa leben. Grünbein überblendet dafür AfD-Rhetorik mit den Bildern der aufgeschwemmten Toten aus dem Meer und mit mythischem Material. Die Bilder hinter den offensichtlichen Bildern sprechen von tiefer Trauer und entsetzlicher Schuld, der sich niemand entziehen kann. Denn die, die vollgefressen unter Breughels Bäumen liegen, stammen aus allen Ständen. –
Stolze Menschen im Grunde, doch nutzlos
In ihrer Verborgenheit, von zwei Augen punktiert,
Die glühten noch lange nach, wenn man sie traf,
Wie im Traum das Meer, das sie hertrug,
Das Meer zwischen ihnen und uns.
Es dürfte kein Zufall sein, dass spätestens in diesen letzten Versen des Gedichts unklar wird, von wem und aus welcher Perspektive dieses Ich im Gedicht spricht. Kein Zufall auch, dass im letzten Vers ein Buchtitel des Menschenrechtlers Gabriele del Grande mitklingt, der das mythisch anmutende „Meer“ in die Realität der politischen Gegenwart holt.
So arbeitet Grünbein, „Dichter der Übergänge“: teilnehmend an seiner Zeit. Im Tiefdruckverfahren und in Cinemascope komprimiert. Manchmal schon rüpelhaft, bereit zur Pöbelei gegen Ansprüche, Feigheit und den „Zirkus der Bigotterie“. Antikes Versmaß und mythische Bilder geben der profanen Präsenz einen Hallraum und holen sie aus der „Bananenrepublik des Realen“ ins Relevante. Die fast schon hemmungslose Feier des Gelegenheits- oder Ding-Gedichts wird klammheimlich ins Ewige gebracht, zu den letzten Fragen, um die es auch in diesem Band wieder geht, mit dem angemessenen Selbstbewusstsein des dichterischen Denkers, der sich bekennt zum Höhenflug, dem letzten Leichtsinn, dem „Tanz im Freien / Über den Aschehalden Europas“.
Insa Wilke, Die Zeit, 1.12.2017
Wie Schatten von Atomblitzen
Seine Bilder sind Röntgenbilder, seine Gedichte Schatten von Gedichten, aufs Papier geworfen wie vom Atomblitz. Das Geheimnis seiner Produktivität ist die Unersättlichkeit seiner Neugier auf die Katastrophen, die das Jahrhundert im Angebot hat.
Lang, lang ist es her, dass der Dramatiker Heiner Müller die Gedichte von Durs Grünbein so charakterisiert hat. Es war 1995 bei der Laudatio auf den gerade einmal 33-jährigen Autor bei der Vergabe des Georg-Büchner-Preises. Durs Grünbeins Neugier ist immer noch unersättlich, nur richtet sie sich längst nicht mehr nur auf die Katastrophen unseres Jahrhunderts. Wovon auch sein jüngster Gedichtband Zeugnis ablegt.
Es gehört längst zum Konzept des Lyrikers Durs Grünbein seine Gedichtbände einzurichten wie ein Kurator eine Ausstellung. Die Kapiteleinteilung entspricht dabei einer Art Raumaufteilung. Dieses Mal sind es acht Kapitel und nur eines hat eine Überschrift, das sechste nämlich heißt wie das Buch Zündkerzen. Die erste Zündkerze heißt „Allgemeine Verschärfung“ und beginnt gleich mit einer Warnung:
ALLGEMEINE VERSCHÄRFUNG
Aufgepasst! Wir verschärfen jetzt das Gedicht.
Alles was Sie schreiben, kann gegen Sie verwendet werden,
Alles was Sie nicht schreiben, auch.
Die Idee, als Lyriker wie ein Ausstellungsmacher vorzugehen, ist bei Grünbein keineswegs neu:
Ich habe irgendwann einmal gesagt: Ich bedauere das sehr, dass es keinen Louvre für Gedichte gibt. Wir wissen, dass es quer durch die Literatur sehr große, wichtige Gedichte gibt, die vielleicht in ihrer Funktion oft über das einzelne Gemälde hinaus gingen. Das ist mir immer klarer geworden, dass es große literarische Texte, eben auch Gedichte gibt, die nachher ungeheuren Einfluss auf die Geschichte der Bildenden Künste, der Malerei hatten.
Roma, caput mundi, die „offene, vom Denken verlassene Stadt“ ist dem in Dresden geborenen, bald nach Berlin übergesiedelten Dichter längst zur zweiten Heimat und Inspirationsquelle geworden. Das Stamm-Gedicht, um das sich alle anderen Kapitel wie Äste und Blätter ranken, heißt „Das Photopoem“ und kombiniert Fotografien der ewigen Stadt mit Wort-Bildern, Impressionen und Reflexionen. Sie sind bereits vorbereitet durch andere Gedichte wie „Michelangelos Nase“ oder „Römische Ungereimtheiten“:
MICHELANGELOS NASE
Hier krochen Remus, Romulus aus dem Schilf.
Heute fährt im Mercedes die Brutusbrut.
An jeder Ecke bettelt ein Afrikaner um Hilfe,
Man schmeichelt dir gratis. Tut das nicht gut?
Rom ist die Bruchform, die nicht mehr zerbricht:
In ihr liegt die Gegenwart aufgebahrt. (…)
RÖMISCHE UNGEREIMTHEITEN
Totes Altertum lockt die müde Jugend an.
Flugzeuge schweben herein übers nahe Meer.
Dein Smartphone erklärt dir: Wer, wo und wann.
Mit jedem Jahr wiegt die Ewigkeit schwerer.
Ja, die Ewigkeit. Mit ihr ringt dieses lyrische Ich. In Zwiesprache mit Signora Ricordi, die sprudelnde Quelle der Erinnerungen. Durs Grünbein hat sich in seinem Werk tief verwurzelt mit der Antike, insbesondere der römischen. Schwer, metaphern- und anspielungsreich hat er sich oft verhüllt und verkleidet.
Spätestens seit seinem autobiografischen Prosabuch Die Jahre im Zoo über seine Kindheit und Jugend in Dresden, gefällt ihm zusätzlich der unverstellte Blick, in dem die Ewigkeit altert und zugleich im Alltäglichen verjüngt. In der „Gespenstersonate“ zum Beispiel:
GESPENSTERSONATE
Am Sonntag findet das Erdbeben statt. Mittags,
Wenn alle im Warmen sitzen zur besten Sendezeit.
Die Wände tanzen Tango, die Bilder wackeln.
An ihren Haken, auf den Hügeln stirbt eine Stadt.
Letzte Vorbereitungen zum Schweigen. Du atmest.
Nachts im Wasser der Badewanne schrumpft
die Welt (res extensa) zum gurgelnden Loch.
Humor und Witz und Ironie gehen Hand in Hand mit Düsternis und Pessimismus. Wie würde Herr Grünbein reagieren, trüge man ihm einst den Literaturnobelpreis an? Das sind so Fragen.
VOM ERLERNEN ALTER VOKABELN
Die Wörter schlafen nicht in den Wörterbüchern.
Sie ziehen um den Block, ziellos, spielen mit Munition
Wie Kinder, die Krieg in sich tragen lang nach dem Krieg.
So hatten wir nicht gewettet, Herr Nobel, dass Dynamit
Alles austauschbar macht in Materie, Moral, Malerei.
Eine Zündkerze erzeugt in Ottomotoren die für die Zündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches nötigen Zündfunken. Sie steht auch als pars pro toto für das untergehende Automobil-Zeitalter. Grünbein zeigt ihre Überlebensperspektive in Sprachgewittern. Wenn das Auto längst Geschichte ist, werden diese Zündkerzen den Sprachmotor immer noch antreiben:
AUS EINEM BUCH DER SCHWÄCHEN
Das klingt alles nach freier Improvisation:
Etüden für ein Spielzeugklavier – haltloser Vers.
Und Haltlosigkeit heißt: Wir sterben
Unmerklich, und plötzlich macht es uns Freude,
So zu leben, als ob wir unsterblich wären,
Während Schrift uns eindämmt, und jedes
Einzelne Wort ist zentral. Nun fang an,
Schreib ein Buch deiner täglichen Schwächen.
So heißt es im allerersten Gedicht dieser Zündkerzen. Es verspricht, was es hält: ein starkes Buch über tägliche Schwächen. „Was nun? Wie soll ich den Tag verbringen, da die Weltausstellung zu Ende ist?“ heißt es dann auf der letzten Seite. Der Leser fragt den Autor vorwurfsvoll zurück: Was nun? Wie soll ich den Tag verbringen, da die Zündkerzen zu Ende sind?
Joachim Dicks, NDR, 4.12.2017
Die Erfindung des „lyrischen Man“
– In seinem neuen Gedichtband Zündkerzen umkreist Durs Grünbein den Konflikt von Lyrik und Leben – und scheut dabei den Einbruch in die Intimsphären der eigenen Familie nicht. –
Die 83 Gedichte in Durs Grünbeins neuer Sammlung Zündkerzen lassen sich nicht unbefangen lesen. Denn in jedem von ihnen tritt ein Dichter auf, der seit seinem ersten spektakulären Auftritt vor drei Jahrzehnten ununterbrochen im Rampenlicht der literarischen Öffentlichkeit stand. Er weiß das. Er weiß auch, dass seine Leser das wissen. Und er macht dieses doppelte Wissen zum Gegenstand seiner Dichtung. Seine poetologisch-biografischen Schriften haben deswegen dieselben Wurzeln wie seine Poesie. Sie werden zu deren Spiegel. Manchmal stellen sie sich geradezu vor die Gedichte. Es ist, als ob der Biograf alles daransetzte, die von ihm entlassenen Gedichte im Netz seiner Prosa wieder einzuholen – und umgekehrt, in der lyrischen Form immer wieder das Biografische geltend zu machen.
Durs Grünbein reflektiert fortwährend sein Schreiben, auch und gerade beim Verfassen von Gedichten: „Damals widerfuhr mir, was noch jeder Dichter mit Stolz und Verwunderung seine Stimme finden genannt hat“: Es ist die „Poetik des Sarkasmus, wie sie mir seit meinen frühesten Schreibversuchen den Ton diktiert“. Eine solche Poetik muss alles Poetische überschreiten. Im Sarkasmus tritt der Autor sozusagen neben sich. Er kann keinen Standpunkt einnehmen, von dem aus er einem lyrischen Ich seinen Horizont hätte zeigen können. Oder anders gesagt: Durs Grünbein erfand sich als den Dichter des „lyrischen Man“.
Eine Zündkerze ist dazu da, kontrollierte Explosionen auszulösen – keine schlechte Metapher für ein Gedicht! Aber sie leuchten nicht, außer in der Ankündigung im Suhrkamp-Bändchen mit diesem Titel:
Jedes dieser Stücke entzündet sein eigenes Leuchten, seine größere oder kleinere Epiphanie.
Es erscheint, als hätte der Verlag seinen Dichter lieber erbaulich. Die Gedichte des jüngsten Bandes, wohl alle nach Koloss im Nebel (2012) entstanden, bilden indessen eine bunte Sammlung, behutsam in acht Abteilungen gegliedert, von denen nur die sechste einen Titel trägt, eben Zündkerzen, was gewiss für alle anderen ebenso gut passt wie für diese.
Mit einer Beobachtung einer kleinen alltäglichen Szene beginnen mehrere Stücke dieser Sammlung:
Die Horde Spatzen im Straßengraben, beim Sonnenbad
In ihren Staubkuhlen, dichtgedrängt, Flügel zerzaust…
Hier erinnert die Horde Spatzen an die Kindheit, „wie wir als Kinder, Trolle der Pubertät, / Eigentlich Prinzen, / stundenlang auf dem Rücken lagen.“
In Durs Grünbeins Werk gibt es für diese Szene ein Pendant, in einem Gedicht über eine gekreuzigte Katze, das „die Fratze Kindheit“ beschwört (in der Sammlung Erklärte Nacht aus dem Jahr 2011). Wie anders klingt das hier: Das Ich im „Wir“ ist nach vier Jahrzehnten auf du und du mit dem Ich von damals, paktiert mit ihm und ist stolz auf seine Ungezogenheit:
Weit zurückgelehnt auf den Fahrrädern, sausten wir
Freihändig die Landstraßen bergab, überglücklich
Bis zur letzten Todeskurve
Für einen Augenblick sieht es so aus, als habe Durs Grünbein das „lyrische Man“ hinter sich gelassen. Es kommt in diesem Gedicht noch einmal vor und demonstriert, wie es das Ich abspaltet von der Person, die doch von sich spricht:
Man sprang dann auf,
War auf Beutezug…
Das Gedicht evoziert und entwertet den Stachel von Grünbeins Dichten, Endlichkeit, Vergänglichkeit, Tod. Das gelingt durch die versgewordene Erinnerung:
All das war wieder da beim Anblick der Spatzen im Staub.
Poetologisch gesehen ist das eine klassische Rundung, das Motiv des Anfangs wiederholt sich, wie in einer Melodie, als ihr befriedigender Schluss. Hier ist es zugleich mehr, die Geste des Autors, eine Erinnerung als ein Erleben in Besitz zu nehmen. Der Leser aber könnte auf den letzten Vers verzichten. Er ist für den Dichter wichtiger als für sein Publikum. Tritt er nicht aus dem Gedicht heraus, drückt er nicht vor allem sein Lebensgefühl, ein Glück aus, im Schreiben etwas erreicht zu haben? Die Präsenz des Autors im lyrischen Ich wird in dieser Sammlung ein akutes poetisches Problem. Davon zeugt nicht nur die Zurücknahme des „lyrischen Man“. Es zeigt sich auch daran, dass es keine Rollengedichte mehr gibt und das die Antike in ihren musealen Spuren als Gegenwart erlebt wird. Das lange „Photopoem“ zum Beispiel reflektiert Rom als gegenwärtige Metropole, aber „verwüstet von Wiederkehr“, und veranlasst erstaunliche Verse wie diese:
Und so ist dieser Morgen ein Anfang.
Er besagt: Der heutige Tag
Wird ein Tag sein wie keiner zuvor.
Hans-Herbert Räkel, Süddeutsche Zeitung, 2.1.2018
Rom ist ein gutes Versteck
– Zündkerzen: Durs Grünbein als Dichter der Übergänge. –
Die Steine sind gut erhalten. Die Inschriften mit verstümmeltem Latein nahezu.
Von allen Seiten stürmt Rom auf dich ein,
Und du, mittendrin, liest überall
Die alten Majuskeln SPQR in Metall
Oder Marmor, je nach dem Alter der Schrift.
Die verwirrende Fülle römischer Baukunst, die in ihr verwobenen Jahrhunderte eines Imperiums und nicht zuletzt die katholische Opulenz – das sind viele Vergangenheiten auf einmal. Die Ewige Stadt ist schön, ohne Rechtfertigung in dieser von Nebenwirkungen zerrissenen Welt.
Und an diesem Tag, der die Sonne
Aufgehen sah über Rom,
Offene, vom Denken verlassene Stadt,
Steinbruch der alten Imperien, Schauplatz
Von Staat und Kirche und musealer Kunst,
An diesem antiken Tag wurde ihm klar:
Er war ein Dichter der Übergänge.
Aber der neue Gedichtband von Durs Grünbein heißt nicht „Rom ist ein gutes Versteck“, sondern Zündkerzen. Das gehört zur „Allgemeinen Verschärfung“:
Aufgepaßt! Wir verschärfen jetzt das Gedicht.
Alles was Sie schreiben, kann gegen Sie verwendet werden,
Alles was Sie nicht schreiben, auch…
Grünbein setzt sein gleitendes Ich als Vergewisserung, als Erbe und als Projekt. Hin- und hergerissen zwischen Selbstfindung und Selbstzweifel und Vergänglichkeit ohnehin:
… Wir sterben
Unmerklich, und plötzlich macht es uns Freude,
So zu leben, als ob wir unsterblich wären,
Während Schrift uns eindämmt, und jedes
Einzelne Wort ist zentral. Nun fang an,
Schreib ein Buch deiner täglichen Schwächen.
In Rom lässt sich der Dichter keine Szene entgehen. Auf Wirkung verzichten: Das wäre ja der Tod. Er übernimmt die Geschwindigkeit der Stadt, rings rauscht ein ungezügeltes Leben, wie am Campo de’ Fiori – laut und farbig ein Platz, der nie schläft. Die rasante Gleichzeitigkeit des Verschiedenen wird zum kulturellen Übergangswert. Antike Projektionen unter Vespa-Pegel.
Rom zeigt jedem die Zähne. Zu viele
Autos, zu viel Gedränge in den Straßen,
Baugerüste, in Staub gehüllt, zu viele
Obdachlose in allen Ecken, in den Parks,
Auf den Kirchenstufen, in dreckigen Schlafsäcken,
Zu viele Pilgernonnen, die selig schwatzend
Vorübertrippeln. Zu viele Kirchenstufen:
Das Elend hat einen langen Bart.
Als seien alle Verse unterwegs entstanden. Ein Flaneur, ein Fernfahrer, ein Fluggast im Wettlauf mit der Zeit.
Die Sonne heizt den Asphalt. Sie kocht
Die Suppe der Armen im Staub der Subura,
Dieser ältesten Vorstadt, wo ein neuer
Populus Szenen aufführt – des einzigen Films,
Der keine Proben kennt, nichts wiederholt
Oder alles. Hier zeigt sich Völkerwanderung,
Die jeweils jüngste, zuerst…
Beschwichtigungen nirgends, Idyllik noch weniger. Grünbein kennt sein Rom, er durchlebt und abstrahiert, was er sieht. In dieser Unmittelbarkeit von Welteinlassung und Denkungsart, von Gemüt und Eros, von Traum und Weltende scheint das wahre Leben vorüberzulaufen, zum Greifen nahe. Der Grundsatz: nichts auslassen. Kein Wissen wird von der Wahrnehmung getrennt.
Dann ein „Stolpern, an falsche Türen Klopfen“. Grünbein vertraut im „Photopoem“, der römischen Säule des neuen Bandes, nicht allein auf poetische Bilder. Eigene Photos werden zugesellt. Die Ausweichbewegung wird zum Handicap, die Formstrenge aufgeweicht. Jeder darf als Photograph dilettieren, aber nicht erwarten, dass dieser Beifang einer Poesie aufhilft, die alles ausschreibt bis auf den Grund. Die Verse spannen sich zwischen den Photopfosten wie Hängebrücken. Es kommt zu einer Materialermüdung im festen Gefüge. Wenn im Schwung der Dinge alle Lampen zugleich aufleuchten, gehört das zwar zur poetischen Ausschweifung, doch das Zündungserlebnis bleibt aus. Verfehlt. Um Haaresbreite.
Das Alte, das Neue, chaotisch gemischt,
Geht es in ihn ein, verwandelt ihn. …
Wieder ein Mittag: Rom brannte,
Lichterloh brannten die Romkulissen
In der Sonne, wie aus Millionen Photos
Ein Scheiterhaufen. Hey, wir verbrennen,
Selber Fossile in der täglich erneuerten,
Totalen Gegenwart. Wir,
Die da atmen, schauen, seelenruhig laufen.
Katharsis durch Erschöpfung.
Ganz anders im Zyklus „Sieben Pinien“:
Hunderte Nadelkissen,
Von Geheimnissen knisternd.
Wir wissen, wir wissen,
Hört man sie flüstern
In ihrer nächtlichen Pracht.
Entweder rundet ein Leben sich,
Oder es bricht plötzlich ab, sinkt
Unbemerkt in die Nacht.
Das lastet nicht, es schwebt als Denk- und Gefühlsleistung. Ein zweites Langgedicht heißt „Die Massive des Schlafs“ und erzählt von der Tiefenwirkung des „musealen Lebens“ und wie es mit uns umspringt, ein Sturz der Parität.
Was erzählbar ist, scheint gerettet. Es wird
Integriert in das Märchen vom chronischen Ich,
Das der Traum um uns schlägt wie einen Mantel.
Wir gehen herum in den Außenbezirken der Kunst,
Die in uns schlummert. Auch schien der Mensch
Im Schlaf schwerer zu sein…
Ein in die römische Realität verschlagener, vielseitigkeitsgeprüfter Dichter unterläuft das Reale, bewahrt es und zieht es zugleich tiefer in einen sanften Surrealismus. Diese stille Destruktion dessen, was gewesen ist, ist von einer Art, die zur Dichtung gehört. Eine Kontemplation kann man nicht fassen wie einen Gedanken, aber in der Welt der Dichtung auf einen anderen Wahrheitsgrund heben. Grünbein nimmt sich dabei auch das Vorrecht, nonchalant zu sein. Er zügelt damit sein diskursives Temperament.
Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 8.9.2017
Zündkerzen: Am Tiberufer, dort, wo der Pfeffer wächst
– Antiker Modernismus: Durs Grünbeins famoser neuer Gedichtband. –
Kaum ein Lidschlag trennt uns von der römischen Antike. Es ist noch immer derselbe durchdringend blaue Himmel, der über Rom sein „Auge aufreißt“, das „uns nicht sieht“, aber überallhin verfolgt: mit „Wettergefühlen“. Doch den Flaneur, der die Stadt am Tiber durchquert, erfasst ein Taumel, der keiner bloß atmosphärischen Luftveränderung geschuldet ist.
Rom, diese tausendfach mit Geschichte überlagerte Stadt, bildet das Glut- und Speicherzentrum in Durs Grünbeins neuem, hervorragendem Gedichtband Zündkerzen. Grünbein ist der legitime Spross der sächsischen „Dichterschule“. Deren Vertretern gelang es bereits zu Zeiten der DDR spielend, die Vorgaben der sozialistischen Literaturbürokratie mit Formbewusstsein auszuhebeln.
Grünbeins antikisierender Ton klingt heute gesamtdeutsch. Seine Lyrik kennt den sicher gesetzten Effekt, die Wirkung von verlustanzeigenden Wörtern. „Wir leben in geheimnislosen Städten“, hebt so ein Gedicht an. Zu dieser traurigen Einsicht soll dem Ernüchterten ausgerechnet die „Nachtigall im Park am Morgen“ verholfen haben. Das Los der Vereinzelung weiß der Stadtläufer ungerührt zu tragen:
Es war nicht schwer, hier einsam zu sein
Wie die Krabbenfischer in ihren Booten
Vor den Lofoten.
Selbst Doktor Benn, der die Anrufung fremder Weltgegenden durch exotische Wörter liebte, wäre von der Nonchalance einer solchen Reimkonstruktion hellauf begeistert gewesen.
Häufig genug konnte einem früher Grünbeins Altklugheit den Genuss an seiner Poesie trüben. Mit uns Zeitgenossen verkehrte er bevorzugt im Medium des Altertums. Für die unvermeidlichen Verluste der Moderne wurde sicherheitshalber der Wechsel der Erdzeitalter verantwortlich gemacht.
Noch jetzt, im 56. Lebensjahr, sieht (und hört) der Dichter „die weißen Verben“ am Werk, Tätigkeitswörter wie „verschwinden, verlöschen, verenden“, die mit Geisterhand ausstreichen, was jemals existierte. Sie „operieren verdeckt“ und rücken „still im Schutz der Hauptwörter vor“. Das verdeckte Operieren nimmt nur jemand wahr, der die Schliche der Staatssicherheit noch selbst kennengelernt hat.
Grünbein weiß, dass die (römischen) Felder und Brachen keine Zustände abbilden, sondern das Produkt unermüdlicher Arbeit sind. „Blinde Zerstörung“ trifft den angesprochenen Sachverhalt kaum. „Die weißen Verben“ gibt es, sinniert Grünbein, „wie es die Liebe gibt.“ Sie „zielen auf Horizonte, die nichts erreicht.“ „Er war ein Dichter der Übergänge“, weiß dieser Gedankensänger über sich selbst auszusagen. Und so beharrt Grünbein mit grimmigem, gelegentlich komischem Trotz auf die „profane Helligkeit“ des Gedichts, in dem so anschaulich wie möglich „gegen die Verkürzung der Träume“ gearbeitet wird.
Wie Treppenstürze führen die freien Verse in die schwer zugänglichen Räume von Zeichensetzung und Sinngebung. Als Scheherezade kehrt der Sänger aus dem Armenviertel Suburra wieder. Er hat Glück, dass der Kalif im Traum ein mildes Urteil über ihn spricht:
Dich schonen wir. Bleib, wo der Pfeffer wächst.
Ronald Pohl, der Standard, 18.10.2017
Ein Träumer in einer Welt des Überflüssigen
– Durs Grünbein ist ein Beobachter und Kommentator des Lebens. Er ist Dichter und hat mit Zündkerzen eine Sammlung von 83 Gedichten veröffentlicht. Dazu brauchte es einiges an Abwasch und viele Eindrücke aus einem Leben des Überflusses und der Banalität. –
Der Komponist Giuseppe Verdi schrieb eine Fuge, wenn er sich ausgebrannt fühlte. Tschaikowski hingegen dachte an seine Gage und schindete so Noten. Was aber tut Durs Grünbein? „Immer, wenn mir nichts einfällt, mach ich den Abwasch“, schreibt er in seinem Gedicht „Innere Leere“. Und er wäscht verdammt oft ab, wie er in den folgenden Versen gesteht.
Mein Kopf ist ein Kognakschwenker. Der letzte Tropfen
Verdunstet bei Sonnenaufgang. Es ist, als hätte ich nie
Eine Zeile geschrieben. Vielmehr, sie sind alle vergessen.
Schon als Junge flüchtete der 1962 in Dresden geborene Grünbein vor dem Alltag der DDR in eine Welt der Verse. Nie aber war der Verdruss so groß wie im neuen Buch. Gedichte dienen ihm als „Zündkerzen“, um das profane Leben in dieser „Bananenrepublik des Banalen“ zu meistern.
Das Inferno des täglichen Terrors, den Triumph
Dieser Tauschwirtschaft, die alles trügerisch macht
Alles in Produkte verwandelt
Die Orte entleert.
Der Enthusiasmus der jungen Jahre aber ist verflogen. „Wie lebt es sich, Träumer, in einer Welt / So vieler überflüssiger Dinge“, heißt es da. Und „was, wenn Stille das letzte Wort behält?“
Er sei „Misanthrop aus Geselligkeit, aus Einsamkeit Humanist“, schreibt er über sich, aber der inneren Emigration seien Grenzen gesetzt, das Gehirn sei „kein Bunker“, wenn draußen auch Krieg herrsche.
Nicht mal mehr Rom, diese „Insel der verdichteten Zeit“, wo Grünbein seinen zweiten Wohnsitz hat, bleibt ihm inzwischen noch als letzte Zuflucht. Sind doch auch da schon die Auswirkungen der „Krise, des Konsumrauschs und der Korruption“ nicht mehr zu übersehen.
Meterhoch Unkraut. Inseln von Plastikmüll. Im Park liegen „wie Breughels Bauern“ unter Pinien verstreut Afrikaner.
Stolze Menschen im Grunde, doch nutzlos
In ihrer Verborgenheit, von zwei Augen punktiert
Die glühten noch lange nach, wenn man sie traf
Wie im Traum das Meer, das sie hertrug
Das Meer zwischen ihnen und uns.
Es hat schon etwas Manisches.
Alle ein, zwei Jahre bringt Durs Grünbein ein neues Buch heraus. Bei dem einen oder anderen Gedicht wünscht man sich, er möge sich ein wenig mehr Zeit lassen. Vieles wirkt zu direkt, birgt kein Geheimnis mehr. Die Grenze zwischen Lyrik und Prosa verschwimmt. Doch das muss nicht unbedingt ein Manko sein, sondern kann auch als Qualität begriffen werden.
Grünbeins Verse sind alltagstauglich. Sie sind für jeden verständlich. Hier versteckt sich einer nicht hinter kunstvollen Ellipsen und vertrackten Zeilensprüngen, sondern begreift Gedichte als Lebensspeicher, in die er wie in ein Tagebuch sein Befinden, Gedanken und seine Beobachtungen hineinschreibt. Durs Grünbein selbst spricht in den ersten Strophen vom „Buch seiner täglichen Schwächen“.
Anders als früher, verzichtet er in den neuen Gedichten weitestgehend aufs klassische Vokabular. Nur noch selten wird Latein gesprochen. Das kommt den Texten entgegen, wirken sie dadurch doch nicht mehr so philisterhaft.
Mag auch nicht jede dieser Zündkerzen zünden und manche in sich verglühen, so gibt es doch wunderschöne Bilder. Etwa wenn Durs Grünbein von den vergilbten Zirkusplakaten am Rand einer italienischen Kleinstadt erzählt:
Hier hat die Zeit, für ein süßes Weilchen, gebrannt
Wie das Gras, die Autoreifen am Parkplatzrand
Schon blättern die alten Plakate ab. Die Kinder
Die damals im Zirkus lachten, sind heute Beamte.
Oder wenn er als Vater verstummt vor dem Regal mit Büchern sitzt, in denen „Die Zeit der Toten“ gehütet wird, und im Zimmer seiner „Teenager-Tochter“ unterm Bett die leere Durex-Kondomverpackung findet. Dann fühlt man als Leser ganz unmittelbar, was es heißt, alt zu werden.
Welf Grombacher, Märkische Allgemeine, 6.10.2017
Positionierung des Individuums?
Wo bleibt das Subjekt in einem materialistischen Wahnsystem, im kollektiven Konsumrausch, im „horror vacui des Kapitals“? Dies scheint mir die diesen Gedichten zugrunde gelegte Thematik zu sein.
Die Beschreibung im Klappentext, dass es in diesem Buch um Dinge, nicht um Ideen und Konzepte gehe, trifft meines Erachtens die Sache substanziell nicht. – Hier gibt es wunderbare, eingängige Gedichte in elegischer, melancholischer Tonlage zu lesen, in einer breiten Auffächerung ganz verschiedener Sprechweisen. Auch findet man Texte mit Grünbeins Stammthema der Vergänglichkeit, bis hin zu onomatopoetischen (lautmalerischen) Gedichten mit hohem Kunstcharakter.
Für meine Belange bieten diese Arbeiten ein hohes Identifikationspotenzial. Danke für dieses Leseerlebnis.
aribuch, amazon.de, 26.9.2017
Bald vergessen
Nun ja, so mancher mags als „Lyrik“ ertragen. Aber es ist halt gemacht für eine politisch korrekte Öffentlichkeit. Wenig Substanz.
Geschwurbel, bald vergessen wie alle politisch dichtenden Möchtegerne.
Strelnikow, amazon.de, 23.12.2017
fürchterliches buch
linke politische dichtungen (man kann es wohl eher geschreibsel nennen) eines Menschen der keine Logik kennt und sein eigenes Land hasst.
jens, amazon.de, 13.3.2018
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Walter Delabar: Der Dichter spricht, in welchen Zungen?
literaturkritik.de, Februar 2018
Timo Brandt: Bitterkeit und Sanftheit
signaturen-magazin.de
Bernd Berke: „Wir leben in geheimnislosen Städten“
revierpassagen.de, 13.12.2017
Dagmar Kaindl im Gespräch mit Durs Grünbein: Der zündende Funke der Poesie
buchkultur.net, 26.6.2019
Dagmar Kaindl: Der zündende Funke der Poesie
Buchkultur, Heft 182, 1/2019
Stefan Schmitzer: „War schon genug an Mystik“
fixpoetry.com, 9.10.2017
Buchpremiere: Zündkerzen im Literarischen Colloquium Berlin am 21.9.2017. Lesung: Durs Grünbein, Moderation: Cord Riechelmann
Was lesen Sie?
– Der Lyriker und Übersetzer Durs Grünbein bekam 1995 den Georg-Büchner-Preis. Zuletzt erschienen seine Poetikvorlesungen Jenseits der Literatur. Oxford Lectures im Suhrkamp Verlag. –
Miryam Schellbach: Was lesen Sie gerade, Herr Grünbein?
Durs Grünbein: Ich bin ein langsamer Leser, brauche für jedes Buch viel zu lange und nehme das meiste, was zu lesen sich lohnt, viel zu spät wahr. Man ist eigentlich immer unbelesen, habe ich festgestellt. Ein Buch, das ich seit Kurzem lesen muss, um die Katastrophe, die mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine über die freie Welt gekommen ist, zu begreifen, ist Catherine Beltons Studie über das System des Putinismus, Putins Netz. Es ist unfassbar, wie wenig in den westlichen Demokratien bekannt ist darüber, was sie in den Grundfesten bedroht. Nachdem die deutsche Frage historisch gelöst ist, haben wir es nun mit der russischen Frage zu tun. Gerade erst habe ich Hans Falladas letzten Roman Der Alpdruck von 1947 gelesen – ein gespenstisches Buch über Deutschland und die Deutschen im Jahre null.
Schellbach: Welches Buch hat Sie am meisten geprägt?
Grünbein: Der Ulysses von James Joyce. In diesem einen Roman war alles enthalten, was die moderne Literatur an Ausdrucksformen parat hatte. Ein wahres Feuerwerk an Erzählverfahren, Genretechniken, Stilen wurde hier abgefackelt. Der Bogen spannte sich von der Antike, vom frühen Christentum bis zum jüngsten Tag, einem beliebigen Tag in der modernen Stadt Dublin, der uns von morgens bis Mitternacht in allen Einzelheiten dargestellt wird. Es ist das größte Epos der Alltäglichkeit, das ich kenne, ein Speicher der Weltliteratur.
Schellbach: Wenn Sie vier Autorinnen und Autoren zum Essen einladen dürften, auch nicht mehr lebende, wer säße mit am Tisch?
Grünbein: Imre Kertész (wie damals, als er noch bei uns am Tisch saß), dazu Ilse Aichinger (der ich mich gern erklärt hätte). Vielleicht sitzen wir in einer Trattoria in Rom, und Pier Paolo Pasolini kommt vorbei und bringt eine Schauspielerin mit, Monica Vitti vielleicht, die eben Verstorbene. Sie sehen, das geht nur, wenn man die Uhr zurückdreht.
Schellbach: Sie haben kürzlich gefordert, wir müssen lernen, mehr über Texte und weniger über Haltungen zu reden. Was ist der Unterschied?
Grünbein: Mir ist aufgefallen, wie selten in öffentlichen Debatten über die großen Themen (Religion, Flucht und Vertreibung, Ost- und Westgeschichte, linke und rechte Ideologien) literarische Texte zitiert werden, die uns längst zur Verfügung stehen. Dargestellt wird immer zuerst die eigene persönliche Haltung, die natürlich immer höchst korrekt ist. Dabei gibt es Gedichte, Erzählungen, philosophische Werke, die uns als Orientierung dienen könnten. Sie sind oft das Produkt extremer Spannungen gewesen, persönlicher und gesellschaftlicher Krisen, konfliktreicher Zeiten. Ihre Überempfindlichkeit, ihr Eigensinn, ihre Anstößigkeit ist gerade ihre Schönheit und könnte helfen, die politische Selbstzufriedenheit vieler Zeitgenossen zu durchbrechen.
Schellbach: Sie gelten einigen als der wichtigsten Lyriker des Landes. Wie steht es um die Dichtkunst im Jahr 2022?
Grünbein: Um die muss niemand sich Sorgen machen. Es gibt so viele originelle Stimmen, soviel Neue Musik in der Dichtung, dass man geradezu von einer Renaissance sprechen kann. Am Ende entscheidet das persönliche Schicksal, was aus all den Ansätzen wird. Auch Gedichte werden erst durch das Leben des Autors beglaubigt.
Süddeutsche Zeitung, 24.3.2022
Dichter der Vergegenwärtigung
– Laudatio auf Durs Grünbein zur Verleihung des Internationalen Literaturpreises der Zbigniew-Herbert-Stiftung. –
Wenn Lesen bedeutet, einem anderen die eigene, innere Stimme zu leihen, sich einen bestimmten – verschriftlichten – Code anzueignen, die in ihm gespeicherte Information zu entpacken, wodurch die im Text kodierte Stimme des Autors ein neues Instrument gewinnt, nämlich den Leser, dann erhält das Abwesende die Chance, gegenwärtig zu werden. Wenn aber der Leser zugleich Schriftsteller ist und seine Lektüren zu neuen Texten verarbeitet, wird das Instrument für andere hörbar und weitere Leser werden zum Teil der Übertragungskette, die den abwesenden, vielleicht schon toten Autor mit der Gegenwart verbindet. Wenn das so ist, dann ist Durs Grünbein, ähnlich wie Zbigniew Herbert, ein Dichter der Vergegenwärtigung.
Die Bandbreite seiner Lyrik ist enorm: Aus ihr spricht eine Stimme, die von den grauen Tagen der DDR und vom zerschlagenen Porzellan des im Krieg verbrannten Dresden erzählt, die Stimme des Naturforschers und sardonischen Anthropologen, des Erkunders der Antike, des eifrigen Belauschers der Vergangenheit und der Gegenwart. Es sind höchst unterschiedliche Stimmen – von metaphorischen bis hin zu alltäglichen und verblüffend direkten –, die sich oft in unerschrocken modernisierten, aber im Grunde klassischen Formen artikulieren: Elegien, Oden, Versepen. Um von der Gegenwart zu erzählen, tritt Grünbein in Kontakt mit Kunst und Philosophie, zitiert Seneca, Pascal, Hölderlin und andere. Beharrlich unterzieht er unsere Existenz einer poetischen Analyse und versucht, die irgendwann gesprengte Brücke zwischen Dichtung und Philosophie wiederaufzubauen. So etwa in seinem Gedicht über Descartes, worin das Zwiegespräch mit dem Philosophen zum aus Versen gebauten Vehikel des Intellekts wird. George Steiner wußte genau, warum er sein Buch Gedanken dichten gerade Descartes widmete.
Durs Grünbein gilt als einer der größten lebenden Dichter deutscher Sprache, und auch wenn es heißt, über die Größe eines Dichters solle allenfalls sein Schneider sprechen, braucht es doch zweifellos Raum, um die Stimmen der verschütteten Pompejer in sich aufzunehmen.
Im Gedicht „An Seneca. Postskriptum“ schreibt Grünbein:
Verzeih mir, Toter. (…)
So sehr gefesselt hat, verzeih mir, mich dein Brief,
So sehr bezaubert, okkupiert, im Eigensinn bestärkt.
Ich bin der eine, Seneca, nach dem du schreibend suchtest.
Der späte Lauscher, der ihr zuhört, deiner Geisterstimme.
Es braucht mich nicht. Auch nach mir liest man noch dein Buch.
Ich leb nur kurz, ein Weilchen nur, doch du lebst ewig.
Homer führt Odysseus ins Totenreich, Vergil Aeneas. Katabase ist das Anhören der Toten. Die zu uns sprechenden Seelen der Toten verfolgen noch immer das Geschehen in der Welt, ganz als wäre der Tod unvollständig – sie sind immer noch dort, unter der Erde, hinter Toren aus Elfenbein und Horn, die Kontinuität des Daseins ist nicht abgerissen. Doch die Sache ist die, daß wir, wenn wir den Toten lauschen, in Wirklichkeit uns selbst lauschen. In einem dialogischen Monolog sprechen wir mit uns selbst, geben dem Unsichtbaren eine Stimme – wie in einer spiritistischen Séance, wenn sich der Teller auf dem Tisch bewegt und einer von uns zum Bauchredner wird. Wir brauchen unbedingt den Widerhall, das Gefühl, daß wir nicht allein sind und der Tod nicht die Grenze zum Schweigen ist. Schweigen schließt jede Hoffnung aus.
Wenn Odysseus – und mit ihm Homer – in den Hades hinabsteigt, ist das Höllentor näher als wir denken, und schon das Schreiben eines Gedichts kann eine kleine Katabase sein. Zbigniew Herbert war dort: Er sprach mit der Stimme Caligulas oder der Stimme Kants in dessen letzten Tagen. Oder im Gedicht „H. E. O.“, in dem Hermes Eurydike einige Schritte hinter Orpheus zum Ausgang aus der Unterwelt führt. So wie Herbert schaut auch Grünbein immer wieder im Hades vorbei, indem er diese oder jene Gestalt evoziert – Seneca, Lukian oder den eines Winters in einem beheizten Zimmer in Quarantäne sitzenden Descartes. Ein Akt des Widerstands gegen die geheimnisvolle Sterblichkeit und die Beschränkungen der Zeit, wie jener des Orpheus. Wie auch all jener, die dem gelesenen Text ihre innere Stimme leihen. Das Jenseits ist ein Ort tief in uns, an dem sich die Stimmen aufhalten.
Die Hölle ist in uns, sie ist ein Kästchen voller Klänge, eine sprechende Schachtel.
In diesem Sinne steht Durs Grünbein der poetischen Tradition Zbigniew Herberts nahe: Die Universalkultur ist für ihn noch immer ein Bezugspunkt, ein Ort, an dem wir alle leben, unabhängig von der Zeit und vom Wechsel der Moden und Kommunikationsweisen. Sie ist für ihn ein unerschöpfliches Reservoir von Fragen, die zu stellen sich noch immer lohnt, eine Möglichkeit zum Aufspüren von Verwandtschaften in einer unruhigen Gegenwart. Ein Element der Kontinuität, etwas, das für einem Moment die Zeit und den Raum vergessen läßt, die uns trennen. Der Brief Senecas, von dem Grünbein in seinem Gedicht schreibt, ist die Abhandlung „Von der Kürze des Lebens“. In ihr lesen wir (in der Übersetzung von Otto Apelt):
Wenn wir im Geistesflug uns über die Schranken menschlicher Schwachheit erheben wollen, so öffnen sich uns lange Zeiträume, die wir durchwandern können. Wir können mit Sokrates Zwiegespräche führen, können mit Cameades zweifeln, mit Epikur die Ruhe pflegen, mit den Stoikern die menschliche Natur überwinden, mit den Zynikern über sie hinausgehen. (…) Von ihnen wird keiner dich zu sterben zwingen, aber alle werden es dich lehren; von ihnen wird keiner dir deine Jahre zunichte machen, wohl aber die seinigen dir zugute kommen lassen (…). Das ist die einzige Möglichkeit, die Grenzen der Sterblichkeit zu erweitern, ja sie in Unsterblichkeit umzuwandeln. Ehrungen, Denkmale, alles was dem Ehrgeiz huldigt, sei es in öffentlichen Anerkennungen, sei es in Werken der Kunst, ist raschem Verfalle preisgegeben, alle zerstört der Zahn der Zeit und läßt nichts unberührt. Aber dem, worauf die Weisheit ihr Siegel gedrückt hat, kann die Zeit nichts anhaben. Keine Flucht der Jahre wird es vertilgen, keine es mindern.
Romasz Różycki, Sinn und Form, Heft 4, 2021
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook + KLG + IMDb + PIA + ÖM + IZA + Archiv + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein bei Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


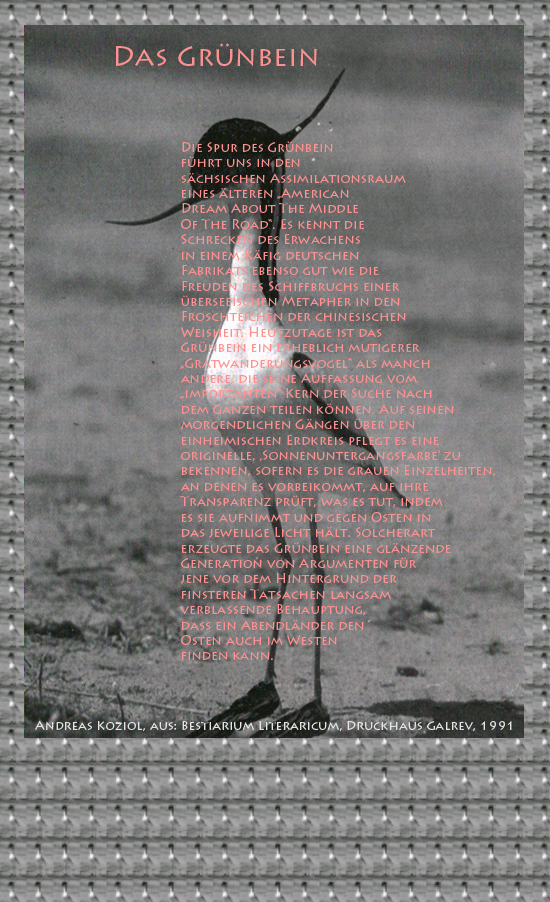
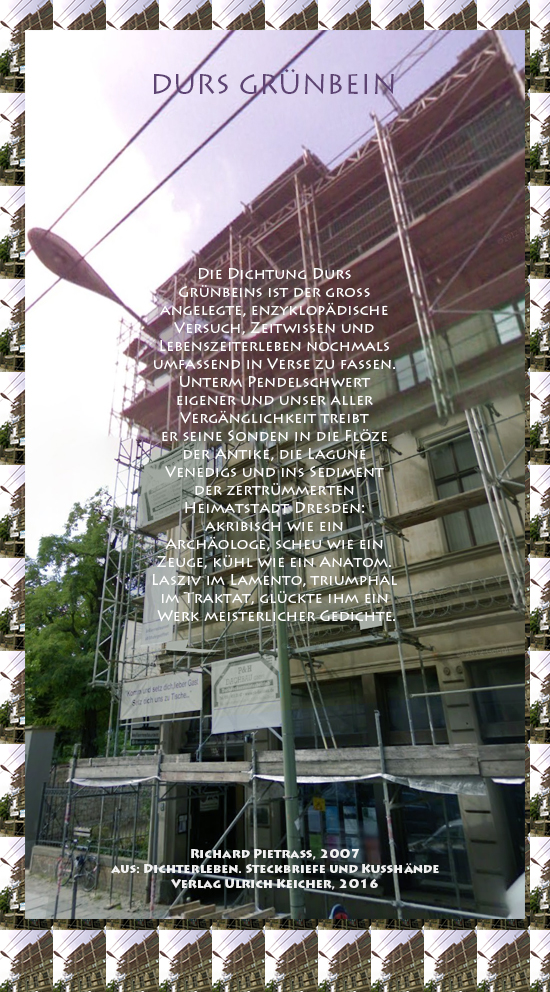












0 Kommentare