KOSMOPOLIT
Von meiner weitesten Reise zurück, anderntags
Wird mir klar, ich verstehe vom Reisen nichts.
Im Flugzeug eingesperrt, stundenlang unbeweglich,
Unter mir Wolken, die aussehn wie Wüsten,
Wüsten, die aussehn wie Meere, und Meere,
Den Schneewehen gleich, durch die man streift
Beim Erwachen aus der Narkose, sehe ich ein,
Was es heißt, über die Längengrade zu irren.
Dem Körper ist Zeit gestohlen, den Augen Ruhe.
Das genaue Wort verliert seinen Ort. Der Schwindel
Fliegt auf mit dem Tausch von Jenseits und Hier
In verschiedenen Religionen, mehreren Sprachen.
Überall sind die Rollfelder gleich grau und gleich
Hell die Krankenzimmer. Dort im Transitraum,
Wo Leerzeit umsonst bei Bewußtsein hält,
Wird ein Sprichwort wahr aus den Bars von Atlantis.
Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle.
![]()
Flaschenpost
Wenn ein Dichter nur lange genug im Rennen ist, bleibt es ihm nicht erspart, daß seine Verse sich in den Schleppnetzen, die man Anthologien nennt, fangen und in die Schulbücher Eingang finden. Spätestens dann wird er sein blaues Wunder erleben. Man wird von ihm wollen, daß er sich deutlich erklärt, über manches in seinem Werk einmal grundsätzlich Auskunft gibt. Poetikvorlesungen werden ihm angeboten, die Spalten der Wochenendbeilagen freigehalten für seine Selbsterkundungen. Eine Flut von Nachfragen geht auf ihn nieder, er soll Stellung nehmen zu dieser oder jener gewagten Formulierung, die ihm vor Zeiten entschlüpft ist. In Deutschland sind es vor allem die Lehrer, die von ihm Rechenschaft verlangen, sodann die kunstbegeisterten Laien, jene Klientel, die keine Galerieführung verpaßt und soweit geht, selbst Literaturarchive zu besuchen. Professoren im Ruhestand klopfen bei ihm an, die Fußnotenjäger, Zeitungsausschnittsammler, Bibliomanen. Und sie alle sind, mit ihrer detektivischen Neugier, schnell auf der heißen Spur. Leicht herauszuhören, daß es auch mir so ergangen ist, denn keiner, der heute schreibt und publiziert, entgeht einer solchen Behandlung. Nicht seit es Medien gibt, die rund um die Uhr jeden zum Mitmachen anstacheln in einer Gesellschaft, die von Interaktivität nur bei außergewöhnlichen Anlässen befreit ist, in einem Musiksaal etwa, beim Symphoniekonzert (sagen wir: Claude Debussy op. 109 La Mer) – oder bei einem Festvortrag, wenn der Ausnahmezustand des Schweigens und Zuhörens gilt.
Ich möchte Ihnen heute einen Vers näherbringen, einen einzigen meiner Verse. Er gehört zu jener Sorte vertrackter Textstellen im Werk eines Autors, die ihm zuverlässig Leserbriefe bescheren und nach mancher Lesung ein Gespräch unter vier Augen. In solchen Momenten kommt der Autor nicht selten in die größte Verlegenheit. So, wenn er eingesteht, daß manches von ihm Geschriebene ihm selber eines Tages zum Rätsel wurde. Daß es Stellen gibt, die auch ihm, Jahre später, nicht mehr ganz geheuer und jedenfalls stark deutungsbedürftig sind. Da ist nichts zu revidieren, nichts zu beschönigen, aber er weiß nun auf einmal, was mit dem Gleichnis vom Gedicht als einer Flaschenpost gemeint war (das so abgegriffen klingt und doch seine Berechtigung hat). Lange ist sie da draußen, auf der hohen See der Bücherwelt, in diesem Meer des gedruckten Verstummens, umhergeschaukelt, und ihm nun wieder vor die Füße gespült worden. A message in a bottle, wie es in der Sprache der klassischen Seefahrernation heißt: ein versiegelter Fetzen Text mit keinem Adressaten, außer dem zufälligen Strandgänger, der ihn herausfischt und verwundert zu lesen beginnt. Von solcher Art ist das Gedicht, das den nun folgenden Überlegungen zugrunde liegt.
Ein einziger Vers darin, sagte ich, aber einer von denen, die viel Staub aufwirbeln. Und es ist dieser Rückkehreffekt, eine Folge all des Unausgesprochenen und Ausufernd-Impliziten, der einen zwingt, zu seiner Ergründung etwas weiter auszuholen. Gut möglich, daß es mich dabei über Landesgrenzen, auch über die Grenzen der Gegenwartslyrik hinausträgt. Die Sache wird nicht ohne Seitensprünge in fremde Literaturen, frühere Kulturen abgehen, ein direkter Weg läßt sich nicht garantieren. Auch könnte es das Thema mit sich bringen, daß das Ganze zuletzt wie die Irrfahrt eines auf dem Ozean der Symbole ausgesetzten Bewußtseins erscheint. Selbst ein Schiffbruch ist nicht auszuschließen. Denn ohne Risiko ist sie nun einmal nicht zu haben, die maßlose Übertreibung, die in der folgenden Behauptung, der folgenden Verszeile steckt:
Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle.
Der Begriff Metapher
leitet sich ab vom griechischen metà phérein (anderswo hintragen), was in der Antike meist „per Schiff“ bedeutete, so daß die Seefahrt bald selbst zur Metapher für die Dichtkunst wurde. Das Schiff als Symbol für den Aufbruch, das Wagnis des Lebens, gehört seither zu den beflügelndsten Bildern der Literatur, Meeres- und Tiefseephantasien finden wir nicht nur bei Homer und Melville, sondern auch bei Jules Verne, Baudelaire, T.S. Eliot, ja sogar bei Dante. In 14 Essays spürt Durs Grünbein der Faszination des Meeres nach, nicht nur in Büchern, sondern auch im Museo Archeologico von Paestum und auf dem Grund des Tyrrhenischen Meers. „Was“, so fragt der begeisterte Taucher, „wenn noch mehr dahintersteckt, eine Sehnsucht nach der Wiege der Evolution, der Urheimat jeder einzelnen sterblichen Zelle?“
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2009
Durs Grünbein und der feine Nachgeschmack der Verse
Die formelhafte Frage, was uns der Dichter damit sagen wolle, erwartet meist eine Antwort, die kürzer ist als der Gegenstand der Interpretation, eine bündige, griffige Antwort. Jeder Leser hat wohl schon die seltsame Formel schräg beäugt und sich über solche Forderung gewundert. Dass die Deutung kürzer ausfällt als der interpretierte Text, ist ein Ding der Unmöglichkeit: ist doch gerade die lyrische Aussage auf Kürze berechnet, die lyrische ist die knappe Ökonomie. Aber gerade der lyrische Text ist es, der das Verlangen nach normalsprachlicher Erklärung laut werden lässt – auch dort, wo die Gleichung „je knapper je undeutlicher“ nicht aufgeht. Gewiss ist es zuweilen so, dass die Forderung, die Deutung möge kürzer ausfallen als der interpretierte Text, ein frommer Wunsch ist. Aber im vorliegenden Fall ist das nicht so. Durs Grünbeins Essay Die Bars von Atlantik, aus zwei Reden an den Universitäten von Berlin und Bologna hervorgegangen und nun bei Suhrkamp erschienen, ist so kenntnisreich im Inhalt und so angenehm im Tonfall, dass man sich den schmalen Band gut und gerne fünf mal so dick gewünscht hätte.
Was interpretiert Grünbein in diesem Essay mit dem verlockenden Titel? Er untersucht ein Gedicht, genauer: nur einen Vers von Durs Grünbein. Dass der Essay so gelungen ist, liegt nun aber nicht daran, dass Grünbein seinen eigenen Vers „besonders gut kennt“. Das könnte man vermuten, das muss aber nicht der Fall sein, auch der Autor weist ausdrücklich darauf hin. Grünbein ist vielmehr grundsätzlich ein guter und belesener Leser und ein eleganter Essayist. Er versteht sich auf Verknüpfungen und Denkbewegungen, verbindet im harmonischen Wechsel Lebenswelt und Literaturkosmos, und er hat sich vor allem nicht zu viel vorgenommen. Ein Vers im Kontext eines Gedichtes auf ein schlankes Büchlein interpretatorisch schweifende Prosa: das ist ein wunderbar getroffenes Mischverhältnis.
Der besagte Vers stammt aus dem Gedicht „Kosmopolit“, das im Band Nach den Satiren (1999) enthalten ist, und lautet:
Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle
Von diesem Vers ausgehend spannt sich ein weiter Assoziationsraum auf, und Grünbein legt recht zügig eine Marschroute durch die Motivgeschichte fest. Kaum ist vom Vorgeschmack, nur bedingt von der Hölle die Rede: die Reise steht im Zentrum, und mit ihr der große, kontinuierliche Topos vom Leben als Schifffahrt und der Schifffahrt der Dichtung. Die Geschichte dieses Topos ist lang und voller Seitenarme, all die Belegstellen ergeben selbst schon wieder ein veritables Meer. Die berühmten Studien und Passagen von Curtius oder Blumenberg bleiben natürlich nicht unerwähnt. Mit kurzen, kräftigen Schritten schreitet Grünbein diesen Bezirk ab, um später einige gezielte Probebohrungen vorzunehmen, so etwa bei Baudelaire, Homer, Lautréamont, Eliot und Dante. Grünbein spürt hier den Wendungen nach, und reichert den Kontext an, der sich zumeist stillschweigend auf den Zentralvers des Essays bezieht.
Schließlich aber lässt er die Geschichte der Schifffahrtsmetapher auch in unsrer Gegenwart stranden. Technikmüdigkeit, Mondraketen, Tankerkatastrophen, ein allmählicher Rückzug des Schiffers, im U-Boot und im Kapitän Nemo, all das wendet das einst enthusiastisch angenommene Wagnis ins Negative. Auch das Reisen selbst, das häufige und routinierte, das im Begriff des Kosmopoliten im Gedicht wie im Essay präsent ist, erscheint verflacht, ins Fließband gestellt. Wie es in vorgreifender Zusammenfassung heißt: „Es wird um die Figur des Kosmopoliten gehen, den von avanciertester Transporttechnik umhergewirbelten, hypermobilen Menschen unserer Tage“.
Aber gerade von Reisen bringt Grünbein viele Fundstücke in seinen Essay, Erinnerungen, Bilder, zufällige und solche aus dem Bildungskanon, Träume, Fragmente; Reanimationen alter Bilder, Traditionslinien des neuen Verses. Von hier aus ergeben sich auch viele der interessanten, entlegenen Seitensprünge von der kulturhistorischen Marschroute – und diese bekommen so Gewicht in der Umkreisung des Verses.
Es versteht sich fast von selbst, dass man am Ende nicht säuberlich aufgereiht all die Absichten des Autors, die sich mit dem genannten Gedicht und dem genannten Vers verbinden, benennen und verbuchen kann. Was den Essay dennoch zu einer guten Interpretation macht, ist, dass er dem lyrischen Text dieses Vorrecht und diesen Rückzugsraum würdigend vorbehält. Ausgehend von dem Vers entspinnen sich für die Dauer eines langen, aber nicht zu langen Vortrags Gedanken, Gedankenstränge und Wege durch den Text, durch die Texte. Da ist viel Aufschluss, viel Bildung, viel entlegene Information, die nun neu versammelt und arrangiert ist. Ob nun klar geworden ist oder nicht, was uns der Dichter mit diesem einen Vers sagen wolle, wir haben ihm zu danken, was von ihm seinen Ausgang nimmt.
Tobias Roth, Die Berliner Literaturkritik, 8.10.2010
Poetologie des Wassers
− Durs Grünbein erkundet Die Bars von Atlantis. −
In einer Bar von Atlantis hocken verblichene Prominente der Weltliteratur nebeneinander wie die Wachsfiguren eines Unterwassermuseums von Madame Tussaud: „Der Mensch ist ein Fremdling auf Erden“ lautet lakonisch ein Schild über dem Tresen. Die versunkene Insel, von der Platon erzählte, soll nach Durs Grünbein von den großen Dichtern der Vergangenheit bevölkert sein, von den verstorbenen Autoren aller Epochen, mit denen er so häufig in seinen Werken kommuniziert. Wie Kapitän Nemo, ein „Festlandsverächter“ und „Radikalmisanthrop“, will der Dresdner Schriftsteller in die Fluten tauchen wie der Mann auf der Tomba del tuffatore in Paestum, dessen Kopfsprung auf eine lange Reise in die Unterwelt, ins Totenreich, ins Unbewusste hindeutet.
Im vergnüglichen Band Die Bars von Atlantis, einem langen Essay in vierzehn Etappen, der auf zwei Vorträgen beruht, die der Dichter in Berlin und Bologna zwischen 2008 und 2009 gehalten hat, lässt Grünbein die schönsten literarischen Werke Revue passieren, die das Leben unter oder auf dem Wasser sowie das Reisen übers Meer zum Thema haben. Natürlich gehören Homer und Herman Melville dazu; Dante, Virginia Woolf und Jules Verne, sogar Charles Baudelaire, Bertolt Brecht und T.S. Eliot werden erwähnt. Dichtung wird als Schifffahrt präsentiert, das Gedicht – nach Ossip Mandelstam – als Flaschenpost konturiert.
Die Literatur, jahrhundertelang von den riskanten Unternehmen der Meeresbezwinger genährt, wimmelt von abenteuerlichen Seefahrern. Grünbein zufolge werden moderne Verkehrsmittel das Schiff und seine charmante Symbolik von Aufbruch, von Wagnis des Lebens nie ersetzen können. Denn wie könnten heute die technikfeindlichen Lyriker über die so unpoetischen Flugzeuge dichten? „Warum“, fragt sich der Autor, „werden keine Oden geschrieben auf all diese Airbusse, Boeings und Helikopter, nicht die kleinste Elegie auf die erst gestern im Technikmuseum abgestellte Concorde […]?“ Auch einem Kosmopoliten wie Grünbein, der seit der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ viel durch die Welt gereist ist, erscheinen die Flughäfen als moderne Höllen, als hektische Transiträume für vom Jetlag verwirrte Globetrotter. Dichtung bewegt sich dagegen auf dem Meer, sie speist sich mit Salzwasser, sie träumt von langen Reisen, von fernen Ländern und submarinen Reichen.
Von der durchdringenden Macht des Aquatischen zutiefst fasziniert, hat Grünbein in seinem Opus Literatur und Wasser wiederholt in Verbindung gebracht, zum Beispiel in den zahlreichen venezianischen Gedichten oder in verträumten Überflutungsfantasien. Der Schriftsteller, ein „neugierige[r] Tintenfisch“, hat sich in seiner Produktion mehrmals der semantischen Sphäre des Liquiden genähert und maritimer Bildkomplexe bedient, um eine originelle Poetologie des Wassers auszuarbeiten, der er nun mit diesem Band eine gewisse Systematik zu verleihen scheint.
Die produktive Anwendung einer aquatischen Metaphorik auf die Bereiche der Poetik und der Semiologie – die ziemlich früh bei Grünbein zu registrieren ist, etwa im Gedicht „Fisch im Medium“ (1991) – findet ihre Krönung im dichterischen Kabinettstück „Calamaretti“ (2005), in dem sich das lyrische Ich bei den wehrlosen, in Scheiben geschnittenen Meeresfrüchten entschuldigt, bevor es sie als Soße eines leckeren Nudelgerichts kostet. Die Kalmare, deren Name an den Calamus – das antike Schreibgerät aus Schilfrohr – erinnert, sind als Tinte ausscheidende Weichtiere auch mit dem materiellen Prozess des Schreibens verbunden. Aus dieser Perspektive gelesen, erhalten die heiteren Zeilen des Gedichtes eine selbstreflexive, eminent poetologische Dimension; der Dichter versetzt sich amüsiert in die Rolle eines Fischers, seine Angelrute ist der Vers:
soweit ich weiß,
In eurem wäßrigen Biotop, in Poseidons wogendem Reich,
Habt ihr niemals die Sonne vermißt. Erst mein Vers
Rückt euch ins Tagelicht, eh euch mein Gaumen berührt
Die „angelnde“ Funktion der Dichtung findet sich auch in „Erklärte Nacht“ (2001), einem der bedeutendsten poetologischen Gedichte Grünbeins, wieder: „Der Vers ist ein Taucher, er zieht in die Tiefe, sucht nach den Schätzen / Am Meeresgrund“, heißt es dort. Die erste Bewegung der Dichtung ist also vertikal, das Gedicht durchbricht die dünne Wasseroberfläche der Gegenwart und sammelt die in der Meerestiefe vorhandenen Schätze der persönlichen, literarischen und geschichtlichen Erinnerung.
Beim Tauchen – so Grünbein in Die Bars von Atlantis – sucht man „eine Schatztruhe an Erinnerungsbildern“; die Tiefsee ist der unzugängliche Raum des Unbewussten, ein Biotop, in dem die Vergangenheit auf keinem Fall verloren geht, sondern im Lichtlosen konserviert wird. Wie uns die sonderbaren Fische in den Ozeantiefen, von denen Grünbein im Essay „Zeit der Tiefseefische“ (1995) spricht, unbekannt bleiben, bis ein Dokumentarfilm oder eine Enzyklopädie ihnen Sichtbarkeit schenkt, überlagern sich die Bilder am Meeresgrund und scheinen damit unter dem kontinuierlichen Wechsel von Ebbe und Flut begraben zu sein, während sie in Wirklichkeit dort unverloschen und geborgen warten, bis sie – auch durch die Poesie – plötzlich heraufgeholt werden. Eine der ersten Aufgaben des Dichters ist also das Tauchen als Akt des Sinkens, des Erkundens und des Emportauchens.
Innerhalb der Grünbein’schen Wasserpoetik ist eine zweite Bewegung der Lyrik zu erkennen, und zwar die horizontale Bewegung der Überfahrt von einem Ufer zum anderen, die im Bereich der Wörter mit der Metapher, für Grünbein vielleicht der wichtigsten rhetorischen Figur, zu identifizieren ist. Ganz bewusst vom etymologischen Sinne des griechischen Ausdrucks metà phérein – das heißt „(meistens per Schiff) anderswohin tragen“ – präsentiert Grünbein im Essay „Katze und Mond“ (1992) den Dichter als zuständige Person für den „Transport der Worte. Er ist der Zwischenträger, der Überträger zwischen dieser und einer anderen Welt“. Und in Die Bars von Atlantis erinnert sich der Autor auch an einen Möbelwagen, den er eines Tages in einer Athener Nebenstraße gesehen hatte und der die Aufschrift Metaphorai trug: „Seither will mir die praktische Bedeutung des Wortes nicht mehr aus dem Sinn. Eine Metapher ist […] ein Umzugswagen, sie schafft Bedeutungslasten von hierhin nach dorthin, und im Fahrerhaus sitzen die Dichter und palavern und steuern“.
Aber die Metapher ist für Grünbein nicht nur eine durch eine ungewöhnliche Wortkombination erfolgende Sinnübertragung, eine Art Quidproquo, in dem „je weiter der Sprung vom Quid zum Quo, um so stärker der Überraschungseffekt“ ist; dank ihrer bildlich-evokativen Kraft ermöglicht sie auch das Reisen durch die Zeiten, das Baden im Gewässer der Kultur und der Geschichte. Im Gedicht „Metapher“ (2002) – einer Umschreibung und Neuauslegung von Lukians Totengespräch zwischen Charon und Merkur anlässlich des Besuches des Fährmanns in der Welt der Lebenden – wird gerade diese Bedeutung der rhetorischen Figur als Brücke zwischen den Zeiten, als Übergang zwischen Diesseits und Totenwelt suggeriert.
Die Metapher „umfaßt […] den beiderseitigen Verkehr auf der mehrspurigen Spiralbahn zwischen dem Reich der Toten und dem der Lebenden“ (Michael Eskin), sie erlaubt dem Dichter, in das „Stimmengewirr vieler Zeiten“ zu lauschen – von dem Grünbein im Aufsatz „Mein babylonisches Hirn“ (1995) spricht – und dadurch eine gewisse Simultanität des historisch Disparaten herzustellen. So lesen wir in „Erklärte Nacht“:
Metaphern sind diese flachen Steine, die man aufs offene Meer
Schleudert vom Ufer aus. Die trippelnd die Wasserfläche berühren,
Drei, vier, fünf, sechs Mal im Glücksfall, bevor sie bleischwer
Den Spiegel durchbrechen als Lot. Risse, die durch die Zeiten führen.
[…] Was bleibt, sind Gedichte. Lieder, wie sie die Sterblichkeit singt.
Ein Reiseführer, der beste, beim Exodus aus der menschlichen Nacht.
Die Metapher hüpft wie ein platter Stein auf dem Wasser, sie springt zwischen Wasser und Luft hin und her, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und sinkt nach den waagerechten Sprüngen senkrecht in die Tiefe, um die Schätze der Vergangenheit – ihren abundanten Vorrat an Bildern und Gedanken, der dem orientierungslosen Gegenwartslyriker Halt gibt – zu erkunden. Wie Grünbein in einem Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks erklärt, ist Dichtung diachronisch, sie entsteht aus dem „Ineinanderverwobensein aller Zeitformen“ und sorgt für die „Gleichzeitigkeit des zeitlich Beziehungslosen“; die Metapher als Figur des Zeitlichen beziehungsweise des Omnitemporalen ermöglicht die Wiedergewinnung des Verlorenen und dessen Verewigung – „Was bleibt, sind Gedichte“.
Wie sich aus diesen kurzen Reflexionen über die das ganze Grünbein’sche Werk durchziehende Poetologie des Wassers ergibt, bildet das Bild des Flüssigen und des Maritimen eine Konstante in der lyrischen sowie essayistischen Produktion des Dichters. In den vierzehn „Tauchgängen“ des vorliegenden Bandes liefert nun Grünbein einen reichen und differenzierten Überblick über die wichtigsten Darstellungsformen des thalassalen „Ur-Topos“ in der Weltliteratur; dabei geht er vorwiegend eidetisch und assoziativ vor, seine Argumentation folgt der sanften Beweglichkeit der wogenden Fluten, sie schwankt von einem Bild zum anderen, von einem Autor zum anderen, von einem Werk zum anderen.
In Die Bars von Atlantis entwirft Grünbein zugleich eine solide poetologische Struktur, die einen Schlüssel zum Verständnis und zur kritischen Einbettung von manchen seiner eigenen Gedichte anbietet. Insofern bestätigt der Band die Tendenz des Dichters, seine Aufsätze in enger Verbindung zu den Gedichten zu konzipieren; nicht zufällig wird die Reihenfolge der kleinen Essays durch zwei Lyrikstücke – „Kosmopolit“ und „Von den Flughäfen“ – unterbrochen, und den Ausgangspunkt der Abhandlung selbst stellt gerade ein eigener Vers dar, der lautet: „Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle“.
Wie der Schriftsteller in einem Interview mit Silvia Ruzzenenti erklärt, schreibt er seine Essays als Studien für die Gedichte, oder umgekehrt schreibt er Gedichte, aus denen dann Essays hervorgehen. Seine Aufsätze, die in ihrer angenehmen Luftigkeit denen von Joseph Brodsky ähneln, werden also zum „unmittelbare[n] literarische[n] Ausdruck eines Confinum zwischen Poesie und Prosa“, wie es bei Max Bense heißt.
Aber nicht nur als erhellendes Handbuch zur Poetik des Dichters soll dieser Prosaband gelten. Mit seiner unterhaltsamen Erkundung der Bars von Atlantis legt Grünbein einen gelehrten und äußerst anregenden Text vor, den alle Literaturliebhaber faszinierend finden werden.
Daniele Vecchiato, literaturkritik.de, April 2010
Tauchgänge zu den Rätseln von Atlantis
− Ein faszinierender Essay von Durs Grünbein. −
Durs Grünbein ist auch in seinen Essays ein Dichter. Die Bars von Atlantis, seine neueste Arbeit, ist durchkomponiert wie ein kostbares Langgedicht. Dazu anregend, erhellend auf jeder Seite, eine Lesefreude!
Wie nicht viele in deutscher Sprache wagt sich dieser Autor weit hinaus und weit hinunter in seiner poetischen Topografie. 1962 in Dresden geboren, zählte er schon 27 Jahre, als die Mauer fiel. Vielleicht war die Isolation gar Voraussetzung und Antrieb für die Kühnheit seiner Gedanken und Gedankensprünge, für die verwegenen Spracherkundungen, wie sie die schon fast legendären Gedichtbände von 1988 und 1991 zeigen, Grauzone morgens und Schädelbasislektion. Zu Beginn der neunziger Jahre musste der Ostdeutsche die Welt neu finden und erfinden. Hinter dem Eisernen Vorhang hatte der Titel „Kosmopolit“, der über den Eingangsversen des neuen Essays steht, als Terminus der Subversion gegolten. Gegen „Auslandsliebe“ waren die Mauern errichtet worden.
Die Leerzeit des Transitraums
Man erinnert sich an einen Schriftsteller aus Grünbeins Grossvatergeneration: Max Frisch, der die geschlossenen Schweizer Grenzen während des Zweiten Weltkriegs kaum ertragen hatte, fuhr nach 1945 gleich los. Es ging ans Meer und in die bombardierten Städte Deutschlands, bald auch nach New York und Mexiko. Im „Tagebuch mit Marion“ konnte er seinen Lesern, auch jenen in Deutschland, vermitteln: Die Welt ist noch da, jenseits von Sorge und Ruinen, Hass und Denkverboten. Ähnlich draufgängerisch verhielt sich Durs Grünbein nach 1989. Er reiste und schaute und schrieb. Und 2009, zwei Dekaden später? Den globalen Blick hat er sich erhalten, sorgsam Landschaften und Ozeane ins Auge fassend, philosophische Konstruktionen und deren Architekten, alte und neue Kulturen, Geschichte und überlieferte Bücher, mit Vorliebe die der Antike.
Dieser globale Dichter macht nun aber dem Reisen den Prozess. Denn jetzt sei der Kosmopolitismus in eine kritische Phase getreten. Der globalisierte Verkehr mit den überall gleichen Rollfeldern und Hallen samt bunten Verkaufsflächen erscheint ihm ortlos wie das Inferno (Dante ist bei Grünbein nie weit weg). Dort im Transitraum herrsche Leerzeit. Das mache ein Sprichwort wahr aus den Bars von Atlantis: „Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle.“ So der letzte Vers des Gedichts, das der anschliessende Essay umkreist. Er plädiert für den waghalsigen Aufbruch im eigenen Namen, kommt auf die Schifffahrt zurück und setzt sie dem Airbus entgegen. Die Seefahrer, darunter Odysseus, Jason, Sindbad und spätere Entdecker, gleichen seit alters den Dichtern. Maritime und poetische Vorstellungen pflügen hinein ins Nichts und erhoffen trotzdem ein Ziel.
Am liebsten taucht der Erzähler ab, hinunter in Träume und Meerestiefen – um vorzudringen zum „Bild“ und es zu versenden als Flaschenpost. Diese ist gedacht für den Leser, der zufällig am Strand steht und sie aufbricht. Solch ein Bild geben beispielsweise die Bars von Atlantis ab. Es sind Spelunken auf jener versunkenen Insel, welche schon Platon und die Ägypter auf dem Grund eines unbekannten Meers im Westen vermutet hatten. Der Autor als Träumender betritt eine der seltsamen Gaststätten. Er sieht verblichene Dichter auf Barhockern sitzen, „lauter Berühmtheiten der Weltliteratur“. (Wen er dazurechnet, legt manch andere Textstelle nahe: Homer und Vergil, Dante, Shelley, Baudelaire, T.S. Eliot und Borges, wohl auch Virginia Woolf, Brecht und Heiner Müller.)
Triebgesteuerte Phantasien
Ein solches Bild leuchtet jedem ein. Die Archaik der Imagination verbindet die Menschen über Epochen hinweg, so Grünbeins hochgemute Annahme. Technik, Thesen und Theorien veralten, Bilder aber behalten ihre neugeburtliche Frische. Damit gerät dieser Essay zum Bekenntnis.
Poetische Phantasien sind triebgesteuert. Wenn Thomas Kling die abrupten Alpen in Verse setzte, so zieht es Grünbein zu den umgekehrten Bergen, den wassergefüllten Schlüften der Ozeane. Er ist selber Tiefseetaucher und berichtet faszinierend von seinen ersten Tauchgängen. Er hat sich wohl schon immer gern in gleitende Gehäuse hineingedacht wie etwa in der bekannten und variantenreich wiederkehrenden Strophe im Band Schädelbasislektion:
In einer Schlafmohnkapsel lag ich und träumte
Um meine leere Mitte gerollt, das metaphysische Tier.
Denken in Korrespondenzen
Das Denken in Korrespondenzen, inspiriert von Baudelaires „Correspondances“, zeitigt gerade auch im neuen Buch wunderbar bewegliche und trotzdem überzeugende, weil nicht bloss willkürlich hingesetzte Assoziationen. So wird das geheimnisvolle Atlantis beispielsweise, das erträumte und nie gefundene, heraufbeschworen durch eine versunkene antike Stadt vor der kleinasiatischen Küste. Sie liegt mitten in militärischem Sperrgebiet.
Der Essayist sieht sie von einem türkischen Fischerboot aus und entdeckt beim Schnorcheln die Trümmer Tausender Vasen auf dem Boden des einstigen Hafens. Die alte Geschichte und das Geschichtslose scheinen diesen Schriftsteller gleichermassen zu bannen. Wenn er beides im Ozeanischen festmachen kann, dürfte sein Dichterglück ungetrübt sein.
Beatrice von Matt, Neue Zürcher Zeitung, 15.12.2009
In den Bars von Atlantis endet der Abend nie
In seinem kurzen Essay Die Bars von Atlantis versucht Durs Grünbein, Lyriker und Kenner der Geisteswelt der Antike, zu erläutern, welche Gedanken hinter einer einzigen Zeile seines Gedichtes „Kosmopolit“ standen und stehen. Dazu entfaltet er in 14 kurzen Betrachtungen ein Feuerwerk der Assoziationen. Sie kreisen um die folgenden Themen und Topoi: Die Leere des Transitraumes am Flughafen, Reisen als Vorgeschmack der Hölle, Seefahrt als Inbegriff der Reise, die Ursehnsucht des Menschen nach dem Eintauchen in das unendliche Meer, das im Meer versunkene Atlantis als Chiffre für das Endziel aller Reisen, und schließlich die Bars von Atlantis als der Treffpunkt für alle, die die Reise hinter sich gebracht haben. Nebenbei erfahren wir auch etwas zur Poseidonstadt Paestum und der Tomba del Tuffatore, zum ganz privaten Tauchvergnügen des Dichters, zur Weltflucht des Kapitän Nemo in seiner Nautilus, zu den Tränen des Odysseus, und dass es Dante war, der die Intention von Durs Grünbein in kaum beachteten Versen vorwegnahm, ja, ihm fast schon die Show stahl.
Es ist ein wahres Vergnügen, den von Gedanke zu Gedanke spielerisch fortschreitenden Ausführungen Grünbeins zu folgen, die sich auf höchstem Niveau von Sprache und Bildung bewegen. Wer ihm folgen kann, wird seine ungetrübte Freude daran haben; wer es nicht kann, hat einen Text vor sich, an dem man sich hervorragend abarbeiten kann, um höher zu kommen. Sprache im Sinne Durs Grünbeins ist eben nicht nur ein Sichversenken, sondern auch ein Emportauchen, ein Lesen zwischen den Zeilen, das sich über das Geschriebene erhebt, ein Erwachen aus fremden Lebensräumen, wo das Leben Traum nur heißt.
Aus der Sicht der Atlantisforschung greift Durs Grünbein ein Thema auf, das schon mehrfach bearbeitet wurde, nüchterner und expliziter – und dennoch unreflektierter – etwa bei Ulrich Sonnemann und dessen Frage nach der tiefenpsychologischen Dimension von Atlantis (Atlantis zum Beispiel, 1986).
Es bleibt die trockene Pflicht, auf einige typische Irrtümer im Zusammenhang mit Atlantis hinzuweisen, denen auch Durs Grünbein erlegen ist, damit die Welten von Dichtung und Wahrheit sich nicht auf unglückliche Weise miteinander vermischen: Die Forschung neigt zu der Auffassung, dass König Atlas von Atlantis, ein Sohn des Poseidon, nicht identisch ist mit dem Titan Atlas aus der griechischen Mythologie. Dieser Titan ist es, nach dem das Meer westlich der Säulen des Herakles das Atlantische Meer genannt wurde; als Platon seine Atlantis-Dialoge schrieb, war der Name schon vergeben. Platon hängt sich also keineswegs an den mythologischen Atlas an, sondern ersetzt ihn überraschend und kühn und weit über eine Entmythologisierung hinausgehend durch eine völlig andere Person gleichen Namens! – Etwas ins Auge geht die Verwendung des Begriffs Okeanos im Zusammenhang mit Atlantis. Platon verwendet das Wort Okeanos an keiner Stelle seiner Atlantis-Dialoge, und bei Herodot kann man nachlesen, warum der Mythos vom Okeanos damals in keinem guten Ruf stand; zumal es ja bei Atlantis um Logos und nicht um Mythos geht.
Wohltuend verschont Durs Grünbein seine Leser mit den ewig falschen Vulkanausbrüchen als Ursache für den Untergang von Atlantis, sondern bleibt bei den von Platon genannten Erdbeben. Und ja, auch hierin ist Durs Grünbein beizupflichten: Wer in ein U-Boot steigt, wird Atlantis wohl tatsächlich niemals zu Gesicht bekommen. Doch das zu erläutern würde das Atlantis des Dichters in unzulässiger Weise mit der Frage nach Atlantis als einem realen Ort verknüpfen. Denn in den Bars von Atlantis wird auch dann noch ein Kommen und Gehen herrschen, wenn Platons Atlantis sich als ein realer Ort entpuppt haben wird. Es wäre ja auch schade, wenn Atlantis das gleiche Schicksal wie Troja widerfahren würde: Ein langweiliger Trümmerhaufen am Ende der Zeit, entdeckt bis zur Unkenntlichkeit. Nein, bei Atlantis muss und wird und kann das alles nur ganz anders sein und bleiben!
Thorwald Franke, amazon.de, 9.7.2010
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Wulf Segebrecht: Und blickt in den Schlund
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.1.2010
Durs Grünbein stellt sein Buch Die Bars von Atlantis vor.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Dieser besondere Kreis
– Dankrede zur Aufnahme in den Orden Pour le mérite gehalten am 6.6.2009 vor den Mitgliedern des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste in Berlin. –
„PARENTHESE FÜR OPTIMISTEN“
Wenn Existenz der reine Zufall ist und Existieren
Die Quadratur des Zufalls mittels Atemzügen,
Ein Weiterschreiten jeden Tag ins Unbekannte,
Den Kopf erhoben gegen eine See von Fragen,
Was ist Gewißheit dann, Gelegenheit, Balance?
Woher die Contenance von Kindesbeinen an?
Dies Wenige, das jeder ist und das doch allem
Bedeutung gibt, ein Spektrum, unbekümmert
Um das Davor, Danach, die kurze Auftrittszeit,
Wie das Geschrei des Kakadus im engen Käfig,
Nimm an, es sei auf Luft gebaut, was dann?
Exzentriker der eine wie der andre, allesamt
Sind sie verdammt zur Demut. Wir, wir, wir –
Ist die humane Bußeformel. Veto für Ekstasen.
Nur muß man sich entscheiden, sagt der Denker.
Es gilt zu wählen zwischen Terrorist und Egoist.
Und so dies Leben, eine süße Form der Ignoranz,
Die niemand missen will zunächst, und später,
Wenn sie Routine wird und Konsequenz und Krise,
Ein Rendezvous mit immer neuen zähen Viren,
Braucht es, das durchzustehn, den Virtuosen.
Woher der Richtungssinn, die schwindelfreie
Vertraulichkeit mit jedem neuen Himmelsblau?
Dies Fabulieren und die Herrlichkeit des Selbst –
Wo Existenz doch Zufall ist und so die Chronik
Des Einzelnen, die sich nie deckt mit den Annalen,
Bei allem Charme, den einer hingibt rein für nichts.
Bitte verzeihen Sie mir, daß ich gleichsam mit der Tür in dieses hohe Haus fiel: mit einem Gedicht. Wie aber könnte ich mich besser bei Ihnen einführen als mit einem Beispiel für jene Kunstausübung, derentwegen Sie (oder einige von Ihnen) mich in diesen besonderen Kreis aufzunehmen beschlossen. „Wenn Existenz ein Zufall ist…“ sagt das Gedicht, und es klingt, als wollte es darauf wie auf eine These pochen. Ich kann mir denken, nicht wenige von Ihnen, vor allem die Naturwissenschaftler, werden schon hier leise Einspruch erheben. Zufall? War das nicht jenes Gespenst, das wir seit langem mit allerlei Kausalitäten und Determinismen ausgetrieben haben? Für den Fall seiner Wiederkehr liegt ein Netz aus Naturgesetzen bereit. Reden wir aber einmal nicht von Genom und Neuron und biologischer Funktion – hier scheinen die Dinge einigermaßen klar zu liegen, in einem neuen, gleißenden Licht. Reden wir von dem, was das Leben selbst einem an Schockmomenten bereithält, das Leben, verstanden als dieser unförmige Gabensack, der so früh über dem Kopf des kleinen Kindes entleert wird. Und da ist dann allerdings manches dabei, das einem lebenslänglich zu schaffen machen kann – von dem geographischen Ort, an dem man aufwuchs, über den historischen Schlamassel, in den man hineingeriet (ohne persönliches Verschulden), bis zu dem verworrenen Familienroman der eigenen Sippe und dem der Nation, jener dickleibigen Schwarte, die man nie auslesen wird, mehr Potpourri als Epos.
Da war es denn die Philosophie, als Tradition voraussetzungslosen Denkens, des Selberdenkens zumal, die einem Wege wies aus dem Festgelegtsein. Es war die Philosophie, die mich den Zweifel lehrte, den systematischen Zweifel, die Zerstörung aller Gewohnheiten und Gewißheiten. Das Gift der Philosophie hat sofort gewirkt: Ich hatte keine Lust mehr, bescheiden zu sein – geistig bescheiden in den Grenzen der Kunst, die eine Beschäftigung für die Dekorateure war, die Schönredner und Luftakrobaten. Bald darauf aber kam die zweite Enttäuschung: die Begriffe waren alle schon vergeben, ich sollte sie nur noch auswendig lernen. Das, was man das Reale genannt hat, war philosophisch aufgeteilt in eine Konstellation von Wahrheit, Sein und Subjekt und längst an den Fixsternhimmel versetzt. Man sollte nur noch die Sternkarten lesen lernen. Der Künstler aber braucht Autonomie, eine Gegenposition, und diese fand sich erst auf dem schwankenden Boden der Poesie. Mir konnte, das stellte sich nach Jahren der Suche heraus, bei der Deutung dieser beinahe deutungsresistenten, unendlich mühevoll zu bestimmenden, zufallsbedingten Existenz nur die tägliche Versarbeit helfen. Sie allein schützte vor der Übermacht des Realen und des Banalen, Vor der bloßen Zirkulation nichtiger Aktualitäten, vor dem Geschiebe der Negationen, in denen der Einzelne sich aufreibt und aufgerieben wird.
Einer meiner namhaften Vorgänger hier, der Dichter T.S. Eliot, ein Grande in unserem Fach, hat die Behauptung aufgestellt:
Poetry doesn’t matter
Es hat ein Weilchen gebraucht, aber heute würde ich dem widersprechen. Privat und in aller Bescheidenheit, nicht gerade mit der donnernden Gegen-Behauptung:
Ein Volk, das keinen Dichter mehr hat, ist am Ende schon tot und leer…
Ein anderer sprach so, Gottfried Benn, einer, dem die Tore zu diesem liberalen Orden sicher auf lange verschlossen geblieben wären, aus naheliegenden Gründen. Das war im vorigen Jahrhundert, als es hoch herging und vieles noch absolut und für immer gültig sein sollte.
Nun sind wir in einem Zeitalter angelangt, das von sich glaubt, ganz andere Sorgen zu haben als die Lehren der Poesie. Ökonomische Sorgen, Religionszugehörigkeitssorgen, Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft, um die staatliche Fürsorge oder ganz allgemein Zukunftssorgen. Bekanntlich ist die Sorge jene Person, die als letzte den rauschenden Ball des Kapitalismus betritt. In Goethes Faust – Der Tragödie Zweiter Teil schleicht sie sich als einziges der vier grauen Weiber im fünften Akt durchs Schlüsselloch ein, um Mitternacht, als der große Unternehmer am Ende seiner Projekte angelangt ist. Dann kommt sie und bläst ihm das Augenlicht aus.
Die Menschen sind im ganzen Leben blind,
Nun, Fauste, werde dus am Ende!
Das ist ein Satz, den nur Dichtung so punktgenau hat setzen können. Solche brutale Erkenntnis, tröstlich allein durch ihre hohe sprachliche Form: das ist es, was ich mir unter Poesie immer vorgestellt habe. Sie scheint also doch eine gewisse Rolle zu spielen, und mehr als nur eine Rolle, wenn man ihr genau genug zuhört.
Das wußte natürlich auch Eliot, der als Schüler des Philosophen Santayana die Vitalfunktion dichterischer Sprache gut kannte. Der Verfasser des Waste Land wäre psychisch verloren gewesen ohne die rettende Ausdruckskraft seiner englischen Verse, ihrer Feier des Lebens noch im Abgesang auf die Zivilisation. Was immer der alte Fuchs mit seinem Spruch auch sagen wollte, wir können ihm widersprechen.
Auch ich habe genügend Gegenbeweise gesammelt. Denn Poesie hat buchstäblich mein Leben verändert, indem sie mir eine Anleitung zur sinnvollen Verwendung meiner Lebenszeit gab. Poesie hat mich gerettet aus ideologischem Wirrwarr und moralischem Stumpfsinn. Sie hat mich gleichzeitig immun und neugierig gemacht. Immun gegen jedes Heilsversprechen auf Kosten des zerbrechlichen Menschen, neugierig auf alle Wissensformen und die verschlungenen Wege der Empfindsamkeit, die der rastlose Mensch sich erfindet. Die Poesie hat mich Hochachtung gelehrt vor den wahren Errungenschaften der Wissenschaft, und sie hat mich zuletzt auch wieder in die Nähe der Philosophie gebracht. Ich verdanke ihr alles, was ich bin, und das meiste, was ich liebe – und wenn ich es mir recht überlege, sogar meine Frau. Ich möchte nicht wissen, wie anders alles gekommen wäre ohne die Liebe zur Literatur, die unsere Aufmerksamkeit füreinander weckte. Und nun hat die alte Wünschelrute mich zu meiner großen Überraschung auch noch hierher gebracht, in Ihre Mitte, liebe Ordensmitglieder. Muß ich wirklich noch weitergrübeln über den Nutzen der Poesie?
Nur ein letztes Wort noch in eigener Sache. Dichtung ist, wie ich fest glaube, nicht nur Spielzeug und süßer Zeitvertreib. Sie ist, wenn sie so ernst genommen wird wie von den Großen unserer Zunft, eine Methode, eine Anleitung zum genauen Denken und Fühlen. Sie beschäftigt sich mit den Grundlagen der Einbildungskraft, ohne die es keine Wissenschaft gäbe. Bei der Verteidigung der Anschauung sind die Dichter allen anderen vorangegangen, damals in Griechenland, lange bevor Platon sie seiner kritischen Prüfung unterzog. Mag sein, daß sie heute in vieler Hinsicht abgehängt sind, weil die Schwerpunkte sich verlagert haben und die Menschheit als ganze umgeschaltet hat vom Kunstmachen auf Erkennenwollen, von Artistentum auf Technik und Information. Dichtung kann allerdings nur überleben, wenn sie sich gegen alle welt anschaulichen, religiösen, pragmatischen oder sonstigen Zumutungen wehrt. Ihre Integrität beruht darauf, daß sie möglichst wenige Zugeständnisse an den bloß kommunikativen Sprachgebrauch macht. Ihr Ziel ist es, die Sprache in einen Traumzustand zu versetzen. Der Dichter ist ein Beobachter. Ihn faszinieren Tendenzen, offene oder verborgene, tektonische Verschiebungen im Geistigen wie im Sozialen, kollektive Bewegungen, die unaufhaltsam sind und alles verändern. Sein elegisches Bewußtsein rechnet mit den Krisen und Katastrophen der umwälzungswütigen Menschheit und ihrer Geschichte. Dies mag eine weitere Zeile aus dem eingangs zitierten Gedicht erklären. Es gelte zu wählen zwischen Egoist und Terrorist, hieß es da. Die Formel stammt von dem französischen Philosophen Roland Barthes, ich fand sie in einer Vorlesungsmitschrift. Sie spricht nur unverblümt aus, was in unserer Zeit des erzwungenen globalen Zusammenlebens mehr denn je gilt. Entweder arbeitet der Mensch an der Singularität seiner Existenz, deren Erträge er den anderen zur Verfügung stellt, und wären sie noch so bescheiden, wie die des Künstlers es meist sind. Oder er maßt sich im Namen der Kollektive und ihrer wechselnden Politik die Rolle des Hauptakteurs an – und wird zur Schreckensgestalt, die nicht nur die eigene, sondern auch viele andere Existenzen auszulöschen gewillt ist. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Es gibt Ehrungen, die lassen den Geehrten verstummen, und andere, die verführen ihn zum Tirilieren. Diese hier gehört, wie ich ahne, zur ersten Kategorie. Ich wundere mich über mich selbst, wie ich hier so ohne weiteres zu Ihnen sprechen kann. Es hat etwas Zwiespältiges für jemanden, der sich als höchst lebendig empfindet, wenn Wohlgesonnene ihm aus gegebenem Anlaß zur Heiligsprechung gratulieren. Das geschärfte Dichterohr ist dazu verdammt, aus allem den Satirenton herauszuhören. Wenn ich also eingangs in Versen zu reden begann, so geschah dies aus reiner Notwehr: ich wollte die Karten gleich auf den Tisch legen, mich in meiner Nacktheit zeigen, in der Zufälligkeit meiner Existenz. Über das Lächerliche der meisten Ehrungen ist viel gesagt worden, zuletzt noch einmal von dem österreichischen Verbalradikalisten Thomas Bernhard. Man kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus, wenn man die Eitelkeiten der Menschen bedenkt – vor allem die eigenen, das wußte auch er. Der Traum vom Ritterschlag aber, der alle Ehrungen ratifiziert, indem er sie gleichsam summarisch aufhebt, dieser Traum dürfte keinem Künstler ganz fremd sein. Mit dem Orden Pour le Mérite kommt man seiner Verwirklichung gefährlich nahe. Ich bin noch nie einem Orden beigetreten. Insofern beschert mir der heutige Tag eine Premiere. Und wie in jede neue Erfahrung, stürze ich mich nun auch in diese Hals über Kopf, mit einem Gefühl von Verschwörertum und Sinn für Geheimlogenzauber. Wer weiß, wie mir geschieht, wenn ich mich erst mit einigen der hier Anwesenden ins Gespräch vertiefe. Ich rechne doch sehr mit dem Austausch von Betriebsgeheimnissen. Ich darf bei dieser Gelegenheit auch andeuten, wie arbeitsnotwendig mir immer das Wissen der Naturwissenschaftler war, wie viel ich den Ansichten der Historiker, Archäologen und Philologen verdanke, wie beschränkt bloße Wortkunst bliebe, würden dem Autor nicht in den Museen, Galerien und Kinos die Augen geöffnet und im Konzertsaal die Ohren.
Durs Grünbein, Sinn und Form, Heft 3, Mai/Juni 2010
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook + KLG + IMDb + PIA + ÖM + IZA + Archiv + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + deutsche FOTOTHEK + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein bei Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


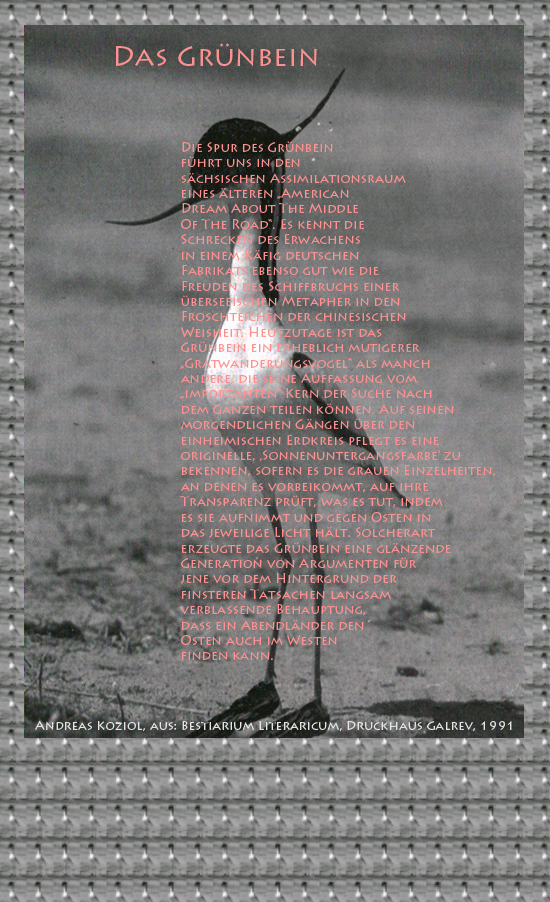
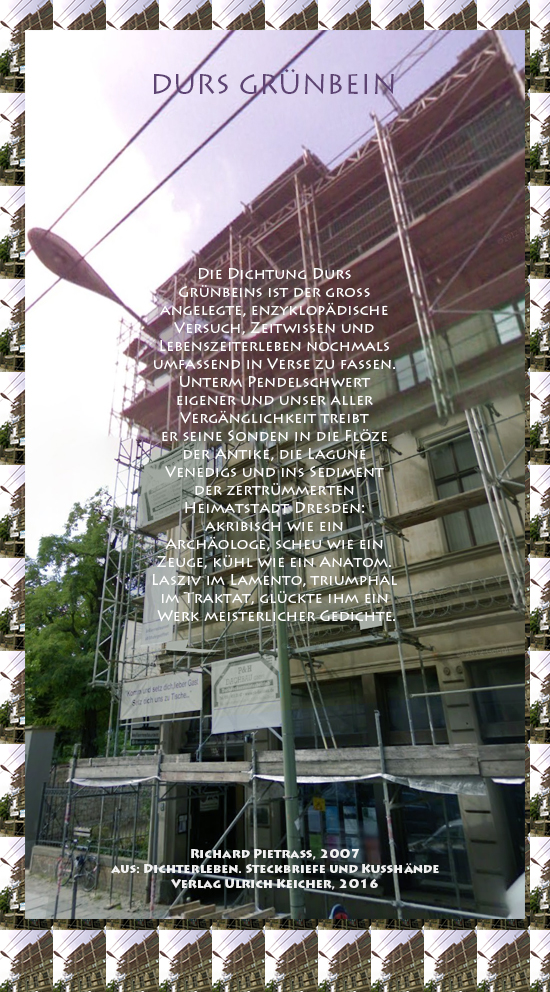












0 Kommentare