DAS TAGEBUCH DER KRANKHEIT
Das Frühjahr 1960 war besonders schön und verheißungsvoll. Boris Pasternak, gerade siebzig geworden, schien jünger, kraftvoller, strahlender, zuversichtlicher, arbeitsfroher und ausgelassener denn je. Augenzwinkernd zitierte er den berühmten Freund der Familie Pasternak – Leo Tolstoi – mit dem Satz:
Man muß das Leben lieben!
Zu Ostern empfing er eine Besucherin: Frau Renata Schweitzer aus Berlin-Lankwitz. Sie schwärmte für den Dichter aus Peredelkino, ja, sie himmelte ihn an. Boris Pasternak, nicht frei von männlicher Eitelkeit und keineswegs unempfänglich für weibliche Reize, war von fast jungenhafter Ausgelassenheit. In der Datscha von Olga Iwinskaja trank man zu dritt eine Flasche „Martell“-Cognac.
Am Tage nach Ostern fühlte sich Boris Pasternak matt und elend. Renata Schweitzer reiste wieder ab. Am Samstag, dem 23. April 1960, begann Pasternak sein Krankentagebuch zu schreiben. Auf grauen Manuskriptblättern im DIN-A4-Format. Immer zwanzig Zeilen auf jeder Seite, mit Bleistift geschrieben, in großer, raumgreifender, schwungvoller Handschrift.
Samstag, 23. April 1960: Ich fühle mich sehr matt und müde. Das Herz macht mir Beschwerden, und der Rücken schmerzt sehr. Ich glaube, ich habe mir über Ostern doch ein wenig zuviel zugemutet. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Das Stehen an meinem Arbeitspult ermüdet mich sehr. Ich muß die Arbeit an meinem Drama wohl unterbrechen. Der linke Arm fühlt sich wie lahm an. Ich werde mich hinlegen müssen. Da fällt mir ein: Ich hatte einem Freund versprochen, ihn heute abend zu besuchen. Vielleicht sollte ich telefonieren und ihm absagen? Aber dann müßte ich aus dem Hause gehen. (Anmerkung: Pasternak hatte kein Telefon im Hause.) Ich werde ihm lieber ein paar Zeilen schicken – durch einen Boten – und ihn bitten, mich heute abend zu entschuldigen und ein wenig Geduld zu haben…
Montag, 25. April 1960: Heute abend will der Arzt kommen, Ich bin gespannt, was er sagt. Wahrscheinlich ist es wieder eine Nervenentzündung. Auf den Beinen zu stehen macht mir immer noch große Mühe. Ich bringe es nicht einmal fertig, mich zu rasieren.
Das war die Eintragung am Morgen. Abends notierte Pasternak:
Der Arzt war da. Er meint, daß es das Herz ist, und hat mir strenge Bettruhe verordnet. Ich glaube nicht recht daran. Es wird wohl wieder eine Nervenentzündung sein, wie ich sie schon vor anderthalb Jahren einmal hatte. Die linke Körperseite ist schwer wie Blei. Der Rücken tut sehr weh. Ich habe starke Schmerzen.
Mittwoch, 27. April 1960: Es geht mir etwas besser. Ich werde nachher ein wenig aufstehen und zum Telefon gehen. Man hat ein Kardiogramm gemacht. Es zeigt nichts Beunruhigendes. Es wird wohl alles wieder vorübergehen.
Samstag, 30. April 1960: Ich bin aus dem ersten Stock ins Erdgeschoß umgezogen und habe mein Bett im Arbeitszimmer aufstellen lassen. Das Treppensteigen macht mir zuviel Mühe. Ein herrlicher Frühling draußen! Wie die Vögel im Garten singen! Ich fühle mich immer noch nicht stark genug, um wieder meine Freunde besuchen zu können. Wir haben ein neues Auto gekauft, einen „Wolga“-Wagen. Ich bin immer noch sehr schwach in den Knien. Der Arzt war wieder da. Er bleibt bei seiner Diagnose.
Montag, 2. Mai 1960: Heute traf Post aus Deutschland ein. Unser Freund H. S. schreibt, daß er später kommt, als geplant war. Ich werde seine Grüße weitergeben. Falls es mir schlechter gehen sollte, wünsche ich, daß man meine Freunde zu mir ruft…
Donnerstag, 5. Mai 1960: Heute fühle ich mich bedeutend besser…
Das war Boris Pasternaks letzte Eintragung in seinem Krankentagebuch. Am Abend dieses Tages nahm er ohne fremde Hilfe ein Kopfbad. Dabei muß er sich wohl überanstrengt haben. Achtundvierzig Stunden später – in der Nacht vom 7. zum 8. Mai 1960 – erlitt er einen Herzinfarkt. Nun konnte er nicht mehr aufstehen. Von nun an war ständig ein Arzt im Hause Nr. 3 an der Pawlenko-Allee. Fünf Krankenschwestern aus dem besten Hospital Moskaus, der Kreml-Klinik, wurden für ihn freigestellt. Niemand durfte mehr zu ihm. Selbst seine Frau Sinaida und seine beiden Söhne Ewgenij und Leonid durften ihn jeweils nur für kurze Augenblicke sehen.
Krankenschwester Marina Borissowna war in diesen Tagen Pasternaks Lieblingspflegerin. Sie war klein und zierlich – nur 1,45 Meter groß –, aber mit großem Mut und letzter Aufopferung. Unerbittlich verteidigte sie die Ruhe ihres Patienten. Einmal klopfte es an der Tür. Draußen stand ein hünenhafter Mann, den Schwester Marina nicht kannte. Da Boris Pasternak gerade schlief, wies sie den Besucher energisch zurück, ohne ihn zu Wort kommen zu lassen. Später erfuhr sie, wer dieses Gast war: einer der berühmtesten und mächtigsten Chefärzte Moskaus. Gehorsam wartete der Professor, bis Schwester Marina erlaubte, seine Visite am Krankenbett zu machen. Die blonde Marina war noch jung. In der Kreml-Klinik war sie erst seit drei Jahren tätig.
Als Boris Pasternak fühlte, daß er krank wurde, packte er 170 Manuskriptseiten eigenhändig in dickes braunes Packpapier. Er schickte das Paket an Olga Iwinskaja. Das Drama Die blinde Schönheit sollte unvollendet bleiben.
Die Diagnose der Ärzte war ein Todesurteil: Lungen- und Magenkrebs.
Am 30. Mai 1960 starb Boris Leonidowitsch Pasternak in seinem Hause in Peredelkino. In den letzten Tagen seines Lebens war er nur noch zeitweilig bei Bewußtsein.
Seine Freunde hat er nicht mehr gesehen.
TOD UND BEGRÄBNIS
Die Krankheit kam überraschend. Zehn Wochen, nachdem er voll Vitalität, Schaffensfreude und betonter Jugendlichkeit seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte. Alle Zeichen des Alters und der Vergänglichkeit hatte Boris Pasternak immer zu unterdrücken versucht. Er überspielte sie – vor sich selber und seiner Umgebung. Strahlend, optimistisch, federnd, elastisch, jungenhaft fröhlich – so ist er mir in Erinnerung geblieben.
Ich war gerade nicht in Moskau, als er krank wurde. Ein Telegramm von Olga Wsewolodowna Iwinskaja alarmierte mich in Hamburg. Als ich in Moskau eintraf, durfte außer seinen engsten Angehörigen schon niemand mehr zu ihm. Dennoch ließ er uns täglich Zeichen und Nachrichten zukommen.
Ein bestimmtes Medikament wurde gewünscht. Von ihm erhofften sich die Ärzte noch eine Wendung des Krankheitsverlaufes. Doch die Medizin gab es nicht in der Sowjetunion. Es gab sie nur in Westeuropa. Ich telefonierte, alarmierte, drängte zur Eile. Die Arznei kam dann per Flugzeug. Doch als man mich vom Zollamt des Flughafens Scheremetjewo anrief, war es zu spät. Boris Leonidowitsch Pasternak war tot.
Uns traf es wie ein Keulenschlag. Wir, seine Freunde, waren wie gelähmt, unfähig, etwas zu tun oder zu denken. So ähnlich muß den Jüngern Jesu zumute gewesen sein, als ihr Herr und Meister gestorben war. Verwirrung. Schock. Angst.
Von allen Begegnungen und Gesprächen mit Boris Pasternak habe ich mir unmittelbar hinterher aus frischer Erinnerung ein Gedächtnisprotokoll gemacht. Als ich jetzt meine Aufzeichnungen durchsah, stellte ich fest: Von der Beerdigung am 2. Juni 1960 gibt es keine Notizen. Ich staune selber darüber. Aber offenbar war ich in jenen Tagen und Stunden unfähig, das gewohnte System der schriftlichen Memoranden einzuhalten.
So muß ich mich – vierzehn Jahre danach – allein auf meine Erinnerung verlassen, wenn ich nun versuche, die Beerdigung in Peredelkino zu schildern:
Es war ein drückend heißer Sommer. Tag und Stunde der Beerdigung waren in keiner Zeitung veröffentlicht worden. Dennoch waren über dreitausend Menschen gekommen, dem Dichter von Peredelkino das Geleit zu geben. Ein endloser Strom von Trauernden zog durch das Haus an der Pawlenko-Allee Nr. 3. Swatoslav Richter spielte Melodien von Rachmaninow, Tschaikowski, Schubert, Chopin. Richter und Pasternak waren Freunde gewesen.
Kerzen brannten. Es roch nach Thymian. Der Tote war im Balkonzimmer aufgebahrt. An ihm vorbei schob sich – Schritt vor Schritt – die Menge der Trauergäste. Sie brachten Blumen, Berge von Blumen. Maiglöckchen, Flieder, Tulpen, Rosen, Veilchen, Narzissen.
Dieser 2. Juni 1960 war ein Tag, wie er auf der ersten Seite des Romans Doktor Schiwago von Boris Pasternak selbst geschildert wird: Drückende Schwüle. Stickig und schwer die Luft. Dräuende Gewitter. Ein Tag wie jener, an dem Jurij Schiwago in der Enge einer vollbesetzten Moskauer Straßenbahn plötzlich keine Luft mehr bekommt, vergeblich versucht, ein Fenster aufzureißen und den Hemdkragen zu öffnen, ehe ein Herzschlag seinem Leben ein Ende setzt.
Kurz nach 16 Uhr Moskauer Zeit trug man Boris Pasternak im offenen Sarg aus seinem Haus. Seine beiden Söhne trugen ihn – Ewgenij und Leonid – und die engsten Freunde der Familie Pasternak, darunter auch Andrej Sinjawskij, der Dichter, dem die bitteren Jahre im Straf- und Umerziehungslager Potma in Mordwinien noch bevorstanden.
Hoch über den Köpfen einer inzwischen auf fünftausend Menschen angewachsenen Menge wogte der markante Kopf wie eine erloschene Boje in aufgewühlter See. Über die kleine baufällige Brücke des Setun ging der Trauerzug zum Friedhof, vorbei am „Haus des Schriftstellers“. Ein Gewitter braute sich zusammen. Konstantin Paustowskij, der sich in der Zeit der wütendsten Angriffe gegen Boris Pasternak, als man ihn einen „Volksfeind“ und „Verräter“ nannte, stets mutig zu ihm bekannt hatte, wollte die Grabrede halten. Doch dann sprach an seiner Stelle der Literaturprofessor Asmus. Heimliche Regisseure schienen bestrebt zu sein, die Trauerfeier auf dem Friedhof möglichst abzukürzen.
Professor Asmus sprach aus dem Stegreif. Er sagte:
Ein großer russischer Dichter und Schriftsteller ist von uns gegangen. Vielleicht einer der größten und bedeutendsten, die unser Land je gehabt hat. Boris Pasternak hat die Epoche, in der er lebte, mit seinen eigenen Augen gesehen. Er hat sich den Blickwinkel nicht vorschreiben lassen. So wie einst auch Leo Tolstoj sich nichts hat vorschreiben lassen. Boris Pasternak war ein Demokrat im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat wohl selten einen Dichter gegeben, der so unerbittlich gegen sich selbst war, wenn er an eine künstlerische Aufgabe heranging. Er wollte die Wahrheit, und er liebte die Mühe. Sein Leben war 70 Jahre lang, aber es ist dennoch zu schnell verflogen…
Jemand sprach ein Gedicht von Boris Pasternak. Die „Regisseure“ drängten zur Eile. Schon sollte der Deckel auf den Sarg gelegt werden. Da sprang einer aus der Menge vor, stellte sich auf den Hügel der neben dem offenen Grabe aufgeworfenen Friedhofserde. Es war ein Mann in den mittleren Jahren. Schütteres Haar. Ein offenes, mutiges Gesicht. Das buntkarierte Hemd stand ihm am Halse weit offen. Für eine Beerdigung war er nicht gerade korrekt angezogen. Aber er hielt eine Grabrede, wie sie sich der ausgestoßene Dichter von Peredelkino schöner nicht hätte wünschen können: „Fahr wohl, verehrter Boris Leonidowitsch“, rief dieser Mann laut und vernehmlich über den Hang des Dorffriedhofes hinweg, „wir kennen nicht alle deine Werke, die du geschrieben hast. Aber der Tag wird kommen, wo wir sie alle kennenlernen werden. Das schwören wir dir in dieser Stunde…“
Der Pfiff einer Elektrolok zerriß die Abschiedsworte des Unbekannten. Hastig wurde der Sarg in die Grube gesenkt. Er mußte am anderen Tag wieder ausgegraben und umgebettet werden. Man hatte in der Eile und Aufregung den toten Dichter am Hang mit dem Kopf talwärts begraben…
Ein Brief an Feltrinelli
Editore
Giangiacomo Feltrinelli
Milano
Via Andegari 6
Moskau/Hotel Berlin/516
6. Juni 1960
Lieber Giangiacomo,
da sitze ich nun und weiß nicht, wie ich beginnen soll. Es ist alles so plötzlich gekommen. Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Ich kann noch nicht glauben, daß er nie mehr den kleinen Hügel zu unserer Datscha hinauf gestürmt kommt, nie mehr mit uns genießerisch ein Glas „Martell“-Cognac trinken wird, den er den „Nektar des Himmels“ nannte, sich nie mehr über unsere Geschenke freuen kann, nie mehr… Es ist auf einmal so leer geworden ohne ihn. Ich wußte das vorher nicht, ahnte es nicht. Ahnte auch nicht, daß ich ihn einmal so sehr vermissen würde.
Nun habe ich ihm nur noch einen schönen Kranz auf sein Grab legen können. Es war ein ergreifendes Begräbnis. Ich habe keine Aufnahmen gemacht. Ich konnte es nicht. Ich war den ganzen Tag wie gelähmt und bin heute noch nicht richtig wieder mobil.
Jetzt müssen wir wohl alle freundschaftlich und fair zusammenstehen, damit wir nur das tun, was in seinem Sinne ist. Zwei Dinge – so scheint mir – sollten dabei vor allem beachtet werden:
1. Es darf kein Skandal (Prozeß oder Zivilstreit oder ähnliches) entstehen, der seinem Andenken schaden könnte. Es muß in allen Fragen ein Weg gefunden werden, sich gütlich zu einigen, so wie er es immer gewünscht hat.
2. Es darf nichts geschehen, was die Freiheit, Sicherheit und Existenz von Frau Olga gefährden könnte. Sie ist nach dem Willen von Boris Leonidowitsch die literarische Alleinerbin und alleinige Bevollmächtigte seines Auslandsvermögens. Das weiß ich. Und das kann ich auch bezeugen. Boris Leonidowitsch hat noch am 15. April 1960, eine Woche vor Beginn seiner Krankheit, eine entsprechende Vollmacht für Frau Olga ausgestellt. Sie ist in drei Sprachen ausgefertigt und soll Ihnen auf dem Wege über Sergio d’Angelas Freunde noch im Laufe dieses Monats zugestellt werden.
Mit gleicher Post übersende ich Ihnen einen Brief von Frau Olga und eine Übersetzung, die ich davon gemacht habe. Sie werden daraus alles ersehen.
Zu dem Drama, das leider nur zur Hälfte fertig geworden ist, muß ich Ihnen ergänzend noch folgendes sagen: Die Urschrift liegt bei Frau Olga. Sie hat aber schon einige Abschriften gemacht. Wir wollen versuchen, eine Kopie davon an sicherer Stelle im Ausland zu deponieren. Vorläufig darf jedoch davon noch nichts veröffentlicht werden! Der Staatssicherheitsdienst ist scharf dahinter her. Sie haben bereits Frau Olga bedrängt, als Boris Leonidowitsch noch gar nicht unter der Erde war. Ich habe ihr geraten, den Leuten eine Abschrift zu geben, denn sonst werden sie doch keine Ruhe lassen. Diese Kopie wird morgen, Dienstag, den 7. Juni 1960, einem hohen Vertreter des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes in Moskau übergeben werden. Es war der Wunsch von Boris Leonidowitsch, daß dieses neue Werk zunächst in Moskau dem Staatsverlag vorgelegt wird. So soll es auch geschehen. Wir hoffen, daß die Vernunft diesmal siegt und man sich entschließt, das Fragment zu veröffentlichen. Dann stünde – in angemessenem Zeitabstand – einem Nachdruck bei Ihnen wohl nichts im Wege, und niemand auf dieser Seite würde gefährdet sein. Seien Sie sicher, daß niemand außer Ihnen im Westen eine Kopie des Manuskriptes erhalten wird.
Die Urschrift soll auf jeden Fall in den Händen von Frau Olga bleiben. Ich habe ihr gesagt, daß auch alles andere, was Boris Leonidowitsch jemals in seinem Leben geschrieben hat, jetzt ein wichtiges Stück der Weltliteratur geworden ist. Sie hat alles gesammelt, alle seine Briefe und Notizen. Hoffentlich bleibt es uns erhalten! Wir fürchten allerdings, daß irgendwelche Stellen hier in Moskau eventuell mit harter Hand zufassen könnten. Jedenfalls sollten wir unsererseits so vorsichtig und so korrekt wie möglich sein. Ich bin überzeugt, daß Boris Leonidowitsch es uns nie verzeihen würde, wenn wir durch Ungeduld, Unvorsichtigkeit oder Eigennutz Frau Olga in Gefahr bringen würden.
Alles Weitere ersehen Sie aus dem Brief von Frau Olga. Mit herzlichen Grüßen für Sie und Inge
Ihr Heinz Schewe
Frau Olgas Brief an Feltrinelli
Lieber, lieber Giangiacomo!
Sie wissen schon von unserem schrecklichen Kummer. Mein geliebter Boris ist nicht mehr. Zwei Tage sind erst vergangen, seitdem man ihn begraben hat, und schon muß ich Ihnen einen Brief schreiben, der nicht nur persönlicher, sondern auch geschäftlicher Natur ist. Es ist alles sehr dringend, und wir haben Angst, damit zu warten.
Im April, als Boris sich ausschließlich seinem Drama widmen wollte und sich schon irgendwie schwach fühlte, hat er mir für Sie eine Vollmacht geschrieben. Darin steht, daß er wünscht, daß meine Unterschrift genauso gelten soll, als habe er persönlich unterschrieben, sei es nun unter Abmachungen finanzieller Natur oder unter irgendwelchen anderen Schriftstücken, die von ihm und über uns ausgingen. Die Vollmacht ist in russischer und französischer Sprache ausgestellt. Sie wurde noch vor der Rückkehr von Heinz Schewe nach Moskau den Freunden von Sergio d’Angelo übergeben, die sie Ihnen persönlich überbringen sollen.
Wenn Ihnen auch nach dem Tode von Boris sein Wille heilig ist, so betrachten Sie, bitte, mich als seine Bevollmächtigte, die es als ihre Pflicht ansieht, seinen letzten Willen zu erfüllen. Ich bitte Sie, mir zu glauben und zu vertrauen, wenn ich Sie nun mit meinen Plänen vertraut mache.
Zuallererst möchte ich Sie bitten, Ihrerseits Herrn Heinz Schewe als meinen Bevollmächtigten anzusehen. Durch ihn sende ich Ihnen – auch auf Wunsch von Boris – die Urschriften, die er Ihnen zu gegebener Zeit zum Abdruck aushändigen wird. Es handelt sich dabei um die Urschrift des Romans Doktor Schiwago, um Archivmaterial, das ich in nächster Zeit ordnen will, und um das Drama Die blinde Schönheit. Die Dinge sind hier sehr schwierig. Wir müssen sehr vorsichtig sein.
Im Hinblick auf Mme. Pr. (Anmerkung: gemeint ist Madame Jacqueline de Proyart) halte ich Schriftstücke in Händen, die es ermöglichen, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu beenden.
Falls Sie die letzte Vollmacht, die Boris auf meinen Namen ausgestellt hat, als gültig anerkennen, wird auch Mme. Pr. damit einverstanden sein müssen. Dann entwerfen Sie, bitte, einen Text, wie wir mit ihr verfahren wollen. Ich werde unterschreiben.
Wir müssen die Wünsche und den Willen von Boris nach seinem Tode genauso gründlich ausführen, als ob er noch am Leben wäre.
Da sind zunächst die Geldüberweisungen, die Sie nach seinem Wunsch an seine Freunde schicken sollen, die ihm geholfen und sein Leben verschönert haben… Sobald ich Ihre Antwort erhalten habe, in dem Sie mir bestätigen, daß Sie mich als Bevollmächtigte anerkennen, kann ich Ihnen auch jenen Vertrag zusenden, den Boris Leonidowitsch noch zu seinen Lebzeiten unterschrieben hat und der eine gütliche Lösung mit Mme. Pr. vorsieht. Es wäre gut, wenn Sie ihr ein bestimmtes Arbeitsfeld einräumen könnten. Das wäre auch im Sinne von Boris Leonidowitsch. Schicken Sie Ihre Briefe, bitte, nur über Heinz Schewe. Und denken Sie immer daran, daß Unvorsichtigkeit uns alle ins Verderben stürzen kann…
Ich habe vor, mich im Juli irgendwo in die Einsamkeit zurückzuziehen, um das Archivmaterial zu sichten. Heinz Schewe, der die hiesigen Umstände kennt, billigt meinen Plan.
Auf Wiedersehen, lieber Freund!
Ihre O. Iwinskaja
PS: Es ist durchaus möglich, daß irgendwelche Verwandte von Boris Leonidowitsch, die im Westen leben, bei Ihnen gewisse Ansprüche anmelden. Vielleicht seine Schwester in England… Sollte sich daraus ein Konflikt ergeben, so finden Sie mich auf Ihrer Seite. Die Familie P. (Anmerkung: gemeint ist die Familie Pasternak) hat keine Vollmachten für die Verlagsrechte an seinen Werken. Die letzte Vollmacht dieser Art ist jene Erklärung, von der ich Ihnen soeben berichtet habe.
Nochmals – Auf Wiedersehen!
Ihre Olga
Peredelkino, 5. Juni 1960
Besuch bei Boris Pasternak – September 1957
„Haben Sie die neuesten Gedichte von Pasternak gelesen?“ fragte mich einer meiner russischen Kommilitonen an der Universität Moskau, wo ich mich wieder einmal aufhielt.
Sehr sonderbar, er ist von religiösen Themen inspiriert worden – Eva, Maria Magdalena, Gethsemane… Wie verwirrend und paradox ist das in unserer Zeit! Aber am erstaunlichsten ist es, daß er es wagt, sie in einer einfachen und gewöhnlichen Sprache zu behandeln, gewissermaßen in einer Laiensprache. Ich persönlich hätte gedacht, man könnte von diesen Dingen nur im alten Kirchenslawisch sprechen. Das ist ein bemerkenswerter Zug in der Geschichte unserer Literatur.
Hierauf sprach er mir einige dieser Gedichte vor, die ich hervorragend fand. Er versprach dann, mir eine der maschinengeschriebenen Kopien zu beschaffen, die in großer Zahl in den Studentenkreisen herumgingen. Offenbar war es ausgeschlossen, sie gedruckt im Buchhandel zu finden. Welche Zensur hätte sie durchgelassen?
Er hielt sein Versprechen, und ich konnte sie in Muße lesen. Ergriffen schrieb ich auf der Stelle an Pasternak und fragte ihn, ob er mir eine Unterredung gewähren könnte.
Ein paar Tage später antwortete er mir und forderte mich auf, in sein Haus nach Peredelkino zu kommen, etwa dreißig Kilometer von Moskau entfernt.
Hier fand mein erster Eindruck seine Bestätigung. Pasternak empfing mich mit außerordentlicher Liebenswürdigkeit. Er führte mich in sein Arbeitszimmer, einen großen, ziemlich kahlen Raum – fast keine Möbelstücke, wenige Bücher auf den Regalen. Das goldene Septemberlicht flutete durch ein großes Fenster herein. Während mehrerer Stunden war ich im Bann seiner Worte.
Zu meiner Freude sah ich ihn in der Folge oft wieder, und ich wußte seine herzliche Gastfreundschaft immer mehr zu schätzen. Jedesmal entdeckte ich ihn von neuem, ihn und die Menschen, die ihn umgaben, und die sich auch stets sehr entgegenkommend zeigten. Ich traf bei ihm etliche seiner Freunde und Kollegen: Konstantin Fedin und Wsewolod Iwanow, zwei begabte, wenn auch der Parteilinie treue Schriftsteller; die vortreffliche Dichterin Anna Achmatowa, die sich 1946 den Bannstrahl von Shdanow zugezogen hatte; Richter, der von vielen Musikliebhabern als der beste Sowjetpianist betrachtet wird; seine Frau, eine ausgezeichnete Sängerin; den sehr sympathischen Dirigenten Neigaus, einen feinen, humorvollen Menschen von vielseitiger Bildung; einen Philosophieprofessor, dessen allzu große Bescheidenheit mich nicht hätte ahnen lassen, daß er die scholastische Philosophie von Grund auf beherrschte; Schauspielerinnen vom Künstlertheater usw.
Unvergeßliche Stunden, in denen sich mir ein Sowjetmilieu enthüllte, von dem ich bisher kaum etwas geahnt hatte, und das mir einem westlichen Künstlermilieu seltsam nahe erschien.
Woher stammt dieser Eindruck? Vielleicht lag es zum Teil an der Tatsache, daß Pasternak und, wie ich glaube, die meisten seiner Freunde im Gegensatz zu den Sowjetbürgern, mit denen ich bis jetzt verkehrt hatte, materielle Bedingungen genossen, die im Westen als normal galten, in der Sowjetunion aber bedeutende Vorteile bieten. (Es ist in Sowjetrußland höchster Luxus, eine ruhige Arbeitsumgebung zu haben!)
Es lag auch daran, daß ich es nicht gewöhnt war, bei der jungen Sowjetgeneration die Wissenstiefe zu finden, die Pasternak und seine Freunde von der westlichen Kultur hatten, von der sie ebenso durchdrungen waren wie von der russischen Kultur.
Diese Kulturverbindung verblüffte mich, weil man bei Pasternak eine Luft wirklicher Freiheit atmete. Freilich, ich hatte in der Sowjetunion sogar zu Stalins Zeiten freie Geister gekannt, die meine Bewunderung erregt hatten; aber ihre Freiheit blieb verborgen, da sie in der Umwelt der intellektuellen Diktatur, die in der Nachkriegszeit herrschte, nicht an die Außenwelt dringen konnte.
Wenn Pasternak innig mit den großen Werten des Westens verbunden ist, so doch nicht nach Art der „Kosmopoliten“. Er ist im tiefsten Grunde in der russischen Kultur verwurzelt, auch im Sowjetleben, dessen geheimste innere Schwungkraft er als Dichter stets auszudrücken wußte. Gerade das zog mich zu ihm. Nach unserer ersten Begegnung bekannte ich ihm, daß mein Besuch weniger durch literarische Neugier veranlaßt worden war, sondern durch das Bedürfnis, ihm dafür zu danken, daß er dieses innere Rußland, welches im Westen derart verkannt und übersehen wurde, dem westlichen Denken zugänglich gemacht hat. Jahrelang hatte die Außenwelt nichts von Rußland gehört außer den Lobliedern der staatlichen Propaganda, der die Sowjetschriftsteller ihre Feder liehen, so daß wahres Heldentum und wahre Größe ihres Volkes unter idyllischen Heldenkarikaturen begraben wurden.
Pasternak schien sehr berührt von meiner Stellungnahme, die er jedoch für seine Sowjetkollegen zu stark und zu streng fand; er suchte sie zu entschuldigen („Sie können nichts dafür. Wer darf mit Steinen nach Ihnen werfen?“), aber er freute sich offensichtlich, daß sein Werk das Band zwischen seinem Lande und der übrigen Welt zu erneuern vermochte, das durch Haß und ideologische Leidenschaften zerrissen worden war. Er unterhielt sich sehr gern mit mir über Gegenstände, die ihm am Herzen lagen, über sein geliebtes Rußland, seine Anschauungen über die russische Literatur und ihre Aussichten.
Ich hörte ihn seine Meinung über die russischen Schriftsteller äußern. Unter anderm ist mir seine Würdigung Alexander Bloks im Gedächtnis geblieben, mit dem er geradezu einen Kult treibt, und dem er sich von allen Dichtern des zwanzigsten Jahrhunderts am nächsten fühlt.
„Man darf ihn nicht als Symbolisten ansehen, er steht jenseits jeder Definition. Er ist der größte Dichter unserer Zeit. Man kann ihn mit Dante vergleichen“, scheute er sich nicht, zu versichern.
In ihm ist alles: seine ganze Epoche, deren Kolorit und Geist er auszudrücken wußte.
Über Majakowski ist er viel zurückhaltender:
„Ich habe ihn mehr geliebt als einen Bruder“, sagte er.
Anfangs gefiel mir alles, was er schrieb. Dann aber, als er unnötigerweise die technischen Schwierigkeiten suchte, fand ich, daß er seine Begabung verpfuschte. Sein Gedicht „150000000“ läßt zum Beispiel vollkommen kalt. Die Worte gleiten dahin, ohne Wurzel zu fassen…
Aber am liebsten hörte ich ihn von seinem eigenen Werk sprechen:
Ich habe mich sehr geändert. Wenn ich meine Jugendverse betrachte, schäme ich mich, als ob sie etwas Fremdes und sogar eine Karikatur wären, als ob ich der Parodie meiner eigenen Verse gegenüberstünde. Jetzt schreibe ich ganz anders. Das hat zu Beginn der vierziger Jahre angefangen…
Er betrachtet seine literarische Vergangenheit mit äußerster Strenge, die zweifellos übertrieben ist. Demnach müßte von seinem Werk fast alles, was er vor dem Krieg geschrieben hat, gestrichen werden. Aber wenn er sich durch die Bewunderung, die seine frühen Gedichte immer noch erregen, herausgefordert fühlt, so liegt es vor allem daran, daß sie für ihn eine vergangene, vollständig überholte Phase darstellen, nach der er erst das geschrieben hat, was er als sein Lebenswerk betrachtet und über die Gedichte stellt: den berühmten Roman.
Lieber Doktor Schiwago! Wie oft haben wir darüber miteinander gesprochen! Pasternak hatte mir das Manuskript geliehen, das ich in Moskau selbst fast in einem Zuge las, geblendet, hingerissen vom Atem des Heldengedichtes, der es durchweht.
„Ich wollte kein Kunstwerk schreiben“, beteuerte mir Pasternak, wie immer allzu streng mit sich selbst.
Es ist ja unvollkommen – alle diese Längen, diese Anhäufung von Gedanklichem, von philosophischen Gesprächen… Aber die Umstände haben das ergeben. Es ist ein Stück meines Lebens. Ich habe das Beste von mir, von meiner Suche als Mensch und nicht als Künstler, hineingelegt. Ich wollte meine Zeit ausdrücken.
„Was meine letzte Lyrik betrifft“, fuhr er fort:
so weiß ich wirklich nicht, ob sie den Westen Europas fesseln kann, ob sie nach dem Futurismus, dem Surrealismus und all diesen ,ismen‘ etwas Neues bringt… Das Neue, das ist allerdings sehr schwer. Nehmen Sie die heutigen Sowjetdichter. Sie schreiben sehr gut, sehr gewissenhaft über nützliche Dinge, und doch habe ich beim Lesen das Gefühl, als fehle ihnen jenes Etwas, das noch nie gesagt worden ist. Man hat den Eindruck des schon Gelesenen, des schon Gehörten. Gewiß, es gibt trotzdem Junge, die Originalität suchen. Sie träumen davon, neuartige, ungebräuchliche Formen zu finden, etwas in der Art von Mallarmé; aber sie denken nicht daran, Stoff und Themata zu ändern. Könnten Sie sich einen Mallarmé vorstellen, der über das landwirtschaftliche Problem des Brachackers dichtet? Ich hingegen wollte etwas anderes ausdrücken: Das Streben nach dem Guten, das heutzutage so grundlegend ist. Man weiß ja, daß es keine Glückseligkeit ohne Heldentat gibt.
Wie um seinen Gedankengang zu illustrieren, erläuterte er eines seiner neuesten Gedichte, welches „Das Brot“ heißt.
Zuerst wollte ich es in modernem Stil schreiben und die Entwicklung der Brotzubereitung und so weiter verherrlichen; aber das Ergebnis war nicht gerade glänzend. Meine Freunde rieten mir davon ab, es zu veröffentlichen. Dann überarbeitete und milderte ich es auf meine Weise, und das Brot wurde zum Sinnbild des moralischen Kampfes, den wir unaufhörlich führen.
Durch dieses Streben nach dem Guten, das für Pasternak so kennzeichnend ist, verbindet er sich mit dem Christentum. Als wir darüber sprachen, wies er mich auf mehrere Stellen in seinem Roman hin; für ihn liegt alles im Christentum, und die einschneidenden Bewegungen, welche die Geschichte gestempelt und dem Menschen etwas Großes gebracht haben, sind mehr oder weniger von christlichen. Elementen inspiriert worden. Sein Christentum scheint mir weniger die Bindung an eine starr umschriebene Glaubenslehre zu sein, sondern vor allem eine lyrische Einstellung und ein moralisches Streben nach Nächstenliebe und Toleranz, die ihn seine Zeit von einem sehr hohen Standpunkt mit hellseherischer Schärfe beurteilen lassen.
„Eine große Epoche ist jetzt beendet“, sagte er.
Etwas vollständig Neues wird erstehen. Dieses geschichtliche Zeitalter, das ich meine, hat während der dreißiger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts begonnen, in dem Augenblick, wo sich der Mensch der technischen Macht stärker bewußt geworden ist. Denken Sie nur an Umwälzung in Industrie und Wissenschaft, Überwindung der Entfernungen. Der Marxismus hat in der Entwicklung dieser hundertdreißig Jahre eine gewisse Rolle gespielt, besonders für die russische Intelligenz, die vom Romantizismus ablassen mußte und statt dessen die Vernunft entdeckt hat. Man ist auf diesem Wege bis zum Äußersten gegangen, bis zum Verdorren, zur Herrschaft der Abstraktion, in deren Namen man alles opfert. Dazu kam der Krieg. Er war zweifellos furchtbar, aber die Lebenskraft des russischen Volkes hat wenigstens die Starre der Abstraktion abgeschüttelt und sprudelt von neuem. Sie ist es, die unser Land gerettet hat.
Es hat gute Dinge gegeben, und von der Revolution bleibt ein Kolorit, eine unaussprechliche Musik – diejenige, von der Blok sang. Außerdem hat die Revolution etwas Ungewöhnliches gebracht, nämlich die Erkenntnis, daß kein Mensch hinfort zu glauben vermag, ererbtes Geld könne alles bestimmen und entbinde uns davon, für die andern zu arbeiten. Darauf dürfen wir stolz sein. Das ist ein geschichtliches Ereignis von ungeheurer Tragweite.
Freilich, wir haben viel gelitten. Das ist besser so. Später erkennt man, daß Leid gut ist. Man schafft nichts, ohne zu leiden. Das ist jetzt die Färbung unseres Lebens, und alle diese Strukturveränderungen sind schmerzlich erworben; aber wir schreiten auf etwas Neues zu: Eine Gewalt zieht uns aus dieser Welt der Abstraktion, und gerade das ist gut. Vorläufig ist alles noch von einer ungeheuren Kruste bedeckt, und man sieht die Züge der neuen Epoche, die sich erst andeutet, noch nicht; doch ist sie da und stößt uns heute schon vorwärts.
In dieser zukünftigen Welt weist Pasternak der Literatur eine Forscher- und Entdeckerrolle zu:
Die letzten vierzig Jahre sind wie ein einziger Arbeitstag vergangen. Ein ungeheures Werk ist vollbracht worden. Jetzt müßte man sich auch ausruhen. Die Literatur würde dieser Traum sein, der dem Menschen erlaubte, das zu verstehen, was er erworben hat. Ja, jetzt bedarf es einer neuen Literatur, einer freien Literatur, die zwar die sowjetische Gesellschaftsordnung umfaßt, aber auch die übrige Welt…
Wie Pasternak sie in seinem zukünftigen Werk verwirklichen wird, das ist noch sein Geheimnis. Das Zeugnis, das er uns bereits durch sein Leben und durch seine Schriften gegeben hat, beweist, daß er uns nicht enttäuschen wird.
Hélène Peltier, aus Boris Pasternak: Bescheidenheit und Kühnheit. Herausgegeben von Robert E. Meister, Die Arche, 1959
Boris Pasternak (1890–1960)
Nur einmal – unfreiwillig und lediglich für ein paar Tage – hat sich Boris Pasternak in Paris aufgehalten. Vorab schon brachte ihn die Reise in Verlegenheit, danach bedauerte er sie und beklagte die damit verbundenen Verluste und Peinlichkeiten; doch zu vermeiden war sie nicht – Pasternak wurde im Juni 1935 auf kurzfristige Anordnung Stalins zusammen mit andern Sowjetautoren in die französische Hauptstadt delegiert, um am Internationalen „Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur gegen den Faschismus“ teilzunehmen. Rund 250 Autoren aus rund 40 Ländern waren angemeldet, unter ihnen André Gide, André Malraux, E.M. Forster, Bertolt Brecht, Robert Musil, Heinrich Mann, Anna Seghers; rund 3.000 zahlende Gäste nahmen vom 21. bis zum 25. Juni an den Veranstaltungen im Saal der Mutualité teil. Knapp zwei Dutzend Parteiliteraten aus der UdSSR – laut Aldous Huxley ein arroganter Vortrupp „kommunistischer Demagogie“ – weilten bereits in Paris, als der parteilose Pasternak mit Verspätung auf dem Kongreß eintraf.
Grund für die Verzögerung waren die Umstände von Pasternaks Zwangsrekrutierung und seine Reaktion darauf. Der politisch unbedarfte, am sowjetischen Literaturbetrieb wenig interessierte und eben deshalb von staatlicher Seite bedrängte Dichter konnte in keiner Weise erwarten, im westlichen Ausland als Repräsentant und Propagandist des stalinistischen Regimes eingesetzt zu werden, ausgerechnet er, der im eigenen Land durch Zensurmaßnahmen und öffentliche Desavouierung zum Schweigen verurteilt war und nur noch als Übersetzer publizieren konnte (Georgische Lyriker, 1934). Daß gleichzeitig manche seiner schreibenden Kollegen behördlich verfolgt, eingekerkert oder gar liquidiert wurden, war ihm natürlich bekannt und ängstigte ihn zutiefst.
Mit der Integration der Geheimpolizei in das Volkskommissariat des Inneren gewann damals der beginnende Staatsterror an Dynamik. Der erste Hochverratsprozeß gegen parteiinterne Opponenten Stalins fand Anfang 1935 in Moskau statt, und zu Hunderttausenden wurden nun angebliche Dissidenten aus der KPdSU ausgeschlossen. Geschichtsbücher und Lehrmittel aller Art mußten zur Förderung des Sowjetpatriotismus umgeschrieben werden, neu eingeführt wurde der offizielle Titel eines patriotischen „Helden der Sowjetunion“ für besonders verdiente Propagandisten des Regimes.
Dies war, grob skizziert, der zeitgeschichtliche Kontext von Pasternaks Pariser Mission, und man versteht, daß der Dichter als beauftragter Kulturfunktionär für die geringste Fehlleistung schwerste Konsequenzen befürchten mußte – sei’s durch Verhaftung bei der Rückkehr, sei’s durch Ausbürgerung während seiner Abwesenheit im Ausland.
Anders als für Nabokov, Samjatin oder Marina Zwetajewa kam für Boris Pasternak die Emigration nicht in Frage. Angesichts der zunehmenden Repression fand er sich, um Exil oder Gulag zu vermeiden, mehrfach zu Zugeständnissen bereit, die man für peinliche Loyalitätsgesten halten konnte, die aber sicherlich auch seiner Naivität geschuldet waren. Dies betrifft nicht zuletzt seine ambivalenten Rechtfertigungen des sogenannten Sozialistischen Realismus, der seit 1934 als „einzige schöpferische Methode“ der Sowjetliteratur doktrinäre Geltung hatte. Obwohl Pasternak dieser Doktrin mit seinem Werk und seiner Poetik – vorwiegend Natur-, Gedanken- und Befindlichkeitslyrik – nicht im Geringsten entsprechen konnte, scheint er doch an seine Anschlußfähigkeit an den offiziellen Literaturbetrieb geglaubt zu haben. Bei öffentlichen Auftritten wie in privaten Verlautbarungen hat er sich jedenfalls dementsprechend geäußert.
*
Aus Furcht vor eigenem Versagen und repressiven Konsequenzen versuchte Pasternak, seine Teilnahme am Pariser Kongreß mit Hinweis auf seinen prekären Gesundheitszustand abzusagen – schwere Neuralgien, Schlaflosigkeit, allgemeine Erschöpfung hatten ihn kurz zuvor zu einem Klinikaufenthalt gezwungen. Doch der obrigkeitliche Entscheid war gefallen, war unwiderruflich. Am Tag danach, dem 21. Juni 1935, trat Pasternak die ungewollte Reise nach Paris an.
Unterwegs im Zug konzipierte er in einem Schulheft auf Französisch sein Kongreßreferat. Der Text wurde von der Kongreßleitung abgelehnt mit der Begründung, er entspreche weder formal noch inhaltlich den Zielsetzungen der Veranstaltung. Ilja Ehrenburg, der die Sowjetdelegation zu betreuen hatte, zerriß nach eigenem Bekunden Pasternaks Heft und forderte ihn auf, nur einfach ein paar Worte zum gegenwärtigen Stand und zur Funktion der Poesie zu sagen. Der Autor befand sich in einer paradoxalen Situation: in der heimatlichen UdSSR marginalisiert, bedroht, zum Schweigen verurteilt, im westlichen Ausland gefeiert als „einer der größten Dichter unserer Zeit“ (André Malraux) und bereits auch als Kandidat für den Nobelpreis im Gespräch.
Schon vor seiner angekündigten Wortmeldung wurde Pasternak von seinen Schriftstellerkollegen wie vom Publikum mit „stehenden Ovationen“ begrüßt. Doch auch solcher Zuspruch konnte seine Selbstzweifel nicht zerstreuen; er war, für jedermann sichtbar, von seiner Krankheit und seinen Ängsten gezeichnet und verhielt sich (nach dem Zeugnis Gustav Reglers) „wie ein eben freigelassener Häftling“ – mißtrauisch und scheu.
Obwohl er sich erstmalig in Paris aufhielt, war er touristisch bemerkenswert desinteressiert. Sehenswürdigkeiten mied er ebenso wie das Kino und andere Vergnügungsangebote. Im Gegensatz zu Deutschland und England war ihm Frankreich stets fremd geblieben, und im Unterschied zu Wladimir Majakowskij hat ihn Paris weder begeistern noch provozieren können. Nach seinem Kurzbesuch ist er auch nie wieder dorthin zurückgekehrt.
*
Pasternak lieferte schließlich die gewünschte Grundsatzerklärung über Poesie und Politik, verweigerte aber die Teilnahme an den Diskussionsveranstaltungen. Verglichen mit seinem Kollegen Isaak Babel, der auf dem Podium mit einem improvisierten Vortrag in französischer Sprache brillierte, war er ein dürftiger Redner. Daß er sich oft verhaspelte und sein Anliegen kaum je nachvollziehbar auf den Punkt brachte, wurde ihm vielfach vorgeworfen, und auch er selbst beklagte freimütig seine rhetorische Schwäche. Doch nun sollte er, von der Weltöffentlichkeit und von Stalins Geheimdienstleuten gleichermaßen beobachtet, die „fortschrittliche“ sowjetische Literaturpolitik belobigen. Gegenüber Isaak Babel soll er vorab vertraulich geäußert haben:
Ich glaube nicht daran, daß Probleme des Friedens und der Kultur auf Kongressen gelöst werden können.
Was er als Referent zu sagen hatte, war für die sowjetische Delegation enttäuschend und irritierend, das Auditorium indes quittierte seinen knappen Auftritt mit anhaltendem Applaus, obwohl nur wenige den auf Russisch vorgetragenen, dann von einem langen Schweigen gefolgten Text überhaupt verstehen konnten. Offiziell ist sein Redebeitrag in folgendem Wortlaut überliefert: „Dichtung wird immer in einer alle Gebirge überragenden herrlichen Höhe zu Hause sein. Sie breitet sich zu unseren Füßen im Grase aus, so daß man sich nur herabzubeugen braucht, um sie zu erblicken und von der Erde aufzuheben. Sie wird immer organische Funktion des Glücksgefühls des Menschen bleiben, der die gesegnete Gabe vernunftvoller Rede besitzt. Und so wird es, je mehr Glück auf der Erde sein wird, desto leichter werden, Künstler zu sein.“ – Malraux’ lakonisches Resümee dazu:
Los, meine Freunde, hinaus in die Natur, geht Blumen pflücken auf den Wiesen! – von der Sorte war dieser stalinistische Delegierte.
Prekäre Ironie! Denn in diesem Verständnis relativierte Boris Pasternak nicht nur seine eigene Funktion als Auftragsredner, er desavouierte auch seine parteitreuen sowjetischen Kollegen und den Kongreß insgesamt. Als Folge davon wurde lediglich eine bereinigte Kurzfassung seines Referats in die Kongreßakten aufgenommen, während die heimatliche Berichterstattung den Text wie den Autor unerwähnt ließ. Pasternaks unbedarfter Versuch, sich in einem Radiointerview für seine Aussagen zu rechtfertigen und seinen „sozialistischen“ Patriotismus zu bekräftigen, änderte nichts mehr daran, daß seine Pariser Mission aus offizieller sowjetischer Sicht als unergiebiger Irrlauf und sein Versagen gleichsam als Verrat eingestuft wurde. Boris Pasternak selbst wie auch mehrere Zeitzeugen bemühten sich in der Folge vergeblich um die Ergänzung und Richtigstellung des Kongreßprotokolls. Mit einem taktischen pauschalen Seitenhieb auf die angeblich erstickende und absterbende Dichtung Westeuropas versuchte Ilja Ehrenburg das Werk Pasternaks in der UdSSR kontrastiv als „große revolutionäre Literatur“ auszuweisen. Erst 1945, ein Jahrzehnt nach dem Pariser Kongreß, vervollständigte und erläuterte Pasternak sein einstiges Votum im Gespräch mit Isaiah Berlin; demnach fehlten im gedruckten Protokoll die nachstehenden, für das korrekte Verständnis unabdingbaren Sätze:
Mir ist schon klar, daß das ein Schriftstellertreffen zur Organisation des Widerstands gegen den Faschismus ist. Ich habe euch dazu nur eins zu sagen: Organisiert euch nicht! Organisation ist der Tod der Kunst. Einzig auf die persönliche Unabhängigkeit kommt es an. 1789, 1848 und 1917 wurden die Schriftsteller auch nicht für oder gegen irgend etwas organisiert. Ich flehe euch an, organisiert euch nicht!
Daß diese Passage nachträglich aus dem Redetext gestrichen wurde, hat den Autor vermutlich vor dem Vorwurf ideologischer Dissidenz bewahrt, denn deutlicher hätte man damals die sowjetische Literaturpolitik nicht unterlaufen können: Kollegen, geht Blumen pflücken, sucht euer Glück in der Natur, statt in der Verteidigung abstrakter Prinzipien! Doch eigentlich hätte man über Boris Pasternaks geradezu idyllisches Weltbild ebenso wenig erstaunt sein müssen wie über seine Ausdrucksweise. Schon viel früher hatte er die Revolution in ähnlicher Weise thematisiert – gerade nicht (wie Majakowskij und die meisten seiner Zeitgenossen) mit martialischer oder panegyrischer Rhetorik, sondern in leiser, melodischer Intonation. Als Beispiel dafür seien hier ein paar Verse aus einem dramatischen Fragment von 1917 eingerückt, das zu einem Bühnenwerk über die Französische Revolution hätte werden sollen und als dessen Schauplatz natürlich Paris im Mittelpunkt stand. Den Revolutionsführer Saint-Just de Richebourg läßt Pasternak an einer Stelle folgendermaßen über die Stadt räsonieren:
Nicht zu jeder Stunde applaudieren
In Paris die Linden dem Cordon
Und zürnen die Wolken und blinkt
Der Himmel von Gewitterblitzen.
Nicht immer stürmt es hier.
Hier gibt’s auch Ruhezeit und Traum.
*
Die nachhaltigste, zugleich schmerzlichste Begegnung, die Boris Pasternak während seines Kurzbesuchs in der französischen Hauptstadt hatte, war die mit seiner langjährigen Freundin Marina Zwetajewa (Kap. XIII/2). Die beiden standen seit 1922, noch vor ihrer Emigration aus Sowjetrußland, in postalischer Verbindung – ihre Korrespondenz entwickelte sich unter Einbeziehung Rainer Maria Rilkes ab 1926 innert Jahresfrist zu einem dreistimmigen „Roman“, der weitgehend von der Zwetajewa dominiert war und bis zu Rilkes Tod Ende Dezember als „Fernbeziehung“ eine schwärmerische Eigendynamik entwickelte. Boris Pasternak und Marina Zwetajewa vereinigten sich in diesem fiktionalen Raum zu einem geradezu mythischen Paar, weit abgehoben von der Wirklichkeit, umweht von einer selbsterzeugten Aura der Genialität und Auserwähltheit. Die Zwetajewa lebte mit Mann und Kindern (nach Zwischenstationen in Berlin und Prag) in Paris, während sich Pasternak in Moskau mit dem offiziellen, schon weitgehend gleichgeschalteten Literaturbetrieb arrangierte und dabei seinen frühen Ruhm bestätigen konnte.
Nun bot sich unter massivem Zeitdruck die Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung am Rand des Pariser Kongresses. Tatsächlich war Pasternak damals jedoch weit weniger mit Marina Zwetajewa zugange als mit deren Mann Sergej Efron und Tochter Ariadne. Mag sein, daß beide nach der vieljährigen Latenzzeit ihres Briefwechsels die reale Zusammenkunft scheuten – wie sollten sie auch dem Bild entsprechen können, das sie eigens von und für sich geschaffen hatten? Erschwerend kam hinzu, daß sie politisch auf fatale Weise uneins waren: Pasternak vertrat widerstrebend das Sowjetsystem, Marina Zwetajewa wiederum war im Exil schlecht gelitten wegen ihrer Sympathien für eben jenes repressive System („die Kraft ist dort!“) und ihrer unverhüllten Absicht, mit ihrer Familie dorthin zurückzukehren.
In seinem späten Lebensrückblick Menschen und Situationen (1956; Erstdruck 1967) hat Boris Pasternak die damaligen Umstände wie folgt beschrieben:
Die Mitglieder von Zwetajewas Familie bestanden auf ihrer Rückkehr nach Rußland. Teils kam darin ihre Sehnsucht nach der Heimat und ihre Sympathie für den Kommunismus und die Sowjetunion zum Ausdruck, teils aber auch die Überlegung, daß Paris für die Zwetajewa keine Bleibe sein könne, weil sie dort ohne Leserecho in der Ödnis zugrunde gehen würde. – Die Zwetajewa fragte mich nach meiner Meinung dazu. Ich hatte diesbezüglich keine bestimmte Meinung. Ich wußte nicht, was ich ihr raten sollte, und zu groß war meine Angst, daß es für sie und ihre Verwandtschaft bei uns [in der UdSSR] zu schwierig und zu unruhig werden könnte. Die gemeinsame Tragödie dieser Familie überstieg all meine Befürchtungen bei weitem.
In der Optik Marina Zwetajewas stellte sich das allzu beiläufige, allzu unergiebige Zusammentreffen mit Pasternak ganz anders dar – der von ihr vergötterte Dichter erwies sich als ein kranker, schwer depressiver Mann, unfähig und unwillens, ein seriöses Gespräch zu führen und naturgemäß nicht in der Lage, die Rolle weiterzuspielen, die sie ihm einst im Briefverkehr zugedacht hatte. Die Zwetajewa war von der ernüchternden Begegnung zutiefst enttäuscht. „Über die Begegnung mit Pasternak“, schrieb sie noch während dessen Aufenthalts in Paris an eine Freundin in Prag:
– es gab sie – aber was für eine Nicht-Begegnung!
Und sie ging so weit, daß sie den Sowjetdichter Nikolai Tichonow, der offiziell am Kongreß in der Mutualité teilgenommen hatte, gleichsam als Ersatzmann für Pasternak in Anspruch nahm und ins Vertrauen zog.
In ihrem diesbezüglichen Brief von Anfang Juli 1935 versuchte sie erkennbar, an das stilistische Niveau der früheren Korrespondenzen mit Pasternak und Rilke anzuknüpfen; entsprechend poetisch – um nicht zu sagen: pathetisch – geriet ihr das Schreiben an den vermeintlich neuen Freund; hier ein Auszug daraus:
Mir kamen Sie vor wie eine entgegenkommende Brücke und – wie eine Brücke, die einen zwingt, ihre Richtung einzuschlagen. (Anders geht’s ja nicht. Denn dazu ist die Brücke da.)
[…] Wir werden einander wiedersehen.
Von B[oris Pasternak] bleibt mir ein verwirrliches Gefühl. Er ist mühsam für mich, weil er alles, was für mich – Recht ist, für ein – sein – borisales Laster hält, für seine Krankheit. […] Und also weinte ich, weil Boris, der beste lyrische Dichter unserer Zeit, vor meinen Augen die Lyrik verriet, indem er sich selbst und alles in sich als – Krankheit ausgab. (Wenngleich als eine – ,hohe‘. Doch auch dies hat er nicht ausgesprochen. Er hat auch nicht ausgesprochen, daß ihm diese seine Krankheit teurer sei als die Gesundheit und daß sie überhaupt mehr Wert habe, daß sie – seltener und teurer sei als Radium.)
Das heroische Image des Dichters, das Marina Zwetajewa konsequent hochhielt und dem sie selbst bravourös gerecht wurde, ließ keinerlei Schwäche oder Nachgiebigkeit zu. Doch ausgerechnet ihr Lieblingsautor zeigte nun in ihrer Anwesenheit allzu deutliche Züge von Wehleidigkeit, Wankelmut, Verzweiflung, aber auch – nach ihrer negativen Einschätzung – Feigheit und Egoismus. Daß sie ihrerseits nicht in der Lage und nicht bereit war, Pasternaks aktuelle Verfassung ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen, bestätigte viel später ihre Tochter Ariadne Efron in ihren Erinnerungsseiten (1967–1975); kritisch vermerkte sie:
Nur Expressivität hat Marina anerkannt, aber keinerlei Depressionen; Krankheiten (anders als Zahnschmerzen) zählten für sie nicht, sie hielt sie ganz einfach für üble Charakterzüge, die an die Oberfläche drangen – Verworrenheit, Willensschwäche, Ichbezogenheit, d.h. Schwächen, auf die kein Mensch (kein Mann!) ein Anrecht hat…
Pasternak und Marina Zwetajewa seien wechselseitig „kontraindiziert“ gewesen.
Offenkundig war die Pariser „Nicht-Begegnung“ zwischen Marina Zwetajewa und Boris Pasternak eine zu erwartende, unausweichliche, kaum zu entwirrende Lebenssituation. Der Widerstreit, den die Zwetajewa so scharf hervorhob, bestand darin, daß sie als Emigrantin prosowjetisch eingestellt war, derweil er, als Sowjetbürger und Sowjetdelegierter, „krankhafte“ antisowjetische Gefühle hegte. Der Gegensatz hätte mit wechselseitig gutem Willen womöglich zu einer „Brücke“ werden können, doch die Verständigung blieb aus, vermutlich deshalb, weil es den beiden letztlich nicht um die Loyalität gegenüber der UdSSR ging, sondern um die Erhaltung der eigenen Schöpferkraft und der Poesie insgesamt.
Werke: Werkausgabe (russisch), Boris Pasternak: Polnoe sobranie sočinenij, I–XI, Moskva 2005; (deutsch:) Boris Pasternak: Werkausgabe, I–III, Frankfurt am Main 2017; (Auswahl): Boris Pasternak: Ausgewählte Gedichte und wie sie zu lesen sind, Zürich 1961; (Pasternaks Gedichte über Paris:) https://primoverso.ru/stihi-russkie/stihi-pasternaka/pro-parij-stihi.shtml
Bibliographie: A. Troitsky: Boris Leonidovich Pasternak (A Bibliography), Ithaca NY 1969
Zur Biographie: Evgenij Pasternak: Boris Pasternak: Materialy dlja biografii, (Boris Pasternak: Materialien für eine Biographie), Moskva 1989; Lazar Flejšman: Boris Pasternak v tridcatye gody, (Boris Pasternak in den 1930er Jahren), Jerusalem 1984; Lazar Fleishman: Boris Pasternak (The Poet and His Politics), Cambridge, Mass./London 1990
Erinnerungen: Ariadna Efron: Stranicy vospominanij, Paris 1979; Isaiah Berlin: „Conversations with Akhmatova and Pasternak“, in: The New York Review, November 20, 1980; Serafima Poljanina: „Neopublikovannoe pis’mo M.I. Cvetaevoj k N.S. Tichonovu“, (Ein unpublizierter Brief M.I. Zwetajewas an N.S. Tichonow), in: Wiener Slawistischer Almanach (Sonderband III), Wien 1981
Sammelwerk: Erinnerungen an Boris Pasternak, Berlin 1994
Kongreßakten: Paris 1935 (Erster Internationaler Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur: Reden und Dokumente), Berlin 1982
Felix Philipp Ingold, aus Felix Philipp Ingold. Paris als Exil. Die Einwanderung aus Rußland 1910 bis 1940, Arco Verlag, 2025
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Boris Pasternak
Hans Gellhardt: Achmatowa – Pasternak – Zwetajewa
Felix Philipp Ingold: Boris Pasternak (1890-1960)
Thilo Koch: Boris Pasternak als Stimme des anderen Rußland
Gerd Ruge: Begegnung mit dem anderen Rußland
Gerd Ruge: Boris Pasternak – Rußlands großer Dichter
Martin Beheim-Schwarzbach: Boris Pasternak im Selbstbildnis
René Drommert: Boris Pasternak als Übersetzer
Zum 70. Geburtstag von Boris Pasternak:
Flg.: Ein Dichter in der Sjetsch
Die Tat, 10.2.1960
Heinz Schewe: Boris Pasternaks 70. Geburtstag
Fakten und Vermutungen zu Boris Pasternak + Instagram 1 & 2 + KLfG + IMDb + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + gettyimages + IMAGO + Keystone-SDA
Nachrufe auf Boris Pasternak: Tat ✝︎ Die Zeit
Gennadij Ajgi zum 100. Geburtstag von Boris Pasternak
Boris Pasternak – Dokumentarfilm Teil 1/2.
Boris Pasternak – Dokumentarfilm Teil 2/2.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Kalliope
Nachruf auf Heinz Schewe:
Ernst Cramer: Heinz Schewe (1921–2009), WELT-Korrespondent
Die Welt, 2.4.2009



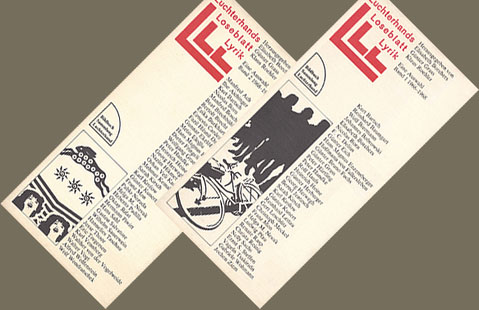




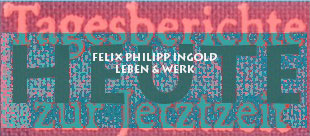


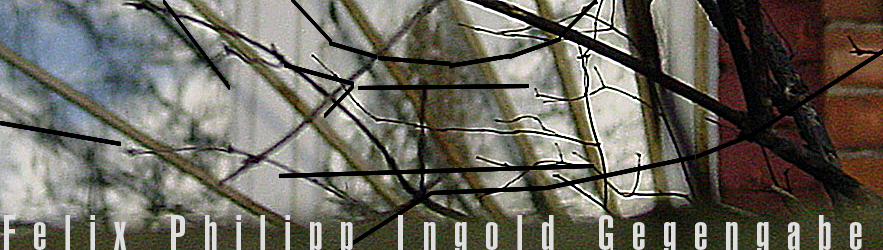
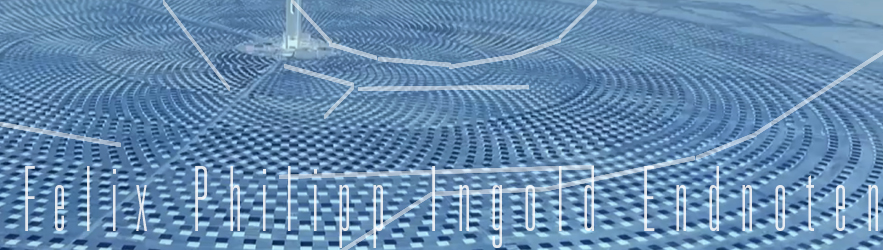

0 Kommentare