Ernst Jandl: Augenspiel
WIEN: HELDENPLATZ
der glanze heldenplatz zirka
versaggerte in maschenhaftem männchenmeere
drunter auch frauen die ans maskelknie
zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick.
und brüllzten wesentlich.
verwogener stirnscheitelunterschwang
nach nöten nördlich, kechelte
mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme
hinsensend sämmertliche eigenwäscher.
pirsch!
döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz
mit hünig sprenkem stimmstummel.
balzerig würmelte es im männechensee
und den weibern ward so pfingstig ums heil
zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte
Nachwort
Österreichische Lyrik der Nachkriegszeit ist uns bisher in relativ wenigen Einzelbänden vorgelegt worden. In größerem Zusammenhang sind die Arbeiten von Dichtern der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart durch den Band Österreich heute (1978) und zuletzt durch die Anthologie österreichischer Lyrik aus vier Jahrzehnten, Verlassener Horizont (1980), bekannt geworden. Unter den Namen der mittleren Generation, die in diesen Bänden aufhorchen ließen, war auch der des Wieners Ernst Jandl, der seit 1952 mit Gedichten und Hörspieltexten an die Öffentlichkeit tritt.
Jandl, 1925 geboren, besuchte von 1938 bis 1943 in seiner Heimatstadt das Gymnasium, nach unfreiwilliger Soldatenzeit und nach Kriegsgefangenschaft in England studierte er von 1946 bis 1950 Germanistik und Anglistik und war danach als Gymnasiallehrer in Wien tätig. Sein erster Lyrikband erschien 1956. Für das Hörspiel „Fünf Mann Menschen“ erhielt er mit Friederike Mayröcker 1968 den Hörspielpreis der Kriegsblinden, 1974 wurde ihm der Georg-Trakl-Preis für Lyrik und 1976 der Preis der Stadt Wien verliehen. Jandl gehört zu den Mitbegründern der Grazer Autorenversammlung (1973), einer Schriftstellervereinigung von gesamtösterreichischer Bedeutung, deren Vizepräsident er ist.
„Mein lyrischer Proviant zwischen 1938 und 1943, als Gymnasiast, hatte aus je drei Gedichten von Stramm, Wilhelm Klemm und Johannes R. Becher bestanden, aufgefunden in einer Gedichtsammlung aus dem Jahr 1926. Eines, ,Lied‘, von Johannes R. Becher, wirkte auf Dauer.“ – Soweit Ernst Jandl über erste dichterische Vorbilder. Wer Jandl zunächst durch spätere Gedichte kennenlernte, wird angesichts der frühen eher zu Staunen Anlaß finden als sich bestätigt sehen. Zum einen wird in diesen Gedichten ein kräftiger sozialer Zug, sogar ein deutliches politisches Interesse, ein Engagement gegen Krieg und Naziokkupation sichtbar, zum anderen sind die frühen Gedichte wie „strassenbau“, „pharmakologisch“ oder „der offiziersbewerber“ weitgehend konventionell gehalten, wenn auch in stärkerem Maße von Sprachbewußtsein geprägt, als es bei Debütanten jener Jahre üblich war. Ohne Jandl zu einem sozialen oder politischen Dichter stilisieren zu wollen – Züge von Hoffnung auf ein sinnvolles Leben, auf sozialen und politischen Fortschritt und ein unverstellter Blick auf den arbeitenden Menschen kennzeichnen das erste Auftreten des Dichters.
Das Debüt Ernst Jandls findet in einer für die Entwicklung der österreichischen Lyrik bedeutsamen Situation statt. Jandl betritt die literarische Bühne zu einem glücklichen Zeitpunkt. Die Wirkung der jüngeren österreichischen Dichtung, die nach Kriegsende einsetzte und hier nur durch wenige Namen wie Aichinger, Bachmann, Busta, Celan, Fried, Fritsch, Guttenbrunner, Huppert, Lavant und Okopenko charakterisiert werden soll, wird Mitte der fünfziger Jahre von einer Schar junger sprachkritischer Autoren „eingeholt“. Sie setzen eine deutliche Zäsur und beenden durch ihre Aktivitäten gleichsam die Phase der Nachkriegsdichtung in Österreich.
Auf die Leistungen dieser Wiener Gruppe (Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm, Wiener) – Sprachkritik im Gedicht, neue Dialektdichtung, Beginn von Lautdichtung und visueller Poesie – kann Jandl als „Material“ zurückgreifen und sich so einer Dichtung anschließen, die im internationalen Kontext der „konkreten Poesie“ steht. Es ist eine Richtung, die ihrerseits auf Barockpoesie fußt, auf Vorläufer moderner Dichtung zurückgreift, von Mallarmé und Apollinaire bis zu Scheerbart, Arno Holz, August Stramm, Kurt Schwitters, Hans Arp, Gertrude Stein und Otto Nebel. In seinem ersten Gedichtband, Andere Augen (1956), zeigt sich Jandl von diesem Hintergrund noch relativ unbeeinflußt. Obwohl der Autor auf Jugenderlebnisse mit expressionistischer Dichtung hinweist, zeigen die frühen Gedichte ein direktes Verarbeiten von „Normalsprache“ und richten sich vornehmlich auf ein zwar verhalten formuliertes, doch spürbar inhaltliches Ziel, ein betont antimilitaristisches Engagement, ein Aufbrechen und kritisches Aufarbeiten jugendlicher Alpträume aus der Zeit des hitlerischen Überfalls und der Okkupation Österreichs.
Der erste große Sammelband der experimentellen Gedichte Ernst Jandls wirkt dagegen wie ein Paukenschlag. Auch im nachhinein, von heute aus, vermag man das nachzuempfinden. Die Gedichte des Bandes Laut und Luise (1966) bieten diese Auseinandersetzung mit Krieg und Nazizeit zwar in nicht geringerer Intensität, doch auf andere Art, die das gewandelte Interesse des Autors, eine neue Akzentuierung und sprachliche Verarbeitung dessen sichtbar werden läßt, was für Jandl vordem mehr oder weniger von „inhaltlichem“ Interesse war. Man kann sich kaum unterschiedlichere Gedichte denken als die von diesem Autor stammenden „die sieben schwaben“, „der offiziersbewerber“ oder auch „lebensbeschreibung“ auf der einen und „wien: heldenplatz“ auf der anderen Seite.
Haben wir es also mit poetischen Indizien für eine „Entwicklung“ des Autors zu tun? Sicher zeigen die Beispiele einer „neuen“ Poesie die Entwicklung des Dichters, zugleich sind sie aber Ausdruck seiner vielfältigen Artikulationsmöglichkeiten. „wien: heldenplatz“ ist eines der markantesten dieser neuen Gedichte. Es stammt aus dem Jahr 1962 und reflektiert ein Jugenderlebnis von 1938, dem Jahr der Okkupation Österreichs; eine Kundgebungshysterie umkreist den namentlich nicht genannten faschistischen Oberrattenfänger. „Ohne das expressionistische Pathos zu übernehmen“, sagt Jandl, „wurde hier für die Wortbildung aus der Praxis der Expressionisten Nutzen gezogen, während die Syntax dieses Gedichts sich mit der Syntax der Umgangssprache deckt. Einen Schritt weiter zu tun, durch Deformation oder Reduktion der Syntax, hätte die Spannung innerhalb des Gedichts verringert. Die Spannung ist die Spannung zwischen dem beschädigten Wort und der unverletzten Syntax,“ Diese in Haltung und Machart von den Anfängen sehr verschiedenen Gedichte deuten nicht nur auf die Beschäftigung des Autors mit dem Expressionismus hin, sie reflektieren auch die Auseinandersetzung mit DADA-Kunst, mit Arbeiten der Amerikanerin Gertrude Stein, besonders aber mit den Gedichten seiner Landsleute H.C. Artmann und Gerhard Rühm. Spätestens an diesem Punkt erweist sich Jandl als eine der Schlüsselfiguren der österreichischen Lyrik der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart.
Ernst Jandls experimentelle Dichtung ist nicht Stimmungsverdichtung in Sätzen, sie ist nicht sprachliche Imagination. „Er geht den Offenheiten der Sprache nach“, sagt Helmut Heißenbüttel, „den Offenheiten der Satzführung wie der Redegewohnheit, des Vokabulars wie der sprachlichen Kleinstteile, um die Möglichkeiten auszunutzen, die diese Offenheiten darstellen…“ – Das heißt nun allerdings nicht, daß bei diesem Autor alles anders wäre, als es der Leser bisher gewohnt war. Es gibt durchaus Gedichte, die traditioneller Lyrik verpflichtet sind: Naturlyrik, Lehrgedicht, Lied, Dialektgedicht, Epigramm. Zugleich reduziert er die traditionelle Form und schafft Modelle, an denen er Sprachverhalten von Zeitgenossen demonstriert. Auch wenn die Lautgedichte, die Sprechgedichte und die visuellen Texte einen anderen Typus oder andere Typen von Gedichten charakterisieren als die Gedichte in „nahezu Alltagssprache“, eröffnen sie damit nicht den Blick auf einen „völlig neuen“ Dichter. Sie zeigen nicht mehr und nicht weniger als seine Vielfalt. Sie weisen auf Stufen auch experimenteller Dichtung hin. Die von einer traditionellen, wenn nicht gar konventionellen Vorstellung von Lyrik geformte Leseerwartung auf einen bestimmten unverrückbaren, einen „ewigen“ Charakter des Gedichts, auf einen unwandelbaren Formenkanon von Poesie wird im ersten Zusammentreffen mit solcher Dichtung vermutlich zunächst enttäuscht, wenn nicht gar schockiert werden. Die Erwartungshaltung mag sogar die konsternierte Frage auslösen: Und das soll ein Gedicht sein?
Die Spannweite des lyrischen Ausdrucks, die Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten überrascht bei Jandl stets aufs neue. Ständig werden Varianten einmal von ihm erschlossener oder „gefundener“ poetischer Objekte angeboten. Zudem lassen sie erkennen, daß auch ihm, dem es vordringlich um Sprache im Gedicht geht, dem es um das Gedicht als Sprachgegenstand zu tun ist, Kausalitätsbezüge, Fragen nach Tradition und nach Geschichte nicht fremd sind. Die zwar nur punktuelle, aber doch entschiedene Auseinandersetzung mit jüngster Geschichte zeigt trotz Verhaltenheit und Verknappung, daß Entwicklungen zu seinen Gegenständen gehören („markierung einer wende“, „straßenrufe“ usw.).
Dem Leser, dem solche Gedichte zum erstenmal vor Augen treten, werden trotz Überraschung durch Ungewohntes formale Schönheit, anspruchsvolle poetische Idee, Humor und intellektueller Witz dieser Poesie nicht verborgen bleiben. Ein ästhetisches Erlebnis aus neuartig geformter Sprache wird bereitgehalten; es gilt nur, es zu entdecken. Ohne sich Jandls Poetik damit zu eigen machen zu wollen, ist es sicher von ästhetischem Reiz, auch seine Sprechgedichte, seine visuelle Poesie in Beispielen vorzuzeigen. Vermutlich wäre Jandl aber der letzte, dem es darum ginge, den Leser auf seine Weise des Schreibens, Sehens und Hörens einzuschwören. Zumal er es nicht nur beteuert, sondern sichtlich praktiziert: „Ich schreibe verschiedene Arten von Gedichten.“
Neben der Möglichkeit, Vielstimmigkeit zu zeigen, schafft er auch die Gelegenheit, das kritische und schöpferische Verhältnis eines Autors zu demonstrieren, der Gedichte “in einer auf verschiedene Weise aus der gewohnten in ein ungewohntes Gleichgewicht gebrachten Sprache” schreibt. Das wirft zugleich die Frage auf, inwieweit diese Dichtung “konkrete Dichtung” ist, inwieweit ihr Autor sich in einen internationalen Kontext von Dichtung einfügt.
Jandl charakterisiert die „konkrete Poesie“ einmal so: „Neue Methoden zu dichten zu ersinnen, nach denen neuartige Gebilde aus Sprache erzeugt werden können… ist seit dem Beginn der fünfziger Jahre das Ziel einer wachsenden Zahl von Autoren, die sich einer internationalen Bewegung zur Schaffung einer neuen, zeitgenössischen Poesie zugehörig fühlen oder zu ihr gezählt werden… Der Initiator dieser Bewegung ist in Europa der Schweizer Eugen Gomringer.“ – Über unterschiedliche Wirkungsmöglichkeiten und Gefahren dieser Poesie ist sich Jandl durchaus im klaren: „Die erste Begegnung mit einzelnen Beispielen experimenteller und konkreter Dichtung kann faszinieren, aber ebensogut verwirren, abstoßen oder ärgern, was ins Auge springt, ist der so oder so empfundene Kontrast zu vielem, was man bisher an Dichtung kannte und liebte.“ – Ist diese „konkrete Poesie“ nun eine elitäre Angelegenheit, wie oft behauptet wird, eine Privatsache, weitgehend unverständlich für die Umwelt? Vieles scheint dafür zu sprechen. Ein bewußt provozierter Kommunikationsbruch durch destruierte und reduzierte Sprache zum Beispiel ist ein deutliches Anzeichen dafür. Andererseits ist nicht zu übersehen, daß diese Poesie den Sprachzustand aufzudecken hilft. Unbezweifelbar ist, daß „konkrete Poesie“ – was immer man darunter verstehen mag – einen kritischen Reflex auf den Zustand der Sprache darstellt. Diesen Zustand macht sie bewußt, indem sie konventionelle Sprachzusammenhänge zerstört, indem sie mit Hilfe von Collagetechniken Stückwerk von Sprache montiert und Zitate in fremde Umgebung stellt. Auf diese Weise hat „konkrete Poesie“ auf Versteinerungen im Sprachgebrauch aufmerksam gemacht, Verkrustungen und Perversion von Sprache denunziert, Banales und Sinnentleertes von Sprachklischees durch Sprachwitz verhöhnt, durch groteske Verzerrung ad absurdum geführt („lichtung“, „wo bleibb da hummoooa?“). Diese Poesie will Unsicherheit gegenüber einer Sprache verbreiten, die von Sprachvorurteilen umstellt, von Gedankenlosigkeit ausgehöhlt ist; sie will zumindest schlechte Sprachroutine in Frage stellen.
Allerdings lehnt es Jandl strikt ab, sich auf eine Bundesgenossenschaft mit „experimenteller Poesie“ schlechthin einzulassen. Er möchte für nichts stehen als für seine Richtung und sein Engagement. Wobei er keineswegs verhehlt, von welcher Dichtung er ausgeht und wen er als Kombattanten ansieht. Expressis verbis weigert er sich, auf eine „Ideologie“ der „konkreten Poesie“ festgelegt zu werden. Den Puristen unter den „Experimentellen“, die im Kommunikationsbruch mit der Sprache ein Universalmittel sehen und zum Teil Hoffnung auf revolutionäre Gesellschaftsveränderung daraus ableiten, versagt er die Gefolgschaft. Ernst Jandl, dem es immer um Lebendigkeit und Wirkung des Gedichts ging, kommentiert den Isolierungsprozeß, dem die extreme Richtung der „konkreten Poesie“ verhaftet ist, deutlich mit Bedauern und mit Ablehnung.
Der Vorsatz, sich und den Leser durch Distanzierung und Trennung von gedankenloser Sprachpraxis wieder sehend und hörend zu machen, ist für Jandl außerordentlich fruchtbar geworden. Redensarten, Redewendungen, Sprüche, Sprichwörter, Sprachklischees werden, indem sie aus der Sprachgewohnheit gelöst werden, in ihrem desolaten Charakter gezeigt: „die sonne ging auf und zu“ („kneiernzuck“). Sprachverfremdung durch semantische Verschiebung, durch Vermischung von Bibelsprüchen, Sprichwörtern, Nonsens-, Abzählversen und Kinderreimen, Verfremdung durch Klanganalogie gereicht zwar nicht immer zu einem tiefgreifenden, verändernden Akt zugunsten des Gedichts; es gelingt damit auch nicht immer eine echte sprachliche Innovation, doch insgesamt ist die Zurückeroberung von sprachlichem Terrain für die Poesie merkbar. Die Mittel der Zitatmontage, der Parodie „klassischer“ Gedichte, vielseitiger Sprachpersiflage kommen ohne die bekannte literarische Vorlage, auf die sie sich kritisch beziehen, nicht aus. Einen Widerspruch kann man darin wohl aber nicht sehen. Obschon Jandl in einem kritischen Verhältnis zur klassischen Gedichttradition steht, lehnt er es doch nachdrücklich ab, tradierte Formen zu ignorieren oder sie zu zerstören. Er greift sogar bewußt auf traditionelle Formen zurück, um ihre heutige Funktionsfähigkeit zu prüfen und sie gegebenenfalls modifiziert zu nutzen.
Wenn man sich an seine Aussage hält, so kommt es Jandl nicht darauf an, „mit den Experimenten etwas Neues in dem Sinn zu beginnen, daß es nunmehr das eigentliche und einzige sein soll, sondern es kam darauf an, möglichst viele Wege aufzumachen, um auf möglichst vielen weiterzukommen“. Oder anders formuliert: das „Gedicht in nahezu Alltagssprache; das Stimme verlangende Sprechgedicht, das laute wortlose Lautgedicht“ gehören zu seiner Dichtung wie das „stille visuelle Gedicht“.
In Jandls Sinn ist ein Gedicht experimentell, das ein Beitrag zu einem noch nicht geschriebenen Buch ist, zu einer „vorauseilenden Grammatik“, zu einem „vorauseilenden Wörterbuch“. Was „beweisen“, was „sagen“ diese Gedichte? Zum einen sagen sie, daß die Sprache nach wie vor für Erprobungen des poetischen Subjekts offen ist, sie sagen, daß die deutsche Sprache mit ihrem Reichtum an syntaktischen Formen auch zu diesem Zeitpunkt ein Experimentierfeld sein kann. Zum anderen sagen sie, daß Jandl Tradition auf seine Weise fortführt. Denn die traditionellen Formen werden nicht zerstört, und sie werden auch nicht als Hülsen benutzt, um „neue“ Inhalte hineinzustopfen; sie werden vielmehr im Zitat bewußt gemacht. Indem sie benutzt werden, indem er mit ihrer Kenntnis, der Kenntnis ihrer Mechanik und ihres Geistes neue poetische Gebäude errichtet, wird erkennbar, daß sie auf andere Weise architektonisch interessant sind, daß ihr Geist von Humanität bestimmt, von Witz und Ironie beflügelt wird.
Der Verwirrung durch das Ungewohnte neuer Dichtungsart begegnet Ernst Jandl mit dem Hinweis, daß experimentelle Dichtung „wie jede Art Dichtung, und zu jeder Zeit, entsteht zwischen den Mustern der Umgangssprache und den Mustern der Poesie. Dazwischen – das ist ihr Raum“. – Sprache wird von Jandl auf den ursprünglichen Sinn und auf den derzeitigen Wert untersucht. Mit mannigfachen Methoden geschieht das. Er nutzt zum Beispiel die Diskrepanz zwischen Schrift- und Lautbild aus („feilchen vür efa“). Er wiederholt Alltagsformulierungen so oft und in mählicher Abwandlung von Vokalen oder Konsonanten, bis sich Stimmung, Farbe und Sinnfälligkeit des Wortes oder des Satzes verändert haben und eine neue Aussage möglich wird.
Jandl strebt eine Dichtung an, die „Gegenstände aus Sprache erzeugt“. Er will eine dichterische Sprache erreichen, die sich von illusionistischer Abbildung der Wirklichkeit frei macht. Der Sprache will er neue Wirkungen abgewinnen, indem er sie durch Verfremdungseffekt mit Spannung auflädt. Im Sprachlabor solcher Poesie wird versucht, poetische Ordnungen zu setzen. Oder wie der Autor formuliert: “Ich verstehe unter dem Spiel mit Sprache eine Voraussetzung für Poesie überhaupt, jeder Poesie und zu jeder Zeit… Das Spiel ist auf ein Ziel gerichtet; das unterscheidet es in jedem Fall von Spielerei.“
Nehmen wir „schtzngrmm“, ein Gedicht, für dessen Gattung Jandl die Bezeichnung Sprechgedichte wählte, die er als Mischung aus Wort- und Lautgedicht bezeichnet: „Seinem Basiswort sind die Vokale entzogen, Vokale kommen im Gedicht nicht vor, wenn Sie wollen: der Krieg singt nicht!“ Dieses Gedicht, das wie andere seiner Gattung sich erst im lauten Vorlesen voll erschließt, mag zunächst befremden. Doch der Autor ist über jeden Zweifel erhaben, was das Engagement gegen den Krieg betrifft. Seine Absicht, dem Gegenstand auf neue Weise zu Leibe zu rücken, sollte, auch wenn man sich mit den Überlegungen zu solcher Poesie nicht befreunden mag, zumindest unseren Respekt, ein ruhiges Anhören erwarten dürfen: „Laute und Lautfolgen werden in diesem Gedicht imitatorisch eingesetzt; die Stimme imitiert Schlachtlärm, das konsonantische Lautmaterial ist dem Grundwort ,Schützengraben‘ entnommen, das auch als solches im Gedicht anklingt, auf weitere Wortanklänge ist bis auf eine Ausnahme verzichtet. Diese Ausnahme ist der Schluß, wenn man will: die Pointe, die Lautfolge t-tt, die das Wort ,tot‘ suggeriert.“
Die Voraussetzung für diese Praxis erläutert Jandl folgendermaßen: „Krieg, das wissen wir, ist ein herausforderndes Thema, aber es läßt sich zu diesem Thema ein herausforderndes Gedicht nur schreiben, wenn das Gedicht sich nicht auf das Herausfordernde seines Themas verläßt, sondern als Gedicht selbst, ungeachtet des Themas, zu einer Herausforderung wird. Das kann nur durch Veränderungen am Gedicht, seiner Sprache und seiner Struktur geschehen, Veränderungen, die im Gegensatz stehen, woran wir uns gewöhnt haben. Diese Veränderungen zu erreichen wird mich beim Schreiben eines solchen Gedichtes mehr zu beschäftigen haben als das eigentliche Thema.“
Auch wenn man mit dieser Positionsbestimmung nicht konform zu gehen vermag, stehen bei Jandl dichterische Praxis und Argumentation in einem unübersehbaren Zusammenhang mit den auch in unserer Auswahl enthaltenen Antikriegsgedichten. Zudem erinnern wir uns an den Satz: „Es kam nicht darauf an, mit den Experimenten etwas Neues in dem Sinn zu beginnen, daß es nunmehr das eigentliche und einzige sein sollte…“
Die Haltung Ernst Jandls hat absolut nichts gemein mit poetischer Maschinenstürmerei, mit Zynismus oder Respektlosigkeit vor Traditionen. Die Reflexion über Kriegsdichtung ist insofern auch von übergreifender Bedeutung, als damit ein zentrales Problem der Jandlschen Dichtung genannt wird. Es geht um Veränderungen in der Sprache, Veränderungen am Gedicht mit Hilfe von Sprache. Eine vorsätzlich „gestörte“ Sprache wird vorgezeigt, um damit die Irritation an einer als notwendig veränderbar empfundenen Welt anzumerken.
Auch die Beispiele visueller Poesie belegen, daß der Dichter sich nicht ins Experiment verrennt. Der Versuch, in der Traditionslinie von Barockdichtung, von poetischen Gebilden der Mallarmé und Apollinaire, der Dadaisten und Kurt Schwitters die Poesie auch augenfällig zu machen, erreicht zwar nicht immer ein neues adäquates Verhältnis von Sinn und formaler Lösung; manche der Sprachfiguren verbleiben in Ähnlichkeit von „Bild“ und Sinngehalt. Dennoch ist auch dieser Raum ein thematisch-formales Prüffeld, eine echte Variationsmöglichkeit für Augenspiele von Sinngehalt und von hohem ästhetischem Reiz geworden.
Daß sich der Dichter nicht im Formalen, im Experiment erschöpft, beweist am augenfälligsten und bis in die jüngste Vergangenheit seine poetische Praxis, die Gleichzeitigkeit von visuellem Text, von Sprechgedichten, von Lautgedichten und von Gedichten in Normalsprache. Sie bestätigt erneut Ernst Jandls programmatische Erklärung: „Ziel meiner Arbeit, heute wie früher, sind funktionierende, lebendige, wirksame, direkte Gedichte, gesteuert, von welchem Material immer sie ausgehen und in welcher Form immer sie hervortreten, von dem, was in mir ist an Richtung und Neigung, an Freude und Zorn. Was ich will, sind Gedichte, die nicht kalt lassen.“
Joachim Schreck, Nachwort, März 1980
Ernst Jandls Augenspiel (1981):
Das publikationstaktische Meisterstück
des Verlags Volk und Welt
Kinder nehmen ja gern alles in den Mund; falls ich aber meines dabei erwischen sollte, daß es Herrn Jandls lyrischen Abfall aus der Mülltonne nimmt, um davon zu naschen, so würde ich ihm wehren und sofort anordnen: „Spül düch den Mund, moyn Künd, aber dalli!“
(Lothar Kusche, 1965)
Die gemeinsame Geschichte von Ernst Jandl und dem Luchterhand Verlag begann im Jahre 1963 mit einem Prolog: Der Österreicher Jandl, im Brotberuf Lehrer und nebenbei Dichter, reiste damals mit seinen Manuskripten durch die Bundesrepublik, nachdem sein sieben Jahre zuvor im Wiener Bergland Verlag erschienenes Debüt Andere Augen von der literarischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden war und er in der heimischen Verlagslandschaft fortwährend auf verschlossene Türen stieß. Doch auch in Westdeutschland war ihm bei ambitionierten Literaturverlagen wie Insel oder Hanser zunächst kein Erfolg beschieden.
Auch beim aufstrebenden Luchterhand Verlag fand Jandls Dichtung zunächst keinen Anklang, doch immerhin brachte ihm der Besuch im mittelrheinischen Neuwied einen „Hinweis von entscheidender Bedeutung“: Es gebe in Stuttgart einen Studenten namens Reinhard Döhl, der über gute Kontakte zum Limes Verlag verfüge und sich vielleicht für Jandls experimentelle Dichtung begeistern könne.1 Tatsächlich brachte Döhl wenig später einige der Gedichte in Zeitschriften und in der Anthologie zwischen-räume unter, über die Jandl schließlich den im Literaturbetrieb exzellent vernetzten Helmut Heißenbüttel kennenlernte. Dieser wiederum schlug vor, eines der Manuskripte endlich in Buchform zu publizieren, und zwar im Walter Verlag im schweizerischen Olten, in dem der Verlegersohn Otto F. Walter mit Unterstützung Heißenbüttels gerade ein ambitioniertes literarisches Programm aufbaute, für das Autoren wie H.C. Artmann oder Konrad Bayer standen.2
Die Skepsis, mit der die katholisch-konservative Verlagsmannschaft des Walter Verlags diese experimentelle Reihe begleitete, mündete nach der Publikation des Jandl-Titels Laut und Luise 1966 im offenen Protest, an dessen Ende die Kündigung Walters stand. Der Verlegersohn zog daraufhin zum Luchterhand Verlag weiter, und mit ihm zog ein Tross von solidarischen Autoren nach Neuwied.3 Weil auch Jandl sich eher an seinen Förderer Otto F. Walter als an den Walter Verlag gebunden fühlte, erschien sein nächster Band sprechblasen 1968 bei Luchterhand. Der Dichter hatte damit – nicht ganz freiwillig – eine bemerkenswerte Verbreitung erreicht, zumindest was die Verlagsorte angeht: Seine ersten drei Bücher waren in drei verschiedenen deutschsprachigen Staaten verlegt worden, in Österreich, der Schweiz und der BRD. Bis auch die DDR in diese Reihe aufgenommen werden konnte, sollte es allerdings noch etwas dauern.
Dass die formalästhetisch avantgardistische Lyrik des österreichischen Dichters lange Zeit nicht unbedingt den Maßstäben für importwürdige Literatur im SED-Staat entsprach, lässt schon die erste Kritik erahnen, die in der DDR über Jandl erschien. Lothar Kusche, Satiriker der Weltbühne, nannte das Gedicht „künd“ 1965 eine „künstlich infantilisierte Hack-Prosa“ und „lyrischen Abfall“, der selbstverständlich in die Mülltonne gehöre.4 Dieser Verriss ist zwar ein Einzelstück, scheint aber durchaus charakteristisch: Er ist ein zynischer Ausdruck für das politische Verhältnis zu einer Dichtung, die selten „realistisch“ war, politische Themen nicht explizit verhandelte, nicht ideologisierte, sondern mit ihren konkreten, visuellen und lautdichterischen Formen Subversivität vor allem im Sprachlichen suchte und ihren avantgardistischen Impetus durch ihre permanente Entwicklung erhielt.5 Für diese Art der Dichtung Devisen und Papierressourcen bereitzustellen, wäre für die SED-Führung eine politische Niederlage gewesen, ein Nachgeben, gar ein Zeichen von Resignation. Deswegen durfte Jandl in den 1960er Jahren in der staatlich kontrollierten Öffentlichkeit nicht existieren. Seine Poesie war ein idealer Popanz, um die offizielle Linie festzulegen, aber gewiss keine Literatur, mit der die Literaturwächter das Lesepublikum im SED-Staat konfrontieren wollten.
Auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze, in der Bundesrepublik, setzte Ende der 1960er Jahre hingegen ein erster, kleiner Popularisierungsschub für den Autor ein, der auch im deutsch-deutschen Kontext von Bedeutung war. Da Jandl nämlich sein Publikum nicht nur über Bücher, sondern vermehrt über Lesungen und Schallplatten erreichte und seine stimmgewaltigen Rezitationen auch im Radio gesendet wurden, kam es zu einem bemerkenswerten Phänomen: Während viele „verbotene“ Autoren in der DDR allenfalls den heimlichen Lesern bekannt waren, war der Name Jandl eher den heimlichen Hörern der westdeutschen Radiostationen ein Begriff, die gemeinsam mit den westdeutschen Fernsehsendern die von den SED-Medien dominierte bzw. konstruierte Öffentlichkeit unterliefen.6 Allerdings waren dieser Form der nicht kontrollierten, aus staatlicher Sicht nicht existenten und deswegen auch per se subversiven Rezeption enge Grenzen gesetzt, weil eine öffentliche Anschlusskommunikation nicht möglich war.
Ein ähnliches Phänomen lässt sich bei den DDR-Verlagen nachvollziehen. Dort konnten sich die Mitarbeiter über Prüfexemplare mit denjenigen Autoren vertraut machen, die in der Öffentlichkeit tabuisiert waren, konnten auch, politisches Vertrauen untereinander vorausgesetzt, in kleineren „Verlagszellen“ offen über die Texte diskutieren. Im Fall Jandl führte das aber lediglich dazu, dass der Autor im Verlag Volk und Welt zwar schon Anfang der 1970er Jahre allgemein geschätzt wurde, seine Bücher aber doch wieder in der Schublade verschwinden mussten, weil die Chancen für eine Lizenzausgabe als zu gering eingeschätzt wurden.7 Wie gering die Chancen tatsächlich waren, zeigte sich im Frühjahr 1974. Bernd Jentzsch, ein alter Bekannter des Luchterhand Verlags aus Zeiten der Loseblatt Lyrik und Lektor im DDR-Verlag Neues Leben, kündigte dem HLV im Februar ein „Bändchen mit Gedichten von Ernst Jandl“ in der Reihe Poesiealbum an.8 Allerdings gab es dabei ein Problem: Die Ankündigung war ohne das Placet der Verlagsleitung erfolgt. Obwohl Jentzsch die Vorbereitung der Jandl-Auswahl noch einem inklusiven „wir“ zuschrieb, scheiterte er mit seinem Vorstoß bereits am Veto von Cheflektor und Verlagsleiter.9 Dieser misslungene Versuch verdeutlicht die Bedeutung eines konzertierten, exakt getimten Vorgehens in Sachen Lizenzausgaben. Jentzsch war mit seiner Lyrikreihe weitgehend auf sich allein gestellt und mühte sich deswegen mitunter vergebens, zumal Neues Leben als FDJ-Verlag galt und deswegen besonders „vorbildhaft“ agieren musste.
Während der Verlagsnomade Jandl in der ersten Hälfte der 1970er Jahre östlich der Elbe also noch keinen Verlag fand, drohte westlich der Elbe wieder mal ein Abschied. Otto F. Walter, nach einigen Jahren als Luchterhand-Mitverleger wieder in die Schweiz zurückgegangen und fortan als Programmberater für den HLV tätig, hatte seinen Autor im Mai 1973 auf eine „außerordentlich beunruhigende Abhängigkeit des Umsatzes vom Bestseller-Glück“ hingewiesen, die einer „viel zu großen Anzahl von nur sehr langsam sich verkaufenden Projekten, worunter wesensgemäß gerade die formal neuen, unkonventionellen Arbeiten gehören“, gegenüberstünde.10 Mittelbar hatte dieses Dependenzverhältnis erhebliche Konsequenzen: Angesichts des Kostendrucks, dem Luchterhand seinerzeit unterlag, nahm der Verlag eine Positionsveränderung im literarischen Feld in Kauf, die sich im Weggang von symbolisch wichtigen, aber auflagenschwachen Avantgardisten wie Artmann oder Mon manifestierte.11 Zudem verließ mit dem Lektor Klaus Ramm ein wichtiger Anker der experimentellen Autoren den HLV.12 Für Jandl waren das untrügliche Zeichen, dass auch er auf der Streichliste eines Verlags stand, der für die autonomen Literaten keinen Platz mehr zu haben schien13 – und seine künstlerische Autonomie, die der Autor auch durch seinen Brotberuf zu sichern verstand, war für ihn tatsächlich literarisches Prinzip.14 Zwar bemühten sich sowohl der alte Vertraute Otto F. Walter15 als auch der neue Geschäftsführer Hans Altenhein,16 ihm das Gegenteil zu versichern, aber die Korrespondenzen belegen auch, dass beispielsweise der Verleger Eduard Reifferscheid keine eindeutige Position bezog: Zwar betonte er im Januar 1975 gegenüber Walter, dass man Jandl halten müsse, „selbst wenn er mehr kostet als einbringt“, weil er zum Profil gehöre, ergo symbolisch wichtig sei;17 nur einen Monat später schrieb er dem in die Schweiz zurückgekehrten Walter dann aber, dass man den möglichen Abgang „im Interesse der Straffung und damit zahlenmäßigen Minderung unseres Programms“ auf sich nehmen müsse, zumal kein Titel mehr verlegt werden sollte, „der nicht mit Sicherheit 4.000 Auflage verspricht“.18 Mit Mäcenas, so musste der ehemalige Juniorverleger Walter einsehen, wollte Reifferscheid „inzwischen oder künftig“ auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden.19
Im Fall Jandl war die symbolische Bedeutung des Autors aber offensichtlich gewichtiger als das wirtschaftliche Credo der Verschlankung. Der österreichische Dichter blieb bei Luchterhand und wurde somit endgültig sesshaft, was seine verlegerische Heimat betraf – das war, wie sich bald herausstellen sollte, für beide Seiten nicht von Nachteil. Es gab nämlich in den Endsiebzigern eine spürbare Jandl-Konjunktur im literarischen Leben der Bundesrepublik, zumindest im Rahmen dessen, was bei experimenteller Literatur möglich ist, denn natürlich blieb die Auflagenhöhe im Vergleich zu den berühmten Prosaautoren weiterhin gering.20
Die positive Entwicklung bestätigte sich 1981 mit einer besonderen Lizenzvergabe: Im Ost-Berliner Verlag Volk und Welt erschien unter dem Titel Augenspiel endlich eine Auswahl aus dem Werk des Autors. Damit war Jandl nach seinem Landsmann Michael Scharang sowie den Schweizern Jürg Federspiel und Peter Bichsel der vierte Luchterhand-Autor, den VW in der DDR verlegte.21 Dass das Wagnis eines Vorstoßes in Sachen Jandl mittlerweile kalkulierbar schien, war Ergebnis einer publikationstaktischen Meisterleistung des Ost-Berliner Verlags, die folgend in den Fokus rücken soll.
Volk und Welt war 1964 per Dekret zum führenden Verlag für internationale Literatur in der DDR geworden, weil das Ministerium für Kultur bzw. die HV Verlage und Buchhandel eine „arbeitsteilige Bereinigung der Verlagsprofile“ veranlasste, um die Aufgabengebiete eindeutig abzustecken, den literarischen Lizenzhandel zu professionalisieren und die Devisenverwaltung zu vereinfachen.22 Dementsprechend hatte der planmäßig gewachsene Verlagsriese den programmatischen Anspruch, die Literatur der ganzen Welt in die DDR zu tragen, die Weltliteratur des 20. Jahrhunderts scheiterte aber gerade wegen dieses Anspruchs mitunter an den strukturellen Hürden. Die Breite des Programms war nämlich Privileg und Problem zugleich, denn es war schlicht unmöglich, jede Nationalliteratur in ihrer Vielfalt zu publizieren, schon weil VW genauso wenig wie andere Verlage einen Blankoscheck von der HV Verlage und Buchhandel für die streng bemessenen Papierkontingente erhielt. Enge Grenzen setzte mitunter auch der außenpolitische Kontext, schließlich konnte die Veröffentlichung von Büchern aus Albanien, China oder Jugoslawien in einem Land des sowjetisch dominierten Ostblocks genauso als politische Demonstration wahrgenommen werden wie Veröffentlichungen deutschsprachiger Autoren aus der Schweiz oder Österreich. Das Heimatland Jandls hatte für die DDR eine politische Sonderrolle, weil die Regierung des sozialdemokratischen Kanzlers Bruno Kreisky in den 1970er Jahren eine sogenannte Nachbarschaftspolitik gegenüber den sozialistischen Staaten verfolgte. Für die DDR war dabei vor allem ein Punkt von besonderer Bedeutung: Mit dem Konsularvertrag von 1975 erkannte Österreich als erster westlicher Staat die DDR-Staatsbürgerschaft an.23
Allerdings hinkte der literarische Austausch zwischen den beiden Staaten der politischen Entwicklung deutlich hinterher. Das lag einerseits daran, dass der österreichische Buchmarkt von westdeutschen Verlagen mit DDR-Literatur versorgt wurde, weil sich die Lizenzen für gewöhnlich nicht nur auf die BRD, sondern auch auf Österreich und die Schweiz bezogen. Andererseits gab es bis Ende der 1970er Jahre auch kaum selbstständige Publikationen zeitgenössischer österreichischer Autoren in DDR-Verlagen. Volk und Welt beispielsweise beschränkte sich im Wesentlichen auf wenig kontroverse Autoren wie Peter Marginter oder Peter von Tramin, den altgedienten Kommunisten Hugo Huppert und das KPÖ-Mitglied Michael Scharang, dessen Publikation eher politisch als literarisch gerechtfertigt werden konnte. Die Veröffentlichung eines undogmatischen Linken wie Erich Fried, der ebenfalls bei Volk und Welt erschien, stellte den Verlag vor beachtliche Probleme, die nur mit großen Mühen bewältigt werden konnten.24 Für Thomas Bernhard, Peter Handke oder eben auch Jandl und Artmann schienen die Türen trotz der politischen Annäherung fest verschlossen. Noch Mitte der 1970er Jahre galten sie als dekadent, formalistisch und bestenfalls unpolitisch.
Um diesen Autoren trotzdem den offiziellen Zutritt zum literarischen Feld der DDR zu verschaffen, versuchte der leitende VW-Lektor Roland Links einen taktischen Kunstgriff: Er initiierte eine Anthologie unter dem Titel Österreich heute, in der Texte versteckt werden sollten, „die man nackt nicht bringen konnte“.25 Wie exakt der Band in diesem Sinne durchkomponiert war, lässt das Gutachten erahnen, für das die namhafte Herausgebertroika aus Georgina Baum, Roland Links und Dietrich Simon verantwortlich zeichnete. Äußerst ungewöhnlich ist auf den ersten Blick dessen Einleitung, in der von der Einweihung eines Denkmals „für 500 gefallene SS-Soldaten“ in der Nähe von Wien berichtet wird. Österreich, so heißt es dort weiter, habe sich der historischen Aufarbeitung der NS-Zeit verweigert, weshalb sich der Neonazismus „noch üppiger entfaltet als in Westdeutschland“. Gegen diesen Nazismus und das österreichische Spießertum, so die Conclusio des Gutachtertrios, gebe es nur zwei Gegenpole, nämlich die KPÖ und die progressive Literatur. Mit diesem Argumentationsgerüst konnten nun viele Autoren als progressiv eingestuft werden: Die Wiener Gruppe, zu der im Gutachten Rühm, Bayer, Artmann, Mayröcker und Jandl gezählt wurden, außerdem Bernhard und Handke, ja selbst „im wörtlichen Sinn Konservative, die aber nicht bewußt politisch reaktionär sind“, wie Ernst Schönwiese. Ausbalanciert werden sollte der Band durch „wirklich politisch engagierte, politisch fortschrittliche Schriftsteller“ wie Michael Scharang, Peter Turrini oder Michael Pevny, die als Proporzecke den Spielraum schufen. Genau das war die Absicht des Sammelbands. „Die Plazierung innerhalb einer Anthologie“, so schrieben die drei erfahrenen Verlagsmitarbeiter in dem Gutachten explizit, „machte es auch möglich, Texte so komplizierter Schriftsteller wie Peter Handke und Thomas Bernhard aufzunehmen“. Ernst Jandl war in dem gut 600 Seiten starken Band mit 13 Gedichten und dem Hörspiel Fünf Mann Menschen vertreten, das er mit Friederike – und nicht „Elfriede“, wie im Gutachten zu lesen war – Mayröcker geschrieben hatte. Von den Stil- und Sprachexperimenten der Wiener Gruppe schrieben Baum, Links und Simon übrigens kein Wort, auch der Begriff Konkrete Poesie fiel nicht.26 Diese Aussparungen erwiesen sich im Druckgenehmigungsverfahren als förderlich. Der Band erschien im Frühsommer 1978 in 8.000 Exemplaren.
Unmittelbar nach der Veröffentlichung von Österreich heute schrieb Jandl einen Brief an Simon, aus dem Dank und Lob für das Ansinnen des Verlags Volk und Welt sprach, eine breite Übersicht über die österreichische Literatur zu schaffen:
Daß weitere ,anthologische Schritte‘ geplant sind, um Ihren Lesern die österreichische Gegenwartsliteratur vorzustellen, begrüße ich sehr – wie sicher alle meine Kollegen, die ihre Arbeit in dem einen oder dem anderen Sinn als ,progressiv‘ erachten und daher wünschen, die Grenzen ihres eigenen Landes mögen nicht zugleich die Grenzen ihrer literarischen Wirksamkeit sein.27
An diesen Zeilen Jandls zeigt sich, dass die DDR als Publikations- und Wirkungsraum den österreichischen Autoren eine erfreuliche Möglichkeit bot: Die Schriftsteller aus der kleinen Alpenrepublik konnten ihre Verbreitung im „Muttersprachenraum“ erweitern, ohne zwangsläufig die häufig hohe Schwelle ins literarische Feld der Bundesrepublik überwinden zu müssen.28 Das war bei Jandl zwar weniger relevant, weil er längst ein etablierter Autor in der BRD war, wohl aber bei vielen anderen, die in Österreich heute und im nächsten „anthologischen Schritt“ präsent waren, einem Lyrikband mit dem Titel Verlassener Horizont. Neben Roland Links zeichnete dieses Mal Hugo Huppert als Herausgeber verantwortlich, was erneut als kluger Schachzug von Volk und Welt gedeutet werden kann. Der knapp 80-jährige Autor war bereits in den frühen 1920er Jahren in die KPÖ eingetreten, hatte den Faschismus in Moskau überstanden und war seit 1957 Mitglied im DDR-PEN, nachdem er aus dem österreichischen PEN ausgeschlossen worden war, weil er den Einsatz der Sowjetarmee in Ungarn begrüßt hatte. Im Mitteldeutschen Verlag waren seine gesammelten Werke in Einzelausgaben erschienen, zudem war er in der DDR als Majakowski-Übersetzer bekannt und als Heinrich-Heine-, National- und Kunstpreisträger hoch dekoriert. Mit dieser klug gewählten symbolischen und sozialen Kapazität als Herausgeber schien eine Druckgenehmigung zur Formsache zu werden.
Problematisch war nur, dass Huppert ein deutlich dogmatischeres Literatur- und Politikverständnis hatte als die VW-Lektoren. Viele der jungen österreichischen Schriftsteller fielen ebenso durch sein sozialistisch-realistisches Raster wie die experimentelle Literatur der Wiener Gruppe, selbstredend inklusive der Texte Ernst Jandls. Acht Jandl-Gedichte erschienen trotzdem, weil Roland Links und Christlieb Hirte, der als Lektor des Verlags mit Huppert um die Zusammenstellung rang und zudem das Verlagsgutachten für die HV schrieb, den offiziellen Herausgeber mit dem Argument überzeugen konnten, dass die Anthologie die österreichische Nachkriegsdichtung in ihrer Gesamtheit vorstellen solle.29 Das hielt Huppert aber nicht davon ab, im Nachwort eine anachronistische Einschätzung der Wiener Gruppe zu veröffentlichen. Die Gruppe, so heißt es in dem Paratext, sei als „rigoroses Experiment bemerkenswert“, aber keineswegs „,revolutionär‘ oder ,innovatorisch‘“. Sie habe zwangsläufig zerfallen müssen, weil „sie ihrer Natur gemäß keine Fühlung, geschweige denn einen Zusammenschluß mit der Arbeiterbewegung finden konnte“. Die „Nachhut“ der Gruppe, namentlich Artmann und Jandl, versuchte er separat zu verlästern und teilte dabei auch einen Seitenhieb gegen den ungenannten Luchterhand Verlag aus:
Dem politischen Inhalt nach bleiben Artmann und Jandl dem anarchistischen Utopismus der ,Gruppe‘ treu, welcher – zutiefst kleinbürgerlich – sich im wirkungslos konfusen Protest gegen rational verwaltete, staatsmonopolistisch gelenkte und ,ideologisch‘ manipulierte Lebensweisen zu erschöpfen droht. Dabei entfernen sich Jandl und Artmann zusehends von ihren besten lyrischen Ansätzen und Leistungen, in welchen sie volksnah waren […] bzw. realistische Antikriegsstimmungen kultivierten. Es kann nicht wundernehmen, daß gewisse Großverlagshäuser der westdeutschen Bourgeoisie, sich als ,aufrührerisch‘ tarnend, gerade diese österreichische Pseudo-Avantgarde marktschreierisch auf den Schild heben und der gestikulativen Wiener und Grazer Sprach-Aleatorik – als harmlosen Klassenkampfersatz – ihren kostspieligen Werbungsapparat zur Verfügung stellen.30
Mit dieser Fülle von belastenden Vokabeln war das Nachwort der SED-Leitlinie deutlich näher als der Band selbst, der die „Pseudo-Avantgarde“ um Jandl im literarischen Leben der DDR zum legitimierten Gesprächsstoff machte. Die Publikation bedeutete auch, dass die Einordnung, gerade die öffentliche und wissenschaftliche, nicht Polemikern wie Huppert überlassen werden musste. Christlieb Hirte versuchte sich 1981 mit seinen „Anmerkungen zur österreichischen Literatur“ in den Weimarer Beiträgen in diesem Sinne als Stichwortgeber. Ihm ging es um eine Aufwertung der Dichtung aus der Alpenrepublik, die, so die Quintessenz, selten direkt gesellschaftspolitisch und ideologisch sei, aber gerade in den 1950er und 1960er Jahren wegen ihrer ästhetischen Konzepte, die sich als „Revolutionierung der Form“ zusammenfassen ließen, keineswegs unpolitisch wirke.31
Mit den beiden Anthologien war das Feld in Sachen Jandl bestellt; der Verlag konnte ihn nun als eingeführten Autor definieren und die Publikation einer Monografie vorantreiben, was man genauso bei Handke und Bernhard sowie mit etwas Verzögerung bei Artmann und Mayröcker machte.32 Diesmal war es Dietrich Simon, der die wesentlichen Argumente für die Publikation im Verlagsgutachten, das mit dem Druckgenehmigungsantrag im Juli 1980 in der HV Verlage und Buchhandel einging und sich auf die Sammelbände Österreich heute und Verlassener Horizont berief, auf den Punkt bringen sollte. Die beiden Anthologien, so Simon, könnten die Lücken bei der Publikation „einige[r] wirklich bedeutende[r] Dichter“ im Leseland DDR nicht gänzlich schließen. „Zu diesen vorstellungswürdigen Autoren gehört Ernst Jandl in erster Linie.“
Nach dieser Eröffnung versuchte der VW-Lektor, Jandl als wahren Erben des in der DDR geschätzten Karl Kraus darzustellen. Außerdem lobte Simon Jandls konsequenten Antifaschismus und Antimilitarismus und pries ihn als einzigen Autor aus dem Umfeld der künstlerisch experimentellen Wiener Gruppe, der „nicht die kritische Auseinandersetzung mit der Realität aus den Augen verloren hat“, was sich auch im Engagement für die sogenannte Grazer Autorenversammlung zeige.33 Mit diesen drei Aspekten – literarische Tradition, politische Einstellung und literarischer Bezug – war eine Argumentationsschiene eingeschlagen, der auch der Außengutachter Klaus Pankow folgte. Pankow wagte darüber hinaus eine Einschätzung von Stil und Form der Jandl’schen Texte, die in den bisherigen Gutachten für die Anthologien wohl bewusst ausgespart waren, weil die Texte nicht in das offizielle ästhetische Raster passten. Er lobte die formale Vielfalt und hoffte auf Anregungen für die literarische Entwicklung in der DDR. Am Schluss seines Gutachtens verband Pankow die Argumentationsebenen:
Neben dem Herausarbeiten künstlerischer Offenheit und Vielfalt wird das Prinzip Antifaschismus und Antimilitarismus als Bindeglied unterschiedlicher literarischer Verfahren ersichtlich. Der auf diese Weise erkennbare (mögliche) Bezug von Sprach- und Gesellschaftskritik ist überaus fruchtbar, nicht zuletzt in den Literatur- und Kunstdebatten unseres Landes.34
Damit stand das Gerüst der Druckgenehmigung für den antifaschistischen, gesellschaftskritischen Autor aus dem kapitalistischen Ausland. Etwas riskant scheint einzig der letzte Satz, der sich auf die junge Literaturszene vom Prenzlauer Berg beziehen ließ, die den Literaturfunktionären nicht ganz geheuer war. Aufschlussreich ist außerdem, was ungesagt blieb: Simon und Pankow verzichteten beispielsweise auf die Information, dass Jandl seit 1951 kritisches Mitglied der SPÖ war, weil das Schlagwort Sozialdemokratismus im Genehmigungsprozess noch immer problematisch sein konnte. Ebenso erwähnten die Gutachter natürlich mit keinem Wort den Einsatz des Dichters für Reiner Kunze nach dessen Weggang aus der DDR.35 Die HV Verlage und Buchhandel hatte letztlich keine Schwierigkeiten, die Druckgenehmigung zu erteilen.36
Im Frühjahr 1981 konnte Augenspiel schließlich in einer Auflage von 1.200 Exemplaren bei Volk und Welt erscheinen. Diese für DDR-Verhältnisse äußerst geringe Zahl war übrigens nicht primär politisch, sondern produktionstechnisch motiviert: Das Buch erschien bei VW in der Weißen Reihe, deren Umschläge aus halbtransparentem Seidenpapier bestanden, das nicht maschinell, sondern von Hand umgelegt werden musste. Ungeachtet der kleinen Auflage dankte der Autor seinem neuen Lizenzverlag und dessen Leiter Jürgen Gruner gleich doppelt, nämlich für die Auswahl mit dem Nachwort von Joachim Schreck und für die Einladung zu einer Lesung im Rahmen der Leipziger Frühjahrsmesse 1982. „Sie und Herr Simon […] wissen“, so Jandl, „daß ich gern einmal in der DDR aus meinen Gedichten lesen möchte.“37 Um das Nachwort, die Rezeption des Bandes und die Lesungen soll es im Folgenden gehen.
Joachim Schrecks Nachwort lag bereits dem Druckgenehmigungsantrag bei und kann als eine Art drittes, öffentlichkeitswirksames Gutachten interpretiert werden, weil es zusätzliche Argumente für die Publikation lieferte. Außerdem konnte Schrecks Text als pflichtgemäßer Einsatz des Verlags im Sinne der politischen Forderung gepriesen werden, den Lesern in der DDR eine Rezeptionsanleitung mitzuliefern, die auch den wissenschaftlichen Diskurs beeinflussen sollte. In der Praxis waren allerdings nur wenige dieser wichtigen Paratexte streng parteilich; vielmehr scheinen die meisten Vor- und Nachworte ähnliche Balanceakte wie die Gutachten gewesen zu sein, in denen es vor allem darum ging, politische Einwände zu antizipieren, aber gleichzeitig möglichst wenig literaturpolitische Schablonen zu bedienen. Das war auch der Anspruch Schrecks, der seit einigen Jahren bei Volk und Welt als „fester Freier“ arbeitete, nachdem er seine Lektorenstelle bei Aufbau nach einem politischen Verfahren verloren hatte.
Schreck eröffnete seinen Text außerordentlich geschickt, indem er neben August Stramm und Wilhelm Klemm mit Johannes R. Becher eine hochdekorierte literarische und politische Autorität der DDR als Vorbild Jandls nannte, als selbsternanntes Vorbild sogar.38 Im Anschluss daran versuchte er eine abwägende literarische Annäherung an Jandls Werk. Interessant ist in diesem Kontext seine Einschätzung der Konkreten Poesie: Im Anschluss an zwei Zitate des Dichters stellte Schreck die rhetorische Frage, ob „diese ,konkrete Poesie‘ nun eine elitäre Angelegenheit [ist], wie oft behauptet wird, eine Privatsache, weitgehend unverständlich für die Umwelt“, ein bewusster Kommunikationsbruch also, mit dem der Autor den Leser überfordert.39 Das entsprach der offiziellen Linie bezüglich dieser Art von Dichtung in der DDR. Schreck betonte aber gleich im Anschluss, dass Konkrete Poesie andererseits „einen kritischen Reflex auf den Zustand der Sprache darstellt“, „auf Versteinerungen im Sprachgebrauch aufmerksam macht, Verkrustungen und Perversion von Sprache denunziert, Banales und Sinnentleertes von Sprachklischees durch Sprachwitz verhöhnt“.40 Außerdem, so heißt es im Nachwort weiter, versage Jandl den „Puristen unter den ,Experimentellen‘“ ohnehin die Gefolgschaft und kommentiere „den Isolierungsprozeß, dem die extreme Richtung der ,konkreten Poesie‘ verhaftet ist, deutlich mit Bedauern und Ablehnung“.41 In diesem Sinne war Jandl also ein Autor für das Volk.
Dass Jandl mit seiner Dichtung trotzdem noch ein heißes Eisen blieb, indiziert die sehr schmale öffentliche Rezeption von Augenspiel. Einzig der schon als Gutachter in Erscheinung getretene Klaus Pankow sowie Ursula Heukenkamp wagten größere Besprechungen, die erst mit spürbarem zeitlichen Abstand zur Veröffentlichung in den Weimarer Beiträgen und in Sinn und Form erschienen. Auch hier fanden sich Schlagworte wie Humanität oder Antifaschismus und konsekratorisch wirkende Namen wie Brecht, Tucholsky oder Weinert, die mit bestimmten Zügen in Jandls Dichtung in Verbindung gebracht wurden.42 Dass der österreichische Dichter im literarischen Leben der DDR nun endgültig angekommen war, lässt der Einstieg Pankows erahnen, in dem auch die geschickte Vor- und Nachbereitung der Publikation im Leseland zusammengefasst wird:
Ernst Jandl ist in der DDR schon seit einiger Zeit kein Unbekannter mehr. Seine Lesungen im Berliner Theater im Palast im Januar 1982 fanden ein zahlreiches und begeistertes Publikum, das gewiß auch durch den Abdruck des Hörspiels Fünf Mann Menschen und einiger Gedichte des Autors in den Sammelbänden Österreich heute (1978) und Verlassener Horizont (1980) auf eine vielgestaltige und grenzüberschreitende Kunst vorbereitet war.43
Die erste „Lesung“ in der DDR hatte der Autor übrigens bereits einige Wochen vor den von Pankow erwähnten Veranstaltungen gehabt. Jandl gehörte nämlich neben dem Wissenschaftler Engelbert Broda, dem in London lebenden Dichter Erich Fried sowie dem Schriftsteller und Naturwissenschaftler Robert Jungk zu den vier österreichischen Staatsbürgern, die an der ersten Berliner Begegnung zur Friedensförderung im Dezember 1981 teilgenommen hatten. An der oft hitzigen und kontroversen Diskussion beteiligte sich Jandl nicht; er mischte sich einzig in die Friedensgespräche ein, indem er seine drei antimilitaristischen Gedichte „vater komm erzähl vom krieg“, „schtzngrmm“ und „fragment“ vorlas.44
Exakt einen Monat nach den Friedenstreffen war er erneut nach Ost-Berlin geladen, um am 18. und 20. Januar 1982 im TiP zu lesen. Das Theater im Palast war eine Kulturbühne im Palast der Republik, dem Sitz der Volkskammer der DDR, auf der neben Schauspiel und Musik auch Schriftstellerlesungen stattfinden konnten. Die Intendantin Vera Oelschlegel hatte sich einen erstaunlichen Spielraum für ihre Veranstaltungen erkämpft, der einerseits ihrer Hartnäckigkeit und ihrer Popularität als Schauspielerin und Regisseurin geschuldet, andererseits aber wohl auch durch ihre „geschickte Heiratspolitik“ entstanden war: Nach einer ersten Ehe mit dem Drehbuchautor Günther Rücker und einer zweiten mit Hermann Kant war sie mittlerweile mit Konrad Naumann liiert, der als Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin und Mitglied des ZK-Politbüros zu den einflussreichsten Kadern in der Hauptstadt gehörte.
Ein organisatorisches Problem war nun, dass die Popularität Jandls und das damit einhergehende Interesse an den Lesungen in keinem Verhältnis zu der geringen Zahl gedruckter Texte standen. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass er vielen heimlichen Lesern, Hörern und Zuschauern schon vor der Publikation ein Begriff war. Diese wollten Jandls Bühnenpräsenz nun live erleben und strömten, so Chris Hirte, mit „einem unglaublichen Hunger nach fremdem Geist, nach fremder Literatur“ zu den Lesungen.45 Der Saal war deswegen bis auf den letzten Platz besetzt; und diejenigen, die keine Karte mehr bekommen hatten, verpassten einen furiosen Auftritt des österreichischen Gasts, der seine Performance-Qualitäten unter Beweis stellte und nun auch in der DDR, mit den Worten von Bernhard Fetz, als eine Art „Dichter als Popstar“46 gelten konnte. Kaum zurück in Wien, schrieb Jandl „erfüllt von der Sympathie und Freundlichkeit meiner Gastgeber in Berlin“ begeistert an den VW-Verlagsleiter Jürgen Gruner. Verärgert war er nur wegen einer anderen Sache:
(Kurz nach meiner Ankunft in Wien wurde ich aus Westberlin von einem Mitarbeiter eines mir bisher nicht bekannten Blattes, die Tageszeitung bzw. taz, angerufen, der von mir wissen wollte, wieso meine Lesung am 18. Januar in Berlin-DDR ,verhindert worden‘ sei. Ich konnte ihm nur sagen, daß ich am 18. und am 20. Januar im Theater im Palast gelesen hatte, ohne irgend etwas an Unruhe zu bemerken, und daß er, falls er eine Bestätigung dafür brauche, beim österreichischen Botschafter anfragen möge. Mir wurde zugesagt, man werde die unzutreffende Meldung zwar aus der westberliner Ausgabe dieser Zeitung entfernen können, vermutlich jedoch nicht aus der Ausgabe, die in Hannover gedruckt wird, aber dort werde man für ein Dementi sorgen. Ich bedaure zutiefst, daß die ebenso unwahre wie dumme Meldung in der westdeutschen taz vom 22.1.1982 erschienen ist, und bin verärgert über die Art, wie diese Meldung dann in der taz vom 26. Januar dementiert wurde.) Ich wünsche mir eine gute Weiterführung meiner Kontakte in der DDR und werde immer gerne zu Besuchen und Lesungen in Ihr Land kommen.47
Jandls Groll war verständlich, denn der Artikel auf der ersten Seite der linksalternativen Zeitung vom 22. Januar kam in der DDR sicher nicht besonders gut an. Dort hieß es nämlich, der Saal im TiP sei ausschließlich mit Stasi-Leuten besetzt gewesen. Die echten Jandl-Fans seien hingegen nicht hereingelassen und der Autor selbst sogar verhaftet worden:
Vor der Tür hielt ein Mann ein Plakat hoch, Schild am Stock: „Suche dringend Karte für Ernst Jandl“. Er wurde, selbstverständlich, dringend verhaftet. Denn wer tut sowas? Na, Ernst Jandl. Die ,öffentliche‘ Lesung fiel aus.48
Diese groteske Anekdote wurde zwar am 26. Januar in der taz korrigiert. Doch auch die Richtigstellung war für eine „gute Weiterführung“ der Kontakte des Dichters in die DDR in ihrer Art und Weise nicht unbedingt förderlich, denn dem Dementi war das 1976 entstandene Gedicht „an einen grenzen“ angehängt, in dem das lyrische Ich in „heruntergekommener Sprache“49 einen DDR-Grenzer mit den Namen Wolf Biermann, Reiner Kunze und Ernst Jandl konfrontiert, die als deutschsprachige Autoren nicht in der DDR erscheinen durften.50 „Das ist ein echter Jandl-Vers“, hieß es dazu in der taz, „und doch stimmt er überhaupt nicht mehr (schade), nachdem Jandl beim Verlag Volle & Welt [sic!] verlegt wird und Lesungen hält.“51 Die Präsenz im literarischen Leben der DDR galt der taz demnach als Ausdruck für politischen Opportunismus.
Diese wenig förderliche Berichterstattung änderte aber nichts daran, dass Jandl mit der Publikation im Osten Deutschlands auch staatlicherseits akzeptiert war. Nach einer weiteren Lesung im Oktober 1983 brachte sogar das Neue Deutschland, das als Zentralorgan der SED für die Vermittlung und Korrektur der offiziellen Linie, an der sich die Verlage und die HV zu orientieren hatten, von außerordentlicher Bedeutung war, auf der Titelseite eine lobende Notiz. Auch hier fielen wieder die Namen Kraus und Becher, und auch hier fanden einige Schlagworte aus dem hegemonialen Diskurs Verwendung:
Viele seiner Poesien zeichnen sich durch antifaschistische und antiimperialistische Haltung aus. Den Teufelskreis der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen er lebt, durchbricht er energisch auf ästhetische Weise. Seine Kunst beruft sich auf den menschlichen Wert, die Liebe vor allem („du warst zu mir ein gutes mädchen“) und baut auf die Kraft des arbeitenden Volkes („zeichen“).52
Diese anerkennende Einschätzung im Leitmedium der SED ist ein Beleg für die offizielle Anerkennung eines Dichters in der DDR, dessen Texte es zehn Jahre zuvor noch nicht einmal bis zum Druckgenehmigungsantrag geschafft hatten und dessen Dichtung zwanzig Jahre zuvor noch als „künstlich infantilisierte Hack-Prosa“53 verspottet worden war. Damit verlor auch die Rezeption Jandls in den beginnenden 1980er Jahren ihren klandestinen Charakter.
Ein Held des DDR-Undergrounds blieb Jandl trotzdem, konnte es jetzt sogar in Persona werden: Nach einer der offiziellen Lesungen im Januar 1982 gelang es einigen jungen Kulturschaffenden, den berühmten Autor in den Prenzlauer Berg zu „entführen“, wo er in der Wohnung der Fotografin Helga Paris vor einem ausgewählten Kreis las. Die „,Jandlianer‘ der DDR“, namentlich Bert Papenfuß, Stefan Döring oder Jan Faktor, lasen im Anschluss, wie sich Adolf Endler erinnert. Für Endler, Spiritus Rector der jungen Dichtergeneration, wirkte es „wie blanker Hohn“, dass plötzlich „Jandl im Landl“ war und im TiP lesen durfte, während
die ihm geistesverwandten jüngeren Autoren im Landl jedoch mit striktem Auftrittsverbot geschlagen sind, von der Drucklegung ihrer Werke ganz zu schweigen: Nach innen dumpfer und höhnischer Terror, da man gleichzeitig dem Österreicher und anderen gegenüber demonstriert, wie ,großzügig‘ man in ,ästhetischer Hinsicht‘ zu denken gelernt hat, wenigstens solange die ,Protokollveranstaltung‘ dauert.54
Dieser Kontrast indiziert, dass das Etikett einer allgemeinen Liberalisierung des Literatursystems der DDR zu Beginn der 1980er Jahre, für die z.B. auch die Publikation der Österreicher Handke, Bernhard oder Artmann sprechen könnte, keine generelle Gültigkeit besitzt. Das ist im Fall Jandl vor allem deshalb interessant, weil sich im Prenzlauer Berg eine Autorenriege gebildet hatte, die einen ähnlichen Umgang mit dem sprachlichen Material pflegte, die eine poetische Sprache auf spielerisch-destruktiven Wegen als „Gegen-Sprache in Opposition zur Herrschaftssprache“ entwickelte.55 Paradoxerweise hatte die Veröffentlichung der Jandl-Texte für die Veröffentlichungsmöglichkeiten der Prenzlauer-Berg-Autoren nicht zwangsläufig positive Folgen, weil die politisch-künstlerische Argumentation gegen die unbequeme Underground-Literatur laut Gerhard Wolf nun wie folgt lauten konnte: „wir haben ja schon Jandl gedruckt, warum sollen wir noch Papenfuß…“56
Während die Prenzlauer-Berg-Autoren bei den DDR-Verlagen also nach wie vor einen schweren Stand hatten, bestellten sowohl der VW-Lektor Dietrich Simon als auch Klaus Pankow, Lektor bei Reclam Leipzig, 1985 die erste Jandl-Werkausgabe bei Luchterhand in Darmstadt, weil sie größere Veröffentlichungen planten.57 1987 erschienen bei Volk und Welt schließlich die Frankfurter Poetikvorlesungen Jandls unter dem Titel Das Öffnen und Schließen des Mundes. Ein Jahr zuvor war der österreichische Dichter sogar als korrespondierendes Mitglied in die Ost-Berliner Akademie der Künste aufgenommen worden. 1988 erschien schließlich die dritte Auflage vom Augenspiel, seinem DDR-Debütband, die dem Ästheten Jandl ganz besonders zu gefallen schien. „Ich freue mich über die große Aufmerksamkeit, die meinem Buch zuteil wird, und über seine gute Betreuung durch Ihren Verlag“, schrieb er an den VW-Verlagsleiter Gruner und fügte hinzu: „auch die verbesserte Papierqualität war sogleich zu bemerken.“58
Konstantin Ulmer, aus Konstantin Ulmer: VEB Luchterhand?. Ein Verlag im deutsch-deutschen literarischen Leben. Ch. Links Verlag, 2016
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Dorothea von Törne: „schtzngrmm“
Sonntag, 11. 4. 1982
Ursula Heukenkamp: schreiben und reden in einen heruntergekommenen sprachen
Zeitschrift für Germanistik, Heft 2, 1983
an einen grenzen
– Ernst Jandl in der DDR. –
Jetzt auch wir gekommen sein an einen grenzen. Und was geschieht? Die Grenze verschwindet. Aber sie bleibt doch. Überall. Der gegenwärtige Zustand des zerfallenden Landesteils „Deutsche Demokratische Republik“ ist nicht zu beklagen; wer mehrheitlich den Anschluss gewollt hat, der soll nun nicht zaudern. Immerhin, die Heldenplatz-Atmosphäre des Frühjahrs ist vergangen und hat einem dumpfen Lauern Platz gemacht. Das wird sich entladen, im Herbst, und es wird die Ausländer treffen, die Kommunisten, die Schwulen, die intellektuellen Spinner. Und die verschwundene Grenze wird in den verwirrten Köpfen weiterwuchern, sie wird ein Geschiebe aus Selbsthass, Intoleranz und Sentimentalität festigen helfen. Die DDR kann gar nicht untergehen. Erich Honeckers hochgemute Prognosen erweisen sich als völlig korrekt. Das sind keine schlechten Zeiten für Literatur, denke ich, ohne sogleich zu schließen, dass die außerordentliche Schamlosigkeit der Mächtigen der Literaturproduktion besonders förderlich sein müsse.
Ernst Jandls Arbeit hat auf das Denken, Reden und Schreiben nicht weniger Intellektueller in der DDR Einfluss gehabt. Dabei ging es nicht vorrangig um die schöne Entdeckung, dass das Material Sprache im freien Spiel der Assoziation zu so etwas wie Wortwitz führen konnte. Im Mittelpunkt des Interesses an Jandl stand für viele das Prinzip der selbstverständlichen Entfernung von den Diskursen der Mächtigen. Die Jandlschen Sprachbewegungen und „Sprachüberraschungen“ eröffneten tatsächlich Frei-Räume. Nun hatte das Sich-Verweigern nichts Spektakuläres oder Sektiererisches mehr an sich. Jandl-Leser wurden ganz einfach unfähig, die offiziellen Sprachen des real existierenden Sozialismus zu verstehen.
So mussten sie auch nicht mehr gegen die Sprachlügen der anderen protestieren, das war unwichtig und langweilig geworden, Ernst Jandl hat das, was in den Feuilletons als „Prenzlauer-Berg-Literatur“ gehandelt wird, aufmerksam verfolgt. Für Bert Papenfuß-Goreks ersten „richtigen“ Gedichtband harm schrieb Jandl das Vorwort. Die Texte Ernst Jandls waren über Jahre hinweg nur in wenigen und unzulänglichen Ausgaben greifbar. Joachim Schreck machte mit der Auswahl Augenspiel im Ostberliner Verlag Volk und Welt einen Anfang. Das war 1982, und es war nicht selbstverständlich. Das gesunde Volksempfinden regte sich schon; erbitterte Leserbriefe an den Verlag waren die Folge. Aber: keine Verbote. Latentes Misstrauen, gewiss. In mehreren großen Lesungen im Palast der Republik (!) erreichte Jandl tausende ZuhörerInnen. Die Frankfurter Vorlesungen bei Volk und Welt und ein illustriertes Bändchen im Kinderbuchverlag folgten dem Augenspiel. Heute, im Sommer 1990, ist alles ganz anders, Ein dicker Reader inklusive Tonkassette bei Volk und Welt, eine umfangreiche und illustrierte Gedichtausgabe bei Reclam, und Glückwünsche von vielen… wir wünschen alles alles Gute… Und wie geht es weiter? Ernst Jandls Texte einer endgültigen Distanzierung wirken weiter, werden weiterhin gelesen und gebraucht. Keine Klagen, keine Sentimentalität. Jandlsche „idyllen“ und „sprüche“ zeigen das, was ist, dafür muss ihrem Verfasser gedankt werden!
Es ist alles ganz anders in diesem Sommer, und es hat sich nichts geändert:
ich bin nicht gerne, wo ich bin
ich wäre nicht gerne, wo ich nicht bin
ach, wäre ich gerne, wo ich nicht bin
wäre vielleicht ich lieber, wo ich bin
Klaus Pankow, Wiener Zeitung, Literaturmagazin LESEZIRKEL, Nummer 46, 1990
Adolf Endler: Eine Reihe internationaler Lyrik, Sinn und Form, Heft 4, 1973
JANDL
Blaablaablaablas
vonjandl
fürweneigentlich
Würdeerfehlenaufderszene
wenner – uuuuuuh…
ersticken würd’ an
seinem talk:
blaablaablaablas
Jürgen Völkert-Marten
ERNST JANDL
War einst Hunger bins nu satt
Bin hungrig nach Wald
Baum Baum um
Baum Baum Baum
Baum bis eine Millionen
im Bauch und den
Nichtbaum auch
Ist ein
Waldhaus in
meiner Brust
klopft nach Waldeslust
klopp klopp klopper
Dennis Hopper
Ein Mund ein Tor
Die Zunge ein Tritt
Mann und Maus
Huhn noch Rind
Nur Frauen
Besser angezogen
Sind
viel Fett im Bett
Viel Haar am Kissen
Kopf Zahl
Köder Schaf
Und nun
Sei brav
Leckerbissen
Peter Wawerzinek
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + ÖM + KLG + IMDb + PIA +
Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl − Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


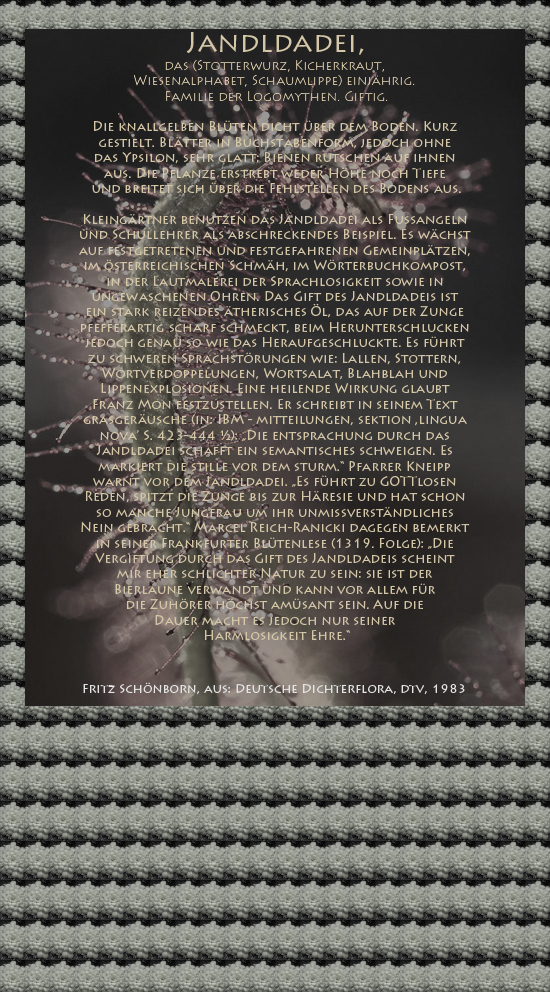












Den hier publizierten Text „Jandl“ schrieb ich 1970. Damals war ich 20, 21 Jahre alt, also alles andere als ein „gestandener“ Autor. 1976 lud die Zeitschrift „die horen“ quasi zu einem „Autorenbashing“ ein und sammelte entsprechende Texte, die dann in der Ausgabe 103 (Herbst 1976) erschienen. Ich war wohl so angetan von der Möglichkeit, in der Zeit sogenannter „Alternativliteratur“ in dieser renommierten Zeitschrift drei Texte veröffentlichen zu können, dass ich den fiesen Inhalt und die desaströse Qualität meines Textes „Jandl“ wohl unbewusst selber wahrnahm, aber für diese Veröffentlichungsmöglichkeit in Kauf nahm. Es dauerte nicht lange, bis ich für meinen Jandl-Text nur noch Scham empfand. In der eigenen Liste, welche Texte ich in jungen Jahren nie zur Veröffentlichung hätte freigeben sollen, ist dieser Text an der Spitze… Er erschien auch einzig in den „horen“ und ansonsten nirgendwo.
Ich hatte die Chance, mich zu Lebzeiten bei Jandl dafür zu entschuldigen und möchte dies hier noch einmal tun.
Einen großen Teil von Jandls Einzelveröffentlichungen besitze ich persönlich und las sie intensiv durchaus mit Neugier und Freude. Auch schon in den 70er-Jahren. Sein Gedicht „Im Delikatessenladen“ steht nach wie vor in den Top-Ten meiner Lieblingsgedichte.
Jürgen Völkert-Marten, im Jahr 2019