Hans-Eckardt Wenzel: Lied vom wilden Mohn
WIR SUCHTEN DAS VERBINDUNGSSTÜCK
Wir suchten das Verbindungsstück
Den ganzen Nachmittag. Außengewinde,
Innengewinde, Versatz, Dichtungen und
Wahrheiten, Engelshaar, Anschlüsse verfetten,
Sieben Drehungen links, Bier
In der Hand. Andre zur gleichen Zeit
Verzweifelten oder warfen
Bomben, schmierten
Marmeladenbrote, Kosmonauten
Scherzten in Sauna, Fruchtbarkeitskult
Afrikanischer Stämme,
Werkzeugmaschinenexportplanerfüllung,
Wie immer entgleiste ein Zug, ein Staatschef
Schoß in sich, ein Franzose, nachts
Ballerte wegen Lärmbelästigung
Mit Jagdflinte auf Gastarbeiter
Am Preßlufthammer, Bäume
Schluckten bis zum Komma ze=oh=zwei.
Mehrere Winkel setzten wir ein, unsinnige
Wege, schüttelten den Kopf, nochmal,
Einzeln paßten die Muffen; ein winziges Stück halbzoll
Wasserleitung in Europas verzollter
Sanitärkonstruktion beschäftigte
Unsere speziellen Gehirne. Wir suchten
Das Verbindungsstück.
Schreib Lieder,
sagen die Gedichtemacher, schreib Gedichte, sagen die Liedermacher. Schreib Prosa, fordern die Essayisten. Hör auf zu schreiben, sagen ganz andere. So ein Durcheinander (unseriös!), eine Mixtur der Genres, fließende Grenzen. Hat der Mann keinen Standpunkt, fragen die Vertreter poetischer Statik.
Kennen Sie Chiron? Den fabelhaften Centauren, halb Pferd, halb Mensch. Zerrissene Doppelexistenz, an der wir uns mitleidend erbauen – weil wir doch, ach, so einig in uns selbst ruhen.
Daß wir uns bloß nicht irren, sagt W., scharrt mit den Hufen und kippt seine Textmappe über unsere Häupter aus. Metallig glänzende Texte, stinkend nach Gebrauchswert, ungefeilt, wie herausgefetzt aus dem Bleistrom der Zeiten, armer Chiron, daß du die Extreme in dich hineinholen willst. Du weißt, wohin das führen kann. Daß du es nach wie vor nicht bequem haben willst.
Du aber sagst: Ich allein bin mir zu wenig. Trauriger Pegasus, der du Chiron heißt, darum schnaubst du so (unseriös!) und hechelst, nach vorn, nach vorn! Der ist ja verrückt, sagen einige deiner Freunde. Mag sein, aber die Kinder und die Narren, was plapperten die, wie hieß das doch gleich?
Steffen Mensching, Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1984
Lied vom wilden Mohn:
Die erste große Sammlung Wenzels. Sehnsucht nach Welt, nach der Totalität bestimmen diese Texte. Die „Schmuggerower Elegien“ bilden das Zentrum des Buches. Auch erste Lieder sind hier in handschriftlicher Notierung abgedruckt.
Homepage Hans-Eckardt Wenzel, Ankündigung
Genauigkeit in Stimmung und Gefühl
– Bemerkenswerte lyrische Debüts von Steffen Mensching und Hans-Eckhardt Wenzel. –
Von Steffen Mensching und Hans-Eckhardt Wenzel lagen bisher je ein Poesiealbum sowie Texte in Zeitschriften und Anthologien vor. Kürzlich sind etwa zur gleichen Zeit die Gedichtbände Erinnerung an eine Milchglasscheibe von Mensching und Lied vom wilden Mohn von Wenzel erschienen. Beide Lyriker wirkten jahrelang als Autoren und Akteure im Liedtheater Karls Enkel eng zusammen. Die kollektive Erarbeitung von Programmen fördert Genauigkeit im Denken, man lernt, sich selbst gegenüber kritisch zu sein.
Beide Autoren wollen mit ihren künstlerischen Mitteln an gesellschaftlicher Entwicklung mitwirken und Verantwortung übernehmen. Auf dieser Ebene haben sie zusammengefunden. Das Liedtheater bot zudem beiden die Möglichkeit, im unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum Reaktionen auf ihre Lyrik sofort zu erfahren, festzustellen, ob und wie sie verstanden worden sind. Das kam ihren Texten, wie die vorliegenden Bände zeigen, zugute.
Mensching und Wenzel sind auf Kommunikation bedacht.
Beide Autoren lassen Gemeinsamkeiten erkennen, die sich auf Haltung und Wirkungsabsicht beziehen. Dabei hat jeder von ihnen eine eigenständige künstlerische Handschrift entwickelt.
(…)
Hans- Eckhardt Wenzel verwendet vor allem die Liedform. Das Lied ist ein Genre, das sich an eine breite Öffentlichkeit wendet. Wenzels Lieder und Gedichte verlangen, bei scheinbarer Einfachheit und Eingängigkeit, genaues Hinhören oder Lesen. Hinter dem Spielerischen im Umgang mit Alltagserfahrungen werden Gefühle und Stimmungen eines Menschen sichtbar, der das Leben bejaht.
Freude und Trauer, Begegnung und Trennung sind in Wenzels Texten Momente, die zum Leben gehören und die die Persönlichkeit bereichern. Selbst wo das Erlebnis persönlichen Schmerzes mitklingt, spürt man das Bemühen, eine aktive Haltung zu bewahren. Er plädiert für ein Lebendigsein im schöpferischen Sinne.
Bei historischen Persönlichkeiten sucht Wenzel nach dem Punkt, der darüber Aufschluß gibt wie sie ihre Aktivität auch unter schwierigsten Umständen bewahren konnten. („Max Hoelz“. „Ich braue das bittere Bier, für Erich Mühsam“). Hölderlin nimmt dabei einen zentralen Platz ein. Sechs Gedichte sowie der Essay „Chiron oder Die Zweigestaltigkeit“ beziehen sich auf diesen Dichter. Hölderlins Leben und Werk erweisen sich bei Wenzel als geeignet, die persönliche Haltung zur Dialektik von Ideal und Wirklichkeit genauer zu bestimmen und Schlußfolgerungen für eigenes Handeln zu ziehen.
Michael Hähnel, Neues Deutschland, 7.8.1985
Die Gedichte von Hans-Eckardt Wenzel
sind nicht mit der kleinen Nadel gemacht, in ihnen spürt man den Strom der Geschichte, die Träume und Utopien der Dichter und Philosophen, die eigenen Erlebnisse in der Zeit. Wenzel, ein Kind der DDR, kennt die Vorzeit, auch die jüngere, nur vom Hörensagen, er hat aber sein Poetenohr überall dort, wo wesentliches in der Geschichte geschah…
Nicht nur bedenkliche Gewöhnung vom möglichen großen Gefährdetsein fühlt sich der Lyriker betroffen. In Angst versinkt er nicht, zu viel sieht er noch vor sich: möglichst jederzeit einen Platz voller Leute, Städte, Kontinente, Meere, Sehnsucht nach großer geschichtlicher Aktion. Alles Dinge, die man mit dem Wort „Optimismus“ nur unzureichend umschreiben könnte.
Waltraud Mohnholz, Berliner Rundfunk
„… Dich zu treiben bis aufs Blut“
Mensching/Wenzel. Das Namenspaar hat sich längst eingeprägt. Es verbindet sich fest mit den Programmen der Gruppe Karls Enkel. Und diese Programme erregten ein nachhaltiges Interesse, weil sie sich dem Sog kunstgewerblich betriebener Verliederung widersetzten: Sie zu genießen wie einen rötlich überhauchten Herbert-Roth-Abend, das ging (und geht) nicht.
Indessen publizierten beide auch schon in Zeitschriften und Anthologien; 1979 gab es ein Mensching-, 1983 ein Wenzel-Poesiealbum; und nun liegt von beiden je ein umfangreicherer, den Ertrag etlicher Jahre präsentierender Gedichtband vor: Mensching bündelte 61 lyrische Texte, Wenzel 51 sowie einen Essay. Und dieses buchpublizistische Doppeldebüt ist natürlich fällig gewesen. Kein Zweifel aber auch, daß ihm hochgespannte Erwartungen galten: Erwartungen, welche man den als gültig ausgewählten Versen zweier – und nicht etwa noch blutjunger – Schreibender entgegenbrachte, die eben die Bürde eines Rufs schon besitzen und die als Exponenten ihrer Generation bereits im Bewußtsein sind. Und insofern handelt es sich nicht um gewöhnliche Debütbünde. (Auf ihre Weise belegt dies übrigens die Kaufbegierde der Literaturfreunde. Beide Bücher waren sogleich vergriffen.) In ihnen lesend, mißt man – unwillkürlich – das nackte und bloße Wort an einem Anspruch, den die möglichkeitsreichen Akteure des Liedertheaters zustande kommen ließen.
(…)
Im Gespräch mit Karin Hirdina (Temperamente 4/1984) hat Wenzel dies zu relativieren versucht – vielleicht deswegen, weil er sich öffentlich gegen ein Wenzel-Bild wehren wollte, das ihm als klischeehaft erscheint. Hält man sich aber an den Band selbst, so wird man kaum geneigt sein, der im Gespräch formulierten Selbstaussage zweifelsfrei zu folgen. Und die „Unpoetische Vorbemerkung“ zum Band spricht ihrerseits eine klare Sprache:
Lieber mit offener Brust auf der Bühne stehen, als hier zwischen den Zeilen versteckt…
Im Grunde also weiß er es genau und richtig, wenn er sich hier als einen Mann bezeichnet, für den der direkte Kontakt mit Publikum eine Conditio sine qua non bedeutet; tatsächlich bedarf er, um sich angemessen mitteilen zu können, der Musik, der Gestik, der Mimik, der mündlich-artikulatorischen Möglichkeiten. Das Wort hingegen, das für sich selbst einzustehen hat, ist seine Sache nicht. Insofern aber ist auch der vorliegende Band mit dem von Mensching schwer zu vergleichen: Charakteristisch für diesen Band ist ja schon, daß er eine größere Zahl dezidierter Liedtexte umfaßt, daß hierzu die entsprechenden Noten beigegeben sind und daß damit also einer Lektüre, die sich pur an die Verse hält, entgegengewirkt wird. Der Leser freilich sieht sich so in der mißlichen Situation, den Text nicht „für sich“ nehmen, zugleich aber auch nicht vom sinnlich-unmittelbaren Eindruck des Vortrags ausgehen zu können. Und er muß sich gleichsam für inkompetent erklärt finden, dem gedruckt Vorliegenden kritisch nachzufragen. Aber er tut es, zumal ihm die Titelseite einen „Gedicht“-band verheißt, natürlich dennoch – und dabei wird er, indem er die Liedtexte wie auch die anderen Verse liest, zunächst der Betonung eines individuellen Anspruchs inne, der schroff auf Selbstbehauptung besteht. In der Tat gibt sich das Ich in Wenzels Versen durchaus „ungehobelter“ als bei Mensching. Bezeichnenderweise findet sich ein Max-Hoelz-Gedicht. („Auf mich scheißen, schießen, spucken / Kann jeder, ders besser weiß! / Ich bin Holz der Verzweiflung, Splitter / Hoffnung; brennbar, Brücke / Über dem reißenden Eis.“) Erich Mühsams wird gedacht – unter anderem mit den Versen:
Ich spucke die Galle, das Gift,
Ich streue den Sand in das Brot.
Ich laß meine Hoffnung nicht,
Ich raufe und leb mich tot.
Und auch an den roten Hölderlin wird erinnert, wie ihn seinerzeit Pierre Bertaux vergegenwärtigt hatte. Darüber hinaus schlagen sich allenthalben Grimm und Ingrimm, Sarkasmus und zähneknirschender Unmut, aufrührerische Lust und nervöse Ungeduld nieder.
Dabei strebt auch Wenzel nach größtmöglicher Weitung des Horizonts. Klassische Dichter werden heraufgerufen (neben Hölderlin mehrmals Goethe); er bezieht sich auf Marx, auf Lenin; der Blick richtet sich auf denkwürdige geschichtliche Vorgänge: Elementarer Hunger nach Welt zeigt sich an; und indem eruierte Abläufe, Haltungen, geistige Reaktionen, zurückweisend auf bewegte Historie, herbeigedacht und diskutiert werden, sucht sich das Ich zugleich hinauszusteigern aus seiner empirischen Existenz. So wird auch der Sehnsucht des Ichs, den Bedingungen dieser Existenz zu entfliegen, sich über Grenzen zu erheben, die Gestalt eines allumfassend an Welt unmittelbar Teilhabenden zu gewinnen, wieder und wieder Ausdruck gegeben. Gleichermaßen jedoch bleibt die unlösbare Bindung an den Status determinierter Existenz jederzeit bewußt; wache Aufmerksamkeit gilt der Reflexion des durchlebten Augenblicks; zu extensiver Mitteilung drängt disparate Erfahrungs- und Selbsterfahrungswirklichkeit.
Diese hier bezeichnete Polarität – die im übrigen auch nähere Auskunft über die Wenzelsche Hölderlin-Affinität gibt –, stiftet eine erhebliche Spannung; und da Wenzel ein zum Ausgleich neigendes Naturell nicht besitzt, erweist sie sich gar als eine „eigentlich“ ungeheuere.
Allerdings: In den Texten selbst realisiert sie sich nicht adäquat. Denn leider ist Wenzel ein sprachlicher „Schlamper“, wie er im Buche steht; seiner diesbezüglichen Selbstaussage (vgl. Hirdina-Gespräch, S. 40) ist nichts hinzuzufügen. So aber besteht das Grundübel seiner Verse darin, daß er seine Aussageintentionen völlig widerstandslos einer impulsiven Rede überläßt, die ihnen nur allzu oft unangemessen ist, die, als eine sorglos „benutzte“, die Texte ins Mittelmäßige oder gar ins Stümperhafte herabzieht und damit das potentiell Explosive entschärft.
Und es verkommt auf diese Weise mancher Text zur billigen Liedermacher-Schnulze, von solcher Güte etwa:
Die Wohnung des Menschen heißt Erde
Bleibt uns doch die eine bloß
Trotz der lichtweiten Flüge
Kommen wir von ihr nicht los
Trivialitäten tummeln sich – Heine-Nachfolge in jener geläufigen Ausprägung, wie sie Karl Kraus bezeichnet hat. (Vgl. zum Beispiel „Das Abschmink-Lied“: „Stechend ist in meiner Rippen / Käfig mir mein Herz gesprungen.“) Den Kästner-Sound im Ohr, verfällt ihm Wenzel prompt. Ob dieser Sound im bestimmten Falle passend ist – es schert ihn einfach nicht. („Winter“: „Der Schnee fällt weiß und wälzt sich auf den Steinen. / Die Toten frieren. Blaß klirrt mein Gesicht. / Die aufgerissne Straße schmerzt mich an den Beinen. / Auf meiner Netzhaut brennt das Licht.“) Einige andere Texte wiederum erschöpfen sich in der Auflistung abstrakter Behauptungen. (Siehe hierzu: „Ich braue das bittere Bier“). Wobei aber selbst dies noch dem Leser zugemutet wird, daß sich derartige Behauptungsverzeichnisse in neudeutscher Bürokratensprache präsentieren. Der Fall ist das beim „Lebenslied“: „Ich plane die Schmerzen mit ein… // Ich plane das Herzweh mit ein… // Ich plane den Ärger mit ein…“ usw. Doch nicht nur hier, auch anderweitig bezeugt Wenzel seine Widerstandslosigkeit gegenüber kurrentem Verwaltungsdeutsch. Schlimmes Beispiel ist die „Schmuggerower Elegie VIII“:
Doch mein Herzschlag ist auf schnelle
Viertelnoten eingetaktet…
Wenzels Schludrigkeit zeitigt freilich auch Folgen in Gestalt von Elementarfehlern. (Der Kritiker als den Rotstift zückender Oberlehrer? Wenn es sein muß: Ja! Und es muß sein in Anbetracht jener allgemeinen Verlumperung, mit der sich Wenzel so unbegreiflich naiv identifiziert.) Da bringt der Autor es fertig, völlig arglos den größten präpositionalen Nonsens zu unterbreiten:
Ich… nenne sie Antigone
Wegen ihrer allgemeinen Sicherheit
Mit der instinktiven Kopfwendung über alles
Was ich tue
(„Die Einsamkeit meiner Katze“).
Wieder und wieder gibt es – das hier gewählte Exempel stammt aus dem gleichen Text – Konfusion in der Bildstruktur :
Sie aber lauert, ein angespannter Bogen, in der Ecke,
Ein Pfeil, ziellos…
Des weiteren finden sich grobe Verstöße gegen das Kongruenzgesetz:
Das Wasser tropft im Becken, die Sekunden.
(„Ich bin vom grünen Licht so schwer…“)
Und ein solcher Verstoß kann sich in einem Gedicht wie „Meine häßlichen Schuhe“ noch so mit einer gedanklich-sprachlichen Fehlleistung verbinden, daß über die betreffende Versgruppe selbst der gutwilligste Leser nur mehr den Kopf zu schütteln vermag:
Meine Mutter nicht und keine
Meiner Geliebten, selbst Bäume,
Ich nehme mich da nicht aus, denn
Ich habe mir diese Zeit nicht gesucht,
Bewegt sich AUS FREIEN STÜCKEN.
(Der „denn“-Satz suggeriert, daß nur durch „diese Zeit“ die Bewegungsfreiheit des Ichs behindert werde – in einer anderen Zeit, so wird zu verstehen gegeben, entfiele die Determination. [? Marx!] Für die Mutter indessen, für die Geliebten, verhielte es sich da nun ebenso? Oder anders? Und für die Bäume gar?)
Doch auch in den formal anspruchsvolleren Texten, wo er sich merklich an bedeutenden Mustern zu orientieren sucht, leistet sich Wenzel so viele Bedenkenlosigkeiten, daß man wiederum vor allem ein Mißvergnügen bei der Lektüre empfindet. Als sinnfälliges Exempel sei hier die „Schmuggerower Elegie VI (1)“ herangezogen. Verfaßt ist sie in Distichen; und damit wird eine große Form aufgenommen, die in jeder Hinsicht hohe dichtungssprachliche Anforderungen stellt. Bereits die ersten Verse der Wenzelschen Elegie konfrontieren den Leser jedoch mit einem kaum faßbaren bildsprachlichen Galimathias. Der einleitende Hexameter lautet:
Pilger und Flüchtling bin ich, der Weg, eine offene Wunde.
Das Komma hinter dem dritten Substantiv läßt keinen Zweifel: Das Ich versteht sich eben nicht nur als „Pilger und Flüchtling“, sondern wahrhaftig auch noch als „Weg“ sowie als „offene Wunde“ – und identifiziert sich folglich mit dem Gekreuzigten, mit dem Heiland. (Vgl. Das Evangelium des Johannes, 14,6). Über ein derart bestimmtes Ich freilich heißt es hernach:
Dicht beklebt mit Gift, schwindlig von U-Bahn und Bier
Tret ich aus dem Gebüsch, einen Stock in den Händen: Hier bin ich!
Vorstellen muß man sich nun also einen solchen Mann, dessen verwundeter Körper auch noch mit einer Giftfolie überzogen ist, der außerdem gerade viel Bier getrunken hat und eine rasende U-Bahn-Fahrt beendete. Doch wie? Da wird ja obendrein angegeben, dieses Ich trete, mit einem Stock versehen, aus dem „Gebüsch“ hervor. Und es wäre demnach ein giftbesprühter, angetrunkener und walduntergrundbahnfahrender Jesus Stülpner, den man sich zu denken hätte? Der Effekt: Ein Gelächter.
Hinzu aber kommt, daß auch bald schon die Distichen in die Brüche gehen. Die ersten sieben Verse des Gedichts sind metrisch korrekt; danach indessen holpert und stolpert es sich dahin; und die groben metrischen Defekte (Verse 8, 10, 11, 13, 14, 15) entstellen die Form bis zur Unkenntlichkeit. Dabei kommt die Interpretationsvariante, Wenzel habe absichtsvoll die Form zertrümmert, keineswegs in Frage. Denn einerseits läßt sich eine solche Interpretation nicht durch den Verweis auf womöglich korrespondierende Aussageinhalte stützen, andererseits finden sich inmitten des metrischen Debakels noch immer einige halbwegs stimmige Verse, und auch der letzte Pentameter sowie der letzte (allerdings ins Leere ragende) Hexameter sind regelmäßig gebaut. Selbst wenn also Formdemontage erstrebt gewesen sein sollte – das Ergebnis bezeugt nicht deformierenden Gestaltungswillen; sondern es tritt als Indiz für verssprachliche Stümperei hervor.
Genug des bösen (gleichwohl notwendigen) Spiels. Nochmals betont sei aber, daß mit alledem, was kritisch zu registrieren war, kein negatives Pauschalurteil gefällt wurde: Außerhalb der Betrachtung blieb Wenzel als Liedertheater-Akteur; und dieser kann ja, indem er eigene Texte als Vorlagen benutzt und sie „umsetzt“, eine spezifische künstlerische Qualität erreichen. Über sie zu befinden wäre denn auch ein kritisches Unternehmen, das sich von einer Besprechung der puren Texte wesentlich unterscheiden muß. Wenn dies hier erwogen und sogar hervorgehoben wird, so ist damit freilich – auch das bliebe zu beachten – nichts Relativierendes in Hinblick auf die Text-Besprechung selbst gesagt. Und wie immer der Akteur Wenzel als Anerkennung gebietend vor Augen stehen mag, die Begutachtung seiner Verse darf sich davon nicht irritieren lassen.
Ein Kritiker ist kein Prophet. Doch er hat Vermutungen. Und im Falle von Wenzel gehen sie, wie bereits angedeutet, eben dahin, daß dieser auch fürderhin seinem Talent am besten Rechnung tragen wird, wenn er sich nach wie vor „mit offener Brust“ auf die Bühne stellt. Auch einem solchen Einsatz freilich kann Wachheit im Sprachlichen nur zugute kommen; immerhin ist die sprachliche Beschaffenheit der „Vorlagen“ keine Größe, die schlechtweg zu vernachlässigen wäre. Und eine Text-Kritik, wie sie hier ausgebreitet werden mußte, sollte dementsprechend – und just für den Mann des Liedertheaters – als Stachel wirken: als ein Stachel, der jene wünschenswerte Wachheit mit zu erreichen hilft. Und der folglich auch nicht als ein giftiger begriffen sein will.
Mon Dien! Zu vergiften streben die persischen Magier schon genug.
Bernd Leistner, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 1985
Vivisektion mit stumpfen Skalpell
– Zu Bernd Leistner: „… dich zu treiben bis aufs Blut“. –
Wir waren schon sehr gespannt, denn wir kannten die scharfe Klinge, die Bernd Leistner als Literaturkritiker zu führen in der Lage ist. Und wir kannten die Verse Menschings und Wenzels, von denen viele in unterschiedlichen Kommunikationsformen – als gesprochenes Wort, als chorisches und solistisches Lied, aber auch unabhängig von der Bühne als gedruckter Text in Büchern und Presseorganen – ihre Wirksamkeit und ihre Lebenskraft bereits unter Beweis gestellt hatten. Vom Zusammenstoß der beiden bisher umfangreichsten Text-Sammlungen von Steffen Mensching und Hans-Eckardt Wenzel mit dem erst jüngst gewürdigten Poesie- und Sprachbewußtsein ihres Rezensenten versprachen wir uns, daß polemische Funken sprühen, und zwar so, daß sich interessante Einblicke in die Stärken und Schwächen der Autoren eröffnen, ihnen vorantreibende Impulse verliehen werden. Unsere Erwartungen waren um so höher, als sie vom (persönlichen und öffentlichen) Bedürfnis nach einer wahrhaft kritischen Literaturkritik getragen waren und von der Überzeugung, daß sie sich in diesem Falle auf Gegenstände richtete, die der höchsten – also auch kritischen – Förderung würdig sind. Handelt es sich doch um jeweils eigenständige, in der gegenwärtigen Lyrik keineswegs selbstverständliche Versuche, wesentliche Traditionen revolutionärer, „eingreifender“ Poesie fortzusetzen.
Desto größer war dann unsere Enttäuschung, ja unsere Verblüffung. Ganz offensichtlich war es dem Kritiker nicht gelungen, Zugang zur künstlerischen Eigenart und damit zu den realen Leistungen der beiden Autoren zu gewinnen. Auch ihr Verhältnis zur Wirklichkeit unserer Epoche und zu deren revolutionärer Veränderung bleibt, obwohl den Texten deutlich ablesbar, eigenartig unterbelichtet. Kaum etwas darüber, welche Entdeckungen in der Wirklichkeit gemacht, welche poetischen Wege dazu erprobt wurden, welchen Platz die beiden Autoren in der Lyrik-Landschaft einnehmen, worin das ästhetisch-weltanschauliche „Geheimnis“ der Wirksamkeit auch der Texte (nicht nur der Bühnen-Aktion und der musikalischen Komponente) besteht. Mehr noch: es scheint Bernd Leistner gar nicht darum zu gehen – um ihn selbst zu zitieren:
es schert ihn einfach nicht
Schon in den ersten, scheinbar achtungsvollen Sätzen der Rezension spürt man die fragwürdige Ausgangsposition: Da kommen zwei eigentlich interessante, vielversprechende „Akteure des Liedertheaters“, erfolggewohnt und publikumswirksam (die Bücher sind daher sofort vergriffen); nun wollen wir doch einmal sehen, was von den beiden nicht mehr so ganz taufrischen Burschen, die sich fürwitzig ins Pantheon der hohen und hehren Poesie vorgewagt haben, eigentlich übrigbleibt, wenn sie mit ihrem „nackten und bloßen Wort“ vor den gestrengen Tempelwächter treten. Der Wächter waltet dann auch sofort – ausführlich und mit dem scholastischen Eifer des Mißtrauens – seines Amtes, um den Tempel rein zu halten, sprachrein vor allem, aber auch rein von all jenen empirischen und ideellen Elementen der Wirklichkeit, die nicht „Ausdruck unbedingter existentieller Verbindlichkeit“ sind. Bleiben wir zunächst bei letzterem, und diesmal ganz im Ernst: Bernd Leistner operiert mit einem Lyrik-Begriff, der nicht von dieser Welt ist. (Dabei ist nicht nur „diese“, unsere sozialistische Welt gemeint, sondern die Welt überhaupt!) Der Irrtum beginnt bereits mit dem „nackten und bloßen Wort“, das es nirgends gibt als in den Köpfen einiger Theoretiker des poetischen Hermetismus. Gerade in der lyrischen Dichtung bringt das Wort eine Fülle-kommunikativer (außer-, inner- wie intertextueller) Beziehungen mit sich, durch die es auch nicht eine einzige Sekunde „nackt und bloß“ dasteht. Ebenso unerfindlich bleibt, warum Lyrik auf den „unbedingt authentischen“ Selbstausdruck eines Ich von „unbedingter existentieller Verbindlichkeit“ reduziert wird. Letztlich muß sie damit aus dem Kreis fiktionaler literarischer Gattungen, also aus dem Reich der Dichtung, herausfallen. Das ist sicher nicht gemeint, der theoretische Ansatz führt aber dazu, daß legitime und außerordentlich kommunikative Erscheinungsformen der Lyrik (Lied, Ballade, chronikalische oder „agitatorische“ Textstrukturen) beliebig „des Platzes verwiesen“ werden können, sowie sie als gedruckte Texte auf dem mehr oder weniger geduldigen Papier auftauchen und mit den vom Rezensenten goutierten Ausdrucksformen, deren Legitimität hier nicht in Zweifel gezogen wird, konkurrieren. Die Willkür der Grenzziehung (bei Leistner ist es gar Entgegensetzung) besteht darin, daß niemand – allenfalls noch der Dichter selbst – entscheiden kann, was „Ausdruck individueller Wahrhaftigkeit“ ist. Als gewöhnliche Sterbliche halten wir uns an die sprachlich (d.h. auch rhythmisch und klanglich) objektivierten, künstlerisch bewußt geformten und in diesem Sinne immer „erfundenen“ Gestalten und anderen Gegenständlichkeiten, die uns im Gedicht entgegentreten, um sie mit ihren Artgenossen in anderen Werken der Kunst, vor allem aber mit der objektiven Realität und unseren eigenen Erfahrungen genußvoll-erkennend in Beziehung zu setzen. Spätestens hier wird dem Leser der Rezension aber offenbar, daß auch der Wirklichkeits-Begriff, mit dem da operiert wird, nicht von allerbester Herkunft ist. Objektive gesellschaftliche Realität und subjektive Aktivität verflüchtigen sich zu abstrakten Unverbindlichkeiten, die mittels einer ebenso allgemein bleibenden „existentiellen“ Tragik des ewig gegen seine Umwelt anrennenden Individuums metaphysisch aufgebläht werden. Vom „engen Horizont, den diese Erfahrungswelt ihm bietet“, ist da die Rede, weshalb das Ich gezwungen ist, sich die „bewegte geschichtliche Welt“ von außen und aus der Vergangenheit „herzuholen“. Es ist ja auch „in eine verhältnisstabile Kleinwelt“ hineingeboren. Mit der „herzugeholten“ Geschichte scheint es aber auch nicht weit her zu sein, denn wichtige Gedichte wie „Betrachtung eines Stillebens“ und „Im Spätsommer“ erscheinen lediglich als die eine oder „die andere Möglichkeit, dem Leiden an der Geschichte Ausdruck zu geben“, als einem immerwährenden „Elend“ des „Heißherzigen in der Geschichte“. Ganz abgesehen einmal davon, was dem Kritiker da des Lobes würdig erscheint: man glaubt in einem ganz anderen Buch, bei ganz anderen Texten zu sein (vielleicht stammt der Schwung zu solch „existentieller“ Unverbindlichkeit noch aus Leistners überaus mitgehender Besprechung zu Wolfgang Hilbigs Gedichten?).
Immerhin werden Mensching noch „sentimentalische Aktivitäten eines Ichs“ zugesprochen, „das Ungenügen empfindet, sich aber weigert, lediglich Klage und Verdrossenheit zu artikulieren“. Das ist gewiß die sublimste Art von „Verweigerung“, von der wir im Zusammenhang mit jüngerer Lyrik bislang Kenntnis erhalten haben. Sie scheint uns aber ebensowenig die wirkliche Leistung Menschings abzudecken wie das positive Hervorheben der Liebesgedichte oder das hymnische Lob auf das Luxemburg-Gedicht, von dem es – wiederum in „existentieller“ Verkürzung – lediglich heißt:
Hier gibt es keinerlei Verschlierung und keinerlei Zurückweichen vor einer Ich-Kundgabe, die das wache Bewußtsein der Situation, aus der heraus das Ich spricht, aufs wahrhaftigste mit ins Gedicht einbringt.
Welcher Art diese Situation ist und was das wache (im konkreten Fall allerdings träumende) Bewußtsein des Ich dabei zustandebringt, all das scheint völlig uninteressant zu sein. So ist es kein Zufall, wenn Gedichte mit einer stärkeren Direktheit der Reflexion von Zeitproblemen – besonders dann, wenn poetische Gestalten außerhalb des „existentiellen“ dichterischen Ichs hinzutreten – entweder verschwiegen oder sprachkritisch „vernichtet“ werden: „Angenommene Farbenlehre Erich Mühsams“, „London, fünfzehnter März dreiundachtzig“, „Blanqui in der Boutique“, „Hegel bei den Skulpturen“, „Späte Elegie“, „Trinkspruch für Weisbach“, „Urlaub Majakowskis…“, „Siqueiros: Unser Antlitz“, „Amtliches Fernsprechbuch…“ U.a.m. Nicht in jedem Falle sind das gelungene Gedichte, unter ihnen sind aber auch einige, die zu dem besten gehören, was in der DDR-Lyrik des zurückliegenden Jahrzehnts an politischer Dichtung hervorgebracht wurde. Darüber kann man im einzelnen sicher streiten, uns geht es hier um die Methode der radikalen Reduktion lyrischer Dichtung auf den „existentiellen Selbstausdruck“, der dazu noch durch das weitgehende Abschneiden gegenständlicher und kommunikativer Verknüpfungen mit dem ganzen Reichtum der „Außenwelt“ seines lebendigen Inhalts beraubt wird. So hört der Leser der Rezension manches von „Leiden“, von „Ungenügen“, vom Bemühen, die Grenzen der Erfahrungswelt zu durchbrechen; er erfährt jedoch nicht, woran der Dichter oder die von ihm gestalteten Figuren leiden, woran er welche Kritik übt, aus welchen geschichtlichen Erfahrungen und weltanschaulichen Prämissen er die Kriterien für seine Kritik gewinnt und wo er die Ansatzpunkte, aber auch die Hemmnisse für sein „Eingreifen“ sieht. Dafür erfährt er, wie gefährlich die Freundschaft und die Zusammenarbeit mit Wenzel für die poetische Existenz von Mensching ist, weil sie seine „authentischen dichterischen Selbstkundgaben“ in eine allzu große Nähe zur künstlerischen Existenz „eines schreibenden Akteurs auf dem Liedertheater“ bringen würde. Da könnte ja etwas abfärben von der lebendigen Unmittelbarkeit der Kontakte zu einem real existierenden Publikum, das sofort reagieren kann. Sehen wir einmal von der Geschmacklosigkeit und der Impertinenz eines solchen Ansinnens ab – es geht uns um Grundfragen. Sicher sollten poetische Kommunikationsweisen, die nicht primär über das bedruckte Papier und die stille häusliche Lektüre gehen, keineswegs verabsolutiert werden. Und wir haben hohe Achtung vor einem Dichter wie Georg Trakl, der – gepeinigt von ständiger Berührungsangst gegenüber dem realen Leben – tiefe und schöne Verse hinterlassen hat, in denen seine Entfremdung einen poetisch gültigen Ausdruck fand. Für kämpferische sozialistische Lyrik jedoch, und in diesem Kontext sehen wir die Bemühungen Menschings und Wenzels, war stets charakteristisch, daß alle, auch außerliterarische, Möglichkeiten der Kommunikation (einschließlich der Massenkommunikation) gesucht wurden, um die Poesie in die Wirklichkeit und die Wirklichkeit in die Poesie zu bringen. Ist es wirklich nötig, hier an die Beziehungen Weinerts, Bechers, Brechts, Fürnbergs, KuBas oder auch Majakowskis und vieler anderer zum Kabarett, zum Theater, zur Agitpropgruppe, zur Rednertribüne, zum Film oder zum Rundfunk zu erinnern? Das Ergebnis war nicht zuletzt „innerliterarisch“ bedeutsam, schlugen sich jene „empirischen“ Beziehungen zum Publikum, zu realen Bewegungen und massenwirksamen Medien doch in einem reichen Genreensemble, in stofflicher und thematischer Vielfalt, aber auch in produktiven sprachkünstlerischen Experimenten nieder. Es ging da also nicht allein um Chancen größerer Verbreitung! All diese Erfahrungen scheinen für Bernd Leistner nicht zu existieren. Er gebärdet sich erschrocken, wenn unter dem Titel „Gedichte“ in Wenzels Band auch Lied-Texte abgedruckt werden, und dann auch noch Noten, die ihn ganz zu verwirren drohen, weil sie ihm den Blick auf das „nackte und bloße Wort“ trüben. (Bei Dramen-Texten, die ja auch „nur“ Teilelement einer komplexen künstlerischen Daseinsform sein wollen, hat ihn solche Prüderie gottlob noch nicht angewandelt, sonst wären wir um manche Analyse aus Leistners Feder ärmer!) Da nun aber das Lied für Wenzel eine verhältnismäßig dominante Rolle spielt, steht das Urteil des Kritikers von vornherein fest:
Das Wort hingegen, das für sich selbst einzustehen hat, ist seine Sache nicht.
Hier haben wir es wieder, das total vereinsamte, allein auf sich selbst gestellte Wort. Vergessen ist die ehrwürdige historische Herkunft jeder lyrischen Poesie aus dem Lied (oder aus dem „Zauberspruch“, der ja auch eine sehr reale „außerliterarische“ Kommunikationsform war). Vergessen ist die Tatsache, daß jener (wichtige, durch nichts zu ersetzende!) Teil der Lyrik, den Leistner zum absoluten Maßstab erhebt, verschwindend klein ist im Vergleich zu dem weltweiten und massenhaften Gebrauch, den die Menschheit von gesungener Poesie macht. (Wenn darunter viel schwache Poesie oder auch Poesie-Ersatz ist – Leistner dürfte sich darüber am wenigsten wundern, da er einen talentierten Dichter wie Mensching ausdrücklich davor warnt, sich auf solcherlei Dinge einzulassen.) Unter solchen Voraussetzungen mußte der Wenzel-Abschnitt der Doppel-Rezension noch weniger ergiebig ausfallen als der zu Mensching, von dem immerhin noch einiges anerkannt wurde. Leistner glaubt, man müsse bei einem Lied davon abstrahieren, daß es ein Lied ist, wenn es einem als gedruckter Text vorgesetzt wird. Weshalb eigentlich? Hat er so wenig Vertrauen zur Phantasie und zur kulturellen Erfahrung der Leser, die sich schon „einen Vers darauf machen“, wenn ihnen in einem Lese-Buch liedhafte Strukturen entgegentreten? Sie können auch dann vorhanden sein, wenn es noch gar keine Melodie dazu gibt, und können oder müssen entsprechend rezipiert werden. Schließlich hat ja die Sprache ihre eigene Melodie. Mit den sinnlichen Qualitäten der Poesie scheint der Rezensent überhaupt seine Schwierigkeiten zu haben. Hält er doch das schöne, auf seine Weise sehr gelungene und in sich geschlossene Huldigungsgedicht nach und für Erich Mühsam, „Ich braue das bittere Bier“, für eine „Auflistung abstrakter Behauptungen“. Abstrakt ist an dem Text nun gar nichts, und mit „Auflistung“ ist wohl die Reihentechnik gemeint, derer sich besonders ein Lied gern bedient. Das Vorurteil des Kritikers war so groß, daß eine nähere Besichtigung dessen, was da mitgeteilt wird, unter seiner Würde war. (Man vergleiche die Lesarten, die Mensching zu diesem Lied vonWenzel beisteuert: „Lyriker im Zwiegespräch“, 1981).
Vorurteilvolles Am-Text-Vorbeireden findet sich auch in anderen Teilen der Rezension, nicht nur im Hinblick auf Wenzels Lieder. Leistner demonstriert seine sprachkritische Sezier-Arbeit gleich am Anfang sehr ausführlich an Menschings Titelgedicht „Erinnerung an eine Milchglasscheibe“. Die vorgebliche Subtilität und Akribie erweist sich jedoch rasch als brüchig, teilweise sogar unlauter. Von einem Januar mit Schnee ist im Gedicht die Rede (also einem richtigen Winter), demzufolge von frost-blinden Fensterscheiben. Der Interpret redet aber fortwährend von einem „trüben Januar“, von der „Trübheit der Außenwelt“, die zu den zugefrorenen Scheiben gar nicht passen würde (und daher im Gedicht auch nicht vorkommt). Außerdem hindert der erlesene Sprachgeschmack den Rezensenten daran, den Doppelsinn der Fügung „Ich habe eine Scheibe“ – also auch ihre plebejisch-umgangssprachliche Bedeutung überhaupt wahrzunehmen, von dem der Spannungsbogen zum „Ich sehe durch“ hinläuft. Die „Durchsicht“ erfolgt am Ende nicht auf eine „trübe“, „verhangene“ Außenwelt (und wäre demzufolge keine Durchsicht), sondern auf eine winterklare Landschaft. Leistner kritisiert also ein Gedicht, das er sich streckenweise selbst zurechtgedichtet hat. Die grimmigen Invektiven, mit denen er seine Interpretation (die als Modellfall hingestellt wird) begleitet, fallen so auf den Interpreten zurück.
Nicht nur Vorurteile gegenüber „außerliterarischen“ Zwecksetzungen und kommunikativen Bindungen poetischer Texte kommen folglich bei Leistners massiver Kritik an Mensching, vor allem aber an Wenzel, zur Geltung, sondern auch ein sehr elitäres Sprachverständnis. Bestimmte Sprachschichten (aus „niederen“ Regionen) scheinen im Bewußtsein des Kritikers gar nicht präsent zu sein. Andere Beispiele („Ich plane die Schmerzen mit ein“) offenbaren zumindest ein Zurückscheuen davor, die poetische Integration von Umgangssprache – denn dazu ist „Einplanen“ längst geworden – als solche zu erkennen und zu werten, einschließlich auch des dabei mitschwingenden ironischen Untertons (weil solche Dinge in der von Leistner angesprochenen „Bürokraten“-Sphäre eben gerade nicht eingeplant werden). Mit anderen Worten: Leistner neigt dazu, die Sprache der Poesie allzu hermetisch gegenüber der „wirklichen“, der massenhaft gebrauchten Sprache abzuschotten. Damit stehen seine Beweisführungen aber auf einer sehr brüchigen Plattform. Rein linguistisch ist der Differenzpunkt zwischen Lyrik- und „Gebrauchs“-Sprache wohl kaum auszumachen. Außerdem zeigen klassische Beispiele der „Moderne“ von Rimbaud bis Ginsburg, von Brecht bis Jandl, welche poetische Sprachgewalt auch dem „gemeinen“ Wort aus poesiefremden Sphären abgewonnen werden kann. Auch dort, wo Leistners Sprachkritik von der Sache her berechtigt ist, geht sie von falschen Voraussetzungen aus und verliert so an Überzeugungskraft. Am Ende bleibt also selbst von den sprachkritischen Stärken des Rezensenten – ganz abgesehen vom beckmesserischen und oberlehrerhaften Umgang mit diesem Instrumentarium – im konkreten Fall nicht sehr viel übrig. Eine Chance hat Leistners Besprechung aber noch: als einer der klassischen Fälle „danebengegangener“ Verrisse in die Geschichte der Literaturkritik einzugehen.
Mathilde Dau / Rudolf Dau, Sinn und Form, Heft 2, März/April 1986
„Überhaupt montiere ich Zitate“
– Zu Texten von Hans-Eckardt Wenzel. –
„Überhaupt montiere ich Zitate. In Wahrheit bin ich ein Engel.“ So endet die Schmuggerower Elegie VIII. Sind diese beiden Sätze ein Angebot Hans-Eckardt Wenzels, seine Texte so ernst nicht zu nehmen? Ein Rückzugsgefecht – er montiere schließlich nur Zitate, unverbindlich? Ein Werben um freundliche Aufnahme – Bravsein eines Engels zeichne ihn in Wahrheit aus? Am Ende einer „Elegie“ jedenfalls sind diese beiden Sätze merk-würdig, gehen gegen den Strich der Erwartung. Und deuten an, wo Gestaltungsprinzip und Grundhaltung dieses Bandes zu suchen sind: Lied vom wilden Mohn. Gedichte. Es sind keineswegs nur Gedichte, die hier abgedruckt sind. Ein „Wortblock“ ist überschrieben:
Das ist kein Gedicht!
Am Ende des Bandes steht ein Prosatext: „Chiron oder Die Zweigestaltigkeit (Ein Essay)“. Und – fast war es zu erwarten – auch dies ist eigentlich kein Essay, sondern eine Folge von Essay, Erzählung, Szene, Filmszenarium, Brief, parodistischer Literaturliste zum Thema. Eine Mischform.
Wenzel spielt mit den Genres und ihren Grenzen. Für das Resultat hat die Theorie noch kein begriffliches Angebot – vielleicht auch deshalb werden Wissenschaftssprache und scholastische Wissenschaftsmethodik in den „Hinweisen der Chiron-Gesellschaft“ für weiterführende Literatur glossiert.
Wenzel reflektiert Erfahrungen, die nicht ihn allein betreffen – auch das Liedertheater Karls Enkel, dem er angehört, ist schwer zu rubrizieren: Kabarett, Theater, Singegruppe? Nichts davon trifft zu – oder auch alles ein wenig. Die Programme dieser Gruppe wie auch Wenzels Texte sind keine im klassischen Sinne deutliche oder eindeutige Gestalt (die ja nach Goethe im Zentrum einer Gattung zu finden ist und nicht an deren Peripherie). Aber sind sie ungestaltet? Wenzel bietet an, sein Gestaltungsprinzip in, der Montage zu suchen. In der lustigen Form ist die Aussage wohl ernst zu nehmen.
Der Essay: eine Text-Montage. Ihr Thema: Zweigestaltigkeit.
Ans Ende des Bandes gestellt wird die Prosa zum Indiz – für den Weg Wenzels vom Liedermacher zum Monteur von Texten, für das Gewicht des Motivs, das mit dem Hölderlin-Gedicht „Chiron“ aufgenommen wird, für Haltungen, die probiert werden, auch in den Liedern, Gedichten.
Der Spielraum an Bedeutungen von Zweigestaltigkeit wird im ersten Text des Essays knapp und ernst geöffnet: Chiron, der Centaur, ist buchstäblich zweigestaltig, ist halb Tier, halb Mensch und dabei ein unsterblicher Gott. Doppelt also in mehrfacher Hinsicht. Und diese Mehrgestaltigkeit bedeutet hier Harmonie von Mensch und Natur, göttlichem Prinzip und menschlicher Weisheit. Die Harmonie wird zerstört, als Chiron, der Gutmütige, durch den vergifteten Pfeil des Herakles verletzt, als Unsterblicher zu ewigem Schmerz verurteilt wird.
Hölderlin schrieb das Gedicht nach seiner Rückkehr aus Frankreich – auf der Suche „nach einem Ausweg aus dem Dilemma seiner Zeit. Die Welt ist aufgeteilt. Auf der einen Seite stehen die Dinge, Objekte, Umstände, die zum Handeln zwingen und oft erscheinen, als würden sie selbst handeln – auf der anderen Seite die Leute, ,Subjekte‘, tätige, sinnliche Menschen, die bedingt tun können, was sie wollen (was wollen sie?).“ – Zweigestaltigkeit als Zerrissenheit.
Über die Zerrissenheit der Kleist, Günderode, Hölderlin hat Anna Seghers, hat Christa Wolf geschrieben. Jene erlebten den Sieg der nachrevolutionären bürgerlichen Wirklichkeit über die vorrevolutionären bürgerlichen Ideale. Sie erfuhren die Notwendigkeit und den Sieg eines Handelns, dessen Resultate sie nicht wollen konnten. So zerriß ihre Identität, starben Hoffnung und Utopie.
Und Wenzel fährt fort: „Aber das Gedicht spricht auch über mich.“ „Die Geschichte geht über ein Leben hinweg, ist nur eine Gewißheit über Zukunft.“ Zweigestaltigkeit als Konflikt zwischen dem endlichen individuellen Leben und dem Gang der Geschichte, zwischen Anspruch vielleicht und wirklichem Spielraum heute. Chiron als Metapher, um der eigenen Existenz nachzufragen, die auf einen eindeutigen Begriff nicht zu bringen ist. Deshalb die Frage:
Warum entstehen solche Gedichte? Worin besteht ihr Zweck, daß sie von Generation zu Generation mitgeschleppt werden?
Antworten auf diese Frage, Wenzels Antworten, geben viele Texte dieses Bandes:
Nur ich allein bin mir zu wenig.
Nur ein Land ist kein Zuhaus.
Nur jetzt ist keine Zeit.
Die Erfahrung von Begrenztheit und Sehnsucht nach Unbegrenztheit betraf nicht nur Hölderlin. Auf sie reagiert Wenzel – auch mit der Suche nach literarischen Formen, die Grenzen überschreiten, die selbst zwei- oder mehrgestaltig sind. Die Ästhetik, die sich dabei herstellt, ist eine der Brüche, der Kontraste, der Montage. Ungleichzeitiges wird montiert.
So folgt im Chiron-Essay ein Dialog, den zwei Dichter in der U-Bahn führen. Die U-Bahn ist steckengeblieben, die Dichter attackieren einander, attackieren einer des anderen Literatur- und Lebenskonzept:
„B: Ich beobachte an Ihnen Melancholie. Sie trauern über Widersprüche, eine Heulsuse.“
„A: Sie sind ein erbärmlicher Analytiker, der nur danach handelt, was ihm die ,Umstände‘ zuweisen. Ihnen geht es immer gut, weil Sie alles einsehen, Sie Apologet!“ Wechselseitige Beschimpfung als Illusionist und Pragmatiker. Grotesk wird der Dialog durch in Klammern gesetzte kontrastierende und kommentierende Situationsbilder wie „Betrunkene fallen aus dem Bus“. Das ironisierende Resümee:
Das Ganze spielt eigentlich im Herz des Poeten, durch das bekanntlich ein Riß gehen soll.
Der nächste Text verschärft das komisch-groteske Moment von Zweigestaltigkeit. Ein Hörsaal, eine Vorlesung über die Widersprüchlichkeit der Poesie. Unter einem anderen Aspekt und auf hochgelehrte Weise ist dies eine Fortsetzung des im Dialog angeschlagenen Themas: Poesie zwischen Kunstanspruch und Gebrauch. Im Auditorium ein übernächtigter, nicht ganz ausgenüchterter Student, dem bei den theoretischen Ausführungen des Professors der müde Kopf auf die Bank schlägt, ein Furz und am Ende gar Widerspruch entfährt – gegen die „Dichotomierung“ von Poesie und sozialem Engagement.
Dies Entgegensetzen von ernster Argumentation und trivialer Situation bestimmt auch das sechste Stück des Essays: den Brief eines Schauspielers an ein „Verehrtes Fräulein D.“. Der Schauspieler spielt in zwei Filmen die Rollen von Jesus und Chiron. Er wird in seiner Einfühlung gestört durch platte Alltäglichkeit – durch Politik ebenso wie durch Fischgeruch an seinen Händen. Zweigestaltigkeit als Gegensatz von platter und überschwenglicher Misere? Wenzel stellt den spießigen Abgesang zum Therria ans Ende, ihm folgt der Jux der Literaturliste. Was mit tragischen Tönen begann, endet als Farce.
Vorher aber stehen zwei Texte, die von Zweigestaltigkeit ganz anders sprechen: eine Szene zwischen Chiron und Herakles, ein Filmszenarium. Herakles kommt, um Chiron den erlösenden Tod zu bringen. Er wird von Chiron verhöhnt, gedemütigt: Herakles als der unkünstlerische Täter, sein Tun als gedankenlos-rohes, Tun als Gegensatz zum Nachdenklichen. Chirons Vorhersage:
Blutgierig ist die Zukunft, guterzogen
Die Barbarei. Zu Helden machen sich die Mörder.
Die Figur des Herakles – über Jahrhunderte hinweg Symbol des Widerstands von unten, plebejischer Tatkraft (zuletzt in der Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß) – wird ins Zwielicht gesetzt. Zweigestaltig ist nicht nur Chiron, das Tier ist im Gesicht auch des Herakles. – Elegische Abgrenzung vom „gedankenarmen“ Tun bei Wenzel? Der ewige Schmerz Chirons als Alternative? Wenzel montiert Haltungen. Der Szene folgt ein Filmszenarium, das für mich der Schlüsseltext des Essays ist, ein Schlüsseltext des Bandes. Montage ist hier selbstverständliches filmisches Mittel, Fetzen von Realität, Geschichte, Gegenwart, literarische und musikalische Zitate zusammenzubringen. Zitate großer Kämpfe (der Freiheitsbaum, Robespierre, Danton, die Jakobinermütze, die Rotarmistenmütze, Lenin, Vietnam, Mai 1968), großer Gedanken und Denker (Schelling, Hegel, Hölderlin), der Niederlagen (Buchenwald), der kleinen Resignation (in der Jakobinermütze bewahrt die Hausfrau Zwiebeln auf). Die montierten Zitate holen Geschichte in die Gegenwart (Hölderlin unter den Häftlingen von Buchenwald, Hölderlin auf einem Bahnsteig). Am Ende werden Jakobinermütze und Rotarmistenmütze aufgehoben, die Zwiebeln weggeworfen, und Hölderlin schreibt „Chiron“, umgeben von Steinen, die bereitliegen, vielleicht für neue Barrikaden. Ein Schlüsseltext, weil er ein zentrales Motiv von Wenzels Texten zeigt: den Griff nach Größe in der Geschichte, die Erinnerung an große Kämpfe, um selbst nicht klein zu werden. Deshalb immer wieder Spanien in Wenzels Texten: Das Lied vom wilden Mohn, die Schmuggerower Elegie V für Eberhard Schmidt – bis zum Programm „Spanien aller Länder“ der Gruppe Karls Enkel. Das ist nicht nostalgische Beschwörung vergangener Größe, wohl aber Maßstab, dem sich auszusetzen für das Ich dieser Texte Spannungen bedeutet, die nicht nur auszuhalten, sondern produktiv zu machen sind. Zweigestaltigkeit. Ihr einer Pol, das sind weltgeschichtliche, epochale Auseinandersetzungen und Wendepunkte. Ihr anderer ist die Alltäglichkeit, sind die zum Klischee verdrängte Erfahrung und Routine. Im Essay, der keiner ist, werden diese Spannungen mit Lust an der Provokation erzeugt – die Texte provozieren einander und uns, leicht sind sie nicht, weil so wenig eindeutig. Und manchmal ist die Provokation auch von jugendlichem Ungestüm, voller Spaß an der schockierenden Farce.
Auch in anderen Texten dieselbe Spannung. Oft eine eigenartige Traurigkeit („Fremd zieh ich ein, fremd zieh ich aus“). Da ist Trauer über das Zerrissensein, über die kleingewordenen Träume und Taten, über die nie gehabten Wunden (Summe), über die vernarbten Wunden, über das noch nicht Geschriebene („An mich, nachts“). Oft eine trotzige Gebärde: „Ich raufe und leb mich tot“ („Ich braue das bittere Bier“). Oft die Narrenspose und ihre Ironisierung:
Alles, was ich hab, verteil ich,
So erfinde ich mein Glück.
Meine Narrenfreiheit freilich
Ist ein lächerliches Stück.
(„Das Abschmink-Lied“)
Volle Aschenbecher, viel Alkohol, schwarze Fingernägel, Großstadt (meist nachts) und die Landschaft um Schmuggerow – Indizien einer Existenz: nicht unbehaust, aber nicht eingerichtet. Ein Ich, das oft mit lauten Tönen Hunger, Einsamkeit, Verletzbarkeit überspielt, das mit dem Griff zum Paradoxon einfühlende Rührung verhindert. Ein Ich, das auch im einsamen nächtlichen Zimmer, im entlegenen Schmuggerow das „Verlangen / Nach einem großen Platz / Nach einem Platz Leute“ als das Eigene und Eigentliche ausspricht. Ein Ich, fähig zur Ironie und Selbstironie – auch über die Traurigkeit, die doch Leben und Lebenslust nicht ausschließt, über jeden Anflug von Selbstmitleid, das als Klischee zitiert wird:
Davon erwacht, gehe ich, gewöhnlich,
Nach Hause, obdachlos, und mein Mund
Flüstert: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß.
Spott ist zu finden – über die allzu gewissen Wahrheiten, über die Phrasen, zu denen Wahrheiten verkommen können.
Lieder von verführerischer Melancholie („Feinslieb, du lachst dazu“), zum Singen gemacht, werden immer wieder gekontert mit derben, fast rüden Texten („Die Gretchentragödie“), die mit der Sprache des Alltags, des Jargons daherkommen.
Montage von Haltungen, Zitaten, Formen. Montage als Defizit von Gestaltungsvermögen, als Hilfskonstruktion? Als Ausdruck von noch nicht Fertigem, Ersatz für verfehlte Eindeutigkeit, geschlossene Gestalt? Wohl nicht. Eher bewußt gewählter Ausdruck der Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem, Mittel, Unvereinbares zu vereinbaren, unmittelbare Erfahrung und Ersehntes, Gefürchtetes, Erahntes zu verknüpfen. Und auch Ausdruck von Suche, schmerzhafter Sehnsucht nach erfahrbarer Identität („Wir suchten das Verbindungsstück“).
Das Ergebnis: eine „Mixtur“ von Jux und Ernst, von Nachdenklichkeit und aggressivem Gestus, von Trivialität und Dialektik, von Schönheit und Groteske, von Realität und Utopie.
Karin Hirdina, aus Siegfried Rönisch (Hrsg.): DDR-Literatur ’84 im Gespräch, Aufbau Verlag, 1985
Wo bist du, Nachdenkliches?
– Notizen zu Wenzels Gedichten und zur Literaturkritik. –
Immer noch gilt der Monolog der Kritiker als die wichtigste Auftrittsform von Kritik. Selbst wenn ein Für und Wider stattfindet, redet man meist nebeneinander her. Sind wir uns einig, mag unser gegenseitiges Schweigen angehen, auch stumme Sympathie verbindet. Ein Stachel jedoch bleibt immer zurück, schweigen wir über Ansichtsverschiedenheiten hinweg. Wie man übereinstimmen kann, sehe ich an vielem, was inzwischen zu Hans-Eckardt Wenzels Gedichtband Lied vom wilden Mohn (Mitteldeutscher Verlag, 1984) gesagt worden ist. Doch zeichnet sich hier gleichzeitig Kontroverses ab. Dieser Vorgang fordert zum gemeinsamen Nachdenken auf. Im übrigen bin ich auch im Gespräch mit mir selbst. In meinen Aufzeichnungen zu den Manuskripten Wenzels beobachte ich Stufen. Vielleicht könnte man einmal an der Stelle einer „Rezension“ mit solchen dialogischen Notizen weiterkommen: Daß sie stets auch danach fragten, was eigentlich die Kritik tut, ist mir jetzt recht.
Tradition und Neurertum (Internationaler Kritikerkongreß, Berlin 1982. Skizze zu einer eventuellen Wortmeldung)
Sollten wir, liebe Kollegen, nicht auch über die Jüngsten sprechen, wenn wir „Tradition und Neurertum in der zeitgenössischen Literatur“ zu unserem Thema machen? Ich will es an einem Beispiel versuchen, am Fall eines jungen Poeten, dessen Name Ihnen nichts sagen wird, dessen Stimme aber aus den schon sehr verschiedenen Scharen der hier und jetzt hervortretenden Literaturgeneration deutlich herauszuhören ist. Ihnen wendet sich die kritische Aufmerksamkeit gerade zu, öffentlich und vor allem nichtöffentlich, mit Hoffnung und vor allem mit Besorgnis. Was ist mit diesen Leuten? fragt man sich. Sie brechen mit älteren Gültigkeiten, setzen sie deshalb bereits neue? Und ihre Tradition, ist sie stark genug und richtig gewählt? Wer weiß?
Weiß es die Kritik? Wir hörten auf unserer Zusammenkunft hier das böse Wort: Kritik erkenne neue poetische Leistung in der Regel nicht, erkläre sie aber fein, hat sie sich erst einmal durchgesetzt. Vielleicht also wird später die Kritik tun, was ihres Amtes ist: unterscheiden. Sie wird von den jetzt Jüngsten sagen, wer Wichtiges im Sinnbereich der Menschenwelt traf, dem Gedächtnis ein erhellendes Dokument vom historischen Augenblick lieferte oder aufgriff, was die Sprache der Zukunft bildete – mochte zunächst auch seltsam und abseitig angemutet haben, was da zum Vortrag kam. Weniger zuversichtlich freilich bin ich, ob die Kritik dann auch erinnern wird an die, die neue Erwartungen nicht zu bilden vermochten, weil sie an zu wenig sich banden, was von unserer Gegenwart bleiben konnte, luftig experimentierten, folgenlos, oder in den eingeschliffenen Konventionen verschwanden – wichtige Zeitzeugen doch ebenfalls. Solche nachdenkliche Kritik fände ich nicht so schändlich, wie das zitierte Wort unterstellt. Ich wollte, sie würde häufig geübt und brächte die Gründe zum Vorschein, die im Gang der Geschichte das Bewahren und das Vergessen besorgen.
Reiz und Schwierigkeit der Kritik liegen jedoch hier nicht. Sie liegen dort, wo sie im Chaos der Ideen arbeitet, in dem Prozeß, in dem sich das vielen Gemäße der Sinnwerte erst formt, so das Tradierbare herausstellt, das, was vergängliche Neuigkeit sein wird, und was, weil weiterwirkend, das Neue. Tradition und Neurertum, Sie merken es schon, ist für mich mehr als ein Verhältnis, das zwischen Vergangenheit und Gegenwart sich abspielt; mit der Frage nach dem Tradierbaren geht es um Zukunft. Könnten wir die Gesetzmäßigkeiten des zugrunde liegenden Vorgangs ganz erkennen, brauchten wir die Kritik nicht. Wertend sucht sie einzuholen, wofür uns das Wissen fehlt. Die Hemmnisse sind groß. Wo die Kritik, in ihrer Abhängigkeit von den Medien, kommerzialisierten Moden der Neuigkeit nicht nachläuft (und das tut sie nicht im Literatursystem sozialistischer Länder), ist sie gern auf andere Weise beschränkt. Ihre Geschichte bei uns zum Exempel könnte zeigen, wie sie, in ihrem Vertrauen auf die je schon formierten Ideologien, künstlerischen und nichtkünstlerischen, immer wieder Neues als bloßen Verlust verdächtigen mag.
Ist als neu vermutbar, was der junge Poet, von dem ich sprechen möchte, uns zu sehen gibt?
Daß Hans-Eckardt Wenzel Kunst der Vergangenheit immer wieder erinnert, von Salomo bis Picasso, drängt als ein erster Eindruck der Lektüre sich auf. Philosophen durchgeistern die Texte, weltgeschichtliche Individuen und Geschichtsereignisse, Revolutionen und große Umbruchszeiten. Anspielung, Berufung, lyrisches Darstellen, Rollensprache, Parodie, essayistischer Zugriff sind, die Formen dieses Heraufholens. „Überhaupt“, sagt der Autor, „montiere ich Zitate“ (S. 49), oder: „einem gewissen Herrn Marx aus dem Bürgertum“ verdanke „ich größtenteils meine Sentenzen“ (S. 85). Hat da einer, Gestalt später (und, folgen wir einem schönen Wort von ebenjenem Herrn Marx, „eiserner“) Zeiten, zu viel gelesen, breitet er nun die Früchte eines umhertreibenden Studiums aus und ist beschäftigt, „in Wachs, Gips und Kupfer abzudrücken, was aus karrarischem Marmor, ganz wie Pallas Athene aus dem Haupt des Göttervaters Zeus, hervorsprang“? Ich denke, wie Wenzel des Früheren innewird, zeigt auf eine existentielle Last des Heutigen und seine Not-Wendigkeit, über die Gegenwart hinaus nicht Größe, wohl aber des Stoffs zu leben sich zu vergewissern. „Ich fieber“, heißt es charakteristisch von einer der Situationen, da die Erinnerungen im Blute treiben, vielleicht ein Heilmittel: „Eine Mischung aus Salben gegen Reizungen ist die Vorzeit“ (S. 54). Aber „scharf“ vor allem, eine „Sense“, eine „heiße Ware“ ist, was der Gedankenschmuggel über die Zeitgrenzen transportiert (S. 56). Die Geschichte als „Museum“ für touristischen Besuch ist Wenzel wie uns. Gewohnheit, und doch ein Spott (S. 28), nicht weniger die „historischen Kleider“, in denen manche seiner Freunde auf und ab stolzieren (S. 58). Was die Toten trugen, wird ihm zur „Zwangsjacke“, er hat sie sich anzuziehen. Er klagt:
Lenin hats wieder auf mich geschoben,
Genau wir Epikur, warum ich?
… Woyzeck
Hat mir die Hand gedrückt
Ans Messer
(S. 35)
Poesie will der junge Poet – Marx’ Worte – „aus der Zukunft“ schöpfen, nicht aus der „weltgeschichtlichen Rückerinnerung“, die es der Gegenwart erlaubt, „sich über ihren eigenen Inhalt zu betäuben“. Aber, wie sich zeigt, kann er die Gewißheit nicht finden, die ihn – wie Marx – sagen ließe, es müßten „die Toten ihre Toten begraben“ (S. 51). „Alle Toten /“, spürt er, „Sind ungeduldig. Nichts / Bewegt sich. Zufrieden sinds / Die Lebenden. Die Toten / Erklären den Krieg“ (S. 35). Das Unerledigte, das aus der Vergangenheit in die Gegenwart ragt, wird zum Motiv, das auf Zukunft das Denken richtet.
Tradition – das klingt so beruhigend und gemütlich, sie ist ungemütlich und beunruhigend in der Empfindungswelt Wenzels. Er, der alles auf sich bezieht, fühlt sich „verirrt in die epochen“ (S. 28), und er sucht in ihren Kämpfen die Bewegung. Kontrastierend setzt er sie in die Bilder seines Alltags, dem er verhaftet ist:
Nur ich allein bin mir zu wenig.
Nur ein Land ist kein Zuhaus.
(S. 76)
Die Dichte der Rückwendungen und der Hinwendungen – denn was von den Wegen in die Zeit, gilt von denen in den Raum –, ihre formale Vielfalt und ihre Energie, das Drängend-Bedrängende, das aus dem Erinnerten steigt, sind Kennzeichen von Wenzels Arbeit. In der Verbindung dieser Elemente sehe ich Neues durchaus. Und zu dem Neuen gehört auch, wie all dies als Weise der Gegenwartsverarbeitung fungiert, im Versuch, diskutierend eine Haltung zu gewinnen, die der Dauer der geschichtlichen Widerspruchslösungen irgend gemäß wäre. Diese Dauer – sie quält den Verfasser heute, sie quälte aber, sieht er, schon andere vor ihm, in ihrer Art Winckelmann oder Goethe, Erich Mühsam oder Max Hoelz und – ihm ein Beispiel – Hölderlin. Dessen Gedicht „Chiron“ wird ein Konzentrationspunkt in seinen Überlegungen. Sie mag er ironisch sogar als die Hauptsache seiner Arbeit erklären, spöttisch lautet die „Literaturangabe“: „CHIRON oder die Zweigestaltigkeit. Ein formloser Essay in sieben Teilen nebst Gedichtanhang vom AUTOR“ (S. 107).
Chiron: Aufruf von Erbe, zur Tradition gemacht – eine Geschichtenfolge, die antiker Mythos war, metaphysisch gedachte Ideenversinnlichung wurde und jetzt literarisches Material ist, die Lage und das Ich in ihr zu erkunden. Hölderlin ist die Mitte dieser Bildwelt. So liest Wenzel die Chiron-Gestalt seines Vorgängers: Der weiseste der Kentauren lebte in „Einheit mit der unberührten Natur“; von Herakles – er „entzaubert die Landschaft, kultiviert, vertreibt aus dem Paradies“ – wurde er mit vergiftetem Pfeil unheilbar verwundet; das Licht ist aus seiner Landschaft verschwunden, sein Leid ist groß, denn er ist unsterblich; prophezeit ist aber: Herakles wird einmal Prometheus vom kaukasischen Felsen befreien, der wird des Kentauren Unsterblichkeit auf sich nehmen; Chiron wartet auf seinen Tod, die Befreiung (S. 91). Der Jüngere hört eine „ROLLE-CHIRON“ sprechen (S. 107), er begreift das Gedicht als Reaktion Hölderlins auf ein „Dilemma seiner Zeit“, als Bestreben, in Kenntnis des nachrevolutionären Frankreich an „Gewißheit über Zukunft“ festzuhalten; die geht notwendig „über ein Leben hinweg“. Historisches Verstehen und aktuelles Verstehen (zwei nützliche Begriffsvorschläge von Karl Mickel aufzugreifen) sind hier vereint. Wenzel weiß: „das Gedicht spricht auch über mich“ (S. 91), es wird zum allgemeineren Sinnbild von großem Zeitenwechsel, von Verletzung, von Zuversicht. Und so wird es ihm Anlaß zum Schreiben, zu produktiver Rezeption.
Wie genauer? Der Autor weiß um viele Möglichkeiten eines aktuellen Bezugs. Parodistisch skizziert er Üblichkeiten kulturkritischen Geredes in einem Anhang zu seinem Essay. Wäre es angemessen, ein „dialektisches Verhältnis von CHIRON (Verlust) und Herakles (Gewinn)“ zu konstatieren oder – im Blick der „Hegelschen Triade“ – einen „Prometheischen Sieg“ (S. 107) (eine glückliche Aufhebung also des gewalttätigen Heraklesfortschritts, der, als einfache Negation, das Naturwesen Chiron tödlich trifft, nicht willentlich, aber doch, wie es seine Art ist, bei Gelegenheit einer der berühmten größten Taten)? Bedeutungen, das ist für Wenzel ausgemacht, stehen nicht ein für allemal fest. Er verwirft die Erleichterungen, die bilanzierend oder synthetisch über die Schrecken der Negation hinwegtrösten, und er nimmt daraus – unaufhaltsam scheint dieser Vorgang, der auch in unserer Kunst Prometheus längst betroffen hat – das Recht zur Uminterpretation der Herakles-Figur, den, vielleicht als letzter?, Peter Weiss doch noch ganz anders aufzufassen vermocht hat. Was Wenzel beschäftigt, ist die Lage an einer Grenze der Zeit. Chiron, Hölderlin und das eigene Ich sieht er in einer „Warte-Situation“, die dem Betroffenen keine weitere freundliche Aussicht bietet als den Tod, die dennoch die Hoffnung nicht verstummen läßt auf den Tag, da die Erde anders ist, da nicht mehr ins Leere die Frage Hölderlins weist:
Wo bist du, Nachdenkliches! das immer muß
Zur Seite gehn, zu Zeiten, wo bist du, Licht?
Die mythischen und die religiösen Hilfsmittel sind erloschen, die eine Antwort verheißen könnten. Dahin führt keine Tradition zurück. Es bleibt nur die Tendenz der Geschichte. Leicht kann diese Hinsicht nicht werden in der „Warte-Situation“: Deren Schmerz und Zuversicht wurzeln in dem Gefühl für eine „aufgeteilte Zeit“, für die Nichtübereinstimmung von „persönlicher Lebenszeit“ und „Zeit, die zur Lösung des Widerspruchs benötigt wird“, von „wahrnehmbarer und nicht mehr wahrnehmbarer Zeit“ (S. 91). Was als Idee eines Zeitwiderspruchs hier erscheint, ist mehr als ein zufälliger Einfall. Vielleicht gleichzeitig, 1981, sprach Heiner Müller vom Wissen des einzelnen, „daß die Differenz zwischen der Geschichtszeit und seiner eigenen nicht mehr zu schließen ist; daß sich seine Erwartungen an das Leben nicht mehr erfüllen lassen in seiner subjektiven Zeit, und auch seine utopischen oder historischen Vorstellungen sich nicht mehr realisieren lassen in seiner Lebenszeit“.
Wie Müller weiß der Jüngere, daß solche Erkenntnis auch den „Verrat als positive Möglichkeit“ produzieren kann, die Einkehr in ein privates Glück. Und er kennt die Möglichkeit, in die steinerne oder weinerliche Empfindung von Stagnation zu verfallen. „Warte-Situation“ heißt für ihn polemisch Einordnung in lange Prozesse der Geschichte. Die Geduld, die sie erfordert, nicht identisch mit dem zufriedenen Gefühl der Geborgenheit, ist bei ihm durchzogen von Ungeduld. Auch dies ist Zweigestalt: die Grenze in seiner Brust trennt und vereint den, der von den Zwängen der Dauer alles, und den, der davon nichts einsehen mag. Wer das möchte, könnte von hier aus – gesetzt, es wurden Haltungsmerkmale umschrieben, die ein Ordnungssystem von Literatur heute erkennbar machen – ziemlich genau Wenzels Platz unter den Dichtern bestimmen.
Im Chiron-Essay tragen Geduld und Ungeduld nun auch die Namen „Tradition“ und „Produktion“. Über sie sprechen, in einem eingesprengten Dialog, zwei Dichter. Sie heißen A und B. A sagt (weil er meint, „Tradition behindere die Produktion“, „Form sei Belastung aus der Vergangenheit“):
Jede Erfindung, jegliche Kunst kommt aus dem freien Spiel der spontanen Kräfte eines Subjekts, das aus dem Formenkanon bzw. der eingegangenen Denkmethodik ausbricht, sich von den Dingen unabhängig macht.
Dagegen B (der glaubt, daß die „Dinge“ von uns auch verlangen, daß wir „gehorchen“, daß „Subjektivität“ ein Anspruch ist, „der auf dem Operationstisch erlischt“):
Nehmen Sie diese schwachsinnige Definition sofort zurück! Die Dinge, Umstände sind vom Menschen gemacht. Sich zur vergegenständlichten Welt verhaltend, verhalten sie sich zu anderen Menschen, ihren Vorfahren. Jede Produktion ist ein Verhältnis zur Tradition.
A besteht jedoch:
Ein einzelner kann nicht alles tun, aber alles Tätige (!) besteht aus einzelnen. (S. 93f.)
Sie merken schon: In dem Dialog geht es keineswegs nur um künstlerische Tradition und Produktion. Dies ist nur Seite eines umfassenderen Problems, wie es die „Chiron“-Interpretation verallgemeinernd benennt:
Die Welt ist aufgeteilt. Auf der einen Seite stehen die Dinge, Objekte, Umstände, die zum Handeln zwingen und oft erscheinen, als würden sie selbst handeln – auf der anderen Seite die Leute, ,Subjekte‘, tätige, sinnliche Menschen, die bedingt tun können, was sie wollen (was wollen sie?). Diese teuflische Spannung ist nicht zu überwinden (beide Seiten bekämpfen sich). (S. 91)
Ob diese Generalisierung den Mythos trifft oder Hölderlin, bleibe dahingestellt, zwischen A und B in Wenzels Dialog jedenfalls wird der Kampf ausgetragen. Auch so, daß A dem B vorhält, er sei ein „erbärmlicher Analytiker, der nur danach handele, was ihm die ,Umstände‘ zuweisen“, ein „Apologet“, der „alles einzusehen“ sich bequemt habe, aus dessen Stellungnahme Neues nicht entspringen könne, daß B aber dem A bedeutet, er sei mit seinen Predigten ein Anhänger der „Spontaneitätseuphorie“, einer zumal, der, weil er die Wirklichkeit für „beschissen, unpoetisch, unrevolutionär“ halte, „sich selbst zur Welt“ erkläre und deshalb, wenn seine „stubenreinen Ideale draufgegangen sind,… im Zynismus“ enden werde. „Widersprüche müssen gelöst werden“ – das ist die Losung von A; die von B lautet: „Widersprüche müssen ausgehalten werden, bis die Zeit ist, daß sie gelöst werden können.“ (S. 92f).
Werden Sie mir zustimmen, liebe Kollegen, daß dieses Beispiel lehrreich ist? Aus ihm seinen „nervlichen Materialschlachten“ (S. 106), will ich mir wenigstens zweierlei merken.
Zuerst: Ich sprach von einem Sechsundzwanzigjährigen. Und was nicht alles hat der schon durchdacht, fast alles, was im Allgemeinen über Tradition und Innovation zu lernen ist! Die Kritik kann die avancierte literarische Produktion nicht über Grundverhältnisse belehren, Ergebnisse langwieriger theoretischer Akkumulation bilden bereits ihren Ausgangspunkt. A im angeführten Dialog weist beispielsweise auf die Gedankenwelt Adornos, auf ein verzweifeltes Vertrauen in die innovative Spontaneität einer Subjektivität, die wider die Verdinglichungen gerade in der Kunst sich äußern soll, auf eine Kritik an Gefügtheiten, zu denen alles zum Gattungshaften Geronnene auch in der Kunst gehört. B im Dialog weist dagegen auf eine Theorie der Aneignung, wie sie im Marxismus ausgebildet wurde; hier spricht das Vertrauen auf die dem Menschen eigentümliche Fähigkeit, ihre Erfahrungen in Kommunikation tradierbar zu machen und so zu erweitern – und nicht anders als über die Vergegenständlichung der subjektiven Kräfte, wie sie etwa auch in den Werken der Kunst vorliegen. In geschichtstheoretischer Sicht: A und B entfalten den Widerspruch eines Marx-Satzes, den Wenzel an anderer Stelle so zitiert:
MENSCHEN MACHEN EIGNE GESCHICHTE ABER NICHT
AUS FREIEN STÜCKEN (S. 54).
Und wenn man hoffen kann, daß sich endlich die geduldige Vernunft von B bewährt, auch die Kritik könnte sehen: mit der Ruhe seiner Argumente ist wenig ausgerichtet, wenn sich die unvernünftige Ungeduld des Dichters A zuneigt. A und B sind einer nur, der Verfasser des Essays, in ihm findet der Streit statt, er widerspricht sich, seine Identität liegt nicht im Unteilbaren, im Individuellen. „Das Ganze“, heißt es, „spielt eigentlich im Herzen des Poeten, durch das bekanntlicb ein Riß geben soll“ (S. 94) „Bekanntlich“ wird gesagt, an Heine wird erinnert, der sagte:
Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so mußte es wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, daß er ein prosaisches weltabgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriß.
Ich merke mir so dann auch dies: Hölderlin und Heine erscheinen als Berufungsinstanzen Wenzels, Antipoden, wenn man Brechts Ansicht folgt, daß nach Goethe die schöne Einheit der Poesie in zwei Linien zerfalle, in eine pontifikale und eine profane, und es erscheint in seinem Essay (wie in seinen Gedichten) auch der Bezug auf Brecht. Mit den „Linien“, die früher gezogen wurden, um eine gewertete Ordnung in das Vergangene zu bringen, kann eine avancierte literarische Produktion heute nicht mehr allzuviel beginnen. Fast sieht es aus, als stünde dem Neueren alles zu Gebote, als könne er über die Vergangenheit verfügen. Sicher ist das Verhältnis zum Älteren heute weniger das eines Ergriffenseins als das eines Zugriffs. Doch ist Verfügung über das Erbe nicht frei. Nicht allein, weil die Vergangenheit als Verpflichtung begriffen wird, sondern vor allem, weil die Beziehung zur Vergangenheit aus den Zwängen der Gegenwart stammt. In dem Wirbel der Bezüge, den Wenzels Gedichte und sein Essay vor uns hinstellen, zeichnet sich durchaus eine Linie ab, die des Rückbezugs auf die Geschichte der Revolutionen und ihre Nachgeschichten und, auf ein poetisches Verhalten, das den Riß der Welt als Riß des eigenen Herzens empfinden läßt. Diese „Linie“ zeugt von einer Werthaltung, die der einfachen Sicherheiten wieder bar ist und auf neue Weise bereit, sich den Widersprüchen zu öffnen. Stilbrüche, Experimente, sonderbare Mischformen, so sagte einmal Anna Seghers im Streit mit einem Anhänger der Ganzheit, kennzeichnen dieses Verhalten auf dem Niveau der Form. Sie hat längst ihre eigene Tradition, und statt den Anschluß an sie als Unreinheit zu bedauern, hätte die Kritik ihre Bedingungen aufzuklären.
Literatur und Leben (Notiz, 1983)
Was ich da im vorigen Jahr aufschrieb, scheint mir jetzt mehr als problematisch. Solche beinahe abgerundeten Texte pressen zusammen, was in viele Richtungen geht, auch wenn sie vom Widerspruch handeln. Da wird ein Überblick versucht – durch Wegsehen. Nur Ausgedörrtes bleibt übrig nach solcher Prozedur, und unzufrieden starre ich auf die blinden Stellen. Das Thema war vorgegeben, läßt sich aber ein Dichter unter ein Thema bringen? Jetzt kann ich froh sein, daß der Beitrag nicht gehalten wurde. Kritikern sollte es nicht erlaubt sein, lebendige Menschen zum Material von „Lehren“ zu machen. Sonst nähern sie sich dem Kulturgeschwätz, das Wenzels Essay in den „Hinweisen“ der imaginären „Chiron-Gesellschaft“ demonstriert oder auch in der erfundenen Vorlesung eines erfundenen Professors, dem nur die Unaufmerksamkeit der zerstreuten Studenten begegnet: Die unterschiedlichsten Zugänge zum Material sind möglich, aber wo sind die notwendigen? Über alles wird Bescheid gewußt, aber wo greift dieses Wissen ein? Es erzeugt bloßes Geräusch. Und handelt nicht davon gerade der Essay? Vom Unernsten, das den Ernst fast unhörbar werden läßt? Vom „Wolfsgeschrei“ (S. 92), das in die Versuche zur Verständigung dringt und sie beinahe zunichte macht? In Wenzels Text sind ständig anwesend auch Fußballärm und Tooorgebrüll, lautsprecherverstärkte technische Anweisungen, das Klirren von zerbrechendem Geschirr und das Krachen der Autounfälle, das Dröhnen der Karussellorgeln, der Blasmusik und der Militärmärsche. Schlagersänger öffnen ihren Mund zu ihrer Frage aller Fragen:
Wer soll das bezahlen
wer hat soviel Geld?
und zu ihren Antworten:
Freiheit! Freiheit! wolltest du und meine Liebe. Lalala. Wolltest beides. Doch das gab es nicht. Freiheit oder ich!
Und wird nicht von einer Kunstindustrie gehandelt, die zu Features macht, was Aneignung sein könnte, zu einem surrealistischen Film zum Beispiel, in dessen Zeitraffer die Entsetzlichkeiten der Geschichte paradox verkunstet werden (Wenzel gibt dafür ein mögliches Exposé), oder die (davon erzählt der mögliche Brief eines zeitgenössischen Schauspielers) alles Vergangene auf die Ebene der Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit bringt, in Stücke eines Repertoires verhext, dessen Schizophrenien die Beteiligten auseinanderreißen.
Da mußte ja dem Autor die hochgesinnte Verschwörung der klassischen Literatur einfallen, die „abgekartete Sprache eines Freundeskreises“, die „Literatur-, Schreibsprache“ (S. 98)! Seine eigene Umgebung scheint sie wieder fast unvermeidlich zu machen. Davon auch sprechen die Gedichte. Wenzel bekennt Sehnsucht „Nach einem großen Platz / Nach einem Platz Leute“, wo viele etwas zu sagen haben und zuhören (S. 79). Der Schreibkreis soll durchbrochen, wenigstens von einer Bühne herab soll das „Hölderlin-Lied“ gesungen werden – wie groß sind dann die Ernüchterungen, wenn nur eine „Operettenrevolution“ herauskam (S. 55), wenn Lieder erklangen – und es vor allem die „derben Witze“ waren, die „vom Klatschen und vom Schreien“ ermuntert wurden? Am Ende steht der Sänger „einsam“ da, und er weiß:
Alles, was ich hab, verteil ich,
So erfinde ich mein Glück.
Meine Narrenfreiheit freilich
Ist ein lächerliches Stück
(S. 67).
Sprachlosigkeit deutet sich an. Doch bleibt es dabei nicht. Glück nicht im Nehmen, sondern im Geben. Kräftiges und auch verzehrendes Sichausgeben in einem selbsterfundenen, schon beinahe überhitzten Dasein:
Ich tanze, ich singe, ich schenk mir ein,
Und rechne nicht aus, was mich würgt, was mich bricht.
(S. 47).
Und dabei immer ein Weiterreichen alles dessen, was man sich, rasend in der Wut der Jugend, erworben hat. Diese Programme von Karls Enkeln – sie sind Stücke einer erarbeiteten Biographie, eines historisch erweiterten Lebenslaufs, Aneignung nicht von „Werken“, sondern Aneignung von Haltungen, von Verhalten, von Gesten, ein Einlassen nicht in Gebilde, sondern in die Frage: Wie kann das gesprochen worden sein? Wie kann man das jetzt sprechen? Weitung der Persönlichkeit über den Raum eigenen Erlebens hinaus durch ein Tun der Phantasie – ist das Bedingung fürs Dichten, was rede ich: fürs Leben? Wäre ich Pädagoge – ich würde den in dieser Aneignungsform liegenden Vorschlag (er ist der eines Avantgardismus) zur Anregung nehmen, über Veränderungen des Kunstunterrichts nachzudenken, über Möglichkeiten, Reichtum durch imaginative Praxis anzueignen.
Es bleibt aber auch die Einsamkeit. Einsam der, der von so vielen umgeben ist? Wenzel zitiert aus der „Winterreise“ (in einer vom Original abweichenden, verschärfenden Schreibweise):
Fremd bin ich. Eingezohogen fremd, zieh ich wieder.
(S. 7).
Gibt eine solche Fremdheit den Ton an, aus dem seine Elegien kommen? „Jeder ist fremd“, heißt es hier, „und Jeder ist der Andre, dem er / Ausweicht: Jedweder Schritt: Kommen und Gehen.“ (S. 73) Das lyrische Ich ist da zum „Pilger und Flüchtling“ stilisiert. Es spricht der Konflikt also nicht nur zwischen dem ans Hiesige, Heutige Gebundenen und dem, der seine Grenzen durchbricht, auch der Konflikt zwischen dem, der dem Unerträglichen zu entfliehen sucht (und immer erfährt: „Die Flucht ist uns mißglückt: Wir hasten, schreien, / Wir kratzen, sieh er heilt schon, unsern Grind“, S. 23) und dem, der aufbricht, das Heilige oder doch: das Erträgliche zu suchen (und schon weiß: „Es reicht nicht. Alles. / Du unser zu künftiges Reich, zu arm ist es“, S. 9):
Unmögliche Lage für den Kritiker. Wie soll er denn ausdenken und in verständige Worte fassen, was der Widerspruch der Empfindung preisgibt? Oder was in den Spannungen des Bildgefüges sich zeigt, in der fünften der „Schmuggerower Elegien“ zum Beispiel?: Idylle eines Vorfrühlingstages, eines ersten Frühstücks im Freien und Tragik der einbrechenden Erinnerung an die großen und die verlorenen Schlachten der Vergangenheit, an Spanien 1936–1939, an Situationen ohne Ausweg; imaginative Identifikation mit den Kämpfern in der Überblendung der Zeiten und die Verführungskraft der schönen Szene:
In solchen Momenten schweb ich in Gefahr,
Meine Unruhe anzuhalten, gelassen mit dem Gras
Abzuwarten die Maitage
Unsagbar, Todesstille fürchterlich, die Trauer im Widerspruch des Hoffenden:
In dieser Ruhe der Mondwechsel, Baumringe,
Jahrzeiten dauert mein Frühstück ein Jahr Hundert.
Ich nehme mir Zeit, genieße das ewige Zurechtrücken
Der Tassen und Teller, bis sie ihren einzig richtigen
Platz gefunden, bis alles im Einklang steht, zueinander,
Keines wiederholen muß Bogen, Weg, Lage, Graben
Eines anderen, Schmerzen oder Niederkunft.
(S. 80f.)
Wie davon sprechen? Die Literaturkritik hat über Literatur zu reden? Hat sie zu schweigen, wenn Glück oder Bitterkeit eines Lebens zu ihrem Gegenstand, werden müßte? Der authentische Dichter offenbart sich – und der Kritiker darf (welch sonderbare Konvention!) über einen Menschen öffentlich befinden? Und womöglich in den Varianten, die Brecht schon notierte, daß man sich nämlich bei den Leiden des Dichters bedankt: „sie haben etwas zuwege gebracht, sie haben ihn gut ausgedrückt“, oder daß man, ausgerüstet mit Begriffen und Gewißheiten, mitteilt: „Da war etwas, was lebte, falsch“?
Dissens und Gemeinsinn (Notiz, 1985)
Über W.s Gedichtband sind sich die Kritiker nicht einig: und es geht dabei, welch selten ausgewählter Gesichtspunkt!, um die Qualität von Texten. Abzusehen ist auch hier allerdings, daß Formfragen Inhaltsfragen sind. L. (in Sinn und Form, Heft 5/85) ist sehr entschieden: Angesichts der „Grundübel“ der Verse von W. sagt er uns, dieser Dichter sei keiner, das „Wort“, „das für sich selbst einzustehen hat“, sei „seine Sache nicht“, er solle das Schreiben fürs Lesen lassen und seinem Talent auf der Bühne Rechnung tragen. Entschieden ist auch H. (in DDR-Literatur ’84 im Gespräch, Aufbau-Verlag). Was W. gibt – kaum „geschlossene Gestalt“ –, will sie nicht als Ausweis eines Defizits von Gestaltungsvermögen ansehen. Ihr ist es „bewußt gewählter Ausdruck der Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem, Mittel, Unvereinbares zu vereinbaren, unmittelbare Erfahrung und Ersehntes, Gefürchtetes, Erahntes zu verknüpfen. Und auch Ausdruck von Suche, schmerzhafter Sehnsucht nach erfahrbarer Identität.“ Ausgleichend wiederum redet S. (in Temperamente, Heft 3/85). Er sieht Stärken und Schwächen an den Texten W.s und entscheidet sich:
Da finde ich eine Qualität, Welt zu sehen und zu bedichten, vor der es mir den Atem zu Bemerkungen über Handwerkliches verschlägt. Da keuche ich nur noch, daß sich an den Texten versuchen mag, wer Unzulängliches sucht, und er wird nicht vergeblich suchen.
Irgend etwas ist da mit der Form nicht in der Ordnung, empfinden alle, heillos L., sinnvoll H., entschuldbar S.
Als L., H. und S. schrieben, kannten sie des anderen Meinung nicht. Fällt es ihnen nun wie Schuppen von den Augen oder ist ihnen die Nase geöffnet – nach dem Muster des Witzes, der einen sagen läßt: „Jetzt, wo Sie es sagen, riech ich es auch.“? Hätten wir ein Gespräch, könnten wir es wissen. Spannender Vorgang: Kaum hatte S. seine Meinung mitgeteilt, keuchend, wie gesagt, da ging schon L. hin, suchte und fand. Wie mag der Atem von S. jetzt gehen? Zumal er geglaubt hat, eine „Empfehlung, W. solle mit dem Schreiben aufhören, dürfte wohl noch keiner gewagt haben“, und der Ansicht gewesen ist, W. bräche mit seinen stärksten Stücken, Liedern vor allem, „durch hartnäckige Vorurteile und ignorante Anwürfe hindurch“, „ein in DIE Literatur“. Er kann nun in sein Stammbuch die Erfahrung eintragen, wie schnell Kritiken widersprochen werden kann. Um seinen Atem bin ich wirklich besorgt.
Könnte mich der Satz beruhigen: „Ein jeder hat seinen eigenen Geschmack“? Was geht es S. an, wie L. befindet – oder mich? Aber es berührt mich doch. L.s Kritik ärgert mich ungemein. Und von Kant, aus seinem Nachdenken über die Antinomien des Geschmacks, weiß ich auch weshalb: So einfach stimmt der eine Satz nicht, es gilt auch der andre: „Über den Geschmack läßt sich streiten.“ Das ästhetische Urteil ist nämlich zudringlich, sagt Kant, eine „Anmaßung“ – da „verstatten wir keinem anderer Meinung zu sein“ –, es ist eine „Zumutung“: „sinnet jedermann Beistimmung an“, verlangt Beifall, weil es auf ästhetische Urteilskraft rechnet und auf „Gründe des Urteils, die nicht bloß Privatgültigkeit haben“, subjektive wohl, aber „allgemein-subjektive“, auf „gemeinschaftliches Gefühl“, einen „Gemeinsinn“. Nicht anders doch wohl die Kritik. Ist sie denn viel anderes als ein Apparat, eingerichtet, in diffus gewordener Öffentlichkeit die Ansinnen des Geschmacks und anderer Wertungen an viele heranzutragen? Ein Kunstraum, in dem beauftragte oder selbsternannte Spezialisten die Konsensangebote der literarischen Produktion zu prüfen und dann medienlaut zu bestärken oder abzuschwächen haben? Dichter denken vielleicht, in der Kritik gehe es um sie. Werch ein Illtum! Die Kritik appelliert an Gemeinsinn und will ihn fördern – am Fall, auf den man sich einigt und der so vielleicht auch zum Beispiel werden kann für eine Regel, die erst noch kommt.
Kant dachte den Gemeinsinn als „allgemeinen Menschensinn“ – eine Utopie, die unser historisch und sozial differenzierendes Denken kaum noch zuläßt. Wir wissen: auf verschiedenem Gemeinschaftsniveau bildet sich Gemeinsinn, sitzt, worum es hier geht, das Gemeinsame der Wertungsgrundlagen, das Allgemeine der Bedürfnisse und Interessen und der daraus abgeleiteten Ideale, Normen, Präferenzsetzungen und Handlungsziele. Und so sind wir auch nicht mehr so sicher, ob sich über den Geschmack, über den man streiten kann, auch sinnvoll streiten läßt: durch Bezug auf Gemeinsinn nämlich mit der „Hoffnung…, untereinander überein zu kommen“. Ach, ginge es doch wirklich nur (bei voraussetzbarem einzigem Gemeinsinn) um unsere ästhetische Urteilskraft!, um die Fähigkeit, auf die hierher gehörende Art das Besondere unter das Allgemeine zu bringen, zum Beispiel die eigentümliche Rede von W. unter eine „idealische Norm“, die wir alle teilen, das verbindliche Muster ästhetisch gelungener Sprache. Aber was heißt denn „nur“, wo doch schon solches Urteil niemals ganz sicher ist (etwa weil wir das Allgemeine nicht festnageln können, unter das das Besondere subsumiert werden soll, oder weil das Besondere allzu viele, vielleicht widersprüchliche Merkmale hat). Und wie groß sind trotzdem die Beleidigungen beim Zweifel an des anderen Urteilskraft! Schwieriger dennoch wird sinnvoller Streit, wenn wir erkennen müssen, gemeinsamen Gemeinsinn nicht zu haben, wenn uns Verschiedenheiten in unseren Wertungsbasen trennen, in den Interessen zum Beispiel oder den Normen, die wir an W. herantragen. Um sie hat dann die Diskussion zu gehen. Um die Vernunft im urteilsleitenden Gefüge der Wertungsgrundlagen, in ihren Hierarchien, um die innere Logik der Auflösung von Widersprüchen zwischen verschiedenen wertbildenden Momenten. Und um die Gültigkeitsbreite der Wertungsgrundlagen, um ihre Geltungskraft wenigstens in der sozialen Einheit, zu der sie gehören sollten. Denn auf begründbaren Gemeinsinn zielt utopisch – wie die Kunst selbst – der Streit im Drama der ästhetischen Aktion (und letztlich, fernhin, auf einen, den man der Menschheit zuschreiben könnte oder doch denen, die – nach einem berühmten Wort – „für die dringendsten Schwierigkeiten, in denen die menschliche Gesellschaft steckt, die breitesten Lösungen“ bereithalten). Und daran sollten wir festhalten – auch wenn neuerdings (man lernt ja hinzu und ahnt so manches vom „gemeinschaftlichen Gefühl“) in der Kritik gern „Ich“ gesagt, auf so geleiteter „Subjektivität“ bestanden und anderen bequem erlaubt wird, anderer Meinung zu sein; auch wenn im Alltag die Rede über Kunst oft genug sich in ein Kontaktspiel verharmlost, in dem wir über (vielleicht so in vollem Ernst gar nicht gemeinte) Geschmacksurteile Stellung zueinander beziehen, bloß um uns zu erkennen zu geben, daß es sich bei dem, was einzelne zum allgemeiner gültig werdenden Urteil beitragen können, zunächst um Zumutungen handelt, bleibt bei Gleichgesinnten vielleicht unbemerkt. Im Dissens aber entsteht Irritation. Behauptet nämlich einer, etwas habe positiven ästhetischen Rang, was ich mit Abneigung, oder etwas habe diesen Rang nicht, was ich mit Zustimmung betrachte, spüre ich sogleich die wahre Natur des Urteils im Geschmack – seinen Charakter als Anspruch, der auf meine Bestätigung wartet. Was ich so deutlich als schön oder häßlich empfinde, soll es nicht sein? Ich kann, unsicher geworden, schweigen. Oder ich setze mich zur Wehr. Nicht nur der Gegenstand erscheint zu Unrecht aufgewertet oder abgewertet, ich selbst bin angegriffen, meine Art, Wert und Unwert zu bestimmen, meine Urteilskraft, meine soziale Identität. Da soll doch lieber der andere sich geirrt haben! Aber mein Urteil ist ebenso hypothetisch wie das des anderen. Erkennend entscheiden können wir nicht, solange wir nicht die Gründe dieser Urteile aus der Unmittelbarkeit des Gefühls herausgearbeitet haben, in der sie ästhetisch funktionieren. Dies wird uns immer nur annäherungsweise gelingen, nur so aber können wir diese Gründe gegenseitig abwägen und zu einer vergleichsweisen Wahrheit kommen. Über das Urteil von L. ärgere ich mich? Warum soll, kann, muß der Streit denn gehen?
Zunächst muß ich konstatieren, daß wir uns auch einig sind. L. meint nicht, daß W. nichts oder nichts von Wert zu sagen hätte. Er sagt, daß W.s Gedichte – in der Polarität eines „elementaren Hungers nach Welt“, der das Ich über Grenzen hinausträgt, und einer „unlösbaren Bindung an den Status determinierter Existenz“ – eine erhebliche Spannung haben; sie erweist sich – mit dem Verzicht auf Ausgleich – als eine „ungeheure“ und als etwas „Explosives“. Wenig variiert findet sich diese Angabe bei anderen wieder. H. spricht von der „Erfahrung von Begrenztheit und Sehnsucht nach Unbegrenztheit“, der Erfahrung der „Zerrissenheit“; S. wiederum von einem Dichten, das „sich widersetzt, um seine Verantwortung wie um seine begrenzten Möglichkeiten wissend“. Und weiter: für Sch. (im Sonntag 28/1985) hat Dominanz in dem Widerspruchsfeld der Gefühlswelt W.s „das Bestreben, im Wissen um das geschichtlich Determinierende eine aktive Haltung zu behaupten“; ich notierte mir die Spannung der Zweigestalt zwischen Geduld und Ungeduld.
Nicht einig aber bin ich mit L.s Idee, daß es die Spannung, die er beobachtet, nur „eigentlich“ gibt, sie etwas ist, was zum Ausdruck drängt, doch Potenz bleibt, die in den Texten nicht adäquat realisiert wird. Die sieht er vielmehr bestimmt von Übeln. Wollte man, wie einmal ein deutscher Klassiker bei Franzosen, Urteilsworte deutscher Kritiker sammeln, man fände eine reichliche Liste derer des Tadels schon bei L.: impulsiv, widerstandslos, unangemessen, sorglos, mittelmäßig, billig, verkommen, arglos, unbegreiflich, konfus, schludrig, bedenkenlos, trivial, und sein größtes ist immer: stümperhaft. Mon Dieu!, den Kritiker zu zitieren, einer der persischen Magier möchte er nicht sein, und das finde ich sympathisch. Aber sind wir besser dran, wenn an deren Stelle die Oberlehrer treten, zu denen, wenn es sein muß, L. sich schlagen möchte? Inhalt gut, ist seine Note, Stil und Grammatik ungenügend; W. kann in die Klasse der Dichter nicht versetzt werden.
Ich bin in Selbstverteidigung, ich muß mich mit Gründen panzern. Und da frage ich zunächst, vor allem Urteilsstreit: Wie will L. denn gemerkt haben, daß Ungeheures spricht, wenn es die Texte nicht gesagt haben? Ich kann nicht annehmen, daß L. zu W. oder dessen lyrischen Ichs noch einen anderen Kanal gehabt hat als die Sprache, also muß ich annehmen, daß W.s Texte eine Qualität aufweisen, die das Explosive, aus dem sie kommen, auch mitteilen können. Daß sie das tatsächlich tun – und zwar in großer Deutlichkeit –, sehe ich daran, daß wir alle, L., S., H., Sch. und auch ich, die Grundspannung beinahe gleichsinnig bestimmen. Nicht der Autor also bewegt sich in einem Widerspruch zwischen dem „Eigentlichen“ und dem, was er sagt, sondern L.: Er verneint den Wert von Texten, die die Gefühls- und Erfahrungsspannung doch transportieren, welche auszudrücken er für wichtig ansieht.
Keineswegs heißt das nun zu bestreiten, daß es in den Texten W.s Übel gibt. Und ich denke nicht daran, sie wie S. zu entschuldigen. Die ästhetische Kultur der Sprache ist ein eigener Wert: Zeugnis eines menschlichen Sinns, der Beherrschung eines Instruments unseres Alltags, Ausdrucksform und Gegenstand genußvoller Tätigkeit. Und sie ist nicht gleichgültig gegen das, was an emotionaler Spannung und imaginativer Welt sie kundtut. Da halte ich es mit Borges, der bei einem Hinweis auf den Wert von Stillagen, die manche als „schlecht“ empfinden, gleich hinzusetzte:
Ich habe nicht vor, Nachlässigkeiten das Wort zu reden; auch glaube ich nicht an eine mystische Kraft des ungelenken Satzes und des pfuscherhaften Epithetons.
Wo L. recht hat, hat er recht, und er hat schöne Beispiele, die sich W. merken wird. Aber wo L. nicht recht hat, hat er nicht recht – und das ist vielfach der Fall, gerade auch bei seinem Hauptbeispiel, der „Schmuggerower Elegie IV, 1“, der er zwei von den sieben Spalten seiner Wenzel-Kritik widmet. Das festzustellen ist mir peinlich: Ich zweifle da an L.s Urteilskraft. Aber ich muß doch fragen: Wieso erscheinen mir bestimmte Textmerkmale bei W. akzeptabel, die für L. nicht akzeptabel sind, obwohl wir doch die Prinzipien teilen, nach denen solche Akzeptanz sich regeln sollte? Ich nehme als Norm an, was in L.s Kritik spricht: Ein Gedicht hat sich in bildsprachlicher Konsequenz zu entfalten. Ich nehme aber nicht an, was er mir an Urteil zur genannten Elegie zumutet. Furiose Kritik an der Bildsprache, sie ist dem Kritiker ein Gelächter. Ich aber lache über ihn, der zu satirischem Zweck einen Galimathias konstruiert, weil er ein Komma in der (sicher nicht glücklichen) Funktion eines Doppelpunktes und eine doch deutlich gezeichnete biographische Situation (ein Stadtbewohner kommt aufs Land) nicht wahrzunehmen vermochte. Vergleichbares bei L.s Kritik an der Versbehandlung in diesem Gedicht. W., meint L., wählt ein „bedeutendes Muster“: Distichen. Er konstatiert weiter; daß die ersten sieben Verse den Distichon-Regeln folgen, und beobachtet dann ein „metrisches Debakel“, weil die Distichen in die Brüche gingen und weil ein anderer (etwa bewußt deformierender) Gestaltungswille nicht erkennbar sei. Die so aufgefaßte Strukturlosigkeit wird dem Häßlichkeitsmuster Stümperei zugeordnet. Ich folge der urteilsleitenden Norm insoweit, als auch ich mir sage: Gedichte müssen rhythmisch durchgearbeitet sein, und wohlbegründet scheint mir die Auffassung, daß erkennbare rhythmische Muster beim Hörer/Leser eine Erwartung schaffen, die erfüllt werden muß oder so enttäuscht, daß man den Sinn der Abweichung begreift. Um den Fakt dieser Abweichung geht der Urteilsstreit. Anders als L. sehe ich in ihr kein Debakel, weil ich erstens nicht voraussetze, daß Wenzel sein Gedicht in Distichen hat schreiben wollen (vielleicht zitierte er die Form nur), und weil zweitens ich dem Abbruch einen Sinn zuschreiben kann – er hängt genau mit der Disparatheit der Erfahrungs- und Selbsterfahrungswirklichkeit zusammen, deren sprachliche Form L. doch so vermißt. Distichen wird konventionell ein Doppelcharakter von Aufstieg und Abstieg, Ruhe und Zwiespalt zugemessen (was eben sie für Elegien so tauglich macht). Offenbar war aber das Gleichmaß des Distichon-Wechsels von Hexametern und Pentametern dem Autor doch zu regelmäßig, eine Form der Unruhe, die ihm zu gebändigt erscheinen mochte. Die größere Spannung seiner Empfindung zu evozieren, bricht er die Regel, setzt auffällig Stockungen des Rhythmus, läßt wie als Erinnerung noch einige Male – in umgekehrter Ordnung – die Distichonform anklingen und greift (markiert auch durch ein Zeilenzitat) auf die Form der „Schmuggerower Elegie I“ zurück. Ich sehe bewußten Bruch, bestimme die Textmerkmale anders, sehe ein anderes Allgemeines, unter das ich das Gedicht bringen müßte, und komme zu einem anderen Urteil.
Aber vielleicht geht es doch nicht nur darum, das Besondere richtig unter ein Allgemeines zu bringen, um eine Frage der Urteilskraft? Bei L. sind Normenakzente im Spiel, die ich nicht teilen möchte. Es ist wahrscheinlich so, daß ich bereit bin, den Formschwenk in der vierten Elegie unter die Norm der Wohlgeformtheit zu bringen, weil diese für mich nicht unbedingt die Forderung nach Bruchlosigkeit einschließt und nicht das Verlangen nach metrischer Korrektheit (L. sagt wirklich „metrisch“ und spricht von „metrischen Defekten“). Hier gerate ich nun freilich auf unübersichtliches Gelände. Es wäre eine Ästhetik nötig, um zu begründen, weshalb mir Wohlgeformtheit mit Korrektheit nicht übersetzt werden kann (die L. auch hinsichtlich der Grammatik erwartet) und weshalb Folgerichtigkeit nicht mit Bruchlosigkeit (die L. auch in der Bildlogik verlangt). Klar ist aber, daß sich L.s Kritik weitgehend aus einer ästhetischen Konzeption ergibt, die nicht allgemein geteilt wird. Und ich darf sagen: diese ästhetische Konzeption ist enger (schließt mehr aus) als eine andere, die sich ja nicht gegen Regelhaftigkeit oder Bruchlosigkeit wendet, sie aber als Sonderfälle von Wohlgeformtheit oder Zusammenhang begreift.
Normendivergenzen spüre ich allenthalben – in der Pauschalität der Kritik, die L. an „Liedermacher-Schnulzen“, am „Kästner-Sound“, an der „Trivialität der Heine-Nachfolge“, am Gebrauch von „Bürokratensprache“ übt. Verschiedenheiten des Ideals kann ich vermuten, wenn ich bemerken muß, daß das Verlangen nach Authentizität bei L. tendenziell ins Verlangen nach „dichterischer Selbstkundgabe“ umgeformt wird (das ich nicht all und jeder poetischen Rede aufbürden würde), oder daß die Forderung nach „individueller Aufrichtigkeit“, nach „Rückhaltlosigkeit“ ihn tendenziell zur Erwartung führt, das Ich möge, trauernd oder zornig, von seinem Leid sprechen (von einer Empfindungslage, die ich nicht als einzigen oder vor allem auszuzeichnenden Inhalt aufrichtiger Selbstkundgabe ansehen kann). Und schließlich weisen mich auf Unterschiede unseres Wertsystems auch die Nullstellen in L.s Text: Bei ihm kommt nicht vor, was vielleicht das Wichtigste ist in der Formarbeit von W.
Wie mache ich mich in Kürze verständlich? H. kann mir weiterhelfen. Sie legt die andere Ästhetik zugrunde, an die auch ich denke, und folglich erkennt sie Werte, die außerhalb des Wertrasters von L. zu liegen scheinen: Spiel mit den „Genres und ihren Grenzen“ (das eben jenes Verlangen nach „Produktion“ in sich trägt, wovon W.s Essay spricht). W.s Texte, sagt H., bieten „keine im klassischen Sinne deutliche oder eindeutige Gestalt“, sie haben ihren Ort nicht in der Mitte der Gattungen, sondern an deren Peripherien. So ist der Essay kein Essay, wie wir ihn uns vorstellen, sondern eine „Text-Montage“ und vielleicht so ein Hinweis auf einen Weg des Autors vom Liedermacher zum „Monteur von Texten“. „Zweigestaltig“ ist seine Erfahrung, und seine Form ist deren Form. Nicht etwas Ungestaltetes liegt vor, sondern etwas, das nach einem offenen Prinzip sich bildet:
Die Ästhetik, die sich dabei herstellt, ist eine der Brüche, der Kontraste, der Montage.
So sehe auch ich Kontraste in der Folge der Formen, die Platz hat für das Lied, die Elegie, den sonderbaren Essay; Montage von Weltgeschichte und Alltag, Größe und Kleinheit in den Bildaufrufen der Gedichte; Brüche in der Empfindungswelt: laute und leise Töne, Sentimentalität, die den harten Blick erweicht, verführerische Melancholie, die in Spott übergeht, Nachdenkliches und Aggressives; und Brüche nicht zuletzt in der Höhe der Stilisierung: jenseits des Banalen das Hin und Her zwischen der Angestrengtheit poetischer Hochsprache und den einfachen Schönheiten des Trivialen (was wir ja endlich auffassen können als das, was sich auf den Straßen abspielt). Und ich sage mir: das alles zusammen zeugt von einer verhaltenen Kraft, von einem Dichter, um mit Sch. zu sprechen, der in einem „Debattenstil“ sich „kräftig zur Sprache bringt, indem er Beziehungen herstellt“, „mit Lust und Skepsis auf das Pochen der Unruhe in sich lauschend“.
Werden die besonderen Stärken der Texte nicht ins Spiel des Urteilens gebracht, so neigt sich zuungunsten der Notierungen die Waage. L. hat mit seiner Feststellung eines Widerspruchs zwischen „Eigentlichem“ und „Texten“ vielleicht nur gesagt: Zwar lassen die Texte die Grundspannung hören, die ich mit Wert belege, aber diese Texte sind so stark von Übeln bestimmt, daß ich von dem genannten Wert ganz abgelenkt bin (ihn als „entschärft“ empfinde) und folglich dem Ganzen Unwert beimessen muß. Ein Entscheidungsproblem für eine Werthierarchie! Wie schön wäre es, hätten wir ein Maß, das uns sagen könnte, bis zu welcher Grenze – angesichts von positiven Qualitäten – Übel tolerierbar sind. S. offenbar hatte eine andere Toleranzschwelle, weil in seiner Werthierarchie die Gewichtigkeiten anders festgelegt sind als bei L. Für den schien das Verhältnis so beschaffen, daß er sich ermächtigt sah, nach eventuellen Stärken des Textes gar nicht mehr zu suchen und seine Aufmerksamkeit voll auf die Übel zu lenken. Wollte ich seine Wichtigkeiten wiederum bewerten, muß ich mir sagen, daß hier vielleicht spricht, was Borges die „abergläubische Vergötzung des Stils“ genannt hat, ein Verhalten, das einzelne Elemente von Texten befragt, nicht aber die „Leistung des gesamten Mechanismus“, das dazu verführt, der „Überzeugung“ gleichgültig gegenüberzustehen oder die „Gemütsbewegung unter das Diktat… einer unbezweifelbaren Etikette“ zu bringen. Borges verdeutlicht, was er meint, am Beispiel von Cervantes, von dem man sagte, der Stil sei seine „schwache Seite“, sein Werk sei auf die Form hin betrachtet klapperig und reizlos“, bestimmt von „Ungehörigkeiten der Wortwahl“, von „unerträglichen Wiederholungen“, „abgedroschenen Wendungen“, einer „im großen ganzen kraftlosen Struktur“. Daß Prosasprache und Gedichtsprache nicht dasselbe sind, die Rede im Vers anderen Ansprüchen an Prägnanz des einzelnen und Dichte des Ganzen untersteht, bleibt mir dabei wohl bewußt.
Ein unaufgeklärter Rest bleibt: Kritiken zeichnen aus, auch wenn sie tadeln; Verve wird nicht aufgebracht bei Unwichtigem. Weshalb hat denn der Kritiker nicht einfach den verschwiegen, der ihm als Dilettant der Poesie erscheint? Weshalb greift er zum Mittel einer destruierenden Kritik? L. behandelt den W. als wichtigen Mann – wichtig ist er ihm aber als Beispiel der „allgemeinen Verlumperung“. Was immer genau das sein mag – Abscheu ist schon durch die Endung des erfundenen Substantivs konnotiert; sie hat eine Form, als ob das dazugehörige Verb wie „verludern“ geklungen hätte, eine Herkunft, die auch in L.s Pejorativ „Verliederung“ mitspricht.
W. identifiziert sich unbegreiflich naiv mit dem Verabscheuenswerten – sagt L. Vielleicht aber hat er gedacht, W. sei dessen Repräsentant und verführerisch, weil er ein bestimmtes Niveau hält. Ein Autor, der andere – man denke nur an S., H., Sch. und mich – schon dazu brachte, ihm Zustimmung zu geben, ein Psychagoge, der mögliche Dichter (wie Mensching in L.s Augen) in die Unterwelt des Gepfuschten leitet. Ein Autor zumal, der lax sich dazu bekennt, ein „Schlamper“ zu sein, der sich – in einer „unpoetischen Vorbemerkung“ – die „verbesserungswütigen oder Heiliges hütenden Hände“ (S. 7) verbittet, der in der Rolle von Max Hoelz sagen kann: „Auf mich scheißen, schießen, spucken / Kann jeder, ders besser weiß!“ (S. 34), der programmatisch verkündet: „Meine Muse ist ein Schmuddelkind“, sie als eine Dame sieht, die sich fein gemacht hat, immer wieder aber in den Dreck fällt, die – Erato, wenn sie es ist, die ehemals schöne Muse der lyrischen Poesie – er so recht nicht mehr verehren kann: Sie vermag ihre „mißliche Lage“ nicht mehr „spielend“ zu spielen (S. 14). Im Essay heißt das Programm: „extensive Poesie“, ein mögliches „Verständnis vom eigentlich Poetischen“, versehen mit den Kennzeichen der „Plebejisierung“, der Provokation „gegen eine überfeinerte, ästhetisierte Literatur“ (S. 97). War sie es womöglich, die die Gegenprovokation von L. hervorrief?
Darüber, leider, spricht L. in seiner Kritik nicht, die doch eine konzeptionelle Kritik ist: Ihr geht es im Grunde nicht um W., über den sie indigniert hinwegschreitet, ihr geht es um das Schicksal unserer Poesie. „Spiel nicht mit Schmuddelkindern!“ ruft ihr – und uns – mit älterem Mutterwort und neuerer Vaterrede nicht der Text, sicher aber der Untertext der Kritik des Kritikers zu. In seinen Kalkül nimmt er nicht; daß die vielen Schmuddel-Kind-Musenfreunde unter den jüngeren der Dichter ihre Botschaft womöglich gerade in der Form äußern, die vom Überdruß an der Etikette zeugt. Und in seine Rechnung nimmt er auch nicht, daß unter denen, die inzwischen die Szene mit Gedichten beleben, agrammatisch oft, sich um Metren nicht kümmernd, in brüchigen Bildern, dennoch sehr wohl unterschieden ist, wer etwa in wegwerfenden Gesten, apokalyptischen Tönen, coolen Manieren sich versucht oder wer etwa das Lied vom wilden Mohn singt, der stirbt, wenn man ihn sich fangen will. Das, sage ich mir, könnte eine Kritik, die unseren Gemeinsinn fördern will, doch interessieren.
Dieter Schlenstedt, neue deutsche literatur, Heft 404, August 1986
Mit Gedicht und Lied zu Buche gemeldet
– Hans-Eckardt Wenzel las im Theater im Palast. –
„Einzig mein Schweigen ist ohne Makel. Dennoch melde ich mich zu Buche“, schrieb Hans-Eckardt Wenzel im Vorwort seines Lyrikbandes Lied vom wilden Mohn, der im vergangenen Jahr im Mitteldeutschen Verlag erschien. Das Buch ist vergriffen, eine Nachauflage angekündigt, ein weiterer Band in Vorbereitung.
Wenzel, Jahrgang 1955, las kürzlich im Theater im Palast alte und neue Texte. Die Eingangszeilen meint der Autor ohne Koketterie. Er weiß um seine Schwächen, artikuliert sie in seinen Arbeiten, ringt mit ihnen. Dies scheint ein Grundzug seines Schaffens zu sein: Seine Helden sind Aufbegehrende, Suchende. Seine Gedichte und Lieder stehen im Spannungsverhältnis von Ideal und Wirklichkeit. Er mißt die Realität am absolut Erreichbaren, ohne dabei in beckmesserische Nörgelei zu verfallen, denn sein weltanschaulicher Standpunkt ist klar.
Nur manchmal klingen mir seine Arbeiten etwas zu wehmütig und bitter, eine Haltung, die er aber wieder selbst aufhebt. Da, wo Wenzel seinen Witz seine Ironie, seinen Sarkasmus in ein dialektisches Verhältnis Individium — Gesellschaft stellt, kann er sein Credo des weiter verbessern Wollens am überzeugendsten ausdrücken. So in seinem Gedicht „Meine Hände“, das mit den Worten endet „Meine Hände sind die Wurzeln in die ganze Welt“.
Geschichtsbewußtsein und Gegenwartsempfinden mischen sich bei Wenzel auf eine sehr poetische Weise. Vor allem junge Menschen finden bei diesem Autor ihre Gedanken und Hoffnungen wieder. Und die Ungeduld und die Aktivität, die notwendig sind.
Hans-Eckardt Wenzel war über Jahre einer der Protagonisten des Liedertheaters Karls Enkel. Die Gruppe löste sich im Sommer dieses Jahres auf. Jeder für sich will neue Formen des Wirkens und Reifens finden.
Konrad Kraatz, Berliner Zeitung, 17.10.1985
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Torsten Wahl: Distanz zu den Siegern
Mitteldeutsche Zeitung, 30.7.2015
Torsten Wahl: Hans-Eckardt Wenzel hält sich tapfer am Rand
Berliner Zeitung, 31.7.2015
Hans-Eckardt Wenzel – Sänger, Dichter, Weltentdecker
Mitteldeutscher Rundfunk, 30.7.2015
Hans-Dieter Schütt: Hoch die Meerwertsteuer!
neues deutschland, 31.7.2015
Matthias Zwar: Der Clown mit den traurigen Augen
Freie Presse, 31.7.2015
Fakten und Vermutungen zum Autor + Facebook + Interview + IMDb
Porträtgalerie: deutsche FOTOTHEK
Hans-Eckardt Wenzel Soloprogramm 2006 bei den Osterburger Literaturtagen im Hotel Zum Reichskanzler.


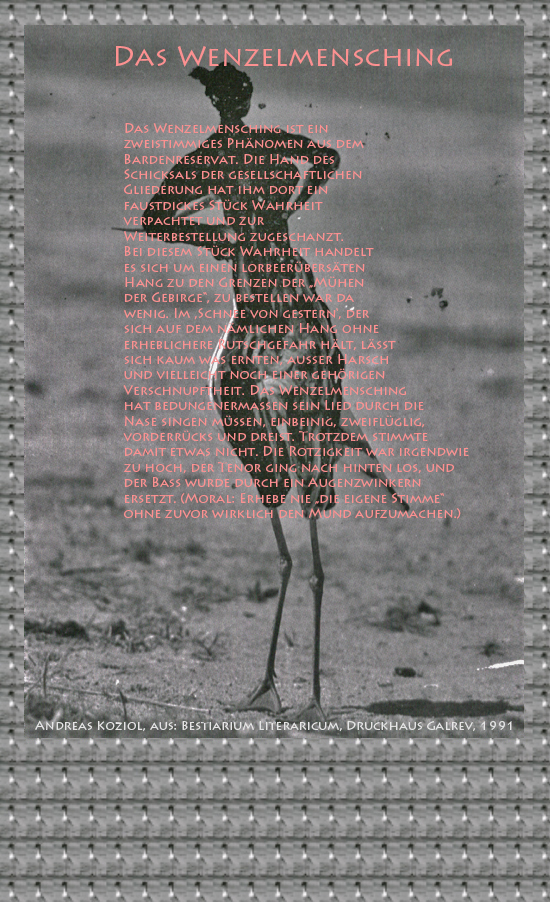













Schreibe einen Kommentar