Immanuel Weißglas: Poesiealbum 334
ER
Wir heben Gräber in die Luft und siedeln
Mit Weib und Kind an dem gebotnen Ort.
Wir schaufeln fleißig, und die andern fiedeln,
Man schafft ein Grab und fährt im Tanzen fort.
ER will, daß über diese Därme dreister
Der Bogen strenge wie sein Antlitz streicht:
Spielt sanft vom Tod, er ist ein deutscher Meister,
Der durch die Lande als ein Nebel schleicht.
Und wenn die Dämmrung blutig quillt am Abend,
Öffn’ ich nachzehrend den verbissnen Mund,
Ein Haus für alle in die Lüfte grabend:
Breit wie der Sarg, schmal wie die Todesstund.
ER spielt im Haus mit Schlangen, dräut und dichtet,
In Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar.
Das Grab in Wolken wird nicht eng gerichtet:
Da weit der Tod ein deutscher Meister war.
Immanuel Weißglas
1920 in Czernowitz, damals rumänische Bukowina, geboren, war er ein Schulfreund Paul Antschels, der später als Paul Celan berühmt geworden ist. Der Jude Weißglas überlebte die rumänischen Lager in der Ukraine, aber die Jahre 1941 bis 1944 prägten sein Leben und Schreiben, wurden zu einer nie mehr zu bewältigenden Last. Dunkle, hermetische, ernste Töne erreichen uns Nachgeborene. Bei erster Kenntnisnahme kann seine Dichtung als altmodisch und provinziell empfunden werden – aber wie Weißglas traditionelle Strophen mit äußerst befremdender deutsch-jüdischer Erfahrung kontrastiert, ist bewegend.
Ankündigung in B.K. Tragelehn: Poesiealbum 333, MärkischerVerlag Wilhelmshorst, 2017
Stimmen zum Autor
Wenn die Seele dieses Sängers weit die Flügel ausbreitet und durch die jetzt beängstigend stillen Lande fliegt: dann ist diese Stille die des Grauens und einer untröstlichen Verlassenheit, und nach Haus findet sie nirgends mehr.
Heinrich Detering
Sein Verfahren spiegelt das sich in der Historie ständig wiederholende Moment von Assimilation und Vertreibung der Juden, denn jeder Vertreibung folgt ein neuer Versuch von Aufbau und Integration, der aber immer wieder scheitert.
Hartmut Merkt
Immanuel Weißglas, der das Selbsterfahrene in den Todesstätten in ein archetypisches Konfliktmodell von Seinsmächten verwandelt, in seinen kunstvoll komponierten Gebilden das Historische mythisiert und den Mythos historisiert.
Peter Motzan
Weißglas hat mit dem Leben und Sterben abgeschlossen, seine Lyrik ist das heroische Bemühen um eine Sinnfindung und -gebung des Todes.
Bernd Kolf
Er sah in der Dichtung die einzige innere Herberge, den ontologischen Schutz vor den brutalen Schicksalsschlägen.
Peter Rychlo
Die „Todesfuge“ stellt eine Antwort auf Weißglas’ „Er“ dar, dessen Existenz Celan kannte. Er ordnet seine Bestandteile neu an, ohne zusätzliche hinzuzufügen: es sind dieselben Elemente, aus denen er aber etwas ganz anderes macht.
Jean Bollack
Weißglas stellte die eigene Lebenserfahrung, die Tragik seiner persönlichen Lebensumstände mit objektivierter Kühle und denkerischer Strenge in den weiteren Rahmen der Zeitgeschichte, die er ins Überzeitlich-Mysthische erhob.
Alfred Kittner
Poesiealbum 334
Immanuel Weißglas hat in Czernowitz mit dem später berühmten Paul Celan nicht nur die Schulbank gedrückt, er war lebenslang mit ihm befreundet; Harald Kittner nannte sie Orest und Pylades. Als Celan für sein berühmtestes Gedicht, die „Todesfuge“, des Plagiats bezichtigt wird, wandte sich Weißglas strikt gegen das „schakalartige Schnüffeln… mit dem unlauteren Ziel, eine dichterische Erscheinung von hölderlinscher Prägung in Frage zu stellen.“ Deshalb hatte er 1947 sein eigenes Gedicht „Er“ nobel und still zurückgestellt und es erst 1970 veröffentlicht. Es wird Zeit, diesen ernsten, hermetischen, im Altmodischen die Moderne hervorkehrenden Dichter wahrzunehmen.
MärkischerVerlag Wilhelmshorst, Klappentext, 2017
Wo die Galgen grünen
Im Versuch, den Tod zu beschreiben, vollendet sich noch jedes Dichters Lebendigkeit, nämlich: sein unweigerliches Scheitern. Der Tod ist das große erste letzte Geheimnis. Unser Vermögen, die Transzendenz zu denken, unsere Gabe, das Unerfassliche fantasierend zu übersteigen – es befreit, und gleichzeitig verstrickt es uns nur umso tiefer ins Gefühl des Ausgesetztseins, ins Erschrecken über das zufällig Hingeworfene unserer Existenz. Kein wirkliches Ergründen ihrer selbst ist uns gegönnt. Im Augenblick eines fremden Todes ganz in unserer Nähe wird der Sinn, dem wir unserem Leben bis dahin gaben, sehr nichtig, aber dann begreifen wir die Paradoxie: dass dieser mühsam erarbeitete Sinn in jenem Augenblick der rüttelnden Trauer seine wichtigste Bewährungsprobe hatte. Denn der Sinn oder wenigstens die Sehnsucht nach Sinn, unsere Abhängigkeit von Sinn – das arbeitet in uns wie ein Motor wider das Tierische; und jetzt, nach dem Tod eines nahen Menschen, beginnt: die Feier unseres eigenen Überlebens. Ja, im Prinzip ist alles sehr einfach: Jemand stirbt, wir leben noch, wir sind diesmal verschont geblieben. Das ist jenseits und hinter aller Trauer ein Triumph, der uns beschämt. Aber doch auch rettet. Das vor allem. Vorläufig.
Und unbesiegt, seht her, doch ohne Sieg
Ging ich im Niemandsland des Lieds verloren.
In der Auswahl, die Kathrin Schmidt aus Gedichten des Czernowitzer Schriftstellers Immanuel Weißglas getroffen hat, ist der Tod der alles bedrängende Stoff. In eines Lebens Unterwegs, „wo Galgen grünten, Gräber blühten“. Tod im Moor, im fremden Land, am Flusse Bug, umrankt von Luzerne – Trauergeist eines Dichters aus der Bukowina, lebenslanger Freund von Paul Celan, und wie dieser ist Weißglas tief getroffen von der Reinigungsgier des 20. Jahrhunderts; Reinigung, die meist nur ein einziges Mittel benutzte: Blut. Celans „Todesfuge“ aufgreifend, schreibt Weißglas:
Wir schaufeln fleißig, und die andern fiedeln,
Man schafft ein Grab und fährt im Tanzen fort.
Ab 1945 lebte Weißglas in Bukarest, als Pianist, Redakteur und Archivar: Seine Verse besingen Himmelfahrt und deutsche Dome, Brunnen, Münzen und das „Gleichnis Gras“, sie lesen sich wie eine Wegbeschreibung entlang des Abgrundes, der zwischen dem Traum vom gelungenen Dasein und der grauen Wahrheit des Lebens liegt. Was Weißglas (1920–1979) beschreibt, ist Leiden, aber in alldem blieb er, ja: ein gütiger, sanfter Mensch. Diese Gedichte sind im Zustand dunkel, sofern sie von keinem Ziel mehr wissen, und sehr hell, sofern der Dichter vor seiner eigenen Klarsicht nicht ausweicht. So bitterwahr sein Gedicht mit dem Titel „Wegesschlaf“: Abschied, Not der Flucht, Härte der Vertreibung unterm Mondlicht.
Ich sollte, sagt mir das Gestirn,
mein Kind im Schlummer nicht verwirrn.
Und will es auf die Augen küssen
wir werden beide wandern müssen.
Hans-Dieter Schütt, neues deutschland, 25.6.2018
Gedichte zum Preis von einem Brot
– Die legendäre Heftreihe Poesiealbum wird 50. –
Lyrik ist der Spiegel einer Epoche. Aus einem individuellen Blickwinkel heraus, aber – besonders in Zeiten des Umbruchs oder der Krise – immer auch mit einem Blick auf die Gesellschaft. Der Czernowitzer Dichter Immanuel Weissglas hat so einen Blick. 1920 als Kind einer deutsch-jüdischen Familie in der Ukraine geboren, überlebte er in den 1940er-Jahren die rumänischen Lager in der Ukraine. Das aktuelle Poesiealbum 333 aus dem Märkischen Verlag des Peter-Huchel-Hauses in Wilhelmshorst spricht von diesen Erlebnissen. Von Verfolgung und Krieg, von Gräbern und vom Tod. Herausgegeben hat es die Buchpreisträgerin Kathrin Schmidt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Reihe Poesiealbum stellt sie es heute im Peter-Huchel-Haus vor.
Seit 50 Jahren erscheint das Poesiealbum. Das erste kam am 7. Oktober 1967 heraus und enthielt Gedichte von Bertolt Brecht. Damals kostete ein Heft 90 Pfennig – so viel wie ein Brot. Bis 1990 erschien im Verlag Neues Leben Berlin jeden Monat ein Heft. Seit 2007 wird die Lyrikreihe vom MärkischenVerlag Wilhelmshorst fortgesetzt, verlegt von Klaus-Peter Anders. Das nächste Heft ist bereits geplant: mit Texten von Adolf Glaßbrenner, dem deutschen Humoristen und Satiriker. Diesem Zeitgenossen von Theodor Fontane wird unter anderem ein böser Leserbrief als Reaktion auf eine Theaterkritik Fontanes zugeordnet, in dem er das Kürzel „Th. F.“ des Autors als „Theaterfremdling“ umdeutet. 2013 wurde der Potsdamer Lyrikerin Christiane Schulz ein Heft gewidmet. Erschienen sind auch immer wieder Ausgaben unbequemer deutscher Dichter wie Sarah Kirsch, Reiner Kunze oder Günter Kunert sowie Außenseitern wie Uwe Gressmann.
Auch der 1979 verstorbene Immanuel Weissglas gehört eher zu den Außenseitern – oder zumindest zu den Unbekannteren. Zu Unrecht. Denn seine Gedichte sind von grausam poetischer Schönheit. Er schreibt in einer sehr bildhaften Sprache und doch auf den Punkt genau. Strophen wie „Über Nacht kam Wanderzeit / regnerisch, mit Wind und Wolke / damals war ich eingeweiht / und ich zog mit meinem Volke“ aus dem Gedicht „Nachtzeit“ erschließen sich dem Leser sofort. Weissglas, der dank seiner gut situierten Familie eine gute Ausbildung genoss, übersetzte bereits als Schüler fremdsprachige Literatur. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurden er und seine Familie von Lager zu Lager geschoben – ein Einschnitt, der im Gedicht deutlich wird. Vor allem durch den Rhythmus seiner Sprache fällt es schwer, sich seinen Worten zu entziehen. Im Gegensatz zu seinem lebenslangen Freund Paul Celan schreibt er seine Gedichte in Reimform. Eine Form, die sich schnell einprägt und im Metrum oft an einen Marschschritt erinnert. Sein Gedicht „Er“ gilt als so etwas wie eine Vorlage für Celans berühmte „Todesfuge“. In beiden Texten wird ein Mann erwähnt, der mit Schlangen spielt – und auch die Gegenüberstellung von Menschen, die parallel Gräber schaufeln und zum Tanz aufspielen sollen, findet sich in beiden Gedichten. Zwei individuelle Spiegel der Zeit – und doch ein gemeinsamer Blick auf die Ereignisse.
Sarah Kugler, Potsdamer Neueste Nachrichten, 14.12.2017
Weissglas, von Kittner erzählt
So oft ich mich an Immanuel Weissglas erinnere, habe ich Alfred Kittner vor Augen.
Ich lernte Kittner eigentlich erst Anfang 1971 kennen. Ganz stimmt das nicht, denn ich hatte ihn während meiner Bukarester Studentenzeit in den fünfziger Jahren als Direktor der Bibliothek des Instituts für kulturelle Beziehungen mit dem Ausland erlebt. Ich las gern in dem angenehmen Saal (mit dem Blick auf einen alten kleinen Park) in einer schmucken Villa am Dacia-Boulevard; aber ich wusste damals kaum, wer dieser deutschsprechende Herr mit dem lebhaften Blick war. Auch hatten wir uns später nicht wiedergesehen. Nun hatte ich 1970 eine kleine deutsche Abteilung im Albatros Verlag Bukarest übernommen, eine neue Aufgabe, die zu meiner schon beinahe fünfzehnjährigen Tätigkeit als Lektor für rumänische Bücher hinzukam. Kittner rief mich im Verlag an und schlug ein Treffen vor zu einem „Frühstückskaffee“ und einem Gespräch über rumäniendeutsche Literatur. Das Gespräch zu jenem sonnigen Februarvormittag 1971 im Restaurant des Hotels Ambasador wurde bald zu einem herzlichen Gedankenaustausch; wir hatten eine gemeinsame verlorene Heimat, die Stadt Czernowitz, jene „Gegend“, in der einst, – so das bereits zu oft verwendete Celan-Zitat „Menschen und Bücher lebten“ – und das galt uns beiden viel. Kittner (schon seit 1958 freischaffend) sollte mein väterlicher Freund und Berater werden. Auch hat er mir meine Vaterstadt (die ich 13jährig verlassen hatte) auf eine bezaubernde Weise „zurückerzählt“ in überaus lebendigen, stimmungsvollen Bildern; er war ein Meistererzähler, ein wunderbarer Plauderer, ein auf eine intelligente, humorvolle und vielseitige Art mitteilsamer Mensch. Und zu dieser Stadt gehörte auch Weissglas.
Kittner machte uns noch im selben Jahr bekannt. Aber erst 1973 erschien im Albatros Verlag Weissglas’ deutsche Übersetzung von Vasile Alecsandris historischem Versdrama Fürst Despot, dann 1974 seine sehr bedeutende Nachdichtung der Letzten ersonnenen Sonnette Shakespeares in der erdachten Übersetzung von Vasile Voiculescu (als zweisprachige Ausgabe in der Reihe „Die schönsten Gedichte“).
Was weiß ich von dem Menschen, dem Lyriker, dem Übersetzer Immanuel Weissglas? Vorwiegend das, was Kittner mir von ihm erzählte. Denn Weissglas selbst sprach kaum jemals über sein Schreiben und so gut wie nie über seine eigene Person. Ich habe ihn als (zumindest mir gegenüber) zumeist Schweigsamen in Erinnerung. Ich sehe ihn, während ich diesen Text schreibe, sehr klar vor mir – seine großen ausdrucksvollen Augen, seinen nachdenklichen Blick; seine Schweigsamkeit habe ich nie als schroff und abweisend empfunden. Man gewann den Eindruck, dass er auf ganz eigene Weise mit seinen wenigen Worten eine Kommunikation herzustellen vermochte, ein Verstehen von Mensch zu Mensch, eine Brücke zwischen Autor und Lektor. So war es zum Beispiel, als ich – mehr als beeindruckt von seiner Voiculescu-Übertragung („Umdichtung“ nannte er sie) – ihn anrief und er anschließend bei mir im Verlag vorbeischaute (wir arbeiteten im selben Gebäude, damals Casa Scânteii genannt, heute Casa Presei, das „Haus der Presse“). Er saß mir gegenüber an meinem Arbeitstisch in der Redaktion; ich lobte seine Texte, die Worte kamen mir vom Herzen, nannte einzelne Sonette, die mir in der deutschen Fassung besonders gefallen hatten; er lächelte ein wenig und sagte schließlich, dass er „lange an dieser Arbeit gefeilt“ hätte. Nichts mehr. Aber es war ein Gleichklang zwischen uns in diesem kurzen Gespräch – und er sollte bestehen bleiben, als wir uns, einige Zeit später, zu zweit über das Erscheinen des zierlichen Büchleins in seinem lilafarbenen Einband freuen konnten.
Das beharrliche Wieder- und Wiederbearbeiten seiner Gedichte und Übersetzungen hatte Kittner oft erwähnt. Er schrieb darüber auch in seinem ergreifenden Nachruf „Abschied von Immanuel Weissglas“ (Neue Literatur Nr. 7/1979):
[…] die an sich selbst gestellten hohen Anforderungen hinderten ihn stets daran, ein Gedicht, das er immer wieder hervorholte, um an ihm zu feilen, es bis zum äußersten zu raffen, als restlos vollendet, schlackenlos und der Veröffentlichung würdig anzuerkennen.
Es nahm mich nicht wunder, dass Kittner gern über Weissglas sprach. Beider Schicksal war von den gemeinsam durchlittenen Jahren der Transnistrien-Deportation geprägt; beide hatten (wie im Nachruf festgehalten) unter „unmenschlichen Bedingungen“, „von Lager zu Lager gehetzt“ nicht aufgehört, Gedichte zu schreiben. Es war eine Zeit, die Kittners Verbundenheit mit dem um vieles jüngeren festigte. Obwohl vom Temperament her grundverschieden, war er Weissglas’ Vertrauter geworden. Er verstand es, einzelne Episoden aus Weissglas’ Biographie herauszugreifen, um den Werdegang des Freundes hervorzuheben und seine Persönlichkeit zu beleuchten. Er erzählte mir (aus seiner eigenen – aber auch aus Weissglas’ Sicht) von dessen Czernowitzer Jugendfreundschaft mit seinem gleichaltrigen Klassenkollegen Paul Antschel (dem späteren Paul Celan); „sie lasen um die gleiche Zeit die gleichen Bücher“, schreibt Amy Colin im bio-bibliographischen Teil der Anthologie Versunkene Dichtung der Bukowina und übten sich in einer Art von „lyrischem Wettstreit“, wie Kittner es ausdrückte. Ich weiß es noch genau: Kittner betonte (nicht nur ein Mal) dass Weissglas sich von Anfang an und auch in späteren Jahren, als sein Jugendkamerad berühmt geworden war, diesem durchaus ebenbürtig fühlte. Krieg und Deportation hatten sie auseinander gerissen. In Bukarest 1945 und 1946 sahen sie sich (soweit bekannt) nur selten wieder; 1947 plante Paul seinen (illegalen) Grenzübertritt und verließ die Stadt (so wusste es Kittner) ohne von den meisten seiner Freunde Abschied zu nehmen. Hat Weissglas es ihm nachgetragen? War er enttäuscht, dass Celan weder von Wien aus, noch von Paris (dem Ort seiner endgültigen Bleibe) die Beziehung zu ihm so gut wie gar nicht wieder aufnahm? Er behielt all das für sich. Aber Kittner vertrat die Meinung, dass sein Freund Immanuel das „Problem Celan“ nie ganz aus seinem Sinn verbannt hatte.
Und nun zurück zu einer älteren Erinnerung. Im Sommer 1971 kam Kittner mit Weissglas zusammen an einem Wochenende ans Meer und beide besuchten mich in Mangalia. In einem Sanatorium, wo ich im Spätherbst 1970 von einem schmerzhaften Bandscheibenschaden glänzend geheilt worden war, machte ich eine Kur (vor allem Heilgymnastik) zum Erhalten der wieder gewonnenen Mobilität.
Ich kannte Weissglas damals nur von zwei oder drei gemeinsamen Abenden im Capşa-Restaurant, die auch Dieter Roth in seinem Erinnerungstext erwähnt. Kittner war dabei, Dieter Roth mit seiner Frau Lotte, gelegentlich auch Dieter Paul Fuhrmann. James Immanuel saß mit uns am Tisch, nippte an seinem Glas Wein und meldete sich selten zum Wort (allerdings waren seine Bemerkungen dann immer treffend).
Doch sollte ich an jenem Nachmittag und anbrechenden Abend in Mangalia, als wir zu dritt einen längeren Spaziergang am Meeresufer machten, einen verwandelten Weissglas erleben. War es seine Liebe zum Meer? Kittners sonst so wortkarger Freund zeigte sich heiter, aufgeschlossen und gesprächsfreudig. Bald 39 Jahre sind seither vergangen – und selbstredend kann ich mich an manches nicht mehr erinnern, worüber während dieser sommerlichen Begegnung gesprochen wurde. Ich weiß nur, dass Weissglas diesmal (dieses einzige Mal!) die Unterhaltung leitete. Kittner war zum Zuhörer geworden und ich sah ihm an, wie erfreut er über das Gelingen dieses Treffens war, womit er mir tatsächlich ein Geschenk machte. Doch eines der von Weissglas angeschlagenen Themen ist mir noch heute gegenwärtig: sein intensives Interesse für das Werk Adalbert Stifters.
Im Vorjahr (1970) war in seiner rumänischen Übersetzung ein umfangreicher Band repräsentativer Erzählungen Stifters im Verlag für Weltliteratur (später Univers) erschienen; die Auswahl hatte wohl er selbst getroffen. Wie auch im Falle seiner Faust-Übertragung (Faust I, 1957; Faust II, 1958) zeichnete er mit dem Pseudonym Ion Jordan. Weissglas sprach von seiner besonderen Freude an dieser (zweifelsohne schwierigen) Arbeit. Das besinnlich-harmonische Weltbild, zu dem sich der österreichische Meisternovellist trotz schwerer persönlicher Erfahrungen durchgerungen hatte, entsprach seiner tiefinnersten Struktur. Schon damals trug er sich mit dem Gedanken, ein Hauptwerk Stifters, seinen Bildungsroman Der Nachsommer, zu übersetzen. Dass diese Übersetzung auch tatsächlich zustande kam ist in Kittners bereits erwähnten Nachruf belegt:
Mit letzter Kraft hatte er noch vermocht, die Übersetzung von Adalbert Stifters Nachsommer, ein Buch, das er seit langem ausnehmend schätzte und dessen Verpflanzung in die rumänische Sprache ihm sehr am Herzen lag, zu Ende zu führen und dem Verlag zu übergeben (Logischerweise handelt es sich um den Univers-Verlag, mit dem Weissglas gut zusammengearbeitet hatte – auch seine Übersetzung von Feuchtwangers Erfolg war 1964 dort erschienen). Und nun ergibt sich die Frage: Warum ist diese Übersetzung nie erschienen? In welcher (in wessen) Redaktionsschublade ist sie versunken?
1984 (5 Jahre nach Weissglas’ Tod 1979) erschien hingegen im Univers-Verlag eine andere rumänische Übertragung des Nachsommers unter dem (nicht sehr glücklich gewählten) Titel Toamna (Der Herbst), was ein wenig befremdet, gibt es doch im Rumänischen den Begriff „Vară tărzie“ („Spätsommer“). Wie dem auch sei: für die Übersetzung zeichnete H.R. Radian, ein vielseitig kultivierter, hochgeschätzter Mitarbeiter des Verlags. Ich kenne seine rumänische Fassung nicht, aber ich kannte den 1992 verstorbenen H.R. Radian persönlich und halte es für so gut wie ausgeschlossen, dass er von einer bereits in der Redaktion existierenden Übersetzung gewusst hätte. Was also ist geschehen? Das Rätsel bleibt ungelöst.
Dass Weissglas’ Text nicht in die Hände der rumänischen Leser kam, sollte Kittner nicht mehr erfahren. 1980 war er von einem Lyrikertreffen in der Bundesrepublik nicht mehr nach Rumänien zurückgekehrt und hatte sich in Düsseldorf niedergelassen. 1990 schrieb er in einem „Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur“ (von Amy Colin als „Nachwort“ in der a.a.O. erwähnten Anthologie Versunkene Dichtung der Bukowina reproduziert):
[…] Im Unterschied zu den Dichtern Siebenbürgens und des Banats kamen die wenigen Dichter der Bukowina bereits als Entwurzelte, als Überlebende des Holocaust in die rumänische Metropole. Ob sie nun glaubten, einem Staat, den sie anfangs törichterweise für ihren Befreier hielten, mit ihrem Schaffen dienen zu müssen, oder ob es ihnen gelang, sich vor dem Zwang eines diktatorischen Anspruchs zu drücken und ihre geistige Freiheit zu bewahren, sie schrieben selbst unter den drückendsten, gefahrvollsten Umständen weiter und trugen durch ihre Übersetzertätigkeit dazu bei, der rumänischen Dichtung außerhalb des Landes Gehör zu verschaffen, wie auch die deutsche Dichtung dem rumänischen Leser zu erschließen. Es sei bloß an Immanuel Weissglas’ Übertragung beider Teile von Goethes Faust und von Stifters Nachsommer ins Rumänische […] erinnert.
***
Als Postskriptum zu diesem Versuch einer fragmentarischen Porträtskizze will ich von einem Eindruck erzählen, den ich im vergangenen Jahr während eines kurzen Aufenthalts in Czernowitz gewann. Ende Oktober 2009 sah ich meine (seit 1944 zur Ukraine gehörende) Heimatstadt nach über sechs Jahrzehnten wieder. Sie war im Vorjahr 2008 600 Jahre alt geworden. Zu diesem Jubiläum kam im Verlag des Rumänischen Kulturinstituts ein Bildband heraus, den mir Freunde zum Geschenk machten. Ich betrachtete die darin enthaltenen Photos lange und entschloß mich zu einem Ausflug mit Reisepaß. Was war aus „unserem Czernowitz“, von dem mir Kittner so oft – und Weissglas nie – erzählte, geworden?
Mir wurde die besondere Chance eines exquisiten Begleiters am Anfang meiner Rundfahrt zur Wiederentdeckung der Stadt zuteil: Dr. Peter Rychlo vom Lehrstuhl für Weltliteratur der Czernowitzer Jurij Fedkowicz-Universität, den ich als gediegenen Celan-Spezialisten während eines Celan-Symposions im September in Bukarest kennengelernt hatte. Professor Rychlo widmete mir einen Nachmittag und war ein mit viel historischem Wissen beschlagener Führer durch alte Haupt- und Nebenstraßen, auf den hell erleuchteten Theaterplatz mit dem überdimensionalen Standbild der ukrainischen Schriftstellerin Olga Kobiljanska und zu der romantischen Statue Eminescus in einer schmalen ovalen Parkanlage. Es konnte mir nicht entgehen, dass zahlreiche Gedenktafeln die geschichtlichen Traditionen der Stadt hervorhoben und an Persönlichkeiten verschiedener Nationalitäten erinnerten, die in Czernowitz gelebt und gewirkt hatten. Am Abschluß unseres Rundgangs legte mir Dr. Rychlo ans Herz, das kleine, aber gut ausgestattete jüdische Museum in der unmittelbaren Nähe des Theaters (im Gebäude des ehemaligen Jüdischen Nationalhauses, 1908 erbaut, heute Kulturhaus und Offizierskasino) zu besuchen. Am nächsten Vormittag befolgte ich seinen Rat.
In einem umfangreichen Saal mit einfallsreicher Einteilung empfing mich eine junge Angestellte sehr herzlich und geleitete mich zu den verschiedenen Themenkreisen des Museums; es war beeindruckend, dass eine vielleicht nicht einmal (oder kaum) dreißigjährige christliche Ukrainerin so vielseitig informiert war über die jüdischen Gebräuche und Überlieferungen der Bukowina und des Kreises Czernowitz insbesondere. Zuletzt legte sie mir ein paar Bücher auf einen Tisch: ich durfte sie eingehend durchblättern.
So entdeckte ich Die versunkene Harfe – die von Dr. Peter Rychlo betreute deutsch-ukrainische Anthologie der vielleicht zu oft als „versunken“ bezeichneten deutschsprachigen Lyrik der Bukowina; Dr. Rychlo wollte mich offensichtlich (auf seine diskrete Art) mit diesem Werk überraschen. Nun komme ich zum eigentlichen Sinn meines Postskriptums.
Kittner und Weissglas waren selbstredend in der Harfe vertreten und auch übertragen. 30 Jahre nach Weissglas’ Tod (1979), 19 nach dem Hinscheiden Kittners (1991) hatte ich dieses Buch vor Augen: es zeugte davon, dass ihre Namen und Gedichte im ukrainischen Czernowitz nicht ausgelöscht, nicht vergessen waren. Obwohl ich die Anthologie nicht erstehen und mitnehmen konnte, wie ich’s gern getan hätte (das Museum bot keine Bücher zum Verkauf an) überkam mich ein gutes, ein freudiges Gefühl. Es blieb bestehen, als ich noch am selben Tag und dann am nächsten – diesmal auf eigene Faust – meine Spaziergänge durch die Stadt fortsetzte, manches wiederfand, auch mir nicht bekanntes auf mich zukommen ließ. Allmählich stellten sich Erinnerungen ein an Stimmungen und Erlebnisse meiner von der Kriegszeit überschatteten, aber doch behüteten Kindheit (meine Eltern und ich gehörten zu den Familien, die in Czernowitz verbleiben durften). Auf keinem dieser Streifzüge in die Vergangenheit fühlte ich mich allein. Mag es auch noch so sentimental klingen – ich erzähle es trotzdem als Ausklang meiner Erinnerungen: Kittner und Weissglas waren meine imaginären Weggefährten. Sie begleiteten mich als gute Geister nicht nur durch das alte, sondern auch durch das heutige Czernowitz.
Herta Spuhn, März–April 2010, aus Andrei Corbea-Hoisie, Grigore Marcu, Joachim Jordan (Hrsg.): Immanuel Weißglas (1920–1979). Studien zum Leben und Werk, Editure Universității „Alexandru Ioan Cuza“ und Hartung-Gorre Verlag, 2010
Tod als Formsache
– Zu Immanuel Weißglas. –
Daß Kultur bis heute mißlang, ist keine Rechtfertigung dafür, ihr Mißlingen zu befördern…
Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben
I
Zu den Vergessenen oder jedenfalls Marginalisierten des 20. Jahrhunderts zählt Immanuel Weißglas – jener Dichter, der in seiner Jugend Freund und im poetischen Wettstreit Konkurrent Paul Celans war, diesem damals allem Anschein nach von manchem und auch von Celan als ebenbürtig empfunden, mag sich auch schließlich die Rezeption auf einen „schmerzlichen Niveauunterschied“ geeinigt haben. Selbst wenn es sich so einfach bilanzieren ließe, dennoch ist Weißglas ein Poet, der eine breite Leserschaft verdiente und zu Unrecht bedroht ist, einst Fußnote zu sein.
Weißglas hat in seinem Werk immer wieder das Thema des Todes berührt, es ist ein „Curriculum mortis“; der Tod ist Formsache, was sich sehr ambivalent verstehen läßt und in dieser Ambivalenz Impetus dieser Lyrik ist, das, was sie als Negativum abstößt, aber auch die Hoffnung auf die Form. Negativ ist der Tod nur Formsache, Formalität, so, wie es von den Nationalsozialisten formuliert ist:
wenn der blockschreiber irrtümlicherweise eine nummer mit dem
vermerk verstorben versieht, kann solch ein fehler später einfach
durch die exekution des nummernträgers korrigiert werden
Heimrath Bäcker: „Nachschrift 2“
Diese Formalität mag der Abgrund der klassisch-unaufgeregten Form sein, die doch in aller Lyrik gegeben ist, die ja nur virtuell unschön werden kann, immer aber doch allzu schön ist. Sie kann es nicht nicht sein, befragen kann sie dies aber, und sie muß es, wo es um die sogenannten letzten Dinge geht.
Da wird die informierte Materie, die den Gehalt generiert – er sogar ist –, über sich getrieben, wird die Formsache ganz der Form inne, indem sie diese transzendiert. Das ist ein Thema in der Krise, die die Bukowiner Lyriker erleben, freilich: nicht ein Thema exklusiv dieser Krise. Aufgelöst und überschritten wird dabei die strikte Form des Textes wie des Sujets desselben, so in der „ALKÄISCHE(n) STROPHE“ Benjamin Fuchs’, der unter diesem Titel vom Vergessen schreibt – „stäubender Aschenrest, / klingt euer Name wenigen Wissenden“. Celan dichtet im konventionellen Reim, um ihn indes zu befragen – berühmt ja sein Vers:
Und duldest du Mutter, wie einst, ach, daheim,
den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?
Man hat zum einen die Asche, worin die Vernichtung thematisiert wird, aber zugleich das Stoffliche der Information diffundiert, und zum anderen den Vers, der seine genuine Form aktualisiert und dekonstruiert.
II
Beide Optionen sind bei Weißglas verzahnt, wie hier kurz gezeigt und bedacht sei, auch, um zu zeigen, daß die Antithese, die die Germanistik verschiedentlich formulierte, ein Werk sei entweder in bezug auf die Tradition – die Formsache allgemeiner – durch „ein dialektisches Verhalten“ geprägt, wofür Celans Werk stünde, oder wie bei Weißglas um eine möglichst ungebrochene Fortführung bemüht“, falsch ist. Das Wörtchen möglichst indiziert es, Weißglas’ Werk weiß, daß es als Förmlichkeit die Form verriete.
Asche und eine Form, die an sich zweifelt, prägen ein Gedicht Weißglas’, das seine Form und jene des Gegenstands – „Dürerhände“, durch die hindurch eros und thanatos sprechen – bedenkt:
Ein letztes Ineinanderfluten,
Die Liebe kam, die Liebe schied,
Schon wird das Abschiedsweh der Gluten
Zu Asche, und die Asche Lied.
Die Form trägt hier, insofern sie das Melancholische in Gleichform überführt, also so, wie sie ist, ihre und jede Hilflosigkeit formuliert, die vor dem Zerstäuben des Geliebten besteht, eine Hilflosigkeit, die begründet und antizipiert, was der Klage widerfahre, welche letzte Spur des Verlorenen gewesen sein wird. Die Beunruhigung hat im Futurum exactum ihre grammatische Form.
Ein Anagramm birgt in einem anderen Gedicht leise das Erinnern – fast möchte man meinen, die Diskretion solle die Form unsichtbar machen, auf daß sie wie bei Fuchs doch wenigen Wissenden desto gewisser erhalten bleibe…:
Wer lebte hier? Wer litt? Wer wird nach Jahren
Den Namen und die Herkunft treu bewahren?
Die eins gewesen, sind hier nicht geschieden,
Die ein Leid litten, ruhn in einem Frieden.
Und unser Sarg ist, Tod, dein Himmelsmaß:
Dies ganze weite Feld voll Wind und Gras.
Der fünfhebige Jambus und der Paarraum trügen über die Subtilitäten des Textes gleichermaßen – zum einen darüber, daß qua Anagramm das Gras Sarg bleibt, nicht bloß der Epitaph verloren ist; und zum anderen über eine Klimax, die metrisch markiert ist, denn die vierte Zeile setzt durchs Alternieren zwar einen Iktus auf den unbestimmten Artikel, der auch wichtig ist, schließlich korrespondieren ein Leid und ein Friede – will man aber das Leid, das mit litten sogleich assonierend variiert ist, unbetont lesen? Erst hernach, in der Versöhnung, die das Grab sein soll, setzt der Fluß, wobei Versfuß und Wortgrenze noch einen Moment zu einander in Spannung stehen, wieder ein, samt Katalexe:
Χξ | ξξ | Χξ | Χξ | ΧξΧ
Die Katalexe ist dabei die Kontinuität, die schließlich durch das Vertrauen in das Gras diesen Text mit männlicher Kadenz zu schließen gestattet. Die Last dabei, und auch die Anmaßung, bleibe fühlbar, sind integraler Teil der intentio operis, die ihr Vermögen nicht leichtfertig voraussetzt, sondern weiß:
Im Namen dessen, der verschieden,
Ruf ich den Tod gewaltig aus.
Das sind zwei Zeilen, die vor Polyvalenz bersten, und bersten sollen und mögen. Denn der Verschiedene ist, indem er verschied, auch nicht mehr einer, der in einer Horizontverschmelzung in seinem Namen zu sprechen ermöglichte, er ist auch in diesem Sinne verschieden. Ist aber das „SELBANDERE“ so fraglich, ist das Wort gewaltig Bild der hybriden Derbheit, die der Akt beinhaltet, mag er sich auch als Liebe verstehen, und dies schließlich sein: „Indem sie sie […] zu Einem zusammenführt, vernichtet die Liebe die anderen Dinge“, „φνεἰρει τά ἄλλα“.
Der, in dessen Name das lyrische Ich die Stimme erhebt, schaut dieses an, ohne zu antworten, „(d)er Tod ist schlafgewordnes Schauen“, in der Radikalität dieses Schlafs ein Anspruch, weil man ihm nicht dialogisch zu antworten vermag…
III
Das „Letzte, Spielendschwere“ der Form ist also in dieser Lyrik bloß dem genauen Blick überantwortet, es zu leugnen, seine Zuspitzung, seine bestürzende Qualität, das wäre Unrecht. Vielmehr ist das, was traditionell scheint, „von aufstörenden Wendungen durchzogen[en]“, eine Formel, die für die gleichfalls als traditionell mißverstandenen Gedichte der frühen Rose Ausländer ein glänzender Exeget der Lyrik der Bukowina fand. Heimat als unproblematisches Sein ist hier keineswegs, die Tradition selbst befiehlt:
Es hieß: Genug! Und es hieß: Zieh!
Expatriiert durch die Tradition ist gerade Weißglas ein subtiler Dialektiker der Form, einer, der selbst dann, wenn er Heimat meint, sie als geglückte doch nicht denken will und kann, der aber gerade durch die Form, die er wahrt, auch nicht einem Jargon des Eigentlichen verfällt, wenn er dies in einer Zueignung an David Goldfeld schreibt:
Du hast so gut wie ich verstanden,
Dass wir im Tod den Himmel sehn.
Es ist ein Warten, „eh […] der Tod aufatmen lässt“; noch deutlicher, noch abgründiger aber vielleicht auch schreibt Weißglas ferner:
Kehr ein, Johanneswandrer,
Beim Tod ziemt Toten Rast.
So wirtlich ist kein andrer
Und so erschöpft kein Gast.
Dieser Gedanke ist zunächst Zuspitzung der in der jüdisch-christlichen Religionstradition bekannten Idee, es sei „dies […] aller Gastfreundschaft tiefster Sinn: Daß ein Mensch dem andern Rast gebe auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhaus.“
Im Anerkennen dessen, was noch kein Sich-Abfinden meint, und im Dialog mit dem Toten, einem Dialog indes, der weiß, daß er längst Monolog ist – oder ahnender Hemi-Dialog –, gerade also durch die so verdächtige Form träumt das Gedicht davon, das überhelle Strahlen der Wahrheit in sich noch einmal, vielleicht auch: erstmals geschehen zu lassen. Es ist ein Durchgang durch Zweifel und Verzweiflung an der Form. Dies erschließt der Glaube, Terry Eagleton schreibt es vom für ihn hierfür paradigmatischen Protestantismus, der Skepsis erst gestatte, bis zur Krise mit ihren Chancen:
Das protestantische Ich findet keine Heimat mehr in der Welt.
Die Bande zwischen beiden haben sich aufgelöst. […] Deshalb bewegt
sich das protestantische Ich ängstlich in einer verdunkelten Welt
[…], verfolgt vom Gespenst eines verborgenen Gottes und seiner
eigenen Erlösung unsicher.
Der Sinnzusammenhang, den Glaube stiftet, und sei’s jener an und aus Form, kollabiert; doch nur er kann diesen Kollaps leisten: Die zerbrechende Form allein gebiert, was sie zuvor zu meinen schien. Dieser Traum von einer Welt, die Zeichen wird, sich lesen läßt, sodaß in der Form kein Unrecht mehr schiene, liest sich bei Weißglas also verhalten und gebrochen; ein „Antlitz […] eine Rune“, so hofft das Poem:
Und deine Lippen kannten schon mein Lied.
Dieses Schon-Kennen ist prekär, natürlich, und das vom Poem zu wissen, das das Erkennen durch die Zeitlichkeit hindurch („– durch sie hindurch, nicht über sie hinweg“) träumt:
Es gibt […] einen […] nicht von Monty Python stammenden Film
mit dem Titel Der Sinn des Lebens, den ich einmal im
Mormonentempel in Salt Lake City gesehen habe. Leider habe ich
vollkommen vergessen, worin dieser Film den Sinn des Lebens sah
– vielleicht auch, weil ich ziemlich erstaunt war, dass der Film nur
vier Minuten dauerte.
Woran erkennt man die Unwahrheit […]? An ihrer verblüffenden
Ähnlichkeit mit bereits bekannter Wahrheit.
Es ist der Abgrund, den die Form kennt – und gegen den sie allein steht, Form wider das „System konformer Kontextlügen“… Doch die allzu leicht von der Form generierte Mystik bleibt und wird wahr: mittels so etwas wie ihrer Implosion.
Das Gedicht in seiner Form erhofft diese Widerständigkeit, sich als Nicht-Cliché. Das ist fast jene Transzendenz, die als behauptete nicht ist, wie Weißglas zeigt, wenn er die „Gnade als ein Rutenbündel“ darstellt… Gerade die Form, die bei Celan nicht geduldet zu sein scheint (duldest du Mutter), ist im Unzureichen der Zeuge, wie man bei Weißglas liest:
Da nie die dunkle deutsche Klage schwieg.
Sie schweigt nicht, weil sie einbekennt, daß ihre Form das, was in ihr offenbar sein soll, zu verschließen droht. So ist eine bestimmte Art der Meisterschaft und ihre Tödlichkeit gemeint, wie bei Celan auch im Falle Weißglas’ das, was durch die noch einmal geleistete Meisterschaft hindurch geschieht, eine „Demontage jedweder meisterlicher Kunst, die affirmativ einer Technik kunstfertig sich zu bedienen wüßte“.
Dekonstruiert wird damit die deutsche Gründlichkeit, die auf das hinausläuft, was heute – als topos – Bilanz der Final Destination-Filme ist:
Der Tod ist ein passionierter Handwerker.
Genau dagegen schreibt Weißglas, gegen die Form, die immer auch meisterlich-präzise ist; ganz logisch ist, daß solche Dichtung sich, aber mit sich den problematisch gewordenen Formenkanon jener Demontage ausliefert. Es ist ja nicht einfach ein als Lob gemeinter Fauxpas, wenn Rose Ausländer über Celan schreibt, er sei „ein genialer ,Meister‘“, und zwar zudem in bezug auf die „Todesfuge“ – man muß, so mag darin vielmehr anklingen, durch Meisterlichkeit eben diese dekonstruieren. Das weiß Weißglas’ Dichtung; sie vermeint nicht, diesem Dilemma entgehen zu können, doch gemäß dem Satz Valérys, wonach ein „Dichter […] schließlich soviel taugen (werde), wie er als Kritiker getaugt hat“, und natürlich auch als der seiner selbst, ist sie Rache an dem, was eben nicht nur an ihr fragwürdig sein mag.
So ist thematisch die Form quasi nekrophil, dann aber das Gedicht, das gedenkt, dies – und in dieser dialektischen Volte doch auch Hoffnung. Celan nannte seine „Todesfuge“ ein Grab. Doppeldeutig, wie dies es wohl ist, ist ein Vers Weißglas’, der verstörend über einen Meister und dessen Totenreigen verlautet:
Was seiner Hand gerät, ist stets ein Sarg.
IV
All das kulminiert in Weißglas’ Gedicht „Er“, berühmt wegen der Motive, die in der „Todesfuge“ gleichfalls sich finden. Gottgleich wird darin der Deutsche adressiert, nämlich in Majuskeln, er ist in der präformierten Cliché-Theologie das, wozu Form verfällt, die hier vorgeführt mehr denn fortgeführt erscheint. Wie auch Celans „Todesfuge“ beredte Polemik gegen das ist, woraus sie erwachsen zu sein scheint, darum „literaturbesessen[es]“ die Versatzstücke gegen das verwendet, was sie gebar, so ist auch bei Weißglas „der Tod ein deutscher Meister“, nur eben nicht der Fuge sich bedienend, sondern – weniger stimmig und weniger ausgreifend vielleicht, aber noch immer effektiv – fünfhebiger Jamben.
Dieses schreckliche Gegenüber ist das Subjekt einer Trivialtheologie, die ihr Böses nicht mehr versteht, darum aber selbst zur Gänze ihm anheimfällt, sich aufzehren läßt, Komplize dessen, was sie als das Böse nicht mehr erkennt, sondern thematisch denunzierend strukturell doch entschuldigen will: „ER spielt im Haus mit Schlangen, dräut und dichtet?“, nicht in raffinierter Antithetik wie bei Celan, doch als das verheerende Epizentrum, dem Sprache nicht für immer entgehen kann, da sie eben immer Form ist, also latent auch der Trug, der die Sprache mit deren Mitteln narkotisiert.
Es ist also nicht so, daß naiv neben Celans Dichtung, die „Polemik und Melancholie zusehends ineinander“ webt und wirkt, eine melancholisch-hohle Formkunst Weißglas’ stünde; die Verwandtschaft, die man aus falscher Rücksicht auf den Unbekannteren der beiden Poeten zuweilen abstritt, besteht, und gerade hier. Weißglas, schon in seiner Jugend „ein hochgebildeter, enorm begabter“ Dichter, wie Rose Ausländer sich erinnert, schreibt eine durchdachte Poesie – und immanent Poetik – der Asche und „Ascheberge[n]“, die Formen, derer er sich bedient, reflektieren ihr Unzureichen, zerfallen im Gedicht gerade im Raffinement, dem sein Gegenstand abhanden kommt, wovon aber allein diese Formenkunst spricht.
Zwischen der Welt des Wortes […] und der Welt der Asche […] ist nichts als Gegensatz..?
Das ist wahr, was die Intention betrifft, doch ist zugleich das Wort – oder die Schrift, die Form – etwas, das der Asche zuarbeitet:
Das absolute Unglück – […] Asche […] ist das Verschwinden des Zeugen. Die Asche ist eine Zerstörung des Gedächtnisses. […] Sobald man von der Asche spricht, sobald man über sie schreibt, […] fährt man fort, die Asche selbst einzuäschern. […]
In der Asche ist alles vernichtet. Die Asche ist die Figur dessen, wovon nicht einmal, gewissermaßen, Asche übrigbleibt. Nichts bleibt übrig.
Weißglas weiß darum, er schreibt aschene Gedichte: für das, was „damals schon Asche“ gewesen sei, immer gewesen sein wird, „im Niemandsland des Lieds verloren.“ Die Form zeugt davon, in der Lektüre gebrochen, wahr in der Irritation der Lektüre, die den Text als in seiner Form vom Scheitern der Form erzählend begreift, sie bringt die Schatten gleichsam ans Licht, die auch bei Celan so essentiellen, zugleich jede Essenz befragenden „Gedankenschatten“ all die „Denkschatten“, den „Schmerz, als Wegschneckenschatten“:
Wahr spricht, wer Schatten spricht.
Weißglas’ Form ist die Asche ihrer selbst, der Schatten ist in ihr, die so ungebrochen, wie man vermeint, nicht ist – man könnte sagen, daß diese reine Form verschattet ist, eine Form „des aller Form Heterogenen, wie Adorno schreibt. Durch ihren „Schatten wird es […] helle“, so schreibt Weißglas – und das Wort helle, das sich Reim und Alternieren nicht zuletzt verdankt, ist das paradoxe Residuum des Sinns fürs Dunkle. Form und Figur werden von Weißglas als Einäscherung gezeigt, und allein dazu scheinbar naiv gebraucht: Das ist es, was diese Lyrik versucht; und was ihr in vielen Versen auch glückt. Sie ist leise dabei, und doch mag ihr in ihrer Nachhaltigkeit gelingen, was dieser Lyriker verheißt:
Ich schreck den Tod, und weck die Sprache.
Martin A. Hainz, aus Andrei Corbea-Hoisie, Grigore Marcu, Joachim Jordan (Hrsg.): Immanuel Weißglas (1920–1979). Studien zum Leben und Werk, Editure Universității „Alexandru Ioan Cuza“ und Hartung-Gorre Verlag, 2010
Oleg Jurjew: Drei Dichter aus Czernowitz
Heinrich Detering im Gespräch mit Jürgen Nelles über Immanuel Weißglas und die Bukowina am 12.12.2017 in Aachen
Fakten und Vermutungen zum Poesiealbum + wiederentdeckt +
Interview
50 Jahre 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + Kalliope
Fakten und Vermutungen zur Herausgeberin + Interview + Lesung
Laudatio + Christine Lavant Preis + Urheberrecht
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Kathrin Schmidt in der Sendung „typisch deutsch“.


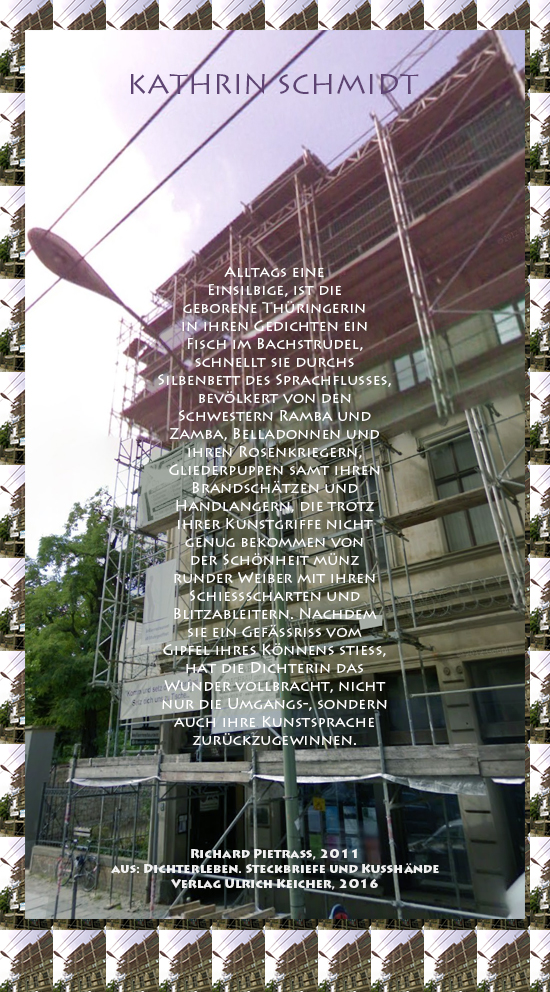












Schreibe einen Kommentar