Inger Christensen: alfabet / alphabet
wie wenn der wasserstoff im
innern der sterne
weiß würde hier auf
der erde kann sich das gehirn
weiß anfühlen
wie wenn jemand die
zeit zusamengelegt
und durch die tür
in ein zimmer
gepreßt hat
wo vorher schon ein
tisch ein paar stühle und
das unbenutzte bett
des schlaflosen
zerbröckeln
wie wenn dunst aus dem
fremden weltraum
reiste wie engel
sitzt man in seiner
ecke da
bis man ohne
daß bestimmte dinge
geschehn plötzlich
aufsteht
und weggeht
wie ein vogel der
unsichtbar erwacht
und um mitternacht
sein ungeborenes
junges füttert
wenn niemand wissen
kann ob die dinge
so wie sie sind
weitergehn
Nachbemerkung
Inger Christensen ist am 16. Januar 1935 in Vejle an der Ostküste von Jütland geboren. Nach dem Abitur besuchte sie das Lehrerseminar in Arhus und hörte während dieser Zeit auch medizinische Vorlesungen. 1958 legte sie die Lehrerprüfung ab und gab mehrere Jahre lang Unterricht, zuletzt an der Kunsthochschule in Holbaæk.
Ihren ersten Gedichtband, Lys (Licht), veröffentlichte sie 1962, den zweiten, Græs (Gras), 1963. Darin werden, wie der Kritiker Torben Brostrøm damals schrieb,
neue Wortsituationen (…) geschaffen, die noch nackter einen Bewußtseinszustand festhalten können, weniger um die Dinge zu überraschen, als um die Dinge und die Wörter verraten zu lassen, wer wir sind. Die Gedichte zeugen für ein Streben danach, die Bastionen des Ich niederzureißen und durch dichterische Erkenntnis zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl vorzustoßen, das Abstände aufhebt, und den Ausdruck dafür quer durch die Sprache zu finden, die so häufig die Dinge nur fremd macht.
Selber hat Inger Christensen bereits 1964 kritisiert, daß „allzu großes Gewicht auf Selbstverwirklichung gelegt“ werde. In dem Aufsatz „Drømmen om en by“ („Der Traum von einer Stadt“) schreibt sie:
Ich finde, daß als Gegengewicht zur Unüberschaubarkeit der Welt ein Kult des Individuums, ja der Unüberschaubarkeit des Individuums aufkommt; als ein Versuch, Gleichgewicht herzustellen, aber auf trügerischen Grundlagen.
1964 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, Evighedsmaskinen (Die Ewigkeitsmaschine oder Perpetuum mobile), eine satirische Etüde über die Gestalt Jesu, deren vorherrschendes Stilmerkmal eine „doppeldeutige Sprache“ ist (Emil Frederiksen). Zum kompositorischen Grundprinzip wird das Spielen mit und das Durchspielen von Sprachmustern in ihrem 1967 erschienenen zweiten Roman, Azorno (Azorno, dt. 1972). Helmut Heißenbüttel charakterisiert ihn in seiner Besprechung der deutschen Ausgabe als „ein Ding in jener anderen Welt, in der Sprache sich auf eigene Faust auf Abenteuer begeben kann“. Inger Christensen hatte, wie zur gleichen Zeit in Schweden Lars Gustafsson, die Arbeiten des amerikanischen Sprachwissenschaftlers Noam Avram Chomsky kennengelernt. Dessen „Ideen über eine angeborene Sprach-Fähigkeit und über allgemeingültige formale Regeln für den Satzbau, die zwar auch für die Struktur der Sprache bestimmend sind, die zugleich aber ermöglichen, daß ins Unendliche Sätze generiert werden“, hätten ihr „ein phantastisches Glücksgefühl“ gegeben, schreibt Inger Christensen in dem Aufsatz „I begyndelsen var kødet“ („Im Anfang war das Fleisch“) 1970: „Eine nicht beweisbare Gewißheit, daß die Sprache eine unmittelbare Verlängerung der Natur ist. Daß ich dasselbe ,Recht‘ hatte, zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben.“
In dem Kommentar zu seinem Gedicht „Die Maschinen“ (1966) hatte Lars Gustafsson von der Vorstellung gesprochen, „daß unseren Worten und unserm Sprechen etwas Mechanisches und gleichsam Unpersönliches anhaftet, als wären nicht wir es, die unsere Gedanken hervorbrächten, sondern als dächte die Sprache in uns, und als liehen wir bloß einer größeren, unübersehbaren sprachlichen Struktur unsere Stimme“. Ähnlich heißt es in Azorno:
Der Gedanke konnte einem kommen, daß die Sprache so unangefochten ihr eigenes Leben weiterführte, auch in ihren am stärksten bearbeiteten Ausdrücken, und obwohl unablässig Versuche unternommen wurden, sie an Übergriffen auf die Erlebnisfreiheit zu hindern.
1969 erschien Inger Christensens bisher umfangreichste lyrische Arbeit, der Gedichtzyklus oder, besser: das Großgedicht det (es), an dem sie unmittelbar nach Abschluß von Azorno zu arbeiten begonnen hatte. „Man kann det als ein Modell der Welt auffassen“, schreibt Uffe Harder,
der Welt, wie die Autorin sie um sich sieht und wie sie sich vorstellt, daß sie sein könnte. Der Text ist mit anderen Worten nicht nur ein Modell von etwas Bestehendem, sondern auch eine Utopie. Außerdem ist er eine Handlung, denn indem sie sich zu der Welt, über die sie schreibt, verhält, greift Inger Christensen gleichzeitig in sie ein.) „Es könnte Wörter geben / die aus sich heraustreten / als Realitäten“, heißt es an einer Stelle gegen Ende des Buchs, und det handelt nicht zuletzt von den Bedingungen für diese Verwandlung.
Als einen Anstoß für ihre Vorüberlegungen zu det nennt Inger Christensen Lars Gustafssons Aufsatz über das Problem des langen Gedichts, „Beobachtungen an Gedichten“ (1965); insbesondere interessiert sie daraus die Frage:
Gibt es in der Summe unserer Erfahrungen, so wie sie in unseren Begriffen auftaucht, in dem wissenschaftlichen Weltbild, das wir besitzen, in unserer Anschauung über die Gesellschaft und die Traditionen hinreichend Gemeinsamkeit und gemeinsame Übereinstimmung, um eine Unterlage für ein funktionierendes allegorisches Gedicht bilden zu können, das in seiner Vieldeutigkeit sowohl Faktizität (Faktisches) als auch Selbstbespiegelung absorbieren kann?
Derselben Frage – der Frage nach einer „Unterlage für ein funktionierendes allegorisches Gedicht“ – geht sie in einem Aufsatz über Dantes Divina Commedia nach, den sie „Die gemeinsame Unlesbarkeit“ („Den fælles ulæselighed“, 1969) überschrieben hat. Darin ist auch von dem Verhältnis zwischen Idee und künstlerischer Ausführung die Rede: „,Die Idee‘“, schreibt Inger Christensen, „existiert vor dem künstlerischen Verlauf, aber in einem Aufblitzen, unfaßbar, unlesbar, / erst wenn sie aus ihrer grundsätzlichen Unlesbarkeit herausgeholt wird, entsteht die künstlerische Struktur und die philosophische Systematik.“ Ihre Überlegungen zu Dante schließen mit den Sätzen:
Dante versetzt seine Theorie und seine Erfahrungen in Schwingungen, bis die Vision der neuen Welt, des neuen Lebens vor seinen Augen entsteht. Er kannte es schon vorher, aber schrieb es, um es kennenzulernen. Und schrieb es, um die Welt lesbar zu machen bis zu dem Punkt oder Augenblick, wo der Autor selber mit der Welt in ihrer gemeinsamen Unlesbarkeit zusammenfallen muß.
Zwischen 1966 und 1975 hat Inger Christensen fünf Hörspiele geschrieben, die auch von bundesdeutschen Sendern ausgestrahlt worden sind: Spiegeltiger (Spejltigeren), Angekleidet, um zu überleben (Påklædt til at overleve), Ein unerhörtes Spiel (Et uhørt spil), Massenhaft Schnee für die darbenden Schafe (Masser af sne til de trængende får) und Ein Abend auf Kongens Nytorv (En aften på Kgs. Nytorv). Aus dem gleichen Zeitraum (1970) stammt das Opernlibretto Der junge Park. Ein Verwandlungsspiel der Gefühle (Musik: Ib Nørholm) und das Theaterstück Die Intriganten (Intriganterne, 1972).
Zur Lyrik kehrte Inger Christensen 1979 mit Brief im April (Brev i april) zurück. Diese siebenteilige Gedichtfolge ist in Paris entstanden; die Gliederung der einzelnen Teile folgt einem um die Zahl 5 variierenden Aufbaumuster, das Inger Christensen nach eigener Auskunft einer von Olivier Messiaen benutzten seriellen Kompositionstechnik entlehnt hat. Schon det aus dem Jahre 1969 hatte eine zahlenkombinatorische Grundlage, die auf der Zahl 8 basiert. Ihrem alphabet schließlich (alfabet, 1981) hat Inger Christensen die sogenannte „Fibonacci-Folge“ zugrundegelegt, „eine mathematische reihe mit der zahlenfolge 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, in der jedes glied die summe der beiden vorangegangenen glieder darstellt“, wie sie in einer Anmerkung erläutert. „… ich vertraue darauf,“ so hat sie 1986 in einem Gespräch mit dem norwegischen Schriftsteller Jan Kjærstad geäußert, „daß, wenn ich etwas schreibe, das teils ich selber bin, teils in der Welt ist – in diesem Falle also Mathematik −, daß diese Kombination aus den Zahlen und meinen Worten so etwas wie ein natürlicher Organismus wird.“
Und (in demselben Gespräch):
Ich benutze Modelle, um nicht gänzlich dem Spiel der Zufälligkeiten überlassen zu sein. Mit „Spiel der Zufälligkeiten“ meine ich mein zufälliges Temperament, das einer von Milliarden von Zufällen ist. Wenn man das entdeckt, dann erfindet man einen oder sucht man nach einem Widerstand wie Mathematik. Mathematik ist ja ganz anders als die Gedanken, die man hat, wenn man beispielsweise herumläuft und ein Haus putzt. Einer der Gründe dafür, daß ich Systeme benutze, ist mit anderen Worten, daß ich gerne etwas anderes sagen möchte als das, was mir zuerst einfällt. Weil das, was mir zuerst einfällt, dasjenige ist, worüber man sonst herumläuft und redet, dasjenige, was einen die ganze Zeit umgibt. Die Systeme helfen dabei, etwas herauszubekommen, das anderswo herstammt, nicht bloß aus der eigenen „Seelentiefe“, sondern aus allen möglichen merkwürdigen Ecken. Da ich als Mensch die ganze Zeit mit Formen von Systemen konfrontiert werde, will ich, daß auch die Gedichte, die ich schreibe, in der Begegnung mit etwas Ähnlichem geschaffen werden. Auf diese Weise kommt etwas heraus, Gedichte, die eine Kombination aus der Welt und mir selbst sind, und das werden Gedichte, die anders sind, als wenn ich bloß von meiner eigenen privaten Welt aus schriebe.
Die vierzehn Abschnitte von alphabet fangen jeweils mit einem der ersten vierzehn Buchstaben des Alphabets an. Außerdem verweist der Titel auf die Formel vom „Lesbarmachen der Welt“, die Inger Christensen auch in einem programmatischen Text aus dem Jahre 1971 aufgreift, in „Die klassenlose Sprache“ („Det klasseløse sprog“); darin heißt es:
Es ist nicht meine Absicht, Vermittler oder / Produzent von Meinungen und Ideen zu sein (…). Ich will auf die Blindheit einwirken. / Die Menschen schaffen die Geschichte in einer verworrenen Mischung / aus Bewußtsein und Blindheit. / Das Bewußtsein kennen wir, es hat seine Variationen; mag / sein, daß sie immer mehr werden und in der Praxis unüberschaubar, / doch im Prinzip ist das Bewußtsein der bekannte Faktor. / Doch stets ist es der unbekannte Faktor, worauf einzuwirken sich lohnt. / Doch auf die Blindheit läßt sich nicht dadurch einwirken, daß wir die Wahrheit suchen. / Auf die Zufälligkeit läßt sich nicht mit Meinungen einwirken. / Doch der Würfelwurf ist es, worauf eingewirkt werden muß. / Ich betrachte es als die Aufgabe eines Schriftstellers, einen Code / zu konstruieren, der den Würfelwurf lesbar macht, / und sich ein Zeichensystem vorzustellen, das die Blindheit übermittelt, / kurzum, ich betrachte es als die Aufgabe des Schriftstellers, / sich mit dem Unmöglichen zu beschäftigen, dem Unvollkommenen, dem, was / außerhalb liegt, / versuchsweise eine Sprache zu gebrauchen, die nicht existiert, noch nicht. Diese nicht-existierende Sprache nenne ich die klassenlose Sprache. In demselben Sinne, wie die nicht-existierende Gesellschaft von vielen die klassenlose Gesellschaft genannt wird.
Hanns Grössel, Nachwort
Der naive Leser
Wenn ich Gedichte schreibe, dann kann es mir einfallen, so zu tun, als schriebe nicht ich, sondern die Sprache selber.
Ich tue so, als wäre es möglich, als Person ein wenig zurückzutreten und die Sprache sozusagen von außen zu überwachen, so als hätte ich sie selber nie benutzt.
Ich tue also so, als hätten die Sprache und die Welt ihre eigenen Verbindungen. Als hätten die Wörter, unabhängig von mir, direkte Berührung mit den Phänomenen, auf die sie verweisen. So daß es der Welt möglich wird, Sinn in sich selbst zu finden. Einen Sinn, der vorher schon da ist.
Dabei tue ich nur so, als ob. Ich spüre aber auch, daß ich nicht anders kann. Ich muß in der Welt Sinn finden, nicht, weil ich das beschließe, vielleicht nicht einmal, weil ich das wünsche, sondern weil ich naiv bin, ich bin eine Eingeborene, ein Eingeborener – auf dieselbe Weise, wie ein Baum eingeboren ist −, ja, ich bin wirklich ein eingewachsener Teil der Welt, der nicht umhin kann, Sinn zu schaffen, den Sinn, der vorher schon da ist und der unaufhaltsam seine eigene Verwandlung verwaltet, als das, was wir unter Überleben verstehen.
Ich kann es auch anders sagen. Was ich hier erzähle, unterscheidet sich im Prinzip nicht von der Art der Bäume, Blätter zu treiben. Die sich selbst produzierenden, sich selbst regulierenden Systeme der Biologie sind im Grunde von derselben Art, ob sie nun Bäume genannt werden oder Menschen.
Als Mensch muß ich natürlich einwenden, daß ich, während ich zum Beispiel an meinem Fenster sitze, den Baum sehen kann, während ich annehmen muß, daß der Baum nicht mich sehen kann. Aber was heißt das: sehen? Das ist ja Menschensprache. Natürlich ist es richtig, daß der Baum nichts gesehen hat, aber auf seine Weise hat er mich dennoch gesehen, indem er die Anwesenheit des Menschen gemerkt hat, wenn nicht anders, dann als Luftverschmutzung. Dann kann man sagen: das zeigt eigentlich nur, daß die Menschen höher stehen als die Bäume und Macht über die Dinge haben, daß, kurz gesagt, wir es sind, die bestimmen, ob die Bäume sterben sollen, und nicht umgekehrt. Doch wer weiß, wie die Verwandlung am besten verwaltet wird. Was wie Waldsterben aussieht, ist vielleicht vor allem ein Zeichen dafür, daß wir selber in Gefahr sind, daß wir selber erliegen können – natürlich nach den Wäldern.
Aber vorher oder nachher ist in dem Zusammenhang wohl für die Bäume nebensächlicher als für uns. Wir haben ja keine unmittelbare Fähigkeit gezeigt, aus der Erde wiederaufzuerstehen, wenn wir erst einmal tot sind, aber da Pflanzensamen, die in den Pyramiden Ägyptens versteckt gewesen sind, sich heute als keimfähig erwiesen haben, muß man annehmen, daß die Bäume sich nur in der Erde verstecken und wieder heraufkommen wollen, wenn die Zeit da ist, wenn einmal die Luftverschmutzung und die Menschen weg sind. Die Bäume überleben – dann aber eher mit den Küchenschaben zusammen als mit uns.
Auf diese Weise kann man es wirklich nicht sagen. Und doch. Sie zeigt vielleicht, daß die Welt in Wirklichkeit sowohl lesen als auch gelesen werden kann. Daß Eindrücke gelesen, das heißt geerntet werden können, so wie Trauben geerntet werden. Daß Zeichen gesammelt werden können, so wie Nahrung gesammelt wird. Daß wir als Menschen eine Vielfalt von Zeichen lesen können, von den Bewegungen von Sternen und Wolken über Vogel- und Fischschwärme bis hin zur Ameisensprache und Wasserstrudeln im heimischen Küchenausguß. Alles von Astronomie und unsichtbarer Chemie bis hin zur Biologie und ihrem Klima. Aber auch die Ameisen lesen. Auch die Bäume lesen und wissen auf Sekunden genau, wann sie die Blätter hängen lassen müssen, wenn ihre Blüte in Gefahr ist.
Dennoch sind wir natürlich einzigartig, aber nur, weil die Erde einzigartig ist. Die Erde hat in ihrer Biosphäre das Projekt entworfen, das Menschheit heißt. Das einzigartig ist, nicht so sehr, weil in unserem Teil des Weltraums keine anderen in der Nähe sind, die uns ähneln, und auch nicht so sehr, weil wir alle Zeichensysteme der Welt ablesen können und immer versuchen werden, sie in unsere Sprache zu überführen, auch nicht, weil wir den natürlichen und historischen Prozeß der Lesbarkeit an sich lesen können – nein, eigentlich sind wir nur einzigartig, weil wir das Wort Gott benutzen.
Weil wir uns vorstellen müssen, daß wir auch nach beendeter Lektüre unserer selbst und all des anderen zusammen schließlich an die Grenze der Lesbarkeit gelangen werden. Und vielleicht ist es diese von uns vorweggenommene Grenzstelle, was uns so einzigartig macht. Hier, auf dieser Stelle und dennoch unterwegs, führen wir das Gespräch zwischen Mensch und Weltall, zwischen Lesbarkeit und Unlesbarkeit, das wir versuchsweise Gott nennen.
Und dieses Gespräch haben wir ja lange geführt. Noch bevor wir eine Schriftsprache hatten. Vielleicht sogar, bevor wir eine Sprechsprache hatten. Jedenfalls bevor wir das erste Gedicht dichteten, mündlich oder schriftlich, weil wir von vornherein mit dem Gedicht verbündet waren, das das ureigene Gedicht des Weltalls ist.
Unterwegs haben wir verschiedene Versuche gemacht, dieses Gedicht einzufangen, und wir haben sie alles mögliche genannt, von Offenbarung bis Wissenschaft. Von den ersten heiligen Schriften zum Beispiel der Bibel, über Novalis bis hin zu Mallarme, und in der Wissenschaft weiter bis zu den letzten Theorien über den Zusammenhang des Weltalls, hat eine Vorstellung vom Weltbuch bestanden, dem Buch, das alles aussagt und damit das Gespräch zwischen Lesbarkeit und Unlesbarkeit zum Aufhören bringt, sozusagen im Inneren des Wortes Gott.
Eine Vorstellung, die immer Nahrung aus ihrer eigenen Unmöglichkeit gesogen hat. Die Bibel wird zwar eine Offenbarung genannt, aber eine Offenbarung, die in den Vorbehalt mündet, daß wir hier wie in einen Spiegel sehen, ein Rätsel, aber zu seiner Zeit von Angesicht zu Angesicht sehen werden – das heißt: einmal, wenn die Welt, die offenbart wird, nicht mehr existiert.
Und auch wenn Novalis die allumfassende Verschmelzung von Wort und Phänomen sucht – Zitat: „Das Äußre ist ein in Geheimniszustand erhobnes Innre“ – und die Formel für das archetypische Buch umkreist, wird die Arbeit immer wildwüchsiger, denn je mehr er sich um das ganze konzentriert oder sich in das ganze hineinliest, desto mehr scheint es sich auszubreiten, genauso wie später Mallarmé dahin kommt, mehr auf die Leere zwischen den Wörtern hinzuweisen als auf die Wörter selbst. Auch die Versuche der Wissenschaft, das Weltbuch in einem einzigen Zusammenhang zu schreiben, sind in ständig revidierten Theorien über Entstehung, Einrichtung und Verlauf des Weltalls gelandet, Theorien, die ganz draußen an der Grenzstelle entstehen, wo das Gespräch zwischen Lesbarkeit und Unlesbarkeit zwar geführt werden kann unter Namen wie Chaos-Theorien, Fraktalen und Superstränge, aber nur, weil es mit dem Wort Gott allzu anmaßend klingt.
Doch so, wie die Buchstaben in einem Buch niemals das Buch werden lesen können, so können wir auch niemals die Welt lesen. Die Buchstaben werden es natürlich auch nicht versuchen. Wir dagegen sind gezwungen, weiterzulesen. Und stets wird es uns gehen wie in der berühmten Erzählung von Jorge Luis Borges, der Erzählung von der Landkarte, die immer größer und ausführlicher gezeichnet wird, bis sie schließlich genauso groß ist wie die ganze Welt und das bedeckt, was sie eigentlich aufdecken sollte.
In einer menschlichen Dimension muß die Karte eine Abkürzung sein. Und auf dieselbe Art und Weise muß die Sprache eine Abkürzung für die Lesbarkeit der Welt als solche sein. Eine poetische Abkürzung für all die Zeichen im Weltall, deren Verhältnisse und Bewegungen wir nicht umhin können uns anzulesen, Was Novalis „das seltsame Verhältnisspiel der Dinge“ nennt. Dieses Verhältnisspiel kommt in allen Arten sich selbst produzierender Systeme und ihrer Verflechtung zum Ausdruck. Von der Welt der Menschen aus gesehen, in erster Linie in der Sprache und der Mathematik und ihrer Verflechtung in uns. Unter anderem in Gestalt von Gedichten.
Wenn ich sage: unter anderem in Gestalt von Gedichten, dann deshalb, weil die Gedanken, die ich mir hier mache, auch eine nachträgliche Rationalisierung sind, die jedenfalls teilweise mit dem Erlebnis verknüpft ist, das ich selber mit dem Schreiben von Gedichten hatte, als ich die Gedichtsammlung alphabet schrieb. Sie entstand auf eine besondere Art und Weise, die vielleicht Licht auf den Zusammenhang zwischen Zahlen, Poesie und Sprache werfen kann. Wie alle, die sich ab und zu mit der Unlesbarkeit konfrontieren, vielleicht gerade, weil die Lesbarkeit überhaupt existiert, erlebte ich das, was man eine Krise nennt. Warum überhaupt schreiben, wenn die Unlesbarkeit bloß anhält? Und auf einer anderen Ebene: warum schreiben, wenn die Menschheit ihre eigenen Ausrottungsmittel anhäuft und so aussieht, als sehnte sie sich nicht danach, zu lesen, sondern danach, sich über die Grenze hinwegzuwerfen, in die große Unlesbarkeit hinein. Die eigentliche Arbeit damit, diesen Fieberzustand zu überwinden, begann als ein Vorgang des Einsammelns. Eine mir selbst unverständliche Beschäftigung damit, Einzelwörter auf Papier zu schreiben, vorzugsweise Substantive, die auf konkrete Phänomene in der Welt verweisen, alles mögliche Eßbare, Sichtbare und sinnlich Wahrnehmbare wie Aprikosen, Tauben, Melonen, aber auch Dioxin und dergleichen. Da standen sie, auf großen Bögen weißen Papiers, Wörter mit a, Wörter mit b, Wörter mit c usw., und wenn ich noch unerträglich viel länger weitergemacht hätte, dann hätte es einer besonders schlampigen Form von Wörterbuch geähnelt, einer Wildnis unzusammenhängender Phänomene. Hier kommt die Mathematik herein. Denn da die Phänomene niemals von selbst in Zusammenhängen auftreten, nur weil sie benannt werden, wurde es mein Glück, daß ich unterwegs, in meinem Suchen nach Wörtern, zufälligerweise über Zahlen fiel (in einem Lexikon unter F), nämlich über Fibonaccis Zahlenreihe, die ich am ehesten als eine Vision erlebte, als ein Bild für Entstehung und Ausbreitung des Weltalls, das der Theorie von Big Bang entsprach, die damals, 1980, die führende war. Als das Weltall geboren wurde, geschah folgendes: Alles, was anfangs zu fast nichts zusammengepreßt war, explodierte und breitete sich nach allen Seiten aus, eine Bewegung, die andauern wird, bis die Ausbreitung so groß ist, daß alles zu verschwinden und wieder zu nichts oder fast nichts zu werden scheint. Ein Bild also. Oder ein Gedicht, das sich draußen in der Unlesbarkeit befand, dessen formale Struktur ich jedoch über die eingesammelten Wörter und ihre Phänomene preßte. Dadurch gelang es mir, ein Gedicht zu schreiben, das verhältnismäßig lesbar ist, es vielleicht aber am meisten dadurch ist, daß es auf die gemeinsame Unlesbarkeit hinweist.
In dem Zusammenhang kann es interessant sein zu erzählen, daß ich erst, nachdem ich alphabet geschrieben hatte, detailliertere Kenntnis über Fibonaccis Reihe erhielt, worin jede Zahl die Summe der beiden vorangehenden ist; ich wurde nämlich darauf aufmerksam gemacht, daß ganz viele Pflanzen sozusagen Fibonaccis Zahlen benutzen. Zum Beispiel werden zwei aufeinanderfolgende Blätter auf einem Pflanzenstengel das Verhältnis zwischen Fibonacci-Zahlen spiegeln, die zwei Stellen auseinanderstehen. Für den Apfelbaum ist dieses Verhältnis 2 zu 5, für Porreestangen 5 zu 13. Und es gilt nicht nur für Blätter, sondern auch für Zweige, Blüten und Samenkörner. Bei der Sonnenblume und der Margerite zum Beispiel sind die Samenkörner in der mittleren Scheibe in Spiralen angeordnet, wo die Zahlen für die Sonnenblumen allgemein 21 und 34, 34 und 55 oder 55 und 89 sind, während sie für Margeriten 21 und 34 sind. Es sieht also wirklich so aus, als hätten die Pflanzen ihre eigene Art und Weise gefunden, Gedichte zu schreiben. Gedichte, die wir Menschen nicht umhin können zu lesen.
Ob Gedichte nun aber auf die eine oder andere Weise geschrieben werden, ob ich nur so tue, als schriebe ich, oder als schriebe die Sprache, ob ich nun schlecht und recht die Welt lese oder sage, daß ich ein Teil der Welt bin, der die Welt liest, und daß sie damit sich selbst liest, so bin und bleibe ich der naive Leser, ein Eingeborener, der seine Welt nie von außen sehen kann. Und mein Gedicht wird dasselbe Verhältnis zum Weltall haben wie das Auge, das seine eigene Netzhaut nicht sehen kann. Jedenfalls aber sieht es. Und es liest weiter.
Inger Christensen, Manuskripte. Zeitschrift für Literatur, Heft 115, 1992
Inger Christensen spricht über das System von Fibonacci. Clip aus dem Film Die Zikaden sind (1998) von Jytte Rex.
Die zärtliche Mathematik der Anwesenheit
− Alphabeth von Inger Christensen. −
„die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“ – so startet der Lyrikband Alphabet von Inger Christensen. Die dänische Lyrikerin wendet sich nicht der Erscheinung, sondern der Existenz der Dinge zu. Behutsam, als würde sie eine Feder auf einen Tisch vor sich legen, richtet sie die Welt der Dinge auf – der Aprikosenbäume, des Broms, des Cerebellums und der Citronella, des Dioxins und der Eiderenten.
Sie schafft damit eine geistige Architektur der Anwesenheit, die zugleich eine weiche Poesie und Präzision hat, die die Sprache eines existentiellen Forscherwillens spricht. Ihre Beziehung zu der Naturwissenschaft spiegelt sich in der Konstruktion des Alphabeths. Dem Gedichtsband mit einem einzigen „Großgedicht“ liegt eine mathematische Formel zugrunde: die Fibonacci-Reihe – die mathematische Formel für Wachstum. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 – für eine neue Stelle werden immer die beiden vorherigen addiert.
Jeder Abschnitt des Gedichtes ist einem Buchstaben zugeordnet und der wiederum einer Stelle in der Fibonacci-Reihe, die angibt, wie viele Zeilen das Gedicht hat. Während „A“ mit einer Zeile geschrieben wird, gehören „N“ (womit das Großgedicht endet) 610 Zeilen. Bei „Z“ wäre in 175.682 Zeilen die ungreifbare Nebligkeit von Deutungen und Erscheinungen der Welt mit dem Gewicht und der Anwesenheit von Dingen bevölkert worden.
Das Zugrundelegen einer mathematischen Formel unter ein lyrisches Werk spiegelt eine der Besonderheiten von Christensens Arbeit: Die hohe, naturwissenschaftlich akribische Reflexion schafft mit der Schönheit ihrer Sprache, die etwas Verführendes und Auflösendes hat, ein einzigartiges Feld poetischer Präzision. Häufig wird Inger Christensen als die reflektierteste Lyrikerin unserer Zeit beschrieben. Und tatsächlich spürt man in jedem ihrer Texte den Forscherwillen, der nicht nur die Wirklichkeit, sondern auch das Instrument der Annäherung – die Sprache – mit der Poesie als Methode erforscht.
Einer meiner Lieblingssätze von Inger Christensen ist ihre Aussage, dass es darum ginge „in der Schwindligkeit Wohnung zu nehmen“. Und genau das gelingt mit diesem außergewöhnlichen Gedichtband: Im Geheimnisvollen, Unbenannten jenseits der Sprache wird mit der Sprache ein mathematisch-zärtliches und poetisch-präzises Haus gebaut, von dessen Veranda aus man ein bisschen mehr Horizont erahnt als von anderen Orten.
Judith de Gavarelli, artediem.net
Wunderschön, tiefgründig und kritisch
Dieser Gedicht-Zyklus gehört zum Schönsten, das ich bisher gelesen habe.
Was außer ihr Wachstum, ihre Vielfalt, die Wiederholung oder Schönheit könnte die Natur, aber auch die Menschheit, die eine Unzahl von Spuren in schöpferischer Kultur (=Identität) hinterlässt, den Verheerungen einer Wasserstoff- oder Atombombe entgegenhalten?
[…]; die Erde auf ihrer route
durch die Milchstraße gibt es; die Erde unterwegs
mit ihrer last von jasminen, mit jaspis und eisen,
mit eisernen vorhängen, vorzeichen und jubel, mit Judasküssen
geküsst auf verdacht und jungfräulichem zorn in
den straßen, Jesus aus Salz; mit dem schatten des
jakarandabaums überm flusswasser, mit jagdfalken, jagdflugzeugen
und januar im herzen, mit Jacopo della Quercias
brunnen Fonte Gaia in Siena und mit juli
so schwer wie eine bombe;[…]
Im gleichen Verhältnis, wie sich Vielfalt der Natur und der friedlichen, erschaffenden Kultur gleichwertig neben Verrat, Widerstand, Mitläufertum und drohender Zerstörung in den Text fügen, wächst beim Leser das Berührtwerden und Entsetzen. Weil jede Anklage fehlt bei Kostbarkeiten wie „das schwindelerrregende waagrechte wissen des weizenfeldes“ oder „das jadeohr der fledermaus“ wird es zum Plädoyer für Unschuld und Wehrlosigkeit, wird besonders und besonders schützenswert.
Hieb- und Schusswaffen oder Messer haben eine begrenzte Reichweite und bieten die Möglichkeit von Flucht und Überleben. Atom- und Wasserstoffbomben überraschen ihre Opfer, wie die Autorin schreibt, völlig ahnungslos, zum Beispiel gerade ins häusliche Leben vertieft oder in einem Moment „selbstvergessen deine hand in meine geschmiegt wie ein junges“.
Die Autorin konstruiert die äußerste Möglichkeit: Es gibt kein Danach, wo die Opfer ihre letzten, schrecklichen Sekunden endlagern können und es ist niemand mehr da, sich des Todes zu erinnern. Wenn selbst diese Generationen verloren gehen, kann nichts mehr, sei es auch nur durch Erinnerungen, wiederbelebt werden. Unerträglich und unmöglich ist es, sich diesen Totalverlust vorzustellen.
Bei den Buchstaben l, m und n verschwimmt das Alphabet und bricht schließlich ab. Die Schreibende versucht, sich an der Natur zu beruhigen, geht noch einmal an den Anfang zurück und spannt den Bogen vom Urmeer bis zu ausdifferenzierten, menschlichen Kulturleistungen. Sie spielt mit den Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft, aber der Text erholt sich von keiner Störung mehr. Die Welt wird immer kleiner: der Ort der Kindheit, ein Punkt am Sims eines Hauses, von dem eine Taube, Tier wie Symbol für den Frieden, abfliegt.
Die Katastrophe tritt ungehindert ein. Die Autorin setzt sie an einem imaginären Datum, dem 11. August, mit Bezug auf historische Daten (Hiroshima am 6. August 1945 und Nagasaki am 9. August 1945) fest.
eine schar kinder sucht schutz in einer höhle
nur stumm von einem hasen beobachtet
als wären sie kinder in den märchen
der kindheit hören sie den wind von den abgebrannten
feldern erzählen
doch kinder sind sie nicht
niemand trägt sie mehr
ell, amazon.de, 8.2.2009
Sprachwunder
Die Gedichte von Inger Christensen im Band Alphabet sind etwas ganz Besonderes. Sie sind einerseits puristisch mit der immer wiederkehrenden Formulierung „… gibt es.…“, andererseits ziehen sie einen hinein in eine Fülle von Bildern – fast immer aus dem Alltag. Diese Bilder, Worte werden aneinander gereiht wie zufällig und eröffnen so ganz neue Sinnstrukturen, Blickweisen, Einsichten… Am besten liest man die Gedichte laut, um selbst in dieses Fließen der Sprache zu geraten. Es ist ein unglaublich schönes Buch! Leider starb Inger Christensen Anfang des Jahres, sodaß wir keine neuen Gedichte mehr erwarten können.
Brigitte Engel-Hiddemann „Playing Artist“, amazon.de, 3.8.2009
Nachdenken und nachleuchten
– Zwei dänische Lyriker lenken den Blick auf eine Literatur, die hierzulande nur wenig bekannt ist. Wo Inger Christensen Weltschöpfung betreibt, erkundet Søren Ulrik Thomsen das Beiläufige des Alltags. –
(…)
Was für Søren Ulrik Thomsen die spiegelblanken Tage sind, sind für Christensen die Juninächte, nur ins Positive gewendet: ein fliegender Sommer „wie ohnmächtig, wie mit weisse gesättigt, ein stundenloses // läuten von tau und insekten“. In ihrem Langgedicht alfabet von 1981 bringt die dänische Dichterin mühelos Wörter wie „weizenfeld“, „halbwertzeit“ und „hungersnot“ zusammen. Auf den ersten Blick mag das alfabet wie eine blosse Ansammlung von Begriffen wirken. Aber Christensen ist eine Meisterin der Komposition. So, wie ein Baum sich verästelt und Blätter bildet, wachsen bei Christensen die Sätze und Zeilen:
den herbst gibt es; den nachgeschmack und das nachdenken
gibt es; und das insichgehn gibt es; die engel,
die witwen und den elch gibt es; die einzelheiten
gibt es, die erinnerung, das licht der erinnerung;
und das nachleuchten gibt es.
Es sind mathematische und klangliche Muster, die das alfabet im Innersten zusammenhalten. Die Fibonacci-Folge etwa, in der jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen darstellt (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw.). Eine Folge, die sich auch in der Natur finden lässt, etwa in der Art, wie einige Pflanzen ihre Blätter und Früchte anordnen. Christensen richtet nach dieser Folge die Länge aller Strophen und Kapitel ihres Gedichts aus, noch in den kleinsten Abschnitt hinein. Dazu kommen die sprachliche Grundformel „es gibt“ („findes“ im Dänischen) und die Buchstabenfolge des Alphabets. Aber auch Figuren der Wiederholung und bestimmte Satzformen, die ein ums andere Mal variiert werden, bis aus dem berühmten Anfangsvers „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“ ein Geflecht von über 1.300 Versen geworden ist. Und es wäre noch viel länger geworden, hätte Christensen die Reihe nicht mitten im Buchstaben „n“ abgebrochen.
Dabei entspringen die Verse keineswegs nur einer Lust an formalen Momenten. Ein ideeller Kern ist vielmehr die Vorstellung, dass die Menschheit seit der Erfindung von Atom-, Wasserstoff- und Kobaltbombe in der Lage ist, sich selbst auszulöschen. Das alfabet enthält auch ein Epitaph auf die Toten von Hiroshima und Nagasaki – „zahlen die stillstehn / irgendwo in einem fernen / gewöhnlichen sommer“. Als Gegenimpuls zu diesem Gedanken des selbstgeschaffenen Nichts fächert das Gedicht zahllose Metaphern des Wachsens und Blühens auf, Figuren aus Mythen und Sprachschichten aus Geologie und Botanik.
So anspruchsvoll diese Überlegungen klingen mögen – nie wirken Christensens Verse überladen oder bildungsbürgerlich verdruckst, schon gar nicht platt didaktisch. Stattdessen leben sie von einer sehr feinen rhythmischen Kraft und haben bald etwas Liedhaftes an sich, bald erinnern sie an die Beschwörungsformeln von Litaneien. Je weiter das Gedicht voranschreitet, desto öfter tritt auch ein Ich hervor, das die Zikaden hört und sein eigenes Schreiben reflektiert:
ich schreibe wie das frühe
frühjahr das das gemeinsame
alphabet der anemonen
der buche des veilchens und
des sauerklees schreibt
ich schreibe wie der kindliche
sommer wie donner
über den kuppeln des waldrands
wie weissgold wenn der blitz
und das weizenfeld reifen.
Nun ist das alfabet in der grossartigen Übersetzung von Hanns Grössel (1932–2012) wieder erhältlich. Klanglich und rhythmisch hat Grössel das Gedicht in einer ganz eigenen Variante im Deutschen aufgefaltet. Auch die Fachbegriffe und die semantischen Fächer der Wörter hat er sehr gut eingeholt. Wo das Deutsche einen Gleichklang oder eine Reibung nicht gleich hergibt, verschiebt Grössel das Phänomen um ein paar Verse oder löst es auf einer anderen Ebene des Gedichts ein. In der Neuausgabe sind den Gedichten Radierungen von Per Kirkeby zur Seite gestellt, kleine, abstrakte Gefüge, die das Moment der Variation aufnehmen und weiterdenken – „eine zeichnung so einfach / wie wenn das lachen dein gesicht in luft zeichnet“. Ein Elementar-, ein Weltschöpfungsgedicht ist dieses alfabet, das zeichnet, leuchtet, fliegt.
Nico Bleutge, Neue Zürcher Zeitung, 29.3.2017
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Kai Sammet: Das Buchstabieren von Schöpfung und Vernichtung
literaturkritik.de, November 2017
Floating Alphabet – Vortragsreihe im Haus der Kulturen der Welt
12.7.2019
Lyrikschaufenster: Daniela Seel spricht über alphabet von Inger Christensen
Vom Alphabetisieren
Die Sprachen, so sehr sie einander zu entsprechen scheinen,
sind verschieden – geschieden durch Abgründe.
Paul Celan
Ohne Einbußen und Verluste lässt sich kein Text aus einer Sprache in die andere übersetzen, mögen die Sprachen einander noch so sehr zu entsprechen scheinen wie das Dänische dem Deutschen. Sehr anschaulich wird das an Inger Christensens alfabet (1981).
alfabet ist keine Gedichtsammlung, sondern ein durchkomponierter Zyklus, ein vielgliedriges Textcorpus, dessen Gestalt und dessen Wachstum von zwei Prinzipien gesteuert werden. Das erste ist das Alphabet, und zwar so, daß die gewichtigen, die sinntragenden Wörter jedes Gedichts mit einem neuen Buchstaben anfangen, „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“, lautet das erste Gedicht des Bandes, das nur aus dieser einen Zeile besteht.
Das zweite steuernde Prinzip ist die sogenannte Fibonacci-Folge, „eine mathematische reihe“, so Inger Christensen in einer Anmerkung, „mit der zahlenfolge 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, in der jedes glied die summe der beiden vorangegangenen glieder darstellt“. Nach dieser Zahlenfolge nimmt der Umfang der Gedichte zu, bis einschließlich des Buchstaben ,j“. Von da an wechseln „gesteuerte“ mit freien Gedichten ab. Das letzte Gedicht, das dem Buchstaben- und Zahlengesetz folgt, ist das Gedicht, dessen hauptsächliche sinntragenden Wörter mit dem Buchstaben „n“ anfangen. Es hat 33 Zeilen, und die ersten beiden lauten:
die nächte gibt es, den nachtschatten gibt es
die nachtseite, den mantel der namenlosigkeit gibt es
Dank der Stammverwandtschaft des Dänischen mit dem Deutschen kann das Steuerprinzip des Alphabets in der Übersetzung ohne Beeinträchtigung der Semantik fast überall eingehalten werden: Die deutsche „aprikose“ steht der dänischen „abrikos“ weder als Klangkörper noch als Sinnträger wesentlich nach, genauso wenig wie der deutsche „nachtschatten“ dem dänischen „natskygge“. Aber schon im zweiten Gedicht von alfabet hapert es mit Entsprechungen. Im Dänischen fangen die vier Hauptwörter des Zweizeilers alle mit den Konsonanten „br“ an: bregner, brombær, brom und brint – zu deutsch: Farne, Brombeeren, Brom und Wasserstoff. Im Deutschen also zwei Übereinstimmungen und zwei Abweichungen vom übergreifenden Prinzip des Alphabets.
In einem Aufsatz hat Inger Christensen berichtet, wie ihre Vorarbeit zu alfabet, in der Phase des Wörtersammelns, „einer besonders schlampigen Form von Wörterbuch geähnelt“ habe, „einer Wildnis von unzusammenhängenden Phänomenen“. Wäre ihr Text in dieser Phase veröffentlicht worden, dann hätten in der Übersetzung statt der widerspenstigen Wörter „farne“ und „wasserstoff“ vielleicht Wörter wie „brenennesseln“ und „braunstein“ stehen können. Nicht nur dem Prinzip des Alphabets, auch der Homogenität der benannten Naturphänomene wäre damit auf den ersten Blick Genüge geschehen.
Doch wie alfabet jetzt vorliegt, ziehen sich durch den Zyklus mehrere Leitthemen, die durch Wiederaufnahme verstärkt und verdeutlicht werden. alfabet ist kein verbales Naturalienkabinett.
„mir ging […] auf“, schreibt Inger Christensen, „daß ich Wörter sammelte, um mich selbst daran zu erinnern, daß die entsprechenden Dinge existierten, und um die Hoffnung auf ihr weiteres Existieren anzurufen. Ein beschwörender Charakter, aber […] noch keine beschwörende Form. Und in der Form liegt ja die eigentliche Beschwörung.“
Bei dieser Beschwörung kommt dem Wasserstoff (dänisch: „brint“) im zweiten Gedicht eine bedeutende Funktion zu. Inger Christensens alfabet im großen enthält nämlich ein dreiteiliges Alphabet im kleinen, und das sind drei Bombengedichte mit den Anfangszeilen: „die atombombe gibt es“, „die wasserstoffbombe gibt es“ und „die kobaltbombe gibt es“ – im Dänischen ein ABC der Vernichtung: „atombomben findes“, „brintbomben findes“ und „cobaltbomben findes“. Diese Entscheidung für die Wörtlichkeit ist zwingend; jede andere (etwa „braunstein“ für „wasserstoff“) hätte den inneren Zusammenhang des Gedichtzyklus verdeckt. Und konsequenterweise wird in der deutschen Übersetzung von alfabet jede Sache bei ihrem Namen genannt, ganz gleich mit welchem Buchstaben der anfängt.
14 Gedichte ihres Zyklus sukzessive mit je einem Buchstaben des Alphabets zu markieren, einschließlich des Buchstaben „n“ (der auch als mathematisches Zeichen gelesen werden kann), diese erste selbstgewählte Vorgabe Inger Christensens lässt sich also auch in der Übersetzung allergrößtenteils erhalten, hauptsächlich, wie gesagt, dank der Stammverwandtschaft des Dänischen mit dem Deutschen.
Die zweite Vorgabe, die Zahlenreihe der Fibonacci-Folge, appelliert zwar nicht unmittelbar an den Übersetzer als einen Wortsucher und -finder, er kann sie aber nicht außer Acht lassen, denn sie ist mehr als ein bloßer arithmetischer Automatismus. Sie wirkt mit der ersten zusammen und bestimmt nicht nur den Umfang, sondern auch die Proportionen des Gesamttextes und seine inneren Relationen. So gesehen, geht die Funktion beider Prinzipien über die eines Steuermechanismus hinaus; wechselweise steuern sie den Text und erzeugen ihn.
Im Rückblick versteht Inger Christensen die Fibonacci-Folge als „eine Sicht der Welt als eines zwar sprachlich stummen, aber zahlenmäßig sehr sprechenden Zusammenhangs zwischen verschiedenen Phänomenen eines Zusammenhangs und einer Schönheit, die sich z.B. dadurch zeigt, daß die Fibonacci-Zahlen konkret vorhanden sind in den Wachstumsprinzipien von Kristallen und Pflanzen. „[…] Ich empfand es“, schreibt sie 1992, „als ein großes Abenteuer, daß ich versuchte, dieses stumme universale Gedicht mit dem menschengeschaffenen Alphabet zu kombinieren, oder richtiger: diese Kombination in einer nicht abgeschlossenen Gedichtreihe anzudeuten.“ Nicht von ungefähr spricht man von Inger Christensens „Bioepik“.
Hanns Grössel, manuskripte, Heft 183, März 2009
Der Punkt zwischen allem und nichts
„Wiedererkennen, was man nie zuvor gesehen hat.“ Es kann recht verräterisch sein zu sehen, wie eine Privatbibliothek organisiert ist. Nicht zuletzt ist es verräterisch, seine eigene anzusehen. Wohl die wenigsten von uns haben die Bücherregale nach einem streng objektiven System aufgebaut, innerhalb von Genres, Zeitepochen und thematischen Gruppen und Untergruppen alphabetisch geordnet. Mit einem solchen System ließe sich nicht leben. Wider alle offensichtlichen Prinzipien sind andere und subtilere Codes im Spiel: Anziehung und Repulsion, Akkumulierung von Energien und Einsichten, Verbindung stromführender Linien, wo man sie nicht immer erwartet. Das System ruft nach seinem Bruch. Und der Bruch ruft neue Bilder hervor, die sich in den Echokanälen der Schrift fortpflanzen und verschwinden.
Physisch sind meine Bücherregale ein Konglomerat einander überlappender Bilder, offensichtlicher sowie halb geheimer Verbindungen. Mental handelt es sich um ein Set konzentrischer Kreise. Im zweitinnersten Kreis wird man drei Bücher von Inger Christensen finden: Det (Es), alfabet (alphabet) und Sommerfugledalen (Das Schmetterlingstal). Daran ist nichts Merkwürdiges. An allen drei Büchern kommt man in der nordischen Nachkriegsliteratur nicht vorbei. Sie sind unverrückbar in ihrer nie ganz fixierbaren Balance zwischen modellgesteuerten Prozessen und paradoxer überschreitender Freiheit, zwischen Leben und Tod, zwischen dem Schwebenden und dem Erdgebundenen, zwischen Daune und Eisen. Diese drei gehören zu den raren Büchern, bei denen man jäh dem Unbekannten von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und es augenblicklich wiedererkennt. In diesen Büchern werden zwei widerstreitende – und lebensnotwendige – Operationen gleichzeitig ausgeführt: die Aufrechterhaltung einer streng kontrollierten Form als Demarkationslinie gegen ein Chaos, das es unmöglich machen würde, Erfahrungen auszuscheiden und festzuhalten, und die Freisetzung einer anarchischen Lebensenergie, welche die totalitäre Steuerung von Existenz und Schrift durch das System kontinuierlich demontiert. Auf allen Ebenen in diesen drei Büchern sind die Widersprüche eingebaut. Sie sind geschlossen und offen, stark und verletzlich. Das ist ihr Triumph.
Im innersten der konzentrischen Kreise finde ich nur noch ein Inger-Christensen-Buch: alphabet. Was ist es, das dieses zu einem Der Wunderbaren Bücher macht?
Vor alphabet und danach. Das Systemgebundene und das Systemüberschreitende konstituieren den Doppelgriff, in dem Inger Christensen ihren Stoff hält. Es gibt wenige Parallelen in der Literatur, die eine entsprechende Freisetzung von Energie durch Kettenreaktionen zwischen Widersprüchen aufweisen. In alphabet bleibt auch das Gedicht von Mißtrauen und Zweifel am Nennwert der Aussagen nicht verschont. Das Gedicht ist keine Freistatt, kein idealer Raum: Auch dieses ist potentiell kontaminiert. Auch das Gedicht hat seine Unschuld verloren, ist von Invasion bedroht und kann jäh sich gegen den Schreibenden wenden:
… den tatort gibt es;
den tatort, verschlafen, normal und abstrakt, in ein weißgekalktes, gottverlassenes licht getaucht,
dieses giftige, weiße, verwitternde gedicht
Die Poesie ist ein Kampfplatz. Die Sprache ist Träger der Ansteckung wie der Schönheit, und das Gedicht ist die unzuverlässige osmotische Haut zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Das Destruktive ragt auch in die Sprache und frißt sich nach und nach in Inger Christensens Schrift ein, wenn das Alphabet sich entfaltet: die Aprikosenbäume, die Farne, die Brombeeren, der Wasserstoff, die Zikaden, Wegwarte, Chrom, Zitronenbäume, Zeder, Zypresse, Cerebellum, die Tauben, die Träume, die Puppen, die Töter, Dunst, Dioxin…
Während sich die Schrift, ausgesetzt und angreifbar, in diesem heimtückischen Muster von Station zu Station bewegt, bestätigt sie den Menschen als Pascalschen Punkt zwischen nichts und allem: das, was ex-sistiert, das, was herausragt und von den Aprikosenbäumen und den Tauben und dem Dunst sich unterscheidet, ein Bündel von Möglichkeiten, ein Hohlraum, der stetig gefüllt werden muß. Wir sind nicht „Natur“ wie die Farne oder die Zikaden. Uns fehlt „der name des narwals für die arktischen meere.“ Wir sind das weltausgesetzte Wesen, dem exponiert, was die Existenzphilosophen „die Unheimlichkeit der Welt“ nennen. Dadurch erhält das akute Krisenbewußtsein in alphabet seinen ganz eigenen Charakter, im Schweben zwischen Hoffnungsprojekt und Eschatologie. Vielleicht bekommen auch deshalb die insistierenden Wiederholungen in alphabet einen so zweideutigen Status: „die aprikosenbäume gibt es… die tage gibt es… die einsamkeit gibt es… die spaltprodukte gibt es… den tatort gibt es… die haut und die häuser gibt es…“. Diese kunstvoll phrenetische Aufzählung und Katalogisierung der Mannigfaltigkeit, die nach und nach die Form einer dunklen Beschwörung annimmt, vorangetrieben durch das Gefühl, daß alles zu entgleiten droht, wird dem genommen, der sieht – und benennt. Gewiß gibt es, in der Sprache wie in der sprachlosen physischen Welt, aber wie lange gibt es, und was ist es, das einzudringen droht, in das, was es gibt, wie in den, der erkennt? Wie lange wird es „sauerstoffwirbel zuinnerst im Styx“ geben?
Das selbstauferlegte System ermöglicht es, solche Fragen zu artikulieren, auf die gleiche Weise, wie das Alphabet Voraussetzung für die Schrift ist. Und manchmal ist das System Agent von eben dem, was der Text zu überschreiten sucht: Versteinerung, Abwesenheit, Kontrolle, Terror einer geradlinigen und durchdefinierten Rationalität. Und von Zynismus, letzten Endes.
In alphabet geht es nicht nur um „die Kolonisierung der Lebenswelt durch das System“, um einen Ausdruck von Habermas zu verwenden. In alphabet ist der Konflikt viel akuter: Systemwelt und Lebenswelt sind miteinander verwoben, und der Text legt eine dunkle gegenseitige Abhängigkeit frei.
In einem Artikel charakterisiert Milan Kundera die Musik von Iannis Xenakis als „einen konstruierten Raum tröstender Objektivität“. Bei Inger Christensen indes wird das Rahmenwerk oder „der objektive Raum“ nie zur tröstenden Instanz. Er ist eine Voraussetzung der Erkenntnis, die ständig problematisiert sein will: ein Raum, der jederzeit zum Gefängnis werden kann. Der Raum der Objektivität wird unaufhaltsam von Zweifel und Unruhe der Subjektivität perforiert, und das Gedicht zeichnet die Grenzfläche, wo diese Durchbrechung stattfindet. Auf die gleiche Weise wie bei Xenakis sind die Relationen bedeutungstragend, und Inger Christensens Text weist eine ähnliche eruptive Energie auf wie die Musik des späten Xenakis, bei der das klingende Resultat aus den objektiven Prozeduren hervorbricht, die das formale Fundament des Kunstwerks sind.
alphabet ist ein Bauwerk mit einem sichtbaren Flügel und mehreren unsichtbaren. Der sichtbare Teil folgt der Fibonacci-Reihe in der Zeilenverteilung bei jedem Buchstaben, wobei jeder Abschnitt gleich der Summe der beiden vorangegangenen ist, bis das Gedicht ein Stück jenseits der Mitte von dem, was der abgeschlossene Text zum Buchstaben n sein sollte, jäh aufhört. In den letzten Strophen taucht eine Schar Kinder auf, die in einer Höhle Schutz suchen, Dort hören sie
… den wind von den abgebrannten
feldern erzählen
doch kinder sind sie nicht
niemand trägt sie mehr
So endet der sichtbare Flügel des Textes. Danach trägt uns keine Stimme mehr. Durch den Aufbau des Systems aber wird ein neuer Text suggeriert, ein phantasmagorischer Flügel, der durch den Rest des Alphabets hindurch expandiert, bis hin zum monströsen Volumen beim Buchstaben å, der allein infolge der Fibonacci-Reihe ein Buch von über 20.000 Seiten füllen würde. Dieser überwältigende, nicht existierende Text folgt dem geschriebenen Text wie ein angsteinflößender Schatten, mit einer handgreiflichen Realität, die das Bewußtsein des Lesenden nicht verlassen wird. Er ist ununterbrochen gegenwärtig, infiltriert die sichtbare Schrift mit seinem unruhigen Pulsieren zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Weil er nicht realisiert ist, lebt er um so stärker, als Utopie wie als ein dunkles Omen. Als „Küstenlinie des Bewußtseins.“
Ich kenne, neben alphabet, nur ein einziges literarisches Werk, dessen Konstruktion sich durch eine entsprechende suggestive Operation über die Grenze der sichtbaren Schrift hinaus erstreckt:
Italo Calvinos Il castello dei destini incrociati, der Roman, der auf deutsch Das Schloß, darin sich Schicksale kreuzen heißt. Er ist ein Triptychon mit zwei sichtbaren Teilen (Das Schloß, darin sich Schicksale kreuzen und Die Taverne, darin sich Schicksale kreuzen, beide auf Muster aufgebaut, die in Sequenzen von Tarotkarten entstehen). Und dann der dritte Teil, der nicht entwickelt ist, lediglich durch eine kurze Bemerkung dem Leser eingepflanzt wird, wie ein Samen, der unverzüglich zu keimen beginnt: die Idee von einem Motel, darin sich Schicksale kreuzen, wo Menschen (in der Gegenwart? in der Zukunft?) nach einer Katastrophe zusammentreffen, stumm vor Schock und Furcht, und nur kommunizieren können, indem sie die Felder eines versengten Comic-Heftes so verschieben, daß sie Muster rudimentären Sinns bilden; eine Erzählung am Ende der Welt, außerhalb der Grenzen des Alphabets, nachdem die Sprache aufgehört hat.
Auch Inger Christensens alphabet erstreckt sich über das Alphabet hinaus, vor O, nach O. Das liegt in der Methode, in der Formel Fibonaccis: Nicht nur, daß sie prinzipiell unendlich ist; sie beruht auch auf der Vorstellung, daß vor jeder Größe immer etwas sein muß. In diesem Schattenland, außerhalb dessen, was wir greifen können, verlieren sich nach allen Seiten Schrift, Sinn, Gedanke. Im Wirbel jenseits des Horizontes von dem, was es gibt, in einem potentiellen Spiel an der Außenseite dessen, was dem Menschen zugänglich ist. alphabet ist die eigentliche Ewigkeitsmaschine im Werk Inger Christensens, ein Text von schwindelerregender Ausdehnung zwischen dem ungreifbar Unendlichen und dem beinah schockierend Nahen,
ein gebet, ein
gewöhnliches gebet, eines
gewöhnlichen tages, daß das
leben auf ganz gewöhnliche
weise fortfahren möge
Dieses einzigartige Buch, dieses große Schweben. Zwischen allem und nichts.
Paal-Helge Haugen, aus: Hermann Wallmann und Norbert Wehr (Hrsg.): Inger Christensen, Hanns Grössel – Preis für Europäische Poesie 1995, Stadt Münster, 1995. Aus dem Norwegischen von Angelika Gundlach.
Die Aprikose
Zwei Hälften, gleiche Hälften, „gleichlige“, verschlossen zu einer Frucht, einem Satz aus zwei gleichen, geschieden nur durch einen Spalt, einen Strich, Beistrich: das ist die Aprikose am Anfang. Anfangend, indem sie ihre Herkunft wie prophezeit so behauptet und wiederholt: „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“ Miteinschließend so, daß es die Aprikosenbäume nicht gibt, während sie in der Pause zwischen den beiden Hälften den Kern zur gegenteiligen Gewißheit trägt, als Stein, fruchtbar, Fruchtbarkeit bergend. Kein Punkt, weder vor dem Anfang noch in sich als Ende, noch am Ende als Abschluß, Umfang: eine in sich offene Frucht. Eröffnend, daß es die Aprikosenbäume gibt, und so das Alphabet der Bäume und Früchte, der Baumfrüchte und der Früchte als der Dinge, die es gibt, unterschiedslos, unterschieden, noch nach der Sprache, die keine Worte hergab für das, was geschah (Paul Celan).
Also hält dieser Anfang die Existenz oder an der Existenz der Aprikosenbäume fest, doch nicht fest, eher fließend, er hält ihre Existenz in Fluß, indem er wiederholt, ist so wiederholend als Wiederholung der Fluß: doch er beharrt doch auch, auf den Aprikosenbäumen, die es gibt, als vergängliche gibt, von Anfang an, von diesem Anfang an, der ihre Vergänglichkeit mitsagt, denn im zweiten Satz ist der erste als Vergangener wiederholt oder erzählt. Und so wird die Welt unvergänglich, ähnlich der Welt der Fresken, welche auf ihre Weise Gegenwärtigkeit und Vergänglichkeit gleichzeitig werden lassen, wenn Geschichte und Vorgeschichte zusammenfallen mit der Gegenwart als Welt oder Bild.
„Welche Welt, denke ich. Aber ich sage es nicht.“ So lautet, stets in der Übersetzung von Hanns Grössel, das Ende der Erzählung aus Mantua von Inger Christensen. Hier birgt der erste Satz einen Ausruf oder eine Frage, doch nur gedacht, ohne Ausruf- oder Fragezeichen, und der zweite Satz wiederholt das Nurgedachte als Nichtgesagtes, so sich nicht empörend, nicht fragend, in der Schwebe belassend, was in der Schwebe ist. Und so sagt der zweite Satz nicht, was der erste Satz nicht sagt und ist dieses Ende ein offenes, ein in sich geschlossen offenes, ähnlich vorläufig und endgültig wie das Ende eines Wachstums in der Form einer Frucht, einer zweiteiligen wie der Aprikose.
So es nicht sagend, doch wissend, hält sich Inger Christensen an die Regeln des Spiels, das die Kinder der Erzählung in einem alten Waschzuber spielen: „Am Fluß unten hatten sie einen alten Waschzuber gefunden und ihn in den Hof hinaufgeschleppt. Dort spielten sie, daß er ein Fahrzeug sei, das sie hinauf auf die Berge oder hinaus ans Meer führte. Auf der Stelle eroberten sie die Welt, und keiner hat sie je dabei ertappt, mit Sehnsucht auf etwas zu warten. Sie wußten, daß sie Menschen waren, und obwohl sie kaum drei oder vier Jahre alt waren, arbeiteten sie jeden Tag von morgens bis abends daran – und zwar weitaus beharrlicher als später in ihrem Leben −, die Welt unsterblich zu machen.“ In denselben Waschzuber pflanzen sie etwa zehn Jahre später einen Apfelsinenbaum, von dem es heißt:
Der Apfelsinenbaum ist immergrün und trägt die ganze Zeit Blüten. Wenn die Blüten gelingen, trägt er ebenfalls die ganze Zeit Früchte. Auf Grund dieser charakteristischen Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stadien im Leben des Baumes ist er immer Symbol für Reinheit und Keuschheit und für Fruchtbarkeit in einem gewesen. Und eben deshalb für die ewige Liebe.
Die Symbolwelt ist hier an die Stelle der Weltreise der Kinder getreten, und es heißt dann bezüglich des Symbols: „Als die praktischen Menschen, die sie waren, begriffen Piero und Nana dieses Geheimnis, sprachen aber nie darüber.“ Und so ist hier das Nichtsagen als Nichtsprechen wieder und wird hier, doch nur zwischen den Zeilen, gesagt, daß das Nichtbegreifen des Symbols und also des Zusammenhangs von Baum und Welt nur das Anliegen unpraktischer Menschen sein kann. So daß wir am Ende der Erzählung in einem großen, runden Theater stehen, unter seinem Himmel im Freien wie im Freien unter dem Himmel des gemalten Zimmers.
Doch kehren wir zurück zu den Aprikosenbäumen, zu alfabet/alphabet, dem Gedicht, wo es heißt:
und die obstbäume gibt es und das obst im obstgarten wo
es die aprikosenbäume gibt, die aprikosenbäume gibt,
in ländern wo die wärme genau die farbe im fleisch
erzeugen wird die aprikosenfrüchte haben
Noch einmal wiederholt sich der Anfang hier, erinnert noch und gegenwärtig, begrenzt von einem Beistrich am Versende, in der Sprache des Originals verändert um diesen Beistrich nur, diese Einschränkung, bevor im nächsten Vers die Sprache die Aprikosenbäume aus der Sprache in Länder trägt, wo sie, noch von den Aprikosenfrüchten sprechend, deren Reife an eine Zukunft verliert. Denn nur der Verlust läßt die Früchte so reifen, so in der Zukunft und bis zu der Dichte der Aprikosenfarbe, die „genau“ genannt Rest noch ist einer erinnerten Gegenwart.
Konkret, also gewachsen oder der Interlinearität entwachsen ist der Verlust dann in einem wilden Aprikosenbaum im ortlosen Irgendwo einer zeitlosen Augenblicklichkeit von Stillstand und Blühen, einem Blühen, das so zart noch gegenwärtig wird:
irgendwo steht ein wilder
aprikosenbaum einen augenblick still und
blüht, doch nur mit einem ganz dünnen
schleier um die ausgebreiteten zweige,
bevor er dennoch fortfährt
Womit fortfährt oder wohin, denke ich, doch das Gedicht sagt es nicht. Es sagt es nur, indem auch es fortfährt, bis es in der Folge heißt:
irgendwo fällt etwas das keiner
angefaßt hat von einem regal herunter,
vielleicht während meine großmutter in ihrer
küche steht wie sie immer gestanden hat
und aprikosengrütze kocht;
ich weiß sie ist tot, doch der duft
ist so stark, daß der leib der ihn
wahrnimmt, selber zur frucht wird; und
während die frucht in den nächsten baum
gehängt wird, der vielleicht eine birke ist die
kätzchen trägt und nie aprikosen,
hört man schon vorher den schuß, früher als
kurz danach, und es klang wie eine
tür ohne haus die noch offensteht
Hier ist zuerst wieder irgendwo, nur daß hier kein wilder Aprikosenbaum mehr steht, sondern etwas fällt herunter, doch nicht mehr in einem Augenblick, doch in einer vermuteten Gleichzeitigkeit mit Gegenwärtigem, das Erinnertes ist und wieder gegenwärtig als das Kochen von Aprikosengrütze. Nur der Tod ist gewiß und zu ihm im Widerspruch der Duft, der „so stark“ genannte, der verwandelnde, den Leib zur Frucht, so daß Wahrnehmung und Metamorphose des Wahrnehmenden hier eins sind. Und in einer nächsten Gleichzeitigkeit führt die Verwandlung weiter in die Entfremdung, den Verlust der Zugehörigkeit von Frucht und Baum, der noch reflektiert wird vor dem Hintergrund einer Konfusion des Zeitlichen beim Versuch, den Zeitpunkt eines Schusses in der Vergangenheit so genau anzugeben wie sein Klang, der verglichen mit dem Zufallen einer Tür durch das Bild des Vergleichs wiederum zukünftig wird, da die Tür noch offensteht. So hebt sich Geschehenes und Ungeschehenes auf zugunsten oder kraft der Sprache, die beides geschehen oder ungeschehen macht, das Geschehene oder den Verlust, das Ungeschehene oder die Erinnerbarkeit.
Dann, wiederum in der Folge, ist die Welt zunehmend verloren, verschließt sie sich in der Form eines artfremden Traums, geträumt von einem Ich, das erzählt, den Traum, den fremden, beiseitegestellten, vergessenen, so erzählt, als ließe sich das Unglück schließlich erzählen, erzählbar oder zum Objekt geworden, objektiv: die Abwendung der Dinge, eines weißen Aprikosenbaums, und sein plötzliches Verschwinden. Und eine Vermutung greift dann zurück auf eine Vorvergangenheit vor der Vergangenheit des Traums, auf einen Sommer, eine weiße Welt, eine festliche vor dem Begreifen der Not oder Pflicht, zu träumen, zuletzt, nach dem Vorbild der Bäume, von Früchten oder: Früchte.
ich schlief in meinem zimmer im hotel
es war wie ein artfremder traum,
den der gast vor mir im schlafe
beiseitegestellt und vergessen haben muß
im traume war keiner den ich kannte,
ich erhielt nur einen forschenden blick
von einem weißen aprikosenbaum der sich
umdrehte, bevor er plötzlich wegging
vielleicht ist er dort vergessen worden in einem sommer,
als die welt weiß war wie ein fest,
und ehe ich begriff daß ein träumer
träumen muß wie die bäume zuletzt
von früchten träumen
Und so, also demgemäß ist das folgende Gedicht eine solche Frucht, ein solcher Traum und zwar von jener weißen Welt vor dem forschenden Blick:
der schnee
ist gar nicht schnee
wenn er mitten
im juni schneit
der schnee ist
gar nicht vom himmel
gefallen
im juni
der schnee ist
selber aufgestiegen
und hat geblüht
im juni
wie äpfel
aprikosen
kastanien
im juni
sich verlaufen
im richtigen schnee
welcher der schnee im juni ist
mit blüten und samen
wenn man nie sterben muß
Lautet der erste Vers des Gedichts: der Schnee, und setzt es dann mit einer Verneinung fort, wenn es sagt, daß der Schnee gar nicht Schnee ist, so bleibt der Schnee doch so bestimmt der Schnee und ist nur unbestimmt nicht Schnee, in jener unbestimmten Weise, in der es schneit, so daß er schneit, noch einmal so bestimmt, mitten im Juni, wie es dann heißt. Und er bleibt auch der Schnee, wenn er gar nicht vom Himmel gefallen ist, wenn er entgegen der Bestimmung, jener unbestimmten von Schnee, selber aufgestiegen ist und geblüht hat wie Äpfel, Aprikosen, Kastanien. Oder er hat geblüht wie Äpfel, Aprikosen, Kastanien sich verlaufen, so heißt es dann, über den Zeilensprung hinweg, und zwar sich verlaufen im richtigen Schnee. Und noch einmal wiederholt das Gedicht seine gegenläufige Bestimmung von dem Schnee, dem richtigen, wie es betont, wenn es ihn bestimmt als jenen, welcher der Schnee im Juni ist mit Blüten und Samen. So ist das Gedicht ein beharrlicher Gegenentwurf und wie versöhnlich fast, so unbeirrbar, denn harmlos ist hier die Verirrung der Dinge, in dieser Juniwelt, wo die Bäume sich im Schnee des Gedichts verlaufen: wenn man nie sterben muß, wie es in einem letzten Vers heißt. Und so ist zuletzt der Juni bestimmt oder bestimmt der Juni die Zeit des Gedichts als eine unendliche Zeit der Unsterblichkeit, und also der Dauer.
Die Beharrlichkeit ist es, die sich im Laufe von alphabet verändert hat. Durchwegs ist die Form der Beharrlichkeit die Wiederholung gewesen, doch in einem sich wandelnden Sinn. Ist sie anfangs eine Verdoppelung der Aussage und also beharrlich gewesen, indem sie zweimal dasselbe gesagt hat, sich so der Welt vergewissernd, ist sie nach dem Verlust dieser Gewißheit zunehmend Wiederholung als Erinnerung, beharrlich im Erinnern gewesen, so daß Gegenwärtiges und Vergangenes sich in ihren Bezügen verwirrt haben bis zur Unlösbarkeit. Im Traum enträtselt sich diese Unlösbarkeit zugunsten der Gewißheit des Verlusts und der Not dann oder Pflicht, diesem Verlust träumend zu begegnen, beharrlich zu sein im Träumen. Das heißt dann, hier, zuletzt, das Bestimmen noch einmal aufzunehmen, bestimmend die Welt zu wiederholen, entgegen den Bestimmungen, den unbestimmten, mit Beharrlichkeit.
So ist dem Anfang von alphabet, der zweiteiligen Frucht oder Aprikose, in der Folge oder alphabetisierend diese Folge als eine Struktur von der Art eines Baumes entwachsen, welcher die Selbstdarstellung der Dichtung in der Dichtung zugunsten einer Neubestimmung der Welt durch die Dichtung verläßt: zugunsten des Traums von Früchten, die den eigenen Anfang wiederholen.
Michael Donhauser, März/April 1992, aus: Hermann Wallmann und Norbert Wehr (Hrsg.): Inger Christensen, Hanns Grössel – Preis für Europäische Poesie 1995, Stadt Münster, 1995. Aus dem Norwegischen von Angelika Gundlach.
Der paradiesische Raum
− Die dänische Schriftstellerin Inger Christensen. −
(Gesprächsessay für das Radio, gesendet im WDR, Köln)
Peter Waterhouse: In Inger Christensen wird eine Stimme laut, die wie schon lange nicht mehr gehört zu sprechen beginnt. Sagen wir, sie spricht ziellos. Sie spricht wie außerhalb der Entwicklung der festen Zeit. Sie lebt in etwas um eine Spur anderem als der Zeit. Sie spricht und lebt in etwas Rundem, Mittelpunktuellem und in einem Frieden. Sie spricht, daß / damit nicht Fortschritt komme, sondern Vereinigungen; die Wörter berühren einander, die Dinge berühren einander. Sprache ist ein Berühren von Lauten und gleicht darin der Welt, die aus zusammenhaltender Berührung geschaffen ist oder aus Vertrauen. Sie fabuliert, das heißt, erfindet, ermöglicht, erträumt; sie fabuliert, sie stellt nicht fest, sondern unterstützt die Schöpfung, sie erfrischt, sie hilft der Welt in ihrem Dasein. Wer sehr klug ist, wird Inger Christensens Sätze vielleicht nicht mehr hören und nicht wollen. Der Anfang des langen Gedichts „Alphabet“ sagt etwas, das alle Klugen – also wir alle – schon wissen und dann seltsamerweise nicht mehr brauchen und vergessen. Der Anfang des Gedichts „Alphabet“ sagt, daß es die Aprikosenbäume gibt. Und wiederholt den Satz sogar. Wenn ich das höre, dann erinnere ich mich an die wirklich wenigen Momente originaler Sprache, die ich fast alle weit weg und vor langer Zeit gehört habe. Weit weg und vor langer Zeit, im Satz von den Aprikosenbäumen strömt es herbei, bahnt sich eine Straße ohne Zeit.
Inger Christensen liest die ersten vier Teile, die ersten vier Gedichte von „Alphabet“. Das erste einzeilige, das 2. zweizeilige, das 3. dreizeilige, das 4. fünfzeilige.
aprikostraeerne findes, abrikostraeerne findes
die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es
bregerne findes; og brombaer, brombaer
og brom findes; og brinten, brinten
die farne gibt es; und brombeeren, brombeeren
und brom gibt es; und den wasserstoff, den wasserstoff
cikaderne findes; cikorie, chrom
og citrontraeer findes; cikaderne findes;
cikaderne, ceder, cypres, cerebellum
die zikaden gibt es; wegwarte, chrom
und zitronenbäume gibt es; die zikaden gibt es;
die zikaden, zeder, zypresse, cerebellum
duerne findes; drommerne, dukkerne
draeberne findes; duerne, duerne;
dis, dioxin og dagene; dagene
findes; dagene doden; og digtene
findes; digtene, da gene, doden
die tauben gibt es; die träumer, die puppen
die töter gibt es; die tauben, die tauben;
dunst, dioxin und die tage; die tage
gibt es; die tage den tod; und die gedichte
gibt es; die gedichte, die tage, den tod
Waterhouse: Wir können sagen: die Sache wächst; man hört sie hier wachsen. Sie wächst an, und das Wachstum ist dabei eine Integration. Die Wachstumskraft ist so: Jeder Gedichtteil des langen „Alphabets“ umfaßt so vieles, genauer gesagt: umfaßt so viele Zeilen wie die zwei vorangegangenen Teile, wenn man sie addiert – wiederholt also den Körper, das Gewicht der zwei vorigen Teile, wiederholt sie und gibt ihnen eine Dauer über sich hinaus. Wenn der zweite Teil des Gedichts zwei Zeilen hat und der dritte Teil drei Zeilen, so wird der folgende Teil sie addieren und vereinigen und überdauern lassen und fünf Zeilen lang sein. Dieser Aufbau entspricht der mathematischen Reihe, die man Fibonacci-Folge nennt, mit ihrer Zahlenfolge 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 undsofort. Fibonacci-Prozesse finden sich in der Natur, in Kristallbildungen, im Geäst der Bäume, in Blumen.
Inger Christensen: Mir ist es ja auch so irgendwie wie ein Wunder, dieser erste Satz. Und damals, als ich angefangen habe, das Gedicht zu schreiben, damals habe ich ja sehr viele Wörter mit A, mit B, mit C undsoweiter das ganze Alphabet hindurch gesammelt, und dann aus dieser ganzen Seite mit Wörtern mit A habe ich dann ein einziges Wort WÄHLEN können. Und warum das dann die Aprikosenbäume waren, weiß ich nicht.
(Pause)
Christensen: Für mich fängt das Gedicht wohl damit an, daß man…, daß man das zweimal sagt. Also einmal die Aprikosenbäume gibt es zu sagen, das ist ja eigentlich nur so, das könnte man wohl sagen, so in alltäglicher Sprache. Aber das zweimal zu sagen, das ist, so auch auf die Sprache, auf die Benennung der Welt aufmerksam zu machen.
(Pause)
Christensen: Und vielleicht ist das ganze Buch auch eine Art Schöpfungsbericht, das nur so mittendrin anfängt, so ganz plötzlich, als ob du eines Morgens durch das Fenster hinausguckst, und dann siehst du dies, das ist die Welt, sie ist erst jetzt, in diesem MOMENT ist sie da, zum ersten Mal eigentlich.
(Pause)
Christensen: Du hast ja die Kastanien, die Akazien, es gibt ja auch…, das ist ja auch aufgrund der Sprache – Aprikosen, da ist sowohl ein A, ein I, ein O schon drin. Und damit…, nicht nur gibt es dann sozusagen eine Vorerinnerung, was die Bäume betrifft, Wald undsoweiter, aber auch so diese Vorerinnerung der Sprache. Die ganze sprachliche Welt ist schon eigentlich drinnen, weil diese Vokale dann ganz stark wirken, und dann, daß es da mit A anfängt – dann kommt ja die Erwartung, es wird sich jetzt etwas hinausfalten oder so, glaub ich.
(Pause)
Christensen: Und warum überhaupt ein Gedicht schreiben, das nur eine Zeile lang ist. Das schreibt man ja auch nur, weil man weiß, daß man damit weitergehen muß. Irgendwie war ja das ganze Fibonacci-System da, eigentlich ein stummes Gedicht über die Welt, das nur so mittlerweile dann zufälligerweise von mir ausgefüllt wird.
(Pause)
Christensen: In der Fibonacci-Reihe, auch weil diese Fibonacci-Reihe mit der Natur verbunden ist. Es gibt Phänomene der Natur, die auch dieser Zahlenreihe folgen. Und deshalb oder auf dieselbe Weise glaube ich, daß wenn du so Wörter zufällig, mehr oder weniger zufällig nacheinander hinaufreihst, dann siehst du irgendwie diesen Zusammenhalt, der schon da war, früher war.
(lange Pause)
(Alphabet, Deutsch von Inger Christensen)
die alphabete gibt es
den regen der alphabete
den regen der rieselt
die gnade das licht
zwischenräume und formen
der sterne der steine
den lauf der flüsse
und die bewegungen des gemüts
die spuren der tiere
ihre straßen und wege
den bau der nester
den trost von menschen
tageslicht in der luft
das zeichen des mäusebussards
das zusammensein der sonne
und des auges in der farbe
die wilde kamille
an den schwellen der häuser
den schneehaufen den wind
die hausecke den sperling
ich schreibe wie der wind
der mit der ruhigen schrift
der wolken schreibt
oder schnell über den himmel
in verschwindenden strichen
wie mit schwalben
ich schreibe wie der wind
der stilisiert monoton
ins wasser schreibt
oder rolle mit dem schweren
alphabet der wellen
ihre schaumfäden
schreibe in die luft
wie die pflanzen schreiben
mit stielen und blättern
oder rund wie mit blumen
in kreisen und büscheln
mit punkten und fäden
ich schreibe wie der strand
einen saum schreibt
aus schaltieren und tang
oder fein wie mit perlmutt
die füße des seesterns
und den schleim der muschel
ich schreibe wie das frühe
frühjahr das das gemeinsame
alphabet der anemonen
der buche des veilchens und
sauerklees schreibt
ich schreibe wie der kindliche
sommer wie donner
über den kuppeln des waldrands
wie weißgold wenn der blitz
und das weizenfeld reifen
ich schreibe wie ein vom tode gezeichneter
herbst schreibt
wie rastlose hoffnungen
wie lichtstürme quer
durch nebelhafte erinnerung
ich schreibe wie der winter
schreibe wie der schnee
und das eis und die kälte
und das dunkel und der tod
schreiben
ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das schweigen des skeletts
und der nägel der zähne
des haars und des schädels
ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das flüstern der hände
der füße der lippen
der haut und des geschlechts
ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
die geräusche der lungen
der muskeln des gesichts
des gehirns und der nerven
ich schreibe wie das herz
das klopft schreibt
das rufen des bluts
und der zellen der gesichte
des weinens und der zunge
Waterhouse: Es ist vielleicht paradox. Wer soetwas sagt: Die Aprikosenbäume gibt es, der sagt zugleich, daß die Welt unbekannt ist. Solche einfachen, klaren Sätze zu sagen heißt, sich in einer unbekannten Landschaft zu bewegen. Nicht festhaltbar, nicht feststellbar, ob es Traum ist oder Nichttraum. Sprechen über ein Wunder. Wunder ist ja selbst ein weitgehend unbekanntes Wort, von dunkler Herkunft. Vielleicht verwandt mit einem alten Wort, welches „verwickelt, verflochten, perplexus“ bedeutet. Wer einfache Dinge sagt, ist perplex. Und wer den einfachsten Satz der Welt sagt, ist in die Komplexität verwickelt.
Es gibt in „Alphabet“ eine Euphorie des Gleichens. Was man sich als abgegrenzt vorgestellt hat, beginnt, gleich zu werden, sich zu mischen und wieder zu leben. Wie eine Durchmischung mit Aprikosen. Oder: Die Welt ist mit Chrom gemischt, mit Brombeeren gemischt, mit Himmeln gemischt, mit Hasen, Gärten, Monden, Haut und Häusern, mit dem licht leuchtenden blauen oder grünlichen Schlafnebel der Hortensie, mit Gifthubschraubern und Hirtentäschel, sie ist wie im Himmel also auch auf Erden, sie ist gemischt mit Juni, Flugzeugen, Judenburg und Jerusalem. In den ersten Aprikosen spürt man schon oder nahezu das dann später genannte Jerusalem kommen. Aprikosen wie Prophezeiungen. Die Euphorie spricht. Man kann das Wort Euphorie auch redefinieren, umbuchstabieren zu: Erinnerung. Es ist klar, daß das euphorische Erinnern eine Bewerbung um Nähe ist, ein Werben um die Dinge, Berührung. Daß alles, auch das Alphabet, offensichtlich nicht abschließbar ist, ist wohl das Grundgefühl des Gedichts, unabschließbar, offen, verwundet, selig, gefährlich, heiter. Es ist da, es geht nicht verloren, es ist ganz fern. Der allerfernste Aprikosenbaum steht aber immer noch im kontinuierlichen Raum der Erinnerung und Euphorie.
In der langen Aufzählung des Gedichts gibt es plötzlich die Atombombe. Erinnert wird da an den Abwurf der Bombe am 6. August 1945 auf Hiroshima und am 9. August auf Nagasaki. Das Gedicht sagt an dieser Stelle nicht, daß es diese Bomben gab, sondern daß es diese beiden gibt. Sie gehören zur Gegenwart, zu jeder Gegenwart, zur Ewigkeit. Es ist eine feine, durchsichtige Ader, über die Vergangenheit und Gegenwart zueinander führen. Die Sprecherin des Gedichts hört in ihrer Küche Wasser rauschen, wie es aus dem Wasserhahn fließt. Jetzt beginnt etwas. Das Wasser übertönt – oder übertönt – fast die lauten Kinder draußen im Hof; die lauten Kinder übertönen fast die zwitschernden Vögel oben in den Bäumen; die zwitschernden Vögel übertönen fast das Geräusch der Blätter im Wind; und das Blättergeflüster übertönt fast mit seiner feinen Akustik den Himmel und das Licht des Himmels, das jetzt in dieser fast mathematischen Reihe des Feinwerdens, Weich- und Wach werdens, der Schmelze der Grenzen, einem anderen Licht ähnlich ist, dem Feuer der Atombombe über Japan. In diesem Raumerlebnis, in diesem akustischen Raum wird die Zeit und ihre scheinbare Chronologie überbrückt. Genauer gesagt: Die Zeit wird übertönt. Es ist klar: Die Kinder, wie sie rufen, übertönen die Zeit. Die Vögel, wie sie singen, übertönen die Zeit. Und das Rauschen der Blätter im Baum überrauscht die Zeit. −
Hanns Grössel, der Übersetzer von Inger Christensen, liest aus „Alphabet“ den nächsten Teil:
die liebe gibt es, die liebe gibt es
so selbstvergessen deine hand in meine geschmiegt wie
ein junges, und der tod unmöglich zu erinnern,
unmöglich zu erinnern wie ein unverlierbares
leben, so leicht wie mit einer chemischen bewegung
über kammgras und felstauben hin, alles,
verloren geht verschwindet, unmöglich zu erinnern daß
scharen die es hier und da gibt von entwurzelten
menschen, haustieren und hunden verschwinden;
tomaten, oliven verschwinden, die bräunlichen
fraun, die sie ernten, welken verschwinden,
während der erdboden vor übelkeit stäubt, ein pulver
aus blättern und beeren, und die blüten knospen des kapernbuschs
niemals gesammelt, in salz eingelegt
und gegessen werden; doch bevor sie verschwinden, bevor wir
verschwinden, eines abends wenn wir zu tisch sitzen mit
etwas brot, ein paar fischen ohne geschwüre und wasser,
das mit schläue zu wasser verwandelt ist, verläuft
einer der tausend historischen kriegspfade plötzlich
quer durch das zimmer, du stehst auf, die grenzen,
die grenzen gibt es, die straßen, das vergessen
überall, doch dein versteck kommt nicht näher,
schau, der mond ist allzu stark beleuchtet und der Große Wagen
fährt zurück so leer wie er gekommen ist; die toten
wollen getragen werden, die kranken wollen getragen werden,
die erschöpften bleichen soldaten, die Narziß ähneln, wollen
getragen werden, du wanderst so sonderbar ewig
umher, und nur wenn sie sterben, machst du halt
in einem kohlgarten den mehrere jahrhunderte hindurch
keiner in ordnung gehalten hat, lauschst dich zu einer ausgetrockneten
quelle hin irgendwo in Karelien vielleicht, und während
du an wörter denkst wie chromosomen, chimären
und an den mißratenen wuchs der liebesfrüchte
machst du etwas rinde von einem baum ab und ißt sie
(Pause)
das erz im erzgebirge gibt es, das dunkel
in den stollen der gruben und die milch die in den brüsten
der mütter stockt, eine eingewurzelte angst wo
es das flüstern gibt, das flüstern gibt
das älteste und zärtlichste mitwissen der zellen
betrachte diesen markt, betrachte diesen import
export von vätern, die hälfte büttel
die hälfte gequälte soldaten, betrachte
ihr stammloses letztes verschwinden, metall
gegen metall, während die menge an nicht angebautem mais
zunimmt und der mangel an trinkwasser zunimmt
sprich bald von milde, sprich bald vom mysterium
des salzes, sprich bald von vermittlung, menschen,
mut; erzähl mir daß man den marmor der banken
essen kann, erzähl mir daß der mond schön ist,
daß der moa ausgestorben von der grünen melone
frißt, daß die munterkeit gedeiht, es sie gibt,
daß es das moostierchen gibt, den makrelenschwarm gibt,
methoden für verzicht, für abstieg gibt,
physische verteilung wie in gedichten von unvergleichlichen
erdgütern gibt, mitleid gibt
(lange Pause)
Christensen: Ich habe aber einmal von meinem Sohn, als er fünf Jahre alt war, eine Antwort irgendeiner Art bekommen. Er hat plötzlich gesagt, als wir die Straße entlang gegangen sind, daß wir vielleicht ein Traum der Dinosaurier wären, nicht wahr. Also dieses, daß die Welt sowohl ein Traum als auch real da ist, daß wir ganz real hier gehen, aber dennoch irgendwie in einem Traum da leben. Das ist wohl so genau. Aber die Antwort muß von einem Kind kommen, glaub ich.
(Pause)
Christensen: Daß es das schon alles gab, wenn da nichts war. Also so, man sagt Aprikosenbäume und dann sagt man es noch einmal, und da in dieser kleinen Verdoppelung, da gibt es schon dieses Wachstum, daß alles in diesem Kern da ist. Und alles kann eigentlich drin sein, dies ist nur ein Beispiel was draus gemacht werden könnte, es könnte ein ganz anderes Gedicht sein.
Waterhouse: Ein Wort zur Übersetzung. Das Gedicht sammelt in seinen Abschnitten Dinge mit jeweils gemeinsamen Anfangsbuchstaben: der erste Abschnitt Dinge mit A; der zweite Abschnitt Dinge mit B wie Brombeeren und Brom. Die Übersetzung Hanns Grössels ist aber in der Lage, dieses Gesetz wiederzugeben, obgleich manchmal die übersetzten Wörter im Deutschen einen anderen Anfangsbuchstaben haben. Was für eine gute Übersetzung ist das, die ein C wiedergeben möchte, aber Wegwarte übersetzt, also C in W übersetzt – und doch ist das C oder zz da, es ist in den Zikaden da und in den Zitronen. Die deutsche Übersetzung deutet an, daß im Abschnitt C vielleicht alle anderen Buchstaben Platz haben, eine Gemeinschaft bilden könnten, ohne Gezwungenheit, durch Erweichung der Grenzen.
Christensen: Ich habe das eigentlich niemals als einen Gewinn gesehen. Es gibt ja dieses Problem zum Beispiel, das auf Dänisch mit B heißt es brint, auf Deutsch wie heißt das, Wasserstoff. Und in allen Sprachen heißt das etwas Verschiedenes, und die Übersetzung, auch der französische Übersetzer, der schwedische, die haben dann…, zuerst haben sie…, da wollten sie nicht weiter übersetzen, die wollten ein anderes Wort finden, aber das geht ja nicht, weil wenn der Wasserstoff nicht schon da genannt wird, dann wird das Gedicht auch nicht weitergehen. Dann später gibts ja Gedichte über Wasserstoff. Und dann kann ja nicht ganz plötzlich eine Biene da auftreten oder so was. Aber es freut mich, daß du sagst, daß alle Wörter mit anderen Buchstaben, die können eigentlich auch unter B hineingehen.
Vielleicht ist es auch, weil du das Buch so viele Male gelesen hast, sann siehst du das alles so eigentlich schon da in diesem Aprikosenbaum. Und dann ist es egal, ob plötzlich mit B eine Wegwarte da ist.
(Pause)
hier stehe ich denn an der Barentsee
da liegt also die Barentsee
es sieht so aus als wäre die Barentsee
immer alleine mit der Barentsee
doch jenseits hinter der Barentsse
schlägt das wasser gegen Spitzberger
und gleich hinter Spitzberger
treibt das eis umher im Eismeer
und gleich hinterm Eismeer
sitzt das eis fest auf dem Nordpol
und gleich hinterm Nordpol
sieht es so aus als wäre die Beaufortsse
ganz alleine mit der Beaufortsee
doch jenseits hinter der Beaufortsee
sieht es so aus als hätte Alaska
immer nur Alaska
gesehn doch hinter Alaska
liegt dann endlich der Stille Ozean
es sieht so aus als wäre der Stille Ozean
immer alleine mit dem Stillen Ozean
doch jenseits hinter dem Stillen Ozean
treibt das eis umher im Eismeer
und gleich hinterm Eismeer
sitz das eis fest auf dem Südpol
und gleich hinterm Südpol
ist wieder wasser im Südpolarmeer
und gleich hinterm Südpolarmeer
schlägt das wasser gegen Afrika
und gleich hinter Afrika
wieder etwas wasser im Mittelmeer
und gleich hinterm Mittelmeer
sieht es so aus als wäre die Türkei
ganz alleine mit der Türkei
doch jenseits hinter der Türkei
ist wieder wasser im Schwarzen Meer
und gleich hinterm Schwarzen Meer
sieht es so aus als wäre Rumänien
immer alleine mit Rumänien
doch gleich hinter Rumänien
liegt dann die Sowjetunion
es sieht so aus als wäre die Sowjetunion
ganz alleine mit der Sowjetunion
doch gleich hinter der Sowjetunion
liegt also Finnland
und sieht so aus als wäre Finnland
ganz alleine bloß Finnland
doch jenseits hinter Finnland
liegt also die Finnmark
und gleich hinter der Finnmark
liegt also die Barentsee
eben und verchromt
unter der lichtkuppel
hier stehe ich denn an der Barentsee
ganz alleine an der Barentsee
abend den 24. juni
(Pause)
Christensen: Es gibt ja auch also so…, es ist ja, weil das Gedicht eigentlich, wie du auch gesagt hast, in Ewigkeit eingebettet ist, nicht wahr. Der Zeitraum, worum es sich handelt, ist so weit, so groß, daß dann alles gleichwertig von diesem Gesichtspunkt heraus gesehen wird, nicht wahr. Oder man fühlt das. Es wird schon vielleicht mit der Menschheit gehen, obwohl es auch diese Wasserstoffbombe undsoweiter gibt. Es gibt ja also unendliche Möglichkeiten, Frieden irgendwie. Aber es gibt ja auch drin ein…, weil man hört ja auch, daß das geschrieben ist von einem Menschen, nicht von einem Aprikosenbaum. Das heißt, daß es auch eine Trauer gibt, einen also irgendwie Versuch, diese Trauer zu überwinden. Das Überwinden ist aber ja nicht so mit, ganz plötzlich mit irgendeinem Satz getan. Es liegt, es liegt, glaub ich, mehr in diesem Begriff, daß es dennoch drin hat auch diesen Frieden, woraus man sich vielleicht Kräfte holen könnte für das, für das Weitergehen.
(…)
Waterhouse: Das Werk Inger Christensens ist erfüllt von Echos, das heißt erfüllt von Bündnissen, das heißt erfüllt von Wiedergeburten. Kein Satz, kein Bild ist bei sich selbst, alle verbinden sich mit fernen Passagen im Text. Alles lebt in anderem mit. Alles scheint darum unsterblich. Es spricht ein Echo-Ich, ein Bündnis-Ich, ein wiedergeborenes Ich, das aus allen Menschen und Materien sich zusammenfügt. Hier sprechen labyrinthisch und paradiesisch auf einmal alle und verlischt, was man bisher als Grenzen gesehen hat. Es spricht die Vermählung, der paradiesische Raum:
Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten,
wie Farbenstaub vom warmen Körper der Erde,
Zinnober, Ocker, Gold und Phosphorgelb,
ein Schwarm von chemischem Grundstoff hochgehoben.
Ist dieses Flügelflimmern nur eine Schar
von Lichtpartikeln in einem Gesicht der Einbildung?
Ist es die geträumte Sommerstunde meiner Kindheit,
zersplittert wie in zeitverschobenen Blitzen?
Nein, es ist der Engel des Lichts, der sich selbst
als schwarzen Apollo mnemosyne malen kann,
als Feuervogel, Pappelvogel und Schwalbenschwanz.
Mit meiner umschleierten Vernunft sehe ich sie
wie leichte Federn im Pfühl des Hitzedunstes
in der mittagsheißen Luft des Brajcinotals.
De stiger op, planetens sommerfugle
som farvestov fra jordens varme krop,
zinnober, okker, guld og fosforgule,
en svaerm af kemisk grundstof loftet op.
Er dette vingeflimmer kun en stime
af Iyspartikler i et indbildt syn?
Er det min barndoms dromte sommertime
splintret som i tidsforskudte lyn?
Nej, det er lysets engel, som kan male
sig selv som sort Apollo mnemosyne,
som ildfugl, poppelfugl og svalehale,
Jeg ser dem med min slorede fornuft
som lette fjer i varmedisens dyne
i Brajcinodalens middagshede luft.
manuskripte, Heft 135, 1997
Offenbarer Ort
− Rede anläßlich der Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Europäische Literatur an Inger Christensen. −
Inger Christensen hat das Langgedicht „alphabet“ geschrieben, das ganz viele Sachen der Welt in alphabetischer Reihenfolge aufzählt, von den Aprikosenbäumen und dem Brom und den Zikaden und dem Eis und dem Flüstern bis zu den Namen und Nächten, Nachtkerzen und Nelken. Es gibt in dem Gedicht, wie es aufzählt und aufzählt – alles was jeder kennt aufzählt −, eine große Schönheit da, und wiewohl kaum überraschende Sachen genannt werden, ist alles überraschend. Schon die erste Zeile des Gedichts, die nichts Überraschendes sagt, ist eine Überraschung. Sie nennt das Gegebensein der Aprikosenbäume, und ich glaube, es ist auf einmal überraschend, daß es die Aprikosenbäume gibt. Schönheit und Überraschung der ersten Gedichtzeile kommen zum Teil daher, daß gar kein Aprikosenbaum da ist, aber die Gedichtzeile ihn in die Erinnerung ruft, dabei aufweckt, verlebendigt. Fast auch ist er ein Freund, den man zu lange vergessen hat, eine Güte, die man vergessen hat, eine gute Nahrung, sogar eine vergessene Rettung. Und sogar ein Teil von einem selbst, vielleicht sogar die eigene Seele – ach, die Aprikosenbäume, ja, meine Augen und meine Berührungen mit der Hand.
Ich lese Ihnen diesen Anfang des Alphabet-Gedichts vor −
die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es
die farne gibt es; und brombeeren, brombeeren
und brom gibt es; und den wasserstoff, den wasserstoff
die zikaden gibt es; wegwarte, chrom
und zitronenbäume gibt es; die zikaden gibt es;
die zikaden, zeder, zypresse, cerebellum
die tauben gibt es; die träumer, die puppen
die töter gibt es; die tauben, die tauben;
dunst, dioxin und die tage; die tage
gibt es; die tage den tod; und die gedichte
gibt es; die gedichte, die tage, den tod
Eine weitere Überraschung in diesem selbstverständlichen Feld: Das Gedicht geht alphabetisch voran – in der deutschen Übersetzung nicht ebenso streng wie im dänischen Original −, doch innerhalb des alphabetischen Progresses erscheinen die Wiederholungen. Die Zikaden unter dem Buchstaben oder Laut C, sind nicht bloß einmal aufgezählt, sondern dreimal. Oder daß es die Aprikosenbäume gibt, wird am Gedichtanfang nicht nur einmal gesagt, sondern gleich darauf wiederholt. Wenn man dieses Wiederholen in unser Schulalphabet übersetzte, dann lautete es wie: AA BB BB C C C DA DD EE E BF FF. Warum lernen wir als Kinder ein so karg-chronometrisches Alphabet? Das zweifache A, die zweifachen Aprikosen, obgleich sie scheinbar alphabetisch dastehen, sind doch a-alphabetisch, nämlich eine Gegenpartitur zur Ordnung der Chronologie. Daß die Zikaden schon bald nach ihrer ersten Nennung wiedergenannt sind, eröffnet eine andere Ordnung als die des Fortschritts. In den Wiederholungen schlägt das Gedicht vor, daß es etwas anderes gibt als den zeitlichen Verlauf, nämlich daß unter oder hinter oder in diesem Verlauf eine Musik gemacht wird, ein musikalischer oder musischer Raum, ein Raum der Muße und Erlaubnis, ein Intervall, fast eine Art Nichts, und dieser Raum aus Gegenwärtigkeit gemacht ist. Es ist, glaube ich, die Lust an diesem anderen Raum, die schon aus der ersten Zeile des Gedichts ausstrahlt – als Schönheit – auf den, der liest. „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“, da ist Gespür für das Vergehen des Satzes und ein Wissen, daß er doch nicht vergeht, sondern – wie in der Wiederholung – in eine musikalische Gegenwart eintritt. Oder das Gedicht teilt überhaupt das Wissen mit, daß nichts abläuft, sondern in einen Raum zusammenfließt.
Dieser Raum des Zusammenflusses, oder Raum der Vereinigung, wird immer dann wahrnehmbar, wenn die Dinge fort sind. Er wird also beispielsweise im Sprechen immer spürbar, weil das Sprechen ein bißchen getrennt ist von den Dingen. Der musikalische Raum wird wahrnehmbar oder öffnet sich, wenn der Satz von den Aprikosen ausgesprochen ist und beendet und irgendwie weg ist, und seine Wiederholung tritt den Beweis des Raums an. Wenn der Zikadensatz fort ist, beginnt ein Gespür für sein Fortsein und die Lust an der Wiederholung. Aber es gibt auch größere Verluste, fernere und mehr angstmachende. Das Damals des August 1945 in den Städten Hiroshima und Nagasaki ist ein solcher Korpus aus Abwesenheit und Vernichtung, der sich bemerkbar macht und ein Aufwiegen verlangt und eine Musik der Verlebendigung auslösen kann. „die atombombe gibt es“ sagt das Gedicht an dieser furchtbaren Stelle. Was kann das Gedicht aber wiederholen? Welchen Raum kann es aufspüren? Es sucht wieder nach dem Indiz, daß das Vergangene nicht vergangen ist, sondern sich bezeugt. Wie bezeugt sich dieses Vergangene oder mit welchem Alphabet macht es sich bemerkbar? Es macht sich bemerkbar mit fünf verschiedenen Alphabeten: zunächst mit dem Alphabet des rauschenden Wassers, das aus dem Wasserhahn in einer Küche fließt – in diesem Rauschen sind draußen im Hof die Kinder hörbar, welche rufen; wie wenn das Alphabet des Wasserrauschens erzählte von dem Rufen der Kinder; im Alphabet der Kinderrufe draußen sind hörbar die zwitschernden Vögel – wie fast wenn diese Rufe den Vöeln gelten würden; im Alphabet dann der zwitschernden und singenden Vögel bleibt oder wird hörbar das leisere Flüstern der Blätter im Wind; und im Flüsteralphabet der Blätter ist hörbar das leise Alphabet des Himmels, und dieser Himmel mit seinem Leuchten buchstabiert und erzählt, daß er ganz hell ist und so hell wie das Licht jener furchtbaren Feuer am 6. und 9. August.
Noch einmal die Aprikosenbäume: Der Satz von diesen Obstbäumen erinnert wie an einen zu lange vergessenen Freund. Aber da ist noch etwas: die Frage nach dem Alphabet, nach dem der Gedichtband seinen Titel hat. Welches Alphabet wird buchstabiert? Das lateinische literarische Alphabet ABCDE steht nirgendwo im Gedicht. Welches Alphabet also? Mögliche Antwort: Die Aprikosenbäume sind ein Alphabet, die Brombeeren sind ein Alphabet, die Erinnerungen, die Einzelheiten, die Luft, die Leidenschaften, der Lotus. Das Buch also ein Verzeichnis von Alphabeten; ein Alphabet der Alphabete. „die aprikosenbäume gibt es“, das ist auch soviel wie: die Buchstaben, die Schriften der Aprikosenbäume gibt es – wie es im Wort Aprikosenbäume A und I und O und E und U gibt und einen Wald von Konsonanten. Hier am Beginn des Gedichts sind unter der Ordnung des A, wie in einem Lexikon, die Aprikosenbäume verzeichnet, aber schon sieht man, daß hinter diesem Anfangs-A alle anderen Vokale und die Konsonanten Platz haben, ihren Platz haben im A-Alphabet. Die Schönheit des Gedichts liegt auch in der Zurückholung der vergessenen Alphabete der Welt und darin, daß diese Alphabete lesbar sind. Lauter Alphabete, sie sprechen durcheinander, sie verwirren, das heißt auch, sie entchronologisieren dich, das ist das Beste, was dir passieren kann. Denn verwirren heißt: immerfort kehren die Buchstaben wieder, mit Lust. Verwirren heißt: wir sprechen eine Vielzahl von Alphabeten. Wir beginnen ein Wort mit A, und in dieses schießen Konsonanten und Vokale ein, wie um die Gleichzeitigkeit zu beweisen und die Zurückholbarkeit. Jeder spricht so, wie um an einen Raum anderer Ordnung zu erinnern; die Sprache ist geradezu dieser Raum anderer Ordnung, ein musikalischer Raum, Raum der Musen, die ja die Einflüsterer der Gleichzeitigkeit sind. Wer spricht, spricht immer mit den Musen. So wird klar, daß das Sprechen und die Sprache ein Glück sind.
eigentlich war es erst
aaaim hafen von Berlevåg
aaaaaawo die möwen in der kälte
aaaaaaaaaim juni wüten
daß die abwesenheit der tauben
aaaihr ausgebliebenes
aaaaaagrundloses plaudern
aaaaaaaaamich in etwas versetzte
das nicht verwunderung war
aaasondern ganz gewöhnliche
aaaaaaalltägliche offenheit
aaaaaaaaafast frömmigkeit
als läge in der welt
aaaein großartiges sonnenklares feld
aaaaaaaus zentimeterkleinen schritten
aaaaaaaaaauf weinroten füßen
ein ständig verliebtes
aaaund kompliziertes aufspüren
aaaaaavon nahrung und verlangen
aaaaaaaaain der höhle des tageslichts
ein gemurmel von lust darauf
aaasekunde um sekunde
aaaaaaseinem tode zu entgehn
aaaaaaaaaund anwesenheit mitzuteilen
mir ging auf daß das bedichten
aaavon tauben im regen
aaaaaain einem ei anfangen muß
aaaaaaaaain einem schwindelerregenden tropfen
mit daunen anfangen muß
aaamit dem sammeln der tropfen
aaaaaamit feder um feder
aaaaaain einer gesuchten zeichnung
mit gräulichen bräunlichen
aaaweißlichen bläulichen
aaaaaaunberührten farben
aaaaaaaaaund wasserschichten in der luft
mit einem herzen irgendwo
aaamit lungen so fein
aaaaaawie farne aus sauerstoff
aaaaaaaaaund mit dem gespinst der wolken
mit einer abwesenheit und sofort
aaamit einem gleichzeitigen durst
aaaaaanach dem glück von menschen
aaaaaaaaamit sämtlichen möglichen/wörtern
Die Rekonstruktion der Taube, vielleicht ist das auch die Rekonstruktion und Realphabetisierung des Friedens, der nicht der Vater aller Dinge ist, ein zum Zusammenschuß-Bringen des Friedens: das ist eine aus Farben gefiederte Figur, eine vielleicht im Hals-Schilch der Taube zeichengebende zittrige paradiesisch-parataktische mögliche Sache, sein Herz heißt Irgendwo, die Feinheit seiner Lungen braucht als Vergleichsmöglichkeit die Feinheit der Farne und das Chlorophyll der Farne für das Schöpfen der Atemluft, er hält sich auf in einem anderen Raum voll Lust auf Glück.
Das ist der Augenblick, über Inger Christensens Erzählung Das gemalte Zimmer zu sprechen. Auch die Erzählung gibt Nachricht von dem Raum der anderen Ordnung, dem nicht-chronischen Raum. Derjenige, der das beste Wissen von diesem Raum hat, ist der italienische Maler Andrea Mantegna. Der Fürst von Mantua, Lodovico Gonzaga, lädt den Maler Mantegna ein, mit seiner Familie am Hof Wohnung zu nehmen und zu arbeiten. Er bezahlt ihn fürstlich oder staatspreislich dafür, bezahlt ihn eigentlich grenzenlos, wie um den Maler zu bestätigen in seinem Durchbrechen der Diachronie. Vor allem soll Mantegna das „gemalte Zimmer“ schaffen, das fürstliche Ehegemach im Palast ausschmücken mit Fresken.
Der andere Raum bekundet sich auch darin, daß die Grenzen einer Person undeutlich werden. Die Erzählung ist voller Personen und Namen, aber im Lesen entsteht von Anfang an eine Aufmerksamkeit dafür, daß sie zwar da-existent sind, sie jenseits aber in eins zusammengefaßt werden könnten, in etwas Dort-Sistentes oder Re-Sistentes, wie unter einem einzigen Namen versammelt, wie unter dem Namen Bleiben oder Dauer oder Bewahrheiten oder mantenere oder Mantegna oder Mantua.
Die Erzählung beginnt in der Tagebuchform, es ist das Tagebuch des fürstlichen Sekretärs, der Marsilio Andreasi heißt. Bald nachdem man diesen Namen des Sekretärs gelesen hat, entwickelt sich in dieser Buchstabenfolge eine Virulenz. Der Name ist wie eine unvollkommene Wiederholung des Namens Andrea Mantegna. Gut, aber der fürstliche Sekretär ist kein Freund Mantegnas, vielmehr schildert der Tagebuchschreiber den Maler als seinen Feind, als den, den er wirklich haßt, er beschreibt ihn als hochmütig, brutal, als einen Populisten in der Kunst, als Krawallmacher. Zudem heiratet Mantegna jene Frau, in die der Sekretär Andreasi verliebt ist. Das ist die Ordnung des Konflikts oder der Aktualität. Der Staatsmann Gonzaga aber hat Mantegna eingeladen im, glaube ich, Wissen darum, daß die Kunst in oder hinter der Ordnung des Konflikts und der Helden und der Apotheosen eine Lösung errät. Er fördert den Künstler, der eine Möglichkeit des Friedens enträtseln kann.
Der Sekretär, in Haß und aktueller Verzweiflung, tötet die geliebte Frau. Zwei Monate nach diesem Tod eine Bitte Mantegnas, die der Sekretär in seinem Tagebuch vermerkt −
Etwas Unerklärliches ist heute geschehen.
Mantegna lud mich ein, seine Bilder zu sehen, und, mir selbst unerwartet, sagte ich zu.
Machte ich mir etwas aus ihm, so würde ich sagen, daß es ein gelungener Besuch war. Eine ruhige Unverständlichkeit ist um ihn, die sehr herausfordernd wirkt. Die Eingebung ließ mich denn auch, ganz ausnahmsweise, Höflichkeit und Wahrheit auf eine lebhaft fördernde Weise kombinieren. Aber dieses ganze physische Spiel wird mir nie verhehlen können, daß ich seine Bilder äußerst fremdartig finde. Bei näherem Nachdenken eher widerlich. Obwohl Ekel normalerweise nichts ist, was Nachdenken erfordert.
Seine Besessenheit, seine Effekte, seine Transpositionen sind fundamental anti-klassisch, und er dehnt die Logik so weit, daß die logische Konstruktion zusammenbricht und wegbröckelt wie Illusionen. „In der Erzählung des Bildes darf keine Einsamkeit sein“, sagte er etliche Male.
Während eines anderen Besuchs bewegen sich Maler und Sekretär auf eine Zone zu, die in der Erzählung einmal als „psychologische Raumforschung“ bestimmt wird und einmal als „Staat“. Beides, die Raumforschung und der Staat, sind Phänomene der Undeutlichkeit oder Defokussierung, wie wenn man eine Sache nicht ganz gut identifizieren kann, sich über ihren Namen oder ihre Bezeichnung im Unklaren ist, alles überhaupt den Namen verliert und man, vielleicht wie im Gedicht vom Alphabet, ein bißchen gleich wird den Aprikosen und Dingen und gleich wird mit einer Sache, die gar nicht da ist. Andrea Mantegna und Marsilio Andreasi sitzen, jetzt schon in Vertrauen, beisammen und spekulieren darüber „wie der einzelne sich in den anderen findet (sich mit den anderen abfindet) und die anderen in sich wiederfindet und diese ständige künstlerische Bewegung den Staat nennt.“ „Wenn der Staat ein Kunstwerk sein kann“, sagt Mantegna, „dann kann das Kunstwerk wohl auch ein Staat sein.“ „Und der Staat brauchte kein Unglück mehr zu sein, wenn nur alle seine Mitglieder all seinen Mitgliedern unterworfen wären – nicht so, daß der einzelne dem Urteil der Mehrheit unterworfen wäre, sondern so, daß alle, jeder für sich als Einzelperson, das einzelne Verbrechen auf sich nehmen müßte, ganz gleich, in welcher Person dieses Verbrechen zum Ausdruck gekommen wäre.“ Was Mantegna hier anspricht in der Erzählung, ist die Vorstellung eines moralischen Kontinuums, das ganz anders als das Gebietende im kategorischen Imperativ – der zu einer Art Imperium der Kategorien gehört – ein akategorielles Empfangen und Gleichsein aufleuchten läßt. Subjekt/Unterwerfung anstelle von Imperium, heißt das. Am Ende seines Tagebuchs tritt für den Sekretär Marsilio Andreasi das Erlebnis der Gleichung ein, und er schreibt −
1506 13. September Andrea Mantegna ist gestorben.
Ich sitze neben dem Bett und verstehe nichts. Nie, auch als Kind nicht, habe ich eine so fröhliche und freie Liebe empfunden.
Als ich ihm vor einer Weile erzählte, daß ich Nicolosia umgebracht hätte, antwortete er nur, das habe er die ganze Zeit gewußt. Er habe gemeint, das Beste, was er in seiner Trauer tun könne, sei, sich direkt an mich zu wenden und mich in seiner Nähe zu behalten, weil der Zufall mich mit seiner Person verbunden habe.
Mit dieser Tagebucheintragung endet der erste Teil der Erzählung vom gemalten Zimmer. Was folgt, ist fast wie der doppelte Beginn von „alphabet“: „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenhäume gibt es“. Im zweiten Teil der Erzählung vom gemalten Zimmer erscheint derselbe Zeitraum wieder, den schon das Tagebuch des Staatssekretärs umfaßt hat. Es wird dann klar, daß die Bewegung der Erzählung nicht Progress ist, sondern eine einwärts drehende Spirale, ein Wirbelsturm, der nicht zu einem Ende führt, sondern zu einem Mittelpunkt oder genauer: zu einer Art von Anfangspunkt oder zur innersten Zelle des Tempels: zur Anfangszeit (oder ich weiß nicht, wie die Sache heißt). Weil vielleicht die Anfangszeit der Ort des Friedens ist.
Die Erzählung ist erfüllt von Anfangsaugenblicken, und es scheint vor allem Mantegnas Wunsch zu sein, in der Bemalung des Zimmers für die Eheleute, für also die in Liebe Verbundenen, die Anfangszeit festhalten zu können. Anfangszeit. Zu Beginn der Erzählung notiert der Staatssekretär in seinem Tagebuch, wie es mit seinen GefühIen steht, wenige Wochen nach der Hochzeit zwischen Mantegna und der von beiden Männern umworbenen Frau. Da steht im Tagebuch das selbstbeschreibende Wort vom „Engel im Feuer der irdischen Gefühle“. Sechs Jahre später steht im Tagebuch dieselbe Selbstbeschreibung, nach einem Blick auf die geliebte Frau: „… ich fror. Ein Engel im Feuer der irdischen Gefühle.“ Im zweiten Teil der Erzählung findet eine junge Frau in einem Buch mit dem Titel „De duobus amantibus historia“ „ein knappes Dutzend zusammengefalteter Manuskripte von Gedichten“. Es ist ein Buch, welches ihr geschenkt wurde zu ihrer Hochzeit, von einer Unbekannten. Geschrieben hat das Buch der Vater des Ehemanns, der, wie sich in der noch anfänglicheren Anfangszeit herausstellen wird, auch ihr eigener Vater ist. „Eines dieser Gedichte handelte von dem Engel im Feuer der irdischen Gefühle; von einem Engel, der mit so weißem Licht brennt, daß aus dem Brand kaum Asche entsteht und deshalb auch keine eigentliche Fruchtbarkeit für Felder und Mitmenschen, vielleicht aber für die unsichtbaren Gewächse im Himmelsgarten, die, wie vermutet werden muß, eine Ewigkeit auf eine endliche Klärung der Frage nach ihrer Bildwirkung gewartet haben.“ Die anfänglichen Gefühle des Tagebuchschreibers sind hier plötzlich im Wortlaut wiederholt und in eine anfängliche Textur gewebt. Die Erzählung durchschlägt hier ihren zeitlichen Körper und wirft Licht auf Anfängliches hinunter; und tut solches wieder und wieder. Aber der Engel wird dann ebenso wiederholt, das heißt mit seinem Anfang konfrontiert. Der Tagebuchschreiber notierte am 23. Mai 1468: „Die Pfauen sind gekommen.“ Der zweite Teil der Erzählung notiert: „Gerade als Nana [die junge Frau] geschmückt wurde [für die Hochzeit], kamen die Pfauen.“ Und notiert dann weiter: daß dieser Tag der Ankunft der Pfauen der Tag der Engel wurde. Es ist deutlich: Die Erzählung geht nicht vorwärts, sondern einwärts, doch nicht einwärts im Sinne von seelischer oder dramatischer oder traumatischer Vertiefung, nicht einwärts im Sinn von Gedankentiefe und Sittenbild und tragischer oder erzählerischer Meisterschaft, sondern sie geht zeiteinwärts. Tut vielleicht nur eine einzige Sache: zeigt die Anfangszeit – die Zeit „ohne daß tag und nacht bestimmt / plaziert sind, ohne daß nadir und zenit senkrecht / darunter oder darüber sind“ und wo „weder siege noch / niederlagen da sind, nur von nichts der trost“.
So kann man sagen, daß diese Erzählung nichts verkündigt, aber offenbart. Das ist ein großer Unterschied. Offenbaren heißt: einen Pfeil schicken gegen die Zeitrechnung und Realisierung zum Anfang und alles mit dem Anfang deckungsgleich oder zeitgleich machen können. „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“, der zweite Satz ist deckungsgleich mit dem ersten; der zweite leuchtet aus der Anfänglichkeit des ersten; er bestätigt die Kindlichkeit und Fülle des ersten. Im Essaybuch Teil des Labyrinths schreibt Inger Christensen über diese Anfangszeit:
wir werden mit einem Wissen von der Welt geboren, einem ganzen und unteilbaren Wiedererkennen, einer Disposition für die Welt. Im selben Augenblick, da wir die Augen aufschlagen, ist die Welt in ihrer ganzen Realität anwesend. Hier beginne ich, mich zu entrealisieren. Mit meiner besonderen Disposition (meinen Anlagen, die das sind, womit ich mich an andere wende) erkenne ich die Welt auf einmal wieder, wie sie ist und unaufhörlich stattfindet und wie sie nicht stattgefunden hat. Nicht vorher. Diese Nicht-Statt ist es, die sooft ein Mensch geboren wird, zurecht eine Utopie genannt werden kann.
Wenn diese Utopie verbraucht ist an dem Tage, da das Kind in das eintritt, was wir die Reihen der Erwachsenen nennen, beginnt das Kind, sich zu realisieren, damit doch etwas anwesend sein wird, statt sich zu entrealisieren, weil alles bereits anwesend ist.
Ich freue mich, daß diese Dichtung so gelobt und gefeiert wird, indem für sie der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur heute vergeben wird.
Peter Waterhouse, manuskripte, Heft 129, 1995
Das Spiel regeln
– Zur poetischen Verfahrenstechnik bei Inger Christensen und Jan Kjærstad. –
Die Hoffnung, „daß es Dinge gibt, die einzig die Literatur mit ihren spezifischen Mitteln zu geben vermag“, scheint angesichts der Medienübermacht im „technischen Raum“ (Reinhard Knodt), der uns umgibt, von unbekümmerter Fröhlichkeit, ja von halsbrecherischer Naivität.
Gehegt hat diese Hoffnung allerdings kein Geringerer als Italo Calvino, dem man zwar viel Phantasie, aber wohl kaum realitätsferne Naivität nachsagen würde. Und was er äußerte, war im übrigen weniger Hoffnung als vielmehr und selbstbewußter noch: ein Wissen, auf das er sein „Vertrauen in die Zukunft der Literatur“ gründete. Solch wissendes Vertrauen schickte er seinen Sechs Vorschläge(n) für das nächste Jahrtausend voran, einer Poetik von eleganter Leichtigkeit und pointierter Prägnanz, in welcher von „einigen Werten oder Qualitäten oder Eigenheiten der Literatur“ die Rede sein sollte, die dem großen italienischen Schriftsteller besonders am Herzen lagen – und die er gerne ins nächste Jahrtausend hinübergerettet gesehen hätte.
Solch wissendes Vertrauen in die fortgesetzten Möglichkeiten der Literatur treibt offenbar auch die beiden Autoren um, von denen im folgenden die Rede sein soll: die Dänin Inger Christensen und den Norweger Jan Kjærstad. Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage nach einer zeitgemäßen Poetik für die Literatur im Medienzeitalter, nach dem Schreiben im technischen Raum.
II
Vielschichtigkeit lautete eines von Calvinos Stichworten; es gab dem letzten vor seinem Tod noch fertiggestellten der Sechs Vorschläge den Titel. Womöglich trifft das englische „multiplicity“, das Calvino von Hand auf einen Zettel mit den einzelnen Kapiteln notierte, noch genauer ins avisierte Ziel einer „Apologie des Romans als große(m) Vernetzungswerk“. Ganz automatisch denkt man da an die „multiplicity of worlds“, die Vielzahl der Welten, welche uns etwa die neuen, die elektronischen Medien so voller virtueller Euphorie versprechen. Dabei geisterten diese doch längst in den alten Medien umher, wenn auch nur in unserer Vorstellung. Aber sitzt nicht gerade dort der „Unort“, die Utopie, wenn sich zwischen Buchdeckeln Druckerschwärze zu unsichtbaren Städten auftürmt oder man mit Cosmicomics in ferne Universen entschwindet?
Inger Christensen ist es, mit der wir diesen Calvinoschen Faden samt ihrer kosmologisch-kaleidoskopischen Perspektive der Parallel-Welten zuerst aufnehmen. Den titelgebenden Essay ihrer Sammlung Teil des Labyrinths (1982, dt. 1993) eröffnet sie über Giordano Bruno nachdenkend, „der an einem der ersten Tage des Jahres 1600 (…) verbrannt (wird), weil er an mehrere Weltbilder zugleich glaubt.“ Hätte Bruno damals die hergebrachte Ordnung der Welt erschüttern können mit seinen ketzerischen Gedanken, so erscheinen sie der heutigen Physik längst nicht mehr so fremd wie den Inquisitionsbehörden seiner eigenen Zeit. Für Inger Christensen stellt sich mit der Frage nach der einen Weltordnung zugleich die Frage nach Macht und Ohnmacht, nach den Menschen und ihren Möglichkeiten, den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Darin nicht zuletzt liegt die Brunosche Utopie eines pluralistischen Kosmos:
Daß es ein anderes Schauspiel gab; eine andere Weltordnung, oder mehrere, und dazwischen vielleicht einige, wo sie die Handlung selber mitbestimmen könnten.
Die Bahn der Planeten, den Lauf der Dinge und den (aufrechten) Gang zur gemeinsamen Sprache zu bringen – nichts geringeres hat sich Inger Christensen in ihrem Werk vorgenommen. Man bemerkt darin eine unablässige Suche nach dem großen Zusammenhang, die über das bloß Individuelle hinausgeht, ohne es indes zu vernachlässigen; man erfährt zudem, wie auf ganz unpathetische Weise ein Band geflochten wird zwischen einer persönlichen und einer makroskopischen (und von daher existentiellen) Perspektive. Das geht nicht ohne ein Bewußtsein des Risses zwischen beiden. Er erschüttert den guten Glauben – und forciert Erkenntnis. Typisch dafür die folgende Passage: „Als ich 9 Jahre alt war, da war die Welt auch 9 Jahre alt“, beginnt ihr Essay „Zusammenspiel“. Aber die Ent-Täuschung läßt nicht lange auf sich warten, denn: „Als ich 10 Jahre alt wurde, da wurde die Welt plötzlich 10 Millionen Billionen Jahre alt.“
Es ist der Schock über die schiere Größe und Weite des Unbekannten, das da schon seit Ewigkeiten außerhalb von einem selbst existieren soll. Es ist Fassungslosigkeit angesichts des Unfaßbaren, welches das Kind im Unmaß der Zahl trifft.
Möglicherweise rührt Inger Christensens Sinn für Zahlen von einem derartigen Erlebnis des Unermeßlichen her: die Zahl, und sei ihr Wert noch so abstrakt, gibt ihm immerhin eine „Dimension“, etwas Berechenbares. Doch plötzlich weiß das Kind zum ersten Mal auch, daß es fast nichts weiß über die eigene Teilhabe an jenem großen Labyrinth mit Namen Universum: „Ich denke, also bin ich Teil des Labyrinths“ heißt folgerichtig der vollständige Titel des Essays, der den selbstbewußten cartesianischen Modus um jenen entscheidenden Tick in die existentielle Unsicherheit weiterdreht. Wobei die wiederkehrende Metapher des Labyrinths eine besondere Rolle in Inger Christensens poetologischem Weltbild spielt, „als eine Art gemeinsamer Gedankengang, ein Möbiusband zwischen Menschen und Welt – und in solchen Labyrinthen bewegen sich eigentlich nur die Kinder wie zu Hause: sie heben nämlich die Verzauberung dadurch auf, daß sie sie zu Wirklichkeit machen.“
In einem ihrer Bücher geschieht dies tatsächlich. Wenn am Ende der Erzählung Das gemalte Zimmer (1976, dt. 1989) die Kinder des italienischen Renaissance-Künstlers Andrea Mantegna dessen Fresco in der ,camera picta‘ betreten, dann um bald darauf dem geistigen Auge des Lesers zu entschwinden. In einem Labyrinth, dem der künstlichen Gassen einer dort abgebildeten Bergstadt, in der sie ihre gestorbene Mutter vermuten, die Gentilia, die Tochter, so gerne zurückholen will in die diesseitige Welt. „Welche Welt, denke ich (ihr Bruder, TFS). – Aber ich sage es nicht.“
Welche Welt also? Welche Welten? Im Grunde wissen ja auch wir, wissen es, auch ohne Jorge Luis Borges zu befragen und dessen Geschichte vom „Garten der Pfade, die sich verzweigen“, wissen, daß das Jenseits das ultimative Ziel und zugleich ursprüngliche Modell aller Labyrinthe darstellt.
Wie eine ständig zu überprüfende Arbeitshypothese liegt das Bild des Labyrinthes dem Werk Inger Christensens zugrunde. In diesem Grundmuster entrollt sie ihre roten Fäden: die wechselseitige Bedingung von Freiheit und Gefangensein (so formuliert in „Zusammenspiel“), die notwendige Ergänzung von systematischer Suche und zufälligem Finden, die Durchdringung von Phantasie und Realität, die gegenseitige Abhängigkeit von Spiel und Regel. Vor allem letztere erlegt sie sich immer wieder selbst auf. Sie fügt sich Prinzipien, hält sich an eigens gegebene Vorschriften, die sie, so will es zunächst scheinen, einengen, ihr im Endeffekt aber einen völlig unerwarteten Freiraum eröffnen.
Einer, der diesen Freiraum in der selbstgewählten Regulierung erkannte, ist der französische Kollege Raymond Queneau. Calvino zitiert ihn mit folgenden Sätzen:
Der Klassiker, der seine Tragödie schreibt und dabei eine gewisse Anzahl von Regeln einhält, die er kennt, ist freier als der Poet, der schreibt, was ihm gerade durch den Kopf geht, und dabei der Sklave anderer Regeln ist, von denen er keine Ahnung hat.
Soweit Queneau. Mit ihm und anderen Kollegen aus der Werkstatt für potentielle Literatur, kurz Oulipo, verbindet Inger Christensen so manches. In ihrem ersten Großgedicht det (es, 1969) orientierten sich die Regelsetzungen mehr oder weniger stark am Sprachspiel, blieben also letztlich im erweiterten Bezirk des Literarischen. Dabei gerieten Lars Gustafssons Überlegungen zum langen Gedicht ebenso zu produktiven „Stolpersteinen“ (O-Ton Christensen) wie die Bekanntschaft mit der Präpositionstheorie des Linguisten Viggo Brøndal. Sie inspirierte die strukturelle Ordnung von det gerade in einem Moment, als Inger Christensen nicht recht weiterkam, wie sie einmal bemerkte. Interessanterweise deutet der strenge Aufbau die Form des klassischen Dramas an, aber sie ist gewissermaßen „selbstdeskriptiv“, bezeichnet die Form zugleich als ihren Gehalt: Ein Prologos und ein Epilogos rahmen drei „Akte“ ein, deren Titel „Die Szene“, „Die Handlung“ und „Der Text“ lauten. Aufgeführt wird das Schauspiel des „Zur Welt kommen, zur Sprache kommen“, worin sich dem dramatischen Schöpfungsgeschehen eine grammatische Ordnung unterschiebt. Vereint zu einem geschlossenen System, mag in diesem Zirkel aus Sprache das Bild eines Planeten aufscheinen. Ob es der unsere ist, oder eine fiktive Parallelwelt – wer wollte das entscheiden?
„Ich habe versucht, von einer Welt zu erzählen, die es nicht gibt, damit es sie gäbe“, heißt der Anfang eines Gedichts in det. Dessen Schluß lautet: „Dies ist eine Kritik an der Macht des Menschen über die Sprache, weil es eine Kritik an der Macht der Sprache über den Menschen ist.“ Worin sich letztlich die Hoffnung aller Literatur äußerte: daß Sprachschöpfung Machtkritik sein könne.
Noch entscheidender für solches Experimentieren wurde die Entdeckung von Noam Chomskys Transformationsgrammatik und der mit ihr verbundenen Vorstellung von einer angeborenen Sprachfähigkeit des Menschen. „Diese Sprachsicht Chomskys gab mir ein phantastisches Glücksgefühl. Eine unbeweisbare Gewißheit, daß die Sprache eine direkte Verlängerung der Natur ist. Daß ich dasselbe ,Recht‘ hatte zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben.“
So beiläufig klingt die Analogie, die Inger Christensen hier zwischen Baum und Sprachvermögen zieht, und irgendwie doch so altbekannt. Aber sie birgt erhebliche Konsequenzen. Denn hier gilt nicht länger jenes souverän behauptete, jedoch ungern hinterfragte Abbildungsverständnis, wie es die realistische Literatur für sich reklamiert. Inger Christensens Beziehung zwischen Welt und Sprache, zwischen Literatur und Wirklichkeit formuliert sich anders. Es ist nicht-mimetischer „Natur“, aber deswegen nicht weniger eng – im Gegenteil!
Wie das beispielsweise funktionieren kann, läßt sich am besten an ihrem komplexen Großgedicht alphabet (1981, dt. 1988) zeigen.
III
Der Struktur von alphabet liegen zwei Prinzipien zugrunde: zum einen die Buchstabenfolge des Alphabets, zum anderen eine mathematische Reihe, die sogenannte „Fibonacci-Folge“. Sie geht auf den italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci (1170–1240) zurück, der sie in seinem Liber abaci aufführt, eine Reihe, bei der sich jedes Glied der Folge aus der Summe der beiden vorangehenden errechnet. Also: 1 / 1 + 1 =2 / 1 +2 =3 / 2+3 =5 / 3+5 =8 / 5+8 =13 / 8 + 13 =21 usw. Man kann sich leicht ausrechnen, wie schon nach kurzer Zeit die Zahlen schwindelerregend größer werden.
In alphabet bestimmt die „Fibonacci-Folge“ gewissermaßen das Versmaß. Demnach besteht der erste Vers aus einer Zeile, der zweite aus zwei, der dritte aus dreien, der vierte aus fünf, der fünfte aus acht usw. So geht das weiter bis zur Nummer 14, längst kein „Vers“ mehr, sondern ein Gebilde von 610 Zeilen.
Nach oben hin offen wie eine poetische Richterskala, bricht hier allerdings die Folge ab, wobei sich ein möglicher Grund auf den ersten Blick zwar paradox, doch bei näherem Hinsehen schlüssig aus dem zweiten Strukturprinzip ergibt, dem Alphabet. Dessen einzelne Buchstaben markieren in erster Linie Substantive im Text, und zwar sukzessive und entsprechend den fortschreitenden „Versen“ und ihren Zahlen, wobei darin so etwas wie eine Inventarisierung der Welt vorgenommen wird.
An ihrem Anfang stand bei Inger Christensen – nein, nicht der Apfelbaum, denn das kommt im Dänischen nicht hin (wie auch umgekehrt in der deutschen Übersetzung manches nicht aufgeht), dort heißt der Apfel „reble“. Am Anfang also war: der Aprikosenbaum. Eine ganz ähnliche Frucht zweifellos – und noch dazu eine mit einem Kern. Und ein Kern ist – biologisch betrachtet – dazu da, sich zu teilen. Das tut er bei Inger Christensen auch umgehend, denn die erste Zeile von alphabet lautet nicht etwa „die aprikosenbäume gibt es“, sondern: „die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es“.
Es ist schon alles da, und das wird auch durch die über lange Strecken des Buches durchgehaltene formelhafte Wendung „… gibt es“ bestätigt: der Baum ist da, und mit ihm das Wachstum (und – wichtig! das Prinzip der Verzweigung). Das Eine ist da und die Zahl eins, aber gleich doppelt, so daß die 2 ganz von selbst aus ihr hervorgeht. Und natürlich die Sprache: sie sagt A wie Aprikosenbaum.
Im zweiten Vers dieses Schöpfungsrapportes gibt es lebenswichtige chemische Substanzen wie Wasserstoff und urwüchsige Pflanzen wie den Farn, aber auch die rein sprachliche Verbindung zwischen diesen Stoffen (Brom und Brombeere). Der dritte führt neben allerlei Pflanzen auf C auch niedere Tiere ein (die Zikade, dän.: cikade) und – das Kleinhirn: cerebellum. Und mit ihm im vierten Vers die Träume, die Tage und den Tod. Im sechsten Abschnitt werden die Syntagmen komplizierter, erste Nebensätze deuten sich an, besagen: Auch die Sprache unterliegt der Evolution. (Und hier scheint eine Parenthese angebracht: Das Gedicht seinerseits unterliegt einem Wachstumsprozeß, den biologisch zu nennen man nicht abgeneigt wäre. Baummodell, Verzweigungsprozeß, Pflanzenwelt – alles wird eng miteinander verzahnt, spielt sich sowohl auf der inhaltlichen wie auf der formalen Ebene ab. Das Gedicht als Entelechie – oder zeitgemäßer: als autopoietischer Prozeß. Wobei nicht nur das Gute wächst, sondern die Möglichkeit der Katastrophe auch.)
Im siebten Abschnitt geschieht dann etwas Merkwürdiges: Die „Fibonacci-Folge“ taucht noch einmal auf, und zwar in der Binnenstruktur, d.h., der Block aus eigentlich 21 Zeilen ist aufgespalten, verzweigt sich, indem nach einer ersten Zeile zwei à zwei, zwei a drei und zwei a fünf Zeilen folgen. Ähnlich der berühmten Mandelbrot-Menge wiederholt sich im Gedicht das Große im Kleinen, oder umgekehrt erwächst das Große selbstidentisch aus dem Kleinen.
Wenn der gesamte Text nicht mit Z, mit dem sechsundzwanzigsten und letzten Buchstaben des Alphabetes endet, sondern schon mit N, dem 14ten, so mag man dahinter zunächst praktische Erwägungen vermuten. Zum Beispiel den enormen Umfang, den allein die 196.418 Zeilen des letzten Abschnittes erfordert hätten. Von dessen literarischer Bewältigung ganz zu schweigen – ein Lebenswerk.
Es gibt aber durchaus einen anderen, einen ungemein schlüssigen Grund. Denn n bezeichnet oder unterscheidet als sogenannter Index in mathematischen Folgen die einzelnen Funktionsglieder, ein abstrakter und letztlich offener Wert, für den man eine bestimmte Zahl erst einsetzen muß. Anders ausgedrückt: Im Buchstaben n verschmelzen mathematische und Buchstabenfolge zum „alphanumerischen Code“ (Vilém Flusser). Das Gedicht erreicht seinen Scheitelpunkt, aber die Tendenz lautet gerade in dieser Offenheit: unendlich.
Wie zwei transparente Folien scheinen in alphabet diese beiden Codes, der numerische und der alphabetische, übereinandergelegt. Wobei es sich im Grunde bei beiden um relativ einfache Strukturen handelt, die zusammen jedoch ein äußerst komplexes Gebilde hervorbringen.
Ein unerwartet klares Licht auf diesen Umstand der doppelten Codierung wirft ein Zitat des Philosophen Vilém Flusser, vor allem im Hinblick auf den antizipierenden Charakter von Literatur, auf deren diagnostische Fähigkeiten, Wandlungen zu erspüren, aufzunehmen und zu „gestalten“ (ohne daß diese damit gleich gutgeheißen würden):
Die Computer verlangen nach neuen Codes, deren Charakteristik es ist, strukturell sehr einfach und funktionell außerordentlich komplex zu sein – ein Charakteristikum, das übrigens alle hochentwickelten Strukturen kennzeichnet. Diese Codes aber gestatten ein neues, nicht mehrsprachliches Denken, das für das Bedenken der Welt adäquater ist als das logische, alphabetische Denken und das daher auch dem zweiten Problem, jenem der Unbeschreibbarkeit der Welt, die Stirn bietet. Die neuen Codes sind geeigneter als das Alphabet, die Welt zu bedenken und zu behandeln, und sie werden über kurz oder lang das Alphabet als Träger des Denkens verdrängen.
Flusser liefert eine schlüssige Erklärung für die „Digitalisierung“, welche sich gerade in der formalen Struktur von alphabet (und übrigens auch in dem 1990 auf deutsch erschienenen brief im april) niederschlägt
Was hier an die „Oberfläche“ (eben an die der Form) tritt, und was dieser Philosoph des Medienzeitalters nicht ohne die melancholische Wehmut des Schriftgelehrten anerkennt, ist ein apokrypher, ein lange Zeit vom Buchstabenlogos verdrängter Diskurs abendländischen Denkens. Nun drängt er mächtig ins Bewußtsein zurück: daß die Welt nicht im Wort, sondern erst in der Zahl vollkommen darstellbar sei.
Dieser verborgene Diskurs, diese Geheimlehre läßt sich nachvollziehen von den Kabbalisten über mittelalterliche Versuche einer ars combinatoria (allen voran derjenigen des Spaniers Raimundus Lullus), über die Renaissance mit ihren Wunderkammern und der Verbindung von Kunst und Wissenschaft (mit Leonardo als ihrem berühmtesten Repräsentanten), über den Barock und seine Labyrinthe und seine Zahlenspiele sowie die kombinatorischen Versuche Leibniz’ bis hin schließlich zu Alan Turing und seiner intelligenten Maschine. Deren simpler Code lieferte das know-how für die Chiffrierung der Welt durch die geringsten aller Zahlen, durch nichts weiter als 0 und 1.
(…)
Thomas Fechner-Smarsly, Schreibheft, Heft 45, Mai 1995
Inger Christensens Alfabet
Die Zeilenzahl von Inger Christensens Langgedicht Alfabet ist auf der Fibonacci-Folge aufgebaut, bei der sich jede Folgezahl aus den zusammengezählten vorhergehenden Zahlen ergibt. Die Lexik wird vom Alphabet angeleitet, löst sich aber streckenweise völlig davon. Die Fibonacci-Folge gibt einen Rhythmus an und stellt eine Art Schneeballen dar, das auf einer formalen Ebene das vom Hundertsten ins Tausendste Kommen der Assoziation, der Natur wie auch der Zivilisation darstellt. Das Alphabet fungiert als Gegenkraft zur Assoziation, als eine Art Zufallsgenerator, auf dessen Impuls hinauf Brom neben Brombeeren zu stehen kommt und andere heterogene Dinge, die es gibt, genannt werden, wie:
den herbst gibt es; den nachgeschmack und das nachdenken
gibt es; und das insichgehn gibt es; die engel,
die witwen und den elch gibt es; die einzelheiten
gibt es, die erinnerung, das licht der erinnerung;
und das nachleuchten gibt es, die eiche und die ulme
gibt es, und den wacholderbusch, die gleichheit, die einsamkeit
gibt es, und die eiderente und die spinne gibt es,
und den essig gibt es, und die nachwelt, die nachwelt
Es scheinen drei Kräfte am Werk zu sein: Phantasie, Assoziation und Alphabet. Wie bei einer Jongleuse, die zu den Kugeln, die sie in der Luft wirbelnd erhält, immer noch eine hinzufügt, kehren, analog zum mathematischen Generationsmechanismus der Folge, die erwähnten Dinge, wie zum Beispiel die Aprikosenbäume der ersten Zeile, in späteren Folgen wieder. Laut Christensen hat ihre Dichtung mit dem nicht bekannten Teil der Welt zu tun, im Zusammenspiel von Generationsregel und arbeitendem Bewusstsein soll eine Art eigenständiger Organismus entstehen mit seiner eigenen Folgerichtigkeit.
Sehr eindrücklich schlagen sich die dreifachen Einflüsse in den Metaphern nieder, die manchmal von einer Assonanz herrühren, manchmal naheliegen und manchmal ganz unerwartet weit, mit oder ohne Assonanz. Wie in Borges’ „Enzyklopädie“ werden die Ebenen und Kategorien durcheinandergewirbelt, zu Metaphern oder Vergleichen zusammengeschirrt oder bloß juxtaposiert, im Fall der Vokale färbt Assonanz die ganze Passage ein, verleiht ihr beispielsweise eine Art Glast:
[…]
das eis mit dem licht identisch, und zuinnerst
im eislicht das nichts, leibhaftig, eindringlich
wie dein blick durch regen; diesen rieselnden
lebenstilisierenden nieselregen, in dem es wie eine geste
die vierzehn kristallgitter gibt, die sieben
kristallinischen systeme, deinen blick wie in meinem,
und es Ikaros, Ikaros hilflos gibt;
Die Beschwörung – zeitweilig kommt zur wiederkehrenden Floskel „gibt es“ der beschwörende Ausdruck „bestimmt“ hinzu – und der hilflos wirkende Litaneienton, der Rhythmus geben der so angerufenen, unterschiedlich perfekten Welt eine pathetische Gloriole, mit Humor unterwandert, wo sich menschliches Bewusstsein mit den mathematischen und physikalischen Prozessen der Natur trifft.
Die Litanei ist eine weitere mit der Liste verwandte Gattung. Aus dem Zauber kommend hat sie viel mit der Macht des Benennens, der Anrufung und Beschwörung zu tun. Die Wiederholung eines Wortes (wie Ommm…) oder einer Kette von Wörtern (Mariamuttergottesbittefüruns…) wird in seiner rhythmischen Wiederkehr zu Musik beziehungweise geleitet durch die einlullende Wirkung einer sanften Dauerbetätigung der Stimmbänder in tranceartige Zustände. Ohne dem Sonderstatus von Religion zu nahe treten zu wollen, drängt sich ein Vergleich mit Tätigkeiten wie Joggen, Rauchen, Kritzeln, Sci-Fi-Lesen oder Jammen auf, die, indem sie eine gewisse Bewusstseinsschicht beschäftigen, einem anderen Teil ermöglichen, ungestört zu arbeiten. Das wäre die musikalische Seite.
Da eine Litanei in religiösen Systemen allerdings wie ein legales Dokument funktioniert, ist ihre vollständige und richtige Ausführung ausschlaggebend für den Erfolg. Der Text ist, ähnlich wie beim Theatertext, in seiner primären Funktion bloß Vorlage für eine Ausführung, welche die Bürde des Gelingens trägt.
Die Funktion der Liste als symbolischer Ersatz für eine bestimmte Menge von Gegenständen, wie sie sie als Gedächtnisstütze innehat, teilt sie in gewisser Weise mit bestimmten Arten von Litaneien, wo man sich vorstellt, durch die Nennung des Namens eines Geistes oder einer Gottheit, wenn es richtig gemacht wird, diese Gottheit nicht nur gebeten, sondern gezwungen wird zu erscheinen. Hat das Wort auf diese Weise einen Teil der Gottheit inne, die im Aussprechen des Worts präsent ist, so unterscheidet sich die Konkretheit dieser Gottheit nicht unbedingt entscheidend von der Konkretheit der Bedeutungen der Wörter in der KP (Konkreten Poesie).
Ann Cotten, aus Ann Cotten: Nach der Welt. Die Listen der Konkreten Poesie und ihre Folgen, Klever Verlag, 2008
Die Geschwindigkeiten der Literatur
– Sondierungen auf dem Gebiet der Poetik und Prognostik. –
Was hat Geschwindigkeit mit Literatur zu tun, oder Literatur mit Geschwindigkeit? Geschwindigkeit ist ohne Zweifel das Markenzeichen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, ob wir über Kommunikation, Informationsfluss und Datenverarbeitung, technische Neuerungen (High-Speed-Technology), Digitalisierung oder Sport reden. Und natürlich haben die rasanten Veränderungen unserer Alltagswelt, insbesondere seit der digitalen Revolution, unsere Wahrnehmungsweise eminent geprägt, was wiederum Spuren in der kulturellen Produktion hinterlassen hat. Von der bildenden Kunst und dem Film kann hier leider nicht die Rede sein, obwohl sie unter dem Aspekt der Beschleunigungsproblematik interessanteste Einblicke erlauben. (Einige Streiflichter auf das Thema habe ich in meinem Buchessay „Langsamer!“ geworfen.) Ich will mich auf die Literatur konzentrieren, und zwar unter zwei sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten: Wie äußert sich Geschwindigkeit (Tempo) in literarischen Texten in poetisch-ästhetischer Hinsicht, und: Was bedeutet es, wenn Literatur sich prognostisch-prophetisch verhält, d.h. Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Technik antizipiert und somit schneller ist als die Wirklichkeit selbst. Im ersten Fall gilt mein Augenmerk poetischen Verfahren, vor allem Satzbau, Montagetechnik und dem Stilmittel der Wiederholung, im zweiten Fall Fragen von Inhalt und Imagination, aber auch von Rezeption. Ein weites Feld. Doch verstehe ich die nachfolgenden Gedanken eher als Impulsgeber, als Anregungen zum Weiterdenken, denn als Thesen. Zu komplex die Materie, zu weitläufig das Material. Wenn ich mich auf Texte des 20. Jahrhunderts und der letzten Jahre beschränke, dann vor allem aus Gründen der Überschaubarkeit.
(…)
Auf Detailanalysen verzichte ich, um zur Lyrik zu kommen.
Geben wir zu: zwischen der heftigen, substantivischen Lyrik des Expressionisten August Stramm und Inger Christensens Schöpfungsgeschichte Alphabet (1981) liegen Welten, auch in Sachen Geschwindigkeit. Bei Stramm gleichen die Wörter schnellen Geschossen, die dänische Lyrikerin Inger Christensen bevorzugt einen litaneienhaften Sound und Rhythmus:
die aprikosenbäume gibt es, die aprikosenbäume gibt es
die farne gibt es; und brombeeren, brombeeren
und brom gibt es; und den wasserstoff, den wasserstoff
die zikaden gibt es; wegwarte, chrom
und zitronenbäume gibt es; die zikaden gibt es;
die zikaden, zeder, zypresse, cerebellum
die tauben gibt es; die träumer, die puppen
die töter gibt es; die tauben, die tauben;
dunst, dioxin und die tage; die tage
gibt es; die tage den tod; und die gedichte
gibt es; die gedichte, die tage, den tod…1
Das Poem treibt die Aufzählung immer weiter, gelassen und mit vielen Wiederholungen, wobei es mit jedem Buchstaben des Alphabets komplexer wird, denn es folgt der mathematischen Fibonacci-Reihe, in der jedes Glied die Summe der beiden vorangegangenen Glieder darstellt. So hat Christensen beim Buchstaben „n“ aufgehört, die Zahl der Verse – es sind gegen 1.300 – wäre sonst explodiert. In seinem 140 Verlauf ändert das Poem kaum den Tonfall, nur verzweigt sich die Aufzählung und bietet auch Raum für kommentierende Reflexion. Wir folgen der Weltentfaltung langsam, Wort für Wort, auch ihren schrecklichen Aspekten, denn da wird nichts ausgespart: weder das Dioxin noch die Spaltprodukte, weder die Kobaltbombe noch die Atombombe (mit Hiroshima und Nagasaki). Doch neben dem menschengemachten Schrecken gibt es die Gesetze der Natur, die eine andere Dauer andeuten. An diese Dauer, um nicht zu sagen kosmische Unendlichkeit, appelliert Christensen. Aus ihr holt sie sich Halt und Atem – und den Rhythmus einer magischen Beschwörung. – Wer Christensen mit ihrer melodischen Intonation je hat vorlesen hören, wird den beruhigenden Singsang nie vergessen. Hier rührte jemand an den Archetypus der Poesie.
Nicht unnötig zu sagen, dass litaneienhafte Gedichte – zumindest formal – an Litaneien, das heißt Gebete anknüpfen, deren Wiederholungsduktus Zeitlosigkeit suggeriert.
(…)
Die langsame oder schnelle Anmutung eines Gedichts besagt allenfalls etwas über seine Intention, doch kaum etwas über seine Qualität, wobei Inger Christensens litaneienhaftes Alphabet ohne jeden Zweifel „eines der großen Weltgedichte der Moderne“ (Heinrich Detering) darstellt. Weil es vor allem eines ist: eine Parallelschöpfung als klangvolles Sprachkunstwerk.
Doch im Trend liegt, wie gesagt, eine Poesie des schnellen, aus disparaten Partikeln gespeisten „Flow“, was unserer fragmentierten Wahrnehmung, unserer immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und der neuen Unübersichtlichkeit entspricht. Daran ist nichts auszusetzen. Auch wenn die Verstehbarkeit machmal strapaziert wird.
Ilma Rakusa, Manuskripte, Heft 217, Oktober 2017
Durch Ingers alphabetische Natur
Am Anfang stand ein Hörspiel: Angekleidet, um zu überleben, der erste Text von Inger Christensen, den ich übersetzt habe. 1968 wurde dieses Hörspiel in Deutschland gesendet, in den folgenden Jahren weitere drei Hörspiele, zuletzt Ein Abend auf Kongens Nytorv. Da hatte ich Inger Christensen schon in ihrer großen Kopenhagener Wohnung in der Dag Hammarskjölds Allé, nicht weit von Kongens Nytorv; besucht und auch ihren Mann Poul Borum kennengelernt.
Der S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main entdeckte damals ihren Roman Azorno, den ich ebenfalls übersetzen konnte und der 1972 in der kurzlebigen Reihe Fischer erschien, immerhin Inger Christensens Debüt auf dem deutschsprachigen Buchmarkt, wenn man von dem großen Prosagedicht „Wassertreppen“ absieht, das ich in eine Anthologie dänischer Erzähler der Gegenwart aufgenommen hatte; die war 1970 bei Reclam in Stuttgart herausgekommen.
Azorno fiel Helmut Heissenbüttel auf. In einer Sammelbesprechung des Norddeutschen Rundfunks ging er auf Inger Christensens Schreibweise ein und umschrieb den Roman als „ein Ding in jener anderen Welt, in der Sprache sich auf eigene Faust auf Abenteuer begeben kann“. Da war ein erster Funke übergesprungen, ein literarischer Brückenschlag, den man als Auftakt zu Inger Christensens später so engen Beziehungen zu deutschsprachigen Schriftstellern sehen kann.
Bis die Lyrikerin Inger Christensen bekannt wurde, dauerte es freilich. Zwar hatten sich früh schon Kieler Skandinavisten eingehend mit ihrer Gedichtkomposition det aus dem Jahre 1969 beschäftigt und darüber geschrieben, aber weder aus det noch aus Inger Christensens früheren Gedichtbänden lagen Texte in deutscher Übersetzung vor.
Mehrmals hatte sie mir Bücher geschickt: ihre Erzählung aus Mantua (Das gemalte Zimmer), später die französische Übersetzung von alfabet, das 1981 in Dänemark erschienen war und mit dem sie bei uns wirklich bekannt wurde. Josef Kleinheinrich in Münster, studierter und promovierter Skandinavist und Lyrikliebhaber, hatte Mitte der achtziger Jahre seinen Verlag gegründet und fragte mich, ob ich alfabet für ihn übersetzen wolle. Das tat ich um so lieber, als ich damit meine Zweitsprache reaktiveren, mich sozusagen in Dänisch realphabetisieren konnte, und als das Buch 1988 in einer zweisprachigen Edition herauskam, geschah ein kleines Wunder: im September dieses Jahres stand alfabet / alphabet auf Platz 1 der Bestenliste des Südwestfunks.
Josef Kleinheinrich veröffentlichte daraufhin in schneller Folge Das gemalte Zimmer und den Essayband Teil des Labyrinths, beide innerhalb einer Reihe mit Dänischer Literatur der Moderne, als deren Herausgeber der Kieler Skandinavist Bernhard Glienke zeichnete. In ihm fand ich einen idealen Lektor und Redakteur – ideal, weil er einer der drei gewesen war, die sich 1972 mit det beschäftigt hatten, weil er Inger Christensens damals vorliegende übrige Werke kannte, weil er nicht nur ein genauer Philologe, sondern zugleich ein Mann des absoluten Gehörs für literarische Nuancen war, mir also nicht nur die Dänismen austreiben konnte in die man als deutscher Übersetzer aus dem Dänischen so leicht verfällt, sondern auch das mot juste wusste, wenn ich es nicht hatte finden können.
Leider ist Bernhard Glienke früh gestorben. Deshalb zögerte ich lange, mich auf die Übersetzung von det einzulassen: für diese Arbeit wäre er der prädestinierte Gesprächspartner und Ratgeber gewesen. Andererseits: ich hatte versuchsweise aus det schon den Epilogos übersetzt, hatte sogar mit Inger Christensen bei einer Lesung diesen Versuch vorgetragen, und Norbert Wehr hatte ihn in seinem Schreibheft abgedruckt. Josef Kleinheinrich fragte mehrmals in der Sache an, und Inger Christensen, der nichts ferner lag als zu drängeln, war denn doch anzumerken, dass sie nichts dagegen gehabt hätte, wenn auch det aus dem Jahre 1969 deutschsprachigen Lesern zugänglich gemacht würde.
Mehr als schiefgehen kann es nicht, dachte ich schließlich und machte mich an die Arbeit. Nicht der Umfang des Buches stellt die Schwierigkeit dar, auch nicht die Verständlichkeit der Textteile im einzelnen, denn Inger Christensen ist keine Hermetikerin, sondern die feinen verbalen Verknüpfungen der Teile miteinander – Verknüpfungen, die durch Wortfolgen und Wendungen hergestellt werden, die Inger Christensen in leichten Abwandlungen aufgreift und für deren Varianten nicht immer deutsche Äquivalente zu haben sind.
So heißt es in „Die Handlung, Konnexitäten 7“, zu Anfang:
1. De går i krig for hinanden I krig mod hinanden
2. Indimellem mens de endnu har overskud nok til at uddele døden så langsomt at den ligner liv søger de at elske hinandens had
3. Det erdig Det er mig Det er vores mellemværende.
„Indimellem“ heißt soviel wie „zwischendurch“ oder „dazwischen“: mellem, das Wort für zwischen, ist aber zugleich Teil des Substantivs mellemværende, und mit jemand ein mellemværende zu haben, kann auch bedeuten, dass man mit ihm ein Hühnchen zu rupfen hat. Ein Wort, das einerseits gemeinsames „Interesse“, andererseits noch fällige Abrechnung miteinander bezeichnet, haben wir im Deutschen nicht; deshalb bin ich auf ein substantiviertes „Dazwischen“ ausgewichen, das nicht mehr als eine Verlegenheit ist.
Mit den seltenen Stellen, an denen Inger Christensen sprach- oder wortspielerisch wird, hatte ich ähnliche Mühen, so in dem Gedicht „Opspilet“ aus ihrem ersten Gedichtband Lys, 1962 erschienen und erst 2008 auf deutsch herausgekommen. Wo sie mit zwei dänischen Verben, spile und spilde spielt, hatte ich wenigstens die Möglichkeit, ein paar Komposita unseres etwas matten Verbums tun herbeizuholen; jetzt steht in der zweisprachigen Ausgabe – wiederum im Verlag Kleinheinrich:
OPSPILET
Opspilet udspilet spildt
eller endnu ikke helt forspildt
med fremtidens grå elektroder
spændt fast til hukommelsens
blegede fingerspids
står jeg og stammer
at jeg vil være god
AUFGETAN
Aufgetan ausgetan vertan
oder noch nicht ganz abgetan
die grauen elektroden der zukunft
fest an die gebleichte fingerspitze
des gedächtnisses gespannt
stehe ich da und stottre
dass ich gut sein will
Bei einem längeren Aufenthalt in Kopenhagen konnte ich Inger Christensen einige Fragen zu diesen frühen Gedichten nicht ersparen; sie waren ihr aber nicht in allen Einzelheiten mehr präsent. Gelegentlich lehnte sie sich leicht zurück und sagte nachdenklich:
Ja, so schrieb man damals.
Und in einem Brief äußerte sie:
Selber neige ich dazu, sie als Phänomene aus einer fernen und fremden Jugend zu betrachten. Aber vielleicht ist es ganz gut, an ihre Existenz erinnert zu werden.
Inger Christensen hat selber einiges übersetzt, aus dem Deutschen wie aus dem Schwedischen. Wahrscheinlich wusste sie deshalb so genau, was zwischen zwei Sprachen möglich ist und was nicht. Als es darum ging, ihren Sonettenkranz Sommerfugledalen (Das Schmetterlingstal) auf deutsch zu veröffentlichen, hat sie kein einziges Mal von der Möglichkeit einer Nachdichtung in Versen und mit Reimen gesprochen, geschweige denn dieses Kunststück von mir erwartet. Dass eine solche Nachdichtung dennoch zustande gekommen ist, verdanken wir Norbert Hummelt, der das Wagnis mit beachtlichem Ergebnis eingegangen ist. Allerdings musste er sich in seiner Nachbemerkung bei dem Schmetterling namens Pappelvogel entschuldigen: den habe er aus rhythmischen Gründen nicht mit aufnehmen können.
Zu Inger Christensens 60. Geburtstag, 1995, brachte ihr Verlag Gyldendal eine kleine Festschrift heraus, zu der ich auch beigetragen habe. Mein Text schließt mit dem Wunsch:
Ich bin mit Inger von a bis n gegangen, jetzt möchte ich mit ihr auch von o bis z gehen!
Von a bis n – das war natürlich eine Anspielung auf ihr alfabet, das mit den vielzitierten Aprikosenbäumen beginnt und mit den Nächten, dem Nachtschatten und anderen Wörtern mit dem Anfangsbuchstaben n endet. Von o bis z dagegen sollte mehr allgemein heißen, dass ich hoffte, auch weiterhin mit ihr zusammenzuarbeiten, wie ich es damals schon länger als fünfundzwanzig Jahre getan hatte.
Nach ihrem Tod ist mein Wunsch überraschenderweise dennoch in ganz wörtlichem Sinne erfüllt worden: Ich entdeckte eine Erzählung, die sie 1980 veröffentlicht hat, also kurz vor dem Erscheinen von alfabet; diese Erzählung trägt den Titel „Eine Wanderung in der alphabetischen Natur“, und anders als in alfabet flicht sie in diese Erzählung Wörter mit allen Buchstaben des Alphabets ein – des dänischen Alphabets wohlgemerkt, denn das geht über das Z hinaus und endet mit dem für uns exotischen Kringel-A, dem Å. Beim Übersetzen dieses Textes bin ich noch einmal durch Ingers ganze alphabetische Natur gewandert.
Hanns Grössel, aus Michael Buselmeier (Hrsg.): „die aprikosenbäume gibt es“. Zum Gedenken an Inger Christensen, Verlag Das Wunderhorn, 2010
WÖRTER GESCHEHEN
Das Wort hat im Prinzip dieselbe Chemie wie diejenige, derer es dazu bedarf, die Kristallisationsprozesse in Gang zu setzen.
Inger Christensen: „Die Seide, der Raum, die Sprache, das Herz“
ich hab mein Herz in Heidelberg ich
hab mein Herz im Kleiderschrank ich hab
das Bett noch nicht verbrannt mein Hut
geht bis zum Mantelkragen der Krug
geht übern Brunnenrand es bricht das Licht
mein Hut geht durch das ganze Land
es tut nicht weh in Heidelberg es schneit
so weit und breit du siehst wir sehen
bei Nacht die Hand vor Augen nicht
sie sehen Hand und Fuß und Hut
das Rosenrot das Schornsteinschwarz
der Zufall hat sich eingestellt und wenn
die Sonnen aufgehn und der Schloßberg
glüht wie ein poetisch Licht, dann
möchte man bedenken, vielleicht auch nicht
viel Worte machen eine Handvoll doch
beschenken Flügel zwischen Sprachen
schlagen als wär’n sie Tat nicht Wortsalat
nachtschattenlos hau’ ich mein Herz
an manchen Zwerg gehangen mitgefangen
und mit Stangen aus dem Fluß gefischt
an manchem Zweig erschüttern Blätter nicht
was frisch ist und was nicht geschenkt
bedenken – entgrätet habe ich mein Herz
sanft ist das dünngeküßte Fühlen und
das Unkrautzupfen mechanische Bewegung
wie große Walzen die sich drehen
wie Räder rollen in einer dünngewalzten Spur
in Heidelberg man dichtet nicht man hat
das Herz in Heidelberg auch auf der Zunge
und im Leib ohne Schlacken hirnverbrannt
man schweigt vom Herzen nicht in Heidelberg
oder besser nicht ohne Hand und Fuß
der Fluß liebreizend floß er weiter
nicht so die Trauerweiden einknickend
wie in Tübingen allein die Schmetterlinge
die umwölken Häupter Stirnen Dichter kommen
und gehen in Scharen Bücher werden
aufgeschlagen ein Bett auf Sand gebaut die Erde
hat sich aufgetan in Heidelberg sein Herz
ist krank bei gedämpfter Trommel Klang
mein Hut geht durch das ganze Land
hab in der Welt leidlich nur ihn verstanden
hast du den Hut doch sehr galant
an einen Haken ihren Hut im Haar hat sie
versteckt acht Kugeln sind vorbeigefegt
es tut nicht weh in Heidelberg es schneit
so weit so breit du siehst wir sehen
die Hand vor Augen nicht die Hand
ist weiß so wie der Schnee gewaschen ist
keine Hand kein Bett in Heidelberg am Fluß
im Kleiderschrank noch Lumpenzeugs das
trägt so weit so gut so lang bis gestern
ein’ feste Burg ist unser Gott so lang
sein Wort in Heidelberg bewahrt die Brücke
hat’s mir angetan mein Hut geht durch
das ganze Land ihr seht nicht mehr
die Hand vor Augen sie sehen Hand
und Fuß und Bein und eine Handvoll noch
von Wörtern in Heidelberg im Schnee
die Spur hab ich verloren nicht
Ursula Krechel
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + Kalliope +
Johann-Heinrich-Voß-Preis + Europäischer Übersetzerpreis
Porträtgalerie
Nachrufe auf Hanns Grössel: Übersetzen ✝︎ FAZ ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Autorin + IMDb + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


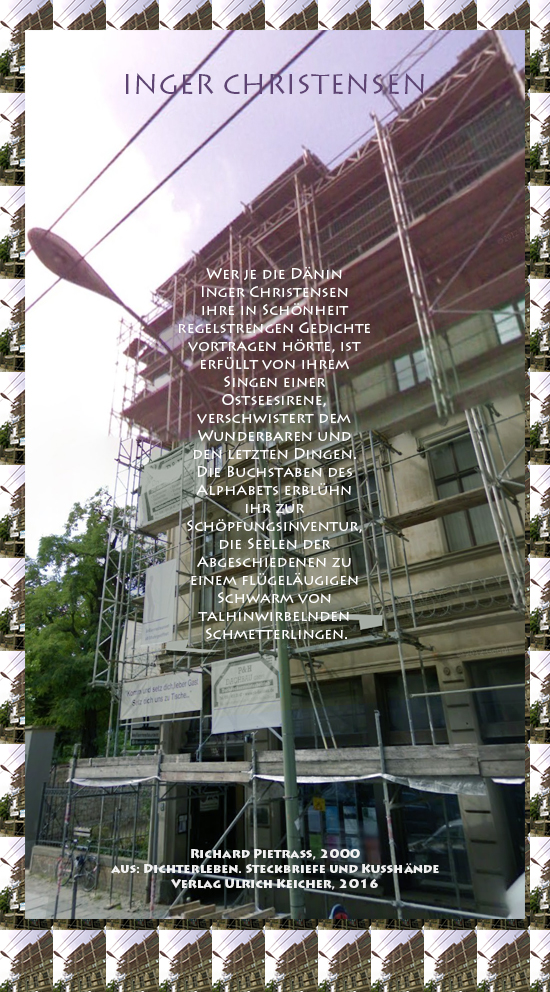












Schreibe einen Kommentar