Inger Christensen: brev i april / brief im april
° ° ° ° °
Mit, wie als sprache,
nichts anderm
kein hämmern
mit geballten
fäusten,
nur das gedicht,
das frei
die zukunft
entfaltet
wie einen fallschirm
aus seide und stille,
ein fächer
aus veränderter beleuchtung,
leidenschaftliche
sternengesandte
steile
gleichgültigkeit
zu gemüt
gesponnen,
während wir
auf unsere eigne
leicht rollende art
um die sonne herumgehn.
Dann sind wir am hause.
Stilleben mit briefschreibender Figur
Die Wirklichkeit ist ein verschlossenes Sinnversteck, die poetische Entzifferung ihres Alphabets nichts weiter als eine Übersetzung, ein zweites Alphabet, das mit dem Original nicht identisch ist, eine Konstruktion von Wirklichkeit. Dieser Gedanke steckt in einem Bild, das ein rotierendes Labyrinth mit baumelndem Ariadnefaden zeigt und eine die „Welt“ kartographierende Figur in häuslicher Umgebung. Das spannungsvoll komponierte Stilleben Inger Christensens ist das Konterfei einer Kunst, die autonom und universal ist.
Die Texte der Autorin sind, jeder für sich, Weltbilder aus Sprache, Summen, Schöpfungsberichte. Das gilt für ihr Großgedicht Alphabet, das vor fünf Jahren in deutscher Übersetzung erschienen ist, und als Allegorie tödlicher Komplexität eine unserer zentralen Zeiterfahrungen poetisch ausformuliert. Das gilt für die bei uns vor drei Jahren erschienene Erzählung Das gemalte Zimmer, in der sie auf der Unterlage eines Gemäldes von Mantegna die hermetischen Bauformen und den Einsturz der höfischen Renaissancewelt beschreibt. Das gilt für die jetzt ins Deutsche übersetzte Idyllendichtung Brief im April, die angesichts einer radikalen Skepsis in der Erkenntnisfrage mit dem alten Universalanspruch der Gattung hantiert.
Der Schritt in die Sprache wird als Eintritt in ein System und als Konstruktionsvorgang kenntlich gemacht. Die Wörter verdanken ihre Entstehung mathematischen Gesetzen. In Alphabet war es die Fibonacci-Reihe, die in der Chaosforschung eine Rolle spielt, weil sie rückgekoppelte Wachstumsprozesse beschreibt. In Brief im April folgt die Autorin nach eigener Auskunft einer seriellen Kompositionstechnik Olivier Messians.
Das Gedicht besteht aus sieben lyrischen Kapiteln zu jeweils fünf Strophen, deren Folge so umgestellt wird, daß die siebte Permutation zur ersten Strophenreihe zurückkehrt, Die sieben Gedichtkapital mit ihren fünf motivisch verklammerten Strophenzyklen winden sich zopfartig durch das Buch. Diese Ordnung der Sprache verhindert eine hierarchische Organisation der Motive, die sich zu einem idyllischen Kleinkosmos zusammenschließen.
Ein Haus gehört dazu mit einem Garten in dem Anemonen blühen. Eine „gaffende“ Steinfigur steht darin. Im Staub der Gartenwege baden Spatzen. Ein Granatapfel wird aus dem Obstteller geholt. Nicht weit, in der Nachbarschaft, liegen ein Spielplatz und eine Bäckerei, die sich per Reim gelegentlich in eine Wäscherei verwandelt. Die briefschreibende Person nennt ihr Alter: 44 Jahre.
Aber zugleich ist diese häusliche Welt ein Kartenhaus, nämlich ein Gedicht, das gelegentlich davonzufliegen droht. Das Haus wird „dünngeküßt“. Die Erde erscheint als rollendes Ding neben der Schreibperson, und die Dinge, die benannt werden, sind nichts weiter als Lesearten von Dingen, die anders heißen können, denn die Sprache ist unversichert, ihr Sinnbezug nicht garantiert. Das Stilleben im Atelier der Sprache läßt seinen universalen Anspruch in einer Art „intensiven Totalität“ erkennen. (Ich leihe den Lukácsschen Begriff für eine Spracharbeit, die noch das Bruchstück durchbildet und sinnvoll macht.) Ein poetischer Föderalismus ist am Werk, der die Hierarchie zwischen Ganzem und Teil auflöst.
Früh eines morgens kommen wir an,
fast ehe wir wach sind.
Die luft ist blaß und etwas kühl…
so beginnt das Gedicht, im Stile einer Erzählung, die sich zu ihrem epischen Weltaufbau anschickt. Der Übersetzer Hanns Grössel betont durch die Umkehrung der Satzkonstruktion gegenüber dem dänischen Original das Moment Zeit und macht mit der Inversion zugleich drohende rhythmische Verluste wett. Aber etwas stimmt nicht. Der Text entwickelt keine epische Energie. Das Ankunftsmotiv ist nicht der Keim eines linearen Wachstums, sondern das erste Glied eines sich öffnenden Fächers, zu dem Bilder des Erwachens, der Geburt, des ersten Schöpfungstages, des Einzugs gehören. Der Text geht nicht aus einer Wurzel hervor, die sich zum Stamm bildet und dann verzweigt. Vielmehr ist schon der Wurzelstock verzweigt. Die Elemente des Geflechts sind auf den Gesamtplan der poetischen Schöpfung bezogen, beispielsweise das Bild des Spinnennetzes, das in der ersten Strophe auftaucht. Es hat seit Ovids Arachne-Erzählung ursprungsmythologische Funktionen in der Literatur.
Die Spinne, die ohne Lehrmeister arbeitet, ist eine Herausforderung und Konkurrentin göttlicher Schöpfungskunst. Das Motiv zieht sich quer durch das Gedicht. Fast entsteht so etwas wie eine Spinnenerzählung, die auf ihrem Höhepunkt durch das Wortspiel dug/gud im dänischen Original (Gud bedeutet Gott) in einen universalen Zusammenhang rückt. Der narrative Faden des Spinnenmotivs läuft in der konventionellen Vorwärtsrichtung. Gelegentlich stellt die Autorin die Zeitfolge auf den Kopf und erzählt rückwärts wie im Falle des Granatapfels, der seinerseits wegen seines reichen Kerngehäuses ein altes Lebenssymbol ist. So entsteht quer zur Gleichzeitigkeitsebene des Textes ein narratives Verkehrssystem entlang verschiedener Uhren, das durch Kurzschlüsse und Übersprünge mit den stehenden Bildern kommuniziert. Der Leser ist in allen Richtungen unterwegs, vorwärts und rückwärts entlang der Buchstaben, in Windungen den Strophenzöpfen folgend, den sich entfaltenden Motivfächer zusammenlesend, die Sprachelemente als Univeralmetaphern entziffernd.
Der Brief, der da in einem stillen Zimmer des Gartenhauses geschrieben wird, verwandelt sich mit jedem neuen Sinnweg in ein immer hermetischeres Gebilde. Die offenste, gerichtetste Form von Sprache schließt sich mit wachsender Komplexität zu einem Weltbild. So erlangt die moderne Idyllendichtung auf neuer ästhetischer Grundlage ihre kostbarste Eigenschaft zurück: die kunstvolle Verbindung von Winkel und Welt.
Sibylle Cramer, die horen Heft 168, 4. Quartal 1992
„Als ihr Alphabet mich in die Hand nahm“
IN INGER CHRISTENSENS REGISTERN reicht eine chinesin ihre hirse-terrine ins reisgericht, eine geste. in ihrer strengen geste ist gerste geschichtet, in ihrer gerste gries – eine geschichte
nicht seit gestern erst
sicher ist, es geschieht in stiegen
renitente striche erregen ihren geister-sinn
escher, ein trichter sticht in see, es regnet, seiner reise schritt riecht schnee
in nestern regieren schein-einheiten, steineichen niesen ringe, es ginstert
sechs echsen reinigen sich
inger christensens register erreichten schneisen
ihr interner steg richtet sich gegen schienen, sie entrinnen, sie entrinnen nicht, einstein, richtiges sternengetier, echte stirnen
eines nicht geringen tisches reiche genießen chitinschicht – ihr einstieg rechnet sich eher genetisch, negiert eiserne thesen: sichtlich ein teich
(gestern hingen sie in nischen, ein geschirr-test ihres schieren seins – triestiner gneis hingegen regeneriert sich)
ich sehe, hier ist strittiges erreicht, ein innen-hirn-gesicht, sicher, sie singen es in eins: sehr riesig, sehr in teig gestrichen – trichinen! rettich! stets ein geschrei in engen resten, hinein, herein, es ist nicht ihres, nicht seins −
richtig, ein geister-schnitt, ein scheren-riß, ein geniestreich-gitter „estrich“ – nein, ein reigen gesichter, gesichte, hie steingeschichte, hie trennstrich, hie einsicht: ich sehe sensen, hirse, reis, gries, gerste, rieche gerne ihren gischt-regen in trichtern hinter registern gesintert −
hier ist er, hier ist er nicht, hier geschieht’s
INGERCHST AUS IHREM VORKOMMEN GEKLAUBT: und ziemlich einfach darin zu bauen, denke ich, so in „variablen Homophonien“ aus dem 9-Buchstaben-Raster gelautet, der Inger Christensen heißt und bedeutet – denke ich freiwillig, wenn das Tentakelwerk sich dann freilich wie selbsttätig in Gang und etwas in Sprache setzt, das an die Hexenprobe des Mittelalters gemahnt: Beweise mir, „Stechring“, dass du bist was du nicht bist, Spielregel Sprache, die du du bist, die du ich bin – ob du schwimmst, ob du geschwemmt wirst, ob du dich anfühlst oder es dich anfühlt, Bild, das du dir und mir machst von der Welt, die sich ausmacht, wenn sie dich über sich hinaus liest, selber eingeschränkt, wie es (wie Sie hören konnten) im Raster der Fuge der 9 Lautbuchstaben geschieht −
ziemlich einfach auch noch zu bewerkstelligen, wenn man denkt, selbst im 26-Buchstaben-Raster, mit welchem, über welchem und in welchem in unseren Breiten die Welt aufgeht −
und geradezu läppisch einfach, wenn ich mir vorstelle (und wir alle können es ja mit unseren 9 oder 26 Milchzähnen!), wie komplex ein Denkgebilde etwa aussähe, wenn, sagen wir, die ganze Haufendispersion der Milchstraße bloß ein Dialekt unter vielen anderen einer sich denkenden Milchsäure wäre! Oder wenn im Tuten einer Güterwagenlokomotive eine historisch unbekannte Zahl von Sonnenauf- und -untergängen in den Schlund eines einzigen Buchstabens stürzte, von dem die Zwischenstufe zum Klang sich auf halber Strecke, zwischen der alten Seidenstraße und einem Pfauenschrei im Innenohr des ausgemalten Himmels über der Zwergin Nana von Mantua eben erst anbahnen täte −
aber, und diese Einsicht verdanke ich all den Texten genannt Inger Christensen: auch solche Alphabete in statu nascendi müßten sich ganz einfach anfühlen – eine textorganische Empfindung genannt Erkenntnis. Könnte ich „staunen“ sagen, ohne „staunen“ sagen zu müssen, wäre somit und hierin „sich anzufühlen“ möglich wie etwas in dem und indem gerade erst wird, was es wahrnimmt, den Schritt, der er war im Schritt, der es wird. Wüsste sich ja fast so einfach anzufühlen wie Inger es dänisch buchstabiert, denkt mein Deutsch, irgendwie im Spektrum der transitorischen Milchsäure, die sich organisiert.
Wir sind hier übrigens auch mitten in der Gattungsproblematik einer „Laudatio“. Rühmen, von diesem hier zu jenem dort, das ist’s, konnte einer sagen, als Konnexitäten einmal klar wie ein Glaubenssatz schienen – hier Newton, da der Apfel.
Welche Sprachwelten haben seit wann sich global gewandelt. Auch Physik ist eine Sprachwelt. Doch ich ist seit jeher ein anderes, Mantegnas ausgemaltes Weltzimmer hat’s gewusst. Ingers Brunnen von Rom wissen es, und die Arterien im permutativen Wirbel des hellroten Cabrios loben die Baumeister nicht, sie sind sie. erschrocken wie beglückt.
Laben, leben, loben, die Ijub-Lupe Chlebnikovs wie die Lippenblütler aller Liebesbrüter – vom Lorbeer des Lobs fällt aber – Obacht! – in unserem Ohrbereich des hautnahen Spiels im Nu das Ob ab: Stoßbote Staunen: ob’s – verdammt und bitte, die optative Optik – möglich sei, dass Materie sich liest, sich lesen möge, ja sie tut’s doch, noch, Ontologie wird Poiesis, sozusagen indeterminiert bedingt, ihr Ob vom Lob des skandalösen Anfangs, quasi ein Hiobs-Apfel-Abfall aus dem Oberbegriff. Ich ist, weil es wird, permanentes Fallobst, mal als Ichthyosaurus, mal als Bin-Birne, jedenfalls ein Obsassa (manche sagen dazu Quantensprung, manche sagen Übersetzung) eines sich verstört wahrnehmenden, also mit einer gewissen Wirkung selber generierenden „Lebens“. Traumwandlerische Entscheidungsfreiheit dann die Entzweiflung des Apfelmännchens in der Bifurkation. Chaobst aus der Baumschule eines Inger-Textes von der flüssigen Algebra ihrer Alchemie.
Und kleine Lobotomie eines Lobsters in Ingers Laudation. Die ist natürlich ihr Text. Das sind die Teile und die Kräfte zwischen ihnen. Ob das genüge.
A
BLOSS NEULICH WAR’S, am 16. Januar dieses Jahres, Sechzehnter Erster Fünfundneunzig. Oder Eins Sechs Eins Neun Fünf Oder, andere Lesart, Sechzehntausendeinhundertfünfundneunzig.
Wir lernen Sprachen wie ein Datum, da aus Inger Christensens sechzigsten Geburtstag bereits im Augenblick des Abhebens vom ABC: Wieso bist du oder warum ist mir Sechs Null Sechzig. Oder eben, aus der übergreifenden Grammatik einer solchen Flugbahn, in der unsere Sprachen („Dänisch“, „Französisch“, „Neuhochdeutsch“, „Spanisch“, „Englisch“, „Polnisch“ und so fort) im Flickenteppich einer Cumulusdecke auf dem Augapfel zusammen schwimmen, für sie notiert:
sechszehntausendeinhundertfünfundneunzig
inger zum sechzigsten
teilbar durch fünf
das datum wie die jahre
ganz ernsthaft
was war zum beispiel („ballspiel“)
am dritten februar neununddreißig
oder wie man sich mit zwölf erinnern könnte
einmal vier (und ein wenig drumherum)
womöglich gewesen zu sein
eher den tag
als den abstand
eher einen allgemeinen zustand
als den tag
teilbar durch fünf
datum wie jahre
gibt es primzahlen
wie denkt sich das wort primzahl
wer stellt sich wolkenlos darunter
und darunter irgend etwas vor
warum denkt sich das wort
teilbar wie unteilbar
zwischen 16195 und 3239
kommt möglicherweise etwas ins spiel
das kein spiel ist
nämlich dies und das und
zwischen dem und dem und
ortung und willkommenszeit
verpuppt sich dann ach die koordination aber leichtgläubig in knochenarbeit – „wie“ ein heuschreck „wie“ ein differenzialgeblase „wie“ eine sanduhr für metaphern −
tritt konjunktion ein („möglicherweise“)
und entpuppt sich als primzahl und
wir stauen: dominoklötze: teilbar durch fünf nächte fünf pfauen fünf augen
wenig domestiziert doch in die eigenschaften
aaaaavon na-
men und namenslisten genommen sagen wir wir
aaaaaund und
und das hündchen wirbelt aus der milchstraße heraus in eine primzahl die keine verneinung der anderen fünf augen ist in dieser syntax die keine eigenschaft der anderen fünf milchstraßen ist in diesem zustand zwischen 16195 und 3239
aaaaader eher staunt
als dass er teilbar ist an einem solchen tag der kein abstand ist von jahren & texturen die teilbar wären (heute) durch fünf
und willkommen und
zum ballspiel und
warum ein datum sich denkt
N
DEM NETZ IN DIE NATUR GEGANGEN – der Netzhaut Sprache; und der Iris, ihrem Stiefvater oder Störfaktor, das ist nämlich der Briefträger des Störs an die verflossenen Adressen und Absender gestriger und kommender Verknüpfungen – sage ich mal, gestelzt, in schiefen Metaphern, eingedenk der Sprache, die ja selber, um überhaupt zu reden, ständig verblümt und unverblümt auch „danebenhaut“ – während Ingers Texte sich doch so einfach und ohne Metapherngepränge oder gründelndes Nominalornament eben einfach wie der Seidenfaden in seinem Kokon der Konnexitäten traumwandlerisch zu entrollen scheinen. Man kann das nur holprig umschreiben, was in ihren Texten wie mit leichtester Hand passiert.
Und gleichzeitig wahnsinnig beglückend künstlich ist. Und das Wahnsinnige daran, dass man es nicht merkt. Wenn ich etwa an den als „symmetrische Permutation aus 5 Elementen“ gebauten Gedichtband brief im april denke. Oder an das trotz seiner nur 70 Seiten ins Unermessliche geworfene alphabet: Stichwort Fibonacci-Reihe, eine ganz bestimmte Art ausschreitender Zahlenprogression, bemessen hier in Verszeilen, nach der die Grammatik der 14 Abschnitte des Buchs, die also vom A bis ins symbolische N reiche, ihren Schneeball bilden.
„Proteus & Mandelbrot, oder Das Nüchterne Entzücken“ heißt dann vielleicht meine barocke Lesart ihrer leichtfüßig strengen Brüderlichkeit, wenn man so sagen kann angesichts der Textgenese aus dem mathematischen Verfahren – ich will das gar nicht kontrollieren müssen.
Ich muss es ja gar nicht kontrollieren, wo es ist, das Verfahren. Es sagt sich, und du sagst es ja und hast mich Lesenden ja erst hergestellt, Teil seines keiner Kontrolle bedürftigen gegen Kontrolle sich regelrecht stemmenden Erschreckens, da zu sein im Satzbau „avant la lettre“ – hat mir der Faden gesagt, Bewusstsein, die komfortable Unleserlichkeit.
WEISER KONTRAST −
Wie die Fadenheftung dieser schönen weißen Bände, von Kleinheinrich, auch so ein „Ob“ aus dem Lob, wenn sie da sind, und wie Hanns Grössel ja im Spiel ist darin, auch wenn niemand sich fragt, oder gerade weil niemand beim Lesen sich fragt, wer ist die Autorin und wer ist ihr Übersetzer? Denn was Hanns Grössel da seit Jahren unternimmt (intim, dezent, kundig, so absolut verlässlich), ist, und der Text weiß das, und Inger weiß das beim Schreiben auf ihre Art, und Hanns Grössel bei seiner Tätigkeit auf seine Art, eben wieder nichts anderes als die bewusste Hexenprobe, der sich jede wirkliche Übersetzung stellt: Beweis mir, dass du bist was du nicht bist, Übersetzung, Original.
So wie Inger Christensen seit Jahren das Gleiche unternimmt, was wirklich Schreibende in allen Sprachen tun: rerum natura und vitae natura gleichsam gleichzeitig zu sein und werdend zu bedeuten −
weißer Kontrast.
Nichteingestandenes inklusive. Wenn Ingers Texte einen lesen, während man sie liest, gibt es, Überfluss und Abfall, ja immer ein kosmisches Teflon der Gefühle „im Moment des Umschlags“, wo ihr Zustandekommen kein Epitheton verträgt, immer punktuell einen Stich, doch ständig unterfüttert vom besagten Staunen und Schlucken darüber, ob überhaupt etwas sein und heißen kann und darf und möchte – universell schon im solidarischen Kleinmaßstab der Spinne, der Sinne.
Proteus eben, das selbst sich Wandelnde, und nicht Prometheus, das Transportvehikel mit dem mimetischen Touch von Vorbestimmung und Verheißung („promettre“!), scheint mir, ist der Spinnfaden ihres Gehirns wie dessen Granatapfel, den Inger Christensen in die Hand nimmt und schneidet; so wie in Säften aus filigraner Süße eine kleine Über-Säure zu kosten ist.
Wo das Pfauenauge mich auftut, sich liest – herrlich asymmetrisch (schon wegen der Zeitschlaufe von Flügel zu Flügel), bestürzend unvorhergesehen (schon wegen der Musterung im Wiedererkennen), ruhig bis jähzornig, wie tanzend
die langen Pinselstriche
als ihr Alphabet mich in die Hand nahm
von Sprachraum zu Sprachraum, Hörsaal zu Hörsaal die Welt und ihre Lesbarkeit gegen den Standard im Standort „Niels bohrende Frage mit den Wildgänsen“ – der Traum vom Original:
Ingers Geheimnis
− das ich nicht berühren kann. In seinem Unterschied fühlt es dich etwas anders an als du es anfühlst. Dort bin ich anders vorgedacht und nachgebracht, verneige mich unruhig. Und danke.
Laudatio zum Preis der Stadt Münster für Europäische Poesie 1995 von Oskar Pastior auf Inger Christensen und Hanns Grössel, erschienen in: Als ihr Alphabet mich in die Hand nahm, Daedalus Verlag, 2011.
Zu Inger Christensen
Inger Christensen ist 1935 in Vejle an der Ostküste von Jütland geboren. 1958 legte sie die Lehrerprüfung ab und arbeitete danach eine Zeitlang an der Kunsthochschule in Holbade. Ihren ersten Gedichtband, Lys (Licht), veröffentlichte sie 1962, den zweiten, Græs (Gras), 1963. Darin werden, wie der Kritiker Torben Brostrom damals schrieb, „neue Wortsituationen (…) geschaffen, die noch nackter einen Bewußtseinszustand festhalten können, weniger um die Dinge zu überraschen, als um die Dinge und die Wörter verraten zu lassen, wer wir sind. Die Gedichte zeugen für ein Streben danach, die Bastionen des Ich niederzureißen und durch dichterische Erkenntnis zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl vorzustoßen, das Abstände aufhebt, und den Ausdruck dafür quer durch die Sprache zu finden, die so häufig die Dinge nur fremd macht“.
1964 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, Evighedsmaskinen (Die Ewigkeitsmaschine oder Perpetuum mobile), eine satirische Etüde über die Gestalt Jesu, deren vorherrschendes Stilmerkmal eine „doppeldeutige Sprache“ ist (Emil Frederiksen). Zum kompositorischen Grundprinzip wird das Spielen mit und das Durchspielen von Sprachmustern in ihrem 1967 erschienenen zweiten Roman, Azorno („Azorno“, dt. 1972). Inger Christensen hatte, wie zur gleichen Zeit in Schweden Lars Gustafsson, die Arbeiten des amerikanischen Sprachwissenschaftlers Noam Avram Chomsky kennengelernt. Dessen „Ideen über eine angeborene Sprach-Fähigkeit und über allgemeingültige formale Regeln für den Satzbau, die zwar auch für die Struktur der Sprache bestimmend sind, die zugleich aber ermöglichen, daß ins Unendliche Sätze generiert werden“, hätten ihr „ein phantastisches Glücksgefühl“ gegeben, schreibt Inger Christensen in dem Aufsatz „I begyndelsen var kødet“ (Im Anfang war das Fleisch) 1970:
Eine nicht beweisbare Gewißheit, daß die Sprache eine unmittelbare Verlängerung der Natur ist. Daß ich dasselbe ,Recht‘ hatte, zu sprechen, wie der Baum, Blätter zu treiben.
1969 erschien Inger Christensens bisher umfangreichste lyrische Arbeit, der Gedichtzyklus oder, besser: das Großgedicht Det (Es), an dem sie unmittelbar nach Abschluß von „Azorno“ zu arbeiten begonnen hatte. „Man kann Det als ein Modell der Welt auffassen“, schreibt Uffe Harder, „der Welt, wie die Autorin sie um sich sieht und wie sie sich vorstellt, daß sie sein könnte. Der Text ist mit anderen Worten nicht nur ein Modell von etwas Bestehendem, sondern auch eine Utopie. Außerdem ist er eine Handlung, denn indem sie sich zu der Welt, Über die sie schreibt, verhält, greift lnger Christensen gleichzeitig in sie ein. ,Es könnte Wörter geben / die aus sich heraustreten / als Realitäten‘, heißt es an einer Stelle gegen Ende des Buchs, und Det handelt nicht zuletzt von den Bedingungen für diese Verwandlung.“
Als einen Anstoß für ihre Vorüberlegungen zu Det nennt Inger Christensen Lars Gustafssons Aufsatz über das Problem des langen Gedichts, „Beobachtungen an Gedichten“ (1965); insbesondere greift sie daraus die Frage auf: „Gibt es in der Summe unserer Erfahrungen, so wie sie in unseren Begriffen auftaucht, in dem wissenschaftlichen Weltbild, das wir besitzen, in unserer Anschauung über die Gesellschaft und die Traditionen hinreichend Gemeinsamkeit und gemeinsame Übereinstimmung, um eine Unterlage für ein funktionierendes allegorisches Gedicht bilden zu können, das in seiner Vieldeutigkeit sowohl Faktizität (Faktisches) als auch Selbstbespiegelung absorbieren kann?“ Derselben Frage – der Frage nach einer „Unterlage für ein funktionierendes allegorisches Gedicht“ – geht sie in einem Aufsatz über Dantes Divina Commedia nach, den sie „Die gemeinsame Unlesbarkeit“ (Den fælles ulæselighed, 1969) überschrieben hat. Darin ist auch von dem Verhältnis zwischen Idee und künstlerischer Ausführung die Rede: „Die Idee“, schreibt Inger Christensen, „existiert vor dem künstlerischen Verlauf, aber in einem Aufblitzen, unfaßbar, unlesbar, / erst wenn sie aus ihrer grundsätzlichen Unlesbarkeit herausgeholt wird, entsteht die künstlerische Struktur und die philosophische Systematik.“ Ihre Überlegungen zu Dante schließen mit den Sätzen: „Dante versetzt seine Theorie und seine Erfahrungen in Schwingungen, bis die Vision der neuen Welt, des neuen Lebens vor seinen Augen entsteht. Er kannte es schon vorher, aber schrieb es, um es kennenzulernen. Und schrieb es, um die Welt lesbar zu machen bis zu dem Punkt oder Augenblick, wo der Autor selber mit der Welt in ihrer gemeinsamen Unlesbarkeit zusammenfallen muß.“
Zur Lyrik kehrte lnger Christensen 1979 mit Brief im April (Brev i april) zurück. Diese siebenteilige Gedichtfolge ist in Paris entstanden; die Gliederung der einzelnen Teile folgt einem um die Zahl 5 variierenden Aufbaumuster, das Inger Christensen nach eigener Auskunft einer von Olivier Messiaen benutzten seriellen Kompositionstechnik entlehnt hat. Schon Det aus dem Jahre 1969 hatte eine zahlenkombinatorische Grundlage, die auf der Zahl 8 basiert. Ihrem Alphabet schließlich (alfabet, 1981) hat Inger Christensen die sogenannte „Fibonacci-Folge“ zugrunde gelegt, „eine mathematische Reihe mit der Zahlenfolge 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, in der jedes Glied die Summe der beiden vorangegangenen Glieder darstellt“, wie sie in einer Anmerkung erläutert.
Die vierzehn Abschnitte von Alphabet fangen jeweils mit einem der ersten vierzehn Buchstaben des Alphabets an. Außerdem verweist der Titel auf die Formel vom „Lesbarmachen der Welt“, die Inger Christensen auch in einem programmatischen Text aus dem Jahre 1971 aufgreift, in „Die klassenlose Sprache“ (Det klasseløse sprog); darin heißt es:
Es ist nicht meine Absicht, Vermittler oder
Produzent von Meinungen und Ideen zu sein (…). Ich will auf die Blindheit einwirken.
Die Menschen schaffen die Geschichte in einer verworrenen Mischung
aus Bewußtsein und Blindheit.
Das Bewußtsein kennen wir, es hat seine Variationen; mag
sein, daß sie immer mehr werden und in der Praxis unüberschaubar,
doch im Prinzip ist das Bewußtsein der bekannte Faktor.
Doch stets ist es der unbekannte Faktor, worauf einzuwirken sich lohnt.
Doch auf die Blindheit läßt sich nicht dadurch einwirken, daß wir die Wahrheit suchen.
Auf die Zufälligkeit läßt sich nicht mit Meinungen einwirken.
Doch der Würfelwurf ist es, worauf eingewirkt werden muß.
Ich betrachte es als die Aufgabe eines Schriftstellers, einen Code
zu konstruieren, der den Würfelwurf lesbar macht
und sich ein Zeichensystem vorzustellen, das die Blindheit übermittelt,
kurzum, ich betrachte es als die Aufgabe des Schriftstellers,
sich mit dem Unmöglichen zu beschäftigen, dem Unvollkommenen, dem was
außerhalb liegt
versuchsweise eine Sprache zu gebrauchen, die nicht existiert, noch nicht. Diese nicht-existierende Sprache nenne ich die klassenlose Sprache. In demselben Sinne, wie die nicht-existierende Gesellschaft von vielen die klassenlose Gesellschaft genannt wird.
Hanns Grössel, Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 2, April 1988
Mehr als ein Gedicht
– Variationen zum Zyklus Brief im April von Inger Christensen. –
I
00000 und die welt ist eine weiße wäscherei,
aaaaaaawo wir gekocht und gewrungen
aaaaaaaund getrocknet und gebügelt werden,
aaaaaaaund wassergescheitelt
aaaaaaaund preisgegeben
aaaaaaastieben
aaaaaaawir zurück
I
0000 Zurück sich denken? Nach vorn? Wo sind wir denn überhaupt? Die Geschichtslandschaften hinter uns sehen pittoresk aus oder erschütternd, je nach Lichtfall: Geschichte der Evolution, Geschichte der Kulturen, Geschichte der Moderne, an deren Ausgang das einundzwanzigste Jahrhundert allmählich abhebt in seine virtuell globalisierte Zukunft – aber wir, die einzelnen, wo leben wir denn? Jetzt, hier? Wir sind einzelne nur in Geflechten, wir denken, handeln, überleben nur in Geflechten, und doch: Wir fühlen allein, jede und jeder für sich. Schmerz, Lust, Erkenntnis müssen wir einander übersetzen, selbst da, wo Zellwand gegen Zellwand reibt. Wenn der Funke springt, begreifen wir für einen Augenblick alles, jede Wurzel, jeden Knoten, dann wieder nichts. Nichts in unzählbarer Gestalt und Vielfalt.
I
0 Im Berliner Zimmer zieht Ines Lindner frische Laken auf, wahrscheinlich summt sie dabei, ein paar weiche, selbstvergessene Töne, die die Falten glattstreichen, obwohl sie das Summen nicht erwähnen wird, wenn sie ihren Text damit beginnt, daß sie ein frisches Laken aufzieht und Birgit Kleber einen neuen Film in die Kamera einlegt.
I
00 Wie linear müssen wir uns ein Gedicht denken? Das mündliche Gedicht, das aus Rhythmus und Klang entsteht, ist von der Linearität des Hörens geprägt, und auch das schriftlich angelegte, aber mündlich vorgetragene Gedicht muß sich ihr beugen. Vor jeder Suggestion, die sich aus der affektiven Sprachverarbeitung von Stimmfärbungen, Atemgeräuschen, emotionalen Ober- und Untertönen ergibt, ist das Sprechen schon in der Unumkehrbarkeit des Hörens gefangen. Kein Hören kann sich von dieser Grundbedingung freimachen. Erst das Denken, Empfinden, Verstehen hat die Freiheit, die lineare Zeit mit anderen Konzepten der Großhirnrinde zu kreuzen, den Abwägungen und Spekulationen etwa, die das Sehen ermöglicht. Im Wortsinn „ermöglicht“, denn genau hier entsteht der Möglichkeitssinn: das linke Auge sieht etwas anderes als das rechte. Nur mit einem Auge zu blicken, erzeugt eine flache Welt. Aber wer könnte entscheiden, daß die flache Welt des linken Auges gültiger sei als die des rechten? Einzeln stellen beide je eine Variante vor, die von der anderen nicht widerlegt wird.
I
000 „Zyklus“ und „Gedichte“ fügen sich zu einem Thema, das sich in der Geschichte der Poesie wie von selbst ergibt – aber noch ehe ich zuende genickt habe, hakt schon etwas im Nacken, und jetzt kann ich den Kopf nicht mehr drehen, wie ich will. Nämlich: wenn nach meinem Verständnis die Gedichte Körper sind, eigene Entitäten, was ist dann ein Zyklus? Eine Art Ringelreihen? Von was denn? Nähme man eine so strenge, traditionelle Zyklenform wie den Sonettenkranz, gliche das Verfahren eher einer Transplantation als einem Tanz, wenn jeweils die letzte Zeile eines Gedichts im nächsten als erste weitermachen muß und alle zusammen schließlich den künstlichen Körper des Meistersonetts bilden. Oder umgekehrt? Sind die vierzehn Gedichte nur Schlingen, nur Ausstülpungen des fünfzehnten?
II
000 Das Sprechen in seiner linearen Entfaltung formt die Erfahrung, den Körper zu verlassen, aus sich herauszutreten in einen realen Raum, der nicht der eigene Körper ist. Die Stimme transzendiert den Körper, ohne (wie das Denken) diesen realen Raum außerhalb des Körpers zu entwirklichen; im Gegenteil macht sie ihn erst fühlbar. Aber niemand verläßt seinen Körper wirklich, es sei denn sterbend. Sobald ich auf das Wort Körper zu horchen beginne, taucht in mir die Vorstellung von Toten auf. Das ist wie eine Erinnerung daran, daß im Mittelhochdeutschen die Bezeichnung Körper (aus dem lateinischen corpus) das ältere Wort Leiche verdrängt hat. „Leiche“ ist mit „gleich“ verwandt, und das bedeutet etwas wie „Gestalt“. Aber im Englischen ist es zum Beispiel umgekehrt – dort ist aus corpus das Wort für den toten Körper geworden, corpse, während der lebende Körper body heißt, was aus der Familie der Wörter für Gefäße zu kommen scheint. Der heutige Sprachgebrauch im Deutschen – daß Leiche nur einen toten Körper bedeutet, während das Wort Körper alles meinen kann, wie im Falle des lateinischen corpus – scheint darauf hinzudeuten, daß bei Bezeichnungen für den Körper die Unterscheidung in tot oder lebendig eine schillernde Frage ist, wichtig und unwichtig zugleich.
II
00 Wie linear also lesen wir ein Gedicht? Wir könnten unbekümmert tun, indem wir die Schrift nur als eine Notation auffassen, eine Partitur für das gesprochene und wieder zu sprechende Gedicht. Laut zu lesen scheint der unmittelbare Vollzug dieser Anweisung zu sein. Wir lesen das Gedicht vor, das auf dem Blatt steht. Aber wenn wir still für uns lesen, lesen wir auch dann das Gedicht, das auf dem Blatt steht? – Ohne Stimme zu lesen bedeutet eine gänzlich andere Operation als das Nach- oder Mitsprechen des Gelesenen. Sobald nur die Augen lesen, beginnt das Vexieren.
II
00000 untröstlich
aaaaaaasichtbar
aaaaaaawie sorgfalt
aaaaaaaund tätigkeit,
aaaaaaadas lange
aaaaaaagedächtnis
aaaaaaader frauen,
aaaaaaaliebkosungen
aaaaaaaund küsse
aaaaaaain einer anderen
aaaaaaaart sprache,
aaaaaaadie die
aaaaaaader zeichen ist
II
0000 Waren Gedichte nicht immer riesige Projekte auf kleinstem Raum? In der Poesie arbeitet etwas, das vielleicht in allen Künsten arbeitet, auch in den wortlosen, rein darstellenden Künsten, ein eigener Denktrieb nämlich, der sich nicht in die engen Raster der traditionellen Begriffe von Rationalität einsperren läßt. Wenn es diese engen Raster abendländischer Schulweisheit überhaupt noch gibt, d.h. wenn sie heute dort noch maßgeblich erscheinen, wo tatsächlich über das Denken nachgedacht wird. Längst werden in den Neurowissenschaften wie in der Philosophie neue Konvergenzen zu jenen eigensinnigen Denkprojekten skizziert, die sich im weiten Spielfeld der Kunst voranbewegen. Ihr Sinn und Nutzen liegt gerade nicht in der Ausgestaltung von Systemen allgemeiner Gültigkeit, sondern in der Individualität ihrer Welterschließungen. Das, was wir Denken nennen, eine permanente Großhirnaktivität, die schon zwischen Selbst- und Weltvergewisserung nicht sicher unterscheidet und daraus doch unentwegt Bewußtheit, Verhalten, Entscheidungen erzeugt, ist kein Privileg des abendländischen Verstandes in einer von logischen Schlüssen determinierten Welt.
II
0 Birgit Kleber hat immer Gesichter fotografiert, so nah, so nackt, daß niemand sich in seiner Mimik verstecken kann, wenn sie hereinkommt und ihre Kamera auspackt, ein paar beiläufige Sätze sagt über das Interview, die Redaktion, eine Ausstellung, das Licht aussucht, ihre Wünsche erklärt. Die öffentlichen Gesichter setzen ihre Tricks auf, lächeln, blicken, aber das nützt ihnen nichts. Birgit Kleber hängt sie in die Schwerkraft und wartet.
III
0 Vielleicht ist es ja über die Jahre hin heimlich das Summen gewesen, das Ines Lindners Texte über Birgit Klebers Fotografien geschrieben hat. Die Geduld dieses Summens, die Gelassenheit. Ich spüre, daß es eine Methode ist, gleichzeitig genau hinzusehen, den ordnenden Blick der Kunstgeschichte anzulegen, darüber Thesen und Assoziationen zu formulieren, und doch am Rand des Blicks eines Unscharfen, Unerwarteten, Unerklärlichen gewahr zu bleiben. So zeigen die Texte uns die Bilder von zwei Seiten her, bis wir in der Mitte, fast schielend, erst das Entscheidende sehen: wie nämlich das Warten aus den Gesichtern alle Absichten abläßt. Weiß und geduldig blicken sie in die Schwerkraft, bis ich sie so deutlich sehe wie die Laken im Berliner Zimmer. Diesmal wird Birgit Kleber noch länger warten.
III
0000 Auch Iteration ist ein mathematischer Begriff und bezeichnet das sogenannte Näherungsrechnen, bei dem bestimmte Rechenoperationen in Folge wiederholt (iteriert) werden, um die größtmögliche Annäherung an einen Grenzwert zu erreichen. Die Bezeichnung geht auf das lateinische Wort iteratio, iterationis f. zurück, das „Wiederholung“ bedeutet, auch im Sinne einer rhetorischen Figur, und ist mit dem Verbum ire für „gehen“ verwandt, von dem das Substantiv iter, itineris n. abgeleitet ist, „Gang, Marsch, Weg“ usw.
III
000 Dann ein Geruch, der beiläufig die Frage stellt, ob dem männlichen Körper Zyklen auf vergleichbare Weise eingängig erscheinen wie dem weiblichen? Aus der Sicht der Gender-Forschung ist das eine gefährliche Art zu fragen, zumindest eine unbedarfte. Denn die soziale Ordnung der Geschlechter leitet sich nicht aus den realen biologischen Unterschieden ab, sondern bildet daraus, wie diese Unterschiede wahrgenommen und interpretiert werden, eine kollektive These. Deshalb sieht in jeder Kultur, jeder sozialen Konstellation die Zuschreibung von weiblich oder männlich anders aus. Der biologische Unterschied erscheint sozial markant, wo es um die unmittelbare Reproduktion der Spezies geht. Aber ist das Mädchensein an einem beliebigen, noch nicht reproduktionsfähigen Kind markanter als der Umstand, daß es als eins von zwei Kindern stottert? Der andere, der stottert, ist ein Junge.
III
00 Das Kind, das auf dem Topf saß und sang, hat auch später nie gelernt, etwas anderes zu binden als seine beidohrige Kinderschleife. Kaum besser ist es ihm mit den Knöpfen ergangen. Die Knopfkiste meiner Urgroßmutter stand in einem flämischen Eichenschrank. Eine junge Frau aus der Bauerneifel, die zwei Weltkriege früher in der fernen Großstadt Aachen ein eigenes Kurzwarengeschäft eröffnete, aus dem ein paar Dutzend Knöpfe sich bis in meine Kinderzeit vererbt hatten. Wie kommt so ein Knopf ans Hemd?, fragte sich das Kind. Mit Nadel und Faden, ließ sich herausbringen. Also nähte das Kind, von innen nach außen, bis rund um den Knopf die Fäden über den Rand gespannt waren. Dann fiel dem Kind etwas auf. Oder irgendwem anders fiel etwas auf, und eine Frage wurde gestellt. Das Kind überlegte lange.
III
00000 sag nur,
aaaaaaadaß die dinge
aaaaaaaihre eigne
aaaaaaadeutliche
aaaaaaasprache
aaaaaaasprechen
IV
00000 und die welt ist eine weiße bäckerei,
aaaaaaawo wir zu früh erwachen
aaaaaaaund zu spät träumen
aaaaaaaund wo ströme aus rohen
aaaaaaaund unbenutzten gedanken
aaaaaaader Wahrheit am nächsten kommen,
aaaaaaalange bevor sie gedacht werden
IV
00 „Zykel“ heißt der mathematische Begriff für einen Kreis mit festgelegtem Umlaufsinn, etwa der Uhrzeigersinn. In dieser Figur bildet das Lineare keinen Gegensatz zum Zyklischen, sondern einen Gegensatz zur Fläche. Aus der Linearität des Hörens entsteht in der Fläche des Blatts ein Körper mit festem Umlaufsinn.
IV
0 Gesichter in Kissen, soviel versteht man sofort, und doch prallt das Hinsehen gegen eine Irritation. Es sind schlafende Gesichter in einem so großformatigen Schwarzweiß, daß es an Kinoleinwände erinnert oder an Werbetafeln. Auf solchen Bildern schlafen die Gesichter nicht wirklich. Sie halten nur die Augen geschlossen, während die Gesichtsmuskeln wach bleiben. Diese hier sind anders. Echte Schlafgesichter, in denen die Mimik keiner Kontrolle gehorcht, wobei das Wort Mimik schon etwas darüber sagt, woher unsere Gesichter überhaupt kommen. Aus der Nachahmung nämlich. Aber das ist es nicht, was mich hier irritiert.
IV
0000 Bis jetzt, sagen alle neuen Gedichte, an denen ich arbeite, und sie sagen es geduldig, ohne Vorwurf, nur immer und immer wieder, bis jetzt hast du überhaupt noch nicht angefangen zu begreifen, was wir wollen. Die Gedichte spüren eine Erschütterung, die ich mit meinem Verstand, meinem Handwerkszeug, meinen Denkgewohnheiten nicht deuten kann, während ich mir ihrer Signifikanz gewiß bin. Als wären diese Impulse tatsächlich Schwingungen von und nach außerhalb, die nichts mit mir (der biographischen Person, dem egozentrischen Agglomerat) zu tun haben, sondern sich nur beharrlich durch die Bleischichten meiner persönlicher Begrenztheit hindurchzukämpfen versuchen. Oder nicht einmal das – durch mich hindurch gehen sie ja ohne Mühe, aber ich kann ihnen nicht folgen, ich verstehe sie nicht, wenn ich ihnen aus meinen Sehschlitzen nachblicke.
IV
000 Der Geruch wohnte in einem emaillierten Eimer im Bad, ein paar Tage jeden Monat. Das Bad war gelb gekachelt, mit rotgelb geflammten Fußbodenfliesen. In den geflammten Fliesen wohnten Gesichter, die ich heute noch sehen kann, wenn ich die Augen schließe. Niemand sonst sah sie. Eins saß als überschwerer Kopf auf einem Körper mit winzigen Gliedmaßen, die Augen in riesigen Höhlen. Dieses Gesicht hielt ich lange für meine tote kleine Schwester. Ein anderes grinste, aber ich wußte genau, daß das kein freundliches Grinsen war. Es mußte freundlich tun, damit ich meinen Fuß nicht draufstellte. Der Geruch war ein Muttergeruch. Er gehörte in eine Reihe, die irgendwo in der Mitte mit einem Summen begann, einer zärtlichen Stimme, Lachen und Nachsicht, wenn wieder der Abdruck einer schmierigen Kinderpfote auf der eben abgewischten Kühlschranktür erschien. Ein, zwei Wochen später verschwand die Nachsicht, die Stimme wurde schrill und nervös, dauernd ging irgendwas zu Bruch. Ich stellte den Fuß auf das Grinsen. Dann kam der Geruch, der die Stimme matt machte. Tagelang blieben die Pfotenabdrücke auf der Tür. Eines Morgens wurden sie abgewischt, der Eimer ausgespült, wir fuhren in die Stadt oder räumten den Kartoffelkeller auf. Und irgendwann summte sie wieder, lachte zärtlich.
V
000 Einmal Fotos, die die Gesichter von Embryos zeigen, ihre rötlich oder gelblich oder bläulich verfärbte Haut, stille, oft schon ganz fertig gebildete Gesichter, eingelegt in Formaldehyd. Die Flüssigkeit sieht man nicht, nur manchmal die Wandung der Gläser, wenn sie den Rand zu einem Profil bilden oder en face die Nase davon leicht eingedrückt wird.
V
0000 Auch das Lesen oder Hören von Gedichten ist eine Kunst, sagt eine der Stimmen im Kopf, und sie setzt in diesem Satz, mit einem „oder“ statt „und“, beiläufig etwas voraus, das ich vor einem Mikrophon erst noch ins Gedächtnis rufen müßte, nämlich, daß Hören und Lesen zwei ganz verschiedene Zugangsweisen sind; es ist eine Kunst, der die Leserinnen und Hörer im eigenen Interesse einen bestimmten Respekt entgegenbringen müssen, eigene Aufmerksamkeit also und die eigene Anstrengung, sich ihres ersten, vielleicht unvollständigen oder mißverständlichen Eindrucks zu vergewissern. Damit meine ich weniger die Vertrautheit mit einer Vielzahl von akademischen Interpretationsansätzen, die schließlich eine fast ebenso lange Geschichte haben wie Gedichte selbst, sondern eher das intuitive Verständnis, das durch Übung entsteht, so, wie man beim plötzlichen Klang eines Akkordeons nur dann in einen Tango gleiten kann, wenn man die nötigen Schrittfolgen beherrscht. Natürlich sind auch andere Bewegungen möglich, und in einer Choreographie wären sie um vieles wichtiger als die Perfektion des Geläufigen, aber beides, der unwillkürliche Schritt wie die kalkulierte Abweichung, sind Antworten auf das Wunder des Tangos (und der Tango wieder auf das elementare Vermögen der Musik, Körper in Bewegung setzen). Ähnlich geht es mir bei der Begegnung mit einem Gedicht, wenn ich plötzlich spüre, wie die buchstäblich in Fleisch und Blut übergegangene Vertrautheit mit poetischen Formen um diesen Augenblick einen Bann schlägt, in dem Frage und Antwort, Abwehr und Verstehen, Fremdheit und Vertrauen einander berühren wie im Tanz.
V
00000 so spielend leicht
aaaaaaawie in einer anderen
aaaaaaaart gehirn
aaaaaaahier
aaaaaaaauf dem backheißen
aaaaaaaspielplatz
V
00 Immer gehen wir in unserer Wahrnehmung von Mustern aus, willkürlich oder unwillkürlich, und verstehen die Art, wie wir die Muster wahrnehmen, als Gesetzlichkeit. Für Gedichte gilt eine affektive Physik von Rhythmus und Klang, sie leuchten auf im Denksprung. Und doch liegt ihr Reiz, ihre Gegenwärtigkeit als Denkkörper nicht darin, daß ein einzelnes Gehirn sie sich ausdenkt, sondern daß andere sie wiedererkennen. Ihre Stofflichkeit mag flüchtiger scheinen als die Stofflichkeit eines Stuhls, an dem wir uns das Schienbein stoßen, egal, wie wir philosophisch über die festen Körper denken. Aber auch Verstehen ist stofflich, es materialisiert sich buchstäblich in Mustern oder Repertoires, die sich ihrerseits aus Mustern und Repertoires zusammensetzen und die wieder aus weiteren Mustern und Repertoires. Ihre wechselseitigen Manipulationen bestehen, einzeln betrachtet, aus scheinbar einfachen Operationen wie ja/nein, an/aus, innen/außen usw. Andererseits bleiben sie aber gänzlich unsteuerbar, weil die Zahl der tatsächlich beteiligten Manipulationen nicht überschaubar ist. In unserer Art von Erkennen arbeiten wir ständig mit Schätzungen und Erfahrungswerten, die auf willkürlichen Reichweiten beruhen. Wir zählen zwei und zwei zu vier zusammen und wissen doch nicht, was mit solchen Größen im Unendlichen passiert. Unser Abstraktionsvermögen suggeriert hier „Berechenbarkeit“, weil es als besonders pfiffige Denkleistung erscheint, zwei Äpfel und zwei Birnen zu vier Stücken Obst addieren zu können. Immer wieder, egal wie oft, ergibt zwei und zwei vier, weil wir die vielfältigen Unterschiede zwischen Äpfeln und Birnen zugunsten der Operation des Zählens vernachlässigen.
V
0 Was dann? „Ines schläft“, weiß das Kind von Ines Lindner. – Im Kopfkissenbuch der Hofdame Sei Shonagon einmal sein Porträt unter der Überschrift Was lieblich ist: Ein kleines Mädchen mit Pagenfrisur, das, gebückt, eifrig auf etwas lugt, so daß die Haare ihm ins Gesicht hängen. Es streicht sich die Haare nicht zurück. Es legt den Kopf nur etwas zur Seite. – Das könnte es sein. Ich erkenne auf den Bildern seine Mutter nicht mehr. Als Birgit Kleber nach Stunden auf den Auslöser drückt, hat der Schlaf jede Ähnlichkeit mit dem wachen Gesicht von Ines Lindner gelöscht.
VI
00 Alles hat Augen, jede Falte, jedes Haar, jede Pore hat Augen, jede Linie ist eine Wimper, jede Wimper wieder ein Blick – das wäre der Beginn einer Bildbeschreibung, einer Beschreibung also, die sich nicht wie ein Gedicht aus Klang, Wortbewegungen, Metapherngelenken herleitet, sondern aus dem Ansehen dieses Bildes. Als könnte ich tatsächlich sagen, was ich sehe, nicht (oder nicht nur), was die Worte von sich aus sagen. Das Bild ist ein Bett aus Haaren und Stille –
VI
00 Tatsächlich werden ja Gedichte nicht aus Organen und Zellen gemacht, sondern aus Wörtern. Oder Worten? Eine Reihung von Wörtern oder Worten jedenfalls, nach Regeln, die ein Verfahren vorgibt oder herstellt oder ausführt. Das Verfahren bewegt Wörter. Erzeugt Worte.
VI
000 Oder Gedichte sind doch wandernde Seelen, die ein Leben nach dem anderen durchqueren, und denen, die zufällig mich durchqueren müssen, bin ich so etwas wie die Station der Katze oder die der Küchenschabe. Was ich aber nicht aussprechen kann, ohne mich sofort hin- und hergezerrt zu fühlen zwischen ganz verschiedenen Konzepten. Denn daß es so etwas wie „Körper“, „Entitäten“, „Werke“ in der Kunst überhaupt gibt, erscheint mir irritierend abgelebt, obwohl ich ein absolut zwingendes Bedürfnis danach habe. In allem, was ich als gesellschaftlich wahrnehme, wirkt der Zug ins Prozessuale, Konzeptionelle, Virtuelle unübersehbar und nicht mehr aufzuhalten. Und doch bin ich andererseits ganz sicher, daß es im Gedicht auf nichts so entscheidend ankommt wie auf Integrität, Wahrheit, etwas Direktes, Sinnliches, durch stoffliche Erfahrbarkeit Verbürgtes, wie immer man das nennen will. Aber nichts daran ist „auktorial“, sondern mir erscheint es unpersönlich, in gewisser Weise akzidentiell, selbst als Benanntes unnennbar anonym.
VI
0000 Die Anordnung der Gedichte in der Symmetrischen Permutation von Brief im April:
I 00000 0000 0 00 000
II 000 00 00000 0000 0
III 0 0000 000 00 00000
IV 00000 00 0 0000 000
V 000 0000 00000 00 0
VI 0 00 000 0000 00000
VII 00000 0000 0 00 000
VI
00000 kleiner verständiger traum,
aaaaaaawenn ich abend für abend
aaaaaaain meinem bett
aaaaaaabetten zähle,
aaaaaaawie viele
aaaaaaaund wo
aaaaaaaich geschlafen habe
aaaaaaain meinem leben
VII
00000 so jede nacht, während wir schlafen,
aaaaaaawie brot,
aaaaaaadas der wahrheit
aaaaaaaam nächsten kommt,
aaaaaaaso
aaaaaaajeden tag, während wir leuchten
aaaaaaawie rohe und unbenutzte
aaaaaaalaken,
aaaaaaawird die welt in der welt
aaaaaaader wiederholung
aaaaaaawiederholt
VII
0000 Brief im April besteht aus sieben abschnitten, jeder zu fünf strophen, numeriert mit einer anzahl von kreisen von 1 bis 5. Diese numerierung (die auf bestimmte textliche spuren verweist) folgt dem kompositionsprinzip des buches, der ,Symmetrischen permutation‘, die häufig in der musik verwendet ist. Man geht von einer reihe aus, z.b.
aaaaaaa5 4 1 2 3
und liest so:
5. element 4. element 1. element 2. element 3. element der reihe
aaaaaaa3 2 5 4 1
Die neue reihe wird auf dieselbe weise gelesen
3. element 4. element 1. element 2. element 3 element der reihe
aaaaaaa 1 4 3 2 5
Wenn man eine reihe auf diese weise permutiert, kommt man irgendwann zu der reihe zurück, mit der man begonnen hat. Hier wird die 7. permutation gleich der ersten:
aaaaaaa5 4 1 2 3
aaaaaaa3 2 5 4 1
aaaaaaa1 4 3 2 5
aaaaaaa5 2 1 4 3
aaaaaaa3 5 2 1 1
aaaaaaa1 2 3 4 5
aaaaaaa5 4 1 2 3
(Anmerkung von Inger Christensen zu Brief im April)
VII
0 Als ich ein Kind war, wollte mir niemand erklären, was eine Zahl sei. Ich konnte natürlich zählen, lernte in der Schule rechnen, aber immer, wenn ich danach fragte, was eine Zahl überhaupt ist, fing wieder jemand an, Gummibärchen in eine Reihe zu legen: Wenn du davon drei wegnimmst, wieviele bleiben übrig…? Ich war sicher, daß das keine Antwort war auf meine Frage.
VII
00 In einem Interview, in dem Inger Christensen über die mathematischen Reihen spricht, die vielen ihrer Texte zugrundeliegen, sagte sie auch:
Ich benutze Modelle, um nicht gänzlich dem Spiel der Zufälligkeiten überlassen zu sein. Mit ,Spiel der Zufälligkeiten‘ meine ich mein zufälliges Temperament, das einer von Milliarden von Zufällen ist. Wenn man das entdeckt, dann erfindet man einen oder sucht man nach einem Widerstand wie Mathematik. Mathematik ist ja ganz anders als die Gedanken, die man hat, wenn man beispielsweise herumläuft und ein Haus putzt. Einer der Gründe dafür, daß ich Systeme benutze, ist mit anderen Worten, daß ich gerne etwas anderes sagen möchte als das, was mir zuerst einfällt. Weil das, was mir zuerst einfällt, dasjenige ist, worüber man sonst herumläuft und redet, dasjenige, was einen die ganze Zeit umgibt. Die Systeme helfen dabei, etwas herauszubekommen, das anderswo herstammt, nicht bloß aus der eigenen ,Seelentiefe‘ sondern aus allen möglichen merkwürdigen Ecken. Da ich als Mensch die ganze Zeit mit Formen von Systemen konfrontiert werde, will ich, daß auch die Gedichte, die ich schreibe, in der Begegnung mit etwas ähnlichem geschaffen werden. Auf diese Weise kommt etwas heraus, Gedichte, die eine Kombination aus der Welt und mir selbst sind, und das werden Gedichte, die anders sind, als wenn ich bloß von meiner eigenen privaten Welt aus schriebe.
VII
000 Hat es denn je ein einzelnes Gedicht gegeben?
Brigitte Oleschinski, aus Ortstermine. Wolfenbütteler Lehrstücke zum Zweiten Buch II. Herausgegeben von Hugo Dittberner in Zusammenarbeit mit Linda Anne Engelhardt und Andrea Ehlert, Wallstein Verlag, 2004
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Archiv + Kalliope +
Johann-Heinrich-Voß-Preis + Europäischer Übersetzerpreis
Porträtgalerie
Nachrufe auf Hanns Grössel: Übersetzen ✝︎ FAZ ✝︎
Fakten und Vermutungen zur Autorin + IMDb + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.


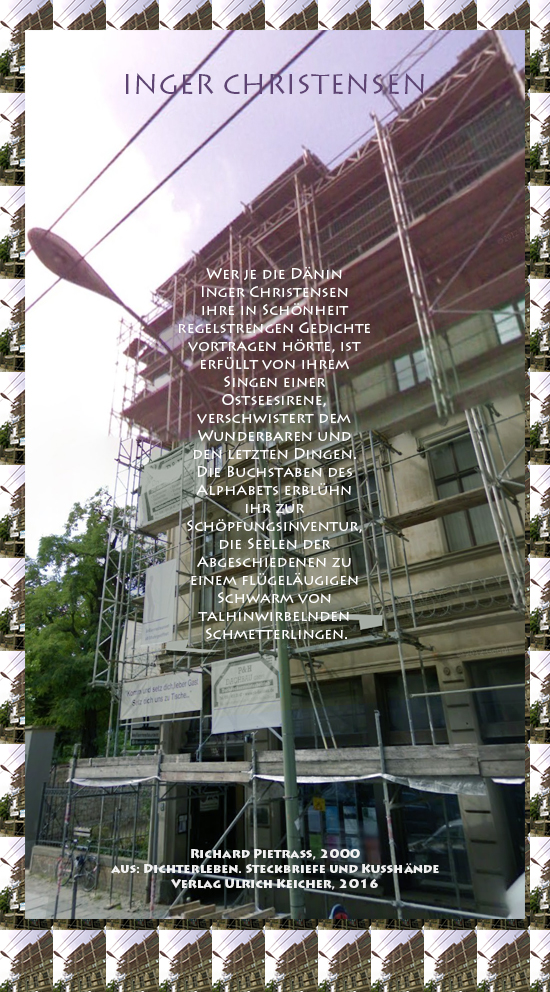












Schreibe einen Kommentar