Kathrin Schmidt: Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik
GRENZWERTBESTIMMUNG
Zwischen zwei Versen durchkreuzt mich geduldig
ein tarnfarbner Tanker im deutschen Kanal.
Ich kann mich nicht waschen, nicht haschen, nicht
aaaaaschänden,
ich kann mich nicht kürbisgelb neidisch abwenden
vom Diwan, westöstlich. West-östlich: Skandal!
So liege ich ausgestreckt zwischen den Gleisen,
so bleib ich am Leben im Schienenverkehr.
Die ausgefahrenen Straßen und Bahnen
der freien, deutschen und fliegenden Fahnen
verließ ich längst gestern, und heut schon nicht mehr.
Und heut fang ich an, in die Suppe zu spucken
und spucke mir flugs alle Zähne mit fort.
Nun muß ich mich schützen, mich stützen. Die Pfützen
des Blutes in A-Stadt und B-Land, die nützen
dem Abstand zu manchem zerschossenen Wort.
Die Mark macht mich müde, so funkt mir mein Rückgrat.
Ich ziehe sie rasch untern Rippen hervor,
die blecherne Lunge des Lebens im Streben
nach Aufruhr und Abfuhr, und leg sie daneben
und komme zum Grunde und stehe am Tor.
Zwischen zwei Versen durchkreuz ich geduldig
die Zwischenräume im Schienenverkehr,
ich spuck in die Suppe und fühle mich schuldig
der Müdheit des Marks, als läge ich quer.
Das Wagnis Metapher
„Die Metaphern“, so notierte Franz Kafka im Dezember 1921 in sein Tagebuch, „sind eines in dem vielen, was mich am Schreiben verzweifeln läßt.“
Vager zwar, aber nicht weniger skeptisch äußerte sich Gottfried Benn in seiner programmatischen Rede „Probleme der Lyrik“: Die Metapher sei „ein Fluchtversuch, eine Art Vision und ein Mangel an Treue“. Stellt es also ein Wagnis dar, auf metaphorischen Ausdruck zu setzen? Schwimmt Kathrin Schmidt, die sich vor Jahren schon zum bildhaften, metaphorischen Sprechen bekannte, gegen den Strom? Das 1982 veröffentlichte Poesiealbum (Nr. 179) ließ dies vermuten, aber erst der nun vorliegende durchkomponierte Band ermöglicht Auskunft und Einsicht, und zwar vor allem in bezug auf zwei wesentliche Aspekte: Poetologisches Programm und poetische Realisierung – dies zum einen – differieren bei Kathrin Schmidt kaum. Das variantenreiche metaphorische Sprechen prägt entscheidend die etwa fünfzig Texte ihres Debütbandes. Deutlich wird aber auch, daß die Spannkraft der Metapher, dieser, wie Robert Weimann sagt, „kleinsten poetischen Instanz“, sich jeder Reglementierung und Kanonisierung widersetzt. Es macht den Reiz und die Vielgestaltigkeit von Lyrik aus, daß das Verdikt des lateinamerikanischen Dichters Nicanor Parra („Krieg der Metapher, Tod dem Bild; es lebe der konkrete Fakt…“) ebenso seine aus Zeitumständen und Traditionsbezügen erwachsende Berechtigung hat wie Kathrin Schmidts Position („Ich liebe Bildhaftigkeit, Metaphern“). Relativ leicht fällt es, traditionelle Metaphern zu entschlüsseln, die sich zum Beispiel im Gedicht „Mittwochs“ finden. Da geht die Rede vom „Zeitkarussell“, von „Tränenschnee“ und „Schmerzlawinen“. In der letzten Strophe liest man eine ebenfalls recht konventionelle und gleichwohl berührende Umschreibung:
Der Stuhl, auf dem ich sitz, hat Katzenpfoten.
Man hört ihn nicht, wenn ich so lauthals schreibe
und mich bekenne zu papiernen Rettungsbooten.
Dieses Gedicht kann zugleich auf ein wesentliches Charakteristikum von Kathrin Schmidts Schreibart aufmerksam machen: sie kultiviert – mit wechselndem Erfolg – das Parlando als Kunstform. Über das Aufnehmen oder Ablehnen der Texte entscheidet die Bereitschaft des Rezipienten, der Bilderflut nicht zu wehren und eine entsprechende innere Gestimmtheit auszubilden.
Freilich ist eine gewisse Inflation des Metaphorischen nicht zu übersehen. Allzu beiläufig und austauschbar scheinen mir manche Verse und Adjektive. Daß ein überbordendes Bild schief werden kann, machen die ersten Zeilen von „Netzhautnetz“ kenntlich:
so sehr am morgen
schon beklemmung in den venen: die früh
schiebt die kanüle ein
das bißchen welt wölbt sich in mir
zum krummen hund, erst mittags wirft er lachende,
weinende welpen
In der Mehrzahl der Gedichte jedoch wird souverän eine expressive Bildsprache eingesetzt, begegnen uns kühne Metaphern surrealistischen Zuschnitts, die durch weite Entfernung zwischen Bildspender und Bildempfänger zu einem Appell an die Vorstellungskraft des Lesers werden.
Sinnüberschuß kennzeichnet die metaphorische Sprechweise in Versen wie „… Da strandet an den küsten / mein lippenschiff…“ („Märzen-Becher“) oder „Die Abende sind aschene Geschosse / vor denen ich in meinen Liebsten flieh“ („Mitgift“). Kathrin Schmidt gliedert den Band in drei deutlich voneinander abgehobene Abschnitte. Dennoch ist es kaum möglich, ein die Kapitel jeweils strukturierendes Thema so knapp wie genau zu fixieren. Zwischen den Texten waltet eine universelle Kommunikation, die Gedichte bedrängen, ergänzen, erweitern und korrigieren einander. Vorstellbar wäre auch: alle Gedichte relativ „unsortiert“ zu präsentieren. Die den Band als Ganzes prägende Subjektivität würde so noch stärker kenntlich: durch den Aufbau von Spannungen zwischen den Texten, durch vermittelndes gegenseitiges Kommentieren. Ein Liebesgedicht aus dem Abschnitt „Kopplungen“ neben der eindringlichen Geschichtsbefragung in „Beispiele. Jahre“? Denkbar sicherlich. Letzteres Gedicht fragt nach generationsspezifischen Erfahrungen im Umgang mit der Historie. Gestus und Zugriff auf Geschichte korrespondieren deutlich zum Beispiel mit Steffen Menschings „Amtliches Fernsprechbuch, Reichspostbezirk Berlin, 1941“. Das Gedicht praktiziert am Beispiel der Olympischen Spiele 1936 geschichtliches Sichvergewissern und verbindet sich mit der leisen, aber um so nachdrücklicheren Warnung vor dem Versinken in Geschichtslosigkeit:
träg, wie ermüdete schwimmer,
kommen die jahre an land.
über den beispielen dunkelt es längst,
sie sind hin ins vergessen
oder, verschweigen…
Den Text durchzieht gleichsam eine Wellenbewegung. Der aus Erinnerungsarbeit erwachsende Impuls versetzt das sprechende Ich in Unruhe:
hinter der schläfe
weiden noch herden durchbluteter jahre
die keiner mir austreibt.
Das ernste Spiel mit Redewendungen und gesunkenen Metaphern ist ein von Kathrin Schmidt häufig angewandtes poetisches Mittel, um die Oberfläche von Widerspruchskonstellationen und Manipulationsmechanismen zu durchstoßen. Mit erhellender Doppeldeutigkeit heißt. es in „Beispiele. Jahre.“:
… du findest
ein beispiel unter der nummer 1936
in den archiven jeder kalenderfabrik.
schwarze athleten
liefen ins gold der olympischen spiele.
Ins Messer laufen, ins Gold laufen – Lyrik vor allem vermag durch eine scheinbar winzige Modulation des Sprachsystems Wesentliches (in diesem Fall den Alibicharakter der Olympischen Spiele 1936 in Berlin) sichtbar zu machen.
Einige Gedichte (zum Beispiel „Korrosion“ und „So simpel hängt der Winter herab“) benennen Defizite in den Geschlechterbeziehungen, die Spiegel gesellschaftlicher Widersprüche sind. Sie finden ihr Pendant in Texten, die im gedanklichen Experiment die emanzipierende Kraft des Utopischen erproben, Visionäres aufscheinen lassen, „Halluzinatorischer Ausgang“ – ein beziehungsreicher Titel:
man müßte spanisch zu den versammlungen gehn,
aber ich bin weder schlank noch schwarz…
ich rege
ein kreisspiel an: wir könnten einander
berühren, ehe das schlußwort zur welt kommt!
so spanisch kommt mir das vor…
Vor fünfundzwanzig Jahren polemisierte Karl Mickel gegen den „Feinsinn“ vieler Gedichte, die von den Beziehungen zwischen den Geschlechtern handeln (NDL, Heft 2/1963). Das Gefühl erscheine in ihnen nur als „Resultat von Erwägung“. Der Dichter reflektierte in seiner Polemik die Suche nach einer lyrischen Sprache, die der Sinnlichkeit der Liebesbeziehung angemessen ist. Kathrin Schmidt hat ihre unverwechselbare Sprache gefunden. Gedichte wie „Ich gestehe“, „Die braunen Lämmer meiner Achselhöhlen“ und „Höchste Zeit“ in ihrer Mischung aus intimem Parlando, aus Rigorosität und Verletzbarkeit lohnen allein schon die Lektüre des Bandes. Möglicherweise muß die belächelte, bejahte, verneinte, auf jeden Fall heiß umstrittene Frage nach der Existenz „weiblichen Schreibens“ (Stichwort „Frauenliteratur“) stärker gattungsbezogen diskutiert werden. Den genannten Texten und auch dem Sonettenkranz „Pupillenfliegen“ eignet unzweifelhaft ein spezifisch weibliches Ferment, das sich begrifflicher Fassung womöglich entzieht.
Auf die Frage nach den für sie wesentlichen Traditionslinien verwies Kathrin Schmidt in einem Interview auf Johannes Bobrowski und die expressionistischen Lyriker, nannte auch Ungaretti, Lundkvist, Brecht und Volker Braun. Vermutlich gaben in den letzten Jahren auch die frühen Gedichte Paul Celans Impulse, und zwar sowohl in bezug auf die Metaphorik als auch auf den dialogischen Zug der Texte.
Für jenes „Komm! ins Offene, Freund!“, das die Lyrikerin im Gedicht „Ins Feld, ins Feld mit Hölderlin“ zitiert, steht nicht zuletzt die Figur des Engels, die uns in wechselnder Gestalt verschiedentlich begegnet. Namentlich der „Fabrikengel“ aus dem Gedicht „Tapetenfabrik“ vertritt das nicht Planbare, das reizvolle Unwägbare. Im Flugschatten des „Fabrikengels“ verändern sich die Lichtverhältnisse, gewinnt Wirklichkeit etwas Durchscheinendes. Die sehr irdischen Engel erinnern mich an das Leitmotiv des „Lächelns“ in der AItersdichtung Erich Arendts – es steht für das Menschliche.
Skeptisch fragte Kathrin Schmidt noch vor einigen Jahren:
Vielleicht stehe ich mit meiner Metaphorik bißchen einsam rum? Ich bin mir nicht sicher, ob sie gebraucht wird.
Diese Zweifel sind geschwunden, die Lyrikerin ist sich ihrer poetischen Mittel sicher. Spürbar ist eine nachdenklich-wägende Haltung, die ihre Wurzeln sicher auch im familiären und beruflichen Alltag hat (Kathrin Schmidt ist Mutter von vier Kindern und arbeitete als Kinderpsychologin). Sowohl die Gedichte als auch die poetologischen Positionsbestimmungen zeugen von dem Bestreben, über den Rand des Faktischen, des Gegebenen hinauszudenken.
So zielen die Überlegungen der Autorin zu den Wirkungschancen von Lyrik letztlich auf das Verhältnis von – menschlicher und politischer Emanzipation:
Wir haben so eine Massenbewegung im Land, die Menschen trainieren ihren Körper, und zwar ganz freiwillig, aus Spaß und Einsicht. Das läßt mich hoffen, daß eines Tages auch ein lustvolles Trainieren des Geistes üblich sein wird. Gedichte, davon träume ich, werden dann ihre Natur als Massenmedium realisieren… (Temperamente, Heft 3/1986).
Rainer Zekert, neue deutsche literatur, Heft 438, Juni 1989
Dialoge mit Kathrin Schmidts Gedichten
Im Jahre 1979 veranstaltete die junge Universität der alten Hauptstadt Bulgariens, die Universität Veliko Tirnovo, aus Anlaß des dreißigsten DDR-Geburtstages eine germanistische Konferenz. An deren Rande überraschte mich ein polnischer Linguist mit seinen Übersetzungen von Proben jüngster Lyrik aus unserem Lande, erschienen in einer Jugendzeitung. Unter den von ihm nachgedichteten Texten war auch einer von Kathrin Schmidt, damals gerade einundzwanzigjährige Studentin der Psychologie in Jena. Ich wußte wohl von ihr durch das Aprilheft der Neuen deutschen Literatur von 1979, das in großer Aufmachung JUNGE LITERATUR angeboten und deren Verfasser vorgestellt hatte. Natürlich erbot ich mich, Kathrin Schmidt ein Exemplar dieser polnischen Zeitung mitzubringen, und meinte, daß ihr das noch eine größere Überraschung bedeuten würde als mir. Als ich Gelegenheit fand, das Mitbringsel an die Frau zu bringen, nahm sie es gänzlich oder so gut wie wortlos hin und ging damit von dannen. Dadurch trug ich den Originaleindruck davon, den mir spätere Begegnungen zu bestätigen schienen, Kathrin Schmidt sei ein Mensch, dem Reden weniger als Silber und Schreiben mehr als Gold ist. Ihre saloppe Erklärung „Ich möchte ja was taugen / im Schreibgeschäft“ (Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik, Berlin 1987, S. 78) darf sicher nicht so verstanden werden, als halte sie das Schreiben für ein Geschäft oder für eine beliebig wählbare Beschäftigung. Ich jedenfalls schaue nun seit zehn Jahren mit Interesse auf Kathrin Schmidts Texte; sie liegen mir näher als die von manchen anderen jungen Autoren, deren Gesicht ich noch nie oder höchst flüchtig gesehen habe.
Als der Verlag Neues Leben für 1987 ein erstes richtiges Schmidt-Buch ankündigte, stellte sich neue Spannung her, zumal der Titel schon recht verheißungsvoll klang: Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik. Als ich den Band endlich in die Hand bekam, vertiefte ich mich neugierig in die Texte, unter denen auch wirklich nur zwei bereits bekannte standen. (Aus dem Poesiealbum 179 von 1982 wurden „Ins Feld, ins Feld mit Hölderlin“ und das auf Volker Braun bezogene Gedicht „Neuerer“ aufgenommen; alles andere war wohl bisher ungedruckt.) Um ehrlich zu sein, muß ich gestehen: Reine Freude wollte bei der Lektüre nicht aufkommen, obwohl mich die offensichtliche Weiterentwicklung der Autorin nicht unbeeindruckt ließ und mancher schöne Einfall zu bewundern war. Auch wiederholtes Lesen änderte kaum etwas an dem deutlichen Abstand zu dem Buch. Doppelt so alt wie Kathrin Schmidt, glaubte ich mich schließlich verdächtigen zu müssen, wegen mangelnder Jugendlichkeit kein zuständiger Leser zu sein.
Ich präsentierte also das Gedichtbuch den jungen (meist weiblichen) Menschen, die ich zu dieser Zeit gerade in meinem Seminar sitzen hatte, und forderte sie zur Lektüre, zum Gespräch, zur schriftlichen Urteilsbildung auf. Die Ergebnisse waren für mich frappierend und zunächst weit weniger hilfreich als vielmehr beunruhigend. Zwischen den Angeboten der Autorin und den Erwartungen der etwa vierundzwanzigjährigen Leser(innen), künftigen Deutschlehrern, kam es zu keinem sonderlich guten Verhältnis. Die meisten fühlten sich eher befremdet als angesprochen. Nur von einigen wurde das zum Anlaß genommen, das eigene Rezeptionsvermögen in Frage zu stellen. Die Meinung überwog, Kathrin Schmidt mache es dem Leser zu schwer, sie schreibe nur für eine sehr kleine Gruppe oder bloß für sich selber. Sogar das Stichwort „Kunst um der Kunst willen“ fiel (obwohl von anderer Seite die Ansicht vorgetragen wurde, die Dichterin wolle wachrütteln und an der Bewußtseinsbildung mitwirken). Man sprach von „Sprunghaftigkeit“ und „Bilderfülle“ (als einem Negativum), fand „viele Gedichte mit künstlichen Bildern überfrachtet“ und andererseits wieder „abstrakt“, und eine Studentin monierte zu meinem tiefen Erschrecken noch die Kleinschreibung als ein „Rezeptionshemmnis“. Kathrin Schmidts recht originelle Auseinandersetzung mit dem Faschismus bezeichnete jemand als „Wälzen der Vergangenheit“, die doch schon zum Überdruß „gewälzt“ worden sei. Ein „Problemkatalog“ werde von der Autorin entworfen, aber nicht „aufbereitet“.
Diese letzte Aussage war vielleicht schon ein bißchen lobend gemeint. Jedenfalls wurde auch Positives oder als positiv Gemeintes artikuliert, allerdings zumeist ziemlich lustlos, förmlich und unbetroffen; die wichtigsten Nennungen hier in Kürze: Themen- und Formenvielfalt, Annahme aktueller Probleme, Frauengedichte, Darstellung von Liebesbeziehungen, Vergangenheitsbewältigung, interessante Wortneubildungen, eigene Handschrift. Der von den Studentinnen am auffälligsten beachtete und am entschiedensten angenommene Text ist gerade jener, den Thomas Wieke in seiner Rezension als eine „versehentlich stehengebliebene Sentimentalität“ (Sonntag, 39/1988, S. 4) klassifiziert hat. Gerade dieses kleine Gedicht „Dank“, das wahrhaftig nicht zu den bedeutendsten des Bandes gehört, nahmen mehrere Studentinnen im vollen Wortlaut in ihre schriftlichen Besprechungen auf.
Und das Ergebnis für mich? Auf andere Art, als erhofft, brachten mir meine studentischen Partner Kathrin Schmidts Gedichte näher: Ich mußte sie und ihre Verfasserin verteidigen. Ich erfuhr abermals, was ich nun schon lange weiß, daß der Kritiker hier und heute sich vor allem als Mittler zwischen Autor und Leser bewähren, das Publikum insbesondere für die neuen Angebote aufschließen muß. Indem ich das als Herausforderung annahm, kam ich natürlich in der Diskussion mit mir selbst weiter. Ich weiß nun genauer, womit mich Kathrin Schmidt anspricht und was meine Freundschaft mit ihren Texten beeinträchtigt.
Anziehend wirkt auf mich, daß sich in den Gedichten dieser jungen Frau von Anfang an und immer ausgeprägter ein unkonstruiertes, nicht retuschiertes Ich ausspricht, für das elementare menschliche Bindungen einen großen Wert besitzen und das sich dazu empfindungsstark bekennt, ohne darüber reden zu müssen. Der erwähnte Text „Dank“ (Ein Engel…, S. 65) mag mit Recht als eine schwache Leistung be- oder verurteilt werden, und er mag mit seiner „Milch“ und seinem „Honig“ sentimental scheinen, doch versehentlich steht er gewiß nicht da, sondern eben bezeichnenderweise. Er bekundet Freude oder zumindest Genugtuung darüber, daß die Sprecherin jemand neben sich weiß, der für sie da ist und sich zuverlässig mehr um sie sorgt als sie selbst. Gefühlige Verse zu schreiben ist ihre Sache eigentlich gar nicht. „Gefühle“ und „Kühle“ harmonieren bei ihr als Reim (ebd., S. 76), und das wiederum harmoniert mit ihrer Fähigkeit, Emotionalität wirklich und differenziert in Sprache zu vergegenständlichen.
Angesprochen werde ich als Leser ihrer Texte immer wieder dadurch, daß dieses als authentische zeitgenössische Person umrissene Ich seinen Alltag nicht unreflektiert hinnimmt, aber mit einer Art naiver Selbstverständlichkeit voll ins Gedicht hineinnimmt, sich dabei jedoch weder aus dem Raum der Geschichte noch aus den Spannungen der „großen“ Welt herausnimmt. Eindrucksvoll ist für mich das Nebeneinander und Miteinander von Selbstbehauptung und Selbstreflexion, von Sinnlichkeit und Intellektualität, von Ernst und Spielfreude, von Dialogischem und Monologischem. Die heutige Welt nimmt Kathrin Schmidt als Zustand, doch der Zustand der Welt tritt in ihren Gedichten allenthalben (wenn auch meist indirekt) dynamisch in Erscheinung: Das sprechende Ich präsentiert sich in permanenter Auseinandersetzung damit, Un-Ruhe ist gleichsam seine Lebensweise und seine Sprechweise selbst dort, wo der thematische oder motivische Bezug auf die großen Menschheitsgefährdungen fehlt. Nicht zuletzt beeindruckt mich auch und gerade an dem umfänglichen Angebot des ersten richtigen Gedichtbuchs der Kathrin Schmidt ihr sichtbares Bestreben, sich in vielfältigen Formen zu äußern, nicht nur auf die Generationsgenossen zu schauen, sondern auch Tradiertes anzunehmen und zu erproben: die vierzeilige Reimstrophe zum Beispiel oder gar den Sonettenzyklus als kunstvolles Gefäß einer großangelegten Selbstbesinnung und Positionsbestimmung.
Eben hier schließen sich dann aber meine kritischen Nachdenklichkeiten an. Denn dem begrüßenswerten Bestreben nach gestalterischer Vielfalt möchte ich nicht gern zuschreiben, daß es einerseits ein angestrengtes, mitunter überanstrengt wirkendes „Wortvernähen“ (ebd., S. 77) gibt, andererseits wieder flächige Stellen, Passagen oder Stücke. Manches läßt auf ein durchaus entwickeltes Formbewußtsein und einen energischen Gestaltungswillen schließen, aber durchgängig zeigt sich deren Funktionieren nicht. Daß Kathrin Schmidt die Schwierigkeiten des Sonettenkranzes ein wenig mindert, indem sie an den Terzetten einen Reim ausläßt, muß man ihr nicht ankreiden; immerhin hält sie ihre Abweichung von der Norm (und sie ist ja auch nicht die erste Abweichlerin) dann als selbstgeschaffene Norm konsequent ein. Gelegentlich arbeitet sie sehr geschickt und vorteilhaft mit einer leitmotivischen Wendung; das sechsfach gesetzte „als alles noch drin war“ (ebd., S. 26 und 28; durch den Einsatz des Konjunktivs wird dann auf S. 29 eine wirksame Variation und Schlußpointe geschaffen) ist semantisch reich genug, um so oft wiederholt zu werden, und es hilft wesentlich, das lange Gedicht deutlich zu strukturieren. In anderen Fällen jedoch sucht man vergeblich selbstgeschaffene Gesetze der inneren Form und gewinnt den Eindruck, daß da einfach etwas hingesetzt oder -gesprochen wird. Wohlgemerkt: Mich stört Prosanähe nicht als solche. Mir gefällt sogar gut, wie in der Lesart zu Bechers „Aufstand im Menschen“ (vgl. ebd., S. 20–23) ein Prosastück aus Prosalektüre-Erleben entwickelt wird und in ein „wirkliches Gedicht“ (ebd., S. 14) umschlägt. Wenn Lyrik und Prosa längst auf weiten Strecken ineinander verlaufen, wer wollte da noch auf restriktiven Abgrenzungen bestehen?! Aber ein produktives Erinnern an Brechts einstiges Nachdenken über gestisches Sprechen scheint bei den Jungen weithin unzumutbar geworden zu sein. Die Versgestaltung nimmt sich nicht selten zufällig und bedeutungslos aus, die Tendenz zu willkürlicher Zeilenbrechung (die sich auch bei Kathrin Schmidt findet) geht einher mit mangelnder rhythmischer Durchgestaltung des Textes. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Seinen Rhythmus hat auch ein guter Prosatext, aber freie Rhythmen zeichnen sich nicht durch Beliebigkeit aus.
Vielleicht ist es altmodisch, für größere künstlerische Disziplin und gestalterische Strenge zu plädieren. Aber haben die sich nicht noch immer als Faktoren gesteigerter und länger wirkender Strahlungskraft erwiesen? Das ahnten wohl auch meine studentischen Partner, als sie die „Bilderfülle“ bemängelten. Kathrin Schmidt neigt, scheint mir, zu einem unmäßigen Aufwand an Bildern und Wortgemengseln, die dann diffuse Bedeutungen stiften und sich wechselseitig eher beeinträchtigen als potenzieren, (Ich denke da nicht an einen Text wie „Mitgift“, wo die Zeile oder das Zeilenpaar relativ geschlossene Gebilde sind, obgleich es sich um paradoxe Fügungen von Disparatem handelt, sondern beispielsweise an das Nach- und Durcheinander der Bilder von „Ins Feld, ins Feld mit Hölderlin“, wie es besonders im ersten Drittel des Textes stattfindet.)
Meine Distanz zu den Angeboten der Kathrin Schmidt versuche ich schließlich durch die Kritik ihres Gedichts „Neuerer“ (S. 11) zu zeigen und zu erklären.
Es fällt mir ganz gewiß nicht schwer, mit dem rebellischen Gestus zu sympathisieren, der dem Text seine Atmosphäre gibt. Ich kann auch nur begrüßen, daß hier nicht in hergebrachter Manier ein(e) Dichter(in) einen anderen ansingt oder feiert, sondern sich ein Mensch zu einem anderen bekennt, der auf drastische Neuerungen des Lebens aus ist. Nun ist da aber ausdrücklich und programmatisch (als Untertitel) Volker Braun als Bezugsperson angegeben, die aber wird für meine Begriffe im Text nicht kenntlich gemacht. Es fehlt den aufgebotenen Bildern durchweg an der dafür nötigen Genauigkeit, Stimmigkeit, Bedeutsamkeit. Ich kann jede der Metaphern der Reihe nach befragen, und jede bleibt als ästhetische Information weit von ihrem Ziel ab; ich kann sie als sorgsam gereihte Zeichenfolge zu lesen trachten, und der Text fügt sich dennoch nicht zu einem überzeugenden Ganzen. Die einzelnen Redefiguren integrieren sich nicht zur angekündigten Figur. Zugespitzt: Titel und Untertitel des Gedichts sagen mir mehr als das Gedicht selbst. Das liegt aber nicht nur an den Bausteinen des Textes, sondern auch an deren Organisation; der bloße sprachliche Ablauf schon ist unangemessen: Die Definition oder Evokation des Gemeinten setzt zunächst forsch und heftig ein (Zeilen 1–5), verliert dann aber seht rasch an Kraft (Zeilen 6–8), wird noch einmal versuchsweise dynamisiert (vom letzten Wort der Zeile 8 an bis zur Zeile 10), fällt jedoch schnell wieder und nahezu endgültig ab; am Ende wendet sich die Mitteilung über den „Neuerer“ sogar verblüffenderweise von ihm ab (Zeile 13/14). Das separate Schlußzeilenpaar, für den Leser gänzlich unmotiviert angebaut, macht vollends deutlich: Der Text ist im Grunde, und zwar im Widerspruch zur vorangestellten Steuerung des Lesers, eine Verlautbarung der Verfasserin; die darin addierten Motive geben Auskunft über sie, schließen sich aber nicht zu einem authentischen Braun-Bild zusammen. (Nebenbei: Der Neologismus „silotisch“ mag hier seine Funktion haben; er verrät aber auch darüber hinaus durch seine Art eine Wortbildungsfreude, die mitunter ins Extrem treibt und dann desto auffälliger wird, wenn sich in nächster Nachbarschaft ihrer Produkte schwächliche Wendungen und dünne Stellen finden.)
Uwe Berger war so freundlich, der Dichterin schon bei der Verleihung des Becher-Diploms also bereits vor dem Erscheinen ihres Poesiealbums von 1982, eine „eigenständige Handschrift“ (NDL, 9/1981, S. 124) zu bescheinigen. Mit dem Blick auf das viel reifere und reichere Buch, das nun vorliegt, mußte man das heute erst recht sagen können. Daß nicht wenige ihrer Texte methodisch-technisch und stilistisch unausgewogen erscheinen, sollte aber nicht verschwiegen werden. Was ich da an Unsicherheit und Unreife zu sehen meine, folgt wohl aus einem Mangel an Selbstdisziplin und Selbstkontrolle, wurzelt gewiß aber auch in Erfreulichem: Kathrin Schmidt hält sich gründlich frei von kunsthandwerklicher Selbstbescheidung. Sie fordert sich immer wieder neu; riskiert etwas, experimentiert. Die Entdeckung der gerade ihr gemäßen Möglichkeiten beziehungsreichen und kommunikativen Sprechens, scheint mir, ist gerade im vollen Gange.
Hans Richter, Weimarer Beiträge, Heft 6, Juni 1989
Ebenfalls zu Kathrin Schmidts Gedichten
Ein poetischer Titel lädt ein zur Begegnung mit Kathrin Schmidts erstem Lyrikband: Ein Engel fliegt durch die Tapetenfabrik (Berlin 1987), der bereits auf Erwartungen trifft; das Debüt der Autorin 1982, Poesielbum 179, abgesehen von Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, ließ eine durchaus eigene lyrische Stimme vernehmen (erinnert sei da an Texte wie „Ibykus“ und „Die Deutsche Reichsbahn lädt zum revolutionären Ausflug“). Der eigene Band nun, die Wortmeldung einer mittlerweile Dreißigjährigen in der keineswegs kargen Lyrik-Landschaft der DDR am Ausgang der achtziger Jahre, ist nach der Spezifik der aus ihm sprechenden lyrischen Subjektivität im Dialog mit zahlreichen Debütstimmen junger Autoren zu befragen. Ob und inwiefern vermag Kathrin Schmidts Äußerung den besonders intensiv gerade von ihrer Generation getragenen gesellschaftlichen Diskurs über alternative Lebenskonzepte und Wertvorstellungen zu befördern?
Solcherart Annäherung an in Lyrik artikuliertes Lebensgefühl, Weltverhältnis, Zeitbewußtsein erfordert den Ansatz eines nicht nivellierenden, zweidimensionalen Generationsbegriffes, das heißt neben der Kennzeichnung der von der älterer Generationen differierenden Grundsituation den Gesichtspunkt verschiedenster Schreibgrundierungen einzubeziehen, resultierend aus unterschiedlichen Erfahrungsräumen und -tätigkeiten sowie darin benutzten Verarbeitungsmustern und -techniken relativ gleichaltriger, in derselben historischen Situation in diesem Land Lyrik Schreibender. Hier spricht kein sich elternlos empfindendes Subjekt; anders als beispielsweise Bert Papenfuß-Gorek „mutterselennakkt“ und „splitterallein“ sich „kwehrdeutsch“ gegen das „faterland“ (Papenfuß-Gorek: dreizehntanz, Berlin. und Weimar 1988, S. 106), gegen die Tradition stellend, erscheinen die Vorfahren bei Kathrin Schmidt wiederholt im Erinnerungsvorgang als aufgenommene Lebenslinien. Ihr Subjekt ist ein sich in diesen Linien ortendes, nicht sich in radikaler Ablösung außerhalb setzendes. Die Formensprache kündet davon mit Konsequenz in der Aufnahme literarischer Traditionslinien. Von dieser Positionsbestimmung her wird die „Mitgift“ (vgl. S. 47) als „Täuschungsfrieden“ eines sich in fataler Gangart bewegenden Lebenslaufes entlarvt und verhalten beklagt.
Gleich suchender Vermittlung zwischen Erfahrung und Glücksanspruch des Individuums lassen sich zwischen den Polen solcher Klage im Benennen von Defiziten und der Behauptung von Utopie-Räumen Grundgefühl des Schreibens und Gestus lyrischen Sprechens bestimmen. Schon der Titel der Auswahl, Metapher einer Utopiekonstruktion, markiert den benannten Zusammenhang als inhaltlichen Widerspruch, der den gesamten Band durchzieht: Zwar haben die einzelnen Gedichte ein Thema, aber sie bewegen es nicht. Der Versuch, in der Auswahl der Texte einen konstituierenden Band-Zusammenhang auszumachen, mißlingt. Die in vier Komplexe gruppierten Texte („Beispiele. Jahre“ / „Ausflug einer lebenden Frau“ / „Kopplung“ / „Pupillenfliegen“) lassen wohl die Idee einer Gliederung erkennen, kommunizieren untereinander aber lediglich wiederholend. Das lyrische Subjekt tritt hauptsächlich als ein weibliches ICH auf, dessen Selbstortung anhand des zentralen Reflexionsgegenstandes Alltag ins Bild gesetzt wird. Es findet sich im „zeitkarussell“ (S. 16), in den „Zwängen der „Lebensdatenmühle“ (S. 78f.), einfordernd die Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes, schöpferisches Tätigsein. In den Gedichten „Die Feier Abend“, „Mittwochs“, „Tapetenfabrik“, „Dämmerungsschalter“, „Netzhautnetz“ sowie in „Pupillenfliegen“ verhandelt die Autorin immer wieder das Problem der Kürze individueller Lebenszeit im Verhältnis zur Zeit des sozialen Organismus in einer alltäglichen Situation von Arbeit beziehungsweise Freizeit. Als utopische Räume werden neben der in ein naives, Ironisierung entbehrendes Wunschbild zerfließenden Fabrikengel-Vision die erfüllte Partnerschaft in der Liebe, die Beziehung zum Kind, die Behauptung weiblich-menschlicher Identität hergestellt. Diese erscheinen eher als Refugien für das Subjekt, einen moralischen, nicht aber sozialen Anspruch artikulierend. Der Ort als Movens gedachter Selbstbefragung bleibt die poetische Provinz des privaten Individuums, auch wenn Welterfahrung, aktuell problematisiert als medial vermittelte, das heißt als zum größten Teil nicht selbst primär getätigte, wiederholt thematisiert wird („Rast“, „während Rauch aufsteigt“, „Schiffe versenken“, „Vorspann“). Weder der Gang in die Tapetenfabrik noch die west-östliche Grenzwertbestimmung eigener Existenz, die Selbstverständigung als Frau und als Schreibende oder die Aufarbeitung von Geschichte durch die eigene Generation beziehungsweise die Begegnung mit Erlebnismustern einer jüngeren Generation scheinen von tiefem geistigen Durchdringen und ernsthafter Arbeit am Widerspruch bis in die Konsequenz zu wählender Zeichen zu zeugen.
Eklatant wird dies meines Erachtens am durch Kopplung von Prosatext und Gedicht kompositorisch auffallenden Stück „Lesarten zu J.R. Becher. Der Aufstand im Menschen“. Darin läßt die Autorin Bechers Seiltänzer über Ruinen schmerzlos in das Ich der schreibenden Frau eintreten; er macht ihr einen Text. Ein großes Motiv Bechers wird bemüht, aber lediglich seine Erscheinung im Bild des Seiltänzers ist der Schreiberin gegenwärtig. Die Folge: Ein entfremdeter Vorgang führt zum Erlangen einer fragwürdigen Produktivität. Es offenbart sich ein gefährlicher Verzicht auf Eigenartikulation des Widerspruchserlebens einer ganzen Generation. „Schmerzlos“ (S. 23), das heißt widerstandslos, wird Fremdes als Eigenes angenommen und als intuitives Kunstprodukt dargeboten.
Das Thema künstlerischer Produktivität, dichterischer Existenz taucht in mehreren Texten auf, zentraler Gegenstand ist es im vierten Teil des Bandes, dem Sonettenkranz „Pupillenfliegen“. Der Versuch in dieser äußerst selten aufgegriffenen Dichtungsform – bei den jüngeren Dichtern gibt es ihn in „Märchen-Land“ von Kerstin Hensel – stellt wiederum das Ziehen einer Traditionslinie dar; Bechers Gedanken über das Sonett sind anwesend. Schmidt teilt offenbar nicht das zweifellos vorhandene Mißtrauen vieler Lyriker ihrer Generation gegenüber dem Sonett mit seiner streng gebundenen Form, Harmonisierung, Glättung von Widersprüchen bewirkend, die aus ihrer Sicht auf Welt als offenliegende Ausdruck finden müßten. Ein Beispiel dieser Haltung, die verdächtigte Form aber doch ironisierend nutzend, findet man in Kurt Drawerts Text „Das Sonett“:
… Ach all die Regeln, all die Norm
Die baun zu Harmonie den Müll
…
Ein Spiel, ein Trick, die Form Verrat
Denn alles Leben will sich spalten
Will Brüche, Löcher, Kanten, Falten. (Sinn und Form, 5/1985)
Kathrin Schmidt versucht sich im Extrem dieser Form, dem Sonettenkranz, sich bewußt in die Tradition stellend und möglicherweise nach neuen Akzenten heutigen Aussprechens darin tastend. Ihr dichtendes Ich fragt in inständiger Selbstauseinandersetzung sich und seine Kollegen nach Qualität, Sinn und Berechtigung ihrer Tätigkeitsart im sozialen Gefüge: „Was ist erzeugt, was lediglich erbrochen?“ (S. 77) „Wir häckseln alle Tage alte Texte“ (S. 76), die Gedichte welken, „Kommamilben“ fliegen, „Wortmehl dickt den Staub und die Gefühle“ (ebd.), aber „Hoffnungslaugen verwaschen nicht“ (S. 78) im „Schreibgeschäft“, Sprachspalt-Produktivität wird behauptet. Das Thema öffnet sich schwerlich zum Raum echter Auseinandersetzung; der Reimzwang läßt die Anstrengung der Schreiberin offenbar werden, versuchte Ironisierung geht verloren, „Wortmehl“ entsteht tatsächlich; lautes Lesen der Texte kann man weitgehend als quälend im Sprachrhythmus empfinden. Das fünfzehnte Sonett, das Meistersonett, gerät zu einem solchen in der Negation, außer Achtung vor dem Wagnis schließlich potenzierte Langeweile, auch durch gar zu viel Redundanzen, beim Leser hervorrufend, der keinen Freiraum für eigenes Neu-Zusammenbauen dieser Texte erhält. Ein eigener innerer Ton der Lyrik Kathrin Schmidts ist hier am schwersten zu vernehmen.
Eine Ursache dafür mag in ihrem Produktionsverfahren liegen, das die Autorin im zweiten Sonett treffend selbst im Bild des „Wortvernähen[s]“ (S. 77) beschreibt. Sie betreibt dies in vielen Texten des Bandes in eiliger Addition von Wortmaterial zu Zeilen ohne qualitatives Ergebnis. Das Wort fungiert dort nicht als selbständiger Bedeutungsträger; Wörter-Assoziationen ersetzen Sinn-Assoziationen, wo letztere intendiert sind, und strukturieren ganze Texte („Kopplung“, „Schiffe versenken“, „Frauenrummel“). Gestalterische Entsprechung findet dies im Operieren mit festen Redewendungen, Wortverwandtschaften, Lautmalereien, Klangassoziationen, wobei neben dem häufig zu angestrengt geratenden und den Sprachrhythmus eher verstellenden Reim Häufungen von Substantivkomposita wie die undifferenziert wirkende Wiederholung einzelner Motive und Bilder (Engel, Flug, Himmel, Fallen in Speichen) den Vorgang befördern, daß anstelle von (Ver-)Dichtung ein Aufweichen und Auflösen der Metaphern erfolgt. Geistreichelnde Trockenheit und entkräftete Bildansätze sind meines Erachtens das Ergebnis der Verselbständigung der Arbeit mit Einfällen. Die Autorin verschenkt so mögliche Skurrilität sowie sinnliche und intellektuelle Impulse. Ein belangvoller, körperlicher Ton wird vernehmbar im ganz Privaten, Intimen („Die braunen Lämmer meiner Achselhöhlen“, S. 69).
Deutsch-Sein ist ein Begriff, der den Band durchzieht, im Traditionsverhalten zu den deutschen Dichtern – Hölderlin („ein deutscher vorfahr“, S. 10), Becher und Braun werden direkt benannt –, das deutsche Volks- und Kirchenlied erfahren Zitation, und in der fiktiven Begegnung mit Personen, Orten und Ereignissen deutscher Geschichte. Während bei letzterer in den Texten „Beispiele. Jahre“, „Grenzwertbestimmung“, „Ausflug einer lebenden Frau“ mit künstlerischen Mitteln, wie sie zum Beispiel in dem frühen Text Schmidts „Die Deutsche Reichsbahn lädt zum revolutionären Ausflug“ erprobt wurden und auch den Dialog mit Texten von Steffen Mensching wie „Traumhafter Ausflug mit Rosa L.“ oder „Grenzwertberechnung“ eröffnen, ein heutiges Subjekt in aktiver Beziehung zur Geschichte erfahrbar wird, sind im unkritischen Traditionsbekenntnis zu Hölderlin, Braun und auch zu Picasso keine Beziehungen organisiert. Das jeweils enthaltene Porträt wird beliebig, da sich für den Leser keine neue oder überraschende Sicht anbietet. Damit entzieht die Autorin der intendierten Selbstverständigung und -bestätigung den Boden sozialer Konkretheit.
Innerhalb der Alltagssituation bleibt die Sicht mit unaufgebrochenen Klischees von „Liedlos [en] Punks“ (S. 83), der Setzung des eigenen stoppligen Schädels gegen allgemeine „Dauerwellen“ (S. 83) im Land dem alten „Kleider (bzw. Frisuren) machen Leute“ verhaftet und wie auch in „Schiffe versenken“ oder „Halluzinatotischer Ausgang“ unter den Erfahrungen der Leser. Müdigkeit, „Müdheit des Marks“ (S. 8) taucht mehrfach im Band auf, ein Lebensgefühl und Zeitempfinden des lyrischen Subjekts kennzeichnend, das sich in „scheinheiler mitte“ (S. 10), in „höllischer mitte“ (S. 7) sozialer Existenz ortet. Im Vorgang des Benennens spricht sich die Opposition gegen Mittelmaß und Bescheidung aus. Gegen jene gesetzt sind die wiederholt aufgenommenen Motive des Flugs und des Himmels, die die angebotenen Utopien aufscheinen lassen: das Träumen, die Liebe zum Partner, die Beziehung zum Kind. Diese entlassen unbefriedigt, denn die Texte dringen nicht zu substantiellem Angriff vor. Gesellschaftliche Relevanz steht als zu Erringendes fast durchgängig noch aus. Ich kann mich des Eindrucks einer übereilten Fertigung des Bandes nicht erwehren. Ein Dialog vermag sich mir leider nicht zu realisieren. Das Lesen dieser Lyrik ist mir sehr wenig Lust und Spiel, Entdeckungen ermöglichend. Der Gewinn: mögliche Beförderung des öffentlichen Gesprächs über die Probleme heutigen Schreibens von Lyrik.
Katrin Schmidt, Weimarer Beiträge, Heft 6, Juni 1989
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Interview +
Lesung + Laudatio + Christine Lavant Preis + Urheberrecht
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Kathrin Schmidt in der Sendung „typisch deutsch“.


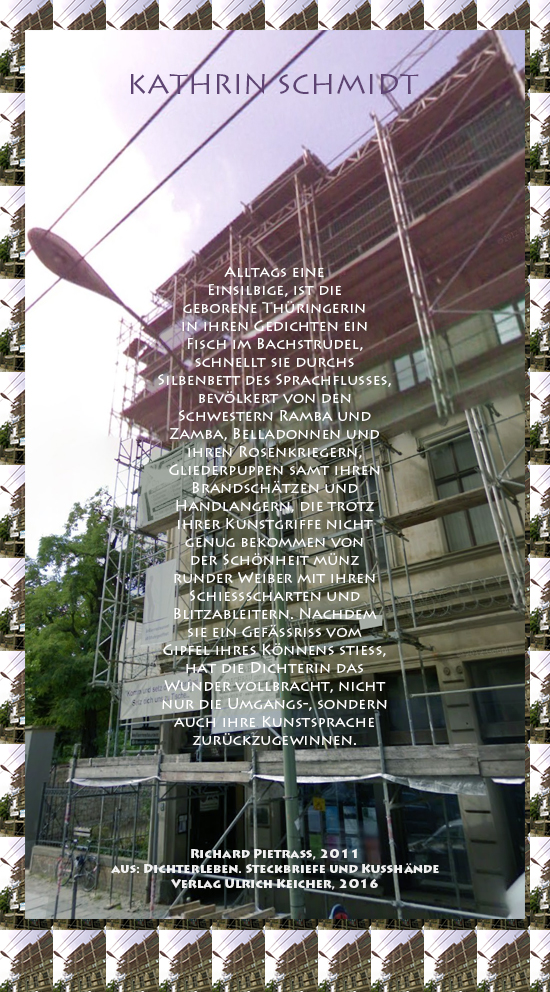












Schreibe einen Kommentar