Kathrin Schmidt: Go-In der Belladonnen
e. outet den flop
(Flop, der, … eine Hochsprungtechnik, bei der
der Springer die Latte rückwärts mit dem Kopf
voran überquert u. auf dem Rücken landet
Großes Fremdwörterbuch, Bln. 1984)
nicht erst zum ende einer beinah schon geglückt
aaaaageglaubten stille
trat e. zum sprung an, teilte lachend ihres herzens schläge aus,
die nicht berührt sein wollten noch berühren.
in einigen war deutlich zu erkennen,
daß sie auf erdung aus warn. andere hingegen verformten sich
und sprachen mit geschälter stimme rauch
nach liliput hinüber, wo kleine blumenzüchtende
genossen ihren wettkampfsprung begossen und rosen nelken
einander in den brustkorb rammten. endapril
und anfangmai ging das so weiter. wie frohlympia ungefähr.
wie zeigenfinger brechen. und der kollege wähnte irrend outflipped,
was von außen her zum frieren abgeschlossen war: e’s kopf.
aus solcher lage sprang ihr dichten flip statt flop, so outend letzteren,
und wir warn froh, daß e. so angetreten und die stille
zwar nicht vorbei, doch unterbrochen war
von herzensschlägen.
Wenn wieder die Weibsmauser naht
Geschichte und Geschlecht, Körper und die Codes unserer Erfahrung, ein Blick, der die Sprache zum „fremdwörterhaus“ werden lässt, die „kleinhausordnung“ der Kindheit: Das sind Themen, um die das Schreiben von Kathrin Schmidt kreist, nicht nur in ihrer Lyrik, aber dort werden die Modelle zunächst erprobt, mit Lakonie, Frechheit, Intellekt, aber auch nicht ohne Melancholie. „im oberwasser berlins ein rumoren: breitblättrig, außer fasson, schlägt die zunge ein rad“, heißt es im Titelgedicht, und worauf dann die losgelassene Sprache sich einlässt, ist bestimmt von Geschichte, vom Blick auf die Sprengkräfte der Körpergeschichte und das, was sie gewaltsam eindämmt, „aus all meinen schießscharten“. Mit einem großen Formenreichtum bezeugen die neuen Gedichte die Individualität und Intensität der Lyrikerin Kathrin Schmidt.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Ankündigung
Liebe schaffen ohne Redenswaffen
− Kathrin Schmidts Gedichte erproben Grenz- und Zeilenfälle. −
Wer „zwischen den schultern / die flügelmutter“ hat, kann sich offenbar mühelos auf verschiedene literarische Spurweiten einstellen. Was in ihrem Debütroman Die Gunnar-Lennefsen-Expedition ins Kolossale gewuchert war, hat Kathrin Schmidt in ihrem vierten Gedichtband wieder zurückgeschraubt auf das lyrische Maß, das ihrer Worterfindungswut förderliche Fesseln anlegt und ihre überbordende Bilderflut in kunstreich angelegte Kanäle lenkt.
Auch hier geht es um verborgene Zusammenhänge zwischen Körper und Geschichte, um die gewaltsam eingedämmten Sprengkräfte weiblicher Weltwahrnehmung unter den Vorzeichen einer DDR-Sozialisation, deren Residuen lange nach dem Mauerfall noch immer in den Adern kreisen, im „souterrain der lungen“ nisten und aus Liebeslagern dünsten. Aber die familiäre „kleinhausordnung“ im östlichen Deutschland war in den frühen Sechzigern, den Kindheitsjahren der Autorin, von jener im westlichen nicht gar so verschieden, und überall dort, wo die Gedichte unverhüllt mit Reminiszenzen an den untergegangenen Versuchsstaat spielen, schwingt die Erfahrung mit, daß es eben nicht oder nicht nur politische Systeme sind, die Barrieren zwischen Individuen, zwischen den Geschlechtern, zwischen dem lyrischen Ich und der Welt errichten.
Mit „grenzblick“ erkundete die „pimpfkinderhorde“ die Landschaft „und probte den grenzfall“; später dann wird „der deutsche reisende, furunkelträger“ an den „körpergrenzen“ kontrolliert. Die sexuelle Vereinigung, Gewehr bei Fuß, vollzieht sich da, „wo die / grenzlinien übereinanderfallen und kein dazwischen ist“; erst wenn die „gedrechselten / redenswaffen“ schweigen, kann es zuweilen geschehen, daß „der grenzrahmen bricht“. Die Kriegsmetaphorik ist so allgegenwärtig wie das Grenzmotiv, die Dichterin und ihr männliches Gegenüber befinden sich „im belagerungsabstand im summenden / ausseelungskampf“. Dann wieder kommen sie schrankenlos deftig zur Sache, wie bei einer sommerlichen, stark nach Günter Grass schmeckenden Buttermahlzeit am Saarmunder Bodden:
in deinen hosen entsteht was, wie tosen
geht jetzt das meer mir vorbei an ohren
und arsch
Mit Säften und Sekreten, mit „ramba und zamba“ trotzt eine aufmüpfige, nicht immer appetitanregende Sinnlichkeit dem fahlen Aroma von „ersatzkaffee“ und „rauhputzfassaden“ und zugleich dem „schlappmut der doktorwut“, den der Geliebte auf der Stirn trägt.
Kindheit und Alter sind, neben dem „Paarsegeln“, Themen der Kathrin Schmidt, außerdem die Agonie der Natur, die Analogie zwischen Körper- und Maschinenwelt, gentechnische Verheißungen, aber auch aktuelle deutsche Befindlichkeiten. „Hinterm wohlfühlgewicht dieses land / läufigen aufschwungs“: damit ist viel, wenn nicht alles gesagt. Das Titelgedicht „go-in der belladonnen“ entfaltet ironisch und wortlüstern ein Berlin-Panorama aus weiblicher Außenseitersicht. Viel Kryptisches, viel Codiertes findet sich in diesen Versen, aber es erweitert die grenzkontrollfreien Assoziationsräume, die mit Hilfe von Wortschöpfungen und Wortverdrehungen so fintenreich wie routiniert geöffnet werden. Natürlich ist, wer auf dem Buchstabenspielfeld sich tummelt, nicht gegen Manierismen gefeit: Eingebungen wie „gefallender engel“, „spiegelverkehr“, „achtgebet“, „kreuzorträtsel“ reizen zu beliebiger Vermehrung, Adjektive wie „würzbecherfarben“ oder „mondhohngeschützt“ kokettieren ein wenig mit ihrer leeren Schönheit, und im Schutzraum des Lyrischen dürfen sich der „kardamom des instinkts“, die „herzhundestaffel“ oder die „drosophila der schwarzbiernacht“ spreizen, ohne durch Nachfragen belästigt zu werden.
Dafür steht Kathrin Schmidt mit Jambus und Daktylus auf ausgezeichnetem Fuß, und wo sie sich zur Reduktion statt zur Ausschweifung entschließt, können kleine Perlen der Verrätselung entstehen, wie der Achtzeiler „auch das asyl“. Mit etwas Pathos ließe sich resümieren, dies seien die Gedichte einer Unbehausten, die in ihrem privaten Sprachkosmos zuverlässiges Asyl gefunden hat und von dort auf alle Schein-Geborgenheiten spöttisch zurückblickt:
dabei hieß es
doch früher immer, wo ein hauswart
dir lacht, findet alles sein gütliches ende
Kristina Maidt-Zinke, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.6.2001
Weibsmauser
– Körpergedichte mit Witz: GO-IN der Belladonnen von Kathrin Schmidt. –
Anders als die meisten zeitgenössischen Gedichte halten die der Kathrin Schmidt weniger Augenblicke fest als vielmehr Prozesse. Sie sprechen davon, wie Erfahrungsmuster entstehen, wie Lernvorgänge als Verbiegungverfahren erlebt werden; sie berichten von Gewalt und Verletzung durch Erziehung in Familie und Schule, vom Fortführen und Durchbrechen tradierter weiblicher Rollen innerhalb von Liebe, Ehe und Gesellschaft. Die Dichterin nimmt dabei nicht die Pose einer Welterklärerin ein, sie fischt die bitteren Brocken der Erkenntnis aus dem wohlfeilen Einheitsbrei, deklariert sie mit genüßlich beiläufiger Geste als „Falschmarzipan“. Sie macht Wort für Wort die Komik in den Scheingefechten sichtbar, filtert aus „Ersatzdehnungen“ die schmerzhaft hohl tönenden Vokale und läßt die Konsonanten vernehmlich knacken. Sowohl in den Versen, die Kindheit und Jugend in der DDR erinnern, als auch in denen, die neudeutsche Entwicklungen thematisieren, geht es um Werte und Rollenverteilung in der Historie. Dabei steht – wie schon im Roman Die Gunnar-Lennefsen-Expedition – die weibliche Version der Geschichte im Mittelpunkt, nicht als bloße Widerspiegegelung äußerer Zeitabläufe, inklusive Grenzfall und Neuorientierung, sondern als akribisch bilanzierte Körperempfindung.
Was Durs Grünbein aus männlicher Sicht entwirft, kreiert Kathrin Schmidt aus weiblicher Perspektive: eine ganz gegenwärtige Nervenkunst. Ihre zentrale Metapher ist „weibsmauser“ oder „mauser der frau“. Kathrin Schmidt beschreibt Verweigerungen, Aufbrüche und Ablösungen, lauter „Vorgänge mit befreiender Wirkung“. Wo die Schmidtsche Prosa in immer neuen epischen Anläufen und Episoden ihren roten Faden spinnt, treibt in der Lyrik ein mit ironischer Geste dargebotener Sprachfluß die Entwicklungen dort voran, wo sie in der Realität zu stagnieren scheinen:
ein stockender ablauf
matter zirzensischer akte.
beugungen, brechungen.
spiegelverkehr, der die geschlechter
knapp ans verfallsdatum schleppt.
Nichts in diesen Versen läuft schnurstracks auf einer Ebene, nichts ist eindeutig. Wortbedeutungen und Assoziationen berühren und überlagern einander, etwa aus den Bereichen DDR-Gesellschaft und jetzige Bundesrepublik. Sprache und Erotik oder moderne Medientechnik, Genetik, Anatomie, Historie, Militär und Bürokratie. Das Wortmaterial wird neu kombiniert, gleitet rhythmisch ineinander. Schroff gegeneinander gesetzte Idiome färben einander ein, so daß sich traditionelle Wortgrenzen verschieben und herkömmliche Bedeutungen lockern oder gar auflösen. Kathrin Schmidt arbeitet in hohem Maße sprachreflexiv und wortschöpferisch. Fast überwiegt die Zahl der Worte und Wortfügungen, die in keinem Duden zu finden sind und dennoch Sinn machen.
Die ersten drei Teile sind reich an Textgeflechten, die vor Wortneuschöpfungen geradezu überquellen, dabei Ecken und Kanten zeigen, manchmal fragmentarisch ausufern. In den letzten beiden Teilen: „Paarsegeln“ und „Distanzfieber“ überwiegen Gedichte, die sich auf einzelne Phänomene beschränken. Das bedeutet Gewinn und Verlust zugleich. Die zumeist kürzeren, teilweise auf eine Strophe begrenzten Gedichte sind übersichtlicher geworden, die verschiedenen Textebenen weniger ineinander verschlungen. Sie benennen Lebenshaltungen, Identitäten und individuelle wie gesellschaftliche Perspektiven (Altern, geklonte Menschheit) ohne überbordende Wortmätzchen, in knapper, runder, in sich geschlossener Form. Obwohl sie – wie die Verse aus den vorangegangenen drei Lyrikpublikationen – ihr Spiel zwischen wörtlicher und abstrakter Bedeutung treiben, bewegen sie sich im Existentiellen: der Mensch in der Welt der Autos, der elektronischen Netze und gentechnischen Verfahren. Frühere Themen wie das der Generationen werden erneut aufgegriffen und abgeklärter, gelöster betrachtet als vor Jahren. Die Unmittelbarkeit früherer Verse geht dabei verloren: Aus Erlebnislyrik ist Gedankenlyrik geworden, die ihre Phantasie mit sparsamer, konzentrierter Wortwahl zu bändigen sucht.
Selbst die Engel, jene geflügelten Wesen, die ostdeutsche Identitäten einst das Fliegen lehrten, also Ungebundenheit, freie Bewegung und phantastische Übersicht garantierten, rauschen nun nicht mehr so unbekümmert durch Schmidtsche „Tapetenfabriken“, werden auch nicht mehr zum gepeitschten Spielball der Wut eines kollektiven Wir, wie noch im Suhrkamp-Band Flußbild mit Engel. Seit dem Poesiealbum, das 1982 im Verlag Neues Leben erschien, sind die kuriosen lyrischen Figuren der Kathrin Schmidt illusionsloser und gewitzter geworden, vor allem aber technisch durchgestylt. Gerade das aber entzaubert sie: Zwischen ihren Schultern sind jetzt – statt des romantischen Federflaums – Flügelmuttern zu entdecken, wie im Gedicht „dimmbar, das schraubzwingenplatt“. Was einst wider die Verhältnisse lockre, boxt sich jetzt durch die Zeiten. Nein, ein „gefallender“ Engel wollte dieses weibliche lyrische Ich nie sein.
Auch jetzt begibt es sich statt dessen sarkastisch spöttelnd ins Getümmel angepaßter „Belladonnen“. Im Medienzwinger des „Fräuleinwunders“, das kürzlich jüngere Autorinnen werbewirksam zum allgemeinen Bestaunen feilbot, läßt sich die Lyrikerin nicht halten. Ihre weiblichen Ich-Figuren sind politisch unbequeme Bürgerinnen, die sich in Putschlaune durch die Ämter kämpfen. Als Deutsche mit DDR-Erfahrung lassen sie sich nicht festnageln auf Grenzrahmen, Gewinnzonen oder Werbezwecke. Kathrin Schmidt bilanziert die atmosphärischen Veränderungen von „aufschwungs kapriolen“ auf dem „deutschen park / und paradeplatz“ („satzverlust“). Sie setzt sich bewußt in Beziehung zu anderen zeitgenössischen Schriftstellern und zu lyrischen Traditionen, die sie aufgreift, indem sie sie bricht. „stimmbläße.frostsicher“ räumt ironisch mit der immer noch weit verbreiteten Vorstellung von der Lyrik als Hort der Gefühle auf, die – nach klassischem Vorbild – dem Unendlichen zugeneigt seien. Ein Affront gegen das Naturgedicht, das Abendromantik, Stille und Wälderfrieden wie eh und je besingt, ist u.a. das Gedicht „auch das asyl“ – subtile gesellschaftskritische Verse, die in ihrer dichten Bildsprache etwas von der unheimlich boshaften Heiterkeit des Couplets „Gehen wir Tauben vergiften im Park“ haben. Selbst die Paar-, Kreuz- und Binnenreime verlieren bei Kathrin Schmidt ihre gefällige Glätte: „das deutsche reimt sich immer auf transport“ heißt es sarkastisch in ihrer Reisegedicht-Parodie „spaltbild mit ankunftsszene“.
Affinitäten gibt es zur Dichterin Elke Erb, deren gelungenes Porträt sie in „e. outet den flop“ entwirft. Es ist zugleich ein fabelhaft satirischer Rückblick auf das Spannungsfeld zwischen Künstlerexistenz und DDR-Kulturpolitik, Berührungen gibt es auch zu Volker Braun und dessen Gesellschaftsdiagnosen. „wir befinden uns im belagerungsabstand im summenden ausseelungskampf nur die gedrechselten / redenswaffen haben zum glück zu schweigen begonnen“, kontert Kathrin Schmidt Brauns „Wir befinden uns soweit wohl“. Da stürzen Staaten und Utopien wie Kartenhäuser zusammen, aber auch individuelle Lebenspläne. Vom Küchenlied über das Wiegenlied bis zum Zauberspruch und zu Sarah Kirschs „Seßhaft / eine Eizelle / blieb ich zurück“ wird alles auf seine Brauchbarkeit für weibliches Selbstbewußtsein hin abgeklopft, umgewendet und zu einer Wortmusik aus Assonanzen und Alliterationen verarbeitet. Zu den Rhythmen von Jamben und Daktylen tanzen jedoch nicht nur die mütterlich geerdeten lyrischen Ich-Gestalten der Berliner Autorin. Über raffinierte Wort- und Zeilenbrüche springen außer Rand und Band die Schwestern Ramba und Zamba, Findelväter und Leermütter, lüsterne Pannengehilfen, arme Altritter, Männer wie Pottwale, kleine Marktführer, das Tunichtguthendlund Kerle wie Vadim Frivolnikov. Letzterer überschreitet rüde die Grenzen der Moral und des gehobenen Stils mit umgangssprachlichen Vokabeln, die über das Saloppe ins Vulgäre abgleiten. „… so schluff klingt das tunnel-u durch die lust / daß man’s nicht aufschreiben kann so ausgesprochen deutlich“ – an diese Erkenntnis des Gedichtes mit dem Titel „fischisch“ hält sich die Autorin in anderen Texten nicht, macht selbst Toilettensprüche lautmalerisch lyrikfähig, so als wetteifere sie insgeheim mit der Frivolität eines Charles Bukowski. Allerdings wird Sex bei ihr kaum zum singulären Thema eines Gedichts gemacht, gehört eher selbstverständlich zum Textgeflecht dazu, genauso wie Geburt und Mutterschaft, verschiedene Liebesarten, Partnerschaftskonflikte und Alltag in seinen kuriosesten Varianten. Manche Verse wirken wie kurz vor dem Absprung ins episodenhafte Erzählen, andere wie witzige pointierte, nicht in Handlungsstränge auflösbare rhythmische Textgebilde. Durch alle weht ein unsentimentaler, frischer Luftzug.
Dorothea von Törne, neue deutsche literatur, Heft 536, März/April 2001
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Dorothea von Törne: Kein ‚gefallender Engel‘
Die Welt, 13. 1. 2001
Hauke Hückstädt: Dudenzauber
Literaturen, Heft 10, 2000
Der Anteil der Frauen am Verschwinden der Männer
– Gespräch mit Kathrin Schmidt am 23. Juni 2002 in ihrem Haus in Berlin-Mahlsdorf. –
(…)
Axel Helbig: Ich habe heute auf der Fahrt nach Berlin noch einmal in Ihren vier Lyrikbänden gelesen. Beim ersten Band (1982) gewann ich den Eindruck von einem Ich, das sich gegenüber der Welt zu erklären versucht. Bei den beiden folgenden Bänden (1988, 1995) war es dann der Eindruck von einem Ich, das sich selbst die Welt zu erklären versucht. Beim letzten Band (2000, GO-In der Belladonnen) hatte ich den Eindruck, von einem Ich, das sich stark in sich selbst zurückzieht. Das Ich, das sich am Anfang offenherzig gab, wird jetzt zunehmend verschlüsselt, um den Zugang zu sich zu erschweren. Wie sehen Sie selbst die Entwicklung Ihrer Lyrik?
Kathrin Schmidt: Sie sind der zweite Mensch, der das äußert. Das ist für mich wirklich interessant. Ich halte das für ein Mißverständnis mit der Verschlüsselung. Die Bedingungen für mein lyrisches Schreiben haben sich in den letzten vier Jahren ziemlich stark geändert. In den ersten beiden Bänden – und ich finde das ziemlich treffend, wie Sie das sagen – da war Sprache für mich in erster Hinsicht Ausdrucksmittel. Jetzt, und das wird im letzten Band deutlich, ist Sprache für mich sehr viel stärker zum Material geworden. Den Eindruck der Verschlüsselung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dieser Gedanke, etwas sagen zu wollen und dafür einen Ausdruck zu finden, spielt für mich heute beim Schreiben von Lyrik keine Rolle mehr. Vorher hätte ich Ihnen anhand einzelner Gedichte durchaus sagen können: Das Gedicht habe ich in der und der Situation geschrieben, mir ging es um die und die Zusammenhänge. Das ist jetzt völlig anders. Jetzt reicht manchmal der Anblick einer Zeile und die Stellung eines Kommas darin, um einen Text rein aus der Sprache entstehen zu lassen. Das ist eine Art des Schreibens, die sehr viele intuitive, unbewußte Momente hat, die aber genau dieser Unbewußtheit mit ziemlicher Schärfe nachzuspüren versucht. Dieses Konflikthafte begeistert mich. Ich fühle mich hier viel stärker zu Hause als in der Prosa.
Helbig: Ein Kennzeichen des letzten Bandes ist die Zunahme von Wortneuschöpfungen. Das kann auch als Zunahme von Codierung empfunden werden.
Schmidt: Aber wenn ich nichts verschlüssele, dann gibt es auch nichts aufzuschließen. Das ist gar nicht die Frage. Mir geht es überhaupt nicht mehr darum, irgend etwas zu sagen. Ich sage natürlich etwas. Wenn das Gedicht fertig ist, steht ja etwas da. Und es gibt auch Leute, die einen Zugang finden und möglicherweise sagen können, worum es in dem Gedicht geht. Was ich sagen will, ist, daß diese Überlegungen während des Schreibens für mich keine Rolle mehr spielen. Ich habe vor Kurzem in einem poetologischen Vortrag, den ich in Wien gehalten habe, versucht, dies anhand eines Gedichtzyklus’ ausführlich darzustellen. Es geht nicht um Verschlüsselungen, die aufgeschlüsselt werden sollen. Das Gegenteil ist der Fall. Indem ich auf diese Art schreibe, betreibe ich eine Offenlegung.
Helbig: Hat die Erfahrung des Romans Ihre Art und Weise Gedichte zu schreiben verändert?
Schmidt: Lyrik schreiben ist für mich im Moment: Sprechen im Gegensatz zu Sagen. Sich zurückziehen können auf Prosa und eine Sprache zu verwenden, die sich in den allgemeinen Konventionen bewegt, die von anderen Leuten verstanden wird, in der man etwas ausdrücken kann – und wo sozusagen ein ganzes Konglomerat, wozu es ansonsten der Psychoanalyse bedurft hätte, abgearbeitet werden kann –, das befreit auch und ermöglicht es, dann wieder auf die Sprache als Material zugehen zu können. Nichts mehr im Kopf haben zu müssen, was man sagen muß, das macht frei. Ich kann unmöglich Prosa und Lyrik parallel schreiben.
Helbig: Ist das Schreiben von Lyrik ein Prozeß der Anreicherung, in dessen Ergebnis das Gedicht in einem Zug niedergeschrieben wird, oder zieht sich die Arbeit an einem Text über einen längeren Schreibprozeß hin?
Schmidt: Wenn ein Gedicht erst einmal auf dem Papier steht, dann ändere ich es selten noch einmal. Selbst in Einzelheiten nicht. Die Prozesse, die dahin führen sind unterschiedlich. Früher war es so – auch noch bei den Gedichten für den Suhrkamp-Band von 1995 –, daß die Gedichte im Kopf entstanden sind. Nicht vor dem Computer oder vor der Schreibmaschine. Zumeist während völlig anderer und banaler Tätigkeiten. Wenn ich ans Schreiben ging, brauchte ich nur noch den fertigen Text aufzuschreiben. Jetzt ist es ein Prozeß, wo ich mich hinsetze und versuche, mich wirklich leer zu machen. Oft trete ich unmittelbar vorher in Kontakt mit anderen Kollegen, indem ich deren Gedichte lese. Warte dann im Grunde auf den ersten Satz. Wenn der kommt, entwickelt sich das dann weiter. Dabei kann es sich um eine Art Übergangsphase handeln. Das muß ja nicht ewig anhalten. Vielleicht macht man sich ja auch etwas vor. Im Moment hat das für mich etwas Zauberisches und Magisches. Ich bin selbst ganz fasziniert davon, wie das funktioniert. Aber, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich traue diesem Frieden ja auch nicht. Das sind also jetzt längere Prozesse, die zum Gedicht führen. Aber es gibt immer nur eine Fassung. Worauf ich mich ganz stark beziehe, das sind andere Autoren. Was Lyrik betrifft, versuche ich, so viel wie möglich wahrzunehmen. Am liebsten würde ich den ganzen Globus lyrisch wahrnehmen wollen. Aber das ist natürlich schwer und wird durch die sprachlichen Barrieren behindert. Das ist für mich aber auch die einzige Möglichkeit, einen Maßstab herauszubilden. Wie der Maßstab beschaffen ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Helbig: Zum Schluß eine persönliche und vielleicht auch Standardfrage. Was ist Heimat für Sie?
Schmidt: Im ersten Moment bin ich versucht zu sagen: Nichts. Aber das wäre natürlich kokett. Mein Heimatbegriff definiert sich nicht auf Deutschland hin. Ich beziehe den Begriff Heimat in erster Hinsicht auf die Frage nach der Herkunft. Meine Heimaterfahrung ist am ehesten zu beschreiben durch die etwas zwiespältige Situation, sich in einer thüringischen Kleinstadt wohlzufühlen. Einerseits, im Sinne von aufgehoben und gebunden sein, in einem überschaubaren Rahmen zu leben. Jeder wußte von jedem fast alles. Man verhielt sich nach einem bestimmten Kodex und war im guten psychologischen Sinne gebunden, frei von existentieller Angst und Bedrohung. Auf der anderen Seite das Gebundensein im schlechten Sinne, das wie eine Zwangsjacke empfunden werden konnte, wie Provinz immer auch Zwangsjacke bedeutet. Ich fühle mich natürlich auch in der Sprache zu Hause. Auch wenn ich mich nicht von der Sprache herkommend empfinde. Eher würde ich sagen, daß die Sprache so etwas wie mein Exil ist. Ich gehe da hin wie zu einem Fluchtpunkt, den man sich gewählt hat. Wo man sich dann letztlich auch sehr heimisch fühlt.
Helbig: Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ostragehege, Heft 28, 2002
Fakten und Vermutungen zur Autorin + KLG + IMDb + Interview +
Lesung + Laudatio + Christine Lavant Preis + Urheberrecht
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Dirk Skibas Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Kathrin Schmidt in der Sendung „typisch deutsch“.


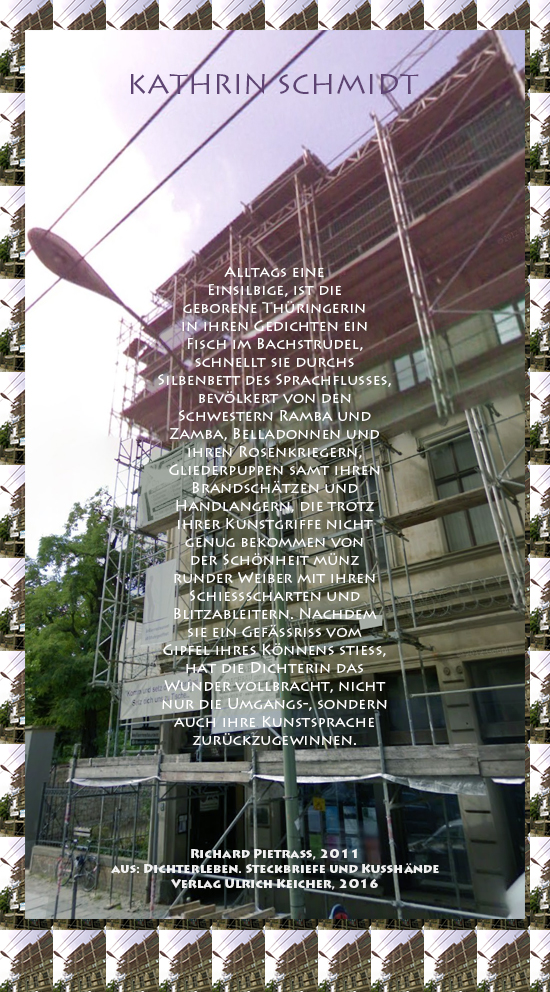












Schreibe einen Kommentar