Kurt Drawert: Wo es war
SISYPHOS
Das waren noch Zeiten,
als es einen Gegenstand gab,
den es zu bewegen galt.
Daß der Auftrag ein Flop war
und der Winkel der Steigung
das Objekt jeweils kippen
und zurückstürzen ließ,
konnte als Strafe
nur in der Unterwelt gelten,
in der Dilettanten am Werk sind.
− Kein Gespür für die Lust
auf Wiederholung,
solange noch Materie
im Spiel bleibt,
keine Gerichtsbarkeit,
die er ernst nehmen mußte.
Seit seinem Freispruch
dümpelt er trüb vor sich hin
und stiert in die Leere
zwischen den Händen.
Wieder und wieder.
Der Freispruch des Sisyphos
− Formenreich: Kurt Drawerts Gedichtband Wo es war. −
„Wenn die Literatur nicht alles ist, ist sie der Mühe nicht wert“ – der Satz von Sartre steht als Motto über einer anderen Publikation Kurt Drawerts; die darin erhobene unbedingte Forderung gilt aber ebensosehr für diese neuen Gedichte. Deren Strenge, ein manchmal fast lastender Ernst, das ist wohl der tiefste Grund der merkwürdigen Faszination, die von ihnen ausgeht: sie kommen den Lesenden nicht entgegen, aber sie lassen sie nicht mehr los. Der hohe Anspruch impliziert dennoch keinerlei Überschätzung oder Hochstilisierung der Kunst. Sie muss alles sein, damit sie nicht nichts ist; das ist ihre Paradoxie; immer befindet sie sich in Gefahr, mitsamt dem ganzen Leben in Sinnlosigkeit zu versinken. Vor diesem finsteren Hintergrund sind auch die bittersten Verse des Bandes zu verstehen, in denen das berühmte Diktum Adornos auf den Kopf gestellt und zynisch verschärft wird:
Und so stimmt es: nach Auschwitz
haben die Deutschen
nur noch ein Recht
auf Gedichte.
Etwas von der Tonart, vom grossen Atem der Elegie ist in diesen Versen. Bei aller Vielfalt der Formen, über die der Autor souverän verfügt, ist deren Rhythmus, vielfach gebrochen, untergründig immer wieder hörbar. Aber was ist der Gegenstand dieser Elegie, um welche Verluste wird hier Klage geführt? Sicher nicht um das Ende des „Landes der Herkunft“, eben der DDR, an der Kurt Drawert tief gelitten hat, die ihn noch immer umtreibt; und nur am Rande um persönliche Verluste oder um die allgemeine Erfahrung, dass auch das Schöne sterben und alles, was intensiv beginnt, schliesslich im Alltag verdämmern muss. Das alles führt nicht ins Zentrum.
Die Leere zwischen den Händen
Wegweisend ist hier das Gedicht „Sisyphos“, das, als setzte es Tonart und Thema fest, am Anfang des Bandes steht. Die Sage des Sisyphos wird darin zu einem überraschenden Ende geführt (sogar eine Spur von Humor darf aufblitzen): der zur Höllenqual der vergeblichen Anstrengung Verurteilte wird freigesprochen, der Stein, den er bis in alle Ewigkeit rollen musste, ihm abgenommen. Aber jetzt erst fangen seine Qualen an: er erfährt den Freispruch, die Erlösung vom Stein als Sinnverlust; nichts bleibt als „die Leere / zwischen den Händen“. Allgemein gefasst (und das bezieht sich nicht nur auf den griechischen Helden) heisst das:
Das waren noch Zeiten,
als es noch einen Gegenstand gab,
den es zu bewegen galt.
Da ist, in einem wahrhaft lapidaren Bild, der Verlust genannt, den die Elegie dieser Gedichte beklagt: nicht der Abschied von Eden, sondern, bescheidener, der Verlust des Konkreten, der sichtbaren, greifbaren, der körperhaften Wirklichkeit. Das ist das grosse Thema Drawerts, das untergründig durch diesen Band geht. Es gibt kaum ein anderes lyrisches Werk, in dem das Verschwinden der Wirklichkeit, das drohende Nichts, so eindringlich, zugleich so verhalten-diszipliniert dargestellt wird. „Nirgendwo bin ich angekommen. Nirgendwo war ich zuhaus“, heisst es, in radikaler Verallgemeinerung. Wer stirbt, ist wie nie dagewesen: „Der tote Nachbar war auch entbehrlich.“
Auf den ersten Blick mag befremden, dass Drawert dem Band als dessen vierten Teil seine Rede zum Uwe-Johnson-Preis (1994) beigegeben hat, in der das Thema der „Abschaffung der Wirklichkeit“ aus der Aura des Modischen und Zeitgemässen gerückt und als historische Erfahrung eines DDR-Bürgers interpretiert wird. Vom einleitenden „Sisyphos“-Gedicht wird der Bogen weit und kühn gespannt bis zur Abstraktion des Schlusses; vom Konkreten zum Gedanklichen führt der Weg. Da drängt ein philosophischer Geist in die Abstraktion – und bindet sich selbst immer wieder zurück ins Konkrete, in die Bilder, die, präzis, sorgfältig gesetzt, eine verlässliche Garantie sind gegen alles Verstiegene. Bilder: Nicht zufällig spielen Tiere – eine Gegenkraft zur Tendenz der Abstraktion – eine wichtige Rolle. Die „Kröte“ erscheint als eine Instanz, die dem Menschen seine Grenzen setzt, ein armseliger, verendender Hund (in „Der Köter“) wird zur Verkörperung unformulierbarer Leiden.
Im letztgenannten Gedicht, aber auch in anderen, hat der Reim wieder seinen Platz, als brauchte das Motiv des geheimnisvollen Tieres den Halt einer alten Form. Überhaupt ist der Formenreichtum des Bandes erstaunlich, bewundernswert die Fähigkeit des Autors, das Vielfältige zum Eigenen zu machen. Es gibt unter den Gedichten ironisiert Liedhaftes, Anklänge an Heine; es gibt den trockenen Ton, die lakonische Sprache, die an die Gedichte des Bandes „Privateigentum“ erinnert; es gibt fragmentarisch wirkende Notate, und nicht selten hört man semantische Anklänge an lyrische Traditionen der klassisch-romantischen Zeit. Dies nicht als ein Pastiche, das alte Sprachformen variiert oder durchscheinen lässt; nicht als Zitat und nicht als Formspiel. Der Autor hat eine neue Souveränität im Umgang mit der Sprachtradition erreicht: er braucht sie und verändert sie, um so, in Anklang und Abgrenzung, die eigene Sprache zu gewinnen.
Im Sprachzentrum verletzt
Sprache: das umfasst hier immer auch Sprachverlust und, zögernder, Sprachgewinn, beides vor dem Hintergrund des drohenden Verstummens, das, in paradox-sinnvoller Umkehrung, manchmal auch ein Glück sein kann. Und das ist nicht einfach ein Thema unter vielen, sondern – man kann es im Prosatext „Spiegelland“ nachlesen – die zentrale Erfahrung des Autors, die das Privateste erschliesst und zugleich das Politische umfasst. Im geheimnisvollen Sprachzentrum, an der empfindlichsten Stelle, wurde er während seiner DDR-Kindheit am tiefsten verletzt; eine Wunde, die nie ganz heilt. So schreibt er heute als einer, der nichts hat als die Sprache – und der auch die nicht „besitzt“, sondern immer wieder verliert, sogar in ihrem alltäglichen Gebrauch. „Meine Freunde im Osten / verstehe ich / nicht mehr / im Landstrich / zwischen Hammer und Weser kenne ich keinen“, heisst es in „Ortswechsel“. Und an anderer Stelle:
Die Zeitung ist leergelesen,
die Bücher sind tot.
Die nie gebannte Gefahr des Sprachverlusts: das ist wohl der schmerzlichste Aspekt des Verschwindens der Wirklichkeit; gegen beides leisten die kompakten, streng gearbeiteten Sprachkörper der Gedichte ihren Widerstand; der eingangs formulierte hohe Anspruch an die Literatur, „alles zu sein“, gewinnt hier seinen Sinn.
Elsbeth Pulver, Neue Zürcher Zeitung, 23.7.1996
Vom Dichter heimatlos
Kurt Drawert hat 1987 im Aufbau Verlag mit Gedichten debütiert (Zweite Inventur). Seitdem ist der Autor beinahe ausnahmslos für seine inzwischen erschienene Prosa hoch dekoriert wurden (u.a. Ingeborg-Bachmann-Preis 1993, Uwe-Johnson-Preis 1994). Trotzdem verstärkte sich beim kritischen Lesen der Eindruck, sein eigentliches Metier sei vielleicht doch die Lyrik. Deshalb konnte man auf Gedichte von Drawert gespannt sein und umso genauer fällt die Lektüre des neuen Gedichtbandes aus.
Abgesehen von einer Rede als Teil Vier, über die noch zu reden ist, ist das Buch in drei Abschnitte gegliedert, was ein Formspiel ist, denn im Grunde wird in allen Gedichten ein und dasselbe Thema verhandelt. Ob Selbstbeschau, Liebesgedicht oder Landschaftseloge, es geht immer um den Verlust von Lebenszeit, Erinnerung, Gewohnheiten, Freunden, Heimat, oder kurz gesagt geht es um das verloren gegangene Land DDR. Wo es war, wird gefragt: „Mein kleines, aufgeschlitztes Land / mit seiner textlosen Hymne“, und dann wird unerbittlich geantwortet:
begraben liegt es im Himmelreich
der Hunde, und modert,
und verendet nicht.
Auffällig ist, daß die Behauptungen, je unerbittlicher sie ausfallen und ins Politische, Gesellschaftliche zielen, umso weniger den Autor als „ich“ einbeziehen, sondern auf die Mehrheit verweisen, für die es dann „wir“ heißt. „Aber auch wir waren sozialistische Pimpfe…wie flott wir marschiert sind… sind wir die Nachgeburt“. In zwei groß angelegten Gedichten wird das Dilemma deutscher Geschichte in diesem Jahrhundert angerufen und auf persönliche Erfahrungen zurückverwiesen. Während in Geständnis mit Distanz schaffender Ironie die eigene Zuständigkeit hinterfragt wird („Ich gestehe, im Land der Verwöhnten / lebe ich gern… Ich lehne rigoros jede Zuständigkeit ab“), wird in Tauben in ortloser Landschaft distanzlos ein „sie“ angeklagt („Doppelagenten / in Herzensgeschäften, den Verstand, / der privateigen war, mehrfach gewendet / und für silberne Groschen meistbietend / verkauft… sie haben unsere Absicht / gebrochen und sind auf die Seite / der Verführer gewechselt“). Was in wohltemperierten Versen sich zu Vorwürfen auswächst, fällt unter Umständen auf den Dichter selbst zurück. Mit Erstaunen und Verwunderung kann auch nachgelesen werden, wie Drawert, der bis 1993 in Leipzig wohnte, seinen Umzug nach Niedersachsen als eine Art spätes Dissidententum thematisiert, wie Ärger durchschlägt, nicht eher gegangen zu sein. Die Rede ist von der sächsischen Stadt L. als „einer Stadt im Auswurf der Zeiten“, vom „Ende der Herkunft“, von den Freunden im Osten, die nicht mehr verstanden werden und davon, daß der Dichter sich wie „vertrieben“ fühlte:
Ich bin sehr entschieden gegangen,
und wäre doch gern auch geblieben.
Wer denkt bei solchen Versen nicht an die Biermann-Zeilen: „Ich möchte am liebsten weg sein, und bleibe am liebsten hier“ oder aber an den Wagen, der rollt:
Ich wäre ja so gerne noch gebliehiehieben
Aber nur auf letzteres spielt Drawert bewußt an, weil er dem Gedicht den Titel… zum deutschen Liedgut gibt, und doch klingt es, als wäre ihm die Haltung Biermanns lieber. Im Mittelpunkt der dem Buch angehangenen Rede „Die Abschaffung der Wirklichkeit“, die Kurt Drawert als Dank zur Verleihung des Johnson-Preises gehalten hat, steht noch einmal die „Heimatlosigkeit“ und der Versuch einer Erklärung, warum er diesen Zustand für sich kultiviert. Und wieder, wie bereits in den Gedichten, erscheint vieles als arg bemühte Konstruktion. Was er den DDR-Bürgern von 1989/90 u.a. zum Vorwurf macht („Dieser eilige Sprung auf ein anderes Pferd, das schon gesattelt auf der anderen Weltseite stand.“), hat er selbst vielfältig vorgelebt, indem er zuerst seinem Protektor Karl Krolow auf den Schoß und 1989 in den marktgerechten Sattel des Suhrkamp Verlages sprang.
In den Gedichten geht es oft „blau“ und „blond“ zu, mehrmals spazieren „Pioniere“ durch die Zeilen, eine Vorliebe für drei Pünktchen als Gedichtanfang ist zu verzeichnen, aber Herzlosigkeit nicht, auch wenn es einmal heißt, daß lange in die Stille hineingehört wird „auf mein wenig benötigtes Herz“. Drawert hat in seinen neuen Gedichten oft nachvollziehbaren Klartext geschrieben, der selten mit „kühlem Lakonismus“ spricht, wie es im Suhrkamp-Waschzettel heißt. Hier hat sich einer was vom „Herzen“ geschrieben, eingedenk der Gefahr, verlacht zu werden.
Michael Wüstefeld, SAX. Das Dresdner Stadtmagazin, 01/1997
Stürze aus Bildern
Während sich Über & Unternehmer landauf, landab darum bemühen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und unser Glück zu mehren, während sie sich den Kopf zerbrechen darüber, wie das Standwort Deutschland flüssig gemacht werden kann, oder wie unsere Menschen, pardon: Humankapitale, zu noch mehr Eigenverantwortung anzutreiben sind, kurz: während viele tüchtige und leistungsbereite Menschen hart arbeitend um unser aller Wohl bekümmert sind, düstern diese Gedichte eine Wahrnehmungswelt finaler Zustände: „am giftigen Grund der Benennung“ schocken bereits die Eingangsgedichte des ersten Komplexes in diesem genau komponierten Band mit Momentaufnahmen aus den stillgestellten Landschaften jenseits des Todes. Kaspar Hauser als Widergänger im zu guten Glauben; Sisyphos, arbeitslos, „stiert in die Leere zwischen den Händen. / Wieder und Wieder.“ Schreiben ,vom Endprodukt‘ her: Der letzte verbliebene Zweck der ewig jugendlichen Geselligkeitsgesellschaft, die dröhnende Todesverdrängung, wird nicht etwa nekrophil bestätigt, sondern zum Thema. Sehr unangenehm. Was er nur hat gegen die schönste neue Welt der High-Tech-Nomaden oder „ein Leben / mit hübschen Maschinen, fortschrittlich, ohne Geheimnis.“ Denn „wir können doch stolz sein auf dieses / mein Vaterland mit so schönen Enten. / Und auf all deine Siege Boris“, wie es im „Heimatgedicht, C-Dur“ lobpreist wird.
Ausgeräumt die Bestände jedweden Glaubens, ausgeträumt die Visionen eines halbwegs geglückten Miteinanderlebens. Kurt Drawert verortet konsequent das noch alle ,Ereignisrelikte‘ beschattende Empfinden der Leere und Fremde – dies auch stets wiederkehrende Grundworte der Heimatlosigkeit: das Thema des Bandes. Aber, hier wird nicht gut existentialistisch der ,unbehauste Mensch‘ eines Holthusen beschworen. Es ist die bis in seine industrialisierte Innerlichkeit vermessene, verwaltetete, im technizistischen und bürokratischen Zugriff verkommene Selbstverwertungsmonade: „eine Leerstelle… im zivilen Bereich mit seinen Revolten und erkämpften Rechten auf Spekulatius“ am Ende des Jahrhunderts. Thornton Wilders „Wir sind noch mal davongekommen“, es gilt nicht mehr, „und näher und näher / kommen die Kriege.“
Diese Gedichte antworten schonungslos dem Zerfall der Wahrnehmung gesellschaftlicher Zusammenhänge, wie sie gleichzeitig die Sprachtechniken der eingepaßten intellektuellen ,Eliten‘ als das bloßlegen, was diese euphemistisch zu verschleiern suchen: als berechnete, Angst betäubende Barbarei unter der dünn gewordenen Patina des symbolischen Kulturkapitals. Dieser Mut zur Unschicklichkeit im laufenden Kulturbetrieb ist auch deshalb hervorhebenswert, weil der ahasvernde Lyriker damit gegen die seit etwa 1991 in der Meinungsmache-Kritik unüberlesbare Bevorzugung der quassligen bzw. entrückten Äquilibristik, der yuppiistischen Neuen Behaglichkeit oder lyrischen Hip-Hop-Aufschaltung verstößt. Und wie die Gedichte dies tun: in geschliffener, ellipsenreicher Syntax, in sparsam gesetzter, aber wirkungsvoll Überraschung stiftender Metaphorik, listigem Verrücken von Redewendungen, im knochentrockenen Witz des understatements. Unterkühlt, rabenschwarz sarkastisch, entschlägt sich Drawert jeder Sentimentalität: aber ich spüre jene untergründige Verzweiflung des „verlorenen Exilanten eines Gefühls“, die mir ebenso vertraut ist wie sie erschreckt. Nur kann er eben nicht mehr mit jenen Mythen zweiter und dritter Hand tümeln, nach denen der Werte-suchende Bürger im spätrömischen „Internetz“ so süchtet. Anders als viele Gedichte in den friedensbewegten Achtzigern stellen diese Texte eben nicht einmal die narzißtische Lust am Apokalyptischen zur Schau oder verbrauchen sich in wohlfeil zu habendem Entrüsten.
Nach den triftigen Zivilisationsdiagnosen des ersten Bandteils versammelt der zweite Abschnitt eher Gedichte, die sich an einer einzelnen Impression, einer Schrecksekunde des Innehaltens, einer Reisenotierung entzünden. Eine präzise Aussparungs- und Verzögerungstechnik ermöglicht es (z.B. in „Blicke“, „Eine analytische Geschichte“), eine beträchtliche Spannung bis zum Balladesken aufzubauen, die schon mulmig machen kann: alles so „Stürze aus Bildern, die man selber / von sich schuf.“ Die Texte der dritten Abteilung unter der titelgebenden Überschrift „Wo es war“ gehen jenen Erinnerungsspuren nach, die in die Städte führen, „in denen heute / die Hymnen verwaist / ihr Vaterland suchen.“ Der Ortswechsel des Leipzigers nach Nordwestdeutschland und als Stipendien-Vagant nach Stuttgart oder Rom, bestärkt den nur vorgeblich trauerlosen Schmerz:
Nirgendwo bin ich angekommen.
Nirgendwo war ich zuhaus
Und so müssen die Schädigungen zu einer Sprache finden, die an die Gründe rührt: Davon etwa versucht ein für mich großes Gedicht „Tauben in ortloser Landschaft“ zu sprechen. Ein bitteres Lang-Gedicht in Vierzeilern, das – eine neue Qualität – im Nachspüren der eigenen Verletztheiten zugleich generell die tragikomischen Bedingtheiten in den Lebensverläufen der Nach-und-Nachgeborenen in der DDR berührt. Schon in Spiegelland hatte Kurt Drawert gleichsam programmatisch geahnt:
Wir sind mit Dutzenden von verlogenen Begriffen aufgewachsen, die wir im ehrgeizigen Alter der Kindheit unbedarft und schamlos vor uns hingesagt haben und die wir auswendig lernten wie fremde Vokabeln, ohne zu wissen, daß sie ein Leben und eine Existenz von innen heraus nur zum Scheitern bringen, wenn man sich ihrer nicht rechtzeitig entledigt so gut es geht, und vielleicht, denke ich, bedarf es eines ganzen Lebens, sich dieser Begriffe zu entledigen.
Die Beschädigungen, die die weitgehende ,Abschaffung der Wirklichkeit‘ im herrschenden Sprechen bei den Angeherrschten zur Folge hatte, machen, daß „die Kaspar-Hauser-Legion, / verschüttet in den Trümmern / der Bau-auf-Konstrukteure,… für keinen Zusammenhang / mehr zu gebrauchen“ ist. Nachdem sie ihr blendendes Werk pünktlich zu ihrer Verrentung als Schrott den Nachfolgenden übereigneten, haben sich die Mütter und Väter des Staates in den Ruhestand begeben, alzheimern oder waren schon immer dagegegen. Ihre Zöglinge aber, die „sozialistischen Pimpfe / mit gebogenen Rücken, sie wurden am Wegrand der Geschichte ausgesetzt. Tauben in ortloser Landschaft. … Und sie werden krank sein, / nicht aber sterben, wenngleich / das Ende der Gespräche erreicht ist…“ Die Gespenster einer Irrealität, die sich immerfort von ihren ,Zielvorstellungen her definierte‘, entsorgenals eingehirnte Sprachzombies noch und noch die ,Findelkinder‘ des Sozialismus in die Heimatlosigkeit, denn: „Alle waren sie plötzlich weg, die man noch hätte fragen können oder denen man noch etwas zu sagen gehabt“ hätte, wie Drawert in der dem Band beigefügten Dankesrede für den Uwe-Johnson-Preis 1994 lakonisch konstatiert.
Peter Geist, moosbrand, neue texte 5, März 1997
Wäldchen, Wald und Dschungel
(…)
„Mit dem Wort Opfer kann ich nicht umgehen“, baut so auch der vielgeehrte und vielgescholtene Kurt Drawert schon mal Kritikern vor, die seine Gedichte für weinerlich und modisch halten. Drawert will kein „Botenjunge“ oder „Quotendichter“ sein, und das ist er bei näherer Betrachtung auch nicht. Dagegen sprechen seine Biographie und die meisten seiner Verse. Und doch bleibt er ein Grenzfall. Drawert ist immer dann gut, wenn er seine Tiraden gegen die DDR, die Wende und die neuen politischen Verhältnisse ironisch wendet, die Haltung des zornigen jungen Mannes aufgibt und mit reduziertem Gestus und sich öffnendem Blick Klischees und Chiffren durchbricht:
Und so stimmt es: nach Auschwitz
haben die Deutschen
nur noch ein Recht
auf Gedichte
oder
Jeden Tag eine Nachricht
von Kriegen, ist auch eine Art
geregeltes Leben
Hier greift sein Spott präzise, gehen Wahrnehmung und Wort eine geglückte Liaison ein. Solche Sätze hallen nach und prägen sich ein wie gute Graffiti. Wenn Drawert scharf formuliert und seinen Witz pointiert einsetzt, dann erreicht er ein Niveau zwischen bestem Politkabarett und Brecht. Problematisch wird es hingegen, wenn er mit hohlem Pathos die Rolle des Chefanklägers übernimmt, Kohls Karawane für den Zug der Lemminge hält und dem morbiden Charme der Wiener unbedingt Konkurrenz machen will. Da wird es verkrampft und unglaubwürdig, bei aller Selbstfreisprechung von Voyeurismus und Marterpfahl. So modert und verwest es auf dem Geisterschiff DDR, giftige Tauben flattern durch die Zeilen, alles ist beschädigt, heimatlos und fremd, immer bewegt man sich am Rand der Geschichte und jeder ist irgendwie auch ein Kaspar Hauser, der seine Sprache verloren hat. Das wirkt, bei allem Respekt vor der persönlichen Befindlichkeit des Autors, auf die Dauer ermüdend. Wenn er dagegen gedanklich und verbal differenziert, wie er es in seiner dem Band beigegebenen Dankesrede anläßlich der Verleihung des Uwe-Johnson-Preises bravourös vorführt, hält er den Leser bei der Stange.
Thomas Kraft, neue deutsche literatur, Heft 508, Juli/August 1996
Kurt Drawert: Wo es war
Zwei Jahre nach der Vereinigung Deutschlands bescheinigte Durs Grünbein der jungen ostdeutschen Künstlergeneration in einem lyrischen Manifest eine Haltung von „frischer Zuversicht…, Appetit auf Moden, Techniken, Konzepte,… ein Rundumoffensein“ („Transit Berlin“, 1992). Nur sechs Jahre trennen diesen Lyriker altersmäßig von dem 1956 geborenen Autor Kurt Drawert. Doch der Tenor der von Drawert nach der Wende publizierten Werke ist alles andere als zuversichtlich. Zwar gesteht auch Drawert in seinem neuen Lyrikband von 1996 ein, den materiellen Freuden und Sinnesreizen der neuen Gesellschaft durchaus nicht abhold zu sein:
Ich gestehe, im Land der Verwöhnten
lebe ich gern, gern nehme ich
Verwöhnungen hin, ich wehre mich sehr gerne
nicht mehr, doch mehr gestehe ich nicht
(„Geständnis“).
Der Akzent liegt auf dem „doch“. Der gesamte Lyrikband mit seinen 58 Gedichten – vorrangig Drei- und Vierzeiler – ist eine einzige variationsreiche Umspielung dieser suggestiv entgegensetzenden Konjunktion, die Enttäuschungen, Hoffnungslosigkeit und – wie Drawert es einmal in einem Interview faßte – „permanente Zukunftslosigkeit“ signalisiert. Erwartet der Leser nun allerdings Stimmungen von Nostalgie/Ostalgie in dieser Gedichtsammlung, so sieht er sich getäuscht. Beladen mit der quälenden Erblast DDR und der daraus resultierenden Sprachskepsis, begreift sich Drawert unter den neuen veränderten kommerziellen Bedingungen in einem gesellschaftlichen Leerraum, der von der fortwährenden Erfahrung des radikalen Sinnverlustes und Bedeutungswandels der Dinge und ihrer sprachlichen Zeichen geprägt ist.
In seinem 1992 erschienenen Essayroman Spiegelland. Ein deutscher Monolog stellte Drawert Sozialisierungserscheinungen seiner Herkunft in den Mittelpunkt, wie er sie vor allem im Medium der Herrschaftssprache erlebte. Das Buch ist eine Untersuchung seiner Sprachverweigerung, seiner Sprachhinterfragung und einer tiefgehenden, lähmenden Sprachskepsis. Es endet mit einem Essay, der den vielsagenden Titel „Kein Ende. Kein Anfang“ hat; damit ist der Ton für den vier Jahre später folgenden Lyrikband Wo es war gesetzt. Spürte der Autor in den kommerziellen Worthülsen und in der medialen Sprache der bundesdeutschen Verbrauchergesellschaft nach der Wende sofort neue Formen von „Wortverbrechen“, so werden diese jetzt genauso intensiv empfunden und abgelehnt wie die beschädigte, korrumpierende Sprache des realen Sozialismus. Die Sprachkrise währt unter verändertem gesellschaftlichen Vorzeichen fort und mit ihr jene existenzerschütternde Lähmung und Hoffnungslosigkeit, die Drawert in seinen in der DDR entstandenen Texten gestaltete. Leitmotivisch durchzieht das Thema des Fremdseins in der DDR und der BRD den neuen Lyrikband: der Dichter als Nichtdazugehöriger („Wo immer ich bin, bin ich fremd“ [„Unterwegs“]), dessen „Ortswechsel“ von Sachsen nach Niedersachsen – so ein Gedicht – nichts Neues, bestenfalls andere Formen altbekannter Kommunikationslosigkeit bringt:
Nirgendwo bin ich angekommen.
Nirgendwo war ich zuhaus
Zahlreiche signalisierende Gedichttitel umkreisen den „Status melancholicus“ eines Heimat- und Wurzellosen, Titel wie u.a. „Unterwegs“, „Man kann nichts dagegen machen“, „Warten“, „Das bleibt nun so“ oder – resigniert-lakonisch – „Nichts“. Der gesamte Band ist durchzogen von einem bildlichen Instrumentarium, das Verlusterfahrungen, Vergeblichkeit und Leere suggeriert. Sinkende Schiffe, Strandgut, Treibholz, Risse, Brüche, Staub und Fäulnis dominieren, und immer wieder neue bildliche Formen der Figur des Fremdlings tauchen auf, in deren Projektionen der lyrische Sprecher sich mitbegreift. Ein Gedicht trägt den vielsagenden Titel „Kaspar Hauser“, eine Figur, die Drawert in einem anderen Gedicht in dem Versatzstück „Kaspar-Hauser-Legion“ zum Symbol einer Gruppenerfahrung Deplazierter verdichtet:
daß wir am Wegrand
der Geschichte ausgesetzt wurden
und Findelkinder sind, Bastarde,
Waisen bei befleckter Empfängnis
und bei keinem Namen zu nennen,
eine Kaspar-Hauser-Legion,
verschüttet in den Trümmern
der Bau-auf-Konstrukteure,…
(„Tauben in ortloser Landschaft“).
Wahlverwandtschaften zu Dichtern wie Trakl, Büchner, Heine und Hölderlin sind offensichtlich, ebenfalls zu Uwe Johnson, über dessen spezifische Form von Fremdheit und Heimatlosigkeit Drawert in einer dem Band beigegebenen Rede („Die Abschaffung der Wirklichkeit“) berichtet, die er beim Empfang des Uwe-Johnson-Preises 1994 gehalten hatte.
Die Gedichtsammlung Wo es war besteht aus drei Teilen mit den Untertiteln „In dieser Lage“, „Leer und sehr blau“ und „Wo es war“. Daß die prägenden Grunderfahrungen von Leere und Sprachskepsis in jenem Teil Deutschlands gemacht wurden, von dem jetzt nicht mehr existiert als „ein Brandfleck“, manifestiert sich in der emphatischen dreimaligen Wiederholung des Satzfragments „Wo es war“: als Titel des Gesamtbandes, als Titel eines seiner drei Teile, als Gedichttitel. Der erste Teil, „In dieser Lage“, handelt, wie der Titel vorgibt, von Formen der Fremdheit im bundesdeutschen Land, das weder Heimat ist noch Identifizierungspunkte gibt. Ein ironischer Päan auf die Marktwirtschaft, genannt „Heimatgedicht, C-Dur“, spricht für sich selbst:
wir können doch stolz sein auf dieses
mein Vaterland mit so schönen Enten.
Und auf all deine Siege, Boris
Im zweiten Teil, „Leer und sehr blau“, verdichtet sich das Gefühl von Verlust und Desorientierung zu einem umfassenden Vanitas-Erlebnis, das weit über politisch Gesellschaftliches hinausgeht und alle vom Menschen erlebten Erfahrungsbereiche einschließt: sterbende Natur, vergängliche Liebe, nichtssagende schöne Künste, sinnentleerte Sprache, bedeutungslose Freiheit, ein Gedächtnis, dem man nicht trauen kann. Die Farbe Blau, in der mythologischen Überlieferung Symbol der Wahrheit und Beständigkeit, erscheint bei Drawert vorrangig mit Verweis auf die literarische Tradition der Romantik: als Chiffre von Unbeständigkeit, dann in barocker Steigerung von Schemenhaftigkeit und Vergänglichkeit. Auch die glänzende Scheinwelt und Substanzlosigkeit der bundesdeutschen Konsumentengesellschaft ist dem unterworfen:
Ein anderer Himmel,
zum Greifen zu hoch
und zum Sterben zu blau.
Das bleibt nun so
(„Das bleibt nun so“).
Daß die vorherrschende Stimmung von Trübsinn und Apathie dem Leser nicht aufs Gemüt geht und er das Buch gelangweilt aus der Hand legt, liegt – nach Meinung der Rezensentin – vor allem an den Gedichten des dritten Teiles des Lyrikbandes, „Wo es war“, die sich mit dem Verschwinden der DDR und ihrer Entlarvung befassen. Diese Gedichte sind von ergreifender Intensität, spiegeln die Zerrissenheit eines Menschen, der sich im „Nirgendwo“ bewegt. Im Zentrum steht der unlösbare Widerspruch, daß Lüge Heimat und Gehaßtes vertraut sein können. Fast erschrocken und verwundert über sich selbst, gestaltet der lyrische Sprecher auf liedhafter Heinescher Folie das Unvereinbare:
Das Land, von dem die Rede geht,
es war einst nur in Mauern groß,
dies Land, von Lüge zugeweht,
ich glaubte schon, ich wär es los.
Ich glaubte schon, es wär entschieden,
daß wer nur geht, auch gut vergißt.
Doch war nun auch ein Ort gemieden,
der tief ins Fleisch gedrungen ist.
Als fremder Brief mit sieben Siegeln
ist mir im Herzen fern das Land.
Doch hinter allen starken Riegeln
ist mir sein Name eingebrannt
(„Mit Heine“).
Der Gestus des Erstaunens über das Unversöhnliche, Unverständliche durchzieht die zwanzig Gedichte dieses letzten Teiles. Der Ton ist schlicht. Die Aussage überzeugend und ansprechend. Das macht den Lyrikband zu empfehlenswerter Lektüre, zu einem deutsch-deutschen Zeitdokument im sechsten Jahr nach der Vereinigung. Drawerts Psychogramm deutet jedoch keineswegs auf lähmende Stagnation. Vielmehr spürt man eine resignierte Entschlossenheit und nüchterne Akzeptanz:
und so können wir
gut ohne Hoffnung bleiben
und kommen voran…
„in diesem anderen, sehr fremden Land“
(„Tauben in ortloser Landschaft“).
Christine Cosentino, Glossen, Heft 1, 1997
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Harro Zimmermann: Die finsteren Senken der Augenblicke. Kurt Drawerts neuer Lyrikband Wo es war
Frankfurter Rundschau, 27.3.1996
Matthias Zwarg: Sturzflug in fremdes Land
Freie Presse, 22. 3. 1996
Hermann Kurzke: Lauter abgeschnittene Ohren
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 5. 1996
Jörg Dieter Häusser: Sisyphos ist arbeitslos
Darmstädter Echo, 3. 6. 1996
Daniel Rothenbühler: Militanz der Resignation
Tages-Anzeiger, 5. 7. 1996
Frank Dietschreit: Weil aus meinem Land ein Territorium wurde
Märkische Allgemeine, 12.7.1996
Traugott Weisskopf: Wacher politisch-philosophischer Geist
Der Bund, 20.7.1996
Peter Michalzik: Wo es war, soll nichts werden
Süddeutsche Zeitung, 17./18. 8. 1996
Michael Braun: Im Himmelreich der Hunde
Die Zeit, 6. 9. 1996
Manfred Stuber: Sisyphos hat keinen Stein
Mittelbayerische Zeitung, 7./8. 9. 1996
Thomas Kraft: Geregelt
Stuttgarter Zeitung, 13. 9. 1996
Jan Koneffke: Leer-Jahre
Freitag, 20. 9. 1996
Jakob Stephan: Lyrische Visite. Bei Sarah Kirsch, C.W. Aigner, Kurt Drawert, Hans Löffler und der Pop-Fraktion
Neue Rundschau, Heft 3, 1996
Ilka Scheidgen: Aus dem Land der gebrochenen Bäume
der literat, Heft 10, 1996
Hans Dieter Zimmermann: Eine Landschaft ohne Orte
Der Tagesspiegel, 17. 11. 1996
Neil H. Donahue: Kurt Drawert, „Wo es war“
World Literature Today, Heft 1, 1997
Charitas Jenny-Ebeling: Land der gesplitterten Bäume
Der Landbote, 17.8.1996
Thomas Rietzschel: Jeden Tag eine Nachricht von Kriegen
Die Presse, 14.6.1997
„Deutschlandbilder“ in der jüngsten Lyrik Kurt Drawerts
Dem Kontext der „Deutschlandbilder“, die jüngst in einer gleichnamigen Berliner Ausstellung zu sehen waren, kann man die literarischen Gestaltungen von Identitätsverlust und Deutschlandsuche der Ostdeutschen im Umfeld von 1990 zureihen. Das Bild, das sich ergibt, ist trotz vieler Übereinstimmungen ein in sich gebrochenes. So sahen sich z.B., wie kaum anders zu erwarten, systemkritische Autoren der älteren Generation, die man kaum der Riege blind Parteihöriger zurechnen kann – man denke etwa an Christa Wolf, Volker Braun oder Helga Königsdorf – einem akuten Widerstreit verschiedener Loyalitäten ausgesetzt, einem komplexen Ineinander von selbstquälerischen Gewissensfragen und schmerzendem Utopie- und Identitätsverlust. Repräsentativ ist hier ein bitterer Text Volker Brauns aus dem Jahre 1990, „Das Eigentum“, der das Bild eines östlichen Deutschlands projiziert, von dem es heißt:
Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen
KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN.
Ich selber habe ihm den Tritt versetzt.
Bei der jüngeren Generation „hineingeborener“ Autoren, „die an der Utopie… sowenig teil [hatte] wie an deren Aberbild, der kollektiven Resignation“, gestaltet sich das Thema des Deutschlandverlustes und der Deutschlandsuche einerseits weniger tiefgehend und verstörend, andererseits aber auch widersprüchlich komplex. Lachen sich die Spätgeborenen in einer im Moment blühenden burlesk-heiteren Prosaliteratur von Schelmenroman und Satirespektakel geradezu gesund – zu nennen wären stellvertretend Thomas Brussigs Helden wie wir (1995), Jens Sparschuhs Der Zimmerspringbrunnen (1995) oder Bernd Wagners Paradies (1997) – so herrschen in der Lyrik derselben Generation ungleich diffizilere Töne, zumindest in den unmittelbaren Jahren nach der Wende und Wiedervereinigung. Was man im Gewand der Poesie vernimmt, ist oft eine verwirrte Haßliebeserklärung sowohl an die vergangene DDR als auch an die ungewohnte Leistungsgesellschaft der Bundesrepublik. Nicht von ungefähr lassen sich bei so manchem jungen Lyriker Wahlverwandtschaften zu dem großen Zerrissenen Heinrich Heine, zu dessen Harzreise oder Deutschland – Ein Wintermärchen, beobachten. Selbst in der betonten gesellschaftlichen Gleichgültigkeitsgeste und der respektlos vorgetragenen Distanzdemonstration des Sprachexperimentators Bert Papenfuß-Gorek läßt sich letztlich ein Gefühl von Unbehaustsein aufspüren, etwa in dem Gedicht mit dem vielsagenden Titel „übereinfall“:
was die hölle war, weiß ich nich mehr
weißt nicht mehr, du warst doch dabei
was jetzt los is, is die zukunft, die zusammentrifft.
Aufatmen beim Verschwinden der DDR, aber auch Ambivalenz dem Verlust gegenüber zeichnen sich in einer ganzen Reihe lyrischer Kontrafakturen der Jüngeren zu Volker Brauns Gedicht „Das Eigentum“ ab. So spürt man beispielsweise in Annett Gröschners kontrafaktorischem Text ratloses Verstörtsein:
Was mir nicht gehörte
wird mir genommen im Namen
Deutschland…
und nun ist da nichts mehr
außer den Wänden
gegen die ich jetzt treten darf
Weit über Gröschner hinausgehend und im Ausdrucksgestus eruptiver, gestaltet Kerstin Hensel ihre Verunsicherungsgefühle mit sarkastischem Ärger. In übereinstimmender direkter Ansprache an Braun heißt es:
Denn hier ist keine Heimat – jeder treibt
Komm, laufen wir, als ob uns nichts mehr hält.
Denn jede Straße führt ans End der Welt.
Kühl optimistisch dagegen faßt es Durs Grünbein in der Gedichtsektion „Niemands Land Stimmen“:
und wer war ich:
ein genehmigtes Ich,
Blinder Fleck oder bloßer Silbenrest… (-ich),
zersplittert und wiedervereinigt.
Doch die Stimmung allgemeiner Desorientierung, die die östliche Literatur nach der Wende und der deutschen Wiedervereinigung spiegelt, schwindet allmählich. Neue, gemäßigtere, skeptisch-leisere, ja heitere Tonlagen lassen sich vernehmen. Nicht nur den Ausdrucksformen von Scherz, Satire und Ironie begegnet der Leser, sondern auch einem Gestus des Akzeptierens und der Ruhe. Herausgegriffen aus der Gruppe diverser „Hineingeborener“ sei der Lyriker Kurt Drawert, auf den ersten Blick ein Fremder, Zerrissener, Gequälter in beiden Deutschlands, sowohl in Sachsen als auch Niedersachsen:
Nirgendwo bin ich angekommen.
Nirgendwo war ich zuhaus.
Noch im Jahre 1995 äußerte sich Drawert über sein Deutschlandbild folgendermaßen:
Ohne Koketterie: ich habe mir, ganz allgemein, nie eine Zukunft vorgestellt. Das hat mir die Enttäuschung erspart, daß auch nichts daraus wurde. Über die permanente Zukunftslosigkeit, bezogen auf die Vereinigung, habe ich in Spiegelland. Ein deutscher Monolog geschrieben, und natürlich wiederhole ich das nicht.
Letzteres Satzfragment – „und natürlich wiederhole ich das nicht“ – kann irreführend wirken, denn es bleibt offen, ob der Autor das in Spiegelland Gesagte nicht noch einmal wiederholen will, oder ob sich hier bereits eine implizierte Absage an den Gestus „permanenter Zukunftslosigkeit“ andeutet. Spiegelland, ein essayistischer Prosaroman, gestaltet das biographische „Niemandsland“ des damals in Leipzig lebenden Autors. Es war ein „Nirgendwo“, das auf der Welt der in totalitären Systemen geprägten Väter fußte, auf deren Denken, auf deren herrschende Ordnung und manipuliert-institutionalisierten Sprachdiskurs. Die Grunderfahrung von Heimatlosigkeit und Fremdheit in der untergegangenen DDR schöpfte bei Drawert folglich aus Sprachverlust, aus der Inadäquanz von Zeichen und Bedeutung. In einem Gespräch – „Eine eigene Sprache finden“ – mit Christel und Walfried Hartinger im Jahre 1988 – führt der Dichter aus, wie diese Sprachkrise, „die Verlorenheit der Begriffe vor den Dingen“, bei ihm regelrechte Sprachstörungen auslöste, er „sehr wenig sprach, fast stumm war oder [s]ich stumm fühlte, selbst wenn [er] notgedrungen zu sprechen begann.“ Beim Versuch neuer Heimat- bzw. Sprachfindung nach der Wende sieht sich Drawert dann unter den völlig anderen gesellschaftlichen Bedingungen einer sehr ähnlichen Sprachlosigkeit ausgesetzt, denn die Sprache, „die ich suchte, auf die ich wartete oder die ich wiederherstellen wollte… [war] das ganze Gegenteil… einer Sprache, die mir stündlich abverlangt wurde und auf schon irrationale Weise mit Modeanzügen und Aktenkoffern, Geldanleihen und Unterarmsprays usw. in Verbindung zu bringen war.“ (Spiegelland)
Auch in Drawerts bis dato letztem Gedichtband, Wo es war (1996), ist Fremdheit im neuen deutschen „Niemandsland“ in der Entfremdung von der Sprache verankert, einer auf Profit gerichteten Vermarktungssprache medialer Vermitteltheit. Damit scheint der Dichter einer Äußerung recht zu geben, die er 1994 in einem Interview mit Andreas Herzog gemacht hatte. Es hieß:
Ich kann die Gegenwart nur aus der Vergangenheit heraus sehen, das heißt, ich schaue auf die Bundesrepublik wie aus dem Fenster einer Zelle. Und mit diesem Blick und mit allem, was mein Leben in der DDR war, bin ich so sehr beschäftigt, daß mich das gegenwärtige Deutschland nur in seiner Verweisung, in seiner Differenz zu meinen Erfahrungen interessiert.
Drei Texte aus dem Band Wo es war – die Gedichte „Wo es war“, „Ortswechsel“ und „Tauben in ortloser Landschaft“ – seien betrachtet, um zu beleuchten, ob die oben betonte Akzentuierung der Differenz zu seinen Erfahrungen im „neuen Deutschland“ bereits den Gestus von Distanzierung suggeriert.
In einer Rückschau auf die DDR evoziert der identische Gedicht- und Gesamtbandtitel Wo es war den fortwährenden Einfluß, den die realsozialistische Vergangenheit ausübt:
Ich wußte nicht mehr, wie wir uns trafen,
damals, in den Städten, in denen heute
die Hymnen verwaist
ihr Vaterland suchen. In den Ruinen
des letzten Krieges war eine friedliche,
vaterlose Stille zu finden.
Hier kam ich als Kind her, verstört,
hier ging es uns gut, hier war die Sprache
außerhalb des Körpers geblieben.
Später, an einer empfindlichen Stelle
der Biographie, brach, wie dem einen
die Stimme, dem andern
das Rückrat, erinnere dich,
mir war das Glück des Verstummens
gegeben, wo es war.
Wo es war, hat das Gras schon zu wuchern
begonnen. Die kleine Senke im Boden,
in der ich von Liebe geträumt haben muß,
ist mit Schotter gefüllt, Lachen von Flußtang
und Öl, zerdrückte Aluminiumdosen,
ein Brandfleck. Auch diese Erde
hat ihre Geschichte verleugnet. Schon lange
war es dunkel geworden, als ich noch immer
bewegungslos dastand. Was ich hörte,
war fremd. Was ich dachte. Und es war Tag.
(„Wo es war“)
Der Leser bemerkt auf Anhieb ein ihm bereits aus früherer Drawertscher Lyrik bekanntes breitangelegtes Bezugsfeld von Entfremdungsmetaphern. Der Dichter wählt aus einem etablierten Wortarsenal Begriffe wie „verwaist“, „vaterlos“, „Stille/Stagnation“, „verstört“, „Verstummen“, „bewegungslos“, „fremd“. Im assoziierten Gedanken der Heimatlosigkeit lassen sich Affinitäten zu einem anderen modernen Unbehausten, zu Uwe Johnson, aufspüren, die Drawert selbst in einer Rede beim Empfang des ersten Uwe-Johnson-Preises (1994) betonte: Fremdheit als Ausgeliefertsein an einen Sprechprozeß innerhalb einer Herrschaftssprache, „in der von vornherein feststand, wer mit welcher Aussage und in aller Unumstößlichkeit im Recht war… [oder] nicht im Recht war“. Daraus ergibt sich der Gedanke schemenhafter Unwirklichkeit, kurz: ein „ein übergangslose[s] Ineinanderfallen von Bildern, Stimmen und Szenen, wie wir es in Johnsons Mutmaßungen über Jakob finden“. Fremdheit also als Verlorenheit in der „Unwirklichkeit“ eines „undurchdringlichen Nebel[s]“ in einem „Szenario der Träume“. Von dieser zersplitterten Unwirklichkeit isolierter Einzelwahrnehmungen ist realiter nicht mehr als ein „Brandfleck“ geblieben, eine verwüstete Landschaft, wucherndes Gras – ein Vakuum. Und trotz allem bleiben freundliche Erinnerungsfragmente, Begegnungen mit Freunden und geträumte Liebe in verschandelter Landschaft. Fassungslos durchlebt der lyrische Sprecher eine ihm völlig unverständliche akute Verlusterfahrung: auch der ungeliebte Staat DDR war Heimat, auch Lüge kann Heimat sein. Unmittelbar und wie so oft in diesem Lyrikband wird der Gedanke an den berühmten zerrissenen Vorfahren Heinrich Heine evoziert, den Drawert im Titel eines anderen Gedichtes, „Mit Heinrich Heine“, direkt anspricht:
Als fremder Brief mit sieben Siegeln
ist mir im Herzen fern das Land.
Doch hinter allen starken Riegeln
ist mir sein Name eingebrannt
Fremdheits- und Ambivalenzgefühle setzen sich in dem Text „Ortswechsel“ fort, ein Titel, der den Gedanken der Veränderung in sich birgt, aber, wie überhaupt so viele Titel oder Gedichtversatzstücke in diesem Lyrikband, ebenfalls auf ein Assoziationsfeld von Wurzellosigkeit, Rastlosigkeit oder Suchen anspielt: „Warten“, „Das bleibt nun so“, „Unterwegs“, „Bleib sitzen“, „Winter“, „Nichts“. „Ortswechsel“ ist ein sehr langes Gedicht, und zitiert sei zunächst das Achsenstück, das sich pessimistisch dem Problem des medialen Sprachbreis zuwendet:
denn schon wieder gilt es,
das falsche Wort
im rechten Moment
zu verpassen, den Startschuß,
das nächste Ziel abwärts
Der Anfang des Gedichtes mit seinem auf den ersten Blick vorherrschenden Impetus absoluter Kommunikationslosigkeit legt jedoch vorsichtig noch eine weitere Bedeutungskomponente, ein Fundament sich andeutender Hoffnung frei. Eigenartigerweise schöpft dieses aus den zunächst pejorativ wirkenden Metaphern „Beamter“ und „taubstumme[r] Bauer“, also aus unverbindlichem, versachlichtem Sprechen bzw. Nichtverstehen oder Unverständnis:
Meine Freunde im Osten
verstehe ich
nicht mehr, im Landstrich
zwischen Hamme und Weser
kenne ich keinen.
Gelegentlich grüßt mich
der taubstumme Bauer
von gegenüber, oder ein Beamter
kommt auftragsgemäß
und überreicht,
was zu befürchten war,
mit lockerer Hand.
Nirgendwo bin ich angekommen.
Nirgendwo war ich zuhaus.
Das stelle ich fest
ohne Trauer.
Der Gedanke größeren Abstands – „ohne Trauer“ – verdichtet sich am Ende des Gedichtes dann in einer Freundlichkeitsgeste des „grüßenden Bauern“. Subtil, fast unauffällig deutet sich in diesem Gruß der Gedanke der Selbstkritik an:
Doch mein Körper
ist ruhig geworden,
und es grüßt mich
der gemiedene Bauer
Der vom Bauern angestrebte Dialog mit dem lyrischen Sprecher suggeriert – so könnte man die Textstelle lesen – Überwindung des isolierenden Meidens und Beiseitestehens, Ausbruch aus der Isolation durch Kontaktaufnahme. Nicht zuletzt handelt es sich in diesem Gedicht des Unbehaustseins also auch um ein Bekenntnis zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung.
„Tauben in ortloser Landschaft“ ist der vorletzte Text im Lyrikband Wo es war, der sich stimmungsmäßig mit dem letzten Gedicht „Frieden“ überschneidet. Der Titel evoziert den Gedanken eines negativierten „Nirgendwo“, ein sowohl in Ost als auch in West angesiedeltes Utopia. Zwar sind die Tauben empirische Tauben – „gelbe,/ giftige Tauben… / in den faulenden Giebeln der Häuser“ im ehemaligen DDR-Staat –, doch auch der Gedanke des Friedenssymbols mit dem ihm anhaftenden ideologischen Apparat spielt hinein. Zusätzlich klingt im Homonym „Taube/r“ die oben bereits erwähnte Bedeutungsfacette der Kommunikationslosigkeit an: der Taube als der Sprachunfähige, das Nichtbegreifen von vorfabrizierter Sprache. Das retrospektive Gedicht „Wo es war“ ist, wie es an einer Textstelle heißt, eine „Entsorgung von Biographien“ in ortloser Landschaft, die eine Erblast von Identitätslosigkeit hinterlassen hat. Ein breitgefächertes Spektrum von Verlustmetaphern zahlt diesem Thema Tribut: „am Wegrand Ausgesetzte“, „Findelkinder“, „Bastarde“, „Waisen“, kurz: eine „Kaspar-Hauser-Legion“. Doch das Gedicht endet nicht mit totaler Selbstaufgabe oder Absage an die neue Gesellschaft:
Sobald die Karten
neu eingemischt sind, wird sich das Blatt
ohnehin wieder wenden,
und was einer eben gesagt hat,
reicht morgen zur Hinrichtung aus.
Aber nicht daran werden wir denken,
hier, in dieser namenlos weiten,
ortlosen Landschaft, in die hinein
die Tauben aus allen Himmeln stürzen
und auf der Erde zerbrechen.
Und sie werden krank sein,
nicht aber sterben, wenngleich
das Ende der Gespräche erreicht ist.
Wer im Wind steht, hört ohnehin
keine andere Stimme, und so können wir
gut ohne Hoffnung bleiben
und kommen voran, wo einer noch
desertiert ist oder sonstwie über den Bildrand
verschwindet – „all ihr schönen, fallenden Tiere
in diesem anderen, sehr fremden Land“.
Auch ohne Hoffnung kann man letztlich in diesem anderen fremden Deutschland vorankommen. Beim zweiten und dritten Lesen dieses poetischen Deutschlandbildes glaubt der Leser im Gestus nonchalanter Kälte geradezu eine gewisse Ruhe bzw. Gelassenheit zu erkennen. Blickt man noch einmal auf Drawerts Äußerung von 1994, das gegenwärtige Deutschland interessiere ihn nur „in seiner Differenz zu [s]einen Erfahrungen,“ so spürt man zwar nach wie vor auf Ost und West gerichtete Skepsis, aber der Ton gequälten Zerrissenseins ist leiser geworden. Das scheint auf beginnende Distanz zu deuten, wohl auch Entschlossenheit und ein größeres Selbstbewußtsein. Bei aller Verschiedenheit der weltanschaulichen Position Kurt Drawerts fühlt sich der Leser hier an ein paradoxes Bonmot Volker Brauns aus „Böhmen am Meer“ erinnert: „ICH WEISS KEINEN WEG, ABER ICH GEHE IHN.“ Komplementieren könnte man dieses Statement mit der saloppen Trotzgebärde des wiederum so andersartigen jüngeren Dichters Steffen Mensching:
Im Schnellkochtopf,
time is money, honey, totsein können wir
Noch lange genug…
Menschings lässig vorgetragenem „Dennoch“ in den gesellschaftlichen Ungereimtheiten des „anderen, sehr fremden [deutschen] Land[es]“ fügt sich fast nahtlos die unterkühlte Schlußsentenz von Drawerts allerletztem Gedicht aus dem Band Wo es war zu:
Und es war Frieden
auf den kalten, leeren Alleen.
(„Frieden“).
Christine Cosentino, glossen, Heft 5, 1998
Laudatio auf Kurt Drawert
Empfänger der Otto Braun-Ehrengabe 2001
Kurt Drawert, in einem Interview angesprochen auf Adornos These, nach Auschwitz könne man kein Gedicht mehr schreiben, widerspricht:
Denn das Gedicht ist ein Ort des Widerstandes und der Selbstwerdung und damit auch das Gegenteil von Staat oder jeder Form machtpraktizierender Reglementierung. Im Gedicht kann ein einzelner in einer Weise für sich sein, wie es gesellschaftlich unmöglich ist, mit einem Wort: er entkommt seiner Domestikation. Also wenn es eine Antwort auf das Barbarische gibt, dann im Gedicht. Der Beweis ist Celan. Spätestens mit ihm war Adornos Satz ja nicht mehr zu retten. Es ist gerade dies die Bedeutung von Literatur, dass sie Dinge sagt, die im außerpoetischen Diskurs nicht mehr sagbar sind. Deshalb auch meine Definition des Gedichtes, oder sollte ich richtiger sagen, des Poetischen als eine Sprechmaschine, […] etwas, das Zugriff auf das Wahre hat im Unterschied zum Tatsächlichen. Das und nichts anderes ist die große Herausforderung, vor der jeder Autor auf seine Weise steht.
Nachzulesen ist das in der Dezembernummer 2001 der Dresdner Literaturzeitschrift Ostragehege.
Ein paar Seiten zuvor finde ich dort von Drawert, in dem Gedicht „Ich liebe Industriegebiete“, so wundervolle Strophen wie:
Wie Zwillingsbäume, die einander
über dem Abgrund sich halten, so stehen
vom Lichtschein des Mondes entblößt
und Liebenden ähnlich, die Einsamen
zweisam vereint, endlich verschmolzen
zu einem Geheimnis, das sich selber verbrennt,
die jungen Blüten und das alte Holz, märchenhaft schön in ihrer schrecklichen
Unschuld, an die Rückseite einer verlorenen
Geschichte eines Tages gelehnt. Darüber
hängen die Fahnen der Händler,
nicht mehr im Winde, wirklich,
wie gelbe Birnen
über dem See.
Kurt Drawert ist 1956 in Hennigsdorf (Brandenburg) geboren; 1956 ist das Jahr der Enthüllung stalinistischer Verbrechen auf dem XX. Parteitag der KPdSU, ist das Jahr des Ungarnaufstandes. Er verbrachte seine Kindheit in Borgsdorf und Hohenneudorf bei Berlin. 1967 zog die Familie nach Dresden. Drawert wuchs dank der Stellung des Vaters als linientreuer Polizeioffizier im Privilegiertenmilieu auf – wie er es in seinem 1992 erschienenen „Deutschem Monolog“ Spiegelland formuliert:
Wir saßen in einem provisorisch hergerichteten Keller als die verkommenen Söhne hochbeamteter Väter, dieses ganze Dresdener Innenstadtviertel bestand fast ausschließlich aus hochbeamteten Vätern mit verkommenen, zumeist einzelnen Söhnen und Töchtern, die es mit vierzehn schon machten in einem provisorisch eingerichteten Keller wie diesem, wir waren die zu bummeln und zu trinken beginnenden und verzweifelten Söhne ohne Herkunft und Ziel.
Drawert lernte als Facharbeiter für Elektronik, arbeitete als Hilfsarbeiter in der Fabrik, bei der Post, in einer Bäckerei. 1978 erhielt er eine Anstellung als Hilfsbibliothekar in der Sächsischen Landesbibliothek Dresden; damit stand dem Lesehungrigen die Welt auch verbotener Literatur offen. Er holte das Abitur nach. Von 1982 bis 1985 studierte er am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. 1984 zog er nach Leipzig. Seit 1986 ist er Freier Autor. Sein erster Gedichtband, Zweite Inventur, erschien 1987 im Aufbau Verlag. 1993 übersiedelte er nach Osterholz-Scharmbeck (bei Bremen). Heute lebt er in Darmstadt.
Ich habe mich soeben auf Spiegelland bezogen. Dieser mitreißende Sprachstrom, in dem die Sätze daherschießen „wie aus einem Druckrohr“ (Marie-Louise Zimmermann 1993 in der Berner Zeitung), „als mitreißender Wörterstrom, dann wieder in quälenden Strudeln endlos kreisender Reflexionen, immer aber mit seltener Sprachkraft“ frappiert. Dieser Romanessay ist eine noch schärfere Sohn-Vater-Abrechnung als sie bis dahin aus unserer Zeit vorlagen. Sie gilt überdies dem Großvater gleich mit, der sich zum Widerstandskämpfer stilisierte. „Das Kind, das ich war, wollte die Welt des Sprechens, die es zu betreten hatte, wieder verlassen. Es spürte, vielleicht gerade rechtzeitig noch, wie es über die Worte dem Einfluss des Vaters ausgeliefert war und seinen noch wachsenden Körper an dessen Befugnis verlor“, schreibt Drawert in dem Essay „Der Text und der Körper“. Auf die Frage von Andreas Herzog, 1994, nach der Authentizität, die auch der Leser sich unwillkürlich fortgesetzt stellt, antwortet er:
Wirklichkeit und Wahrheit gehen nur über die Konstruktion ein Verhältnis ein, und die Authentizität in der Literatur ist eben etwas ganz anderes als die dem Realen gegenüber. Selbst wenn man streng mit biographischen Fakten arbeitet, unterliegt man ästhetischen Gesetzen, die der Text fordert […] Das heißt also, ich kann nicht über mein Buch und über mein Leben gleichzeitig sprechen, auch wenn das eine aus dem anderen hervorgegangen ist.
„Zeitmitschriften“ sind nach Drawerts Verständnis seine Essays und Artikel in dem Band Haus ohne Menschen. Für den prosa-essayistischen Text, der der Sammlung den Titel gab, erhielt Drawert 1993 in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis. Der Band ist im selben Jahr bei Suhrkamp erschienen. Es ist eine aus Verletzung zornige Prosa. Die Urheber der „Demontagelandschaften“ werden enttarnt und „linke Nostalgie als Vergesslichkeit nicht nur im Osten, sondern auch in der literarischen Schickeria des Westens festgemacht“, zieht Wilhelm Kühlmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Summe. Drawert widme „sich mit Ingrimm der Entmythologisierung der DDR“ und kratze auch „den Lack ab von der Gloriole der sogenannten friedlichen Revolution, die vielleicht gar keine war.“ Diese Texte, meine ich, werden ob ihrer scharfsichtigen, in Sprache gebrachten Analyse auch dann noch gelten, wenn eines Tages die West-Ost-Diskussion, die bis jetzt ja noch aussteht und die vermutlich noch länger ausstehen wird, einmal geführt werden wird.
Ich greife schließlich aus dem Œuvre Drawerts heraus die Sammlung „Texte und Kontexte“, betitelt Rückseiten der Herrlichkeit, 2001 in der edition suhrkamp erschienen, zum einen in der Absicht Sie dazu zu verführen, Drawerts Bericht und Reflektion zu lesen einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, überschrieben „Nach Osten ans Ende der Welt. Eine Eisenbahnreise“, zum anderen – ich halte inne: vom Folgenden zu reden bedarf eines eigenen Ansatzes. Ich meine seinen Text mit nichts als der Überschrift „Text“. Er beginnt:
Und dass es die Hoffnung ist, in die hinein die Existenz sich entfremdet, habe ich schließlich gedacht gehabt, als ich den unter die Erde führenden Betonweg hinab in die Gaskammer ging. Eine Szene bei Borowski ist mir eingefallen gewesen, in der beschrieben steht, wie eine Gruppe Frauen ins Vernichtungslager Auschwitz überführt wird, wie dieser Todeszug, nur von wenigen SS-Leuten flankiert, an zehntausend Häftlingen, Männer, für die, so Borowski, die Frau mehr noch als die Verkörperung des Gedankens an Freiheit war und die, so er weiter, den ganzen Tag kaum von etwas anderem sprachen als von Frauen […] wie dieser Todeszug nun, in jener Szene, an die ich, als ich den unter die Erde führenden Betonweg hinab in die Gaskammer ging, gedacht habe, an zehntausend Häftlingen, die tatenlos und stumm am Straßenrand lagerten, vorbeigetrieben worden sind. Die Frauen haben laut zu schreien angefangen gehabt […].
Borowskis Szene kehrt wieder und wieder, den Text und die Realität dieser Szene immer mehr verdichtend. Ich halte es nicht für respektlos gegenüber Celan, ihn neben Celans „Todesfuge“ zu lesen.
In Würdigung des Gesamtwerkes hat die Jury der Deutschen Schillerstiftung von 1859 zu Weimar dem Kuratorium der Stiftung vorgeschlagen, den Lyriker, Erzähler, Dramatiker und Essayisten Kurt Drawert mit der Otto Braun-Ehrengabe der Stiftung auszuzeichnen.
Egbert-Hans Müller, Deutsche Schillerstiftung von 1859: Ehrungen – Berichte – Dokumentationen, 2003
SONNE AUF GLASUR
für Kurt Drawert am Goldenen Horn
Sie kleben eng aneinander, bedecken die ganze Wand,
die große östliche Wand der Rüstem-Pascha-Camii,
Ornamente, Fragmente, floral und nicht, Kacheln
aus Iznik, aus Kütahya, unterschiedlichste Farbvaleurs:
hellblau, blaudunkel auf Weiß, weiße Rosetten, rotrot und blau.
Wir brauchen ein Chiragon, das Lesegerät der Blinden,
um zu verstehen, wie ingeniös gefügt dieses Potpourri ist.
In der Nähe der Mitte, nicht die Mitte, aber doch die Mitte
werdend eine Kachel mit der schwarzen Kaaba, einzige Figuration.
Spielzeugstadt. Der Platz fällt über das Schwarz. Von allen Seiten
deuten Minarette, spitze Nadeln, auf den schwarzen Kubus.
Das Licht, weil ungebündelt, schafft nichts als Helligkeit,
hellen Film aus Glasur. Wiedergespiegelte Sonne.
Meine Retina knistert. Hat die Wand Pupillen?
Folgen die Augen dem Köcher? Sonne. Sonne auf der Glasur.
Bin ich ein Tunesier? Bin ich der Fellache aus Fort-Sud?
Fügen die Kacheln den Traum der afrikanischen Jahre?
Girlande, Kelch, Speer: Fern immer wollte ich sein.
Draußen, zwischen dem Strich der Braue und dem Strich des Lids,
versperren monumentale Sarkophage den Weg durch die Erde.
Joachim Sartorius
Joke Frerichs: Deutsche Zustände
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.



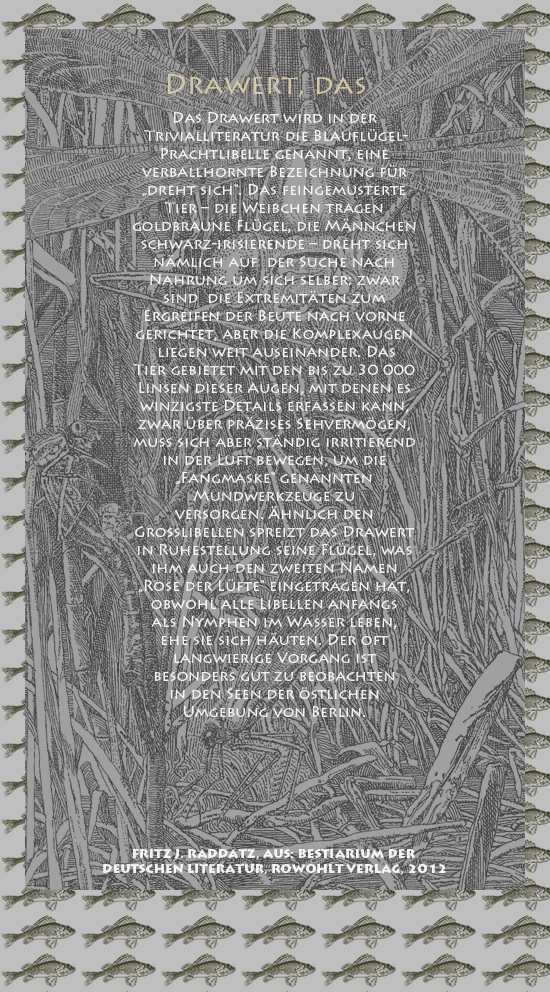












Schreibe einen Kommentar