Reiner Kunze: Gedichte
IN MEMORIAM JOHANNES BOBROWSKI
Sein foto
an den anschlagsäulen
Jetzt
Der nachlaß ist
gesichtet, der dichter
beruhigend tot
Alle Gedichte in einem
Für mich waren Die wunderbaren Jahre in der DDR eine „Überlebenshilfe“. Kunzes Gedichte habe ich erst viel später gelesen. Mit Begeisterung habe ich vor kurzem diese Sammlung entdeckt. Eine sehr schöne und handliche Ausgabe. Vor allem habe ich jetzt auch seine ersten Gedichte, die so nicht mehr erhältlich waren. Sehr gut finde ich auch, dass seine Kindergedichte mit enthalten sind.
Ein Kunde, amazon.de, 4.1.2003
Grandios, bewegend
Reiner Kunzes gesammelte Lyrik. Fischer investiert in einen seiner besten Autoren und ist Kunze nicht einer der herausragenden lebenden Lyriker?!
Liebevoll gestaltet ist der Band. Wem das ein oder andere Gedicht fehlte, wer eines der schmalen Bändchen verliehen hat und nicht wieder bekam (wer mag Kunze schon hergeben?)… hier sind sie alle vereint. Unbedingt empfehlenswert! Allen, die das Nachsinnen noch nicht aufgegeben haben, sei der Band ans Herz gelegt. Wer noch keine Kunze-Poesie gelesen hat, greife ebenfalls gleich zu diesem Band. Er/Sie wird sie nachher doch komplett haben wollen.
Leserat, amazon.de, 1.3.2002
Großartige Lyrik
Natürlich 5 Sterne: Kunzes Lyrik ist so tiefgründig, sprachlich faszinierend, reduziert und doch alles sagend, voller poetischer Bilder – einfach höchste Kunst! Und deshalb diese 5 Sterne! Man mag das für verrückt halten, was jetzt kommt, aber eigentlich ist es für mich schrecklich, dass fast das gesamte lyrische Werk dieses großen Schriftstellers in einem einzigen Buch für ein paar Euro zu haben ist. Wie viel mehr bedeuten mir seine einzelnen Bücher, am liebsten in gebundener Ausgabe. Es ist eigentlich traurig, dass diese Gedichte, die mich nun schon mehr als mein halbes Leben begleiten, die ich immer aufs neue lese, mich immer erneut berühren, mir neue Blickwinkel vermitteln, mir neue Erkenntnisse erschaffen, alle gesammelt in einem Buch um gleich viel Geld zu haben sind, wie ein Abendessen im Restaurant. Was für einen Wert hatte es damals, als ich von meinem Taschengeld als Schüler mir den ersten Gedichtband Kunzes leisten konnte, ihn wie ein Heiligtum nach Hause trug und dann, einige Jahre später bei einer Lesung signieren lassen konnte.
Jedem wirklichen Lyrikleser, der nicht am absoluten Existenzminimum leben muss, empfehle ich, ein finanziell größeres Opfer zu bringen, und sich die Lyrikbände als Einzelausgaben zu kaufen – für mich macht es einen Unterschied und im Vergleich, was diese Gedichte für mein Leben bedeutet haben, ist es immer noch unglaublich wenig Geld, selbst wenn ich die Einzelausgaben zu zahlen habe.
O. Kraft, amazon.de, 24.11.2007
Eine wirklich schöne Sammlung
Dieser Band in Leinen und mit Lesebändchen ist wirklich hochwertig. Für alle Liebhaber der lakonischen Gedichte Reiner Kunzes absolut empfehlenswert! Viele werden mir beipflichten: Lyrik-Leser sind eine aussterbende Rasse, aber nur im gelassenen Von-Wort-zu-Wort-Tasten entsteht wirkliche Lesefreude! Gerade wer sich mit der Gegenwartslyrik auseinandersetzt, kommt an Kunze nicht vorbei. Einer der großen deutsch-deutschen Lyriker!
Ein Kunde, amazon.de, 8.6.2005
kunze ist einfach DER zeitgenössische Lyriker
Kunze ist einer der wenigen Autoren, von dem ich bereits mehrere Lesungen mit Genuß erlebt habe.
Ein ganz besonderer Dichter und Lyriker; nicht nur aufgrund seiner Biographie.
Eine schöne Auswahl seiner Werke liegt mit diesem Buch vor.
patrickkunkel, amazon.de, 30.10.2002
Von einem Land in ein anderes
− Zur Lyrik Reiner Kunzes −
Ich wähle meine Stoffe nicht, die Stoffe wählen mich.
Im Vorspann zu seinem Tagebuch eines Jahres „Am Sonnenhang“ zitiert Reiner Kunze Albert Camus: „Mit vierzig Jahren klagt man nicht mehr laut über das Böse, man kennt es und kämpft gemäß seiner Schuldigkeit. Dann kann man sich dem Schaffen zuwenden, ohne irgend etwas zu vergessen.“ Dem fügt er lakonisch hinzu: „Mit sechzig gilt das doppelt.“
Im Munde eines deutsch-deutschen Schriftstellers am Ausgang unseres Jahrhunderts gewinnen die Worte des Philosophen der Existenz eine konkrete, biographische Bedeutung; was dort – vielleicht etwas pathetisch – in philosophischer Allgemeinheit konstatiert worden ist, füllt sich hier mit der Wirklichkeit eines Lebens unter den Bedingungen deutscher Geschichte in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Zitat und Kommentar schlagen jenen lebensgeschichtlichen Bogen, der in der Auseinandersetzung mit diesem Autor schon oft von seiner frühen Zeit in der DDR bis zu seinen späteren Jahren in der Bundesrepublik gezogen worden ist.
Kunze hat immer besonderen Wert auf die Feststellung gelegt, daß sein Schreiben – jedenfalls seit es ernst zu nehmen ist, d.h. seit es Ende der 50er Jahre aus der Spur sozialistischer ,Volksverbundenheit‘ getreten ist – sich dicht an die Erfahrung von Realität anschließe. Nach dem Impuls für sein Schaffen gefragt, antwortete er:
Ich wähle meine Stoffe nicht, die Stoffe wählen mich. [… Sie] ergeben sich aus dem unmittelbaren oder mittelbaren Erleben, und insofern liegen meiner Arbeit oft eigene Erfahrungen zugrunde. Das schließt das Erschaffen von fiktiven Welten […] nicht nur nicht aus, sondern ein.
Kunzes Schreiben folgt in der Tat den Erfahrungen seines Lebens. Im Rückblick, „mit [mehr als] sechzig“, erweist sich, daß die zentrale Erfahrung seiner schriftstellerischen Existenz die Erfahrung mit den Spielräumen gewesen ist, die dem Schreiben nach Einschätzung des Autors jeweils gegeben waren: So wie der Moralist die Unmoral braucht, so scheint der Schriftsteller Kunze die Erfahrung der Einschnürung des Schreibens zu brauchen, um wie er selbst zu schreiben. Und da er dieser Aufgabe mit Nachdruck nachging, blieb es nicht bei der Erfahrung einer Einschnürung nur des Schreibens.
In den frühen Jahren der DDR erlebte er, in welchem Maße die Sprache der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Realität durch die politischen Verlautbarungen von Partei und Staat besetzt waren, die den ,Kulturschaffenden‘ im wahrsten Sinne des Wortes vor-schreiben wollten, in welcher Weise diese Sprache der (unterstellten) unmittelbaren ,Widerspiegelung‘ von Realität in der Literatur weiterzuverarbeiten sei. In der Auseinandersetzung vor allem mit tschechischen Lyrikern der 50er und 60er Jahre, mit der Aphoristik des späten Brecht, mit Paul Celans Vers-Verknappungen und den atmosphärischen Verdichtungen Huchels suchte Kunze eigene Wege im bedrückenden Labyrinth zwischen den Sprachmauern und fand schließlich zu seinem eigenen Stil. Die Veröffentlichungen zwischen Widmungen (1963) und dem Auswahlband Brief mit blauem Siegel (1973) legen von diesen Versuchen ein beredtes Zeugnis ab. Was Wunder, daß ihm Schreiben weder ein Bekunden im Auftrag wessen auch immer ist noch eine Tätigkeit, die den mechanischen Regeln eines Berufsstandes folgt, etwa dem Gebot der kontinuierlichen Präsenz auf dem Markt; Schreiben wird dem organischen Reifeprozeß in der Natur gleichgesetzt. Wenn der Meister des Marktes, Marcel Reich-Ranicki, im vertrauten Zweijahres-Rhythmus die Kontinuität des Publizierens einfordert und meint, es sei „höchste Zeit“, mit einer neuen Veröffentlichung herauszukommen, dann antwortet ihm der Dichter (die merkantile Formel der Unrast „höchste Zeit“ pointiert theologisch umdeutend):
Höchste zeit kommt von innen
Höchste zeit ist, wenn die kerne
schön schwarz sind
Und das weiß zuerst
der baum
Unter den Doktrinen der verordneten realsozialistischen Regeln fühlte Kunze seine Texte dazu verurteilt, mit ihrer Wahrheit hinter dem Berge zu halten; in ihren poetischen Verschiebungen und gedanklichen Verknappungen reklamieren sie das Recht des Einzelnen; nicht als ,Regimekritiker‘, sondern vom Standpunkt eines sozialistischen (oder vielleicht doch eher eines schlichten menschlichen) Humanismus vermaß er die Erfahrungen, die der Einzelne machen mußte.
Greiz grüne
zuflucht ich
hoffe
Ausgesperrt aus büchern
[…]
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen würde
Konsequenterweise formulierte der Autor seine Erschütterung über den Einmarsch der Truppen des „Warschauer Pakts“ in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 oder die Empörung über die Behandlung, die Alexander Solschenizyn in seiner sowjetrussischen Heimat widerfuhr. Seine Gedichte legen – anders als viele der Kurztexte in Die wunderbaren Jahre – recht eigentlich keine Sachverhalte dar, verkünden keine Botschaften; sie notieren Gefühle, halten Spuren fest und fixieren, was bleibt:
Nur die erinnerung in ihm
ist belichtet
Genau diese Sprache wurde verstanden; wo er las, kamen Hunderte zusammen. Er wußte, für wen er schrieb, und es bedurfte keiner großen Erläuterungen darüber, was unter der Brechtschen List zu verstehen sei, die Wahrheit zu verbreiten. Und er wußte selbstverständlich auch, wer da noch unter den Zuhörern saß. Denn die Obrigkeit blieb nicht untätig. Es nutzte nichts, wenn er beteuerte, er kämpfe nicht gegen den Staat, sondern für eine bessere Welt. Diese Arbeit und diese Kunst, prägnante Worte für die schikanöse Allgegenwärtigkeit der Macht zu finden, erreichen in seinem bekanntesten Buch, in Die wunderbaren Jahre, ihren markanten Höhepunkt.
Bis in jede Nuance sind dem Autor seine Umwelt und die Menschen, mit denen er sie teilt, und vor allem ihre Sprache vertraut, er kennt die Machinationen der staatstragenden Institutionen und findet stets neue Bilder, die von seinen Lesern unmittelbar verstanden werden. Das bereitete der Lektüre im ,Westen‘ durchaus Schwierigkeiten, weil die Assoziationsräume erst durch Kommentare und Erläuterungen geöffnet werden mußten, wo sie den Lesern im ,Osten‘ unmittelbar vertraut waren.
Der Staatssicherheitsdienst der DDR revanchierte sich dafür auf der Höhe seiner literarischen und künstlerischen Möglichkeiten: er produzierte und archivierte 3491 Blatt Akten in zwölf Ordnern, darunter ein Foto von nachgerade Kunzeschem Reduktionismus. Der Betrachter sieht wenig, eigentlich gar nichts, jedenfalls nichts Aufregendes: drei Autos verlassen auf den PKW-Spuren des Grenzübergangs Rudolphstein die DDR. Wäre da nicht ein großer hand gemalter Pfeil, der auf einen dunklen Wartburg mit schmaler Decklast zeigt, in dem zwei Personen zu erkennen sind: Die Kunzes verlassen die DDR, und die Sicherheitsorgane knipsen die Rücklichter!
Wenn man Schriftsteller sein will, muß man sich zu der Konsequenz durchringen, nicht unbedingt Schriftsteller sein zu wollen.
Als Reiner Kunze mit seiner Familie 1977 die DDR verließ, veränderte sich dieses bedingende Umfeld für ihn schlagartig und grundlegend. Er war gezwungen, sich neu zu orientieren und die neuen Lebensbereiche zu vermessen. Er kam nicht allein in eine andere politische, er kam vor allem auch in eine andere literarische Welt. Bei aller stilistischen ,Modernität‘ seiner Texte, Kunze war – trotz Böll oder Wallraff – in der Westliteratur eine befremdende Erscheinung, Ohne daß vereinfachend und populär Text und Biographie kurzgeschlossen werden sollen, läßt sich in den Gedichten, die nun entstehen, doch deutlich erkennen, welchen Widrigkeiten die sprachliche Erkundung der neuen Umwelt ausgesetzt ist. Wo der Druck eines regulierenden Anspruchs fehlt, steht Kunzes Schreiben in der Gefahr, ins Leere zu gehen.
Die Ängste, die ihn im alten System bedrückten, werden zwar in der neuen Umgebung nicht vergessen, und die Erfahrungen, die er in der DDR machen mußte, sind nicht aus den nun entstehenden Gedichten verbannt; aber sie ändern gleichsam ihren Modus: sie werden in die Erinnerung eingegraben, und wiederholt spuken sie durch die Texte, etwa – Wolf Biermann und Walter Mehring gleichermaßen paraphrasierend – „Beim auspacken der mitgebrachten bücher“: Die Bücher von Mandelstam, Nadeshda, Solschenizyn,
Hier dürfen sie
existieren
Noch
Wo die DDR allerdings weiterhin über die Staatsgrenze hinweg auch in westliche Lebensverhältnisse eingreift, etwa mit ihren Ausreiseregularien, da bleibt sie auch im Gedicht unmittelbar gegenwärtig:
Das grab herbeisehnen,
um am tisch des freundes
eine tasse tee trinken zu dürfen
Kunzes Schreibweise ändert sich nicht grundlegend, aber der Ausdruck vieler Gedichte ist weniger aufgesplittert, die Bilder schließen sich leichter und erinnern entfernt an Haikus; der Gedanke tritt direkter und unmittelbarer ins Bild. Und wenn etwa dem bereits erwähnten Gedicht „In Deutschland“ eine prosaische Erläuterung über das bürokratische Reglement des ,innerdeutschen‘ Reiseverkehrs beigefügt wird, dann verweist das auf ein neues Publikum, dem Erklärungen mit auf den Weg gegeben werden müssen, das also den Dichter zwingt, aus seinem Gedicht herauszutreten, um diesem überhaupt erst erläuternd den Weg zu bahnen.
Die ,Übersiedlung‘ in die Bundesrepublik wurde somit von Kunze als eine Entfremdung erlebt: Die Welt, aus der er gekommen sei, meinte er in einem Interview, kenne er bis in die letzte Webfaser, und er sei sich nicht sicher, ob er die Welt, in die er hineingekommen sei, je werde in dieser Weise verstehen können. Daraus folgte für ihn eine bittere Wahrheit: „Wenn man Schriftsteller sein will, muß man sich zu der Konsequenz durchringen, nicht unbedingt Schriftsteller sein zu wollen.“ Das war keine leere Bemerkung; sie wies in die Zukunft.
Kunze behält auch in den neu entstehenden Gedichten im Prinzip seine einmal entwickelte Schreibweise bei, vor allem das Bestreben, durch Verknappung auf engstem Raum ein Höchstmaß an Ausdruck zu erreichen. Er versucht, diese, wenn man es gelehrt sagen will, ,ecriture‘ an den neuen Wahrnehmungen zu erproben. Das Blickfeld des in diesen Texten Sprechenden ist auf den Horizont seiner Privatheit zurückgezogen; die Gedichte der beiden schmalen Bände Auf eigene hoffnung (1981) und Eines jeden einziges leben (1986) beziehen sich auf die unmittelbar erlebte Umwelt, auf die neue Lebenssituation, auf Erinnerungen und auf den Schmerz eines zerteilten Lebens, und wo sich der Horizont weitet, bleiben sie doch an die persönliche, ja private Perspektive gebunden. Die Welt erscheint in isolierten Reiseeindrücken (aus Amerika, aus Portugal, aus der Provence oder aus Israel). Die einfachen täglichen Dinge, die Selbstverständlichkeiten geben die Themen vor, das Finden eines Lebensortes, befremdliche (und auch abgelehnte) Gewohnheiten der neuen Nachbarn, die Jahreszeiten, die Beschädigung und Zerstörung der Natur, deren Teil wir sind.
Das Echo auf seine Gedichte veränderte sich indes, sein Erfolg bekam eine besondere Färbung, Kunze blieb im wesentlichen der Autor der frühen Lyrikbände Sensible wege (1969) Zimmerlautstärke (1972), vor allem aber von Die wunderbaren Jahre (1976) und des Kinderbuchs Der Löwe Leopold (1970), Ein Teil seiner Bücher erlebt durchaus hohe Auflagen, aber ihr Autor steht doch – trotz Büchner-Preis (1977) und vielen Ehrungen – eher am Rande. Das mochte zunächst auch einigermaßen äußere Gründe haben; er störte – ähnlich wie Jürgen Fuchs – das herrschende Meinungsklima, das auf ein Agreement mit ,dem Osten‘ geeicht war und die Konfrontation eher über den Atlantik suchte. So konnte es nicht ausbleiben, daß er politisch konservative Kräfte anzog:
Ein menschliches buch, sagte die stimme am telefon […]
Könnten Sie, sagte die stimme,
nicht auch etwas schreiben
in unserem sinn?
Aber nach 1990 änderte sich die Situation nicht sonderlich; das lenkt die Aufmerksamkeit zurück auf das diesem Autor literarisch Eigentümliche. Er sei, stellt er einmal diese Erfahrung überdenkend fest, in den Augen der ,Westler‘ „altmodisch“. Das ist nicht unrichtig. Schon der Sprachgebrauch Kunzes sticht (in den beiden ,westdeutschen‘ Lyrikbänden vielleicht noch merklicher) gegen den als zeitgenössisch-modern geltenden Duktus ab. Trotz ihrer häufigen Frakturierung mag Kunzes Metaphernsprache dem ,westlichen‘ Ohr zu dringlich, zu geschlossen vorkommen, etwa die von Christa Wolf her berüchtigte Metaphorik des Hausbaus, und der Ton zuweilen (bewußt!) arg hoch angesetzt sein:
Wo,
aaawo bliebe das wort, abgeschwiegen
dem tod, wäre, hochgesetzt,
der hallraum nicht
eines herzens
Aber auch dort, wo Verse artifiziell, stilistisch ,modern‘ angelegt sind, führen die Gedichte nur zu leicht in Bereiche, die jenseits der Scheidelinie zur ,Moderne‘ liegen. Das betrifft ganz besonders jene Texte Kunzes, die sich mit der Erfahrung ,westlicher‘ Lebensweisen auseinandersetzen. Schnell wird hier das ,moderne‘ Leben in sehr altvertrauter Weise als bar jeder ,Mitte‘ und als röhrend leer denunziert: Jugendliche Motorradfahrer mutieren zur Metapher moderner Uneigentlichkeit:
Auch durch euch ertaube ich
an dieser Zeit
Im leerlauf
vollgas
Es scheint, als schütze sich der Autor hier gegen die Fremdheit der neuen Erfahrungswelt durch eine Flucht in vertraute gedankliche und literarische Modelle. Während – um hoch zu greifen – Rilke etwa im Archaischen Torso Apollos die Zentrierung, die Wendung in ein wesentliches Innen, nur noch negativ, nur noch in der Aufforderung zur Umkehr formulieren kann, dieses ,Innen‘ selbst aber nicht mehr aufzufüllen vermag, setzt Kunze auf die positive Kraft des lyrischen Sprechens; der ,poetischen‘ Sprache kommt noch die Kraft zu, ,Sinn‘ zu produzieren:
Aus der höhe schlägt der bach ein, der berg
weist nach unten
Die richtung, die auf uns lebenden lastet
Unter der kalkuliert zersplitterten Textoberfläche funktioniert hier die poetische Sprache noch uneingeschränkt; Metaphern erzeugen noch direkten ,Sinn‘, Natur dient noch als Symbol; das Signifiant zieht ungebrochen das Signifié nach sich. Unter Umständen kann diese ästhetische Korrespondenz politische Dimensionen bekommen:
Lieber über eure köpfe
hinwegfliegen, freunde, lieber
hinwegfliegen müssen über eure köpfe, als
hinwegschreiben
Wo die Kunst-Sprache der ,Moderne‘ die Zerstreuung, die Dispersion – klagend oder feiernd – beschwört, da setzen Kunzes Verse immer wieder auf die sammelnde Kraft von Phantasie und Dichtung. Auf den – nach des Autors Meinung – groben Klotz der Skepsis gegenüber solcher Hoffnung, setzt er – als sei er Robert Gernhardt – den groben Keil reimender Polemik:
Von hundert germanisten liebt die dichtung einer
Berufen ist zum germanisten außer diesem keiner
Die so Gescholtenen könnten zu den Überlegungen über die zeitkritischen Gedichte Kunzes aber doch eine historische Anmerkung beisteuern: Auch wenn (oder vielleicht sogar weil) diese neue Welt – stärker als ihr Autor es selbst einräumt – in den beiden Bänden fremd bleibt, dann ist sie ihm doch auf eine bekannte Weise vertraut; auch literarisch: Der traditionell kulturkritische Blick auf die USA sieht, was er schon vorher und immer gewußt hat. Und er antwortet in der bekannten Sprache, etwa wenn es um eine Garage geht:
Raubtiere,
schieben sie ihre schimmernden schnauzen
über die betonbalustrade,
gierig, am abend wieder
ihren menschen zu verschlingen
Die Motive, die der Autor in diesem Themenkomplex aufgreift, sind durchaus nicht – wie es auf den ersten Blick scheinen möchte – beliebig, es sind vielmehr diejenigen, die vom kulturkritischen Diskurs seit einem Jahrhundert aufbereitet worden sind, und zwar im Negativen (wie vor allem in Motivfeldern ,USA‘ oder ,Stadt‘) wie im Positiven (z.B. im Bildfeld ,Süden‘). Wenn man diese Niederschläge seiner Reiseeindrücke kontrastiv etwa mit denen von Peter Handke oder Rolf Dieter Brinkmann in Beziehung setzt, dann erkennt man leicht die Schablone, auf der sie aufgetragen sind.
Ich bin angekommen – auch dies ist mein Land.
Aber diese – der gescholtene Germanist mag sagen – Gefährdung, im Verlust der Erfahrung den Verlockungen der Diskurse zu verfallen, läßt am Ende doch auch das Spezifische des Lyrikers Kunze deutlich heraustreten. Die beiden ,westdeutschen‘ Bände sind überzogen mit Zitaten von Dichtern und Anspielungen auf Autoren der europäischen Moderne. Hermann Hesse, Georg Trakl, Gottfried Benn, Alfred Kubin, Oskar Loerke, Marie Luise Kaschnitz, Sergej Jessenin, Fernando Pessoa, Ilse Aichinger… . Die Texte sind am dichtesten dort, wo ihr Verfasser mit den An- und Aufgerufenen ins Gespräch kommt, so mit Peter Huchel:
Wenn eure lesebücher die verluste melden werden,
die eure zeitungen verschweigen – dann
vielleicht
Dabei stellen vielleicht nicht einmal die Inhalte oder die Themen die Verbindungen her, es ist die Form, der Duktus, der sie stiftet. Kunze bewohnt – wenn man es einmal poetisch ausdrücken will – einen gemeinsamen Sprachraum mit ihnen.
Anders als die Zivilisationsbezirke des ,Westens‘ sind – so will es dem Leser dünken – die Landschaften der ,Kunst‘, jene Bezirke, in denen der Autor nicht anzukommen braucht, weil er schon seit langem dort wohnhaft ist. In der Literatur, und überhaupt in der Kunst, findet er neben dem verlassenen und dem neu zu gewinnenden Deutschland ein spezifisches, adäquates Areal, das ihm mit Erfahrung gefüllt ist.
Bereits in den Gedichten, die in der DDR entstanden sind, spielen Literatur, Musik und Kunst eine deutliche Rolle; das setzt der Autor fort. Im selbstbezüglichen Reden der Kunst über sich selbst entfalten die bislang letzten Lyrikbände ihre Prägnanz:
Von niemandem gezwungen sein, im brot
anderes zu loben
als das brot
Dabei sprechen nicht einmal diejenigen Gedichte am intensivsten von Literatur oder Musik, in denen in fast poetologischer Weise die Kunst zum Thema wird, etwa wenn von Andersens Märchen gesprochen wird, über den Dirigenten Lawrence Forster oder über die leidige Frage „Und was will der dichter [womöglich: uns] damit sagen?“. Prägnanter ist das Gespräch über Kunst dort, wo von ihr recht eigentlich gar nicht die Rede ist, wo der Bezug sich über den Ton herstellt, wo der Sprechende seinen Gegenstand in den Ton eines anderen nachgerade übersetzt:
Halb hängend am gestein halb
ins wasser gepfählt
Todüber todunter
Vom fels der abschlägt erzählt
das beinhaus
Kunze schreibt sich ein in die Traditionslinie der deutschen Naturlyrik unseres Jahrhunderts; die Webfäden gehen zwischen den Texten hin und her, spinnen ein dichtes Netz, hier zu Huchel, dort zu Loerke, anderswo zu Langgässer, auch zu Sarah Kirsch. Das Gewebe wird dicht in seiner Selbstbezüglichkeit.
Der Junge hat Mut zum Niegesehenen
Dieser Weg ins gleichsam rein Poetische kommt in den 90er Jahren an ein überraschendes Ziel; Kunze schreibt noch einmal ein Kinderbuch: Wohin der Schlaf sich schlafen legt. Gedichte für Kinder. (1991) Es knüpft zwar in manchem an den Löwen Leopold an, aber es setzt sich auch ganz entscheidend dagegen ab. Zwar: „Auch die wunder im märchen sind verzauberte wunden des dichters“, aber die Wunden sind – anders als im Löwen Leopold – bewundernswert gut verheilt. Es ist, als hätte der Autor endlich wieder ein Publikum gefunden, mit dem er zusammenschwingt wie einst mit seinen Hörern (und Lesern) in der DDR: Kinder im allgemeinen und seine bei den Enkel im besonderen. Oder als hätte er sich ein adäquates Publikum erschrieben: die Kinder in uns Erwachsenen:
Kindergruß
kommt zufuß,
schwebt dir ins Gemüt;
leichtes Ding,
Schmetterling −
sucht, was in dir blüht.
In dieser – wenn man so will – Poetologie des Kindergedichts liegt am Ende ein nicht unerheblicher Appell an den Leser. Die Gedichte dieses schmalen Bändchens sind dort, wo sie geglückt sind, und das sind sie sehr häufig, Geburten der Phantasie und Kinder des sprachlichen Spiels; man möchte sie zitieren, eines nach dem andern,
Der Hahn hat einen Kamm,
mit dem er sich nicht kämmen kann.
Kamm hin, Kamm her – der Hahn ist eitel
und kämmt der Wiese einen Scheitel.
Die hält, wenn sie der Hahn kämmt, still
und trägt das Gras dann, wie sie will.
um zu sehen, welches das schönste sei; und kann sich dann doch nicht entscheiden. Die Referenz für diese Gedichte ist keine irgendwie geartete Realität außerhalb ihrer selbst. Der Kamm, mit dem der Hahn die Wiese kämmt, das sind die verhexten, verwunschenen vier (oder sind es nur drei?) Buchstaben, mit denen die Phantasie des Dichters den Hahn ausstattet, auf daß dieser die Wiese kämmen könne. Schon Morgensterns Wiesel brauchte seinen Kiesel. Das Wort wird bei sich selbst, ,wörtlich‘, genommen, und bei seinem Klang. Und das wird über inhaltliche und klangliche Assoziationen weitergesponnen. Der Wortschatz bleibt knapp, die Gedanken entfalten sich eng im Bild, jede Pointe wird gemieden, die Verse sind knapp, die Strophen werden parallel geführt, ohne doch mechanisch zu leiern. Der ,sentimentalische‘ Kritiker würde sagen, die gelungenen Gedichte seien vollkommen ,naiv‘.
Der Autor wirft die naheliegenden Fragen auf, die unsereiner nie mehr stellt, die aber doch so nahe liegen, wenn sie erst einmal gestellt worden sind. Und in unsern Herzen stellen sie die Kinder: Wohin legt sich z.B. der Schlaf eigentlich schlafen, wenn wir wachen? Darüber muß man in der Tat einen Augenblick nachdenken und zurückfragen, um Zeit für die Antwort zu gewinnen:
Wohin der Schlaf sich schlafen legt,
wenn Großvater erwacht?
Am Morgen zwischen die Hörner der Kuh.
Das erscheint glaubwürdig, denn was wäre ruhiger als eine wiederkäuende Kuh? Und das ist zugleich poetisch, denn was erfreute mehr als die heile Natur? Und damit es denn doch nicht zu idyllisch wird, und wir uns besorgt (und banausisch) fragen, ob denn die Kühe am Morgen wirklich schon wiederkäuen, wird behend ein „Furchttraum“ und in der folgenden Strophe ein „Wirrtraum“ eingestreut. Und außerdem erkennt man in der Zeichnung von Karel Franta ganz deutlich zwischen den rosenbekränzten Hörnern der Kuh, wie dem Schlaf die Augen zufallen!
Der Dichter dieser Verse verwandelt sich in den Sohn einer Geschichte aus den Wunderbaren Jahren, dem einer der Freunde des Erzählers prophezeit, er werde Dichter, denn „der Junge hat Mut zum Niegesehenen.“
Die Wiese ist geschoren,
und hätte sie zwei Ohren,
wäre sie ein Schaf
[…]
Und Gras und Wolle wachsen
in Bayern wie in Sachsen
der Wiese und dem Schaf.
Eva und Uwe-K. Ketelsen, aus: Marek Zybura: Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Nur ein Dichter
1
Reiner Kunze kam zur Welt im Jahr 1933, als Stefan George sie verließ. Beiden Großen ist gewiß nicht nur die Kleinschreibung gemein. Dennoch erkennt Kunze seine Ahnen in Fremden, vor allem in dem tschechischen Dichter Jan Skácel. Diesem verdankt er, im Herzen barfuß zu sein. Ohne diesen paradoxen Zustand wären Kunzes sensible Wege undenkbar.
2
Nur in einem Gedicht, nämlich in jenem, das „zuflucht noch hinter der zuflucht“ betitelt ist, ist Reiner Kunze direkt mit Gott verbunden, und dennoch glaubt ihm der religiöse Leser auch in anderen Texten. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß dieser ungläubige Mensch sich nicht davor scheut, Ostern als Dichter zu feiern, und sicherlich damit, daß seine Gedichte wie „glocken allzu nah“ und „der himmel von Jerusalem“ das Schönste, ja das Originärste über Religion in der zeitgenössischen deutschen Poesie sind.
Wenn Kunze im Gedicht „die nacht x“ schreibt: „An ihrer eigenen finsternis! werden sie sich herablassen vom himmel“, was die Welt des Gläubigen auf den Kopf zu stellen scheint, ist dies jedoch das Denken eines Menschen mit Flügeln.
3
„Jeder tag! ist ein brief“ heißt es in einem Gedicht Reiner Kunzes aus der Zeit, als die Post ihm die einzige „Öffnung zur Welt“ und der Brief ein Lichtschein war. Daß er auch heute gelb gestimmt ist, beweist ein überdimensionaler Briefkasten vor seinem Haus.
Nicht nur, daß sein Leben das Postsignal trägt, auch viele seiner Gedichte gelangten durch den Briefkastenschlitz in die deutsche Poesie. Schließlich ist sein Brief mit blauem Siegel neben einem lilienweißen brief aus lincolnshire von H.C. Artmann die bedeutendste Post, adressiert an die deutschen Lyrikleser.
4
Für Reiner Kunze ist der Gast, selbst wenn dieser sich zur Seite setzt, die Mitte. Das gilt für den wirklichen „Besuch aus Mähren“ wie für den winzigen Aquarellgast von Jan Balet. Sogar den Leser seiner Lyrik will er nicht draußen lassen.
Vor der Schwelle des Gedichts lädt er ihn ein: „Treten Sie ein, legen Sie Ihre / traurigkeit ab, hier / dürfen Sie schweigen.“
5
Darum, daß der dichtende Sohn der Provinz, mit der Zunge der Brüder Grimm in der Mundhöhle und František Halas’ Kinderherzen im Brustkorb, zum Dichter von Weltrang emporstieg, machte sich auch eine großartige Frau verdient, deren Zweisprachigkeit seinen Worten über Jahrzehnte entgegenkommt.
6
Den originär Schreibenden gäbe es nicht ohne den originär Seienden. Reiner Kunze hält den Menschen für eines der Wunder der Erde, und er selbst haftet dementsprechend an ihr. Sein existentielles Vorbild ist die sonnige Hänge bevorzugende, ausdauernde Silberdistel: „Sich zurückhalten / an der erde // Keinen schatten werfen / auf andere // Im schatten der anderen / leuchten.“
Marian Nakitsch, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Peter Huchel und Reiner Kunze: eine Wahlverwandtschaft
Wann Reiner Kunze und Peter Huchel sich kennenlernten, lässt sich nicht mehr genau bestimmen. Der erste Briefkontakt stammt aus dem Jahr 1961, als Kunze Huchel eine Übersetzung für Sinn und Form schickte. Es betraf das Gedicht über Chaplin von ihrem gemeinsamen tschechischen Freund Ludvík Kundera, der seinerseits Huchel ins Tschechische übertrug. Zwei Hefte später brachte Huchel gleich vier Gedichte Kunzes, der zwar bereits 1959 einen Gedichtband in der DDR veröffentlicht hatte, aber nun durch die angesehene Akademiezeitschrift auch in Westdeutschland und darüber hinaus bekannter wurde. Neben Brecht und den tschechischen Autoren zählte Huchel zu Kunzes großen Vorbildern. Huchel sei für ihn „die große Autorität“ gewesen, sagte er 2003. „Sich von Huchel akzeptiert zu wissen, streckte das Rückgrat.“ (Mireille Gansel & Reiner Kunze: Die Chausseen der Dichter. Stuttgart 2004).
Als Mitte 1962 bekannt wurde, dass Huchel die Chefredaktion von Sinn und Form abgeben musste, war Kunze einer der ganz wenigen in der DDR, der sich bei ihm meldete, ob er „kleiner Mensch“ etwas für ihn tun könne. Wohin könne er einen Appell an die Vernunft schicken, damit die Zeitschrift nicht eingestellt werde? (Peter Huchel: Wie soll man da Gedichte schreiben. Briefe 1925–1977. Frankfurt am Main 2000). Die Zeitschrift wurde nicht eingestellt, das Schicksal Huchels mit all den Schikanen von Seiten der Partei, der Regierung und der Behörden darf als bekannt vorausgesetzt werden. Wenn nicht, lese man meine Biographie Der heimliche König (Nijmegen 1995, Würzburg 1998).
In den Jahren der Isolation (1962-1971), wo das Telefon abgehört und Post beschlagnahmt wurde, ein Spitzel vor der Tür stand, um die Namen der Besucher oder wenigstens die Nummernschilder deren Autos bei der Stasi zu melden, ging Huchel mit seinem seltenen Besuch meistens in den Wald hinter seinem Haus in Wilhelmshorst spazieren. Denn dort konnte der Feind nicht mithören. Aber auch dann schwieg Huchel oft, und viele seiner Weggefährten bezeichnen gerade dieses gemeinsame Schweigen als eine wegweisende Lebenserfahrung. So auch Kunze, der ihn in diesen Jahren nur ein paar Mal besuchte und glaubte, ihn ein wenig trösten zu können. Dies muss nicht der Anlass zu dem Gedicht „einladung zu einer tasse jasmintee“ aus sensible wege (1969) gewesen sein, bringt es aber zum Ausdruck:
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
„Ich bin jedesmal deprimiert, aber nicht resigniert, sondern bestärkt nach Hause gefahren. Es waren Überlebensgespräche“, sagte Kunze zu Mireille Gansel. Um Huchel Mut zu machen, schrieb er ein Gedicht, das er erst 1971 veröffentlichte. Obwohl es nicht das Haus am Hubertusweg in Wilhelmshorst beschreibt, macht es die Isoliertheit der Hauptperson, die ausweglose Situation Huchels deutlich. Die Farbe grün drückt aber die Hoffnung aus, und Huchel bedankte sich für die schöne Geste.
ZUFLUCHT NOCH HINTER DER ZUFLUCHT
Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor
Hier
ruft nur gott an
Unzählige leitungen läßt er legen
vom himmel zur erde
Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrillt aus hölzerner rinne
der regenstrahl
Was machst du, fragt gott
Herr, sag ich es
regnet, was
soll man tun
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
Kurz vor Huchels Ausreise im April 1971 überbrachte Mireille Gansel Huchel einen Brief Kunzes, der erneut seine Sympathie und sein Mitleben zum Ausdruck brachte. Huchel interpretierte dies jedoch als eine Bitte, zu bleiben, und war einige Tage völlig verwirrt. Um diese Zweifel zu beenden, hat Monica Huchel den Brief aus seinen Händen gerissen und verbrannt.
1967 gehörte Kunze zu der Handvoll DDR-Autoren, die Huchel für eine schwedische Anthologie ausgewählt hatte. Aber auch im Westen setzte sich Huchel für Kunze, um den er sich Sorgen machte, hinter den Kulissen ein. Er befürwortete ein Stipendium der Westberliner Akademie der Künste, das Kunze jedoch nicht akzeptieren konnte, um den Druck in der DDR auf ihn nicht noch größer werden zu lassen. Mit dem Generalsekretär der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Clemens Graf Podewils, unterhielt Huchel sich mehrmals über Kunzes Lage in der DDR. 1973 erhielt Kunze deren Preis. Als Kunze 1977 selber die DDR verließ, war Huchel bereits erkrankt. Meines Wissens haben sie sich nicht mehr gesehen.
Huchel dürfte jedoch der Dichter sein, dem Kunze die meisten Gedichte gewidmet hat, mindestens sechs. Nicht nur die politische Lage in der DDR oder besser gesagt, das Kämpfen um einen humanistischen Sozialismus war eine gemeinsame Quelle ihrer Gedichte, sondern vielmehr das Übersetzen der Sprache der Natur. Das Schweigen, das sie enthält, und die Ruhe, die damit einhergeht, zu übersetzen in Sprache: das teilen Huchels und Kunzes Poesie, so unterschiedlich sie in der äußeren Form sonst auch sein mögen. „Das gedicht als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen und das gedicht als bemühung, die erde […] bewohnbarer zu machen“ lauten Kunzes Maximen am Schluss des Bandes zimmerlautstärke (1972). Huchel hätte das bejaht. Das Warten auf das passende Wort, das Streichen des Überflüssigen, bis der richtige Rhythmus, der richtige Ton gefunden war: das war ihre Art zu dichten, weit entfernt von Trubel und Moden. Wenn das Leben scheinbar stille steht, erfährt ein Dichter wie sie die Essenz des Lebens. Das drückt das erste Gedicht (1967) aus, das Kunze Huchel widmete und das unmittelbar vor der „einladung zu einer tasse jasmintee“ steht:
DORF IN MÄHREN
Fünf jahre heiratete niemand
in Touboř keiner
starb kein kind
wurde geboren
Lautlos blüht am hang
die wegwarte
Wo das menschliche Leben still steht, geht die Natur weiter. Die Wegwarte ist eine wunderschöne blaue Blume, doch wird sie am Straßenrand meistens übersehen oder, als Unkraut betrachtet, sogar mit Gift ausgerottet. In aller Stille und Bescheidenheit blüht sie hier am Hang, zur Freude des aufmerksamen Betrachters, von dem, der die Stille sucht und sie sehen will. Hier verneigt sich Kunze vor dem großen Kleinen, das für ihn den Reichtum des Lebens ausmacht. Das, was er Mireille Gansel als Eigenschaft der tschechischen Poesie beschreibt, ist zugleich seine eigene Grundhaltung.
Die DDR prahlte damit, eine Lesenation zu sein. Als Huchel das Land nach einer Intervention des internationalen PEN-Clubs endlich verlassen durfte, kommentierte Kunze das Schweigen der ostdeutschen Presse in aller Kürze und Schärfe:
GEBILDETE NATION
aaaPeter Huchel verließ die
aaaDeutsche Demokratische Republik
aaa(nachricht aus Frankreich)
Er ging
Die Zeitungen meldeten
keinen Verlust
Doch Kunze vermutete bereits, dass Huchels Poesie im Westen nicht nur auf Lob und Zustimmung stoßen sollte. Die 68er Bewegung forderte politisch engagierte Werke, und wenn man schon Naturgedichte schrieb, sollte es wenigstens um die Bedrohung der Natur durch Umweltverschmutzung gehen. Huchel, der über Unkraut schrieb:
Willkommen sind Gäste,
die Unkraut lieben,
die nicht scheuen den Steinpfad,
vom Gras überwachsen.
Es kommen keine.
und die Wurzeln „erdiger Metaphern“ bloßlegte, um so etwas über die eigene Existenz auszusagen in der Hoffnung, dass ein anderer etwas damit anfangen konnte, stieß auch im Westen oft auf taube Ohren der Geschlechter. Als Kunze im Oktober 1972 in einer westdeutschen Zeitung las, dass die Bedeutung Huchels „mehr von zeitgeschichtlicher als von künstlerischer und psychologischer Beschaffenheit“ sei, brannte sich dies in sein Gedächtnis ein. Er stellte sich vor, wie Huchel, der vor der Stasi und der SED geflohen war, diese Nachricht erleben würde:
ENGRAMM
aaaaaaaaaa[…]
So sehr demütigten sie ihn,
daß er sein leben von den wegen nahm,
die die ihren kreuzten
Angekommen hier, las er, daß er
nicht entkommen war
In einer seiner letzten öffentlichen Lesungen 1977 wurde Huchel attackiert wegen der Mühsal, die das Verständnis seiner Gedichte bereite. Das war nicht das erste Mal, dass Huchel bei einer Lesung beim Publikum auf Unverständnis stieß. Doch er war nicht bereit seine Verse zu erläutern, denn seines Erachtens könne man die Metaphern nur mit anderen Metaphern erhellen. Er antwortete mit einem Vers aus seinem Gedicht „Das Gericht: Nicht gewillt, / um Milde zu bitten…“ und machte durch den Vergleich klar, dass er sich wieder als unschuldig Angeklagten fühlte. Offenbar erfuhr Kunze dies erst 1980. Er teilt Huchels Auffassung, dass ein Dichter seine eigenen Texte nicht erklären, nicht in Prosa umdichten darf. An prominenter Stelle, nämlich am Schluss des Bandes auf eigene hoffnung drückt er die gemeinsame poetologische Haltung aus:
VERTEIDIGUNG PETER HUCHELS
ODER
KRITERIUM
Auch dem vers ist’s versagt,
leichter zu sein
als sein gewicht
Respekt vor dem Werk anderer und Offenheit für das Denken anderer Künstler und Kulturen, auch das war eine gemeinsame Grundhaltung Kunzes und Huchels. Beide waren lange Zeit Vermittler zwischen Kulturen, Sprachen und Völkern. Huchel als Redakteur von Sinn und Form, der Zeitschrift, mit der er in den Zeiten des Kalten Kriegs eine Brücke zwischen Ost und West schlagen wollte; Kunze als Übersetzer aus dem Tschechischen, aber später auch mit seinen Büchern über Namibia und den fast asiatisch anmutenden Betrachtungen über den Kuß der Koi.
1985, also mehrere Jahre nach dem Tod Huchels, schrieb Kunze das Gedicht „wiederbegegnung bei euch“ (aus dem Band eines jeden einziges leben; 1986). Darin zitiert er erneut Huchels „Das Gericht“, aber auch dessen berühmtestes Gedicht, mit dem er seinen Lesern in seinem Abschiedsheft von Sinn und Form 1962 deutlich machte, dass er nicht freiwillig ging:
Der Garten des Theophrast
aaaaaaaaaaMeinem Sohn
Wenn mittags das weiße Feuer
Der Verse über den Urnen tanzt,
Gedenke, mein Sohn. Gedenke derer,
Die einst Gespräche wie Bäume gepflanzt.
Tot ist der Garten, mein Atem wird schwerer,
Bewahre die Stunde, hier ging Theophrast,
Mit Eichenlohe zu düngen den Boden,
Die wunde Rinde zu binden mit Bast.
Ein Ölbaum spaltet das mürbe Gemäuer
Und ist noch Stimme im heißen Staub.
Sie gaben Befehl, die Wurzel zu roden.
Es sinkt dein Licht, schutzloses Laub.
So wie der griechische Philosoph und Botaniker Theophrast in seinem Garten herumlief und sich mit seinen Schülern unterhielt, so war der mit Reiseverbot bestrafte Huchel gezwungen, in seinem Garten Selbstgespräche zu führen, denn „Gäste, die Unkraut lieben“, kamen jahrelang nicht. Huchel verarbeitet hier aber auch Brechts „An die Nachgeborenen“:
Was sind das für Zeiten,
wo ein Gespräch über Bäume
fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen
über so viele Untaten einschließt!
Das bezog Brecht auf das Dritte Reich. Doch Huchel schlägt den Bogen zu der Zeit des Mauerbaus und seiner Entlassung, eine direkte Folge davon, denn eine Ost und West verbindende Kulturzeitschrift war nun definitiv parteipolitisch nicht mehr angebracht. Kunze seinerseits erinnert sowohl an die Zeiten, wo Huchel und später er selbst in der DDR verfolgt wurden, doch auch an beider Kritiker im Westen, die nur die modischen Literaturströmungen gelten ließen. Diese verlangten nämlich ein offenes Sprechen über Untaten, vergaßen allerdings dabei, dass Autoren wie Huchel und Kunze nun gerade über Bäume sprechen, weil sie damit die Verbrechen anprangerten. 1966 heißt es in der „1. bildhaueretüde“ Kunzes:
Auch nach dem sturz
stirbt der baum im baum
nur langsam
Wie im menschen der mensch
Ihm den
kern nehmen,
aushöhlen ihn
Das
macht brauchbar
Doch brauchbar ließen sich Brecht, Huchel und Kunze nicht machen, trotz aller eventuellen Kompromisse, die sie gezwungenermaßen mal eingehen mussten. Das Wasser musste ihnen schon an den Lippen stehen, bevor sie ihr Land verließen, so wie der Eisvogel seinen Ort erst verlässt, wenn der Bach ganz zugefroren ist. Damit referiert Kunze auch an Huchels Winterpsalm, der ebenfalls im Abschiedsheft stand: „Atmet noch schwach, / Durch die Kehle des Schilfrohrs, / Der vereiste Fluß?“ Der Eisvogel ist in der christlichen Symbolsprache das Sinnbild der Auferstehung. Man denke an die Legende vom halkyonischen Vogel, der im Eis nistet.
WIEDERBEGEGNUNG BEI EUCH
aaaaaaaaaaaaaaaaaaNicht gewillt,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaum Milde zu bitten
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPeter Huchel
Wenn eure lesebücher die verluste melden werden,
die eure zeitungen verschweigen – dann
vielleicht
Doch zu ende zählen werden wir die tage nicht
Euch, die ihr gespräche dort pflanzt,
wo sie befohlen, die wurzeln zu roden,
hinterlasse ich den treffpunkt,
damit ihr ihn hinterlaßt:
Beim blauen schriftzug des eisvogels,
der nur dann seinen ort verläßt,
wenn den bächen das eis
bis zum Quell steht
Brecht, Huchel, Kunze: Die nächste Generation verfolgter Dichter wird leider bestimmt kommen. Auch sie werden fahnenflüchtig genannt werden, weil sie den Idealen treu geblieben sind (wie Kunze im Gedicht „Ihre Fahnen“ schreibt). Trotzdem haben sie Gedichte geschrieben und schreiben sie Gedichte, weil sie die Welt ein wenig bewohnbarer machen wollen. Alles auf Hoffnung, wie Johannes Bobrowski sagte. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank Reiner Kunze und herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag!
Hub Nijssen, europäische ideen, Heft 155, 2013
„Rhetorik des Schweigens“
– Zur Autorpoetik Reiner Kunzes. –
Eine aus spontanen Bildinspirationen stammende, oft ,surreale‘ Metaphorik und Lakonismus als Stilprinzip sind die beiden wichtigsten formalen Merkmale des Gedichts von Reiner Kunze. Sie entsprechen zweien der drei grundlegenden dichterischen Verfahren, die die Poetizität lyrischer Texte wesentlich konstituieren; es sind dies die Prinzipien der Normabweichung, der Aussparung und der Überstrukturierung. Die letztere spielt bei Kunze eine eher untergeordnete Rolle, was mit der Prosanähe seiner Verssprache zu tun hat. Alle drei Textbildungsverfahren sind komplementär aufeinander bezogen, und das gilt insbesondere auch, wie zu zeigen sein wird, für das Zusammenspiel von Metaphorik und Lakonismus bei Kunze, das jene Dialektik von Mitteilen und Verschweigen, ein Mitteilen durch Verschweigen ermöglicht, das in der sogenannten modernen Lyrik eine so zentrale Rolle spielt (ohne deshalb eine Erfindung der Moderne zu sein) – als deren Antwort auf die Sprachskepsis und die Sprachnot, die bei den Dichtern des 20. Jahrhunderts so vielfältig und so massiert hervortrat wie noch nie vorher in der Literaturgeschichte.
Die lakonische Sageweise versucht sich nach zwei Richtungen hin abzugrenzen: Einmal beugt sie einer ,schlechten‘ Poetisierung der dichterischen Rede vor, zum andern setzt sie sich ab von dem, was man das „Geschwätz“ nennen könnte, zu dem der Jargon des kommerzialisierten Kulturbetriebs ebenso gehört wie die Sprechblasen der Politiker. Ihm setzt sie ein Schweigen entgegen, dem die dichterische Rede erst abgerungen werden muß.
Um dieses Schweigens willen als Voraussetzung des Reden-Könnens hält es der Dichter mit den Taubstummen:
DIMENSION
Gern setze ich mich zum taubstummen, mit den lippen
wörter schälen
Zuhören kann fast nur noch der taube
Er will verstehen
Und nur der stumme auch weiß, was es heißt,
vergebens ums wort zu ringen
Hin und wieder ernennen wir uns durch zunicken
zu alten hasen (jeder im nacken
die meutefühlige narbe)
Gern setze ich mich zum taubstummen, mit den augen
hören, wenn ringsum sich die stimmen
überschlagen
Seine Behinderung privilegiert den Taubstummen zugleich: Der Ausschluß aus der mündlichen Kommunikation erspart ihm die Teilnahme am Geschwätz der vielen, an der Inflation der Wörter, „wenn ringsum sich die stimmen überschlagen.“ Und weil auch der Dichter sich dem ,Geschwätz‘ verweigert und um das (Wahr)sprechen ringen muß, wo er verstummen möchte, herrscht geheimes Einverständnis zwischen ihnen wie zwischen zwei alten Hasen. Die Narbe, die von dem Nackenschlag herrührt, den die „Meute“ der vielen ihnen versetzt hat, bezeugt eine ähnliche Grunderfahrung, die die beiden miteinander verbindet und mit der die Sprachschwierigkeiten in der dichterischen Rede offensichtlich eng zusammenhängen. Während sich die Stimmen der vielen, sprich: der Gesellschaft, gegenseitig überschlagen und erschlagen, üben sich die beiden im ,stummen‘ Sprechen, indem sie „mit den Lippen Wörter schälen“, auf daß wie beim Schälen einer Frucht deren (Wahrheits)kern freigelegt werde. Das Gedicht wird selbst zum Anwendungsbeispiel jenes lyrischen Sprechens, von dem es handelt. Die Parallelisierung mit der Augensprache ermöglicht ein Sagen durch Nicht-Sagen: indem ein Anderes gesagt wird. Das Gedicht ist selbst der Augentausch, jenes ,Sprechen‘ und ,Hören‘ mit den Augen, das so zum Modell literarischer Kommunikation wird: Diese vollzieht sich als Blick und Gegenblick, als ein gegenseitiges Sich-in-die-Augen-Blicken von Text und Rezipient, das mehr ist als bloße Informationsvermittlung. Deshalb hat Goethe das Auge als „das beredteste von allen Organen“ gepriesen. Während „der Mund taub“ ist und „das Ohr stumm“, „vernimmt und spricht das Auge.“
Die lakonische Sageweise findet sich in der Lyrik Reiner Kunzes nicht von Anfang an. Noch der Band Sensible Wege von 1969 enthält z.B. das relativ lange Gedicht „Die Bringer Beethovens“ (entstanden freilich schon 1962). In dem nächsten Gedichtband Zimmerlautstärke von 1972 gibt es dann nur noch das lakonische Gedicht mit bis zu maximal 22 Zeilen. Der erste Anstoß zur radikalen Zurücknahme lyrischer Gesprächigkeit dürfte in der politisch-biographischen Situation begründet gewesen sein, in der sich Kunze seit 1959 befand, der von ihm selbst so genannten „Stunde Null“ seines Lebens. Damals geriet er mehr und mehr in Opposition zum real existierenden Sozialismus in der DDR, und damit ging es für ihn zunehmend ums physische und geistige Überleben. Der Lakonismus als verhüllende Rede diente dem eigenen Schutz – und er ermöglichte das Aussprechen von Wahrheit noch dort, wo sie nicht geduldet wurde. Man hat solche Redeweise als ,Sklavensprache‘ bezeichnet. Sie ist die Sprache der Unterdrückten und Verfolgten, die sich allein mit ihrer Hilfe noch zur Wehr setzen können.
Da sich jedoch das lakonische Sprechen bei Kunze keineswegs in dieser politischen Funktion erschöpft, kann es seine zentrale Rolle in seiner Lyrik weit über den genannten situativen Kontext hinaus beibehalten. Daraus erklärt es sich auch, daß Kunze einmal von dem „Mißverständnis“ sprechen kann, „Poesie sei verschlüsselte politische Botschaft.“ Nach seinem poetologischen Credo dient die spezifische Sprache der Poesie allein dem Heraustreiben von Wahrheit um ihrer selbst willen, und das gilt auch für das Gedicht mit politischem Inhalt. Wenn dies eine bestimmte Hermetik bedingt, so ist diese nicht eigens gewollt, sie kann aber – und tut dies auch häufig – die Funktion erfüllen, die intendierte Aussage vor einem vorschnellen Verstehen zu schützen. Eine solche Hermetik steht in einem engen Zusammenhang mit dem Wissen des Autors, daß bei weitem nicht alles kommunizierbar ist, was danach drängt, gesagt zu werden, d.h., sie steht in Zusammenhang mit der Sprachskepsis Kunzes, die allerdings moderater ist als die anderer moderner Autoren. Ihr begegnet er vor allem mittels der Metapher, die Hermetik zugleich bedingt als auch auflöst, indem sie etwas anderes sagt, als sie meint, um gerade dadurch das Gemeinte zu ,sagen‘, und so Nicht-Sagbares dennoch kommunizierbar macht. Diese Dialektik von Meinen und Sagen, Sagen und Meinen, die der metaphorisch-lakonischen Rede zugrunde liegt, thematisiert Kunze indirekt in dem „Gedicht mit der frage des lehrers“:
Plötzlich, eines morgens im april, parkten
postautos längs der straße, halb
in den vorgärten, halb
auf dem asphalt
Und was will der dichter damit sagen?
Über nacht hat der goldregen
die zäune niedergeblüht
Die Zweiteilung des Gedichts mittels der naiv-plumpen, ewig gleichen Lehrerfrage nach dem Sinn der Aussage, hier spöttisch zitiert, verdeutlicht die Zweiteilung der Metapher in eine Bild- und eine Sachhälfte, auch Bildspender und Bildempfänger genannt. Danach stehen die angeblich entlang der Straße geparkten Postautos (als Bildspender) für den Goldregen, der über Nacht aufgeblüht ist (als Bildempfänger). Er ist die ,gemeinte‘ Wirklichkeit, während sich die Postautos der Bildinspiration des Sprechers verdanken. Als tertium comparationis fungiert die gelbe Farbe, die Bildspender und Bildempfänger gemeinsam haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, durch die die surrealistisch anmutende Metapher noch nicht ,legitimiert‘ ist. Vielmehr ist das angeblich Gemeinte (der Goldregen) selbst ein ,bloß‘ Gesagtes, das seinerseits erst wieder auf ein – ungesagtes – Gemeintes verweist. Während der Jahre, in denen Reiner Kunze in der DDR verfolgt wurde, ist für ihn die Post, wie man seit den „21 variationen über das thema ,die Post‘“ weiß, zum Inbegriff mitmenschlicher Kommunikation geworden, jener Verbindung nach außen, die dem isolierten Autor, „eingesperrt in (sein) Land“, fast allein noch verblieben war. Die gelbe Farbe der Post konnotiert für ihn soziale Wärme, ein Stück Geborgenheit in einer kalten Umwelt, in der die Menschen mittels aller möglichen Arten von Zäunen voneinander getrennt sind. Wenn der gelbe Goldregen die Zäune „niederblüht“, so ist das ein Stück Aufhebung von Trennung, von menschlicher Entfremdung (vgl. dazu auch die positive Besetzung von ,Gold‘!). Trotz der Ironisierung der Lehrerfrage enthält das Gedicht also doch eine ,Botschaft‘, die sich allerdings nicht in der Antwort erschöpft; die auf die Lehrerfrage erfolgt: Erst das Gedicht als Ganzes, als eine Art Superzeichen, ,sagt‘, was es sagen will, ohne es zu sagen. Deshalb kann Kunze das poetologische Statement formulieren: „Das, was der Dichter sagen wollte, ist das Gedicht.“ (Das Superzeichen ,Gedicht‘ entsteht durch Zeichenbildung auf mehreren Ebenen: Das Wortzeichen „Postauto“, das als Zeichen aus einem Signifikanten (einem Bezeichnenden) und einem Signifikat (einem Bezeichneten) besteht, wird seinerseits zum Signifikanten eines neuen Zeichens, nämlich der Metapher ,Postauto = Goldregen‘, und diese Metapher ihrerseits wieder zum Signifikanten einer bei den nochmals übergeordneten Zeichenbildung, dessen Signifikat, das nicht denotiert ist, ganz von der Verstehensleistung des Rezipienten geschaffen wird. Dieser ist dazu allerdings erst dann befähigt, wenn das Motiv der Post bei ihm ähnliche Assoziationen auslöst wie beim Autor. Bei diesem sind sie wesentlich in seiner Biographie begründet. Kunze weist deshalb einmal eigens darauf hin, daß „hinter den Gedichten (…) Biografie“ steht.
Das Stilmittel der Metapher hat seine besondere Bedeutung im Lakonismus darin, daß es, indem die Metapher anderes meint, als sie sagt, Verschwiegenheit ermöglicht, wo das Reden problematisch wird, wo es z.B. nicht zum Bereden werden darf. Verschwiegenheit in diesem Sinn verlangen nicht zuletzt religiöse Inhalte bis hin zum Numinosen.
Auch diesen poetologischen Sachverhalt hat Reiner Kunze im Gedicht indirekt thematisiert:
DER HIMMEL VON JERUSALEM
Mittags, schlag zwölf, hoben die moscheen
aus steinernen Hälsen zu rufen an,
und die kirchtürme fielen ins wort
mit schwerem geläut
Die synagoge, schien’s, zog ihren schwarzen mantel
enger, das wort
nach innen genäht
Die Moscheen, die Kirchtürme und die Synagoge verkörpern drei Weltreligionen: den Islam, das Christentum und die jüdische Religion. Die letztere ist von den beiden anderen deutlich abgesetzt. Sie hüllt sich in Schweigen, das sie deren lautstarker Glaubensverkündigung kontrapunktisch entgegensetzt. Was von letzterer zu halten ist, deutet die pejorative Wortwahl an (lauthals rufen; ins Wort fallen); sie hält sich an die Alltagssprache und unterscheidet sich darin von der ,kühnen‘ Metaphorik, mit der das Schweigen der Synagoge versprachlicht wird. Auf die Metapher am Schluß des Gedichts weist Kunze selbst in einem Essay eigens hin: Sie entbehre für ihn „nicht der Dunkelheiten“, doch ohne sie „wäre sie nicht genau“. Es ist zunächst einmal eine Dunkelheit, die die Metapher enthält: Was, so ist zu fragen, hat es mit dem „nach innen genähten Wort“ auf sich? Es ist das Wort ,Jude‘ auf dem Davidstern, den jeder Jude in den letzten Jahren der Nazi-Herrschaft deutlich sichtbar außen auf Jacke, Kleid oder Mantel tragen mußte: erzwungenes Glaubensbekenntnis mit meist tödlichen Folgen. Und so enthält die Metapher noch eine weitere ,Dunkelheit‘, freilich anderer Art: Sie verweist auf den dunkelsten Abschnitt in der Geschichte des Judentums. Das „nach innen genähte“ Wort ist nichts anderes als das Verstummen im Angesicht von Auschwitz, dessen Ungeheuerlichkeit sich jeder „nach außen genähten“ Sprache entzieht. Insofern ist „das Wort“ nicht nur das Wort ,Jude‘, sondern meint Sprache schlechthin.
Angesichts von Auschwitz verbietet sich aber auch jeder Lobpreis Gottes, zu dem der Muezzin und die Kirchenglocken anheben – auch dies eine ,Dunkelheit‘, in der jede Rede zuletzt verstummen muß. Wo die Judenheit sich wieder offen zu sich selbst bekennen darf, muß sie sich, um mit dem Ungeheueren, das geschehen ist, fertig zu werden, in sich selbst zurückziehen: Zutiefst versehrte Innerlichkeit sperrt sich dagegen, öffentlich gemacht zu werden. Kunze weiß darum, daß die Versprachlichung von Erfahrung diese nie ganz einholen kann. Dies gilt insbesondere für Leiderfahrungen von der Art, für die der Name Auschwitz steht, „weil Erschütterung nicht gesagt, sondern nur erfahren werden kann“. Deshalb ist letztlich Schweigen die angemessene Haltung für Trauerarbeit. Nur scheinbar widerspricht dem das kurze Gedicht „Einladung zu einer Tasse Jasmintee“:
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Trauerarbeit ist nicht Auslieferung an die Trauer. Ein Du kann helfen, mit ihr fertig zu werden: im gemeinsamen Schweigen. So ist das Gedicht ein Lob des Schweigens und ein Exempel dafür – mit einem Minimum an sprachlichem Aufwand (ein Loblied auf das Schweigen wäre ein Widerspruch in sich).
„Erschütterung“ in einem umfassenden Sinn ist eine zentrale Kategorie in der Autorpoetik Reiner Kunzes. Sie ist der Erlebnishintergrund des Gedichts, weil es dafür, daß ein Gedicht entsteht, „einer poetischen Bildinspiration“ bedarf, d.h., eines dichterischen Einfalls, und ein solcher „immer auf Erschütterung zurück(geht), auf Betroffensein.“ Da diese jedoch, wie wir erfahren haben, nicht gesagt werden kann, ist sie nur indirekt erfahrbar zu machen: eben durch ein Bild, das freilich weder herbeigezwungen noch konstruiert werden kann (Kunze zitiert in diesem Zusammenhang Nietzsches Diktum von der „Unfreiwilligkeit des Bildes“). Im Bild nimmt das Nicht-Sagbare Gestalt an und wird so erfahrbar. Damit es aber Gestalt wird, d.h., damit das Zu-Erfahrende erschwiegen werden kann, bedarf es neben bzw. nach der Bildinspiration freilich auch des Kunstkalküls.
Dieser ist um so dringender erforderlich, je stärker sich das „Betroffensein“ des Autors, das „Pathos des Herzens“ (eine Formulierung von Hans-Jürgen Heise) in den Text drängt. Pathos ist nur soweit zugelassen, als es Ausdruck im Bild gefunden hat und damit nicht mehr einem falschen Zungenschlag erliegen kann. Deshalb spricht Kunze sich nachdrücklich für die „Metapher der westeuropäischen Moderne“ aus, in der, wie er sagt, „ein Kinderherz“ schlägt, sowie für die Metapher, wie sie der sog. tschechische Poetismus geprägt hat, in der „durch die Verknüpfung der entgegengesetzten Welten viel menschliche Wärme freigesetzt wird.“ Indem sie die „Wärme des Herzens“ in die Kunstgestalt überführt und in ihr aufbewahrt, bewahrt sie zugleich davor, allzu ,nackt‘ auf dem Markt zur Schau gestellt zu werden. Man wird in diesem Zusammenhang von einem metaphorischen Lakonismus sprechen dürfen, der in der lyrischen Moderne eine zentrale Rolle spielt.
In dem Band eines jeden einziges leben gibt es ein poetologisches Gedicht, das den hier angedeuteten Sachverhalt thematisiert:
VON DER INSPIRATION
Nur ein anfänger von engel
fliegt unterhalb der wolken
(noch ist er in sich selbst
nicht weit genug entfernt vom menschen)
Wenn deine stirn ein flügel streift,
ist’s einer von ihnen,
und du stehst am anfang
wie er
Als Mittler zwischen Himmel und Erde, als Boten Gottes gehören die Engel dem religiösen Kontext an. Dieser Bedeutungszusammenhang schwingt zwar bei der Allegorisierung der dichterischen Inspiration als Engel unausgesprochen mit, wird aber insofern zurückgenommen, als der Engel Kunzes mehr Mensch als Geistwesen und als solcher noch ganz dem Diesseits verhaftet ist. Damit wird zugleich die alte Vorstellung von der göttlichen Inspiriertheit der Dichter, die sie zum Mundstück Gottes macht, dementiert. Wenn auch wie vom Flügel eines Engels berührt, spricht doch nicht der Gott aus ihnen. Auch sind die Bilder, die dem Dichter zufliegen, allenfalls die Keimzellen von Gedichten: Sie stehen am Anfang des dichterischen Schaffensprozesses, den der Autor erst noch zu leisten hat, damit aus dem Bildeinfall genaue dichterische Rede wird:
Die arbeit an einem gedicht kann tage dauern (die halben nächte eingeschlossen), wochen und – mit langen unterbrechungen – auch jahre.
Es gilt, den semantischen ,Mehrwert‘, der in der „entdeckerischen Potenz“ des Bildeinfalls keimhaft angelegt ist, aus diesem herauszuarbeiten und zur Kunstfigur zu verdichten. Von dem Augenblick an, da ihn der Flügel des Engels gestreift hat, bis zum Abschluß des langwierigen Arbeitsprozesses weiß der Autor jedoch nicht, wohin er ihn führt:
Ehe das letzte wort nicht geschrieben ist, weiß der autor weder, wie es heißt, noch, ob er je bis zu ihm gelangen wird.
Mit der Vorstellung von der Balance zwischen Inspiration und Kunstkalkül steht Reiner Kunze in der oft hervorgehobenen Poetik-Tradition der modernen Lyrik. Stärker als andere betont er jedoch die Appellfunktion, d.h. die Beziehungsebene im poetischen Text gegenüber der Ausdrucksebene. Die Feststellung in unserem Gedicht, daß der Engel noch nicht weit genug vom Menschen entfernt ist, findet darin ihre Erklärung. Kunzes Dichtung spricht vom Menschen zu Menschen; sie hat nicht den Ehrgeiz, Metaphysik zu sein. Das ist zumindest ein Grund dafür, daß das Naturgedicht in seiner Lyrik eher selten vorkommt. Eines der wenigen, die es bei ihm gibt, ist in dieser Hinsicht aufschlußreich:
IN DER PROVENCE
Der himmel ein harter blauer stein
in der fassung des mittags
Der ginster weidet in gelben herden
Der staub
schwingt sich auf zu dem herrn, der er ist
Ein steinerner (stummer!) Himmel und der Staub, zu dem alles wird (dessen Herrscher er deshalb ist), bilden die beiden durch Alliteration hervorgehobenen Pole des eher verschwiegenen als nachvollziehbar mitgeteilten Landschaftserlebnisses. Wieder ist der religiöse Bedeutungszusammenhang der eigentlich religiös konnotierten Begriffe Himmel und Herr gleichsam suspendiert. An der Härte des Steins prallt jede metaphysische Sehnsucht ab, und der all beherrschende Staub spricht von nichts als der Vergänglichkeit alles Irdischen. Zwischen diesen beiden Polen ist das Leben eingespannt, für das der gelbe Ginster einsteht, der, bildlich gesprochen, in Herden weidet (weidende Herden konnotieren das semantische Merkmal ,Lebewesen‘), d.h., dessen Stärke einzig darin besteht, daß er nicht allein ist, sondern überall um sich herum seinesgleichen vorfindet. Anstelle von Metaphysik steht so die soziale Dimension als Sinnkategorie. Zwar glaubt Kunze, „daß das Erleben der Landschaft (…) tiefer reicht als das Stimmungsgedicht“, nämlich bis in die Verwurzeltheit der eigenen Existenz, „dorthin, wo man von Heimat spricht“, aber damit ist die irdische Heimat gemeint, in der es gilt, zu sich selbst zu finden. Die Selbstfindung, die soziale Heimat, Mitmenschlichkeit voraussetzt, ist, ausgesprochen oder unausgesprochen, eines der zentralen Themen in der Lyrik Reiner Kunzes. Daß sich auch im Zusammenhang mit dem Thema Mitmenschlichkeit das Sprachproblem stellt, wird nirgends deutlicher als im Liebesgedicht. In ihm wie nirgends sonst drängt das Innerste des Menschen nach Ausdruck – und sperrt sich zugleich gegen ihn, will Sprache werden und erfährt immer wieder die Unmöglichkeit, es unverstellt in die Sprache hereinzuholen. Karl Krolow hat deshalb vom „absurde(n) Terrain des Liebesgedichts“ und vom „Wagnis individuellster Mitteilung“ gesprochen. Schon 1961 verwies er in diesem Zusammenhang auf den Lakonismus, der am ehesten die Lösung des Problems zu bewerkstelligen vermag. Das gilt im besonderen Maße auch für Reiner Kunze, wie ein letztes Beispiel verdeutlichen soll:
Liebesgedicht nach dem start oder
mit dir im selben flugzeug
Sieh den schatten auf der erde den winzigen schatten der
mit uns fliegt
So bleibt die größte unserer ängste
unter uns zurück
Nie ist die wahrscheinlichkeit geringer daß der eine
viel früher als der andere stirbt
Zwar ginge es noch ungleich lakonischer oder zumindest kürzer: ,Der eine Partner kann nicht ohne den anderen leben.‘ Was aber der poetische Text der Direktheit und der Abgenutztheit der alltagssprachlichen Formulierung voraus hat, ist evident. Keimzelle des Gedichts ist wiederum eine Bildinspiration, und wiederum bringt das Bild das Herz zum Sprechen und ermöglicht es ihm zugleich, nicht von sich zu sprechen. Der immer kleiner werdende Schatten, den das Flugzeug auf die Erde wirft, verweist auf den ungleich größeren, der das Glück der Liebenden überschattet: Er wird um so kleiner, je größer die Flughöhe. (Dem subjektiven Empfinden erscheint die Gefahr um so größer, je höher das Flugzeug steigt.) Paradoxie der Situation: Je größer die Todesgefahr, desto geringer ist die Angst vor dem (gemeinsamen) Tod, der vor dem schlimmeren Tod, bei dem einer am Leben bleiben müßte, bewahren würde. Das Zusammenspiel von Bild und Gedanke sowie die lakonische Sageweise schaffen die ästhetische Distanz und damit die Diskretion, die einer ,schlechten‘ Gefühlsunmittelbarkeit vorbeugt. Innerlichkeit will sich im authentischen sprachlichen Ausdruck nach außen kehren, aber dieser verweigert sich zugleich jeder direkten emotionalen Wirkungsabsicht. Dieses poetologische Grundprinzip hat Kunze selbst so formuliert: „Sprache ist für mich nicht nur menschliches Kommunikationsmittel, sondern auch Identität.“ Das Gedicht ist Selbstfindung im (metaphorisch-lakonischen) Selbstausdruck. Zugleich überbrückt es aber auch den Abstand zwischen Dichter und Rezipienten. Indem die dichterische Rede, vor allem mittels einer verfremdenden Metaphorik, die „Faszination des nie Gehörten, des einerseits Paradoxen, andrerseits aber Neuartigen“ bewirkt, läßt sie uns, gleichsam an der Hand des Autors, „zu Entdeckungen in uns selbst aufbrechen.“ Es ist dies das zweite zentrale Grundprinzip in Kunzes Poetik. Es besagt, daß der Lyriker „immer auf dem Weg [ist], (…) die inneren Entfernungen zwischen sich und anderen zu verringern“, um „die Erde um die Winzigkeit dieser Annäherung bewohnbarer zu machen“, „die eigentliche, die dichterische Möglichkeit.“
Otto Knörrich, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
TRANSPARENZ DER STILLE
für Reiner Kunze
Zimmerlautstärke.
Die Eindringlichkeit
des Verschweigens.
Bedeutungen
fortgelassener Worte.
Manches vielsagend
in die Luft geschrieben
in das Wasser
oder in eine leere Zeile.
Verständlich
in der Transparenz
der Stille.
Unausgesprochenes
ausgesprochen
immer da wo es
darauf ankommt.
Christel Lorek
TRAUMREISE
Mir träumte ich ginge durch Deutschland
über Hof
durch Plauen
nach Greiz.
Hinter einer Tasse Jasmintee
lugten zwei Augen –
Er war wieder da.
Ich zog nach Norden
in das preußische Berlin.
In seinen Fenstern hingen Lampions
und durch die Tür klang das Lachen
dreier Frauen,
Er war wieder da.
Nun endlich –
wir waren alle wieder
in einem Land.
Gerald Zschorsch
DER SCHREIBTISCH DES DICHTERS
für Reiner Kunze
sein tisch weit geöffnet auf ein fenster hin zum fluß
vor dem vorüberziehen der horizont
die wasserfarbenen jahreszeiten
und lange weiße schiffe geflaggt
in allen ufersprachen
auf der leeren seite des tisches
groß wie eine zur faust geballte hand
ein mensch der tränen weint aus glühendem metall
Mireille Gansel
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


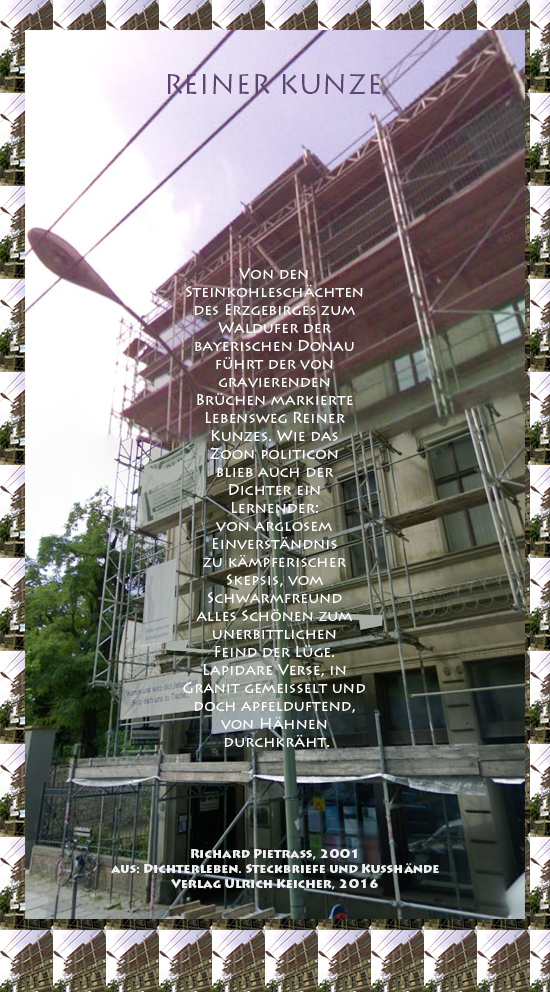












Schreibe einen Kommentar