Z.Zt. n.V. Reiner Kunze: lindennacht
MOHNMOND
Hommage à Christine Lavant
Wozu noch Botschaft?…
Du hast die Sonne von mir wegbefohlen
und wartest ab und hoffst und wirbst geheim,
daß ich die Wärme durch dich selbst ersetze.
Schau, wie die Erde kühl im Monde schläft!
So will ich schlafen.
Chr. L.
Was alles war der mond ihr!
Eine schaukelnde wiege, in der sie,
über sich einen betthimmel,
nie lag
Eher bedrückten im traum sie
die harten kleinen monde
der schwesterlichen knie
(das bett geteilt zu dritt)
Oder sie entdeckte im gesicht des mondes
skrofelgrinde wie im eigenen,
und ihr schien,
die sterne mieden ihn
Der mond, das spinnrad,
an dessen spindel sie sich stach und stach,
ohne schlaf zu finden
Ein henkerrad war ihr der mond,
auf dem die nacht
sie räderte,
ein horn, verlassen
von allen liedern,
und weiße blume für den eigenen leichnam,
um wenigstens im tod
das Jesukind zu rühren
Er war der heidengreis,
der hinterm fenster
vorüberging am kreuz,
verläßlich
Doch mehr noch als der mond
bedeutete ihr der mohn, den Luzifer
im schock des sturzes säte,
und der nun an der böschung ihrer gottverlassenheit
mildtätig blühte
Am morgen waren ihr die augen
gerötet von ihm
Ihr, Trakls
schwester
Inhalt
„,fahrt mit altem meister‘ heißt in Reiner Kunzes neuem Gedichtband eine seiner poetischen Landschaften, wie er sie unnachahmbar mit wenigen Strichen zu malen versteht. Auch der Autor selbst zeigt in lindennacht die reifste Meisterschaft: eine, die mit immer sparsameren, scheinbar immer kunstloseren Mitteln Kunst entstehen läßt. Jahrzehnte von Leben und Schreiben müssen auf diese Kunst hingearbeitet haben.“ Jakub Ekier
S. Fischer Verlag, Ankündigung
Lindennacht
− Reiner Kunze stellt seinen neuen Gedichtband vor. −
Johannes Bobrowski hat ihm den „Namen des Unhörbaren“ gegeben: Holunder – so nannte der sarmatische Dichter 1963 den Verfolgten, „der reif geworden ist / und steht voll Blut“. Er dachte dabei an seine jüdischen Nachbarn im einstigen Memelland, Litauen. Seit je galt der Holunder als Inbild der Lebenskraft. Nur am Vergessen der Nachgeborenen mochte die Holunderblüte in Bobrowskis gleichnamigem Gedicht sterben. Nun hat sich Reiner Kunze zum Holunder bekannt. „Am wesen der eiche jedoch / würde ich leiden, das mark des holunders / spür ich in mir“, schreibt er in seiner „Variation über das Thema ,Philemon und Baucis‘“. Verneigt er sich hier vor Bobrowski? Stellt er sich an die Seite der Schwachen, Verfolgten, er, der selber im Jahr 1977 so von den DDR-Behörden drangsaliert wurde, dass er einen Antrag auf Ausbürgerung stellte, obwohl er doch niemals fortgehen wollte?
Der Holunder ist ein Baum der Grenze – zwischen Wald und Garten, Leben und Tod. Ein Grenzgänger ist Reiner Kunze. Ein bisschen „Waldgänger“ auch, wenngleich ein kosmopolitischer, wie sein neuer Lyrikband belegt. Im Holzhausenschlösschen, das die Zuhörerscharen nicht fassen konnte, stellte er jetzt erstmals seine neuen Gedichte vor, die unter dem Titel lindennacht vor kurzem bei S. Fischer erschienen sind. In fünf Abteilungen versammelt das kleine blaue Buch Gedichte über den Makrokosmos, der sich im Mikrokosmos der Natur und des Alltags spiegelt, Verse über das „Zwischenland“ Kunst, wie sie sich in Musik und Sprache verdichtet, über das Erleben finnischer Landschaft und koreanischer Kultur, über den Tod und über das Leid, das ihn übersteigt.
Die Leitworte, die ihnen vorangestellt sind, weisen den Dichter zudem als belesenen und einfühlsamen Kollegen aus. Doch der Gedichtband ist nicht nur ein Selbst-, sondern vor allem ein Liebesbekenntnis. Er ist nicht nach dem Holunder benannt, sondern nach der Linde, in die sich nach Ovids Metamorphosen Baucis verwandelt hat. Mit jeder Linde in Kunzes Gedichten ist immer auch seine Frau zwischen den Zeilen zugegen, die mährische Ärztin Elisabeth Littnerova, mit der er seit 46 Jahren verheiratet ist. Über das Bild der ehelichen Liebe hinaus weitet sich die Lindenkrone zu einem Blütenhimmel, zu dem der Blick des Menschen wie ein Kleiber emporsteigt, ins bienenumsummte „himmelgrün“ des Tages oder in die sternenwimmelnde Nacht, um das Universum zu vermessen und sich neue Himmel zu erschließen, für die er gar nicht geschaffen ist:
Wollten wir das anderssein der welt
begreifen, müssten wir
andere sein
Wir menschen unter linden, die blühn,
und es ist nacht.
Von den hundert Seiten nehmen die Gedichte der ersten Abteilung fast die Hälfte ein: freie Rhythmen über den Bergmannsalltag der Kindheit im Erzgebirge, das Verwachsensein „auf leben und tod“ über dem Donauhang südlich von Passau, wo der Dichter ein neues Zuhause fand, über die Angst vor dem leeren Schuh des anderen und den „tapferen Vorsatz“, die zusammenbrechende Welt mit der Erinnerung an das erotische Zehenspiel von einst wiederaufzurichten. Spottverse auf die Rechtschreibreform und ironische Kommentare auf ästhetische Programme folgen im nächsten Teil, empathische, aber auch befremdete Annäherungen an Poeten und Passanten in Korea im dritten. Aber vor dem Grauen in den Goldlagern der sibirischen Kolyma schweigt er und lässt wieder einmal einen Autor zu Wort kommen, den niemand hören und lesen will: Warlam Schalamow in einer „Stele“.
Claudia Schülke, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.9.2007
In der Schönheit der Schöpfung
ist der Mensch das störende Element
− Fünf Silben Wehmut und sieben Silben Einsamkeit: Reiner Kunzes neuer Gedichtband lindennacht. −
Seinen lyrischen Beobachtungsposten bezieht Reiner Kunze abseits der Geschäftigkeit des Tages. „Die linde blüht, und es ist nacht / Das dröhnen der bienen ist verstummt, statt ihrer / wimmelt es von sternen“ heißt es im titelgebenden Gedicht des Bandes lindennacht. Es sind Alterswerke, in denen Kunze seine Kunst der Verknappung und der Reduktion auf das Unverzichtbare weiter vorantreibt. „Die welt entfernt sich“, notiert er lapidar.
Der Band umfasst 80 Gedichte, vorwiegend aus den Jahren 2005 und 2006. Sie sind in fünf Abschnitte gegliedert. Doch schon der erste, umfangreichste, spannt den Lebensbogen von Erinnerungen an die Kindheit in einer Bergmannsfamilie im Erzgebirge über den Hunger der Nachkriegszeit bis zur Erfahrung der Vergänglichkeit, der verstreichenden Zeit und der gelassenen Todeserwartung des Alters: „Wir wollen, wenn die Stunde / naht, mit ihr / nicht hadern“. Wesentlich ist dabei das „Wir“ als Ausgangspunkt, das auf der gemeinsam erworbenen Vertrautheit einer langjährigen Ehe beruht. Die „Variationen über das Thema Philemon und Baucis“ gehören zu den schönsten Versen dieses schmalen Gedichtbandes. Es sind Liebeserklärungen, deren Zärtlichkeit über den Tod hinaus reicht:
Der eine wird noch eine zeitlang
weiterleben müssen
Am schlimmsten wird es sein
in zügen
Zwischen zielen
ohne liebe
In seinen besten Gedichten braucht Kunze nur wenige Zeilen, wie ein Zeichner, der mit ein paar exakt gesetzten Strichen die Kenntlichkeit der Dinge schärft. Landschaftsbilder, in denen er die Stimmung des Augenblicks einfängt, entsprechen ihm sehr. Während die Zeitung eher störend auf den Frühstückstisch fällt, sind die wahren Nachrichten der Natur abzulesen: „Die wimpern schwer von regen / tat im tal das feld / ein auge auf / mit blauer pupille“. Reiner Kunze feiert mit solchen Hymnen die Schönheit der Schöpfung. Der Mensch ist darin eher das störende, zerstörende Element.
Eine Tendenz zum Kulturkonservatismus, eine Weltferne, die in das Lob der doch immer so viel schöneren Vergangenheit umschlägt, ist unverkennbar. Kunzes Spottverse auf die Rechtschreibreform als einer „orthographischen inquisition“ sind eher läppisch. Gerade hier, wo er entgegen seiner Neigungen einmal „politisch“ und tagesaktuell sein möchte, wirkt er am ältlichsten. Auch die Reisebilder aus Korea kommen in ihrer Faszination für Fernöstlich-Meditatives nicht über den touristischen Blick auf Reisfelder oder auf Lesende in einer Buchhandlung hinaus. Überzeugender sind seine Versuche mit der Form des Sidcho und mehr noch mit dem Haiku, der in seiner kargen Schlichtheit wie für ihn geschaffen ist:
Fünf silben demut
sieben silben einsamkeit
fünf silben wehmut
Das ist Kunze kompakt.
Abgeschlossen wird der Band mit einer Reihe von Nachrufen auf Freunde und Weggefährten und Würdigungen derer, die ihn prägten, darunter Albert Camus, Christine Lavant und Hermann Lenz. Das Schlusswort bekommt mit Warlam Schalamow ein Zeuge des stalinistischen Gulags, den Kunze mit den Worten zitiert: „Was ich gesehen habe sollte niemand sehen niemand sollte davon erfahren Wenn man es aber gesehen hat ist es besser bald zu sterben“. Die einzelnen Worte sind untereinander notiert, damit sie den Gedichttitel „Stele“ verdeutlichen. So steht am Ende das Verstummen angesichts des Zustands der Welt. Das klingt wie der Abschied eines großen Lyrikers.
Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung, 2.1.2008
Richtschnur Poesie
Obwohl Reiner Kunze am 16. August 2008 seinen 75. Geburtstag feierte, kann man über seine neuen Verse nur bedingt von einem Alterswerk sprechen. Zu lebendig sind viele Bilder, zu überraschend und zuweilen verspielt sind manche Verse.
Es fällt schwer, die achtzig in diesem Bändchen versammelten Gedichte in einem Atemzug einzuordnen, aber eine leichtfertige Formel über Reiner Kunze auszusprechen, um ihn auf einen Nenner zu bringen, bleibt seinen Gegnern überlassen, die sich seit Jahrzehnten hartnäckig halten.
Der Titel lindennacht täuscht, wenn man die neueste Gedichtsammlung von Reiner Kunze auf harmlose Naturidyllen reduziert. Die Natur in ihrer bezaubernden Vielfalt und Schönheit hat zweifellos etliche Verse von Kunze inspiriert und somit zum Leben verholfen, aber andererseits weiß der Dichter von der ständigen Bedrohung der Idylle durch allerlei irrationale Kräfte, welche das Leben bereithält.
Dass Kunze sein Handwerk meisterhaft beherrscht, zeigt sich im souveränen Umgang mit Reimen, mit Metaphern, mit Alliterationen und strophischen Formen. Im Gedicht „Der Teich mit den Roten Fischen“ gewährt Kunze ein weiteres Mal Einblick in die Welt der japanischen Koi-Karpfen. Dabei verwendet er unter anderem Verse mit einer ungewöhnlichen Anhäufung von Alliterationen und kombiniert diese Strophen mit eindrucksvollen Bildern, in welchen die Motive „roter Fisch“ und „Blutstropfen“ ineinander verschmelzen:
und als blute noch immer die schöpferhand,
die das scharfe schattige schilf schuf,
röten sie im röhricht dann
tropfen für tropfen
den kühlenden grund
Im gesamten Gedicht regieren Anspielungen und Zitate, aber auch Paradoxien und überraschende Pointen. Dieser poetische Vitalismus bestimmt auch andere Gedichte dieses Bandes und überrascht mit seiner Spielfreude und Lebenslust. An anderer Stelle wiederum wird Kunze nachdenklich und beugt seine Besinnung der gezählten Lebensjahrzehnte. Eine Art von dichterischer Bilanzierung blitzt dann auf. Erinnerungen an eine von Bescheidenheit und Armut geprägte Kindheit in einer sächsischen Bergarbeiterfamilie fallen dann ebenso an wie Ausblicke für die noch verbleibende Lebenszeit.
Die Liebe zu seiner Frau Elisabeth wird auch im Gedicht mit dem bezeichnenden Titel „Noch Immer“ auf ungewöhnlich einfühlsame und zärtliche Weise formuliert:
Noch immer ist’s
der horizont der jugendlichen hüfte
Noch immer ist
das zarteste
das zarteste
Des spiegels unerbittlichkeit
vermag uns nicht zu täuschen
Wir wissen mehr
als er
Stark und immer wieder verblüffend bieten Kunzes Verse Ausblicke über den vertrauten europäischen Kontext hinaus. Bereits in seinen frühen Gedichtsammlungen, die noch in der DDR entstanden sind, zeichnete sich ein waches Interesse für exotische Kulturen und deren Denken ab. Nicht nur, dass Kunze auch Haikus schreibt – seine Lyrik, die ein Höchstmaß an Genauigkeit zugleich mit größtmöglicher Kürze auszudrücken versucht, hatte von jeher Anleihen aus dieser Gedichtform genommen. Ein Dutzend Gedichte, die offenbar einem koreanischen Aufenthalt zu verdanken sind, widmen sich in direkter oder indirekter Weise Motiven und Mustern koreanischen Denkens und Traditionen.
Auch seiner Tradition der Widmungen ist Reiner Kunze treu geblieben. Er gedenkt dabei verstorbener Weggefährten wie Alexander Graf von Faber-Castell, dem Schriftsteller Hermann Lenz, dem Bildhauer Heinz Theuerjahr oder dem tragisch aus dem Leben geschiedenen Freund Ulrich Zwiener aus Jena.
Kunze vermag es, dem unmittelbar Einzelnen gerecht zu werden und andererseits zugleich der Menschheit als Gattung zu gedenken. Das Vermögen des sprachlichen Ausdrucks kommt angesichts des Todes an seine äußerste Grenze, hält sie aber zugleich spannungsgeladen aus! Die reduzierte Form der sprachlichen Mittel heben Kunzes Nachdenklichkeit wohltuend von zeitgeistiger Geschwätzigkeit ab.
Bei aller Behutsamkeit der abgewogenen Formulierung scheut sich Reiner Kunze nicht, als falsch erkannte Vorgänge kritisch zu benennen. „Scharlatanerie“ in der Welt der Künste ist ihm ein Greuel. Eine Ästhetik, die den „klumpen fett in der zimmerdeckenecke“ zur Kunst proklamiert, wird deutlich hinterfragt:
Und waren die, die applaudierten,
vielleicht nur geiselnehmer
ihrer selbst?
Man hört bereits die verurteilenden Verdikte raunen, das Arsenal der politischen Denunziationen ist sattsam bekannt.
Doch Kunze hat in der DDR wie in der Bundesrepublik bewiesen, dass er sich nicht den jeweiligen Obrigkeiten oder Zeitströmungen, sondern ausschließlich der Poesie unterzuordnen gewillt ist.
Volker Strebel, Ostragehege, Heft 52, 2008
„sieben silben einsamkeit“
− Kunzes Gedichte zeichnen sich durch eine aufs Äußerste konzentrierte Sprache aus. Frei von jeglichem Pathos faszinieren sie in ihrer schlichten Schönheit. −
Es dürfte nur wenige Schriftsteller geben, deren Texten die Zeit kaum etwas anhaben kann. Reiner Kunze, geboren 1933 im erzgebirgischen Oelsnitz als Sohn eines Bergarbeiters, zählt zweifellos zu ihnen. Neun Jahre nach ein tag auf dieser erde hat er einen Gedichtband vorgelegt, dessen Titel nicht zuletzt auf die Motivwelt der Romantik verweist: lindennacht.
Nahezu ausnahmslos werden Kunzes Verse von einem unverwechselbaren, leisen Ton bestimmt, der etwas Endgültiges hat. Entstanden sind die Gedichte in den vergangenen fünf Jahren; sie kreisen um Kindheitserinnerungen an die Bergmannswelt des Erzgebirges und an die Nachkriegszeit, um zentrale Themen des Lebens wie Älterwerden und Tod, aber auch um Bildende Kunst, Musik und Natur.
Die Linde kann als Leitmotiv begriffen werden, erscheint sie doch mehrfach, beispielsweise in „variation über das thema ‚Philemon und Baucis‘“, das zugleich eines der bemerkenswertesten Gedichte des Buches ist. In „nach alter kinderweise“ greift Kunze das Lied „Maikäfer, flieg“ auf, seine „spottverse“ sind gegen Sprachbeschädigung und Rechtschreibreform gerichtet. Einen eigenen Zyklus bilden Gedichte über Orte, etwa „im norden“ oder „Finnland bei Nykälä“.
Annährung an den Tod
Kunzes Gedichte zeichnen sich durch eine aufs Äußerste konzentrierte Sprache aus. Frei von jeglichem Pathos faszinieren sie in ihrer schlichten Schönheit. Viele der Texte lassen sich als Annäherungen an den Tod lesen; sie sind von eindrucksvoller Klarheit sowohl im Ausdruck als auch in der Form, die folgerichtig im Haiku ihren Höhepunkt erreicht.
„Fünf silben demut / sieben silben einsamkeit / fünf silben wehmut“ heißt es in „schule des haiku“. Und die letzte Zeile von Kunzes „altershaiku“ lautet: „Die welt entfernt sich“. Verklärungen oder falsche Romantisierungen liegen dem Dichter fern; besonders deutlich wird dies in „dachfenster bei sternklarer nacht“: „Wie verloren wir liegen // Doch lieber ungeborgen, / als über uns / ein ebenbild des menschen“.
Frank Thomas Grub, titel-magazin.de, 23.12.2007
Es lebe die Trikolore
− Fünf Silben Demut: Reiner Kunzes neue Gedichte. −
„Schreiben Sie noch? Lange nichts gehört.“ Diese einigermaßen ignorante Anfrage eines Anonymus stellt Reiner Kunze vor sein Gedicht „Schuldiggebliebene Antwort“, und das lautet selbstbewusst: „Bücher / sind stille wesen, / man / hört sie nicht.“ Das mag schon sein und den Autor trösten. Dennoch vermerkt man erstaunt, dass der Büchnerpreisträger sogar in einem jüngst erschienenen, umfassenden Porträt-Kompendium aller „bedeutenden“ deutschen Lyriker des zwanzigsten Jahrhunderts gar nicht mehr vorkommt. Sind denn seine vielgelobten und vielgelesenen Gedichtbände Sensible Wege, Zimmerlautstärke, Auf eigene Hoffnung, ein tag auf dieser erde wirklich schon vergessen? Oder verschweigt man Kunze absichtlich? Mit der Rolle des absichtlich Verschwiegenen ist er ja seit seinen DDR-Zeiten gut vertraut. Galt er doch nach anfänglicher Anerkennung durch die offizielle Literaturpolitik der DDR zunehmend als politisch unzuverlässig und wurde kaum noch gedruckt, bis er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Er hat, zuvor und danach, gelernt, mit Zensuren zu leben.
Er seinerseits verschweigt nichts, auch nicht seine frühen parteilichen Elaborate. Schon das Eingangsgedicht seines neuen Gedichtbandes – „Der Teich mit den roten Fischen“ – erinnert an sie. Es scheint sich dabei zunächst nur um eine zeitlos-naturselige Betrachtung des biederen Goldfischteiches im Garten zu handeln; doch die rote Farbe der Fische ruft frühe Erfahrungen auf: „Auch erinnern die ziehenden roten fische / ans wehn einer fahne, / zerschlissen vor unfehlbarkeit, / und ans entzündete des eigenen lebens.“ Der Enthusiasmus für die rote Fahne bewirkt zugleich die bleibende Verwundung. Für die Anthologie der Nationalen Volksarmee der DDR mit dem Titel „Nimm das Gewehr“ schrieb Kunze beispielsweise noch 1959 einen „Gesang auf die Sauberkeit“, in dem er den friedlichen Söhnen von Putzfrauen empfiehlt, das Schießen zu lernen. Nicht jeder einst Fahnengläubige gesteht, wie wir wissen, solche frühen Verfehlungen ohne weiteres ein.
Doch die Fahne, auf die Kunze von Anfang an eingeschworen war und der er bis heute folgt, ist von anderer Art, was ebenfalls dem ersten Gedicht seines neuen Bandes zu entnehmen ist:
Meiner kindheit liehen ihre farben
kohle, gras und himmel
Unter dieser trikolore trat ich an,
ein hungerflüchter, süchtig
nach schönem.
Diese Verse enthalten so bündig wie bedeutungsvoll Kunzes Selbstverständnis und sein poetisches Programm. Sie zeichnen einen Weg nach, der aus der schwarzen Tiefe unter der Erde – Kunze, 1933 geboren, stammt aus einer Bergarbeiterfamilie im Erzgebirge – über die Wahrnehmung der grünen Natur bis in den unausdenkbaren blauen Himmel führt: Herkunft, Ankunft und Zukunft verbinden sich zu den Farben dieser Trikolore, deren revolutionärer Impetus sich ebenso in der Flucht vor dem Hunger wie in der Sehnsucht nach dem Schönen äußert, worunter man sich wohl vor allem das schöne, vollendete Gedicht denken darf.
Eine bloße Wiedergabe der Naturphänomene wird dem Anspruch auf Autonomie nicht gerecht. „Ich füge der Welt ein winziges Stück Welt hinzu“ – so Kunze unter Berufung auf Gadamer (Kunst ist „Zuwachs an Sein“). Bezeichnenderweise ist es die Linde – seinerzeit von Gottfried Benn als Requisit der Spießer verspottet −, der Kunze die Aufgabe auflastet, solche Seinsvermehrung zu leisten:
Wir pflanzten sie
mit eigener hand
Nun legen
den kopf wir in den nacken
und lesen ab an ihr,
was uns, wenn’s hoch kommt,
bleibt an zeit
Als ahne sie’s, füllt sie
den himmel uns mit blüten.
Die Linde, die „große Sommerlinde“ – ein Lebensbaum. Dann aber auch, zusammen mit der Eiche, ein durch den Mythos von Philemon und Baucis geadelter Baum, in dem sich ein gemeinsam alt gewordenes Paar wiedererkennen kann; und schließlich gibt die Linde Gelegenheit, über den seit Eva menscheneigentümlichen Drang nach Erkenntnis zu reflektieren: „Wollten wir das anderssein der welt / begreifen, müßten wir / anders sein.“
Man sieht: Es geht Reiner Kunze immer ums große Ganze, das vom kleinsten Detail abgelesen und auf die kürzeste Formel gebracht werden soll. Dafür bietet sich ihm das Epigramm in seiner ursprünglichen Form als ernste, bedenkenswerte Aufschrift, als Epitaph oder Nachruf an. Der neue Band enthält eine ganze Gruppe solcher Totengedichte: auf Albert Camus und Hermann Lenz, den Bildhauer Heinz Theuerjahr und den Physiologen Ulrich Zwiener, den Freund Graf Alexander von Faber-Castell und den Schriftsteller Warlam Schalamow, dessen Erzählungen über die stalinistischen Lager in Deutschland erst nach seinem Tod gelesen wurden.
Als Nänie könnte man auch die Spottverse auf die „orthographische inquisition“ der Rechtschreibreform bezeichnen. Nur hier, wo in drei Vierzeilern Klage geführt wird über den Tod der alten Rechtschreibung, nutzt Kunze das satirische Potential der epigrammatischen Stachelverse:
Die sprache hat den mund zu halten,
wenn die hohen staatsgewalten
sich für ihren vormund halten
und barbaren sie verwalten.
An den aggressiven Schwung und die argumentative Schärfe seiner Denkschrift Die Aura der Wörter, mit der Kunze seinerzeit in die Diskussion über die Orthographiereform eingriff und die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz attackierte wie kein zweiter deutscher Schriftsteller neben ihm, reichen diese Reimchen allerdings nicht heran. Hier gerät die notwendige Kürze des Epigramms in den Widerspruch zu Kunzes Forderung, die der alten Rechtschreibung innewohnenden Differenzierungsmöglichkeiten der Sprache unbedingt zu erhalten.
Der Lust zur Kürze verdanken sich auch die Mitbringsel von Kunzes Reisen nach Japan und Korea: Der neue Gedichtband enthält eine Reihe von Haikus und einige Sidchos (koreanische Dreizeiler, von denen die beiden ersten Verse aus 14 und die dritte Zeile aus 15 Silben besteht). Ob die Fachleute und Fans dieser Formen mit diesen Eingemeindungen einverstanden sein können, möchte ich bezweifeln. Doch darauf kommt es auch nicht an. Entscheidend ist, dass Kunze mit diesen Experimenten gewissermaßen eine Globalisierungspoetik betreibt: Er erkennt sich selbst und die Welt, frei nach Goethe, in allen Formen wieder und schickt die Welt im Gegenzug zugleich in eine beherzigenswerte „Schule des Haiku“:
Fünf silben demut
sieben silben einsamkeit
fünf silben wehmut.
Wulf Segebrecht, Neue Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.4.2008
Schlichte Schönheit
Reiner Kunze hat sich Zeit gelassen. Sein neuer, schmaler Gedichtband lindennacht ist der erste nach langer Pause. Das Warten hat sich gelohnt. Kunze, der im kommenden April 75 Jahre alt wird, hat ein lyrisches Spätwerk vorgelegt, das schon durch seine Schlichtheit beeindruckt. Es sind 80 Gedichte geworden, die meisten davon aus den vergangenen drei Jahren, alle geradezu minimalistisch. Reiner Kunze setzt auf die kleine Form, trägt nicht dick auf und fasziniert dadurch umso mehr.
Seine Lyrik kommt ohne Reime aus, ohne Punkt und Komma und ohne Großbuchstaben. Selten braucht sie viele Strophen. Im Gegenteil, Kunze zeigt, wie man mit wenig Aufwand dennoch viel sagen kann.
„Harter Januar“ ist ein Musterbeispiel dafür: Das komplette Gedicht besteht nur aus neun Wörtern und benötigt kein einziges Verb. Für die Erkenntnis, dass gerade das Schlichte schön ist, steht Reiner Kunze als Autor schon lange. In lindennacht setzt er das so konsequent um wie noch nie. Oft spiegelt sich darin die Beschäftigung mit japanischer Lyrik und asiatischer Philosophie wieder: „Schule des Haiku“ heißt eines der Gedichte – Reiner Kunze hat dort viel gelernt.
Der Lyrikband ist in fünf nach Themen geordneten Abschnitte gegliedert. In vielen Gedichten erinnert sich der 1933 im sächsischen Erzgebirge geborene Autor an seine Kindheit. „Nach dem Krieg“ beispielsweise erzählt von der Armut dieser Zeit, „Schachttasche“ mit der für den Gedichtband typischen schlichten Schönheit von der Ledertasche des Großvaters, die dieser jeden Tag mit zur Arbeit nahm.
Alter, Sterben und Tod sind ein anderer wichtiger Themenkreis, mit dem Kunze sich intensiver denn je beschäftigt – klug, einfühlsam und unpathetisch.
Andreas Heimann, dpa, 1.10.2007
süchtig nach schönem
… diese treffende Wortwahl trifft man schon am Ende des ersten Gedichtes dieses vorzüglichen Gedichtbandes an. Reiner Kunze, wie immer ein Meister des knappen Wortes, trifft dieses „Schöne“ in Landschaftsbeschreibungen, Bildern aus Finnland und Korea an, aber auch in Gedankenbildern zu geschätzten Kollegen. Manche Texte erinnern in ihrer Verknappung und Konzentration an Haiku und ähnliche fernöstliche Dichtformen.
Bücher
sind stille wesen, man
hört sie nicht
Es wäre zu wünschen, dass diese stille Stimme viel Gehör und noch mehr Leser findet.
Hans-Jürgen Singer „singersoleno“, amazon.de, 27.6.2008
Ein Geschenk in Worten
Die lyrische Sprache Reiner Kunzes ist einzigartig. Ihre inhaltliche Dichte legitimiert das Wort Dichtung, ihre Poesie führt die Gedanken auf weite Ausflüge. Wunderbar versprachlichte Eindrücke, Melancholie und Hoffnung, Assoziation und klares Bekenntnis machen die Gedichte dieses Bandes zu einem Geschenk für Menschen, die Sprache lieben.
Josef Epp „Entäuschter“, amazon.de, 20.4.2008
Ein Humanist
lindennacht ist ein schönes, weil stilles und reifes Alterswerk des 1933 im Erzgebirge geborenen Reiner Kunze, der 1977 die DDR verliess. Der Band enthält fünf Abteilungen mit Lyrik aus den Jahren 2004 bis 2006. Inhaltlich spannt sich der Reigen von menschennaher Naturlyrik (I), über Kunst und Schöpfung (II), Reisen (III), Tod (IV), bis hin zu einem zwei Gedichte umfassenden Nachruf auf die Menschheit (V). – Reiner Kunzes Lyrik ist würdevoll und hier gänzlich frei von Reim und Metrum, sie ist von einer humanistischen Reife geprägt, die mit wenigen, präzis gesetzten Worten ganze Landschaften und Leben heraufzubeschwören vermag. Damit noch nicht genug. Der Autor tritt hier und da in einen weltliterarischen Dialog, setzt Zitate an den Anfang eines Gedichtes und beantwortet diese in seinen folgenden Strophen. Kreuz und quer sind auf diese Art zwischen den Buchdeckeln so berühmte Leute wie Johannes XXIII, Matthias Claudius, Adalbert Stifter, Jean Paul, Hermann Lenz oder Karl Jaspers vertreten. Einer speziellen Erwähnung bedarf auch die Auseinandersetzung mit der koreanischen Lyrik aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die sich im „Reisekapitel“ entfaltet. Ich habe den Band schon seit einiger Zeit zu Hause; er liegt neben dem Sofa auf dem Beistelltisch und ist in der Lage, mich nach wenigen Zeilen Lektüre in fremde Landschaften zu entführen, auf die ich in meiner Seele wieder treffe. Diese Faszination ist dauerhaft.
Andreas Gryphius, amazon.de, 24.12.2007
Ein Buch, das man bewohnen kann
Allen, denen anspruchsvolle Lyrik nahe steht, wird dieses Buch ein Gewinn sein und auf nicht wenigen Seiten ein Genuss. Man möchte es in Reichweite bei sich haben, wie die anderen Bände: Ein Buch, das man bewohnen kann.
Trotzdem, man sieht es dem Meister nach, dieser Band hat Schwächen. Manches wird in Gedichtform gebracht, was in Gedichtform nicht gesagt werden müsste. Manches ist schwer verständlich, weil grammatikalisch verdreht oder zu sehr verknappt, anderes zu lang. Dazwischen einige echte Kunze-Bonbons, für die man dankbar ist:
… In die tiefe sonnenscheibe weht
des nahenden landregens
schwarze mähne
Wir nehmen den weg
ins bild
Angelica Seithe „Brombeerhimmel“, amazon.de, 2.11.2007
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Christian Eger: Unter der Trikolore der Kindheit
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2007
Hans-Dieter Schütt: … um der Scham willen
Neues Deutschland, 1./2.9.2007
Karl Corino: Reiche Ernte, dürftige Zeit
Rheinischer Merkur, 11.10.2007
Jürgen P. Wallmann: Ein Einzelgänger
Am Erker, 2007
Maria Renhard: süchtig nach schönem
Die Furche, 14.2.2008
„im lied jedoch“ – in der globalisierten Welt
– Zu den Korea-Gedichten Reiner Kunzes. –
Der jüngste Lyrikband Reiner Kunzes, lindennacht (2007), enthält zwölf Gedichte, markante lyrische Bilder Koreas, Bilder der Vergangenheit und der Gegenwart. Sie umreißen in asketischer poetischer Sprache Geschichte, Menschen, Kultur und Landschaft, vor allem aber die tiefgehende, geistige Begegnung des Dichters mit der Literatur des Landes.
Diese Gedichte verfolgen verschiedene „Wege“: von der Dichtung des Gastlandes ausgehend über treffend gefasste Straßen- und Landschaftsbilder zu tiefsinnigen Reflexionen.
Die altkoreanische poetische Gattung Sidcho/Sijo wird hier von einem zeitgenössischen deutschen Lyriker in ihrer Entstehungsphase beleuchtet und belebt.
I. Der Zugang über die Poesie
I.I. Das Sijo als Vorlage
Das 시조 Sijo/Sidcho時調 (Zeit-Kontrolle/Harmonie/Melodie) ist eine dreizeilige Gedichtform, die in der Joseon-Dynastie (1392–1910) entstand und in weiten Kreisen – von den Gelehrten bis zum einfachen Volk – praktiziert und gepflegt wurde und sich somit als dominante poetische Gattung etablierte. Die Silben folgen dem Grundschema: 3 4 3 4 / 3 4 3 4 / 3 5 4 3, wobei die erste und zweite Zeile oft leicht variieren, die dritte, insbesondere deren erste Hälfte, hingegen relativ konstant ist: Die Wirkung der letzten Zeile ist vergleichbar jener der zweiten Hälfte der zweiten Zeile eines Distichons oder der Terzette eines Sonetts.
XXX XXXX XXX XXXX
XXX XXXX XXX XXXX
XXX XXXXX XXXX XXX
Diese Form ist zu Anfang der Joseon-Dynastie in einem politisch hochbrisanten Dialog, den jeder Koreaner kennt, in dieser poetischen Gestalt geprägt worden. Der Anlass war die Machtübernahme von 1392, in der die Goryeo-Dynastie (918–1392) durch die Joseon-Dynastie (1392–1910) abgelöst wurde. Es geht um den Dialog, den JUNG Mongju, ein treuer Untertan der Goryeo-Dynastie, und der Sohn des Usurpators, RI Bangwon, kurz vor dem Machtwechsel führten. RI Bangwon lud jenen zur Trinkrunde in einen Lustpavillon ein und stellte eine anscheinend naive, harmlose Frage in Form eines Sijos:
ireondl eoddeohari jeoreondl eoddeohari
mansusan dureongchilgi eolkeojindl eoddeohari
urido igachieolkyeo han baekyeon sarabose
Was macht dies aus, was macht das aus, lass es so.
Auf dem Mansuberg wächst das wilde Geranke zusammen, lass es so.
Auch wir können so zusammen hundert Jahre genießen.
Die Antwort des treuen Untertanen scheint ebenso unpolitisch:
imomi jukgojugeo ilbaekbeon gocheojukeo
baekgori jintodoeo neokirado iskoeopgo
nimhyanghan ilpyeondansimiya gasiljuli isrya
Mein Körper kann sterben und sterben, hundertmal wieder sterben,
Meine weißen Gebeine können zu Staub, zu Lehm zerfallen, mit oder ohne Seele,
Meine Treue dem Geliebten gegenüber würde um keinen Deut verblassen.
Hinter diesem poetisch-politischen Dialog wird sowohl die Einsicht in den Ernst der Lage als auch eine schwere, nun getroffene Entscheidung erkennbar. Nach diesem Gespräch, das höflich und harmonisch verlief, verließ der treue Untertan den Pavillon, ritt nach Hause, saß aber schon rücklings auf dem Pferd, um seinen Mördern nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Und tatsächlich wurde er unterwegs auf einer Brücke (Seonjuk-gyo) erschlagen. Diese Urszene hat rückwirkend die Gedichtform in ihrer Entstehungsphase entscheidend geprägt. Das Sijo wurde fast als einzige Gattung die gesamten fünfhundert Jahre der Joseon-Dynastie hindurch gepflegt.
I.II. Poetische Resonanz auf das Sijo
Dieses historischen Stoffes nimmt Reiner Kunze sich in einem seiner Korea-Gedichte in lindennacht an und gibt ihm – nicht nur inhaltlich, sondern auch formbestimmend – einen eindrucksvollen Umriss:
KOREANISCHE LEGENDE IN ALTEM STIL
dem könig, dem er treue schwor, die treue haltend, schied
der weise vom verschwörer. seines mörders blick er mied
rücklings auf die brücke reitend ins gezückte schwert, ins lied.
XXX XXXXX XXX XXX
XXX XXXX XXXX XXX
XXX XXXXX XXXX XXX
Die poetische Transformation ist schon formal auffällig gelungen: In einer ebenso komprimierten Form wie im Original wird der Inhalt zuerst silbenanzahlgetreu (14, 14, 15) wiedergegeben, wobei die leicht variierende letzte Zeile dem Originalschema entsprechend eine formal kleine, jedoch inhaltlich gravierende Erweiterung zeigt. Sogar die Binneneinheiten innerhalb einer Zeile sind – in der ersten Zeile durch ein Komma und in der zweiten Zeile durch einen Punkt – realisiert. Die formale Parallelität, die die erste und zweite Zeile im Originalschema prägt (3 4 3 4 / 3 4 3 4), findet ihre Entsprechung in den variierenden und sich steigernden Wiederholungen – in der ersten Zeile mit „treue schwor“ und „treue haltend“, in der zweiten Zeile „(der weise vom) verschwörer“ und „seines mörders (blick er mied)“. Sie unterstreichen die Bedeutung des Inhalts.
Noch kunstvoller als im Original ist außerdem der Endreim verwirklicht. Auf die drei einsilbigen Reimwörter, die die drei Verse als eine Einheit verbinden und zugleich inhaltlich ein Steigerungsmoment enthalten, konzentriert sich das Gewicht des ganzen Textes: „schied“ – „mied“ – „lied“. Durch den – im Originalschema nicht notwendigen – Endreim hervorgehoben, wird hier, in diesen drei Zeilen, nicht nur eine Geschichte in poetischer Form und mit persönlicher Prägung vermittelt, sondern auch die Transformation einer Geschichte in die Poesie vorgeführt: Der Ritt eines Treuen „ins gezückte schwert“ stellt hier zugleich den Ritt „ins lied“ dar. Dadurch werden im Gedicht die nachhaltigen Auswirkungen jenes politisch aufrechten Gangs, aber auch die Poetisierung an sich und deren Prozess, anschaulich gemacht. In dieser Hinsicht realisiert Reiner Kunze in seinem Gedicht das, was die beiden Gedichte heute, in der Rückschau bedeuten; JUNG und RI selbst konnten sich der formgebenden Wirkung ihrer Gedichte noch nicht bewusst sein. Hier liegt demnach eine entscheidende Weiterentwicklung vor: keineswegs also ein antikisierendes, nachahmendes Experiment, sondern eine beachtenswerte Innovation.
Was dieses eine kurze Gedicht – über sechshundert Jahre hinweg – ans andere Ende der Welt transferiert, ist ein wertvolles Kulturgut. In dem Gedichtband lindennacht finden sich elf weitere Gedichte, die diesen Themenkreis berühren. Jedes ist eine hohe poetische Leistung, die auf eine andere Möglichkeit des Zugangs zur Fremde hinweist: Jenseits alles möglichen Interesses – des missionarischen, kolonialen, globalisiert kapitalistischen, touristischen – spricht hieraus echte Anteilnahme an Menschen und Literatur.
Wie kam es dazu? Eine so kunstvolle poetische Errungenschaft verdankt sich nicht bloß dem Zufall.
II. Wege
II. I. Eine Reise ins Land der Dichter
Der Ausgangspunkt ist die Poesie; seine Reise bereitet der Dichter durch die Lektüre des alten poetischen Schatzes dieses Landes vor. Das Ergebnis zeigt sich im dritten Teil des Bandes lindennacht, der unter anderem die Korea-Gedichte enthält und meist aus Gedichten besteht, die sich der Fremde widmen. „Reisegedichte“ ist aber vielleicht nicht die treffende Bezeichnung. Sehr deutlich weichen sie von Reisegedichten im üblichen Sinne ab. Hier geht es um eine intensive poetische Begegnung und eigene poetische Reflexionen mit der und über die Fremde. Kunze stellt in seinem Gedichtband etwa einen fremden Dichter wie Fuad Rifka vor, in dem gleichnamigen Gedicht „Fuad Rifka“:
[…] Was wäre er, sagte er,
ohne Deutschland,
und meinte
Hölderlin, Novalis, Rilke
Den belächlern verschlug es
das lächeln
[…]
Wie Deutschland für Fuad Rifka „Hölderlin, Novalis, Rilke“ war, so eröffnen Verse dieses libanesischen Dichters dem deutschen Lyriker Reiner Kunze „das arabische schriftmeer“:
FUAD RIFKA
[…]
Beim anblick seiner verse –
verzaubert vom horizont, über den sie kommen –
sagen wir:
aaaaaaaa… auf dem trümmerfeld der erde
noch immer ein gedicht,
das das auge überrascht,
ein abendstern
Verse dienen als Schlüssel für die Welt hinter dem Horizont. Auch dem fernen Land Korea begegnet der Dichter durch die Dichtung. Anhand weniger Übersetzungen und ohne Vorkenntnisse liest der Dichter den Kern der Sache heraus und begegnet eigenständig einer völlig fremden Dichtungsgattung wie etwa dem Sijo. Der erste Versuch, „echo-sidcho“, ist ein poetischer Dialog, seine Antwort auf einen berühmten Vers Yulgoks:
Gern hätt ich in dieser grünen Welt
einen Krug voll Wein in den Wald gestellt –
ob sich ein Freund zu mir gesellt?
ECHO-SIDCHO
[…]
Nicht des weines wegen
im krug, nicht des kruges wegen
im wald, nicht des waldes wegen
im gedicht
aaaaaaaazög es mich
in dieses land mit bergen
wie aufs bild gespannt.
Ich wäre gern jener
in des dichters welt,
der wegen des gedichtes sich
zu ihm gesellt.
Die einladende „grüne Welt“ im alten Gedicht wird mit „des dichters welt“ gleichgesetzt, und das Entgegenkommen ist bereits im Reim realisiert. Von der Macht eines alten Verses wird der Dichter angezogen und entdeckt Huang Jini, die als Verfasserin der besten Sijos aller Zeiten gilt. So betritt der Dichter das Land des Sijos.
II. II. Seouler Straßen: Das Korea von gestern und heute
Während des kurzen Aufenthaltes im Gastland fiel Kunze zuerst die Dachkurve der altkoreanischen Architektur auf: die koreanische Kurve. An einem Zug von Fabelwesen, der sich entlang der Winkelfirsten des Dachs reiht, blieb sein Blick hängen. Die dargestellten Figuren – eine kleine Gruppe verschiedener Tiere mit einem buddhistischen Mönch an der Spitze – befinden sich auf der Pilgerfahrt nach Indien, um die buddhistischen heiligen Schriften zu holen:
SEOUL, KÖNIGSPALAST
Auf den dächern, unterwegs zu den Heiligen schriften,
mönch,
aaaaaaffe,
aaaaaaaadrache,
aaaaaaaaaaaaaaschwein
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaund fabelwesen
Im gänsemarsch entlang den winkelfirsten
in die vier richtungen der welt
Alle wege führen zu Buddha
Die dachtraufenbögen
scheinen geschnitten
nach seinem lächeln
Diese Gruppe der wenngleich lustigen, witzigen Tiere, aber zugleich der Suchenden im Lichtkreis Buddhas, beeindruckten den Dichter. In seinen Augen scheint sie sich „in die vier richtungen der welt“ fortzusetzen, selbst die Dachtraufenbögen „nach seinem lächeln“, nach dem Lächeln Buddhas, „geschnitten“ zu sein.
In der Tat realisieren die Architekten die koreanische Kurve, diese leicht gebogene Linie, indem sie den Maßfaden nicht horizontal spannen, sondern ein wenig lockern. Diese Kurve bestimmt vor allem die Dachtraufenbögen; aber auch viele andere Dinge basierten und basieren auf dieser Form; die Linie in der traditionellen koreanischen Kleidung ist ein typisches Beispiel dafür. Die Konstellation der Wörter im Druckbild, die dieser Linie folgt – an sich keine neue bildliche Komponente –, gewinnt hier dank der Aufmerksamkeit für diese wesentliche Linie und dank des prägnanten Diktums – „geschnitten / nach seinem [Buddhas] lächeln“ – eine neue Frische. Buddhas Lächeln steht wohl im Zusammenhang mit einer Ehrfurcht ohne Spannung, einer friedlichen Religion, von deren Gnade man alle Lebewesen gleichermaßen erfüllt wünscht. Eine solche Vorstellung vom Buddhismus scheint dem Dichter vorzuschweben.
Mit dem Zug der Fabelwesen auf dem Dach des alten Palastes von einst überlagert sich das Bild der Seouler Bürger „auf dem Weg“. Der Blick des Dichters hat dabei eine Schärfe, die den Kern der Sache trifft:
SEOULER STRASSENBILD
Alle menschen, schien’s, sind
auf dem weg, sind
aaaaaaaaaaaaaaajung und
auf dem weg, sind
aaaaaaaaaaaaaaaschlank und
auf dem weg
Das handy am ohr, schienen sie einander zu beteuern,
daß der eine für den andern wie geschaffen ist,
doch auf dem weg
in die entgegengesetzte richtung
Auf diese Weise fallen die Bürger eines IT-Landes, des heute hochindustrialisierten Korea, dem Dichter auf: jeder in seiner Hektik, in seiner Isoliertheit, doch ständig mit dem „handy am ohr“, als wäre es damit verbunden. So verraten sie alle doch irgendwie die Einsamkeit der Großstädter, trotz des emsigen Kommunizierens, trotz des Scheins, untrennbar miteinander verbunden zu sein. Dies ist das Bildnis der Koreaner, wie sie im Auge des Dichters gespiegelt sind: ein sehr treffendes Bild. Mit dieser Wendung „auf dem weg“ werden zwei Ansichten der Koreaner wie Koreas, von gestern und heute, prägnant gefasst.
Der scharfe Blick auf die Haltlosigkeit der Einwohner der Zwölfmillionenstadt wird anschließend auf den Schein ihrer (leicht suspekten) Gläubigkeit gelenkt – vielmehr: zu ihrer geistigen Obdachlosigkeit:
MISSION IN SEOUL
Über den nächtlichen hochhausblöcken
christuskreuze, neonlichtumrandet
in rot, gelb, weiß, ein Disney-
himmel, geöffnet
rund um die uhr
Der Blick des Dichters hat jedoch Milde und Humor. Die Nachtlandschaft der Megastadt Seoul überrascht den Fremden oftmals wegen der unzähligen, nachts rot leuchtenden Kreuze der vielen Kirchen, deren Anzahl dank der sehr aktiven, fast aggressiven christlichen Missionierung seit wenigen Jahrzehnten geradezu explodiert; manche Besucher erinnert der Anblick der vielen Kreuze an ein Massengrab. Darüber scheint auch der Dichter erschrocken zu sein. Seine Beobachtung ist aber weder zynisch noch analytisch, noch von sezierendem journalistischen Interesse.
Eher mit unterdrückter, liebevoller Sorge wird die bei allem Anschein der Gläubigkeit hindurchschimmernde geistige Leere hervorgehoben. Ein deutlicher Anflug von Humor veranlasst den Leser, sich das Lächeln des Dichters zu vergegenwärtigen. Man erinnert sich an die Dachkurve der traditionellen Architektur, die nach dem Lächeln Buddhas „geschnitten“ worden sein soll.
Beide Gesichter Koreas, der Vergangenheit und der Gegenwart, lassen sich beim Anblick der Menge der Lesenden an einem Feiertag in einer großen Buchhandlung vereinigen („megametropolenbuchhandlung“). Die in sich vertieft Lesen – „Seiende / im fernen kosmos ihrer sprache“ – kommen dem Dichter vor, als wären sie auf dem Weg, nun nicht in gegensätzliche Richtungen auseinanderstrebend, sondern unterwegs in die vier Richtungen des Weltalls wie die Pilgerfahrer auf dem Dach.
II. III. Die Landstraße: Eine Reise „ins Bild“
Dann ist der Dichter selber auf dem Weg. Nach „dort hinten“, wohin es ihn schon vor der Reise zog, in eine Landschaft, deren Land und Berge Yulgok ein Bild nannte, da „überm flachen Land / die Berge wie auf ein Bild gespannt“ sind. Der Dichter reist in die Berglandschaft, wie sie in Yulgoks Sijo beschrieben ist. Es ist eine „fahrt mit altem meister“, ein stiller Eintritt in die Landschaft, die wie eine in einem alten Gemälde aussieht, und es ist zugleich eine Fahrt, die in Begleitung des alten Meisters Yulgok unternommen wird:
FAHRT MIT ALTEM MEISTER
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaFür Chon Tae-Hong
Im abendschatten
reisfeld an reisfeld, winzige
gelbe gevierte, matten
der mühsal
Dahinter, hingetuscht,
die gipfelzüge urwaldgrüner berge, abgetönt
mit nacht, mit durchsichtiger
blauer ferne
In die tiefe sonnenscheibe weht
des nahenden landregens
schwarze mähne
Wir nehmen den weg
ins bild
Den Mittelpunkt der malerischen Landschaft bilden Reisfelder, Grundlage der Ernährung, die in einem sehr bergigen Land bescheiden ist. Diese kleinen Ackerfelder werden mit Ehrfurcht betrachtet: Sie sind zwar „winzig“, aber „matten / der mühsal“. Somit lässt sich dem unauffälligen Wort „gevierte“ die Heidegger’sche Konnotation hinzufügen. Die Bedeutung der kleinen Reisfelder, der Lebensbasis, wird mitten in einer malerischen Landschaft hervorgehoben – als Ort des Zusammentreffens von Himmel und Erde, Göttern und Menschen. Die Mühen der Bauern und der Sinn dieser Qual bleiben dem Dichter präsent. Er hat ein Gespür für die Realitäten des Landes, wie „bitteres sidcho für ein geteiltes land“ erweist. Dieses Gedicht thematisiert nicht die aktuelle politische Teilung des Landes, sondern die Klassenunterschiede, die es seit jeher gegeben hat:
BITTERES SIDCHO FÜR EIN GETEILTES LAND
Wie gern doch möchte ich verlegen
den Pavillon: Wird dann geackert
ganz nahe an des Königs Wegen,
so sieht er, wie das Volk sich rackert.
O Sun, 14. Jahrh., Korea
Mag auch der pavillon am acker stehn,
wer nicht sehen will, wird kein geracker sehn.
Des königs hofstaat wird bezeugen,
daß sich die bauern nur verbeugen.
Wer weiß das besser als das land,
in dem der pavillon einst stand.
Die Mühsal des Volkes bleibt weiterhin im Blickfeld. (Die Naivität des Untertanen aus früherer Zeit, der, um eine Verbesserung seiner Situation zu erreichen, das Mitleid des allmächtigen Regenten zu wecken hoffte, wird nicht aufgegriffen.) Die Aufmerksamkeit des Dichters richtet sich auf das Land selbst, um es im Zusammenhang mit seiner eigenen Geschichte zu sehen: „Wer weiß das besser als das land, / in dem der pavillon einst stand.“ (Der Dichter ist ein ehemaliger Bürger der DDR, die er nach harten Repressalien verlassen musste.) Solidarische Sensibilität für die Leidensgeschichte schärft den Blick und erlaubt eine tiefgehende Innensicht.
Auf diese Weise die Landschaft erfahrend und durchquerend, erreicht der Dichter das O-juk Heon (wörtlich: Haus des schwarzen Bambus), das Geburtshaus des „alten Meisters“ Yulgok. Von diesem ist aber keine Rede mehr. Der Blick richtet sich auf den Wald von schwarzem Bambus, der das Haus umgibt. Diese seltene Bambus-Art soll ungefähr so alt werden wie ein Mensch, und ihre schwarzen Halme werden mit der Zeit grau wie die Haare der Menschen im Alter (siehe das Gedicht „schwarzer bambus“). Diese Pflanze fesselt den Blick des Dichters, womöglich deswegen, weil seine Gedanken oft beim Leben und Willen des Menschen weilen. Die Reflexionen über das Leben beziehen jenen oben genannten Tod auf der Brücke Seonjuk-gyo mit ein, das zutiefst beeindruckende Ende eines aufrechten Gangs („koreanische legende in altem stil“), und wenden sich anschließend dem Weg ohne Wiederkehr zu, weisen dann aber auch „ins lied“. So kommt in dem neuen Lied zutage, was bisher in einem fernen Land halb legendär im Lied lag („im lied jedoch“).
III. Wege „ins Lied“
IM LIED JEDOCH
[…]
Verborgen vor der eigenen erinnerung
die abgelegnen plätze im gebirge, wohin
in früher zeit
aaaaaaaaaasöhne auf dem rücken
die alte mutter, den gebeugten vater trugen
Auf nimmerwiederkehr, zu kostbar war
die schale reis, luden sie von ihrem dasein ab
die last, luden auf
der erde sie,
dem himmel
Im lied jedoch, das von der mutterliebe singt,
pflückt die mutter, während sich der sohn den pfad
durchs gerank der wildnis bahnt,
im vorbeigetragenwerden
azaleenblüten, die sie
fallen läßt,
aaaaaaaadamit der sohn den weg nach haus
nicht verfehle
Im lied jedoch, das von der sohnesliebe singt,
verbirgt der sohn die mutter
vor der brüder schuldbewußtem blick, füllt heimlich
becher ihr und schale
Tausend jahre blickt das lied zurück
Tausend jahre blickt das lied voraus
Der Weg führt zu einem Bestattungsort. Es geht um einen legendären Brauch des fröhlichen, das Singen und Tanzen liebenden Volkes der Goryeo- Dynastie (918–1392), um die sogenannte Goryeo-Bestattung: Uralte Menschen, jenseits eines bestimmten Alters, sollen von einem ihrer Kinder zu einem Ort tief im Gebirge getragen und dort einfach ausgesetzt worden sein. Eine solche Praxis liegt natürlich in bitterer Armut begründet. Historiker negieren bei uns immer noch die Existenz dieses Rituals, doch Gerüchte bleiben. Der Brauch verstößt gegen das ethische Empfinden der Menschen.
Dieser höchst befremdende, exotische Brauch wird hier im Zusammenhang mit zwei ihm verbundenen Legenden in knapper, poetischer Sprache vermittelt und kurz kommentiert. Im Mittelpunkt der ersten Legende steht die Mutterliebe, mit der sich eine alte Mutter, auf dem Weg zu jenem Ort, auf rührende Weise um ihren Sohn und seinen sicheren Heimweg gekümmert haben soll. Während sie auf dem Rücken des Sohnes getragen wird, pflückt sie Azaleenblüten, um diese als Markierung des Heimwegs für ihren Sohn fallen zu lassen. Normalerweise nimmt der Gehende eine solche Markierung des Wegs selber vor, hier wird sie als einmalige liebevolle Hilfestellung einer extrem Hilflosen für einen gut Orientierten geleistet. Die Azalee, ein zartes Zeichen für das allgegenwärtige, belebende Schöne, steht im Original der Legende als Symbol für die letztmögliche Liebe eines Menschen; menschliche Konflikte werden darin zu einem poetischen Bild sublimiert.
Die zweite Legende handelt von der Liebe eines Lieblingssohnes zu seiner Mutter, wegen der er sie nicht ins Gebirge tragen konnte und sie stattdessen in einem Hinterzimmer, vor aller Augen verborgen, heimlich gepflegt haben soll. In der zweiten Legende ist ein moralischer Aspekt besonders evident: die Bemühung, eine fragwürdige Tradition in den Rahmen eines späteren Moralkodex zu integrieren. Der Mythos organisiert – nach Lévi-Strauss – gesellschaftliche Aporien. Die zwei Legenden werden in unserem Gedicht „im lied jedoch“ in nuce rekonstruiert, mit poetisch pointierten Hervorhebungen. Der allgemeinen Beschreibung des Vorgangs – „luden sie von ihrem dasein ab / die last, luden auf / der erde sie / dem himmel“ – folgt die Fokussierung – wie in einer Nahaufnahme – auf die Blume der ersten Legende:
azaleenblüten, die sie
fallen läßt,
aaaaaaaadamit der sohn den weg nach haus
nicht verfehle
Der Zeilensprung bereitet den Leser – eine kurze Denkpause ist gegönnt – auf den erstaunlichen Verlauf der Begebenheit vor, kommentarlos.
Im Bezug auf die zweite Legende wird der Konflikt zwischen gesellschaftlicher Norm und Liebe veranschaulicht – ebenso kommentarlos, hier noch nüchterner: „verbirgt der sohn die mutter / vor der brüder schuldbewußtem blick, füllt heimlich / becher ihr und schale.“ In einer Reihe von Wörtern – „verbergen“, „schuldbewußtem Blick“, „heimlich“ – wird der Konflikt aussagekräftig vermittelt. Auch hier vergegenwärtigen konkrete Dinge – Becher und Schale – die Szene, wie der Faden, der Mutter und Sohn, die angeblich Tote und den Lebenden, verbindet. Was höchst lakonisch in den beiden Legenden umrissen wurde, löst sich am Ende des Gedichts auf:
Tausend jahre blickt das lied zurück
Tausend jahre blickt das lied voraus
Die nun erst evozierte Moral folgt wie zwei Hammerschläge. Diese abschließenden Doppelzeilen bieten dem Leser, wie ein Doppelpunkt, ein offenes, weites Feld für Reflexionen an. Man denkt an die aktuellen, aber auch an eventuelle, zukünftige Probleme, die auftreten könnten, wenn nicht nur die allgemeine Entfremdung bis zur Auflösung der Familie zugespitzt würde, sondern auch der herrschende rücksichtslose Ressourcenverbrauch irgendwann zu absolutem Nahrungsmangel führen könnte. Es geht nicht bloß um die Vermittlung eines alten exotischen Brauchtums. Anhand einer uralten, fast legendären Bestattungsform wird ein aktuelles Problem von globalem Ausmaß angedeutet.
Wegen der stofflichen Nähe lässt sich hier zum Vergleich das Beispiel eines frühen Weltbürgers anschließen: Die geographische Öffnung seines Blickfeldes führte zu einer neuen poetischen Errungenschaft. Johann Wolfgang von Goethe nahm ein hochgradiges Exotikum, den indischen Brauch der Brandbestattung und der Witwenverbrennung, der eben zu der Zeit in Europa bekannt wurde und die christliche Welt Europas schockierte, auf und gestaltete 1797 – im sogenannten „Balladenjahr“ – ein Paradebeispiel der klassischen Ballade: „Der Gott und die Bajadere.“ Klassisch ist nicht nur die Idee, mit der Goethe sich das Fremde zur harmonischen Steigerung aneignet, sondern auch die Virtuosität der sprachlichen Textur der Ballade. Eine höchst kunstvolle Darstellung der indischen Mythologie und Sitten ist letztendlich in die christliche Idee eingebettet: „Es singen die Priester.
aaaaaaaaaa[…]
aaaaaaaaaaSpringt sie in den heißen Tod.
aaaaaaaaaaDoch der Götterjüngling hebet
aaaaaaaaaaAus der Flamme sich empor,
aaaaaaaaaaUnd in seinen Armen schwebet
aaaaaaaaaaDie Geliebte mit hervor.
Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder;
Unsterbliche heben verlorene Kinder
Mit feurigen Armen zum Himmel empor.
[…] (V. 92–99)
Im Bild des indischen Brauchs der Witwenverbrennung spiegelt sich unverkennbar das der christlichen Himmelfahrt. Derart im Rahmen des christlichen Rettungsprojekts eingebettet, ist das Fremde zwar aktiv angenommen worden, bleibt aber fremd, wie Perlen oder Flitter auf Samt und Seide. Ebenso exotisch wirkt auch der entscheidende Moment innerhalb des Rettungsprojekts: die Verwandlung der indischen Tempeldienerin bzw. Prostituierten durch die Liebe und Gottes Prüfung.
aaaaaaaaaa[…]
aaaaaaaaaaUnd er küsst die bunten Wangen,
aaaaaaaaaaUnd sie fühlt der Liebe Qual,
aaaaaaaaaaUnd das Mädchen steht gefangen,
aaaaaUnd sie weint zum ersten Mal;
aaaaaSinkt zu seinen Füßen nieder,
aaaaaNicht um Wollust noch Gewinst,
aaaaaAch, und die gelenken Glieder,
Sie versagen allen Dienst.
Und so zu des Lagers vergnüglicher Feier
Bereiten den dunklen behaglichen Schleier
Die nächtlichen Stunden das schöne Gespinst.
Spät entschlummert unter Scherzen,
Früh erwacht nach kurzer Rast,
Findet sie an ihrem Herzen
Tot den vielgeliebten Gast.
[…] (V. 45–59)
Das Fremde aufzunehmen, aber fremd zu lassen, dies scheint das Ansinnen des ersten „Weltbürgers“ gewesen zu sein. Somit wirkt die Ballade im Ganzen wie eine bewundernswerte exotische Kostbarkeit, die einem anvertraut wird. Sie hat als mächtige Bahnbrecherin gedient. (Man denke beispielsweise an Goethes Orientalistik im West-östlichen Divan.)
In dem schlichten Gedicht Kunzes bleibt ein solches Exotikum bei sich. Das Fremde wird nicht gewaltsam angeeignet. Dennoch ist es dem Dichter möglich, einen umfassenden aktuellen Schluss zu ziehen. Zwischen beiden Gedichten liegen zweihundertzehn Jahre reger Weltkontakte: Expeditionen, Imperialismus, Kriege, Globalisierung usw. Einen regen Austausch der Literaten und Literaturvermittler, um die Zeit der Weltliteratur zu fördern und zu „beschleunigen“, hat es nicht minder gegeben. Neben der Schnellstraße, die die Weltwirtschaft um den Globus legt und die somit auch Kultur und Geist – manchmal alle Differenzen nivellierend – befahren, gilt es doch einen solchen Holzsammlerpfad zu legen.
IV. Das Umfeld der Wege „ins Lied“
Im Gedichtband lindennacht wird der eigene lakonische Stil des Lyrikers in sehr sublimer Weise fortgeführt. Auch die eigene Sensibilität bleibt. Im Ganzen glänzt die Altersweisheit, einschließlich der Distanz, wie man sie erst spät im Leben gewinnt. In den ersten Gedichten wird an die Kindheit in der Nachkriegszeit erinnert, in den weiteren über das Leben und die Zeit reflektiert.
Wie an die Armut jener Zeit ohne jegliche Wertung – weder mit Selbstmitleid noch mit Ressentiment noch mit der Ambition eines Historikers – erinnert wird, dominiert in den Reflexionen über das Alter, sogar über den Tod, die Ruhe. Die mutmaßlich noch verbleibende Zeit wird aber nicht als ein drückendes Moment angesehen, sondern, schön und distanziert, an einer selber gepflanzten, nun hochgewachsenen Linde gemessen:
DIE LINDE
Wir pflanzten sie
mit eigener hand
Nun legen
den kopf wir in den nacken
und lesen ab an ihr,
was uns, wenn’s hoch kommt,
bleibt an zeit
Als ahne sie’s, füllt sie
den himmel uns mit blüten
Ein selbstgepflanzter Baum dient dem Dichter nun, als wäre er eine „Weltesche“, als Halt, als Obdach. Stumm gibt der Baum dem fragenden Dichter mit seiner Blüte, die den Himmel füllt, eine Antwort: Die zu lebende Zeit ist ausschließlich schön und kostbar.
Die Liebe zu allen Lebewesen, besonders den kleinen, bleibt unverändert: Eine unscheinbare Alpenrose mit rostfarbigen Blättern etwa, zieht wie eine Silberdistel im Schatten den Blick des Dichters auf sich:
ROSTBLÄTTRIGE ALPENROSE
Was blühen muß, blüht
in geröll auch und gestein
und abseits jedes blickes
„Was blühen muß, blüht“. – Der Einblick in dieses Grundgesetz der Natur setzt aber Liebe voraus.
Auch die beeindruckende eheliche Liebe findet hier und dort ihren sublimierten Ausdruck – sowohl explizit als auch impliziert, wie etwa in dem Gedicht „noch immer“:
[…]
Noch immer ist’s
der horizont der jugendlichen hüfte
Noch immer ist
das zarteste
das zarteste
Des spiegels unerbittlichkeit
vermag uns nicht zu täuschen
Wir wissen mehr
als er.
Mit starkem Zeitbewusstsein –
Wir wollen, wenn die stunde
naht, mit ihr
nicht hadern
Möglich, daß irgendwann
beim anblick eines leeren schuhs
das universum
über uns zusammenstürzt
–, wird in der Liebe der letzte Halt gesehen:
Dann laß uns denken an den fuß,
zu dem der schuh gehörte,
und an das zehenspiel,
das ungezählte male, als wir
beieinanderlagen,
aaaaaaaaaaaaaadas universum
zurückkatapultierte
an seinen platz
In diesem Gedicht „tapferer vorsatz“ stemmt sich das Ich noch gegen einen möglichen Zusammensturz des „Universums“ – in der Liebe und in gemeinsamen Reflexionen. Und das oftmals zitierte „Wir“ im Reflektieren voller Altersweisheit gibt sich des öfteren als ein harmonisches altes Paar zu erkennen, das alle Spaziergänge Hand in Hand unternommen hat und auch den letzten Weg auf diese Weise gehen wird. So ist lindennacht ein Lyrikband voller poetischer Zeugnisse einer dauerhaften Liebe, wie sie beispielsweise in dem Gedicht „variation über das thema ,Philemon und Baucis‘“ zum Ausdruck kommt:
Tröstlich wär’s, jahrhunderte noch
einander mit den zweigen
berühren zu dürfen
[…]
Zu der Altersweisheit gehört auch der Humor, den der Leser mit Lächeln verfolgt:
Mit grellem schrei
und einem flügeltrommelschlag
eröffnet der fasan
den tag
Dann knarrt er vor sich hin
bis 6 uhr 3
und läßt mich wissen,
daß er mich nicht mag.
(„sommers täglich 5 uhr 30“)
Der Humor ist nie einfach, wie sich in „unwirklicher maitag“ zeigt:
So sehr blühten die kirsch- und mostbirnbäume
daß sie sich verwandelten
in weißes gewölk
Das dorf, eingeblüht,
schwebte davon
Mit unserem weißen haar
täuschten wir vor dazuzugehören
und wurden schwerelos
Die erschütternd schöne Frühlingsblüte ist hier weder für eine jugendliche Begeisterung noch für eine traurig gestimmte Alterserinnerung da. Die Freude an ihr ist an und für sich, der Mensch begegnet dem Alter mit Humor: „Mit unserem weißen haar / täuschten wir vor dazuzugehören.“ Es ist eine Steigerung der Existenz zur Schwerelosigkeit.
So erscheint der letzte Teil des Bandes, in dem Reflexionen über den Tod dominieren, dem Leser nicht düster. Selbst wo der Tod thematisiert wird, geht es im Grunde um das Leben. Hier stellt der Tod das Ende derjenigen dar, die manchmal mit ihrer Selbstlosigkeit in der Kunst, meist aber mit ihrer aufrechten Lebenshaltung unter widerstrebenden Bedingungen das Leben verteidigt haben. Lebenswege mannigfaltiger Art scheinen in Form der Poesie, im Lied also, geprüft worden zu sein.
*
In diesem Kontext betrachtet, zeugen Kunzes Korea-Gedichte, eine kleine „exotische“ Gruppe, von dem übergreifenden Thema des Bandes. Dem Leser wird ein fernes, fremdes Land mit seiner langen Geschichte und Kultur, aber auch mit seiner modernen Dynamik und Problematik – in wenigen Strichen höchst deutlich umrissen – nahegebracht. Ein hochachtenswerter Beweis für die Möglichkeiten und den Verdienst der Poesie heute. „Was bleibt aber, stiften“ immer noch sehr wahrscheinlich „die Dichter“.
Young-Ae Chon, Neue Rundschau, Heft 3, 2009
„Hier dürfen Sie schweigen“
In meinem zwölften Lebensjahr starb der größte Mensch aller Zeiten.
Exzellenter Philosoph, genialer Staatsmann, hohe Koryphäe der Wissenschaft, Schöpfer der Großbauten des Kommunismus, streng, doch allgütig, allwissend und nahezu allmächtig, stand er dem Kind in der weißen Generalissimus-Uniform vor Augen, in der er sich so gern fotografieren und malen ließ. Heilsbringer und Götter werden zur Zeit der Wintersonnenwende geboren: Am 21. Dezember feierten alle befreiten Lande den Geburtstag des ruhmreichen Feldherrn. Nach dem fünften März 1953 wurde meine Schulklasse in die Aula geführt. Stalin stünde uns viel zu nahe, als daß wir aus unserer Ameisenperspektive seine volle Größe erkennen könnten, hieß es in der Fest- und Gedenkstunde. Ich fühlte, daß etwas Bedeutendes geschehen sei, doch ich begriff die hysterische Trauer nicht, die sich in Wort-Tränen über den halben Erdball ergoß. Daß Stalins Herz nicht mehr schlug, rührte nicht an sein Wesen. Er war ja unsterblich. Wer konnte zweifeln, daß wir fortan am 21. Dezember den Tag seiner Wiedergeburt begehen würden:
Dein Name ist im Weltall eingetragen
wie der Gestirne Schein und Widerschein,
dichtete der gewaltige Staatspoet und Kulturminisier Johannes R. Becher.
Der tiefsinnige Denker Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili hatte im Kratkij kurs die berühmte Abhandlung „über dialektischen und historischen Materialismus“ verfaßt, die einer Generation von Sowjetmenschen zelebriert wurde. Darauf spielt Reiner Kunzes Gedicht „Kurzer Lehrgang“ an:
Dialektik
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt
werden wir euch
schulen…
Treffender konnten die dialektischen Grundgesetze, die uns sieben mal siebzigmal eingehämmert wurden, nicht gedeutet und verdichtet werden. „Einheit und Kampf der Gegensätze“ trieben ihr ewiges von unendlichen Schulungen gefördertes Wechselspiel in Kunzes Versen. Der erbitterte Streit zwischen Unwissenheit und Erkenntnis endete in deren umfassender Versöhnung, jedoch nicht für immer, denn die Bewegung, eine fundamentale Eigenschaft der Materie und des von ihr erzeugten Denkens, formte die wissend Unwissenden in keineswegs kurzen Lehrgängen zu unwissend Wissenden. Auch beschrieb Kunze den Umschlag einer gehäuften Quantität von Wissen in eine neue Qualität: die Unwissenheit, ja selbst die Negation der Negation wurde sichtbar: die Unkenntnis erreichte durch eine zweifache Verneinung über eine angestrengte Wissensvermittlung eine höhere Stufe der Unwissenheit. Ein solcher Prozeß vollzog sich in räumlichen Spiralen, und zweifellos hatte die Unwissenheit über den Marxismus-Leninismus, als die DDR dahinging, ihren höchsten Stand erreicht. Zu diesem Zeitpunkt aber gehörte Reiner Kunze schon längst nicht mehr zu den Geschulten.
Sein mir durch staatsöffentliche Mißbilligung vertrauter Name gewann einen besonderen Klang im Mund Peter Huchels. Der in Wilhelmshorst Geächtete sah mit Freude, wie einer aus der quasi-intellektuellen Phalanx der Gläubigen, Halbgläubigen und zerknirschten Zweifler ausbrach. So kam ich zu Reiner Kunze. Die Kämme von Thüringer Wald und Thüringischem Schiefergebirge auf gewundenen Wegen überquerend, fuhr ich mehrmals mit dem Motorrad nach Greiz und wurde zu einer Tasse Jasmintee geladen. Nachdenklich, hell, beflügelnd: ich genoß sein Aroma, das sich aus der Oberfläche emporkräuselte und so flüchtig war wie der erfüllte Augenblick. So trank ich zugleich den Tee und das mir liebste Kunze-Gedicht, erfahrend, daß er seine Verse nicht nur schreibt, sondern auch lebt, ja, daß er nichts schreiben kann, was er nicht lebt.
EINLADUNG ZU EINER TASSE JASMINTEE
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Wir schwiegen nicht. Wenn zwei sich nicht in die Enge des Staatskanons einfesseln ließen, hatten sie viel miteinander zu reden. Bestärkt ummaßen sie die Ackerhufen einer gemeinsamen Gegnerschaft, auch wenn ihre ästhetischen Gedanken nicht immer in die gleiche Richtung wiesen. Damals galt mir die Imagination als höchste, als intensivste Form von Wirklichkeit, während Kunze auf der dinglichen Realität seiner Herkunft, seines Lebens, seiner Gegenwart bestand.
Ein paar Jahre vergingen. Die brudervölkischen Heere zogen 1968 nach Prag, den Sozialismus zu retten. Kunze sah ihn als unrettbar verloren an und verließ die Partei: niemals hat er sich zweifelnd oder gar reumütig dorthin zurückgewendet: Daß die Abgefallenen die reifsten seien, hat er uns gelehrt. Sein Ruhm wuchs. Nach der Zeit der Verfemung begann ein leichtes, von frostharten Nächten begleitetes Tauwetter. Der Brief mit blauem Siegel erschien im Leipziger Reclam-Verlag in einer sehr hohen, doch viel zu geringen Auflage. Der Name Kunze war in aller Munde. Er hatte zur rechten Stunde das Rechte gesagt. Er sprach aus, worauf so viele, ohne es benennen zu können, gewartet hatten. Ihm gelang es, etwas auf das Wort und zu Wort zu bringen, was zwar unverborgen, jedoch in jenem Halbdunkel lag, das für den DDR-Alltag so charakteristisch war: Man nahm es hin, entlastete sich, verweigerte sich selbst die Rechenschaft, weil nachzudenken zu nichts oder – in den späteren Jahren – aus dem Halbland DDR führte.
Doch je größer die Anerkennung und Anhängerschaft wurden, desto stärker trat das Werk zurück. Vielen kam es weit mehr als auf die Texte auf das Symbol Kunze an. Er wurde ein Leitbild, ja ein Idol wie nach ihm nur Christa Wolf. Das Gemeinsame und das Gegensätzliche in beider Wirkgeschichte aufzuzeigen, wäre eine ebenso reizvolle wie schwierige Aufgabe.
Kunze hätte sich damit begnügen und seine Kraft darauf richten können, die Balance zwischen Kritik und scheinbarer Staatsbejahung (eine Technik, die einige DDR-Autoren virtuos beherrschten) zu halten. Er tat es nicht: Mehr als die Wirkung galt ihm die Wahrheit. Die wunderbaren Jahre zerstörten die Schranke, vor der einer noch als staatsfördernder Autor gelten konnte. Die Honecker und Hager begriffen, daß sie den Zeitgeist nicht durch Nachsicht lenken, und meinten, daß sie ihn durch Härte prägen könnten. Da sie Biermann aussperrten, mußten sie auch Kunze hinausweisen.
Der Zufall wollte, daß ich vier Jahre nach seiner Vertreibung aus dieser vogtländischen Stadt nach Greiz zog. Meine Fenster sahen zur Hügelhöhe, auf der er gewohnt hatte. Menschen, Häuser, Begebenheiten erinnerten an ihn. Ich versuchte nicht, sein Erbe zu sein. Keiner hätte an seine Stelle treten können, denn Kunze war, vor allem in Greiz, nicht nur ein Mensch und ein Name, sondern weit mehr ein Mythos und eine Institution.
Weil er das Wort für viele, die wortlos blieben, wog, wurde er für sie zu einer Instanz, deren Existenz wichtiger war als ihr Wort. Auch das ist Dialektik, wie sie das Leben erfunden hat, ein Leben, das nimmt, indem es erfüllt, und erfüllt, indem es sich verweigert.
Wir wußten Kunze in seiner Obernzeller Ferne hinter einer Grenze, die sowohl für uns als auch für ihn unüberschreitbar war. Dann und wann schrieben wir und erhielten als Antwort einen Brief mit dem unverwechselbaren blauen Siegel. Als die Mauer fiel, sahen wir uns wieder – in Greiz. Wo sonst? Sein Einzug glich einem Triumph. Er mißtraute Triumphen. Er wußte, eine solche Begeisterung wahrte nicht das rechte Maß für ein leises, vom Schweigen ertrotztes Wort. Denn Dialektik findet kein Ende. Im geeinten Deutschland wächst die durch vieles Wissen bereicherte Unwissenheit – ohne Schulung, auf natürlichem Wege.
Reiner Kunze wird 65 Jahre alt. Ich möchte wieder eine Tasse Jasmintee mit ihm trinken, meine Traurigkeit ablegen – und schweigen.
Uwe Grüning, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
„Es ist auf den Weg gebracht“
– Eine Danksagung. –
Er hatte tatsächlich an alles gedacht. Das kleine Päckchen voll bunter Schilling-Briefmarken, per Einschreiben aus Österreich geschickt und als Absender ein gewisser Herr Faber-Castell. Etwa der „Buntstift-Graf“: dessen wunderschöne Produkte die Westverwandten stets im Geschenk-Gepäck hatten, zur Freude der Kinder und zum neidvoll-stummen Missfallen der Lehrer danach in der Schule? Die Zöllner und die ihnen übergeordneten Geheimdienstler hatten jedenfalls nichts bemerkt und das Päckchen nicht geöffnet (klugerweise war der kleine Inhaltsangabezettel – „ein Buch“ – vom Absender direkt über den hinteren Verschlussstreifen geklebt worden). Soviel Sorgfalt und Voraussicht, um eines jeden einziges leben, den Gedichtband von 1986, hinein in die sächsische Provinz zu schmuggeln!
Vorausgegangen war dem mein Brief an Reiner Kunze via S. Fischer Verlag, die Bitte um Bücher, notgedrungen vage begründet mit dem Lesehunger eines damals 18jährigen, der dabei jedoch nicht schreiben durfte, dass er aus politischen Gründen zum Hilfsarbeiter gemacht worden war, den Kriegsdienst verweigert und zusammen mit seiner Familie die Ausreise beantragt hatte, und nun nach nichts Geringerem suchte als nach der Schönheit einer Wahrheit, in einem Land der Angst, der Lügen und Vertuschungen. Denn hatte es nicht kurz zuvor diese bald enttäuschte Freude gegeben? In der staatlichen Buchhandlung der nahen Kreisstadt hatte ich einen Reclamband mit Essays von Gerhard Wolf gefunden, in welchem unter dem Titel Dialog mit Dichtung u.a. Erich Arendt, Georg Maurer, Johannes Bobrowski, Volker Braun und (durchaus wagemutig) sogar Günter Kunert präsentiert wurden in einer fein ausdifferenzierten Sprache, die nichts gemein hatte mit dem Losungs-Deutsch der Zeitungen und offiziellen Verlautbarungen. Doch gleichzeitig, dieser Eindruck bereits nach wenigen Seiten: Wie verschroben und ziseliert da um das Eigentliche – eben jene Angst und Unfreiheit – herum geschrieben wurde, Pirouetten der Andeutung drehend und noch im Impetus des sich vorwagenden Widersprechens im allerletzten Moment wegflutschend, mit Verweis auf „Komplexität“ die eigene Position erneut in ein quecksilbriges Fragezeichen verwandelnd. Bei der partiellen Wiederlektüre zur Vorbereitung für diesen Text hatte ich jedenfalls sogleich Kopfschmerzen bekommen, nun seit über zwei Jahrzehnten – auch Dank Reiner Kunze – der sinnlosen Suche enthoben, zwischen den Zeilen lesen zu müssen und lesen zu wollen, was nicht etwa existenzielles Mysterium war – aus gutem Grund von Sprache höchstens zu umkreisen oder in einer gelungenen Metapher zu bannen – sondern lediglich verklausulierte politische Botschaft und im Grunde pure bürgerrechtliche Selbstverständlichkeit. Gerade deshalb gilt Joseph Brodskys Diktum „Ästhetik ist Ethik“: Je freier das Denken und Sprechen, desto klarer und stringender auch die Form. In „DIE VERURTEILTEN VON THORN“ (provoziert von der Ermordung des polnischen Priesters Jerzy Popieluszko und in jenem nach Sachsen geschmuggelten Band veröffentlicht) wird ein politischer Kriminalfall zum Prüfstein menschlicher Widerständigkeit, präzise und bar jeder pathetischen Rhetorik:
Ihr verhängnis: Verräterisch klein
ist ihr land
Ihre hoffnung: das große land
Reglos
kehrt es den rücken zu
Doch jeder weiß, es liegt wach
Waren es Zeilen wie diese, die Gerhard Wolf in erwähntem Essayband in einer Zwei-Zeilen-Notiz davon schreiben ließen, manche von Reiner Kunzes Gedichten seien geprägt von „Ressentiments“? Immerhin ließ sich bei entsprechend gutem Willen selbst die pikiert tadelnde Randbemerkung noch als eine literaturkritische Position verstehen, die Wiedererwähnung eines spätestens seit 1976 zur Unperson gemachten Dichters. Zumindest war es keine Schuftigkeit wie jene des damaligen Schriftstellerverbandspräsidenten Hermann Kant, der auf Kunzes erzwungenen Weggang aus der DDR ein „Kommt Zeit, vergeht Unrat“ gemünzt hatte. Selbst die Schmähung aber reizte, gegen den Strich gelesen, zur Renitenz, war sie doch ebenfalls in einem Band publiziert worden, der in einer Buchhandlung auslag – schwarz auf weiß. Dennoch: Wie deprimierend all das war, wie eng und grau. Und wie letztlich schal selbst das Vergnügen, bei der Leipziger Buchmesse am S. Fischer Stand ganz oben auf dem Bücherregal den Löwen Leopold thronen zu sehen, angestarrt von Besuchern, die einander danach ein wissendes Lächeln schenkten.
Aber war man nicht ebenfalls gefangen in diesem Kokon aus Halbwissen, Gerüchten und mühsam dechiffrierten Nachrichten, in einem Nebel, durch den zum Glück wenigstens ab und an die Radiostimme des engagierten RIAS-Redakteurs Hans Georg-Soldat drang? „Kunze, Kunert, Kirsch“ oder: „Kunze, Biermann, Loest, Fuchs und Klier.“ Der ermutigende Klang allein schon der Namen, zeitweiliger Ersatz für die verbotenen Gedichte und Texte.
Wenn eure lesebücher die verluste melden werden,
die eure zeitungen verschweigen – dann
vielleicht
Doch zu ende zählen werden wir die tage nicht
Euch, die ihr gespräche dort pflanzt,
wo sie befahlen, die wurzeln zu roden,
hinterlasse ich den treffpunkt,
damit ihr ihn hinterlaßt:
Beim blauen schriftzug des eisvogels,
der nur dann seinen ort verläßt,
wenn den bächen das eis
bis zum quell steht
Immerhin hatte man mir am Messestand bei S. Fischer die Verlagsadresse gegeben, über die ich Reiner Kunze schließlich schrieb – nicht wissend um die potentiellen Risiken solcher „Kontaktaufnahme“. Wenig später traf im sächsischen Dorf eine Ansichtskarte mit einem Emil-Nolde-Motiv ein, auf der ein gewisser Toni Pongratz in mikroskopisch kleiner, doch lesbarer Schrift den Erhalt des Briefes bestätigte und seine Postadresse hinterließ. (Für all das würde es später eine Erklärung geben.) War Pongratz womöglich ein Pseudonym für Reiner Kunze? Eine Camouflage, ähnlich dem „das Banjo spielt noch nicht“ des Volker Braun, mit welchem er Anfang der siebziger Jahre in einem Gedichtband die Zensur hatte zu überlisten geglaubt, da ein „die Gitarre spielt noch nicht“ als eine zu starke Anspielung auf das Auftrittsverbot Wolf Biermanns verstanden worden wäre? Die Anekdote, von Biermann als Beleg für ängstlichen Mut oder mutige Angst erzählt, hatte ich ebenfalls eines Abends im RIAS gehört und hielt mich demzufolge für recht gewitzt, im Antwortbrief zu schreiben:
Wäre überglücklich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Falls es geht, auch mehr zu erfahren, Herr Toni Pongratz. (Ich habe von Max Frischs Roman gehört, der hieß: Mein Name sei Gantenbein.)
Doch wiederum: Die flaue, bemühte Klügelei des Halbwissens und notgedrungenen Nur-Vermuten-Dürfens. Am 29.April 1989 dann eine Karte aus Brüssel, mit einer Luftansicht der EG-Gebäude:
Es ist auf den Weg gebracht. Händedruck…
Und so traf eines jeden einziges leben schließlich in einem Kaff namens Wechselburg ein – exakt drei Wochen, eher nach schwerer Zeit unserer Familie endlich die Ausreise gewährt wurde. Seltsame, doch glückliche Koinzidenz, denn nun war es genau dieses Buch, das mich auf das neue Leben vorbereitete.
IN SALZBURG,
AUF DEM MÖNCHSBERG STEHEND
(Nach ankunft im westen Europas)
Wiederzukehren
hierher, können von nun an mich hindern
armut nur, krankheit
und tod
lm kupferlaub der dächer geht der blick
den abend ab
Heimat haben und welt,
und nie mehr der lüge
den ring küssen müssen
Ein Preisen der Freiheit, ohne die Begrenzungen zu verschweigen, die allesamt mitgedacht und doch unterschiedlich gewichtet werden. Denn das „nur“ gilt ja allein der Armut, gegen die es immerhin Gegenwehr gibt im Unterschied zu Krankheit und Tod. Ein Welt-Anschauen in vier Zeilen, poetisch und präzis. Zwar unwahrscheinlich, dass der euphorische Achtzehnjährige, der nun Stunde für Stunde die ungute Gegenwart zu einer bald überwundenen Vergangenheit zusammen schnurren fühlte, auch dies bereits mitlas und unser aller Endlichkeit in Rechnung stellte. An eines aber erinnere ich mich, gilt es doch bis heute: Es war und ist das Aufatmen und Wahrnehmen-Können, das aus solchen Gedichten auf den Lesenden übergeht. Eine ruhige und jedes Detail achtende Gestimmtheit, mit deren Hilfe sich dann auch gewiss die letzte Hürde überwinden ließ. Denn wie ewig lang stand der Zug am Grenzbahnhof in Gerstungen! Die Lok abgekoppelt, dumpfe Mittagshitze. Durch einen Windzug wurde am Sperrzaun immer wieder ein Wellblechstück sinnlos hin und her geworfen, hin und her, während auf dem Bahnsteig die Grenzer patrouillierten, Schäferhunde an der Leine und mit Eisenzangen, an deren Enden sich kleine Spiegel befanden, unter dem Zug nach versteckten Menschen suchend.
Meine Manuskripte aber, die Tagebücher und mit Pauspapier kopierten, aus der Unfreiheit abgeschickten Briefe – dazu die zwei Westpostkarten und der Gedichtband – versteckt inmitten des Gepäcks meiner kleinen Schwester, ohne dass die Mutter davon wusste. Ein, zwei Stunden, und es schien, als würde sich der Mönchsberg in Salzburg doch noch entfernen und womöglich in die Hände der Uniformierten geraten. Dann ging schließlich ein Rucken durch die Abteile. Es ertönte ein Pfiff, der Zug setzte sich – doch wie quälend langsam – in Bewegung, und als er plötzlich an Fahrt gewann und schon nach wenigen Minuten links der Gleise in einem kleinen Dörfchen Westautos auf der Straße zu sehen waren, begann meine Mutter wie befreit zu weinen, und mein Vater nickte mir zu. Ab jetzt…
Die Aufnahmekapazität des Übersiedlerlagers in Gießen war allerdings erschöpft. Was bedeutete, dass die Neuankömmlinge, die spätabends mit Sack und Pack den Weg vom Bahnhof hierher gefunden hatten, in den Kellern der Wohntrakte untergebracht werden mussten. Schränke wurden so zu provisorischen Wänden, als Türen galten die dazwischen ausgespannten Decken und Bettlaken. Warme Mahlzeiten gab es nicht mehr, doch hatten die Leute aus der Küche zumindest noch ein paar Früchte auftreiben können; aus manchen der provisorischen Wohngevierte hörte man gereizte Beschwerden. Am nächsten Morgen ging das Gerücht, oben in einem der Zimmer hätten Ausgereiste einen spionierenden Stasi-Mann wiedererkannt, doch ehe es zu einer Prügelei gekommen wäre, hätten die Verantwortlichen eingegriffen und die Polizei alarmiert. Als beim Mittagessen ein altes deutsch-polnisches Ehepaar – gebeugte Rücken, runzlige Bauerngesichter, sie mit einem weißen Häubchen – aufgrund derart sichtbarer Hinfälligkeit vorgelassen wurde, brach bei einigen in der Warteschlange der Hass hervor:
Was soll das mit dem Polaken, gelten wir Deutsche denn gar nüscht?
Der Gießener Angestellte freilich ließ sich davon nicht beirren und geleitete die zwei Leutchen direkt zur Durchreiche – wahrscheinlich machte ich in diesem Moment zum ersten Mal Bekanntschaft mit jener Bundesrepublik, wie sie mich noch zwei Jahrzehnte später rührt und begeistert: Effizient und demokratisch und dabei durch vielerlei klug eingebaute Zwischenschaltungen den Lärm der Menge, das Hordengebrüll, ebenso effektiv dämpfend. Und wie gut es dann war, in den Amtszimmern zu sitzen und Fragen zu beantworten, die nicht gebrüllt, die nicht mit schneidender Schärfe gestellt wurden. Ruhig vortragen zu können, dass man entgegen des vorgesehenen Kontingentplans lieber doch nicht ins Ruhrgebiet, sondern hinunter an den Bodensee siedeln wollte. „Gut“, sagte mit einem freundlichen Lächeln der Beamte und machte sich Notizen.
Via Durchgangslager Rastatt. Wird allerdings noch ein paar Tagen dauern. Wenn Sie es also solange noch im Keller aushalten könnten… Ich muss mich dafür entschuldigen.
MIT DIESER FAHNE SCHON
Manche hätten ihr den wind
am liebsten ausgeredet
Wir aber hatten gesetzt auf ihn
Wir hatten gehofft
auf das eine land
mit der einen fahne
Auf das land,
das nicht leugnet,
mit der fahne,
die in frieden läßt
Beim Gang durch die Gießener Innenstadt entdeckte ich plötzlich ein Plakat. Ein weiterer unglaublicher Zufall: Reiner Kunze würde am nächsten Tag in der Stadt sein, am 23. Mai 1989, an dem sich die Verabschiedung des Grundgesetzes zum vierzigsten Mal jährte. Morgens eine Schullesung, abends dann ein öffentlicher Auftritt bei einer Feierstunde im Rathaus. In einer Buchhandlung wies man mir den Weg zum Justus-Liebig-Gymnasium, das dann auch ganz einfach zu betreten war – die Wandzeitungen in den Gängen voll mit Bildern von den Auslandsausflügen der Schüler, bunte Polaroids. Im Lehrerzimmer bildete sich sogleich eine Traube um mich, man wollte die Geschichte hören und seltsam: Das Gefühl des Befreitseins wurde stärker und stärker, doch hatte es überhaupt nichts Unwirkliches an sich. Und so hatte der junge Mann, der später dann am Bodensee endlich selbst auf ein Gymnasium gehen konnte, um sein Abitur vorzubereiten, wahrscheinlich schon damals in der freundlichen, zivilen Atmosphäre dieses Lehrerzimmer gedacht: Das hier ist die Normalität und der Maßstab, das ganz Selbstverständliche und es steht mir zu – so wie allen Menschen auf der Welt.
Dann kommen Sie morgen also auch bestimmt wieder? Unser Deutschkurs hat sich begeistert auf die Lesung vorbereitet und ein paar von Reiner Kunzes Gedichten finden sich bereits auf dem kleinen Faltblatt hier, das die Schüler…
Auf dem Weg zurück ins Übersiedlerlager las ich dann Ausschnitte aus Heinrich Bölls Laudatio auf Reiner Kunze, vor allem aber dieses Gedicht – binnen Monatsfrist nun schon das zweite, das den Weg beschirmte.
ICH BIN ANGEKOMMEN
Ich bin angekommen
Lange ließ ich auf nachricht
euch warten
Ich habe getastet
Doch ich bin angekommen
Auch dies ist mein land
Ich finde den lichtschalter schon
im dunkeln
An die Lesung selbst gibt es merkwürdigerweise nur eine verschwommene Erinnerung. Ich hatte Platz genommen in einer der letzten Stuhlreihen in der lichtdurchfluteten Aula – und kämpfte gegen meine Müdigkeit. Nicht, dass die Veranstaltung enttäuschend gewesen wäre. Im Gegenteil: Wie wunderbar fügte sich Reiner Kunzes helle, fein akzentuierende Stimme zu den Gedichten, wie passten sich die Atemzüge den Freiräumen zwischen den Versen an, deren meiste ich ja noch gar nicht kannte! Vor allem aber war es die bereits in Sachsen vorweggenommene und nun wiederkehrende Salzburg-Empfindung, die just in diesem Moment zu einer Erfahrung wurde:
Wiederzukehren
hierher, können mich von nun an hindern …
Und irgendeine Stimme sagte: Es ist gut, Junge, jetzt bist du in Sicherheit, auch genießt du kein Privileg, sondern hast ersten Anteil am Leben in freier Gesellschaft, die Verhörzimmer der Abteilung Inneres liegen hinter dir, die Angst und die Schreie, denn ab nun ist auch der Zugang zu den Büchern nicht mehr versperrt und muss nicht mittels Deckadressen listig erzwungen werden, ab jetzt… Und dem Neu-Übersiedler aus dem Wohngeviert im Lagerkeller, der müder war, als er es sich selbst eingestehen wollte, fielen die Augen zu, während weiter Reiner Kunzes beruhigend klare Modulation zu hören war, rezitierend und die Fragen der Schüler beantwortend. ZUFLUCHT NOCH HINTER DER ZUFLUCHT.
Doch danach, als ich mich am Ende der Lesung vorstellte, wahrscheinlich etwas verlegen, gab es da womöglich einen kurzen Moment des Zweifels, vielleicht gar des Misstrauens, war – nur einen Monat nach meiner „Kontaktaufnahme“ – mein plötzliches Hiersein im Westen ja immerhin ein arg merkwürdiger Zufall? Nichts davon. (Jedenfalls hat das Gedächtnis nichts dergleichen gespeichert.) Stattdessen: Eine Widmung in den Wunderbaren Jahren, die mir zuvor der Gymnasiumsdirektor am Büchertisch gekauft hatte, und dazu eine Einladung zum Spaziergehen in der Innenstadt. Vor allem an zwei Details erinnere ich mich: Als ich während unseres Gesprächs Stefan Heym erwähnte, der mich bei einem Besuch in Ostberlin mit einem jovial-grummeligen „Weggehen verändert gar nichts, junger Mann“ abgespeist, mir aber immerhin seinen großartigen König David Bericht mitgegeben hatte, kam von Reiner Kunze kein abwertendes Wort. „Oh ja, Stefan Heym…“, sagte er, ganz kollegiale Wertschätzung und wahrscheinlich im Vertrauen darauf, dass ich das Zusätzliche schon irgendwann selbst herausfinden würde. Als ich dann von Christa Wolf sprach, von meinen Briefen an sie, und meinte, Inhalt und Ton ihrer Bücher schienen vor dem Entscheidenden, wirklich Schmerzlichen leider jedes Mal abzubiegen, wenn auch in wortreicher Trauer – was sagte da mein Gegenüber, der selbstverständlich dieses und noch vieles andere ungleich besser wissen musste aus existenzieller Erfahrung? Nun folgte eben keine „typische Emigranten-Suanda“, kein Parlando in Bitternis oder gar eine hektische Vereinnahmung des Neuzugangs für die „gemeinsame Sache“. Nichts von alledem. Nur ein leises, doch ganz und gar nicht gewollt suggestives „Vielleicht muss man sich ja mitunter entscheiden, ob es der Nationalpreis der DDR oder der bundesdeutsche Büchner-Preis sein soll“. Ein Gedanke, dem jungen Übersiedler fast beiläufig übermittelt. Sympathische Souveränität, die weder eilfertig nach Gefolgsleuten sucht noch mit politischer Äquidistanz kokettiert. Denn in den Büchern, den Gedichten ebenso wie in den Essays, war ja alles bereits geformt und konzentriert. Auch die Empathie mit jenen, denen dies nicht gelungen war.
LEBEN MIT EINEM MISSLUNGENEN WERK
Zeigen hattest du wollen
den strick, mit dem man die seelen hängt
Gezeigt hast du
ein würgemal
Zu groß war
das deine
Und viele gehen den henkern zur hand,
und tiefer schneidet der strick ein
Am Abend dieses 23. Mai dann die Rathaus-Lesung. Mein Vater und ich im Publikum (zuvor die besorgte, bei der kleinen Schwester im Keller verbleibende Mutter, ob wir auch ordentlich angezogen wären) und wir beide bewegt von der Gelassenheit gerade auch der offiziellen Vor-Redner, der Abwesenheit von Pomp und Parolen.
Was für ein gutes Land, in dem wir dann, wiederum in Monatsfrist, mehr als nur Obdach fanden am Bodensee: Und doch… Konnte man, durfte man sich so vorbehaltlos zu dieser Bundesrepublik bekennen, wie es Reiner Kunze in den Interviews und Gesprächen tat, die in der Edition Toni Pongratz (Lösung des „Decknamen“-Rätsels) veröffentlicht waren und die ich nur wenig später an die neue Adresse in Singen am Hohentwiel zugeschickt bekam? Tatsächlich kein Grund für Trauer und Verlustgefühle, solange man nur in einer freien Gesellschaft lebt? ,,Der Kunze hat völlig recht, denn du verwechselt da was“, sagte daraufhin der Vater, ehe er sich aufs vom ersten Überbrückungsgeld gekaufte Fahrrad schwang, um eine Arbeit zu suchen und für den Sohn ein Gymnasium.
Der Staat ist nur für die Rahmenbedingungen zuständig, nicht für’s Individuelle. Das bleibt mal hübsch bei jedem selbst, und wenn es schwerfällt, das als Chance zu sehen, muss man sich eingestehen, dass ja sogar wir noch ein Stück rot verblödet sind und gehirngewaschen.
Sprach’s und machte sich auf den Weg für die Zukunft unserer Familie.
Die Klarheit des Dichters aber, die Fähigkeit des Benennens auf kleinstem Raum, geleitete auch späterhin in einem Land, in welchem bis heute zahllose gut Vernetzte der Meinung sind, Demokratie und Menschenrecht sei bestenfalls verzichtbares Wortgeklingel. Die Debatten um die Stasi-Akten, der große Frieden mit den Mitläufern bei der Akademie-Vereinigung, die Invektiven gegen die erneut störenden Dissidenten – Reiner Kunze bezog Stellung. Das war mehr als tagesaktueller Einspruch, so wie auch sein Gedicht von 1980 als Quintessenz jeder derartigen und nur zu oft wiederkehrenden Erfahrung zu lesen ist.
AUF DEM VORMARSCH
Erst fassen sie fuß, dann
nach den Köpfen
(Hindert sie die schwelle, kehren sie
die reihenfolge um)
Und die Schönheit, die sich zwar auch in der bitteren Wahrheit findet, aber doch wohl nicht allein an jenem Ort? „Mein Gewährsmann ist Albert Camus“, hatte Reiner Kunze damals in Gießen den Schülern gesagt, wohl wissend, dass in den frühen fünfziger Jahren die aristokratisch prokommunistische Dame Simone de Beauvoir jene wirkungsmächtige Häme ins juste milieu gebracht hatte, nach welcher der furchtlose Mann aus Algerien doch höchstens zur Gymnasiasten-Lektüre tauge. (Auch das war etwas, auf das mich der Dichter noch am gleichen Tag aufmerksam gemacht hatte, denn die noch kurz zuvor in der DDR so glücklich ergatterte Reclam-Biographie wand sich selbstverständlich um die Sache herum, verklausierte den intellektuellen und sinnlichen Antitotalitarismus Camus)
MÖGLICHKEIT, EINEN SINN ZU FINDEN
Durch die risse des glaubens schimmert
das nichts
Doch schon der kiesel
nimmt die wärme an
der hand
Selbst frühe Prägungen aber müssen keine gegenwärtigen Traumata sein: Kunzes auf oder nach Reisen entstandene Gedichte legen davon Zeugnis ab, von der befreienden Mönchsberg-Erfahrung zehrend, ohne dieser thematisch verhaftet zu bleiben. Außerdem, natürlich: Die Liebe und Böhmen! Wer könnte durch jenes Land reisen, das seit November 1989 nicht mehr gedemütigt, ohne an Elisabeth und Reiner Kunze zu denken? Unmöglich, die Grenze zu überqueren, ohne sich an die ironischen Kundera-Anekdoten zu erinnern oder an die kongenialen Übertragungen der Verse von Holan und Skácel. Zátopoli dichte jener und Reiner Kunze übersetzte es als umlindensein: Und in eben dieser Gestimmtheit und Geborgenheit ab nun durch die böhmischen Wälder, entlang der Elbe und Moldau, hinein in die Altstadtgassen von Prag, die panzerfreien…
Was jedoch Krankheit und Tod betrifft, die ewig tumben, eben nicht tot zu kriegenden Breschnews und Kossygins: Furchtlos, ja provozierend wird ihnen gerade das Intimste, Verletzlichste entgegen gestellt, die lebenslange Liebe zweier Menschen, eine Doppel-Existenz gewordene Unwahrscheinlichkeit. Wer ebenfalls des Glücks teilhaftig geworden ist, die Welt mit vier Augen sehen zu dürfen und sich deshalb gar nicht vorstellen mag, gerade dies könnte endlich sein, hat den Trost, dass zumindest in Worten das Unsägliche gebannt ist.
TAPFERER VORSATZ.
Wir wollen, wenn die stunde
naht, mit ihr
nicht hadern
Möglich, das irgendwann
beim anblick eines leeren schuhs
das universum
über uns zusammenstürzt
Dann laß uns denken an den fuß,
zu dem der schuh gehörte,
und an das zehenspiel,
das ungezählte male, als wir
beieinanderlagen,
das universum
zurückkatapultierte
an seinen platz
Eine Revolte gegen das deprimierend Gängige, ja sogar gegen das Schicksal selbst und das indifferente Universum – auch dafür erweist sich der noch in seinem Aufbegehren so stille und modeste Dichter als stark genug: Reiner Kunzes Gewährsmann ist schließlich Albert Camus. Unermesslich, was ich beiden wissenden Menschenfreunden zu verdanken habe.
Marko Martin, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
REINER KUNZE
Ein handlanger der Stille.
Am Abend genügt ihm eine Feder,
um wach zu bleiben.
Auge in Auge mit dem Wort.
Seine Verse sind das Federgras.
Seine Briefe an die Freunde
fliegen, schnellen
über den Schwellen,
manche händigt er selbst aus.
Unter dem Gegenhimmel
verleiht er der Liebe Flügel.
Und er kennt das Heimweh,
im Traum barfuß wie die Weinbergschnecke.
Wälder, wie er zu euch steht!
Wie er unter die Sonne geht,
damit auch sein Schatten Erde hat!
Marian Nakitsch
NUR EIN DICHTER
1
Reiner Kunze kam zur Welt im Jahr 1933, als Stefan George sie verließ. Beiden Großen ist gewiß nicht nur die Kleinschreibung gemein. Dennoch erkennt Kunze seine Ahnen in Fremden, vor allem in dem tschechischen Dichter Jan Skácel. Diesem verdankt er, im Herzen barfuß zu sein. Ohne diesen paradoxen Zustand wären Kunzes sensible Wege undenkbar.
2
Nur in einem Gedicht, nämlich in jenem, das „zuflucht noch hinter der zuflucht“ betitelt ist, ist Reiner Kunze direkt mit Gott verbunden, und dennoch glaubt ihm der religiöse Leser auch in anderen Texten. Vielleicht hängt das damit zusammen, daß dieser ungläubige Mensch sich nicht davor scheut, Ostern als Dichter zu feiern, und sicherlich damit, daß seine Gedichte wie „glocken allzu nah und der himmel von Jerusalem“ das Schönste, ja das Originärste über Religion in der zeitgenössischen deutschen Poesie sind.
Wenn Kunze im Gedicht „die nacht x“ schreibt: „An ihrer eigenen finsternis / werden sie sich herablassen vom himmel“, was die Welt des Gläubigen auf den Kopf zu stellen scheint, ist dies jedoch das Denken eines Menschen mit Flügeln.
3
„Jeder tag / ist ein brief“ heißt es in einem Gedicht Reiner Kunzes aus der Zeit, als die Post ihm die einzige Öffnung zur Welt und der Brief ein Lichtschein war. Daß er auch heute gelb gestimmt ist, beweist ein überdimensionaler Briefkasten vor seinem Haus.
Nicht nur, daß sein Leben das Postsignal trägt, auch viele seiner Gedichte gelangten durch den Briefkastenschlitz in die deutsche Poesie. Schließlich ist sein Brief mit blauem Siegel neben einem lilienweißen brief aus lincolnshire von H.C. Artmann die bedeutendste Post, adressiert an die deutschen Lyrikleser.
4
Für Reiner Kunze ist der Gast, selbst wenn dieser sich zur Seite setzt, die Mitte. Das gilt für den wirklichen „Besuch aus Mähren“ wie für den winzigen Aquarellgast von Jan Balet. Sogar den Leser seiner Lyrik will er nicht draußen lassen. Vor der Schwelle des Gedichts lädt er ihn ein: „Treten Sie ein, legen Sie Ihre / traurigkeit ab, hier / dürfen Sie schweigen.“
5
Darum, daß der dichtende Sohn der Provinz, mit der Zunge der Brüder Grimm in der Mundhöhle und Frantisek Halas’ Kinderherzen im Brustkorb, zum Dichter von Weltrang emporstieg, machte sich auch eine großartige Frau verdient, deren Zweisprachigkeit seinen Worten über Jahrzehnte entgegenkommt.
6
Den originär Schreibenden gäbe es nicht ohne den originär Seienden. Reiner Kunze hält den Menschen für eines der Wunder der Erde, und er selbst haftet dementsprechend an ihr. Sein existentielles Vorbild ist die sonnige Hänge bevorzugende, ausdauernde Silberdistel:
Sich zurückhalten
an der erde
Keinen schatten werfen
auf andere
Im schatten der anderen
leuchten.
Marian Nakitsch, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Reiner Kunzes Deutschland
Was Stauffenberg rief, kurz bevor er im Bendlerblock in Berlin wegen Hochverrats hingerichtet wurde? „Es lebe das geheime Deutschland“ oder: „Es lebe das heilige Deutschland“? Auch die erfolgreiche Biographie von Thomas Karlauf über Stefan George im Jahre 2007 vermutet mehr, als dass sie nachweist. Wie auch immer, den Kosmos des George-Kreises bestimmten die griechische Antike, die staufischen Kaiser, das Rolandslied, und vor allem steuerten Hölderlin, Goethe, Herder und Nietzsche die Umlaufbahn. Die Menschen um George beschworen damit ein virtuelles Gefilde, ein anderes Deutschland. Der 20. Juli 1944 wurde aus diesem Geist zum Gegenentwurf zur Tyrannei. Dessen grandiose Vergeblichkeit wirkt nach bis auf den heutigen Tag. Diese entschiedene Tat galt in der DDR nichts, fast nichts. Erst ganz am Ende des „real existierenden Sozialismus“ im zweiten deutschen Staat fügte man den „Junker“ Stauffenberg dem kommunistischen Erinnern an. Die DDR basierte auf Unwahrheit, Bevormundung und Zersetzung. Bis zum Untergang. Der Rechtsanwalt, der Robert Havemann verriet, war ein Mann des Systems. Die SED hielt und unterhielt solche Personen.
Reiner Kunze ist nicht erschossen worden. Die Zersetzungsmaßnahmen waren allerdings bis 1976 weit vorangeschritten. Er folgte seinem Überlebenswillen und dem Wunsche seiner Frau Elisabeth, Thüringen zusammen mit ihr und damit die Diktatur zu verlassen, die sie verfolgte. Kunze plante keinen Staatsstreich, er kämpfte mit dem scharfen Degen seiner Persönlichkeit, mit dem Brennglas seiner überwundenen Angst gegen die Verhältnisse. Und mit den Mitteln, über die er reichlich verfügt, mit Gedichten. Er steht in der gedanklichen Tradition Stauffenbergs und kann eingemessen werden in die Idee des „geheimen Deutschlands“, des besseren, des eigentlichen Landes mit der Vorsilbe „deutsch“.
Des Dichters Vaterland ist das Wort. Er sieht Deutschland nicht als politischen Corpus, sondern als Sprachland in der Idee Johann Gottfried Herders. Das „innere Vaterland“, von dem Friedrich Schiller spricht, ist umrissen von den Koordinaten, die das freie Wort setzt. Am 16. Oktober 1979 fragte Franz Alt in der Sendung Report Baden-Baden Reiner Kunze, was denn sein Vaterland sei. „Mein Vaterland ist Deutschland.“ Wer sagt das heute so? Als Bundespräsident Horst Köhler in einer Stegreifrede kurz nach der Wahl der Bundesversammlung im Mai 2004 sagte: „Ich liebe dieses Land“, waren viele gerührt. Er sagte nicht, ich liebe „mein Vaterland“. Auch das Wort Deutschland kommt nicht jedem Politiker gelassen, schon gar nicht getragen vom Vierklang des Streichquartetts, über die Lippen. Kunze sah sich nie als DDR-Dichter. Auch eine DDR-Literatur hat es für ihn nie gegeben, wenngleich viele Germanisten so schablonierten: BRD-Literatur, DDR-Literatur, österreichische Literatur, Schweizer Literatur, Südtiroler Literatur. Ein deutscher Dichter zu sein ist schwierig. Als ob das Adjektiv „deutsch“ possessorischen Anspruch begründen wollte, wenn es doch um die Sprache und deren Literatur geht!
Im Dezember 1981 plädierte der damalige Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS), Bernd Engelmann, dafür, den Wiedervereinigungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland aufzugeben. – Wiedervereinigung, 17. Juni, all dies galt als tümelnd, als politisch verdächtig und vor allem – fast noch schlimmer – als Abmeldung vom intellektuellen Gespräch. Kunze zog die Konsequenz und trat aus. Im Deutschlandfunk sagte er am 16. Juli 1983:
Ich gestatte keinem Schriftsteller, der im Namen des Verbandes auftritt, dem ich angehöre, Menschen in der DDR vorzuschreiben, was sie sich zu wünschen haben und was nicht. Die Hoffnung, durch friedliche Wiedervereinigung für ihre Kinder oder Kindeskinder die menschlichen Grundrechte wiederzuerlangen, diese Hoffnung vieler Menschen in der DDR als friedensgefährdend zu denunzieren – das konnte ich nicht mittragen.
Darum ging es Kunze immer: um den Erhalt bzw. die Wiedererlangung von Freiheit. Er sah und erfuhr, wie umfassend die Freiheit den Bürgern in der DDR vorenthalten wurde. Das war den 68ern in Deutschland-West weniger wichtig. Sie ideologisierten ihr Weltbild. Rückgrat zeigen, die eigene Angst überwinden und beharrlich den eigenen Standpunkt verteidigen, das ist die Denkschule von Reiner Kunze. Von Anfang an. Im 1963 in Bonn-Bad Godesberg herausgekommenen Band Widmungen reimte er:
DER VOGEL SCHMERZ
Nun bin ich dreißig jähre alt
und kenne Deutschland nicht:
Die grenzaxt fällt in Deutschland wald
O land, das auseinanderbricht
im menschen
Und alle brücken treiben pfeilerlos
Gedicht, steig auf, flieg himmelwärts!
Steig auf, gedicht, und sei
der vogel Schmerz
Eingekesselt in Greiz von SED- und Stasi-Schergen, gelang die Wahrnehmung auf der literarischen Bühne der Bundesrepublik aber erst mit dem Band zimmerlautstärke im Jahre 1972. Und es war ein mutiges Stück, im freien Teil Deutschlands ein Gedicht wie das folgende zu veröffentlichen:
AUF EINEN VERTRETER DER MACHT
ODER
GESPRÄCH ÜBER DAS GEDICHTESCHREIBEN
Sie vergessen, sagte er, wir haben
den längeren arm
Dabei ging es
um den kopf
Ein Deutschlandgedicht, dessen Textur hinüberreicht von der DDR in die Bundesrepublik, ja bis in die Gegenwart. Wenn man die zur sog. Wende erschienenen Gedichtanthologien zur Hand nimmt, so die Grenzfallgedichte. Eine deutsche Anthologie (Berlin 1991) oder Von einem Land und vom anderen. Gedichte der deutschen Wende, herausgegeben von Karl Otto Conrady (Frankfurt/M. 1993), zeichnen Resignation, Abwehr, Süffisanz und Reserviertheit das Stimmungsbild, Empathie eher selten. Auch Kunze ist weit entfernt von Deutschland-Seligkeiten. Er setzt präzise Verse, und so gelingt ihm im 1998 erschienenen Band ein tag auf dieser erde ein erstaunliches Gedicht, klar im Wurf und Vorwurf:
MIT DIESER FAHNE SCHON
Für Heinrich Oberreuter
Manche hätten ihr den wind
am liebsten ausgeredet
Wir aber hatten gesetzt auf ihn
Wir hatten gehofft
auf das eine land
mit der einen fahne
Auf das land,
das nicht leugnet,
mit der fahne,
die in frieden läßt
Auf das Land, das nicht leugnet. Das ist das Deutschland, in das sich der Dichter gerne geflüchtet hat. Kunze weiß, dass auch der demokratische Rechtsstaat nicht frei von Lüge ist, aber die Lüge, die Unwahrheit, das Verdrehen von Tatsachen sind eher der Betriebsunfall, der Fehler, der passiert, ist aber eben nicht die Grundkonstruktion, nicht das dem Rechtsstaat innewohnende Verhaltensmuster. Der demokratische Staat setzt eben auf individuelle Freiheit.
Reiner Kunze wird immer noch wahrgenommen, er wird von vielen Lesern geliebt für Gedichte, die wie rund geschliffene Kiesel warm werden in der Hand und so Begleiter sind. Aber es ist stiller geworden, als wenn man ihn überlesen wollte. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung konnte man schon seit Jahren keine Gedichte mehr von ihm lesen, und so kommt auch die Frankfurter Anthologie ohne Kunze aus. Seine Widersacher haben ein langes Gedächtnis. Dass er auch aus dem P.E.N. austrat, weil er die rasche Vereinigung von P.E.N.-West und P.E.N.-Ost bekämpfen musste, wollte er nicht mit den Sympathisanten und Beschönigern der SED-Verhältnisse zusammenkommen, war nur plausibel. Er hielt sich an die noble Präsidentin des West-P.E.N. Ingrid Bachér und ging wie sie.
Kunze hat sich trotz der harten Lebensbedingungen seinen inneren Freiheitsraum erhalten. Der 2007 erschienene Gedichtband lindennacht weist ihn als unbestechlichen und nunmehr seit über sechs Jahrzehnten schreibenden Dichter aus, der an der Absurdität und Verlorenheit der menschlichen Gesellschaft nicht verzweifeln will, deren Ausmaß er indes genau kennt. Sein entschiedener Widerstand gegen die Rechtschreibreform war ein Akt der Selbstverteidigung, denn nimmt man dem Autor die Sprache, nimmt man ihm alles – seine Welt. Und diese ist für Kunze neben der tschechischen die deutsche Sprache, in der er schreibt und publiziert. Deutschland ist für ihn das Sprachland und damit die Fläche seiner Existenz. In einem pointierten Text, den er über den aus dem Libanon kommenden Dichter Fuad Rifka geschrieben hat, zitiert er den arabischen Dichter:
Was wäre er, sagte er,
ohne Deutschland,
und meinte
Hölderlin, Novalis, Rilke
Den belächelten verschlug es
das lächeln
Gelobt sei
das arabische schriftmeer,
das ehrfurcht erweckt auch vor dem,
was es trägt
[…]
Was wäre er ohne Deutschland, was wäre der Poet aus dem Libanon Fuad Rifka ohne Deutschland, ohne die drei genannten Dichter, die für alle anderen stehen? In welchen klaren Spiegel will Rifka schauen? Und was wären wir ohne Dichter, die uns das geistige Deutschland vor Augen führen, was ohne Poeten wie Reiner Kunze? Ein armes Land! Aber wir sind es nicht, der Sprache sei Dank.
An der Bewusstheit der einmal geschafften Wahrheit sieht jetzt der Mensch überall nur das Entsetzliche oder Absurde des Seins.
Friedrich Nietzsche legte so ein Schlaglicht auf sein Leben und äußerte seine Zerrissenheit zwischen Wahrnehmung des Alltags und Entgrenzung des Ichs in der Kunst. Wenn die Absurditäten des Täglichen quälen, wenn sie Lasten aufbürden, unter denen man zu zerbrechen droht, wenn die Realitäten die Lebenskraft entziehen, bedarf es einer Gegenwelt, um zu überleben. Man muss sich dann orientieren an einer reinen Quelle, an dem tragenden Gedanken, der auch im strömenden Wasser nicht untergehen lässt. Im Vorspiel zu Richard Wagners Oper Das Rheingold ist es der Es-Dur-Dreiklang. Mit ihm führt der Komponist zur Urform der Existenz: zum Wasser. Aus diesem Dreiklang entfaltet er seine Musik und gleichzeitig seine Kunst-Philosophie. Die Musik des ersten Klanges ist wie der Augenblick der Schöpfung. Aus diesem kann sich eine Existenz entwickeln oder zum Anfang zurückfinden. Reiner Kunze kennt auch einen solchen Es-Dur-Dreiklang. Das „e“ ist nicht nur der häufigste Buchstabe in seinem Namen, „e“ ist gleichzeitig zweifach in dem Namen enthalten, der ihm Motiv für sein Schreiben und Leben ist. Nur ein winziger Buchstabe, das „i“, verbindet leben mit lieben und gibt dem Dichter wirkliche Fülle: Elisabeth.
AUF DICH IM BLAUEN MANTEL
(für Elisabeth)
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue komma das
sinn gibt
Dieses Gedicht las ich zum ersten Mal im Band zimmerlautstärke (Frankfurt/M. 1972). Mit diesem kleinen Text beginnt die letzte Abteilung dieses fünffach gegliederten Lyrikbandes mit Gedichten aus den Jahren 1968 bis 1971. Dem Gedicht folgt noch ein weiteres, das Peter Huchel gewidmet ist – auch er wurde von der SED aus dem Land getrieben (sechs Jahre vor Kunze) und fand in Staufen bei Freiburg eine neue Bleibe. Liest man die Jean Améry-Bemerkung, die Reiner Kunze dem Schlussteil des Bandes voranstellt, hinzu, eröffnen beide Texte eine Dimension, die in den Kern seiner Poetologie führt.
Man muß Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben, so wie man im Denken das Feld formaler Logik besitzen muß, um darüber hinaus zu schreiten in fruchtbarere Gebiete des Geistes.
Halt finden, sich nicht den Mund verbieten lassen in den Absurditäten der SED-Diktatur, im Alltag der genormten Sprache, Zuflucht finden in einer Winzigkeit, die das Leben bedeutet, nämlich im Akzent, der vom geliebten Menschen gesetzt wird und nicht von den Bevormundern der Büros – dies bezeichnet das Rettende der Dichtung. Sie eröffnet einen Zufluchtsraum, lässt finden und erfinden. Poesie ist Selbstgestaltung durch Sprache. Eine rettende Insel, Robinsons Zuflucht. Oder auch der Anfangsquell, der Leben und Dichten Richtung gibt. Kunze setzt immer in Beziehung, in seiner Lyrik wie auch in seinen essayistischen Schriften, ja, in jedem Gedichtband finden sich Textpassagen anderer Autoren, Lyriker, Philosophen, Musiker und Wissenschaftler, denen er seine Weitsicht entgegensetzt oder deren Erkenntnisse er zuspitzt. In zimmerlautstärke (1972) setzt er einem Text von Alexander und Margarete Mitscherlich eine Conclusio hinzu, die sein poetisches Ich umreißt:
Das gedicht als stabilisator, als orientierungspunkt eines ichs. Das gedicht als achse der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen.
Schreiben als Selbstbehauptung, als Heimat und Ich-Gewinnung. Und wenn er in einem anderen Text davon schreibt, dass „das Gedicht zur Ruhe gekommene Unruhe“ ist, zitiert er damit – sich dessen vielleicht gar nicht bewusst – Thomas von Aquin, der seinen Anker Gott zuwarf. Aber ist zwischen Gedicht und Gott, zwischen Gebet und Dichtung nicht eine große Nähe, manchmal nur durch einen Haarriss getrennt? Viele Gedichte Kunzes sind Variationen, ob nun Elisabeth angesprochen ist oder nicht. „Immer geht die hand des anderen mit“, so ein Vers aus dem Band auf eigene hoffnung (Frankfurt/M. 1981). Aus dieser poetischen Gewissheit leitet er ab, dass „wir nicht ins leere greifen“. Das Geländer auf der Brücke über das Absurde ist die Liebe zum andern. Ein Gedanke, den er ausgehend von Albert Camus immer wieder variiert. Aber Kunzes Lyrik ist auch im Natur- und politischen Gedicht Zuwendung, er will zum anderen, zum Gespräch einladen. Schlagstock ist seine Lyrik nie – fast nie, denn Gefühl und Erkenntnis können seinen Vers zuweilen auch schleifen, messerscharf.
Reiner Kunze ist Sohn eines Bergarbeiters und einer Kettlerin. Oelsnitz im Erzgebirge ist sein Geburtsort. Solche Kinder gerieten in den vierziger und fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts schnell ins Visier der SED: ein begabtes Arbeiterkind, dem die höhere Schulbildung ermöglicht wurde. Die SED legte ihre Krakenarme um den jungen Menschen, der dann in der Karl-Marx-Universität in Leipzig Philosophie und Journalistik studierte. 1959 erschien Vögel über dem Tau, sein erster Lyrikband. Mit der Poetisierung begann auch seine Politisierung, oder anders: Die SED erwartete Texte im Sinne des sozialistischen Realismus. Nur zu Beginn konnte der junge Kunze diesem Begriff noch etwas abgewinnen, aber schon 1959 warf ihm die SED vor, als wissenschaftlicher Assistent die Studenten zu „entpolitisieren und konterrevolutionäre Verbindungen zu unterhalten“. Seine Dissertation blieb so auf der Strecke. Als Hilfsschlosser musste er sich ab 1961 in der Schwerindustrie durchboxen. Dann kam die Wende seines Lebens. Denn es erschien das „blaue Komma“. Es kam aus Böhmen. Die In der Tschechoslowakei lebende Ärztin Elisabeth Littnerova hörte Kunze in Radio DDR, wandte sich literaturinteressiert an den Sender und somit an den Autor, und es entspann sich ein mehrere hundert Seiten dichter Briefwechsel, an dessen Ende – ohne die Briefschreiberin je persönlich kennengelernt zu haben – Kunzes Heiratsantrag stand. Denn die Sprache weiß mehr als die Augen. Das Sich-bindenWollen an den anderen, an den, der zählt – es gelang. Elisabeth kam 1961 in die DDR. Sie praktizierte als Kiefernorthopädin und ermöglichte es Kunze, sich ab 1962 in thüringischen Greiz als freischaffender Autor zu entwickeln. Ohne Elisabeth, ohne dieses ständige Es-Dur, gäbe es den Poeten Reiner Kunze nicht, und es wäre ihm auch nicht möglich gewesen, dem Zersetzungsapparat der Stasi im real existierenden deutschen Sozialismus standzuhalten. Seit 1968 agierte die Geheimpolizei gegen Kunze und warf ihm „staatsgefährdende Hetze“ nach § 106 StGB-DDR vor. Der operative Vorgang Reiner Kunze hatte den Decknamen „Lyrik“ unter der Registriernummer X/514/68. Seine Akte umfasst zwölf Bände mit insgesamt 3.491 Blatt. Bis zum 19. Dezember 1977 wurde gegen ihn operiert. Die sog. Westveröffentlichungen waren Provokationen für die SED-Funktionäre, für Leute, die nun in der PDS und in Die Linke (und leider nicht nur dort) nichts gewusst haben wollen oder – noch schlimmer – die mediale Zermürbung, wozu auch Verschweigen gehört, politisch fortsetzen. Und es waren auch Provokationen für diejenigen, die in der Bundesrepublik Deutschland die DDR als Diktatur nicht wahrhaben, sondern zum eigentlichen deutschen Gerechtigkeitsstaat stilisieren wollten. Kunze blieb immer Lyriker, auch und insbesondere in dem Prosaband Die wunderbaren Jahre aus dem Jahr 1976, als er die Welt in den Fingerhut nahm, pointiert Alltagssituationen wie in Filmsequenzen schilderte, die er nicht kommentierte, sondern in ihrer Zuspitzung und Absurdität für sich sprechen ließ. Das hatte den Ausschluss aus dem DDR-Schriftstellerverband im Jahr 1976 zur Folge. Damit war er mit Berufsverbot belegt. Natürlich unterschrieb Reiner Kunze im selben Jahr für seinen Freund Wolf Biermann die Protesturkunde, nachdem dieser im Anschluss an das Kölner Konzert aus der DDR ausgewiesen worden war. Die lebensbedrohlichen Repressalien nahmen zu. Um sich und Elisabeth zu retten, gingen beide und landeten an der Donau bei Passau. Der Georg Büchner-Preis durch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 1977 würdigte nicht nur das ästhetische Werk, sondern auch das standhafte Wirken dieses Menschen, der festhielt an der Wahrhaftigkeit der Kunst, die er schützend gegen ihre Verfolger verteidigt. Damals wie heute. In seinem 2007 erschienenen Gedichtband lindennacht teilt er wieder seine Gedichtsequenzen mit Zitaten und Äußerungen anderer ein, und so lesen wir von Erwin Chargaff:
Wer zuweilen im Zwischenland leben darf, verlässt es niemals ganz. Es ist, als lebte er glücklich gespalten in zwei Welten.
Glücklich gespalten in zwei Welten – in der vom Alltag geprägten Zeitlichkeit und in der entgrenzenden Weite der Worte. Dieses Zwischenland bewohnt Reiner Kunze wie kaum ein zweiter, und deshalb wird er geliebt in Deutschland und in dreißig anderen Sprachen, weil der Leser in dieses Zwischenland der Verse eingehen, sich dort auch heimisch machen will und somit quasi als zweiter Autor dieser Gedichte seine Bilder mit denen Kunzes verbinden möchte.
Und auch in diesem Band immer wieder neue Variationen über „e“: Elisabeth ist die Summe allen Dichtens von Reiner Kunze. Sie ist sein Kosmos. Ein Epigramm, ein wie hingehuschtes Gedicht, es beschreibt nicht, kommentiert nicht, sondern benennt eine ambivalente Welt:
DACHFENSTER BEI STERNKLARER NACHT
Nochmals für E.
Wie verloren wir liegen
Doch lieber ungeborgen,
als über uns
ein ebenbild des menschen
In der inspirierenden Edition Toni Pongratz veröffentlichte er 2013 ein Heft mit drei Gedichten, als wollte er einen letzten Doppelpunktsetzen:
FERN KANN ER NICHT MEHR SEIN
Fern kann er nicht mehr sein,
der tod
Ich liege wach,
damit ich zwischen abendrot und morgenrot
mich an die finsternis gewöhne
Noch dämmert er,
der neue tag
Doch sage ich, eh ich’s
nicht mehr vermag:
Lebt wohl!
Verneigt vor alten bäumen euch,
und grüßt mir alles schöne.
Matthias Buth, aus Matthias Buth: Seid umschlungen. Feuilletons zu Kultur und Zeitgeschichte, Vorwerk 8, 2017
Michael Ragg spricht mit Reiner Kunze – „… treibt uns dem Leben in die Arme“
WINTERLICHER ANSCHAUUNGSUNTERRICHT
(für Reiner Kunze)
Kristalle
an meinen Schuhen als sei ich
dem Himmel entstiegen. So
entstehen Legenden.
Thomas Stolle
REINER KUNZE
Kommt an mein Maul
Setzt euch auf meine Lippen
Und auf mein Fingerschnippen
Schlürft meine karitative Sprache
Schweigt euch ins Reich WUNDERBAR
Alle Wölfe sind schon da
Gleich dürft ihr spurten
Peter Wawerzinek
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLG + IMDb + Archiv +
Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


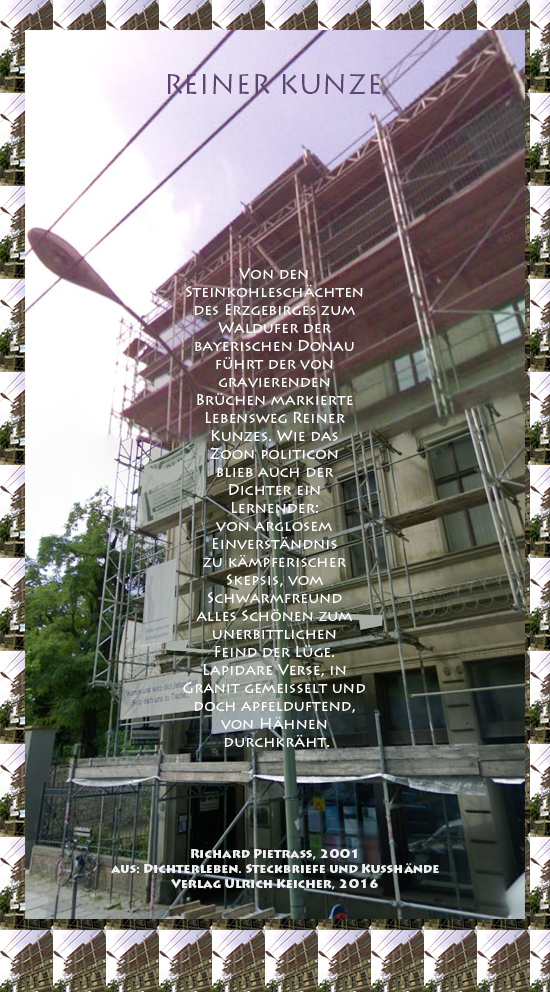












Schreibe einen Kommentar