Thomas Kling: geschmacksverstärker
TAGHIMMEL
wer auf der haut liegt, auf dem
gebogenen spaziert, auf der netz-
haut: mr. bidwell der dem wind
ins gesicht blickt der die rettet
aus dem sirupglas die paddelnde
wespe die sich jetzt auf den heißn
balkonfliesn putzt, der die gelenkig
keit von windhund wespe ins auge faßt fast
alles nachbilder unter äußerst verschieb
baren stratocumulus WOLKN NICHTS
ANDRES ALS TESTBÖGEN & ZWAR RORSCHACH
eingeschmuggelte devise: das unterste
zuoberst, so gehört sich das
Thomas Kling und Frank Köllges: waldstück mit helikopter (vermutlich frühe 90er)
Der „ver-rückte Sprachinstallateur“ Thomas Kling
betreibt mit seinem ersten Gedichtband im Suhrkamp Verlag eine wild-provokative Erforschung unserer Sprach-Wirklichkeit. Seine Gedichte, geschmacksverstärker, verrücken die Sprache und installieren sie neu. Aus unserem „sprachfraß“, aus Wortbruchstücken oder Satzfetzen, gewinnt Thomas Kling neuen und geschmacksverstärkenden Sinn.
In seinen dichterischen Klangkörpern, die mit rasanter Happening-Gebärde eher die Bühnen-Performance als stille Zurückgezogenheit suchen, fängt Thomas Kling die „bestürzung der herzn“ ein, belichtet sarkastisch das „outfit“ und die „schrillen klausuren“ in unserem Land, spießt „geschreberte idyllen“ auf und beschreibt schockierend und verstörend die Brutalität unserer Welt.
Dabei gelingt diesem jungen Dichter eine „Vermeerung der Sprache“ (Friederike Mayröcker).
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1989
Geschmacksverstärker
geschmacksverstärker ist nicht Klings erster Gedichtband, aber der erste, der einem breiteren Publikum zugänglich war und ist. In acht Teile gegliedert, umfaßt er 72 Gedichte, geschrieben in den Jahren 1985-1988. Es sind (um Andersch zu paraphrasieren) 72 eiskalt ausgeführte Schläge in die Fresse der Bürgerlichkeit: Hier tritt ein höchst energischer Sprach- und Formvirtuose auf, der das selbstzufriedene, plane, laue Gedicht der 70er- bis Anfang 80er Jahre (gibt Ausnahmen!) gründlich zu den Akten legt. Konfetti ist’s für ihn! Killefitt! Konfektion! – Kling schaltet mit Aplomb alle Herdplatten der Poesie auf die höchste Stufe und freut sich, wie’s spritzt und brodelt. Viel hat er auf der Pfanne, kaum kommt man mit: Gelehrte bis hippe, mit jazzig-cooler Attitüde oder rotziger Arroganz servierte Anspielungen auf einer eklektisch geeichten Bildungsskala, die von der archaischen Epoche eines Neandertalers bis zur Punk-Ära reicht, treffen auf einfalls- und fintenreich arrangierte Vielstimmigkeit/Vielsprachigkeit und ein ganzes Schock sprachlicher Innovationen, die alle zusammengenommen ausreichten, nicht nur um ein bedeutendes dichterisches Werk auf die funkende Schiene zu setzen (jenes von Kling selbst), sondern um eine neue Generation junger Lyriker mit Feuer und Treibstoff zu versorgen: Steffen Popp, Daniel Falb, Hendrik Jackson, Monika Rinck, Sabine Scho, Anja Utler und und und.
Die Lektüre der geschmacksverstärker fordert. Und, stört das wen?! Kling präpariert die Texte mit Sprachbeschleuniger und hält das Streichholz Witz daran: potenzierter Expressionismus, dadaesk angeschrägt. Teilweise ist das sehr lustig, „ein absolut gebongter lacherfolg“, dann wieder bleibt einem das Lachen im Hals stecken.
Kling-Gedichte sperren sich dem schnellen Verständnis. Den Vorwurf der gewollten Obskurität ließ der Dichter freilich nicht gelten. „Ich bin doch nicht der Kreuzworträtselmann“, sagte er in einem Interview. Der Rezensent empfiehlt zur ersten Annäherung, die Gedichte laut (oder halblaut) zu lesen, sie auch mit Blei- und Farbstiften zu lesen, denn: „Lesen ist nicht deuten, sondern wahrnehmen“ (Hans-Jost Frey); man kommt damit schon ziemlich weit.
Traditionserneuerung vs. –nachstellung
Wie alle Stafettenläufer im jahrhundertelangen Rennen der Tradition, wirkt Kling wie ein Ikonoklast, wie ein Abmurkser der Poesie. Die heftige, distanzlose Gebärde seiner Lyrik, seine provozierenden Modernismen verführen zu diesem Fehlschluß; tatsächlich ist seine Dichtung mit Tradition imprägniert, statt nur auf alt geschminkt zu sein. „Voltaire und Shakespeare – der eine / ist, was der andere scheint. / Meister Arouet sagt: Ich weine. / Und Shakespeare weint“, zitiere ich aus dem Gedächtnis das Gedicht „Vergleichung“ von Mathias Claudius, das in kleinerem Maßstab vielleicht auch auf Thomas Kling und Durs Grünbein gemünzt werden kann.
Wortklang und Zeichenfuror
Kling: Entfesselungskünstler. Entfesselt wird die Sprache, der Buchstabe, der Laut. Kling benutzt alle Tricks des Zeilenumbruchs und Enjambements, verwendet ausgiebig Kapitälchen, streut zahlreiche Zitate ein (echte, vorgetäuschte), geizt nicht mit Ausrufungszeichen, setzt verschwenderisch Kommata, Semikolons, Doppelpunkte, Auslassungspunkte, runde Klammern, Querstriche/Slashs, &-Zeichen und, wenn’s totet, Kruzifixe – Kursivierungen und Sperrungen nicht zu vergessen. Leerzeichen übernehmen die Rolle des Georgeschen Mittelpunkts (zu George, wie Kling in Bingen geboren, unterhielt der Dichter zeitlebens einen kritisch-respektvollen Draht, wovon sein Essay „Leuchtkasten Bingen. Stefan George Update“ zeugt) – mit einem Wort: auf dem Papier ist einiges los, die Augen kriegen viel zu futtern, einiges zu knacken. Die phonetische Schreibung, die Kling rehabilitiert, handhabt er konsequent und radikal, was die Texte als Lesepartituren zu verstehen und zu nutzen erlaubt. „Kling-Gedichte“ lautete nicht von ungefähr der Untertitel des 1986 auf Empfehlung und Vermittlung von Fritzi Mayröcker in der Düsseldorfer Eremiten-Presse erschienenen Bandes erprobung herzstärkender mittel.
geschmacksverstärker ist ein epochales Buch. Es hat den Ruhm des Dichters Thomas Kling begründet, der heute vor zwei Jahren starb. Doch während andere mit ihrem Ableben auch wirklich ,tot‘ sind, tot und begraben, ist Thomas Kling weiter präsent: mit sich intensivierender Geistes-Gegenwart IST ER DA (und wer auch so alles wissen will wie Kling, den hält’s bei den Toten nicht ruhig auf dem Stuhl!) −, seine Energie und Intensität sind in der Welt. Thomas Klings Sprachlust, seine – auch Kalauer und Albernheiten nicht geringschätzende – Wortartistik wollen entdeckt sein.
Moritz von Sprachwitz, Monnier Beach Blog, 1.4.2007
Ein allzu perfektes Debüt
Das kleine Buch der edition suhrkamp, dessen kulinarische Assoziationen erzeugender Titel über den herben Inhalt ganz entschieden täuscht, ist der erste Gedichtband des zweiunddreißigjährigen Autors. (Kling, geboren 1957 – so die Vornotiz – „lebte in Düsseldorf, in Wien, in Finnland und wohnt jetzt in Köln“ – wo er hoffentlich nicht nur „wohnt“, sondern auch „lebt“.) Genuine Lyriker treten meist in einem früheren Lebensalter in Erscheinung als Kling. Dafür hat dieser aber auch sein relativ spätes Debüt als Poet aufs gründlichste vorbereitet, mit einer Art kaltblütiger Perfektion. Selten hat ein deutscher Gedichteschreiber in den letzten Jahren die Leser so konsequent-methodisch durch avantgardistische Verfahren der Montage und idiosynkratische, skurrile Verrätselungen vor den Kopf gestoßen, wie es hier geschieht. Dieser Affront liegt, von allem Individuellen abgesehen, natürlich in der Logik der geschichtlichen Entwicklung des modernen Gedichts überhaupt begründet. Um es pointiert zu sagen: Will man heute als Lyriker noch bei einem größeren Publikum reüssieren, muß man etwa die Gitarre zu Hilfe nehmen, sich aufs Liedermachen, Balladen-Singen werfen, oder aber man versucht, den umgekehrten Weg, einen höchst paradoxen, zu gehen: Man verschließt sich jeglicher „Mitteilung“ – in der Hoffnung, daß die Leute eben dadurch auf einen aufmerksam werden und daß sie anfangen, selbst dort noch nach der „Botschaft“ zu suchen, wo vielleicht gar keine ist. Für diese zweite Möglichkeit, Kommunikation erzwingen wollen durch radikalen Kommunikationsentzug, hat sich also Kling mit Vehemenz entschieden. Er gibt sich strikt hermetisch, er will als undurchdringlich schwierig erscheinen. Schwierig freilich nicht auf die alte Rilke-George-Art, vielmehr auf die neue des „ver-rückten Sprachinstallateurs“ (wie der Autor in der Vornotiz halb schief, halb zutreffend bezeichnet wird). Dabei läßt sich der Eindruck nicht abweisen, daß dieser die Sprache zerfetzende „Verweigerer“ doch eine im Grunde gesellige Ader haben muß. Nicht nur, daß er – wie zahlreiche Anspielungen verraten – Verkehr mit allerhand toten und lebenden Dichtern und Dichterinnen unterhält – von Hölderlin, Trakl, Benn bis zu Jandl und Mayröcker. Er widmet auch viele Gedichte diversen Bekannten und Freunden. Kurz, offenbar haben wir es mit einer partiell geradezu kontaktfreudigen Natur zu tun. Nur – der Leser soll davon augenscheinlich nicht profitieren. Er soll sich bei der Lektüre schinden und quälen. Ästhetische Vergnügungen wie musikalischer Rhythmus, phonetischer Reiz, Sinnlichkeit der Bildersprache, alles, was Heine einst den „Naturlaut“ der Lyrik nannte, was Roland Barthes kürzlich noch als „Lust am Text“ beschwor – Kling gönnt es dem „Rezipienten“ nicht. Ja, das Ohr scheint für dieses allerneueste deutsche Suhrkamp-Genie überhaupt nicht zu existieren. Freilich – wie schon angedeutet – es gibt heute allerlei massive Gründe prinzipieller und objektiver Art, die einen Dichter veranlassen können, in der rücksichtslosen, verstörenden Weise zu „dichten“, wie Kling es sich vorgenommen hat. Der „Geschmack“, den dieser mit der dezidiert unmusischen „Poetik“ seiner Anti-Verse „verstärken“ will, ist der bekannte, bittere unserer Epoche. Die Schrecken, um deren sprachlich konzentrierte Darstellung es dem Autor geht, sind die offenbaren und die verborgenen der heutigen großen und kleinen Geschichte. Kling verfolgt sie bis in die scheinbar idyllischen Nischen unseres Alltagslebens hinein. Dieses ist für ihn ebenfalls durch die allesdurchdringende Atmosphäre des Katastrophalen gekennzeichnet. Keine Frage, daß sich King, dem äußeren Anschein zum Trotz, nicht als „Sprachspieler“ begreift, sondern als „Realist“. Auffallend, daß er, bei aller Extravaganz der poetischen Strukturen, fast immer von höchst konkreten Gegenständen und Anlässen ausgeht. In der Nachfolge Baudelaires und Benjamins dürfte er sich als lyrischen Großstadtdichter sehen, als jemanden also, der die Sprache zerstören muß, weil die Wirklichkeit zerstört ist, der dem Leser Schocks zumutet, weil der modernen Sensibilität auch sonst unentwegt Schocks versetzt werden Die Gefahr allgemeiner Abstumpfung, erzeugt durch das Übermaß solcher Schocks, soll durch Dichtung abgewendet oder vermindert werden.
Dieser ästhetische Ansatz, respektabel, aber auch widersprüchlich, weil er das Risiko der bloßen „Verdoppelung“ des Schreckens eingeht, wird von Kling in einigen Gedichten von bizarrer, grotesker Faszination überzeugend verwirklicht. Zu den in diesem Sinn gelungenen Arbeiten, die übrigens die Nähe dieser Lyrik zur Satire und Polemik beweisen, zählen etwa die präzis treffende „Düsseldorfer Kölemik“, der sarkastische „Brief“ von einem Besuch in der Eifel, das lässig-aggressive „Geschreberte Idyll“. Vor allem gehören dahin die Zeilen mit dem Titel „Terraingewinne“, ein Gedicht, das die verbreitete obszöne Indifferenz beschwört, für die selbst Kriegsgreuel zu einem Teil des Medienspektakels, der „Guckkastenbühne für zwanzig Uhr/MEZ“ geworden sind. Kling, der mit solchen Gedichten künstlerische Stärke und Mut zur rigorosen Aussage demonstriert, verrät allzu oft aber leider auch eine gravierende Schwäche, nämlich die, sich ähnlich einem Manieristen des Barocks in tolldreiste, abseitige Einfälle zu verrennen, abenteuerliche Gebilde „arcimboldierischer“ Art (dies sein eigener Ausdruck) zu fabrizieren. Im Widerspruch zu seinem Thema und seiner Tendenz kann Kling dann plötzlich unangemessen selbstzufrieden, kunstgewerblich und kleinmeisterlich erscheinen, und wo er Sprachunarten der kleinen Leute phonetisch nachzuahmen sucht, gleitet er unversehens geradezu ins Provinzielle ab.
Die vorliegende Talentprobe eines „Anfängers“ läßt so bereits Züge einer künstlerischen Sackgasse (mit einigen interessanten Ausblicken) erkennen. Hier ist ein Autor erstmals hervorgetreten, der in einem spezifischen Sinn schon am „Ende“ angelangt scheint. Man kann deshalb gespannt sein, wie es Thomas Kling anstellen wird, den nächsten Schritt zu tun. Dieser müßte, soll er produktiv sein, nach besagtem „Ende“ den wahren „Anfang“ bringen.
Franz Norbert Mennemeier, 1990, aus Franz Norbert Mennemeier: Spiegelungen. Literaturkritik 1998–1958. 40 Jahre Neues Rheinland. Rhein・Eifel・Mosel-Verlag, 1998
Gegen die „dichterzombies“
Momentaufnahmen werden scheinbar zusammenhanglos synchrongeschaltet, dabei die Wahrnehmung auf Randbereiche gelenkt bzw. diese Ränder fokussiert. In „Geschrebertes Idyll“ (geschmacksverstärker, S. 33/34) bildet eine Gartenparty, bei der zunächst „unerbittlich / urlaubsdias durchgejagt wurden, die Folie, auf der die Privatphantasmen („mit kettschuppfingern mit / karacho in irgendeinen feuchten neilon- / slip“), Kriegskameradennostalgie („rührseligkeitn! männertreu! mein lieber herr gesanxverein“) und Spießerallüren sich zuletzt zu einem Kollektivbesäufnis steigern: „da draußen weiter horrorvideo; g / gröhltes faßbier undundund, wildschwäne- rausch / aus allermund, dem schwulenwitzchen folgen (…) WER / HAT DAS GHETTO BOMBARDIERT?“, das dann allerdings nicht unamüsant wieder auseinander geht:
vor schluß die
stachelbeeren vorgereihert, („irgendzwie
nach haus geeiert…“)
Trotz dieser Sichtbarmachung latenter privater und öffentlicher Faschismen handelt es sich hier nicht primär um politische Gedichte im Sinne deutlicher Denunziation, auch wenn der Autor nicht vor Polemik oder klaren Positionen zurückschreckt. Beklemmender wirkt da jedenfalls jener globale Sarkasmus, mit dem der Lyriker einer aus den Fugen geratenen, widersinnigen Welt gegenübertritt:
UNSRE BELIEBTE KONVENTION
ELLE NAPALM- OPERETTE! INCLUDING
VÖLKERJACKPOT!
(„dochdoch, ganze arbeit“)
In demselben Gedicht („direktleitung“, S. 37–38) spricht sich Kling gegen die „dichterzombies“ aus:
rührendrührendrührend pflatscht
lehmanscher kompott in rilkes einmachgläser (…) schönge
strähntes sprachelchen im geibel-quast
Namen (nicht nur) der deutschen Literatur figurieren, positiv oder negativ konnotiert, neben Zeitungsmeldungen und Gesprächsfetzen: grundsätzlich ist alles zitierfähig, dann wird es kräftig durchgeschüttelt und rhythmisiert, herauskommt „unser sprachfraß echt junkfood, echt / verderbliche Ware“ (S.9).
Daß diese Gedichte, wie kaum etwas in diesem Jahrzehnt Gelesenes die Sprache der 80er, bald 90er sprechen, verdankt sich neben einem offensichtlich bewegten, an Erlebnissen reichen Leben einer äußersten Wachsamkeit der Sprache gegenüber, so wie einem genauen, sezierenden Blick auf die Wirklichkeit. Kurzweil kommt leicht in den Ruch von Trivialität, doch diese Gedichte setzen auch eine Unmenge an kulturellem und geistesgeschichtlichem Wissen voraus. Kling hat mit seinen beiden Bänden bewiesen, daß man sich nicht nur einer literarischen Tradition einverschrieben erklären, sondern diese sogar auf imponierende Weise fortschreiben kann.
Manfred Ratzenböck, Konzepte
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Eleonore Frey: Sprachwerkzeug
Neue Zürcher Zeitung, 14.4.1989
Jürgen Jacobs: Stellenweise Bestürzung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.6.1989
Hubert Winkels: Walkman? Über Kling und Koneffke
Die Zeit, 8.12.1989
Heinrich Vormweg: So geht die tichterey vonstattn
Süddeutsche Zeitung, 15./16.6.1991
Zungenentfernung
– Über sekundäre Oralität, Talk-master, TV-Trainer und Thomas Kling. –
(…)
Zungenentfernung
Auch der rheinische Dichter Thomas Kling ist weit davon entfernt, seine Dichtung aus dem Duktus und den Stereotypen der mündlichen Rede hervorgehen zu lassen. Doch bewegt er sich sehr bewußt im Interferenzbereich von Oralität und Schriftlichkeit. Seine Lesungen sind einzigartige Hörerlebnisse. Bevor noch die ersten Texte gedruckt waren, hatte er sich mit seinem ekstatischen Vortrag bereits ein Publikum geschaffen, das mit einem leichten Schaudern genoß, wie eine erkennbar subtil durchgeformte Sprachfügung in Brüllen und Flüstern, Exklamation und ,Anrede‘ zerrissen wurde.
Die ,Lesungen‘, anfänglich häufig im Umkreis von Präsentationen bildender Kunst inszeniert, sind extrem modulierte akustische Veräußerlichungen von Texten. Insofern sind sie den monoton-,maschinellen‘ Vortragsweisen, wie oben am Beispiel Thomas Hettches beschrieben, entgegengesetzt. Mit dem monotonen teilt der ekstatische Vortrag allerdings die entschiedene Vermeidung jeder Kundgabe individueller innerer Befindlichkeit. Kling macht sich eher zu einer Art ,Tonverstärker‘ der in seinen schriftlichen Texten komprimierten Oratität. Er gibt kein Ich in der Stimmführung zu erkennen, sondern überführt den grafisch strikt organisierten Text in einen komplexen Hörraum. Auch dies ist ein Grund für die extremen Schwankungen in den Modi der Artikulation: Sie lassen den Eindruck eines kontinuierlichen Sprechens, das auf einen Sprecher verwiese, erst gar nicht entstehen.
Wie zeigt sich die ,komprimierte Oralität‘ in der Gedichtschrift selbst? Das auffälligste Merkmal ist zunächst eine beschränkt eingesetzte ,phonetische Schreibweise‘. Vor allem der häufig fehlende Vokal ,e‘ in der Endung von Infinitiv-Formen und bei Pluralbildungen auf ,en‘ und verschiedene Zusammenziehungen von Worten und Wortteilen (Agglutinationen) wie ,ausm‘, ,drumrum‘, ,wisi‘ usw.
Um einen Eindruck von dem Verfahren zu geben, hier die drei Strophen eines Gedichts aus dem (wie in den meisten Fällen thematisch kohärenten) Kapitel ,autopilot‘ des Bandes nacht. sicht. gerät.:
löschblatt, bijlmermeer
1
geschwindigkeit.
höhe.
kurs.
steign.
falln.
uhrzeit.
2
kerosin. ke-, kehlenaas: lädierte
aufzeichnungen im koffer; rachnaas. Kni-
sterndes, gänzlich gestörtes felsbild.
lädierte köpfe ausm koffer; ursprünglich
rot. signalrot, dass mans findet. ein
zirpn kofferförmiger stimm aus ein klein
braun koffer: zu undeutlich gewordner
stimmtresor. felsbilder, ja, ausm koffer.
inmittn ein drumrum versteckter
unwahrscheinlichkeits-brikett; schlafende
bilder nur ruhiger russ. grad mal briketts,
in schattnkrümmun’ menschnbriketts. immer
3
immer schriebe ich, sagt sie, kritzelkritzel,
schrieb ich über kriege. felsbildläsionen, ja.
löschblätter di augn, augenruss übers schollen-
gelände, ja. franklins expedition di ins
feuer muss. ein zirpn? kein zirpendes abhebn
mehr; ein auskunfts-löschlösch: art felsbild,
gründlich gelöscht, ein stilles fest für
gegenstandsfotografn, für dern abflug.
rot. eines koffers ankunft.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawi di kamera
zwitschert!, wisi singt!
und siedeln in der luft.
Grundsätzlich kann im Klinggedicht jede schriftsprachliche Normgestalt auf solche und ähnliche Weise verstümmelt werden. Dieses im zitierten Text eher spärlich eingesetzte Mittel hat einen durchschlagenden Effekt: Der Leser traut seinen Augen nicht. Die gewohnte Zuordnung von Bedeutung und alphabetischem Code funktioniert nicht reibungslos, Dies nicht etwa deshalb, weil die Signifikation überkomplex wäre, also zu viele Bedeutungselemente gleichzeitig evozierte, sondern weil die bloße Form der Anordnung von vertrauten Signifikanten der unmittelbaren intellektuellen Schematisierung Widerstand bietet.
Es stellt sich für einen Augenblick ein befremdender Effekt wie bei der Lektüre einer nur schwach vertrauten alphabetischen Fremdsprache ein, nennen wir ihn mit einem Kling’schen Ausdruck ,brennstabm-Effekt‘. Doch sobald man den Text laut und zusammenhängend spricht oder in einem inneren Vorstellungsakt das Sprechen repräsentiert, schliessen sich die diversen Sinn- und Assoziationskontexte zusammen und klären so auch häufig die Bedeutung der rätselhaften Ausdrücke. Zum Beispiel das Wort ,rachnaas‘: lesend ausgesprochen taucht das eskamotierte e des Wortes ,rachen‘ sofort wieder auf, auch wenn es in der Lautgestalt gar nicht deutlich erklingt, da ein Endungs-e beim Sprechen häufig zwischen den Konsonanten verschliffen wird. Aber selbst als ,verschluckter‘ Buchstabe realisiert es der laut Lesende im Moment.
Ich will damit hervorheben, daß das (innere oder äußere) Sprechen zur sofortigen Ergänzung der typographischen Verkürzung tendiert. Deshalb kommt es auch beim Zuhören einer Kling-Lesung gar nicht erst zu solchen Erschließungsanstrengungen wie gelegentlich beim stillen Lesen; selbst dann nicht, wenn der Vortragende dem Text getreu folgend das ,e‘ gekonnt nicht ausspricht.
Die Gedichte fordern die mündliche Rede heraus, nicht die Gegenrede in einem imaginären dialogischen Akt, sondern die monologische Rede des Lesers, der eine in den Gedichten eingeschlossene wesentliche Potenz so erst freisetzt. Gesprochen erst sind sie erfüllt. Deshalb gilt für den Dichter Kling die poetische Aussage Papenfuß-Goreks „ich schreibe so laut ich kann“, anders als für diesen selbst, tatsächlich. Den Einband seines frühen Gedichtbandes erprobung herzstärkender mittel ziert denn auch wie eine Ankündigung alles Folgenden die ironische Gattungsbezeichnung: ,KLINGGEDICHTE‘.
Schon auf den ersten Blick (und Ton) zeigt sich also hier eine ganz besondere Öffnung des abgeschlossenen Raumes der Schrift, in dem sich moderne Lyrik in ihrer stark binnenorientierten Komplexität und Reflexivität stabil eingerichtet hat. Eine Öffnung jedoch, die gerade nicht hin zu einer traditionellen rhythmisch und melodisch verbindenden Mündlichkeit führt, wie sie sich in Balladen, politischen Liedern oder Rap-Sprechgesängen zeigt, von denen sich ja auch sagen ließe, daß sie ausgesprochen (gesungen) erst wirklich (wirksam) sind; sondern im Gegenteil: eine Öffnung geradezu gegen den ,Populismus‘ der Mündlichkeit; eine Öffnung zur Oralität – allerdings, und das ist entscheidend, bei voller Wahrung der schriftgeprägten formalen Kapazität moderner Lyrik.
Zu dieser Kapazität gehört ganz unbedingt auch die Reflexivität des Gedichts; und zwar in der Art einer formalen Selbstthematisierung, die bezeugt, daß das lyrische Sprechen sich als Ort einer Kommunikationsstörung weiß, in der die sprachliche Weltkonstitution ihrer Routinen beraubt wird. Was so verallgemeinert wie ein poetologischer Gemeinplatz klingt, wird bei Thomas Kling selbst zugleich Ereignis und Metapher. Das Gedicht löst sich von der Repräsentation erlesener Erkenntnis und baut sich scheinbar beiläufig (metonymisch) entlang konkreter Einzelheiten auf, um dann doch so etwas wie ein darstellendes Organ geworden zu sein (Sprechorgan, Zunge, nur schwer im Zaum zu halten von der Aufgabe, Bedeutung zu kommunizieren; delirierend, plappernd, dabei sich verdichtend, schließlich auf befremdliche Weise wahr-sagend).
„löschblatt, bijmelmeer“: geschwindigkeit. höhe. kurs. steign. falln. uhrzeit., das wären die Parameter, nach denen die Daten einer Flugbewegung aufzuschlüsseln sind, vom Lotsen im Tower, vom Auswerter eines Flugschreibers? Zu dieser Hypothese gibt der Name „bijlmermeer“ Anlaß, sofern der Leser sich erinnert, daß dieser Vorort Amsterdams Schauplatz einer der größten Flugzeugkatastrophen der Geschichte war. Um die Aufzeichnungen eines Fluges, um den „stimmtresor“, den „koffer“, die „stimm aus ein klein braun koffer“ baut sich die zweite Strophe auf. Stimme und Koffer, die Chiffren der Aufzeichnung, sind beschädigt ebenso wie die Menschenkörper: „lädierte köpfe“ und „menschnbriketts“.
Diese Beschädigung bleibt der Sprache nicht äusserlich, sie geht in ihre zerhackte Form ein: „kerosin. ke-, kehlenaas“: Die kurze Sequenz beinhaltet schon den ganzen Übergang vom Flugzeugabsturz über die Zerstörung hin zur (sogar thematisierten) Verzerrung des Sprechens selbst, der das Grundmuster dieser zweiten Strophe bildet. Doch das Ineinander von szenischer und Sprech-Zerstörung wird seinerseits gestört durch eine neue Perspektive: Das „felsbild“ kündigt sie an; der Aufschwung auf die Metaebene der „schlafende(n) bilder“ stabilisiert sie; die durch Leerstellen indizierte Pause und die extreme Wahrnehmungsdistanz, die sich in den folgenden, fast zynisch anmutenden Wendungen wie „ruhiger russ. grad mal briketts“ eröffnet, führt das ganze Gedicht in eine andere Zone. Der extreme Zeilensprung hinein in eine neue Strophe macht diesen Wechsel schließlich auch graphisch deutlich.
Der Ausdruck „felsbild“ stellt dabei die Frage nach der Art der Wahrnehmung oder besser noch: Speicherung der Wahrnehmung im Gedächtnis, Die lädierte Aufzeichnungsform, um die sich die zweite Strophe dreht, wird mittels eines vereinzelten Ausdrucks in den Zusammenhang mit der ältesten menschlichen Aufzeichnungsform überhaupt gestellt. Das Gedächtnis operiert nicht linear und kausal, sondern, unterm Schock der „Läsionen“, weiträumig assoziierend.
Anders als bei Klings Kollegen Durs Grünbein, der auf Gottfried Benns Spuren die archaische Natur- und Menschengeschichte mit der Gegenwart in einem Kontinuum verbindet, blitzt das archaische Element bei Kling (durchaus häufig) nur kurz hinein ins Gedicht. Ein ähnlicher Kurzschluß zwingt in der dritten Strophe den Seefahrer und Polarforscher John FrankIin statt ins ewige Eis, in dem seine letzte Expedition scheiterte, ins Feuer aeronautischer Gegenwart. Auch von Franklins letzter Mission fand man wie vom abgestürzten Düsenflugzeug in Bijmelmeer Überreste und schriftliche Aufzeichnungen. Das Gedicht hat hier bereits seinen Übergang auf eine neue Ebene gemacht: Die Frage nach der Aufzeichnungsform, nach Bild und Gedächtnis und dem Schreiben selbst steht im Vordergrund.
Kursiv gesetzt bildet die indirekte Rede einer weiblichen Person die Eröffnung der dritten Strophe. Im lautverwandten Ausdruck „kritzelkritzel“, der distanzlosen, onomatopoetischen Comicsprache entlehnt, wird das Gewicht des Begriffs „kriege“ (seinerseits einen Binnenreim mit „schriebe“ bildend) ironisch konterkariert; kritzelkritzel – kriege: eine metonymische Operation, die auf den Zusammenhang von Graphismus und Zerstörung hinweist, den der Ausdruck „felsbildläsionen“ verdichtet. „felsbildläsionen, ja. / löschblätter di augn“.
Der Semantik dieser umlautgeprägten Kombination von Ausdrücken kann man die Antwort auf die implizite Frage nach dem Verhältnis von Krieg und Schreiben denn auch entnehmen: Der Sphäre konkreter Zerstückelung von dinglichen und menschlichen Körpern, von technischem Speicher (Aufzeichnungsgerät) und poetischer Sprache, welche (selbst zerstückelt) Einzelbilder heraufbeschwört (zweite Strophe), wird hier die Vorstellung einer Zerstörung am Ursprung aller menschlichen Aufzeichnung unterlegt: Schon das Felsbild, früheste Form graphischer Repräsentation, ist durch eine Funktionsverletzung gekennzeichnet; eine Verletzung, die der bildhaften Repräsentation selbst wesentlich zukommt („felsbildläsionen“): Die (graphische) Repräsentation ist konstitutiv von einem (schmerzlichen) Mangel (Funktionsstörung) gekennzeichnet, in dessen Folge Kriege sich auch historisch auf Kritzeln (stab)reimen.
Das solcherart tiefenstrukturell ableitbare graphische Bildgedächtnis des Menschen prägt noch jede neue Wahrnehmung, indem die alten Spuren die neuen Konturen binden und zu einem Bestandteil eines verzweigten Palimpsestes machen. Diesen Zusammenhang verdichtet der Ausdruck „löschblatt“, als Metapher für das Gedächtnis und Paradigma für das Palimpsest gleichermaßen geläufig. „löschblätter die augn“ – der visuell geprägte Dichter leistet diese Schichtung im Akt der (Darstellung der) Wahrnehmung, Die befremdliche Kette, die das Felsbild, die (Aufzeichnungen der) Franklin Expedition, den Flugzeugabsturz (Flugschreiberauskunft) und das (Kriegs-)„kritzelkritzel“ des Dichters verknüpft, erweist sich in der rekursiven dritten Strophe des Gedichts als angewandtes Modell einer nichtlinearen, reflexiven graphisch geprägten (poetischen) Praxis.
In den Schlußversen dann eine ambivalente Wendung zu den „gegenstandsfotografn“, denen der „abflug“ möglich ist angesichts der Absturzes. Ist ihre Wahrnehmung nicht (oder nicht mehr) beschwert mit der Graphik der Verletzung, der eine Verletzung des Graphismus schlechthin zugrundeliegt? Hat sich der Dichter selbst der Gedächtnisschwere im Blick entledigt? Oder verweist er in imitierter zynisch-lockerer Gebärde auf die Unbeschwertheit („stilles fest“, „abflug“, „zwitschert“) einer Aufnahmetechnik, der das (graphische) Tiefengedächtnis nicht länger den Blick führt? Die Kamera, derart befreit, erzeugte also Bilder, die „siedeln in der luft“?; eben dort also, wo der Gegenstand, das Flugzeug (zerstört) gerade nicht ist? Die technische Aufzeichnung der Absturztrümmer, die auch Aufzeichnungstrümmer sind, als Abheben von der Erde in einen luftigen Bilderraum, der zu einem lustigen akustischen Raum wird, in dem es zwitschert und singt?
Überdeutlich gesagt: Am Ende steht die sarkastisch getönte Mimikry an den objektiven Zynismus einer Aufzeichnung, die Störung und Zerstörung verwandelt in ein seliges Ätherrauschen. Das „kritzelkritzel“ des Krieges wäre abgelöst durch ein optisch-akustisches Wolkenkuckucksheim. Entschwunden, losgelöst von der Erde, eben dort, wo der Mensch zur Erde niedergestürzt ist; entschwunden, nicht zu fassen. Eben dies faßt das Gedicht. Mit seinen ureigensten Mitteln. Dazu gehört in diesem Fall die extreme Spannung zwischen den „öffnenden“ oralen Formelementen des Gedichts und seiner graphisch geprägten reflexiven Struktur.
Klings Gedichte kann man nicht lesen, ohne sie zu hören. Was hier umständlich zu explizieren war, kann beim Zuhören in einem spontanen intuitiv-assoziativen Akt erfaßt werden. Es wäre dies aber ein Hören, das sich von den auswendigen Formeln einer sekundären oralen Kultur gelöst haben müßte. Es wäre ein Hören, das sich buchstäblich von den literarischen Traditionen der reflexiven Moderne herschriebe; ein schreibend und lesend eingeübtes Hören.
Klings Gedichte kann man nicht hören, ohne sie zu lesen. Die Spannung im Zusammenspiel von Oralität und Literalität ist in ihnen zu einer genuin neuen Form gesteigert. So fassen sie, indem sie das Sprechen zur immer schon „beschädigten“ Schrift verhalten, auf ihre exzentrische Weise zusammen, was unter den jetzigen Medienbedingungen gänzlich auseinanderzudriften droht: Literatur und inszenierte Medienmündlichkeit. Und davon sprechen sie auch, immer wieder:
DRIFT
schnittwundn abschiede schnitt:
und starr aufs test-, aufs textbilt
gestarrt. bildtest wiederum ausge-
falln. so passiert zungenentfernung.
märzmorgende fiepend; diarien ab-
geflämmt, verflogene stundnbücher.
ein aufgehn in rauch, in schaum. zei-
len di sich hervorschiem, -zwängn etwas
wi „ausgetriebene engeldämonen“: DAS REI-
NE WOHNZIMMER-VOODOO, in einzel in bilt
in einzelbildschaltung; di ganzn bildver-
einzelungen!
aaaaaaaaaaakontinente in zungenentfernung. wir
driftn auseinander. so.
Hubert Winkels, Schreibheft, Heft 47, Mai 1996
Andenken
Thomas Kling lernte ich 2000 in Berlin kennen. Ich schrieb gerade eine Seminararbeit über „Die Modefarben 1914“ und wagte es darum, ihn nach einer Veranstaltung anzusprechen. Wir gingen zum Italiener, aßen, tranken, ich sagte etwas zu den „Modefarben“, den Rest der Konversation bestritt er zumindest hieß es in seiner ersten Mail an mich „ausufernde gespräche – meine schuld“.
Und meine Freude. Ich machte mir keine Notizen hinterher, wie ich mir bei den folgenden Treffen auch keine Notizen machte, was ich heute bereue und auch gar nicht verstehe. Nichts hätte ich dagegen gehabt, Klings Eckermann zu sein.
Aber vielleicht wäre es für Außenstehende auch gar nicht so interessant gewesen, was wir sprachen. Ich wurde viel unterrichtet, staunen und lachen gemacht. Von den vielen Geschichten und Anekdoten, die Thomas mir gesprächsweise erzählte, habe ich aber wohl leider die meisten vergessen. Eine aber, die er mir an diesem ersten Abend erzählte, blieb mir im Gedächtnis. Sie handelte von H.C. Artmann. Ich kannte diesen großen Dichter damals noch gar nicht, Thomas’ Rede aber war von solchem Eifer, dass sich mir der Name sofort einprägte. Einsam sei Artmann am Ende gewesen. Kling erzählte wie er eines Nachmittags zusammen mit ihm auf der Raketenstation saß und Artmann über die Einsamkeit klagte, offenen Hemdes und mit der Brust eines 20jährigen. Und wie er aufgefordert wurde, zu rezitieren, und im Rezitieren sich verwandelte in einen Halbstarken der 50er Jahre (Thomas liegt der Vergleich auf der Zunge, aber wir kommen erst Tage später auf den Namen Horst Buchholz).
Der andere große, im selben Jahr wie Artmann, kurz vor unserer ersten Begegnung gestorben und für Kling vielleicht ebenso wichtige Dichterfreund war Ernst Jandl. Kling erzählte, wie er mit Friederike Mayröcker noch einmal Jandls Wohnung aufgesucht hatte und sie mit Aufklebern übersät fand, auf denen stand: „Wiener Nationalbibliothek“. „Ein typischer Fall österreichischer Nekrophilie.“ Thomas nahm Jandls Pfeife, den kitschigen Kaffeebecher, aus dem der Verstorbene immer getrunken hatte und den Bleistift, der noch auf seinem Schreibtisch lag, als Andenken an sich. Auch Jandl habe geklagt, so Thomas, am Ende allein dazustehen, keine „Schule“ begründet zu haben.
Im Tod ist jeder allein, sagt man. Doch allein sind vor allem die, die zurückbleiben. Ein paar Andenken, Anekdoten, ein paar hundert e-Mails können darüber nicht hinwegtäuschen.
Tobias Lehmkuhl
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest „Oh Nacht“ [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Hommage + Symposion +
DAS&D + Dissertation + KLG + IMDb + PIA + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


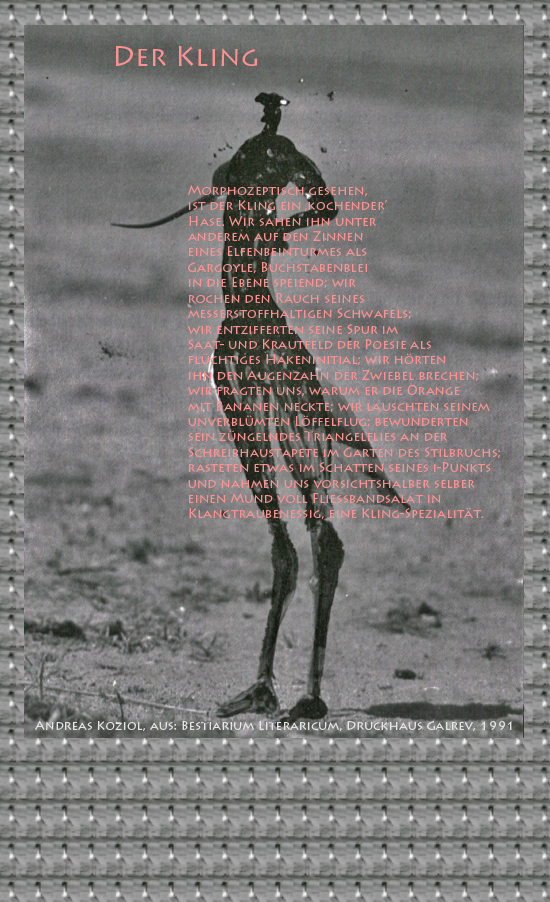












Schreibe einen Kommentar