Thomas Kling und Ute Langanky: GELÄNDE camouflage
GELÄNDE
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafuror und vedute
I
die rosnsohlen die zu glimmen beginnen. die eben
noch glimmenden fußsohlen, das schmal deutlich
von faltn herleuchtende, von unterseitn der zehen
her fünffach zehnfach aufleuchtetende, das
aaaaaschweifnde
beginnende vorübergescheuchte feuer: rosiger finger.
das feuer in ruhe. das hergebrachte das menschheits-
mitbringsel: zufallsprodukt des brennenden astes.
die feuergehärtete keule, lichtwaffe. der blick-
vernichtende bohrer des odysseus der den augapfel,
in drehung, verdampfn läßt des feindes. in blitz-
artiger rammbewegung raumgreifend ausgeführt.
die rosensohlen die zu glimmen beginnen.
Wolkenstein. Mobilisierun’
− Thomas Kling / Ute Langanky. −
Der Dichter und die Künstlerin leben unter einer Anschrift, die zu genau ist, um erfunden zu sein: „Raketenstation Hombroich 1995/96“ lautet die erste Eintragung in dem schmalen Band mit einem Gedicht von Thomas Kling und vierundzwanzig Fotos von Ute Langanky. Gelände heißt er. ,Gelände‘, das war vorzeiten ein auch juristisch klar umrissener Ausdruck, der auf Lehen bezogen war. Heute ist es ein vager topologischer Ausdruck. Er bezeichnet eine weitgehend unmarkierte Fläche, eine Fläche mit Chaosanteil, sei es, daß der Raum in keinem Ordnungskonzept aufgeht, sei es, daß wir nicht wissen, was sich dort zuträgt. In diesem Sinne haben wir früher von Raketengelände gesprochen. Früher, als die Engländer noch ihre Mittelstreckenraketen dort stationiert hatten, mitten im freien Feld am südlichen Niederrhein, in der Nähe von Neuss. Früher, zu Beginn der achtziger Jahre, als wir dort vor den Kasernentoren gegen die Nato-Rüstungspolitik demonstrierten. Auf diesem, inzwischen aufgelassenen militärischen Gelände leben der Dichter und die Künstlerin. Sie haben den Ort zum ihrem Arbeitsort gemacht und jetzt auch zum Gegenstand ihrer Schreib- und Photoarbeit.
Der Ort hat etwas Magisches, etwas zugleich Unheimliches, also Gestalt- und Namenloses, und etwas äußerst Präzises, man könnte sagen: Überreales. Beides findet sich in der Gemeinschaftsarbeit Gelände. Das Verhältnis von Namenlosigkeit und extremer, buchstäblicher technologischer Genauigkeit bildet ihren Kern. Es ist keine Illustration meiner ästhetischen Erfahrung mit dem Buch, sondern ihr Untergrund, wenn ich mich erinnere, wie ich hinten im Familienauto an jenem abgesperrten, dem Leben entzogenen Gelände vorbeifuhr, und sich plötzlich ein aufgeschütteter Erdhügel auftat. Eine große runde Platte fuhr in die Senkrechte, und dahinter richtete sich der schlanke Leib einer Rakete auf, langsam und gleichmäßig fuhr sie empor. In meiner Erinnerung glänzend wie Gold und Silber in der Sonne. Ein Anblick, so losgelöst, daß keine Erzählung ihn einholen konnte. Und so verschwand er wieder.
Und taucht jetzt beim Betrachten der Photos von Ute Langanky verwandelt wieder auf. Photos, am selben Ort entstanden, die mit dem überscharfen Kontrast von dunklem Gelände und einem von Sonnenlicht zur Explosion getriebenen technischem Artefakt arbeiten. Zunächst sehen wir wie eine Schatteninstallation einen langgestreckten schwarzen Gebäudeblock, aus dem ein Turm – ein Lichtpunkt sagt uns: Wachturm – herausragt wie eine massige Säule mit dorischem Kapitel, das den Nachthimmel trägt. Ein technisches Landschaftsimplantat ebenso wie eine antike Ruine. Vor einem abendlichen, am Horizont dunkelrot glühenden Himmel aufragend. Das nächste Photo radikalisiert den Kontrast. Der Turm ist fast vom Schwarz verschluckt, aber die Sonne hat sich in ein großes goldenes glühendes Rechteck verwandelt, das exakt aus der Mitte des Bildes strahlt. Ein längsgestreiftes Rechteck, metallen offenbar, das in seinem unwirklichen Leuchten den Rest der Welt ins Dunkel schickt. Ein technischer Gegenstand, zum Bersten aufgeladen mit Energie. Regelmäßig geformt, fremd, ein Heiligtum von Ingenieurshand und Sonnenlicht.
Auf den folgenden Photos wird die Streifenstruktur des Gebildes näher herangeholt bis sie an die magischen Streifen Barnett Newmans erinnern. Dann öffnet sich der Photozyklus, gibt größere Ausschnitte und andere Details der Raketenstation preis, meist in Spiegelungen und Brechungen, und Himmel und Landschaft werden sichtbar und helfen der Orientierung.
Sein Gedicht Gelände, das zweizeilig pro Seite die Fotos trennt (oder verbindet) eröffnet Thomas Kling mit dem mottoartig gesetzten Ausdruck „furor und vedute“, der eben den Gegensatz zwischen explosiver Intensität und sacht geöffnetem Landschafts-, oder sagen wir besser: Geländeraum benennt. Das Gedicht zieht gelassen Linien von „rosnsohlen die zu glimmen beginnen“ über „vorübergescheuchte feuer“ zu „rosiger finger“, es zitiert Homers Morgenröte, den Raub des Feuers durch Prometheus und Polyphems Blendung mit „feuergehärteter keule, lichtwaffe. der blickvernichtende bohrer des Odysseus der den augapfel, in drehung, verdampfen läßt des feindes“. Und knüpft so die kaum versunkene Schicht der technischen Gewalt, die dieser Ort in sich trägt, mit einer Zivilisationsgeschichte, die auch eine der Medien ist, zum Beispiel der Fotografie selbst:
der feuerwände eleganz. verführung, bollwerk, camouflage.
geschleiftes blickn. das, augnfang, die netzhaut rüber-
zieht mit ostlicht westlicht, frühwarnzeitn. belichtungs-
messer, das den einstich führt auf blendende verblendete
betonfassaden in gläsernem gelände…
Gelände ist bereits die dritte Gemeinschaftsarbeit von Ute Langanky und Thomas Kling, nach wände machn von 1994 und einer großformatigen Mappe wolkenstein. mobilisierun’ von 1997.
(…)
in Schauplatz in Don DeLillos jüngstem Roman Unterwelt ist ein Friedhof für B52-Bomber in der Wüste von Arizona. Eine Gruppe von Künstlern verwandelt diesen Ort des sistierten, des abgesunkenen Grauens in ein Stück farbiger land-art. Ein schweres Hoffnungszeichen. Auf der Raketenstation arbeiten Kling/Langanky an einer vergleichbaren Verwandlung. Sie tun es übrigens im losen Verbund mit anderen Künstlern. Nicht nur ist das Gelände der Raketenstation in Künstlerhand, auch die Insel Hombroich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gelände, und organisatorisch mit ihm verknüpft, jene rekonstruierten Erftauen, die von zeitgenössischer Architektur und Kunst aller Zeiten und Länder durchsetzt sind, erzählen von den Metamorphosen der Gewaltgeschichte durch die Kunst.
Hubert Winkels, Deutschlandfunk, 2.10.1998
Kling und Langanky
– Kunst auf der Raketenstation. –
Es gibt magische Orte. Jeder Einzelne kennt sie. Orte, die erlebte Zeit in sich tragen, Zeit, die abgesunken ist und wiedererstanden in Gestalt eines Schicksalszeichens, heimatlich, unheimlich, fremd vor Nähe.
Es gibt magische Orte für eine ganze Kultur. Der Reiseschriftsteller Bruce Chatwin erzählt von australischen Aborigines, die sich zur Verblüffung der Konsumenten immer wieder an dieselbe Stelle in einem Supermarkt auf den Boden setzen und singen. Hier, wo Büchsencola und Hundefutter gestapelt stehen, ist einer der Knotenpunkte im Liniengeflecht der Erde, dem die Ureinwohner jahrhundertelang folgten. Sie folgen singend den Linien ihrer Erde. Das ist ihr Gebet, ihre Kunst, ihre Selbstvergewisserung. Uns Modernen ist das Hekuba.
Wir lösen uns von den schweren Orten, weil wir leicht dahinzufliegen begehren, von Ort zu Ort, von Bedeutung zu Bedeutung. Wir wollen nicht hören, wie es einrastet und uns gefangen nimmt. Die alten Kathedralen richten wir zu Archiven her, in denen die Bestandteile eines alten Kultes bestaunt werden. Die neuen Orte, die wir für unsere Gegenwärtigkeit reservieren, sind nach einem Ausdruck des französischen Philosophen Marc Auge Nicht-Orte. In ihnen kommen wir niemals an, wir durchqueren sie nur. Flughäfen, Schalterhallen, Einkaufs- und Vergnügungszentren. Dass sie keine Geschichte haben, entlastet und euphorisiert uns, und es macht uns Atemnot zugleich.
Gegen Kurzatmigkeit und Atemnot suchen wir uns zu wehren durch die Kunst. Sie bekommt die Aufgabe übertragen, Orte zu erzeugen, an denen die Zeit innehält. Kunstwerke in diesem Sinne sind Zeitspeicher. Sie schlagen sich selber vor als Objekte der Sehnsucht nach erfüllter Zeit. Sie betreiben ein Kompensationsgeschäft, suchen zu entschädigen für den Schmerz, den uns die Furien des Verschwindens beibringen.
Ute Langanky und Thomas Kling sind Künstler, die an solchen Zeitspeichern arbeiten. Auf ganz besondere Weise. Eine der Besonderheiten bildet dabei der Ort, an dem sie leben und tätig sind. Sie haben ihn gewissermaßen umkreist, indem sie von Haan und Bingen nach Düsseldorf erst, dann nach Köln wechselten, um sich schließlich in einer Mitte niederzulassen, die aus lauter Rändern besteht. In der Raketenstation Hombroich endet eine militärische Geschichte, hier endet ein Siedlungsraum und der Raum einer integralen Architektur. Nichts ist dort fertig und nichts ist ruinenhafter Verfall, ein Raum ohne volle Gegenwart, aber auch ohne saugende Nostalgie: ein Halbfertigprodukt als Lebens- und Arbeitsraum. Die Künstler leben in dem Raum, den sie künstlerisch erforschen. Das erinnert an Ethnologen, die Teil werden des Volksstammes, den sie untersuchen. Oder an Archäologen, die an der Stätte der Grabungen ihr Leben ausbreiten.
Durch eine wundersame Fügung gehören die inzwischen reiseführernotorische Kunstinsel Hombroich und das Raketenareal zusammen. Beide, die Insel Hombroich und die Raketenstation, bieten zwei herausragende Beispiele für die Arbeit der Kunst mit der Zeit. In den rekonstruierten Erftauen zwischen Holzheim und Kapellen finden wir ein Ensemble von Kunst- und architektonischen Zeichen, das uns in alle Richtungen umschließt. In seinem Eklektizismus greift es aus in viele Weltkulturen und Zeiten von alten chinesischen Statuetten über die Skulpturen der Khmer bis hin zu den Farbpolstern von Gotthard Graubner und den Bauplastiken von Erwin Heerich. Die Objekte sollen ihre Intensität kommentarlos, kraft ihrer Eigenstrahlung entfalten, so wie der ganze Raum in seiner inszeniert naiven Kunsthaltigkeit uns als ein Arkadien zweiter Ordnung, als ein ursprünglicher Landschaftsleib aus Natur und Kunst umschließen soll.
Kaum einen Kilometer entfernt dagegen ein Ort, der mit seiner martialischen Bezeichnung „Raketenstation“ eine ganz andere Ordnung evoziert. Nähern wir uns diesem Ort zunächst nicht über seine Geschichte, sondern ganz anschaulich und konkret. Zunächst wird man, kommt man vom Insel-Arkadien herüber, von einer Bahnschranke aufgehalten. Wenn man Glück hat, antwortet auf den Ruf in eine Fernsprechsäule eine rostig klingende Stimme und kündigt das Heben der Schranke an. Das kann dauern. Es war ein heißer Sonntag in diesem Sommer, als ich Ute Langanky und Thomas Kling in der Raketenstation besuchte. Gewohnt im öffentlichen Verkehr an ein promptes Reagieren des Adressaten, gerate ich nach fünf Minuten Warten aus der Fassung. Kein Zug kommt vorbei, kein Mensch ist zu sehen, nur das Dach eines Turmes jenseits der hohen Weizenfelder, die sich hinter der Schranke ausbreiten. Es dauert noch eine Weile, bis die Ungeduld umschlägt in ein Gefühl der Gleichgültigkeit. Es ist die Schranke selbst, die handelt. Und sie wird sich erst öffnen, wenn ich sie nicht dränge. Ich muss sie vergessen und mit ihr meine kleine Zeitökonomie, die das Leben in Minuten zerteilt, um es funktionaler, effektiver zu machen.
Ich weiß, so wie wir eben alles wissen, dass ich die Situation mythologisiere zur Schwelle in eine andere Raum-Zeit. Natürlich funktioniert das nicht. Obwohl die Empfindung unabweisbar bleibt. Verzaubert, ernüchtert. Ein Zwiespalt, kein Widerspruch. Erwähnenswert ist das deshalb, weil sich dieses Gefühl für eine Zwischenwelt nicht mehr verlieren wird auf der Raketenstation. Es erstreckt sich auf das gesamte Areal, das in einem schönen alten Ausdruck Gelände genannt wird: Gelände Camouflage ist der Titel eines Buchs von Ute Langanky und Thomas Kling, das mit der Raketenstation umgeht. Und das Gefühl erstreckt sich auch auf die Arbeiten von Ute Langanky selbst, auf ihre Photos und ihre Gemälde und vor allem auf die Sphäre „dazwischen“. Das Gelände ist davon nicht abzulösen. Es bildet die zugrundeliegende Ordnung, mit der die Photographie umgeht, mit der wiederum die Malerei umgeht, mit der wiederum die Poesie umgeht – und in umgekehrter Reihenfolge.
Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Zwitterhaftigkeit des Ortes selbst: Nachdem ein Zug vorüber ist und die Schranke sich sehr viel später geöffnet hat, trifft man nach fünf Minuten Fußweg auf eine Ansammlung oder besser: Zerstreuung von Gebäuden, die, wie unterschiedlich auch immer, eins verbindet: dass sie in einem provisorischen Zustand erstarrt sind, Relikte einer jüngst vergangenen Vorzeit, Skelette eines Körpers von morgen. Da sind, schon vom Stein her an die Insel Hombroich erinnernd, Ansätze zu Gebäuden oder raumgreifenden Skulpturen, die eine große Geste erkennen lassen, die aber vor Schreck abgebrochen wurde. Der Schreck mag Geldmangel heißen, es ändert nichts an der verzweifelten Verwegenheit der Erscheinung. In einer leichten Einwärtsdrehung, als folge man der Windung eines Schneckenhauses, passiert man dann ehemalige militärische Zweckbauten, ein Torhaus, ein niedriges Gebäude mit einem Turm, um schließlich vor einer Reihe mit Stahlblech verkleideter containerhafter Behausungen zu stehen, die eben jene strenge Linierung aufweisen, die in den Arbeiten von Ute Langanky als Extuberanz der Vertikalen entgegenleuchtet.
Blickt man, für einen Augenblick das vage Raumgefühl des Mittelpunkts bemühend, um sich, wird der Blick buchstäblich in den Himmel gesogen, der eine leere Weite ist, unter dem sich alles in seiner Kleinheit verliert. Was ist das hier?
Eine menschliche Anstrengung auf Abruf. Ein Würfelwurf der Dinge, der seine Zufälligkeit nicht verleugnen kann. Der Funktionalismus der Fassaden wird auf der Stelle zum ästhetischen Zeichen. Der militärgeschichtliche Hintergrund des Ortes lädt es auf mit traumatischer Energie. Es gab einmal eine Logik, die alle Bestandteile miteinander verbunden hat. Wir kennen sie nicht im Einzelnen. Sie hatte ihre Conclusio in den nahen Abschussbasen von NATO-Mittelstreckenraketen, die von Belgiern kontrolliert wurden. Wir haben einmal gesehen, wie sich der Betondeckel eines solchen unterirdischen Silos öffnete und gespenstergleich ein strahlender Raketenleib aus der Erde auffuhr. Als Kind habe ich das gesehen. Auf dem Rücksitz des VW-Käfers meiner Eltern. Himmelblau. Das ist lange her. Doch nicht so lange wie die sakrale Codierung der australischen Erde durch ihre ursprünglichen Bewohner. Trotzdem werden wir das Wissen um diesen einen von 1.000 Knotenpunkten des Kalten Krieges nicht mehr los. Es nistet im Inneren dieses Ortes und er hat heute keine andere Strahlung als die, welche Ute Langanky ihren vertikalen sonnenbeschossenen Lamellen gegeben hat.
Ute Langankys graphisch strukturierte Tableaus greifen die Geschichte des Ortes als Formexperiment auf, die lokale Geschichte, die in einer Logik des Unheils mit der Weltgeschichte verbunden ist. Aber sie leisten mehr als das, wie man unschwer sieht. Sie bilden keine Metaphern für einen bedeutungsschweren Ort, sondern verwandeln seine Energie in ein formales Beziehungsnetz, in dem sichtlich die Senkrechte dominiert, was nie ohne eine semantische Mitgift von Gitterstäben geschieht.
Die Photos binden die dynamische Vertikale eines technischen Serienprodukts wie die regelmäßig gestanzten Stahlbleche in Landschaft, in den Himmel, das Licht, die Jahres- und Tageszeiten ein. Kaum ein Photo, das nicht einen Ausschnitt dessen präsentiert, was gerade nicht Artefakt ist. Doch der Ausschnitt, der hinzutritt, tritt nicht als das andere zur künstlichen Strahlung der gegliederten Fläche auf, sondern als ihr Komplement. Die Gewächse, der Himmelsausschnitt, ja die Nacht selbst verwandeln sich zu korrespondierenden Formgestalten, sodass eine sachte Ablösung des künstlerischen Gebildes von seinem Referenten entsteht – sachte und langsam für den Betrachter, der den Ausgangspunkt, die Bizarrerie des Raumes gespürt hat. Sachte wohl nicht für die Künstlerin selbst. Ich stelle mir ihre Arbeit auf der Raketenstation als eine Jagd nach dem Augenblick vor, der die Erscheinungen aus ihrem Bezugssystem löst und in eine neue Ordnung der Fläche stellt. Dazu gehört ganz unbedingt das Einfangen des Lichts. So viel Dämmerung, die ja eine einzige stufenlose Bewegung des Lichts auf den Dingen ist. Und es sind Augenblicke, in denen die Sonne derart die Fläche zeichnet, dass das Objekt in ihr zugrunde geht, um als gewollte Struktur wiederzukehren.
Gewollt deshalb, weil eine Vorstellung zugrunde liegen muss, eine geradezu libidinös besetzte Formidee, um über das Jetzt zu gebieten, in welchem der Auslöser bedient wird. Ute Langanky ist als ästhetische Botanisiererin ihrer alltäglichen Umgebung ausgezogen, um ein Archiv der Raketenstation zu erstellen. Dann wurde, stelle ich mir vor, die Individualität der jeweiligen Aufnahmen zu groß, um sich dokumentarisch einpassen zu lassen.
Diesem ersten kapitalen Zug folgt, aus der Suggestion der klaren Form erwachsend, die Idee der Serie. In ihr entwickelt sich nun ein Verweissystem, das nur noch seinen eigenen Regeln des Kontrasts und der Ähnlichkeit, der Wiederholung und der Variation folgt. Der Blick gleitet entlang der Farbreize, der Helligkeitswerte, der Lineatur und kann sich, ohne dass das Objekt je geleugnet würde, doch niemals zu diesem hin flüchten, um sich zu beruhigen. Und ebenso wenig wird er Ruhe finden dort, wo die Differenzen in einer monochromen Überwältigung getilgt scheinen. Wie zum Beispiel im Fall der extremen Überbelichtung, bei der die Bildfläche zweigeteilt ist in plane Farblichkeit hier und einen Teil, der ein minimalisiertes Architekturzeichen trägt, dort. Das leuchtende Gelb dieses mehrfach klar geteilten Bildes ist vielmehr evident als Sonneneffekt, als Figur- und a fortiori Objektvernichtung durch Sonnengewalt. Es korrespondiert auf diese Weise mit dem sachten Verlöschen der Sichtbarkeit in der heraufziehenden Nacht.
Auch auf diese Weise ist die Geschichte des Ortes – seine latente Gewaltgeschichte ebenso wie seine vordergründige Idyllik im Zusammenspiel mit den Elementen der Natur, kurz, seine bizarre Zwitterhaftigkeit als aus der Zeit gefallener künstlicher Un-Ort –, auch auf diese Weise ist seine Geschichte noch als eine Art Hintergrundstrahlung spürbar. Im Inneren der Photographien strahlt es. Die Sonne ist gleichsam in die Gebilde versenkt und von ihren Bedeutungen so wenig unterscheidbar wie in der physikalischen Welt das Licht von den Gegenständen, auf die es trifft, weshalb, was hier „Raketenstation“ heißt, in den Werken sichtbar, aber nicht sinnhaft ist.
Der Dichter Thomas Kling hat in einem Gedicht zu diesen Photoarbeiten Ute Langankys daran erinnert, dass das Feuer bis hin zum Atom gestohlenes Sonnenlicht ist:
das feuer in ruhe, das hergebrachte das menschheits
mitbringsel: zufallsprodukt des brennenden astes.
die feuergehärtete Keule, lichtwaffe.
So schnell geht das! Dass die Raketen von Hombroich mit atomaren Sprengköpfen bestückbar waren, weiß man. Dass die Welt, auf die sie treffen, aufglüht, bevor sie in Asche fällt, ist eine nicht löschbare Vorstellung. Atomare Sprengköpfe sind Verdichtungen von Zeit und Energie wie Kunstwerke. Sie löschen die materielle Form, sie sind Spielzeuge der Entropie. Sie überwinden unsere Objektwelt in Richtung Chaos. Das Kunstwerk ist ihnen ähnlich, nur der Richtungssinn ist ein anderer, ein entgegengesetzter. Sie heben die schwere Materialität der Objektwelt auf in konstruktiven Zauber. Nichts beruhigt hier, alles strahlt, entlässt zeichenhafte Signaturen in den Raum der Wahrnehmung. Ich erinnere daran, dass Barnett Newman, an dessen Streifenbilder die reduzierteren Arbeiten Ute Langankys gelegentlich erinnern, seine zündende Idee nach den ersten Atomversuchen der Amerikaner im Pazifik hatte. Er begann neu mit der Teilung des Nichts, mit der Weltschöpfung durch die Linie.
Von der systematisch angeleiteten Augenblicksjagd der Photographin Ute Langanky war die Rede, von der Arbeit mit dem Licht der Dämmerung. Ein Element der Plötzlichkeit gehört dazu. Ein Glück wohl auch, in jeder Hinsicht. Ganz anders verhält es sich mit den großformatigen Aquarellen, die nach den Photographien entstanden sind und ihrerseits wiederum Serien bilden. Sie sind nichts weniger als augenblicksbezogen, sie folgen weder dem günstigen Augenblick noch der Inspiration. Sie sind ganz offenkundig Weltbeschreibungen zweiter oder dritter Ordnung, zumal die zeitlich vorhergehende photographische Beschreibung ihr zugeordnet ist.
Die Malerei nach der Photographie, im zeitlichen wie im referenziellen Sinn, bemüht sich keineswegs um eine irgendwie geartete Verfremdung von Motiven oder Strukturen, sie folgt der Lineatur der Vorlage mit größtmöglicher Exaktheit. Sie können vergleichen, können Lichtschrift und malerisch-graphische Handschrift in Beziehung setzen – anders übrigens als bei Gerhard Richter, dem früheren Lehrer von Ute Langanky, der bekanntlich ebenfalls häufig nach Photographie malte und dessen malerische Figuren nicht selten mit einem spezifischen Wisch-Effekt verzerrt wurden –, sie können also vergleichen, um festzustellen, dass in der Verdoppelung das Original unheimlich wird und umgekehrt und dass in der Technik, in der Machart die Objektreferenz gelöscht wird, um als mehrfach gebrochenes Artefakt wieder in Bewegung versetzt zu werden.
Der Gegenstand ist als Illusion kenntlich, die sich aus der Spannung der Form heraus – gleichsam am Kreuzungpunkt von Waagerechter und Senkrechter – gebiert.
Die Malerei, traditionell das Medium phantasmatischer Illusionsbildung, zerstört hier die illusionären Räume. Nicht nur, dass in der Photographie wie in der Malerei von Ute Langanky Raumtiefe ebenso wie Innen-Außen-Bezüge weitgehend in der Flächenstruktur gelöst sind, das gemalte Bild stellt seinen Willen zu Ent-Illusionierung selber aus. Das Bild sagt es überdeutlich: Ich beschreibe nicht die Welt, sondern ich beschreibe eine Beschreibung der Welt. Dass auch die von Ute Langanky selbst im Medium der Photographie getätigt wurde, pointiert dabei aufs Persönlichste die Tatsache, dass Kunst nur auf Kunst referiert. Ute Langanky hat sich selbst den Kontext erzeugt, in dem ihre Malerei Bedeutung gewinnt. Was, man muss es staunend anerkennen, etwas von Selbsterfüllung hat, etwas Autarkes, Starkes – auch dies eine Verbindung zur Poesie Klings, eine Verbindung von Selbsttätigen und Selbstständigen. Und das strenge Spiel geht dem Prinzip nach weiter, iterativ: Ich hatte, nebenbei, über die Gemälde nachsinnend, Photos dieser Gemälde nach Photos vor Augen und Kling-Gedichte in Kopf und Gehör.
Betritt man nun nach diesem Durchgang durch die Kunst Ute Langankys erneut die Raketenstation Hombroich, so geht man durch Zeichen und Wunder. Der Ort ist aufgeklappt in alle Himmelsrichtungen, eine Kopie seiner selbst, ausgehebelt und reinstalliert, durchgestrichen gleichsam. Von sich selbst – wie das am Niederrhein nun einmal ist – himmelweit entfernt. Ein Zwischenort, vom Realen wie vom Illusionären abgelöst und in eine künstlerische Virtualität erhoben. Ute Langankys Kunst hält diese Ablösung als Prozess fest. Und ermöglicht es uns, die Magie eines Ortes, perforiert und durchdrungen von der Magie der Kunst, ohne falsche Identifikationen in Furcht oder Behagen zu spüren.
Drüben, jenseits der Bahn-Linie, die retardierenden, die bergenden Kunstauen der Insel, diesseits jetzt die Raketenstation als ein Ort, wo sich der Schrecken und die Idylle im künstlerischen Prozess auflösen, ein nicht fixierter, ein Zwischenort; kein heiliger Ort, kein Nicht-Ort, nicht für Ureinwohner und nicht für Terminalpassanten, nichts für den tiefen Sinn, nichts für das gedächtnislose Augenblicks-Manöver: ein Ort in permanenter Öffnung. Die Raketenstation zwischen den Weizenfeldern – sie wird nicht so bleiben, das ist klar. Die Raketenstation im Gedicht, auf Photopapier und Leinwand dagegen sehr. Das ist eben: sonnenklar.
________________________________________
Und jetzt das, fünf Jahre nach dem Tod von Thomas Kling, eine erste Tagung zu seinem Werk: „das gellen der tinte“. Auf der Raketenstation. In der großen Halle. Zwanzig Wissenschaftler. Kling und der Barock; Kling und Celan; Kling und das Rheinland; Kling und die Stimme der Schrift; Kling und der Punk; Kling und das Reden über ihn, der Diskurs, die Philologie. Er hängt an der Wand, photographiert und gezeichnet von Ute Langanky, die im Auditorium sitzt und gelegentlich bemerkt, wie es gewesen ist, real, im Paderborner Land, auf den Spuren von Annette von Droste-Hülshoff, die Mergelgrube, Findlinge, Steine, die man um- und umdreht, bis sie lesbar werden. So geht es nun mit dem Textkorpus von Thomas Kling. Das Um-und-Umdrehen als Vorgang zur Erzeugung des Gegenstandes. Der Gegenstand ist der neue historisch-philologische Körper Thomas Kling. Er richtet sich auf über dem restrealen Körper, der als Vorstellungsbild in den Hirnzellen, in älterer Diktion: als Gespenst noch anwesend ist am Ort. Man wohnt einer Metamorphose bei. Ein seltenes, ein verstörendes, ein großartiges Geschehen. Es geht voran. Geschichte wird gemacht. Es wird ein neuer Körper aus Philologie und Bewunderung. Es war ein kranker leidender Körper vordem. Die zwei Körper des Dichters, sie stoßen sich im Raum; nein, sie stoßen sich in der Erinnerung der Freunde und der Ehefrau. Veränderung, Verwandlung, nicht mehr wesentlich zu beeinflussen. Es sprechen nun die Texte. Und die Stimme in der Schrift. Die audiovisuelle Zutat ist Schrift außerdem. Und das Besondere ist der Wahnsinn: Thomas Kling hat schreibend längst schon und ganz offensiv das Gespräch aufgenommen mit denen, die post mortem deutend lesen und ihn umbauen, den Körper (im Namen) Thomas Klings. Er hat ihnen gesagt, wo’s langgeht, den späten Klingmachern, „wo’s langgeht!“, mit Ausrufezeichen, eine der Lieblingswendungen von Thomas Kling im Gespräch. In seiner Gedichtanthologie Sprachspeicher, seinem Kanon der deutschen Poesie, ist das Gedicht „Bücher“ des Barockdichters Friedrich von Logau abgedruckt, in dem es von eben diesen heißt:
aaaaaaaaaaaaaaa… Ich bin auff die beflissen,
Die mir viel gutes thun und doch von mir nichts wissen;
Ich halte diese hoch, die mich nur an nicht sehen;
Die manchmal mich mit Ernst verhöhnen, schelten, schmähen,
Sind meine beste Freund. Und solt ich die begeben,
Eh geb ich alle Welt, eh geb ich auch das Leben.
Diese Leser hatte er im Sinn, diese Liebhaber von Büchern, Freier der sprechenden Schrift, die die Todten brauchen zum Leben und dieses hingäben wie die Welt für das Wort. Thomas Kling hat sich systematisch, mit Aplomb und mit Fleiß, selbst in das Buch der irdischen Ewigkeit eingeschrieben. Die Tagung ist ein Schriftzug.
Hubert Winkels, aus Hubert Winkels: Kann man Bücher lieben? Vom Umgang mit neuer Literatur, Kiepenheuer & Witsch Verlag, 2010
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Hubert Winkels: Armbrust und Rakete. Thomas Kling und Ute Langanky unterwegs in den Ruinen des Kalten Kriegs
Die Zeit, 3.12.1998
Kathy Zarnegin: Feuer und Flamme – Spurensicherung
Basler Zeitung, 10./11.4.1999
Kl!ng
Neuss, fünf vor zwölf. Regen in der Luft. Am Bahnhof streiten sich zwei Penner darüber, wessen Schuld es ist, dass die letzten Zigaretten, zerbrochen oder zerbröselt, auf der Erde liegen. Ich gehe zum Ausgang. U. wartet im Auto. Auf der Fahrt zur Raketenstation Hombroich unterhalten wir uns über die Zeit seit der Diagnose. „Nur noch ein Wunder kann helfen…“ Nasse Felder, Straßengräben, halbmeterhohes Gras. Es ist kurz vor Mittag, Mitte März.
Nach einer Viertelstunde taucht die ehemalige belgische Militärbasis auf. Die angebauten Pavillons glänzen feucht. Wir rollen auf das Areal, das seit Mitte der Neunzigerjahre eine Künstlerkolonie ist. Hinter ein paar kahlen Obstbäumen sieht man die Baracke, die früher als Kommandozentrale diente. Heute ist sie Wohnung und Atelier. Frisch gepflanzte Blumenzwiebeln in dunklen Beeten. Unter unseren Schuhsohlen knirscht der Kies. In der Küche sitzt U.s Mutter. Ich höre Thomas im angrenzenden Zimmer husten.
Extaseinstrument Sprache. Seit Thomas Kling vor bald dreißig Jahren seine Arbeit als „Zungenhielfer“ begann, ist die deutsche Lyrik nicht mehr wiederzuerkennen. Wie kaum ein anderer in seiner Generation hat er die Bereitschaft dafür gesteigert, was Dichtung sein kann. Kling war der Mann hinter der „Sprachinstallation“, einer Ausdrucksform, die von der Stimme forderte, was sie immer sein sollte: der schnellste Weg zwischen Menschen. Eine Kurzdefinition könnte lauten: Evokation + Konstruktion. Der Begriff gab sein Debüt 1986 auf einem Flyer im finnischen Vaasa. „Die Sprachinstallation“, schreibt Kling ein Jahrzehnt später, war „gleich dreisprachig, Schwedisch und Finnisch kamen hinzu.“
Seine Lesungen wurden schnell berühmt, berüchtigt, nachgeäfft. Die erste Gedichtsammlung Erprobung herzstärkender Mittel von 1986 zeigt, wie Slang und Dialekte, Verbrecherjargon und Rotwelsch das Gedicht aktivieren. Gleichwohl handelt es sich um Texte, die ebenso sehr dem Gelesenen wie dem Gehörten entstammen. Mit Hilfe antiker Verse, dem Barock entlehnter Wendungen und stilistischer Tricks, Zeitungsnotizen aus den 1910ern, Slogans, Jingles und denaturierter Prosa konstruierte Kling sein eigenes Babel. Der mündliche Ton war der eines Originals, die rhetorischen Gesten jedoch so durchdacht wie vielschichtig. Nichts wurde dem Zufall überlassen, auch wenn sein Auftreten spontan schien. Eine Anzeige, die in brennstabm aus dem Jahre 1991 als Faksimilé wiedergegeben wird, formuliert die Methode: „Gehörlose selbstbewußte Gebärdensprache.“
Zur selbstbewussten Darstellung auf der Bühne gehörte, umgehend eine passende Antwort zu geben, wenn sich ein animierter Zuhörer einmischte. Die Poesie war immer auch eine Frage der Begegnung. („Ich bin immer für einen Austausch zu haben – mit einem trashigen Antiphon sozusagen.“) Wenn Kling auftrat, knüpfte er an den Ursprung der Dichtung in einer vorschriftlichen Kultur an, die nicht ohne schamanistische Züge war. Die Poesie wurde zu einem herzstärkenden Mittel, die Steigerung Programm. Seine Texte waren graphischer Gesang und Wahrnehmungsaggregat, gemixt von einem orphischen DJ, der fortwährend bemüht war, das einzige „Extase-Instrument“ zu schärfen, das er anerkennen wollte: die Sprache. Die ersten Zeilen in geschmacksverstärker (1989) geben den Ton an:
nachtperformance, leberschäden
schrille klausur
aaaaaaaaaHIER KÖNNEN SIE
ANITA BERBER/VALESKA GERT BESICHTIGEN
MEINE HERREN.. KANN ABER INS AUGE GEHEN
stimmts outfit? das ist dein auftritt!
(„ratinger hof, zettbeh [3]“)
Später im gleichen Gedicht stehen drei Worte, die zwanzig Jahre später einen anderen Klang bekommen: „Yves-Klein-blau“, „OP-bläue“, „Phantomschmerzen“…
Ruhender Pistolero. Thomas liegt auf dem Bett im Arbeitszimmer. Im Bücherregal steht die schwedische Ausgabe von Der erste Weltkrieg mit der Vorderseite nach außen, sodass der Blick automatisch zu dem roten Kreuz auf weißem Grund wandert. Thomas hat die Brille in die Stirn geschoben, auf seinem Bauch liegen ein paar Blätter. Er trägt einen Bademantel und sieht aus, wie er es immer getan hat, seit wir uns kennen. Will sagen: Wie ich mir Billy the Kid als Erwachsenen vorstelle. Grüßt lebhaft, hustet plötzlich.
Ich habe ein Geschenk mitgebracht: einen Sternenatlas aus den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, herausgegeben von der Francke’schen Buchhandlung, der die Konstellationen am südlichen Sternenhimmel zeigt. Die Bilder sehen aus wie Radarschirme oder vielleicht auch geröntgte Lungen. Ein Lineal aus durchsichtigem Plastik ermöglicht, die Entfernungen zwischen den Sternen zu messen. Wir sprechen über Benns „Südwort“. Ich scherze und verspreche, bei unserem nächsten Wiedersehen den restlichen Himmel mitzubringen.
Trommlerjunge. Geboren in Georges Heimatstadt Bingen und während der Achtzigerjahre Teil der Düsseldorfer Szene, veröffentlichte Kling ein Dutzend Gedichtsammlungen. Doch auch wenn er mit der Zeit verschlagen bis in die Zungenspitze werden sollte, hatte er weniger gemeinsam mit Schönsängern vom Schlage eines Dietrich Fischer-Dieskau als mit David Bennent, alias dem Trommler Oskar Matzerath. Kling umgab die gleiche Aura trotziger Verwunderung wie den Helden in Schlöndorffs Verfilmung der Blechtrommel. Es war das Erstaunen des Jungen, als er von der Erde aufstand, sich den Schmutz von den Knien strich und erkannte, dass er sich in einer Welt befand, in der Krieg und Erwachsensein untrennbar verbunden waren. Wie der kleinwüchsige Oskar schlug auch Kling nur aus unterlegener Position. Seine Gedichte waren Trotzreaktionen, die mit der List eines enfant terrible die Trommel für die einzige Art von Gedichten rührte, die den Namen verdient hat: ein Gedicht, das an der Welt rüttelt. Bei Kling behielt die Lyrik immer das letzte Wort.
Alchimie du verbe. Thomas ist in erstaunlich guter Verfassung. Mit heiserer, aber spöttischer Stimme erzählt er von den Temperaturwechseln im Körper, von den ärztlichen Untersuchungen und der Chemotherapie, von Auftragsarbeiten und Lesungen, die er absagen musste. Plötzlich steht U. in der Tür. Sie erinnert ihn daran, dass er nur für kürzere Zeit aufrecht sitzen darf. U. sieht mich an, als sie das sagt. Thomas legt sich eine Strickjacke um die Schultern, die einem Polarpelz ähnelt. Der synthetische Stoff erinnert an die Liegeunterlagen im Krankenhaus. „Ja, ja“, grinst er listig und nickt. Er kommt allmählich auf Touren.
Als U. gegangen ist, fragt Thomas nach Ekelöf. In den letzten Tagen hat er wieder in der Werkausgabe gelesen, die in sieben Bänden im Kleinheinrich Verlag erschienen ist. Besonders ein Gedicht hat es ihm angetan. Er holt die einzelnen Bände, blättert vor und zurück, ruft schließlich nach U., um sich von ihr helfen zu lassen. Die Stimme bricht. „Aber den hast du doch dahin gelegt“, sagt U., als sie ihm den Band reicht, der auf dem Fenstersims gelegen hatte. Thomas findet den Text. Es ist „Der Alchimist“ aus der Gedichtsammlung Non serviam.
Wir diskutieren Gedicht, Buch, Werk. Thomas ist unzufrieden mit der deutschen Übersetzung, die Ekelöf seiner Meinung nach stellenweise allzu harmlos macht. Nach zwei Besuchen in Schweden und einem längeren Aufenthalt in Finnland in den Achtzigerjahren hat er das Gefühl, geschriebenes Schwedisch recht gut zu verstehen. („wi wa / das noch“, heißt es in einem Gedicht in brennstabm: „ja: HÖSTEN ÄR FIN I SKÄRGÅRDEN.“) Und wenn er das Gedicht selber übersetzen würde?
Thomas denkt nach. Er will mehr über Ekelöfs Verhältnis zu Rimbaud erfahren – diesem „durchglühten Erz-Punk der Moderne“, wie er ihn, wie ich später entdecken werde, in einer Rezension der Kleinheinrich-Ausgabe genannt hat. Ich erzähle von der Rolle der Luzifergestalt in Non serviam und auch von Ekelöfs Essay über Rimbaud aus dem Jahre 1935. Wir spekulieren darüber, ob die Abkürzung „ecr. l’inf.“ („écrasez l’infâme“, Voltaires Slogan im Kampf gegen die unterdrückende Orthodoxie im vorrevolutionären Frankreich) nicht auch als „écrire l’infini“ oder „l’infinitif“ gedeutet werden könnte – als wäre die Schrift ein beharrlich wiederholter Versuch, die Niederträchtigkeiten der Rechtgläubigkeit zu parieren. Wir sprechen über Katzengold und Dreck, über den Fall als Figur und Zustand, über den Handel der Toten und der Lebenden, über die Träume des Alchimisten, Außenseiterdasein und corpus hermeticum…
Thomas kommt in Fahrt. Mehrfach entfährt ihm ein „Geil, geil!“ Jedes Mal streckt er die Zunge heraus und spielt mit ihr – tierisch, sexuell. (Heißt: aufgegeilt von Sprache.) Und jedes Mal wird er von einem Hustenanfall übermannt.
Röntgen der Sprache. Nach den hitzigen Zuständen und der fahrigen Gestik der ersten Bücher, verdichteten Schriftbildern und orthographischen Eigenheiten, werden die Schnitte in Klings Dichtung weniger abrupt, der Ton beruhigt sich. In nacht.sicht.gerät von 1993 öffnen sich „sprachräume“ zum zögerlichen Einwirken der Vergangenheit auf die Gegenwart und Verschiebungen zwischen Oberfläche und Hintergrund. Die Technik, die er benutzt – „WIR BEVOR- / ZUGN DAS KALTGESCHLEUDERTE GEDICHT“ –, erinnert an ein Röntgen der Sprache, bei dem Schichten gelagert oder abgedeckt werden, Doppelbelichtungen die Aussagen kalibrieren und große Entfernungen in Zeit und Raum zwischen die Zeilen gepackt werden, manchmal sogar in einzelne Silben.
DRIFT
schnittwundn abschiede schnitt.
und starr aufs test-, aufs textbilt
gestarrt. bildtest wiederum ausgefalln.
so passiert zungenentfernung.
märzmorgende fiepend; diarien abgeflämmt,
verflogene stundnbücher.
ein aufgehn in rauch, in schaum. zeilen
di sich hervorschiem, –zwägn etwas
wi „ausgetriebene engeldämonen“: das reine
wohnzimmer-voodoo, in einzel in bilt,
in einzelbildschaltung; di ganzn bildver-
einzelungen!
aaaaaaaaaaakontinente in zungenentfernung. wir
driftn auseinander. so.
Botenstoffe. Um die Ausdauer des stimmverschworenen Gedichts zu bezeugen, das zu Klings Markenzeichen wurde, veröffentlichte er vor ein paar Jahren einen Bericht von Reisen in die abgelegeneren Regionen des Alphabets. Botenstoffe wird von einer Kameralinse geziert, in deren Fokus Worte wie „Instantpulver“, „Wirklichkeitsmixer“ und „Präzisionsinstrument“ in unterschiedlicher Entfernung vom Auge schweben. Aber die Linse ähnelt auch dem Deckel zu einem Container von der Art, in denen man gemeinhin Stoffe mit einer hohen Halbwertzeit aufbewahrt. Das Bild suggeriert einen Schriftsteller, der sowohl Sternendeuter als auch Wirklichkeitspathologe, Poesiepusher, Spracharchäologe und Bergmann sein will. Unter Klings alter egos finden sich nicht nur ketzerische Himmelsstürmer wie Orpheus, Hermes und Oskar, sondern auch Pandora. Wer seine Essaysammlung aufschlägt, muss damit rechnen, sowohl begeistert als auch bestrahlt zu werden. Möglich, dass sich der Segen, den Kling in Aussicht stellte, bezweifeln lässt, eins aber war klar: Botenstoffe wollte kein Gefäß sein, das man als der gleiche Leser öffnete und wieder schloss.
„Stegreif-Künstler.“ Als Essayist sprach Kling stets auch in eigener Sache. Bücher wie Itinerar (1997), Botenstoffe oder sein letztes, Auswertungen der Flugdaten (2005), das neben Gedichten mehrere Aufsätze umfasst, enthalten nur wenige Zeilen, die Stoffen anderer Provenienz gewidmet sind als der seiner eigenen Dichtung. Eine andere Art, diese Einseitigkeit auszudrücken, wäre, Klings kritische Texte als Insidertips zu bezeichnen. Hier schreibt nicht nur ein Freund und Kollege, sondern ein Komplize und Schildknappe. Seine Kumpane waren, was er „Stegreif-Künstler“ nannte – „Stegreif, das alte Wort für Steigbügel; Künstler, die etwa gleich nach dem Absitzen, oder ohne den Steigbügel benutzen zu müssen, um hochzukommen, loslegen können“. Zu diesen Wahlverwandtschaften – „schlagfertig reagierende Vortragende in Sprache, Musik, Gesang“ – zählte er Catull und Dante, Abraham a Sancta Clara und den Barockdichter Moscherosch, frühe Modernisten wie Kraus, Ball und Benn, aber auch späte Nachfahren wie Konrad Bayer, Friederike Mayröcker und H.C. Artmann, allesamt geschliffene Zungenartisten, deren Texte „den oralen, den rhetorischen Komponentensatz ins Literale zu transferieren“ suchten.
Orpheus in der Unterwelt. Während unseres Gesprächs bekommt Thomas einmal einen solch heftigen Hustenanfall, dass er den Ekelöf-Band fortlegen muss. Hinterher blickt er misstrauisch in sein Taschentuch. Dann faltet er es zusammen und stopft es sich in die Manteltasche. „Der reinste Raubbau.“
Diebschatz der Sprachen. Bei Kling ist die Entfernung zwischen Himmel und Grube selten größer als eine Verszeile, was heißt, die Dichtung bleibt eine horizontale Angelegenheit. Wie der Stammvater Orpheus nähert er sich „liebend den Sprachen“, ohne sie untereinander ihrem Rang nach zu ordnen – mit anderen Worten waagerecht wie die Fläche, auf der die Glieder des Sängers verstreut werden sollten. Selten hört man seine Gedichte mit jener andächtigen Stimme sprechen, die allein vertikal kommuniziert – in dem hohen Ton „der ja nur in homöopathischen Dosen dem menschlichen Gehirn zumutbar ist“. Als Agent für den Freistaat Babel vermischte Kling im Gegenteil gierig Sprachen, Stile und Tonlagen. Er sprach sich wärmstens für eine „offene Hermetik“ aus, bei welcher der Dichter ein „Verwalter des Diebschatzes der Sprachen“ ist. Zu dieser Poetik gehörte der leichtfüßige Slang der Straße und das Vokabular der Kriminellen, aber auch Fach- und Sondersprachen – ein „Gewirr von Dialekten und Argots, die überspült werden von Ausrufersprüchen und -liedern (Werbe-Jingles), die sitzen“. Nur so konnten das Eigene und das Fremde „in kreative Konkurrenz“ treten und „gestenreich und histrionisch sich beweisendes Wort – ganz Stimme, ganz bildreich verkörperte Sprache“ sein. Das Gedicht war ein Tagebau. Seine Art aufzutreten: intensiv.
Riposte. Als „wunderbare Rampensau“ erkannte Kling, dass man nicht ungestraft Schabernack trieb mit der Macht und den Medien. Damit die Dichtung mit heiler Haut davonkam, musste sie hart und präzise zuschlagen. Kurzum: Nur wenn die Aussagen vernichtend waren, konnte man als Zungenartist davon ausgehen, das Gedicht würde überleben. Noch kürzer: Kling ließ die Hand nicht gerade auf dem Colt liegen. Durchaus reizbar und mit mehr als einer Prise Selbstbehauptungswillen begabt, wusste er, es galt, am schnellsten zu ziehen. Und dass die Munition für den geborenen Dichter nur „der gute, die Polemik führende gesprochene Satz“, „die drastische Ansage, der warnend-paßgenaue Satz, der über den gut bis reichlich eingeschütteten, gern breitschultrigen Inhalt hinaus im Timing perfekten Sitz haben muss“ sein konnte. Denn allein die gute Riposte konnte „nicht gewechselt werden“.
Kling und Klang. Es sagt sich von selbst, dass eine solche Einstellung zum poetischen Auftrag etwas von Männersache hat. Dichtung war Duell. Kling plädierte für Frechheit. Seine Gedichte wollten stark auftreten. „Die Zunge, Dörrfleisch, wird immer geschmeidiger, geiler: das ist der Dichter als Stylit.“
In einem Gespräch kehrt er zu der Figur zurück, die ihm hier vorschwebt. Er erklärt, das Gedicht sei etwas, das „zwischen zwei Hörakte gespannt ist“: den des Schreibenden und den des Lesenden. Letzten Endes war die Poesie nicht anderes als ein „Rausch-im-Ohr“. In Gedichten wie Essays untersuchte er diese „Gehörhalluzination“, will sagen: „wie Welt angreift, wie etwas wie die Welt als Ungestaltetes auf das Ohr des Schreibenden eintrifft, einprasselt, durchaus in einem aggressiven Angriff“, um anschließend – übersetzt und verwandelt in gedichtete Sprache – im aufgekratzten Ohr des Lesers wiederholt zu werden. In dieser Penetration des ständig offenen, ständig rezeptiven Gehörorgans war „der sexuelle Aspekt“ kaum wegzudenken. Im Gegenteil, dessen Doppelung war „sehr wichtig“:
Die Sprachen meinen und von der Sprache gemeint werden.
Ich frage, ob das alphabetische Emblem für diese Figur nicht der Buchstabe I sein könnte. Wir fangen an, über ein Zeichen zu sprechen, das für sich selbst steht, standhaft und allein, und dem bereits Platon einen gründlichen Charakter attestierte. Wie kein anderes Schriftzeichen findet es listig seinen Weg in und durch alles. Ich erinnere an den Titel von Thomas’ erstem Essayband, Itinerar, der dieses Verhältnis ja beschreibt, und verweise darauf, dass die Gedichtsammlung Fernhandel von 1999 den Dichter einen „Klinger, Singer“ nennt. Sagt es sich nicht von selbst, dass eine solche Gestalt, angegriffen von der Welt, selber die Aggression wiederholt? Thomas antwortet nicht. Aber in Botenstoffe kommt die Replik: „Phallischer geht’s gar nicht mehr.“
Frenetisch. Der „Rausch-im-Ohr“ ist das High-Gefühl, das die Sprachinstallation erstrebt. In seinem letzten Buch wertet Kling dessen Flugdaten aus. Nun zeigt sich, die Steigerung hat noch eine andere Seite. („Man kann“, wie Hölderlin meinte, „auch in die Höhe fallen.“) Das „Yves-Klein-blau“, das in der frühen Dichtung heraufbeschworen wird, ist nicht allein die Farbe des Himmels und des Absoluten. Dem erregten, zeitweilig aggressiven Ton steht das frenetische ich-will-es-nicht-glauben gegenüber:
sonne strahlt arnika, trotzdem: frantic,
reichlich alles. die im blauen kranz,
herzkranz austobt sich, protuberanzen.
schraffuren erzeugend im blau –
yves-klein-pigment? sei’s drum.
wenn diagnose steht erstma’ – frantic.
(„Arnikabläue“)
Blauer Atem. Nach dem Mittagessen sind Thomas’ Kräfte erschöpft. Es wird Zeit zu gehen. Er beobachtet mich, während ich meinen Mantel anziehe. Unmittelbar bevor wir uns verabschieden, zeigt er auf meinen blaugestreiften Schal. „Der ist schön…“, hustet er. Ich frage ihn, ob er ihn haben möchte. Er nickt stumm, legt ihn sich um den Hals.
Einen Monat später schickt U. den Schal mit folgendem Gruß zurück:
Deinen Schal hat Thomas ein paar mal im Bett getragen. Er hat sich sehr darüber gefreut.
Der gleichen Sendung fügt sie seine neue Nachdichtung von Ekelöfs „Der Alchimist“ bei – einer der letzten Texte, den er vollendete. Beim Lesen merke ich, dass einige der Zeilen eine andere Bedeutung annehmen, als von Ekelöf beabsichtigt.
Der Stab. Auf dem Umschlag zu seinem letzten Buch steht Thomas auf einer Säule. Die eine Hand breitet er in einer einladenden Geste aus, die andere hebt er, als wollte er gerade den Taktstock schlagen. Als wir Abschied nahmen, erzählte er, das Foto sei in Südtirol entstanden, unweit der Pizzeria, in der wir vor so vielen Gedichten Freunde wurden. Zwei Wochen später ist er tot, 48 Jahre alt, gestorben an der Krankheit, die ihn attackierte, wo der „Zungenhielfer“ am schutzlosesten war.
Ich mustere das Foto, auf dem Thomas auftritt wie ein später Nachfahre von Symeon Stylites. Es ist unmöglich, nicht an Itinerar zu denken, wo er erläutert, das Einzige, was der Dichter zu seiner Hilfe benötige, sei der „Stab (Buchstab? Brennstab?)“ des Diebesgotts Hermes. Mit ihm steckte er seinen Weg durch die Welt ab, mit ihm lotete er die Abgründe der Sprache aus, mit ihm wurde mehr als ein Fenster eingeschlagen. Für Thomas war der Stab zugleich gezügelter Blitz und Echolot, Schreibwerkzeug, Geschlecht und Zunge. Aber zunächst und zuletzt war er wohl Ausrufezeichen. So möchte ich mich jedenfalls an ihn erinnern: als die ausdrücklichste Verbindung zwischen Urgestein und Klang, Grubenschacht und Äther in der deutschen Dichtung. So war er, der unvergleichliche Thomas Kl!ng.
Aris Fioretos, August 2005, Neue Rundschau, Heft 1, 2006
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Fakten und Vermutungen zu Ute Langanky + Kalliope
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest „Oh Nacht“ [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Gespräche mit Thomas Kling:
Fakten und Vermutungen zum Autor + Hommage + Symposion +
DAS&D + Dissertation + KLG + IMDb + PIA + Internet Archive +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“.


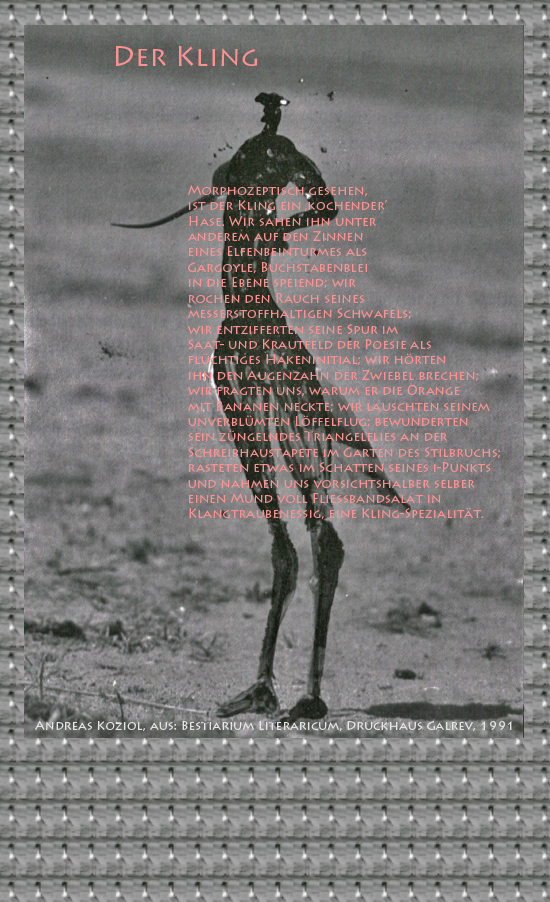












Schreibe einen Kommentar