Wolfgang Hilbig: abwesenheit
H. SELBST-PORTRAIT VON HINTEN
die hand im haar so hockt er
ruhlos am tisch
und ahnt nicht daß die herbstnacht
die luft an seinem nacken dunkel färbt
er sitzt auf dem sprung er sagt ich bin
solitair
aaaaaaund müde bin ich bin mir selbst
entflohn (so hockt er am tisch der fremde
wenn ich allein im zimmer bin
(man sieht nicht sein gesicht
was wartet er gekrümmt zur kralle
harrt er des blauen hauchs der ihn belebte
dem mondeslicht das schwächer in die kalten
haine hängt
aaaaaaaaaadie tage gingen schnell
glaubt er davonzufahren auf dem stuhl
längst hält ein herbst mit kaltem haar
sein hastiges gebein verhangen
er schwimmt in hundert jahren schlaf
er ahnt nicht daß er selber herbstet
vergangen ist was er vergaß
(der herbst steht kopf der herbst verhöhnt ihn
er merkt es nicht er merkt nicht daß sein atemhecheln
dem atemlosen fehlt der händeringend
ruhlos durch die haine rennt und der
so oft ihn rief
(verkrallt hockt seine hand im haar
das nicht mehr mit ihm denken will
zum schreien seltsam trüben draußen
die sterne die nacht ein.
abwesenheit
ist Wolfgang Hilbigs erster Lyrikband, der dort, vorerst, nicht erscheinen kann, wo er geschrieben wurde. Diese Gedichte (sie entstanden zwischen 1965 und 1977) sind mächtige und unruhige Zeugnisse der Verweigerung: Sie wollen weder die verstellten Räume – „die bagger blieben die dörfer sind fort“ – noch die verdorrte Sprache – „unsere worte sind / gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee“ – abbilden. Dieser Autor muß sich aller Verführungskünste der „geliebten wölfe“ erwehren und kann nicht teilhaben an dem verordneten Frieden – „ihr habt mir ein haus gebaut / laßt mich ein andres anfangen“. Hilbigs Gedichte zeichnen sich aus durch die krassse Dinglichkeit der Einsamkeitsbilder: der blaue Schnee, die zugige Wohnung, das leere Bett, der kalte Bahnhof. Er, der Arbeiter, hat staunend die ihm zugängliche Lyrik der modernen Weltliteratur gelesen und in der Auseinandersetzung mit ihr seine Sprache und Formen gefunden, in denen er von sich zu den Menschen sprechen kann (in freier Rhythmik, im klassischen Sonett, im langen Gedicht). Hilbig verteidigt sein „schreiendes amt“, er will nicht einkehren ins verheerende „zuhaus der häuser“ und sich einfügen in „die schreckliche zufriedenheit“. Sein vorgeformtes Leben und die Unerbittlichkeit seiner expressiven wie leidenden Sprache heißen ihm trotzdem „weiterreden rasend stumm“: „geh ich und unerschöpflich wird mein traum“. Und so bestehen diese Gedichte in der aufgebrochenen Wirklichkeit auf der unerschüttlichen Hoffnung, auf der brennenden Sehnsucht nach Anwesenheit.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1979
Highway oder Kesselhaus?
− Zu Gedichten von Karin Kiwus und Wolfgang Hilbig. −
Beide sind zweite Hälfte dreißig, beide schreiben Gedichte in Kenntnis der modernen lyrischen Techniken vor allem des angelsächsischen Raumes. Sonstige Gemeinsamkeiten: keine, ist doch die eine im Westberliner Kulturbetrieb zu Hause, während der andere als Heizer in Ost-Berlin lebt und Publikationsschwierigkeiten im eigenen Lande hat. Am wenigsten mag ins Gewicht fallen, daß es sich hier um eine Frau, dort um einen Mann handelt; immerhin muten die psychischen Voraussetzungen, die zum Gedicht führen, so unterschiedlich an wie die Lebensumstände. Auf der einen Seite Schreiben als Versuch, unbeschadet mit sich und seiner Umwelt ins reine zu kommen; auf der andern Seite das Bestreben, sich ihr und vielleicht sogar dem eigenen Ich durch Abwesenheit zu entziehen. Wo Figurationen der Existenz so gegensätzlich ausfallen, wären Vergleiche wenig ergiebig.
Dem S. Fischer Verlag ist mit der Veröffentlichung von Wolfgang Hilbigs Erstling abwesenheit eine Entdeckung gelungen. Daß diese zwischen 1965 und 1977 entstandenen Arbeiten in der DDR vorerst, wie im Klappentext vorsichtig angemerkt, nicht erscheinen dürfen, ist auf den ersten Blick schwer verständlich. Wohl deutet sich in Gedichten wie „teilnahme an einem abendmahl“ oder „sehnsucht nach einer orgel“ ein verhaltenes religiöses Empfinden an, aber außer einigen politischen Anspielungen stößt der Leser in diesem fünfundachtzig Seiten starken Band auf kein sogenanntes Ärgernis. Auch müsste die DDR ja froh sein über jeden Schriftsteller, der wie dieser in einer Bergarbeiterfamilie aufgewachsene Sachse proletarischer Herkunft ist. Für ostdeutsche Literaturfunktionäre wie für westdeutsche Intellektuelle, die immer noch auf Brechts lesenden Arbeiter schwören, mag an diesem schreibenden Arbeiter anderes befremdlich wirken. Weder wartet er mit Problemen aus der Arbeitswelt auf, die ihm, dem Werkzeugmacher, Heizer und Erdbauarbeiter nur zu gut bekannt sein dürften, noch gibt er sich überhaupt gesellschaftsbeflissen; dieser wilde Sonderling, der sich auf Rimbaud beruft, verbittet sich gleich im Anfangsgedicht „laßt mich doch“ alle Segnungen der Gesellschaft:
laßt mich doch
laßt mich in kalte fremden gehn.
Und damit dies nicht als bloße Romantik verstanden werden kann, redet er im folgenden Gedicht Fraktur:
ihr habt mir ein haus gebaut
laßt mich ein andres anfangen.
ihr habt mir sessel aufgestellt
setzt puppen in eure sessel.
ihr habt mir geld aufgespart
lieber stehle ich.
ihr habt mir einen weg gebahnt
ich schlag mich
durchs gestrüpp seitlich des wegs.
sagtet ihr man soll allein gehen
würd ich gehen
mit euch.
Kann man mit einer solchen Jugend noch diskutieren? Geht diese totale Verweigerung, dieses Beharren auf dem Alleinsein, diese Absage an jede Bevormundung nicht über jede Kritik am real existierenden Sozialismus hinaus? Hier will einer nicht mehr, hier macht einer nicht mehr mit. Ohne zu jammern oder zu schwätzen, stellt er sich selber ins Abseits. Den dauernden Zwang zur Anwesenheit, den die Gesellschaft ihm auferlegt, beantwortet er mit seinem Gedichtband, mehr noch, mit seiner Existenzform abwesenheit. Was dabei herauskommt, ist erstaunlich. Trotz vielfältiger formaler Abhängigkeit von Vorbildern, trotz mancher Sentimentalitäten und Übertreibungen besitzt Wolfgang Hilbig von vornherein den eigenen Ton. Seine an äußeren Eindrücken, an Naturbeobachtungen reiche Lyrik konzentriert sich auf psychisches Geschehen. Die vorwiegend langen, langzeiligen Gedichte vibrieren vor nüchterner Verzweiflung und einer Schwermut, die sich mit Rausch und Traum kompensiert. Vitalität, die nie Show ist, fühlt sich erstickt und bricht aus; „laßt mich“ im Sinne der Abwehr ist ein Schlüsselwort Hilbigs, der sich gegen jeden fortschrittlerischen Optimismus sträubt:
laßt mich
einen augenblick noch sterben
schnell bevor ihr
ewiges leben endlose helle
auf der welt weckt.
Eindrucksvoller als diese resolute Absage, die von untergründiger Religiosität getragen ist (eines seiner Sonette ist novalis gewidmet), wirkt die manchmal geradezu an Blake erinnernde Sensibilität. Hilbig verwandelt die Erfahrungen seiner Arbeitswelt, ohne sie im geringsten zu mythologisieren, in eine übermenschliche Dimension; Feuer, Rauch, Asche, Staub werden zu Indizien der Vergänglichkeit, die in die normale Alltagswelt einbrechen, wie in „gespaltenes thema“:
feuermorgen
schlammschwarz verwandelt −
kommen werd ich
im sturz dem antrieb von oben
und im spiegel stehn – geschoren verlassen −
nackt wie möbel wo sich rote sonnenflecken ringeln
Man kann nur hoffen, daß Wolfgang Hilbig diese Rasanz in Leben und Schreiben durchhält, die seine selbstgewählte Abwesenheit ihm schenkt. Seine stille Revolte jedenfalls geht über alles hinaus, was wir in den letzten Jahren in der westdeutschen Lyrik vernommen haben.
Monika Jäger, Neue Rundschau, Heft 4, 1979
Mutmaßungen über die Struktur und die Komposition
von Wolfgang Hilbigs Gedichtsammlungen
Die Untersuchung von Gedichtsammlungen ist ein paradoxes Unterfangen und man könnte meinen, eine Gedichtsammlung habe an sich etwas Widersprüchliches: einerseits stehen Gedichte einzeln da, als geschlossene Formen und unabhängige Texte; andererseits ist die Anordnung der Gedichte innerhalb einer vom Autor herausgegebenen Sammlung bewusst entstanden, wodurch mehr oder weniger auffallende Korrespondenzen zwischen Gedichten spürbar werden. Gerade die Interpretationsschwierigkeiten mancher Gedichte der Moderne lenken die Aufmerksamkeit des Lesers auf die einzelnen Texte zuungunsten der Makrostrukturen. Dabei kann gerade in der modernen Lyrik, die den autonomen Status des Gedichts unterstreicht (im Unterschied also zu „narrativen“ Folgen von Gedichten wie bei Petrarca oder du Bellay), die Anordnung der Gedichte signifIkant sein. Selbst wenn es an logischen oder inhaltlichen Verkettungen von einem Gedicht zum nächsten fehlt, was dann einem linearen Lesen entgegensteht, wird das Neben- und Nacheinander der Gedichte von Querverbindungen begleitet. Die Sammlung darf als ein aus mehreren Gedichten bestehendes Ganzes durchaus als „Ausdrucksmittel der Moderne“1 angesehen werden und dadurch besitzt dieses Ganze eine „wichtige kommunikative Funktion“.2 Laut Wolfgang Kayser entsteht „durch die Zusammenordnung zu einem Ganzen […] ein Mehr gegenüber einer bloßen Addition“.3 Man kann versuchen, die Reihenfolge der Texte „nicht als lose Gedichtsammlung“ zu betrachten, sondern zu erforschen, inwiefern „das einzelne Gedicht“ innerhalb der Sammlung „seinen Ort hat“ und durch seine Stellung ein „Zusätzliches an Bestimmtheit“ gewinnt.4
Gedichte werden aus unterschiedlichen Gründen in eine Sammlung aufgenommen und diese Auswahl kann (muss aber nicht) auch von der „Gesamtstruktur“ der Sammlung bestimmt sein.5 Gründe für die Auswahl bzw. das Ausscheiden oder Weglassen von Gedichten können z.B. die Qualität, die Relevanz, die Repräsentativität, oder aber der Status eines Gelegenheitsgedichtes, der allzu zufällig für eine Sammlung wäre, sein.
Das heißt aber nicht, dass alle Sammlungen und Zyklen gleichermaßen stringent sind; so unterscheidet Joachim Müller in seiner Studie von 1932 „Das zyklische Prinzip in der Lyrik“ zwischen geschlossenen und offenen Formen (so wie Klotz es ein paar Jahrzehnte später für dramatische Texte herausarbeitet).6 Müller nennt Merkmale, die wir nur bedingt wiederaufnehmen werden können: „das thematische Apriori [d.h. ein – von Diltheys Denken und Terminologie geprägtes – ,gemeinsames Erlebniszentrum‘], die immer wiederhergestellte Schwerpunktsbezogenheit“, beim „strengeren Zyklus die übergreifende und beim ganz strengen die Glied mit Glied verbindende Kontinuität“,7 die dem Zyklus über die einzelnen Gedichte hinaus eine erzählerische Dimension verleiht. Außerdem entfalte dabei ein Gedicht seinen ganzen Sinn erst im Zusammenhang mit den anderen, ihm nahen Gedichten. Das „thematische Apriori“ und das „Erlebnis“ zeige sich aber laut Müller in der modernen Lyrik nicht als autorbezogen, sondern als ein „unausgesprochene[s] und unaussprechbare[s] Zentrum“.8
Eine solche Herangehensweise, die den Schwerpunkt auf die Sammlung legt, scheint gerade bei Hilbig erlaubt und relevant, da unter den Lyrikern des 20. Jahrhunderts ihm solche mit starkem Hang zum Aufbau von Zyklen und Sammlungen besonders wichtig sind, so z.B. George, Rilke, Trakl und Celan. Es handelt sich aber in diesem Beitrag um eine durchaus tentative Untersuchung, daher das Wort „Mutmaßungen“ im Titel.
Als Korpus werden die drei von Hilbig veröffentlichten Sammlungen abwesenheit (1979), die versprengung (1986) und Bilder vom Erzählen (2001) berücksichtigt (wenn auch ungleich ausführlich); das heißt, dass hier – vor allem aus Platzgründen – die Sammlung aus dem Nachlass Scherben für damals und jetzt9 nicht einbezogen wird, obwohl Hilbig, der sie später vernichtet haben wollte, ursprünglich vorhatte, sie zu publizieren, da er sie an den Rowohlt Verlag schickte.10 Obwohl sie nicht ins Korpus aufgenommen wird, weist sie gerade als Sammlung starke Kompositionsmerkmale auf und wäre eine gesonderte Untersuchung wert: sie ist nämlich in mehrere Sektionen gegliedert, deren Titel Assoziationen zum späteren Werk und zu seiner Bilderwelt hervorrufen ( „Natur 1“, „Einkehr und Rückkehr“, „Tageswahrheiten“, „Natur II. Wälder und Meer“, „… nach der gläsern Barke Flug“, „Rest-Stimme“ und „Stimme“). Außerdem enthält Scherben einige programmatische und poetologische Gedichte, die, in der Tradition der großen Gedichtsammlungen von du Bellay, Baudelaire oder Brecht, an exponierter Stelle stehen.
Aus ganz anderen Gründen werden hier aber auch die beiden Sammelbände stimme stimme (DDR 1983) und zwischen den paradiesen (1992) ausgelassen. Nicht nur weil diese Bände sowohl Lyrik wie Prosa enthalten, sondern vor allem, weil es sich hier eher um Anthologien denn um „regelrechte“ Sammlungen handelt. Beide Bände können zwar Aufschluss geben über die Gedichte, die in den Augen von Hilbig und in denen der Lektoren als besonders wichtig, gelungen und/oder repräsentativ erschienen, sind aber eher Zeugnisse den Werdegang des Autors betreffend, was nur ein Aspekt unter anderen von Gedichtsammlungen ist. So liest man z.B. im Klappentext von stimme stimme:
Der vorliegende Band enthält eine Auswahl von Arbeiten, die seit 1965 entstanden sind.11
In diesem Fall handelte es sich außerdem auch – verglichen mit dem Gedichtband abwesenheit von 1979 – um eine für die DDR getroffene „entschärfende Textauswahl“.12
Die Untersuchung wird nach folgenden zwei Ansätzen verfahren: Zum Ersten wird hier versucht, in den publizierten Sammlungen herauszufinden, welche Kompositionsprinzipien sich durch eine werkimmanente Betrachtungsweise erkennen lassen; zum Zweiten wird textgenetisches Material herangezogen werden, um die Komposition von abwesenheit vielleicht besser zu verstehen; beide Ansätze erweisen sich, wie zu sehen sein wird, in diesem Fall als komplementär und es wird sich jedenfalls für diese erste Sammlung herausstellen, dass das Wissen um die Entstehungsumstände von 1977 bis 1979 es erlaubt, die Balance zwischen Formwillen und Zufall im Aufbau der Sammlung besser einzuschätzen.
I. Werkimmanente Untersuchung
Ein paar allgemeine Bemerkungen sollen der Untersuchung der einzelnen Sammlungen vorangestellt werden. Wie Bénédicte Terrisse in ihrer Dissertation über Hilbig feststellt, ist der Aufbau von Hilbigs (nicht nur lyrischen) Sammlungen „reiflich überlegt“.13 Sie beruft sich dabei – unter anderem in Bezug auf zwischen den paradiesen – auf den Briefwechsel mit dem Lektor Thorsten Ahrend in dessen Zeit bei Reclam, für den Schlaf der Gerechten auf den mit Jürgen Hosemann (S. Fischer Verlag). Dass Hilbig eine genaue Vorstellung der Struktur hatte, die er seinen Sammlungen geben wollte, gilt also sowohl für die Gedichte wie für die Prosa. Das heißt aber nicht, dass die Bedingungen, unter denen die Entscheidungen getroffen wurden, immer gleicher Art waren, wie wir es im Fall von abweseneit sehen werden. Anordnung und Unordnung gehören bei Hilbig zusammen; sowohl Prosatexte wie Gedichte stehen unter dem Zeichen des Chaos, des Tohuwabohus. Wie es sein Lektor Thomas Beckermann bei Fischer einmal an Hilbig (hier in Bezug auf Die Angst vor Beethoven) schrieb:
Wieder einmal lese ich Deine Texte, und wieder bin ich in einem Labyrinth aufs Angenehmste verloren […].14
1.1. Allgemeine Bemerkungen
1.1.1 Seitengestaltung
Die Seitengestaltung ist für Hilbig sehr wichtig. Es dauerte nach der Veröffentlichung des Bandes bekanntlich Wochen, bis Hilbig ein Exemplar von abwesenheit in den Händen hielt: Er musste sich Gert Neumanns Exemplar ausleihen, um das Buch überhaupt zu sehen. Seine zufriedene Reaktion im Brief an Beckermann vom 24. Oktober 1979 zeigt, dass er das Buch als ein Ganzes und als ein Netz von internen Bezügen ansieht, also nicht als ein bloßes Nebeneinander von Texten:
ich muß, in noch anhaltender Verwunderung, sagen, daß selbst meine geheimsten Vorstellungen vom Gesicht eines Buches verwirklicht sind, selbst solche nämlich, die ich wegen des damaligen Zeitmangels nicht mehr mit Ihnen erörtern konnte, und in der Verteilung der Gedichte über die Seiten ist ein Bild zustande gekommen, wofür ich Einzelheiten, einen Vorwurf von Pedanterie fürchtend, überhaupt nicht zu fordern gewagt hätte, es ist ein Bild, in dem ich selbst noch Neues zu entdecken und noch nicht bedachte Assoziationen anzustellen vermag.15
In abwesenheit16 wurde zum Beispiel für eine ausgeglichene Verteilung des Textes zwischen der linken und der rechten Seite gesorgt. Sehr selten wird das Auge durch die Tatsache „gestört“, dass eine Seite voll ist, die andere fast leer. Auf Proportionen wird geachtet und die einzigen Beispiele, wo zwei ungleich lange Texte zu sehen sind, sind die längeren Gedichte, deren Schlussverse nur einen kleinen Teil einer Seite einnehmen (so z.B. bei den Gedichten „stätten“ (S. 44–45), „erinnerung an jene dörfer und verhüllung“ (S. 55–58)). Ähnliches gilt für die Sammlung die versprengung,17 wo z.B. bei zweiteiligen Gedichten wie „die namen“ (S. 32–33) und „revenant“ (S. 68–69) dafür gesorgt wurde, dass die zwei Teile einander gegenübergestellt werden, so dass der erste Teil auf der linken Seite steht (und nicht auf der rechten, wie es die Regeln des Druckwesens für die Anfänge von Texten oder Kapiteln verlangen würden) und dann, obwohl es auf der linken Seite noch Platz für mehr Verse gegeben hätte, der zweite Teil des Gedichts auf der rechten Seite beginnt (in der Werkausgabe Werke I ist es dagegen nicht so: „die namen“ etwa fängt auf einer rechten Seite an, die den ersten Teil und die ersten vier Verse des zweiten enthält, während der zweite Teil auf der Rückseite weitergeht, so dass der Leser keinen Blick mehr auf das ganze Gedicht hat).18 Wenn man bedenkt, dass binäre Formen (und ein binäres Denken und eine binäre Bilderwelt) für Hilbig charakteristisch sind, so kann man bedauern, dass die Bedingungen eines spontanen visuellen Erfassens dieser Dimension nicht grundsätzlich gewährleistet sind.
1.1.2 Datierung
Ein zweiter Aspekt, der auch (nicht nur!) textimmanent besprochen werden kann, ist die Datierung der Gedichte. Man könnte meinen, dass dies eher oder nur vom textgenetischen Standpunkt her relevant ist. Textgenetisch hieße das, dass man die aufeinanderfolgenden Versionen eines Gedichtes oder eines Gedichtbandes untersucht. Im Fall von Hilbig ist es anders: Textgenetische Studien bleiben ein Desideratum der Forschung (und jeder, der im Archiv auf unzählbare handgeschriebene Fassungen eines Gedichts oder einer Strophe in unterschiedlichen Konvoluten gestoßen ist, weiß, was für ein gigantisches Unterfangen es wäre) und die Datierung der Gedichte, so wie wir sie kennen, verweist auf „die erste für sich bestehende Niederschrift des Textes“ (so Thomas Beckermann),19 nicht aber auf den ersten Einfall und auch nicht auf die endgültige Fassung. Die in den publizierten Sammlungen angegebenen Daten sind also keinesfalls durch textgenetische Untersuchungen belegt. Das hat zur Folge, dass man diese Datierungen, wenn sie in einer Ausgabe stehen, durchaus als aussagekräftigen Teil des Textes ansehen kann. Das gilt für abwesenheit und Bilder vom Erzählen, in denen die Jahreszahl nach jedem Gedichttitel im Inhaltsverzeichnis steht, während in der versprengung, keine Daten angegeben sind (anders in den Anthologien stimme stimme und zwischen den paradiesen: hier steht die Jahreszahl am Ende eines jeden Gedichts). Dass dies nicht unbedingt immer logisch oder nachvollziehbar erscheint, zeigt auch ein Brief von Thorsten Ahrend, als er den Band zwischen den paradiesen redigierte:
Noch andere Fragen: Sollen die Jahreszahlen ins Inhaltsverzeichnis gesetzt werden oder jeweils unter den Text? Ich wäre für „unter den Text“. Einige fehlen; genau für die Texte, die in versprengung enthalten sind, nicht aber gleichzeitig in stimme stimme. (in versprengung sind ja die Entstehungsdaten generell nicht angegeben.)20
Diese Datierungen müssen als vom Autor angegeben betrachtet werden, unabhängig von einer Rekonstruktion der Textgeschichte, die anhand der sukzessiven Fassungen zu erstellen wäre. Denn die Datierungen besagen etwas über die Intention der jeweiligen Sammlung; in abwesenheit und in Bilder vom Erzählen gibt der Autor Auskunft über seinen Werdegang bzw. er inszeniert ihn: in abwesenheit veröffentlicht er Gedichte aus den Jahren 1965 bis 1977, in Bilder vom Erzählen von 1986 bis zum Publikationsjahr 2001. In abwesenheit sind die Gedichte überwiegend chronologisch geordnet (zu den Ausnahmen s.u.), was bedeutet, dass der Autor sich in dieser ersten Buchveröffentlichung seiner Leserschaft auf diese Art vorstellt. In Bilder vom Erzählen gibt es keine chronologische Reihenfolge, so dass andere Gründe für die ausgewählte Anordnung zu suchen sind als die bloße Chronologie. In die versprengung gibt es gar keine Angaben: Es ist auch der vierte Band von Hilbig, der in der Collection S. Fischer innerhalb einer ziemlich kurzen Zeitspanne erschien (1979 abwesenheit, 1982 Unterm Neomond, 1985 Der Brief, 1986 die versprengung), und er enthält – wie im Ankündigungstext zu lesen ist – „neu[e] Gedichte“ (S. 1) eines Autors, der auf ein Werk zurückblicken kann und schon rezipiert wurde. Dass einige Gedichte – wenn man sich auf die Angaben in Werke I verlässt – aus derselben Zeit stammen wie Gedichte aus dem letzten Drittel von abwesenbeit (z.B. „nature morte“ 1974), wurde wahrscheinlich absichtlich beiseitegelassen. So gesehen könnte man sagen, dass die Datierungen, abseits von textgenetischen Betrachtungen, durchaus Bestandteil der Sammlungen sind und in dieser Hinsicht Sinn ergeben.
1.1.3 Titelgedichte
Der Titel einer Gedichtsammlung übernimmt nicht prinzipiell den Titel eines Gedichtes: in Celans Die Niemandsrose trägt kein Gedicht diesen Titel; dies gilt auch für Baudelaires Fleur du mal (eine Gruppe von Gedichten innerhalb der Sammlung trägt aber diesen Titel). Außer im Fall der bereits erwähnten Sammlung aus dem Nachlass Scherben für damals und jetzt tragen aber Hilbigs Gedichtbände immer den Titel eines Gedichtes (dies gilt sowohl für die drei Sammlungen wie für beide Anthologien). Titelgedichte einer Sammlung gelten im Allgemeinen als besonders relevant: Man könnte meinen, sie hätten erwas Programmatisches; als Text gäben sie der Quintessenz der Sammlung Ausdruck und würden Korrespondenzen sowohl mit dem Ganzen als auch mit den verschiedenen Teilen enthalten. Eine Aussage Hilbigs lädt dazu ein, dies im Fall von abwesenheit zu präzisieren. Man weiß – hier wird der zweite Teil des vorliegenden Beitrags vorweggenommen –, dass Hilbig und Beckermann sich zuerst auf den Titel gegen den strom geeinigt hatten, worüber Hilbig sich in seinem Brief vom 19. Februar 1979 sehr genau und selbstbewusst äußert:
Ihre Frage nach dem Titel, „gegen den strom. gedichte“, beantworte ich bis zu unserem Zusammentreffen im März noch zustimmend, d.h. bis Sie mir sagen, der Titel ginge so nicht, oder ähnliches; ich kann mich vorläufig nicht zu einem anderen entschließen, obwohl auch schon Gert Neumann sehr bedenkenswerte Argumente dagegen geltend machte. Eine Erklärung, wie ich dazu kam: der Titel ist eigentlich von Huysmans (sein Buch „À rebours“; bei uns erschienen als „Gegen den Strich“), dessen Werk in der damaligen Literatursituation in die Gegenrichtung zum immer mehr sich verhärtenden Naturalismus zeigte, ein literarisches Abenteuer, damals, dessen Ansprüchen mein Band vielleicht nicht gerecht zu werden vermag. Mein Gedicht „gegen den strom“, das eine solche Bedeutung natürlich nicht trägt, verstehe ich deshalb weniger als Titelgedicht, und wenn, eventuell nur deshalb, weil es ja nicht ein Gegen-den-Strom-Schwimmen, sondern ein Gegen-den-Strom-Deuten ausdrücken soll, eine Geste, die mir damals beim Lesen der „Einzelheiten“ Enzensbergers gefiel (deshalb die Widmung).21
Abgesehen von den interessanten Verweisen auf Huysmans, die literarische Position des Autors (implizite Parallele zwischen Naturalismus und Sozialistischem Realismus) und dessen Selbstverständnis, ist hier auch die Bedeutung relevant, die Hilbig einem Titelgedicht oder eher einem titelgebenden Gedicht beimisst: Nicht das jeweilige Gedicht beleuchtet die ganze Sammlung, sondern der Titel löst sich vom einzelnen Gedicht und gewinnt Bedeutung auf einer höheren Ebene.
1.2 Zu den einzelnen Sammlungen
Was die einzelnen Sammlungen angeht, wird jetzt hauptsächlich auf abwesenheit und die versprengung eingegangen werden, denn es ist zu Bilder vom Erzählen viel mehr als über die ersten zwei Sammlungen geschrieben worden in Bezug auf den Zykluscharakter, vor allem von Marie-Luise Bott, Stephan Pabst und Bénédicte Terrisse.22 Es wird hier jeweils versucht, einige markante Züge im Aufbau der Sammlungen zu erkennen, etwa interne Zyklen, Unterteilungen oder Querverbindungen.
1.2.1 Die Sammlung „abwesenheit“
Der Tenor dieser aus 66 Gedichten bestehenden Sammlung ist die in einer unerhörten Vielfalt der Formen, Bilder und Motive zum Ausdruck gebrachte psychische Verwirrung eines Ich. Das Herkunftsland wird indirekt genannt und die Situation des Arbeiters evoziert („abwesenheit“, „aufenthalt“, „episode)“, wie auch die deutsche Geschichte („nach dem zweiten weltkrieg“). Der Akzent liegt aber auf den „mauern für meinen schädel“ (S. 7), auf der Entwirklichung der Realität, und verweist somit auf eine absolute Absage an den Realismus. Diese negativen Merkmale, diese Poetik des Subtrahierens, sie wird kompatibel gemacht mit einer bildreichen Sprache und der behaupteten Möglichkeit einer – wenn auch schmerzhaften, widersprüchlichen und prekären – Poesie und einer Poetisierung der Welt, die jedoch allen ästhetisierenden Täuschungen entgegenarbeiten. Die „Weltanschauung“ des Ich ist voller Widersprüche und Kontraste, sie basiert auf dem Bewusstsein einer Spannung zwischen polaren Gegensätzen.
Diese Themen und Stimmungen werden in der Sammlung deutlich und die Sammlung ist zum Teil entsprechend aufgebaut. So findet man Gedichtgruppen mit zusammenhängen&r Thematik, z.B. die sieben Gedichte von „tod und toilettenseife“ bis „aufenthalt“, die Orte und Räume evozieren, oder die vier Gedichte von „trauer. braun und blau“ bis „leben“, die die triste Alltagsroutine spüren lassen.
Anschließend an die vorherigen Bemerkungen zur Seitengestaltung ist festzustellen, dass sich in der Sammlung kürzere, sogar sehr kurze Gedichte mit längeren und langen abwechseln, mit einer Tendenz zu langen Gedichten gegen Schluss (ab dem Gedicht „flaschenpost“). Es erweckt den Eindruck von unterschiedlichen Schaffensperioden: viele Gedichte aus den Jahren 1965/66 und 1973 z.B. tendieren zu einer drastischen Reduktion des Sprachmaterials (vgl. S. 7–12 und S. 62–67). In diesem Zusammenhang ist auch die Gegenüberstellung der zwei Sonette „das ende der jugend“ und „novalis“ (S. 50–51) zu verstehen, die sowohl formal wie poetologisch auf andere Epochen und Autoren der Poesie verweisen, nicht nur auf die Romantik durch den Namen Novalis, sondern auch auf Stefan George durch die Form und die Bilder im Sonett. Dadurch entstehen Sequenzen in der Sammlung: in den ersten drei Gedichten „lasst mich doch“, „ihr habt ein haus gebaut“ und „bitte“ richtet sich das Ich nicht nur zum ersten Mal an den Leser, sondern auch an ein Kollektiv, dem er gleichzeitig eine schroffe Absage erteilt: Das Ich wird nicht „mitmachen“; dieses konsequente Widersprechen kulminiert in „gegen den strom. grober rückfall“ (das 30. Gedicht), das auch in der Konstruktion der Sammlung einen „Rückfall“ in den Zustand der ersten Gedichte bildet, und auf die kurze aus „grober rückfall“, „bewusstein“ und „gedicht“ bestehende Sequenz folgt „weiterreise des dichters“, ein Gedicht, das – als 33. Gedicht ist es das Schlussgedicht der ersten Hälfte – sowohl die Entwicklung zu längeren, epischen Texten am Schluss der Sammlung wie auch die Meeresmetaphorik in den letzten zwei Gedichten und in Bilder vom Erzählen vorwegnimmt. Religiöse und mythologische Bilder tauchen auch in den drei unmittelbar folgenden Gedichten auf: „teilnahme an einem abendmahl“, „sehnsucht nach einer orgel“ und „gleichnis“ benennen auch den Sinn für das Schöne, sei es nur durch die „sehnsucht […] / nach einer hymne / die ich nicht singen kann –“ („sehnsucht nach einer orgel“, S. 41).
So kann man keinesfalls von einem bloßen Nebeneinander der Gedichte sprechen, sondern kleine Gruppen von Gedichten lassen eine dynamische Bewegung von Kontrasten entstehen. Diese Dynamik lässt sich auch an der Entwicklung und der Symmetrie zwischen dem ersten und dem letzten Gedicht der Sammlung feststellen: So unterschiedlich die Gedichte „lasst mich doch“ und „das fenster“ auch sind (sei es nur dadurch, dass das erste eine relativ klare Aussage macht, während das letzte den Interpreten herausfordert), eine Gemeinsamkeit ist das Motiv der Einsamkeit des Ich: im ersten Gedicht kündigt das Ich diese Einsamkeit in fast abstrakter Weise an, fordert oder erbittet sie, im letzten ist es tatsächlich allein; außerdem kann das letzte längere Gedicht zum Teil als Summe der vorhergehenden angesehen werden – dadurch dass es Bilder wiederaufnimmt (z.B. das Meer aus dem „meer in sachsen“), erzählend und reich an versteckten biographischen und persönlichen Elementen ist, die vorher schon einzeln Erwähnung gefunden hatten (Arbeit als Heizer, sächsische Herkunft, Familiengeschichte); all das lässt Einsamkeit und Einzigartigkeit des Ich noch drastischer erscheinen.23
(…)
2. Textgenetisches: zu abwesenheit
Neben diesen textimmanenten Auseinandersetzungen mit den Gedichtsammlungen könnte ein anderer Zugang zu der Struktur von Gedichtsammlungen textgenetischer Art sein. Als Beispiel dafür, wohl aber ohne endgültige Schlussfolgerungen zu ermöglichen, sollen hier einige Aspekte der Entstehung von abwesenheit rekonstruiert werden.
2.1 Außenperspektive auf die Entstehung und briefliche Dokumente
Die Monate bzw. Jahre, die zur ersten Buchpublikation Hilbigs führten, zeugen von der Langsamkeit der Bewusstwerdung als Schriftsteller. Die Zeit bis zur Publikation wurde von Michael Opitz dokumentiert und beschrieben,24 wobei nicht das ganze Material, der gesamte Briefwechsel zwischen Hilbig, Gert Neumann, Margret Franzlik und Thomas Beckermann sowie mit verschiedenen Instanzen, leicht auffindbar oder zugänglich ist. Die Suche nach solchen Briefen ist – so könnte man sagen – ungefähr so wie die Darstellung von Briefverkehr, wie man sie in manchen Prosatexten Hilbigs findet.25
Die Initiative des Fischer Verlags, einen Gedichtband Hilbigs zu veröffentlichen, ist auf den Lektor Thomas Beckermann zurückzuführen, der Ende Oktober 1977 Hilbig anschrieb, nachdem er auf einen Hinweis von dem Journalisten Karl Corino hin Hilbigs Gedichte im Hessischen Rundfunk gehört hatte, sie ihn „neugierig gemacht“ und „in ihrer Klarheit und Einfachheit (bitte nicht mit schlichter Naivität zu verwechseln) sehr beeindruckt“ (27.10.1977) hatten. Er bat um alle von Hilbig im Radio vorgetragenen Gedichte, um sie eventuell zu veröffentlichen. Corino versprach ihm die Zusendung von 30 der erbetenen Gedichte, die Beckermann allerdings erst erheblich später erhielt (24.2.1978). Hilbig kündigte in seinem Antwortbrief zusätzlich zu den geforderten noch 38 weitere Gedichte an und schrieb:
Es sind ja, wie Sie an den Jahreszahlen sehen werden, fast alles ältere Gedichte (1974/75/76 schrieb ich kaum welche, fast nur Prosa; ich dachte, Gedichte gingen nicht mehr), aber es werden auch einige neuerliche Versuche dabei sein. (27.11.1977)
Ein Treffen war auf der Leipziger Buchmesse 1978 geplant, wo sich Hilbig und Beckermann „über die Zusammenstellung des Gedichtbandes unterhalten“ (31.12.1977) wollten. Diese Kontakte waren ein Grund für die Untersuchungshaft Hilbigs von Mai bis Juli 1978. Am 18. Januar 1979 (in zwei auf denselben Tag datierten, aber unterschiedlichen Briefen) äußerte Beckermann den Wunsch, „im Herbst Ihren [Hilbigs] Band ,gegen den strom‘ in der Collection S. Fischer [zu] bringen“. Er plante wohl erneut eine Begegnung auf der Buchmesse:
Ich werde die Texte jetzt noch ein mal genauer durchsehen und sie mit Ihrer Vorschlagsliste vergleichen. (18.1.1979). Später wurde der Titel geändert und der neue Titel soll von Margret Franzlik, der damaligen Lebensgefährtin von Hilbig, vorgeschlagen und von Gert Neumann begrüßt worden sein:26
[D]en Titel für Hilbigs ersten Band im S. Fischer Verlag „abwesenheit“ habe übrigens ich ausgesucht, nachdem die ursprüngliche Variante „Gegen den Strom“ verworfen worden war. Auch der Titel des einzigen Buches von Wolfgang Hilbig in der DDR „stimme stimme“ geht auf meinen Vorschlag zurück.27
Die Entstehung des Bandes ist schwierig nachzuvollziehen und zusammenzufassen, auch weil die an Beckermann per Post abgeschickten Fahnenkorrekturen den Adressaten anscheinend nicht erreichten, so dass Hilbig die Korrekturen telefonisch übermitteln musste, wobei er sich eines Betriebstelefons bediente, was gewisse Probleme mit sich brachte (22.7.1979). Im Sommer erhielt Hilbig die Belegexemplare nicht, sie waren konfisziert worden und das erste Exemplar, das Hilbig schließlich in den Händen halten konnte, war das von Gert Neumann nach dessen Rückkehr aus dem Urlaub.28
Wichtig für den Kontext der Entstehung ist also die Tatsache, dass Hilbig nicht immer direkt das Publikationsverfahren und die Gestaltung des Buches mitverfolgen oder kontrollieren konnte, vielleicht sogar nicht einmal die endgültige Textauswahl treffen konnte, was Aussagen von Gert Neumann und Margret Franzlik nahezulegen scheinen.29 So schreibt Margret Franzlik 2017:
[I]ch weiß noch genau, wie ich Gert Neumann damals – mein Gott, wie lange ist das alles schon her, fast vier Jahrzehnte! – im Diakonissenhaus in Leipzig Leutzsch, in der Georg-Schwarz-Straße traf. Ich kann förmlich noch unsere ständige Angst vor der Stasi [Staatssicherheit, M. F.] nachfühlen. Ebenso habe ich die enormen Schwierigkeiten einer postalischen und – noch schlimmer – telefonischen Verständigung mit Thomas Beckermann vor Augen. Nachdem Wolfgang Hilbig auf seiner Arbeitsstelle verboten worden war, das Telefon für Anrufe in den Westen zu nutzen, mussten wir oft stundenlang auf der Meuselwitzer Hauptpost auf eine Verbindung warten.30
Briefe Hilbigs an Margret Franzlik geben Aufschluss über die Entstehung:
Ich bin unterdessen hier schon wieder in Sorge! Denn ich habe den Rückschein von meiner Post an Beckermann noch immer nicht! Jetzt kommt es mir bald so vor, als wäre dieser Brief verschwunden. Ich werde diese Woche noch abwarten, dann werde ich etwas unternehmen: auf der Post nach dem Verbleib dieses Briefes fragen. Es könnte geschehen, dass Du dann eventuell noch einmal an B. [Beckermann, M. F.] schreiben musst. In der Zwischenzeit bekam ich eine Karte von Corino. Er fragt mich in etwa, ob ich nicht schreiben wolle. Es kommt mir fast so vor, als wäre man dort im Allgemeinen ratlos, was mich betrifft, und vielleicht ist es auch so, dass Beckermann ihn leicht angetippt hat, er solle mal vorsichtig bei mir nachfragen. Denn die Karte ist vorsichtig. Er hätte mich in einem Artikel vom 1. August noch als verhaftet gemeldet. Also man blickt überhaupt nicht richtig durch in Bezug auf mich, und die Dinge müssen geklärt werden.31
Liebste! Gestern noch schrieb ich Dir, dass der Rückschein aus Frankfurt immer noch nicht hier sei. Heute nun ist er endlich hier! Am 14.9. abgesandt, lt. Poststempel. Und mein Brief an Beckermann ging am 27.8. per Eilpost ab. Also eine Unzeit. Aber dennoch, es ist ein gutes Gefühl, Post zu erhalten. Nun warte ich auf einen Brief, der hoffentlich bald kommt und mir mitteilt, dass alles gut angekommen ist. Wer hatte denn Deinen Rückschein unterschrieben? Bei mir ist es ein Name: F. Diet oder Diel. Aber ich denke doch, dass der Brief in die richtigen Hände gekommen ist…32
Der Briefwechsel zwischen Hilbig und Margret Franzlik aus dieser Zeit zeigt auch, dass sie es war, die zwischen Hilbig und Neumann vermittelte, und es kam vor, wie Beckermann an anderer Stelle schrieb, dass „Gert Neumann für Wolfgang Hilbig antwortete“33 und „aus Sorge um sein [Hilbig] Manuskript“34 nicht immer mit dessen Einverständnis.
2.2 Zeugnisse über die Auswahl der abwesenheit-Gedichte im Archiv der Akademie der Künste
Hilbigs Gedichtsammlung wurde als Überblick über sein Lyrikschaffen in den Jahren 1965 (also nach den damals nirgends erwähnten Scherben für damals und jetzt) konzipiert. Im Archiv der Akademie der Künste sind mehrere Konvolute zu finden, die über die Anzahl und die Reihenfolge der Gedichte Aufschluss geben. Statt Hypothesen zu entwickeln, wollen wir hier eine Tabelle mit den Ergebnissen einer Aufarbeitung der jeweiligen Konvolute erstellen.
Wolfgang Hilbig, „abwesenheit“ (1979)
Übersicht über die Entstehung der Gedichtsammlung:
1. abwesenheit, Buchausgabe Fischer Verlag, 1979; [66 Gedichte, 1965–1977].
2. AdK Signatur „Hilbig 173“: Liste (gestrichen und mit dem Wort „erledigt“ versehen) von 38 Gedichten, „Gedichte, am 23.12.77, an Thomas Beckermann, Fischer Verlag, Frankfurt a.M., geschickt. Datumsangabe auf dem beiliegenden Brief: 19. Dez. 77. […] Jeweils letzte Version Stand Dez. 77“; [auf der Rückseite steht geschrieben:] „August 1978: 7 Gedichte“ [=1A bis 7A, Nummerierung durch den Verf. in der Tabelle].35
3. AdK Signatur „Hilbig 117“: „1965–1977, ohne Datum“: Konvolut mit nummerierten Gedichten (oft 2 Exemplare desselben Gedichtes). Es handelt sich hier um eine frühere, undatierte Fassung von abwesenheit (oder gegen den strom) mit 73 Gedichten: sie enthält außer allen 66 Gedichten der Ausgabe 1979 sieben andere, später verworfene Gedichte.36
4. AdK Signatur„ Hilbig 123“: Neben Manuskripten und Typoskripten von Gedichten enthält das Konvolut eine Liste von 25 Gedichten, genannt „1965–1981, ohne Datum“; Unterschiede zu den Fassungen der Buchausgabe lassen sich feststellen. Die in dieser Spalte der Tabelle ange führten Gedichte aus dieser Liste sind diejenigen, die auch Eingang in abwesenheit fanden. Zu den übrigen Gedichten siehe den Kommentar nach der Tabelle.
In Grau: die später auch in stimme stimme publizierten Gedichte.
Eine unterstrichene Jahresangabe verweist auf eine Unterbrechung der chronologischen Reihenfolge.
TB: Thomas Beckermann
Hier sei auch die Liste der 25 (und von 1 bis 25 durchnummerierten) im Konvolut „Hilbig123“ der Akademie der Künste enthaltenen Gedichte erwähnt (s. vorletzte Spalte der Tabelle). Darunter gibt es Gedichte, die nach der Veröffentlichung von abwesenheit entstanden, also auf ein an deres, virtuelles Gedichtsammlungsprojekt verweisen. Obwohl das Kon volut also nicht auf die eigentliche Struktur von abwesenheit zurückge führt werden kann, ist die Liste insofern aufschlussreich, als sie eine Reihenfolge der abwesenheit-Gedichte angibt, die von der in der Samm lung verwirklichten völlig abweicht. Die durchgestrichenen Titel zeigen, dass der Autor für einige Gedichte mehrere Positionen in Erwägung ge zogen hatte; außerdem enthält die Liste Leerzeilen, die auf Unterteilungen in der Sammlung hinweisen; schließlich muss auch vermerkt werden, dass die Titel hier großgeschrieben sind.
1) Bitte
2) H. Selbsportrait von hinten
3) Nach dem zweiten…
4) Garten an der Kirche
5) Gedicht
6) Vorfrühling. Mundtot
7) Gespaltenes Thema Störungen
8) Stoerungcn Monolog eins37
9) Monolog eins Flaschen post
10) Flaschenpost Schluss mit der Wetter …
11) Alibi
12) Interieur eines Traumes
13) Verhüllung
14) Verse um an frühere zu erinnern…38
15) Zeugung
16) Teilnahme an einem Abendmahl
17) Das Erwachen
18) Anbeginn?
19) Gespaltenes Thema
20) Tedeum
21) Diese von Lichtahnen
22) Ankerlos
23) Und so beladen
24) Schwarzäther
25) Feuerverwobenes
Schlussbemerkungen
Nach diesen Erkundungen zu einem Gegenstand, von dem anfangs nicht sicher war, ob sich die Untersuchung überhaupt lohnen würde, können folgende Schlüsse gezogen, bzw. Fragen aufgeworfen werden.
1. Die allgemeine Frage, ob das Mehr an Verständnis oder die Analyse, welche sich aus dem In-Verbindung-Setzen mehrerer Gedichte unter einander ergeben, überhaupt legitim sind – stehen sie nicht im Wider spruch zur Einheitlichkeit und zur Einmaligkeit jedes einzelnen Ge dichts? – diese Frage stellt sich auch im Fall von Hilbig. Stützt man sich auf die textimmanente Lektüre wie auch auf textgenetische Informatio nen, stellt man jedenfalls fest, dass die drei von Hilbig veröffentlichten Sammlungen im Laufe der Zeit eine immer stärkere und bewusstere Komposition aufweisen. Das heißt also auch, dass die Berücksichtigung dieser Makrostruktur einen hermeneutischen Gewinn mit sich bringt, der Wirkung und Wert des einzelnen Gedichts nicht schmälert, sondern ergänzt. Eine genauere Untersuchung der Entstehung von die verspren gung und von Bilder vom Erzählen wäre unter diesem Aspekt zu emp fehlen.
2. Es gibt bei Hilbig neben den als solche publizierten Sammlungen auch andere Formen des „Zusammenseins“ von Gedichten, mit mehr oder weniger latenten Korrespondenzen innerhalb seiner Gesamtproduktion als Lyriker: so z.B. die verschiedenen monologe, von denen man sich fragen kann, ob die Tatsache, dass diese Gedichte dasselbe Wort im Titel tra gen, es erlaubt, sie miteinander in Verbindung zu setzen, eine Konstella tion zu bilden; oder auch prosa meiner heimatstraße, ein Langgedicht, dessen komplizierte Entstehung sowohl Suche nach Kohärenz wie Ent grenzung und unendliche Verzweigungen aufweist.39 Auch hier wären genauere Untersuchungen nötig.
Die Gültigkeit einer Analyse der Sammlungen muss im Falle von Hilbig auch an der Situation des Autors im Literaturfeld und an der Entwick lung dieser Situation gemessen werden. Eine textgenetische Untersu chung darf eben diese Tatsache nicht übersehen. Die Bedingungen, unter denen es zu einer Veröffentlichung kommt, spielen eine Rolle und es gibt wohl bei allen publizierenden Schriftstellern eine Rückwirkung der ge wonnenen Anerkennung auf die nächsten Veröffentlichungen. Das gilt ebenso für Hilbigs drei Gedichtsammlungen: Während Bilder vom Erzählen als (wenn auch heikles) Alterswerk des poeta laureatus gelesen wer den kann, stehen die versprengung und abwesenheit zwischen zwei Lite raturfeldern. abwesenheit ist auf jeden Fall zu betrachten als Ergebnis von Hilbigs Wunsch, überhaupt ein Buch zu publizieren, das heißt wahrgenommen zu werden, wobei die Komposition der Sammlung, wie wir ge sehen haben, hier wahrscheinlich nicht im Vordergrund stand.40
Schließlich wollen und können diese Mutmaßungen nicht mehr sein als ein Anfang und sie ändern nichts an der Tatsache, dass allgemeine und makrostrukturelle Bemerkungen Gefahr laufen, an den Gedichten vor beizureden. Man muss weiter einzelne Gedichte erörtern, wie es der vor liegende Band auch tut, und eine Art Hin-und-Her-Lesen zwischen Ge dichten und Gedichtsammlungen, eine gegenseitige, wechselseitige Ausleuchtung praktizieren, immer in dem Bewusstsein, dass eine Sammlung mehr sein kann als die Summe der einzelnen Gedichte, genauso wie die Gedichte mehr sind als nur Teile einer Sammlung.
Dieser Umgang mit den Gedichten kann abschließend mit einer einleuch tenden Bemerkung Thomas Beckermanns in Verbindung gebracht wer den, eine Bemerkung, die zeigt, wie fließend die Beziehungen zwischen Prosa und Gedichten und zwischen einzelnen Texten und Gesamtheit eines (im Sinne der Romantik) universalpoetischen Werkes sind, was auch dadurch bestätigt wird, dass Hilbig zur Zeit von abwesenheit viel mehr auf sein Projekt blaue blume41 denn auf seine Gedichte setzte. Von Hilbigs Schreibpraxis in seinen jungen Jahren sagt Beckermann:
[er] wurde Sol dat und arbeitete dann als Werkzeugmacher, schrieb und schrieb, vor allem romantische Prosa mit Gedichten (bis er die Erfahrung machte, daß seine Gedichte auch für sich bestehen konnten).42
Bernard Banoun, aus Bernard Banoun, Bénédicte Terrisse, Sylvie Arlaud und Stephan Pabst (Hrsg.): Wolfgang Hilbigs Lyrik. Eine Werkexpedition, Verbrecher Verlag, 2021
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Günter Zehm: Gelbes Gras vor den Abraumhalden
Die Welt, 29.9.1979
Karl Corino: Nach dem Krieg das Aufräumen vergessen
Stuttgarter Zeitung, 9.10.1979
Harald Hartung: Das schreiende Amt des Dichters
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.1979
Hans-Jürgen Schmitt: Überleben durch Poesie
Frankfurter Rundschau, 10.10.1979
Barbara Meyer: Gestaltete Leere
Neue Zürcher Zeitung, 12.10.1979
Siegmar Faust: Ernste Zuschriften nach Meuselwitz
Die Welt, 14.2.1981
Hans-Jürgen Heise: Abwesenheit
Die Zeit, 16.10.1981
Siegmar Faust: Eine Freiheit in mir, die mit Mauern starrt
Neue Deutsche Hefte, Heft 164, 1979
Franz Fühmann: Praxis und Dialektik der Abwesenheit. Eine imaginäre Rede
Merkur, Heft 10, 1982
Theo Mechtenberg: Literatur als Plädoyer für eine zweite Wirklichkeit. Anmerkungen zum poetologischen Programm von Gert Neumann, Wolfgang Hilbig und Wolfgang Hegewald
Deutschland Archiv, Heft 3, 1986
Wolfgang Hilbig: „Ich unterwerfe mich nicht der Zensur“. Briefe an DDR-Ministerien, Minister und Behörden
Herausgegeben und kommentiert von Michael Opitz
Neue Rundschau, Heft 2, 2021
abwesenheit
wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet
keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind
wie wir in uns selbst verkrochen sind
in unsere schwärze
nein wir werden nicht vermißt
wir haben stark zerbrochne hände steife nacken −
das ist der stolz der zerstörten und tote dinge
schaun auf uns zu tod gelangweilte dinge – es ist
eine zerstörung wie sie nie gewesen ist
und wir werden nicht vermißt unsere worte sind
gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee
wo bäume stehn prangend weiß im reif – ja und
reif zum zerbrechen
alles das letzte ist uns zerstört unsere hände
zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch
geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache
einander vermengt und völlig egal in allem
und der wir nachlaufen und unserer abwesenheit
nachlaufen so wie uns am abend
verjagte hunde nachlaufen mit kranken
unbegreiflichen augen.
Sehnsucht nach Anwesenheit
Auf dem Umschlag seiner ersten Buchveröffentlichung, dem Gedichtband abwesenheit (1979), der in der DDR nicht erscheinen durfte, ist der junge Wolfgang Hilbig abgelichtet: ein breites Gesicht mit Boxernase, der Blick nach innen gekehrt, von leicht gelockten langen Haaren umweht. Ein wenig erinnert er an Billy the Kid in Sam Peckinpahs poetischem Spätwestern, dargestellt von dem Rock-Sänger Kris Kristofferson. Grad so ein Rebell und Outlaw muß Hilbig in seinem Land gewesen sein, ein scandalon: Der Proletarier, wie zum Bilderbuchdichter des Arbeiter- und Bauernstaates berufen, nahm – statt sozialistisch-realistischer Schönfärberei zu frönen – überall Unrat wahr, Aussatz, Abgründe und Schrecken. So wurde er bald zum „Fremdkörper“ und zum „Un-Literaten“ befördert, der – wie er selbst bekennt – „ständig unter Wirklichkeits- und Bewußtseinsentzug“ litt. 1985 wich er in die Bundesrepublik aus.
Doch Hilbig kommt von seiner sächsischen Heimat nicht los. Wie im Fieber imaginiert er die Landschaft um Meuselwitz, die von schlammigen Wegen, stillgelegten Kohlebergwerken und maroden Industrieanlagen durchfurcht ist. Seine Gedichte und Erzählungen sind Zeugnisse der Verweigerung wie der lch-Suche; sie zeichnen sich aus durch die Dinglichkeit der in Bewegung versetzten Einsamkeitsbilder, die der Autodidakt, nach intensiver Beschäftigung mit der ihm zugänglichen modernen Weltliteratur, in sich selbst ausgegraben hat.
Das vorliegende (Titel-)Gedicht entstand 1969, ein Jahr nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Es setzt mit fast biblischem Pathos ein: „wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet“ – von Staat, Kirche, Patron oder von einer höheren moralischen Instanz? – unsere Hoffnungslosigkeit, an der wir, „in uns selbst verkrochen“, leiden und die uns anfüllt mit „schwärze“? Die Antwort folgt prompt: Wir werden überhaupt „nicht vermißt“, niemand sucht uns. Dies „wir“, das hier ausschließlich spricht, scheint ein Kollektiv der Opfer zu sein, derer, die ihr Selbstbewußtsein, ihre Selbstachtung längst verloren haben und wie gefangene Tiere mit „unbegreiflichen augen“ umherirren. Sie haben „zerbrochne hände“ und „steife nacken“ vom Arbeiten in den Bergwerken, vielleicht auch von der Folter, und „tote dinge“ umgeben sie – „es ist / eine zerstörung wie sie nie gewesen ist“. So klingt bereits das Ende der zweiten Strophe wie ein (vorzeitiges) Resümee.
Und doch gibt es eine Steigerung. Denn nicht nur „unsere hände“ und die winterlich bereiften „bäume“ zerbrechen, auch unsere Sprache ist „restlos zerbrochen“ und völlig beliebig geworden. Auf sie ist, wie auf uns, kein Verlaß mehr, sie verfehlt die Dinge, die sie bezeichnen soll: Sprachlosigkeit als Form der Abwesenheit.
Hilbigs frühes Gedicht hat Bildkraft, Rhythmus, einen Atem, der durch alle fünf Strophen und über einige Wiederholungen hinweg bis zur letzten Silbe trägt. Es stellt eine kühne, im Ton unerbittliche Abrechnung mit der allgegenwärtigen Zerstörung von Landschaft und Menschen in der noch machtvollen DDR dar und ist zugleich, als Klage und Anklage, auch im goldenen Westen verständlich. Es beschwört mit expressivem Pathos die universelle Krankheit der Zeit. Es malt die Welt pechschwarz in ihrer Entfremdung, als totale „abwesenheit“ von Licht, Leben, Frühling, sinnvoller Ordnung, Freiheit, Selbstvertrauen, und bezieht auch den Dichter ins Kollektiv der sprachlos Abwesenden mit ein. Doch zugleich verkörpert es selber, als Sprachkunstwerk, das „ganz Andere“ (Celan) der Poesie und widerspricht insofern der lückenlos ausgemalten Vorhölle auch wieder, beflügelt von der Sehnsucht nach Anwesenheit, zumindest im Gedicht.
Michael Buselmeier, aus: Christoph Buchwald, Michael Buselmeier und Michael Braun (Hrsg.): Jahrbuch der Lyrik 1996/97, C.H. Beck Verlag, 1996.
Praxis und Dialektik der Abwesenheit
Eine imaginäre Rede
sand kommt
ich sehe ihn nicht wie er nachts mich zu füllen beginnt
mit dem geknirsch einer durstigen zukunft
Der Anlaß sucht seine Gelegenheit, und so stelle ich mir denn vor, einer der namhaften Verleger meines Landes feiert ein Jubiläum, sagen wir: seinen siebzigsten Geburtstag, und die literarische Öffentlichkeit sei versammelt, Geschenk und Huldigung darzubringen, und auch mir – mein Träumen überschreitet Grenzen – wäre Gelegenheit gegeben, ein Scherflein meinerweis beizutragen und in einer der Feierstunden zwar nicht die Rühmungsrede selbst – die bliebe Befugteren vorbehalten −, aber doch zu Ehren des Jubilars ein Etwas zu Literatur artikulieren zu dürfen, so träte ich denn vor das Publikum, machte meine Reverenz vor dem Herrn Minister, setzte mich – Stil sei Stil – an das Biedermeiertischlein und räusperte mich und hübe an:
Was ich hier zu sagen habe, entspringt Betroffenheit, und ich wünsche, sie wäre ungebrochen. Ich wollte, sie wäre nur jener Art, die uns erst verstummen und dann aufjauchzen macht, da ein Dichter in unsre Gesellschaft getreten. Ich würde dann einfach zu berichten beginnen, daß eine Stimme in mein Dasein getreten, von der Überwältigt man sofort weiß, daß man sie nicht mehr vergessen kann. Ein Klang, den man vorher noch nicht vernommen; Rhythmen, Bilder, Verse, Strophen; Gefüge aus Worten, die uns bestürzen als Gedichte ebenjener Art, wie sie vor mehr als dreißig Jahren in einem Aufsatz zur Situation der zeitgenössischen Lyrik Stephan Hermlin so fordernd vermißt und so schmerzlich ersehnt hat: „Gedichte, die uns erschrecken, an denen etwas ist, was wir nie ganz verstehen – Gedichte, die unser Leben ändern, die beim Wiederlesen von unbegreiflicher Neuheit sind.“ – Ich würde, wäre nur diese Betroffenheit, dann zum Beweis ein paar Zeilen referieren, dies Bild etwa:
es war das zwielicht dieser gasse ganz
aus einem toten traum;
oder dies wilde Ausbrechen eines drängenden Rhythmus aus dem ruhigen Fluß des klassischen Blankverses, den Beginn eines Gedichtes: „verhüllung“:
noch immer sage ich die gleichen worte
noch immer fasse ich nichts kann ich nicht halten
was so unsäglich vorüberzieht
ich senke ich hebe
die stimme winke mit beiden händen wie wild
während rings in dünsten von flammen geht aller
entfesselter phosphor des abends und manchmal
lautlose grelle ungeheuer stehn in mir auf…;
oder, ebenfalls einen Anfang, diese Verschmelzung von Erd- und Zeitgeschichte, ganz ohneglcichen im poetischen Raum: „das meer in sachsen“:
braunkohle mit mehr als fünfzig prozent
wassergehalt wird in sachsen gegraben
furchtbare unglücke
katastrophen im tertiär preßten
das meer in die kohle in sachsen wüst und gottgewollt
trat erde über die ufer zerdrückte das meer
und seine lagunen mit mammutbäumen das meer
kocht und dampft in der kohle in sachsen
die
menschen
in sachsen mit fellen behängt
sammeln sich an den küsten der unterirdischen energie
schütteln drohende fäuste gegen das meer gegen
die neuaufschlüsse des meers
(gelbes gras wuchert von den wellenkämmen des abraums
hinab zu den straßen gedeiht im sperrfeuer
vorüberflammender frontscheiben…;
oder schließlich diese Strophe:
denn ich sah auf den tod wie auf einen kalten hof
einen werkhof wo grobe maschinen verfallen
belebt von einem nachtwind aus nassem papier
und fast durchschritt ich den dunklen torweg
den ein vom leben entlasteter alter arbeiter
durchmaß sein schnell vergeßnes sterben erfüllend
und dem meine irre stimme endlos nachruft.
Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Betroffenheit vor diesem Wort, das solcherart nur einer findet, dem die vielberedete Industriewelt, noch dazu in besonders grauer Variante, zum Existenzerleben geworden ist. So eine Strophe kann nur jemand schreiben, der erfahren hat, daß auch Maschinen sterben, einen schäbigen Tod, so wie manche Ideen, eingesargt in Fetzen nassen Papiers, das träg in der Zugluft klatscht und raschelt, verloren in diesen Höfen und Hallen, darin jedes Gedenken an den Tod von denen verbannt und verpönt worden ist, die ihm dort nicht einmal in Gedanken begegnen.
Ein Arbeiter hat diese Zeilen geschrieben, das sollte für uns schon Grund zum Stolz, zumindest zu Genugtuung sein, doch wenn ich nun einen Namen nenne, gesellt sich zu meiner Betroffenheit vor der Macht und der Würde seiner Worte eine andere, die mich verstört. Der schmale Band, aus dem ich die meisten der Verse zitiert habe, heißt abwesenheit, und wenn ein Titel Quintessenz des Buches ist, das er vertritt, dann dieser in schmerzlich hohem Grade.
Der Autor ist ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik; seine Gedichte sind in Frankfurt am Main erschienen, und der innigste Wunsch meiner Worte ist, in dem Titel abwesenheit einen einzigen Buchstaben austauschen zu helfen.
Vorab ein Stück Biographie: Der Mann ist Jahrgang 41, geboren in der Kohle in Sachsen, in Meuselwitz, einer krummen Stadt aus Dampfrohren, Ruß und gekappten Linden. – Ringsum Abraumhalden, Gehölz und Wind. – Der Vater bei Stalingrad gefallen, das Kind unter Kumpeln aufgewachsen, in der Familie seines Großvaters, der aus der Kohle in Schlesien gekommen:
wie das steppengras zischte und die halme sich rieben so
klangen seine polnischen flüche in seinem lachen
grollten hufe und gewitter seine stirn ein feuer
wetterleuchtete fern die rote kolchis.
Lehre als Dreher; Wehrpflicht; diverse Berufe: Werkzeugmacher, Monteur, Erdarbeiter, Heizer, LPG-Schlosser, Aufräumer in einer Ausflugsgaststätte; jetzt Kesselwart in einer Berliner Großwäscherei. Dem Kraftwerk seiner Vaterstadt hat er dies Gedicht gewidmet:
EPISODE
im düstern kesselhaus im licht
rußiger lampen plötzlich auf dem brikettberg
saß ein grüner fasan
aaaaaaaaaaaaaaaaaein prächtiger clown
silbern und grün den leuchtend roten reif am hals mit
unverwandtem aug mit dem großen gelben schnabel aufmerksam
zielte er auf mich
aaaaaaaaaaaaaaso war er herrlicher und schöner
als ein surrealistischer regenschirm auf einer nähmaschine
wie er dort saß genau und furchtlos verirrt
auf seinem schwarzen gipfel
konversation fand nicht statt
ich bewegte mich und er flog davon durch die offene tür
doch von weit her den geruch der sonne den duft
seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht
und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen
und als das kausale grinsen meines kopfes
von energie und frost gefressen in die nacht verschwand
glaubte ich nicht mehr an den untergang
der wahrnehmungen in der finsternis.
Ich will jetzt nicht ins Wider und Für der Umstände eintreten, die zur Abwesenheit dieses Gedichtes hier, in seiner originären Heimat, geführt haben; ich bin bereit, an Mißverständnisse zu glauben und alles Widrige unerwidert abgetan sein zu lassen, um den Tatbestand selbst nicht hinnehmen zu müssen: Ich wünsche so sehr, und ich wünsche es in diesem Saal, und vor diesen Gästen, und aus diesem Anlaß, und ich wage zu sagen: ich wünsche mit Ihnen, daß diese Abwesenheit in ihr Gegenteil umschlägt. Ich wünsche es nicht zuletzt mit dem Dichter selbst, wie ich ihn aus seinen Versen verstehe: Es ist eine Abwesenheit, die nach Anwesenheit schreit, freilich von Anfang an im Ahnen letztlichen Unerfüllbarseins. Anwesenheit hat ja manche Grade; der erste ist simples physisches Hier-Sein, der letzte wäre Identität, Selbstfindung durch das Wirken in einer Gesellschaft, darin nach einem Wort von Karl Marx „die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“. – Die Erfahrung, daß dies Ersehnte versagt bleibt, weist auf ein Knäuel von Widersprüchen, meist vereinfacht als „Widerspruch zwischen Ideal und Realität“ eingeordnet und damit schon so abgetan, als ob Benennung Bewältigung wäre. Immerhin: sie könnte damit beginnen; auch ein Widerspruchsknäuel muß noch nicht schrecken, doch daß es so wenig Bewußtsein werden, das heißt so wenig artikuliert und der öffentlichen Analyse gestellt werden kann, macht seine Entfaltung so peinsam stockend und gibt uns das quälende Gefühl, daß sie sich unbewältigt vollzieht. Denn das Problem von An- und Abwesenheit stellt sich ja nicht nur theoretisch; es ist die Praxis, die uns leiden macht, und ich weigere mich zu glauben, daß lediglich Mißverständnisse walten und daß da wie dort nur Dummheit sich irrt oder Starrsinn Fehlentscheidungen trifft. All dies ist zwar auch da, und wahrscheinlich mehr als vertretbar, doch das Problem reicht tiefer hinab. Eine seiner geschichtlichen Wurzeln ist die Entfremdung zwischen Künstler und Publikum oder, um bei der einmal bezogenen Terminologie zu bleiben: die weitgehende wechselseitige Abwesenheit in der Sphäre des Andern mitsamt dem heftigen Begehren, gerade dort anwesend zu sein.
Daß dies Begehren so unerfüllt bleibt, erzeugt beim Publikum zumeist Ärger, beim Künstler zu oft das Gefühl der Ohnmacht, sein Wirken so eingeschränkt zu sehen, daß das Schaffen bis zum Versiegen entmutigt oder in eine Richtung gelenkt wird, die er als seiner nicht gemäß weiß und die seiner Absicht entgegenläuft, zum Hochmut etwa oder zum l’art pour l’art. Bei diesem Autor zwingt die Abwesenheit ein naturhaft helles Lebensgefühl in die Bitternis der Verzweiflung:
wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet
keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind
wie wir in uns selbst verkrochen sind
in unsere schwärze.
− Qual ungewollten Abwesendseins, und sie paart sich mit der Qual, einer Verlockung widerstehen zu müssen, die als Eintrittsbillett zur Anwesenheit Preisgabe von Erfahrung verlangt, partielle Selbstaufgabe also, die auf andre Art Schaffen und Wirken zersetzt. Ungewollte Anwesenheit: als einer, der man nicht ist noch sein will. Denn man ist als Dichter ja nicht teilbar; Dichter sein heißt aufs Ganze aus sein, was voraussetzt, sich selbst ganz zu haben, genauer: sich selbst finden zu wollen; darum ist man als Dichter nur ganz da oder gar nicht: als die Kraft, die man ist, und mit dem Werk, das man hat. Verkrüppelung ist keine Synthese, sondern nur schlechtes Anwesendsein: eine als Anwesenheit kaschierte, also verlogene Abwesenheit.
Man verliert sich dann selbst, anstatt sich zu finden.
Die Gedichte dieses Autors, in dem Bändchen annähernd chronologisch nach der Entstehungszeit zwischen Mitte der sechziger und Ende der siebziger Jahre geordnet, machen eine der Bewegungen sichtbar, die jenes Widerspruchsknäuel heraustreibt; hier ist es ein Reifen. Am Schluß wird sich die Erfahrung ausdrücken, daß die Identität, die naiv ersehnt war, nicht nur deshalb kein Ziel sein könne, weil sie nie erreicht werden kann; zu Beginn jedoch ist das Begehren nach Anwesenheit als der schreiende Wunsch nach dem Ein- und Aufgehen eines „ich“ in ein „ihr“ da, einem Einssein von Dichter und Gesellschaft, die man vorerst aufs schroffste gegeneinander gestellt sieht:
ihr habt mir geld aufgespart
lieber stehle ich.
− Abweisung von Anwesenheit. Mir ist dies Selbstbewußtsein sympathisch; die übliche Formel heißt: „lieber hungere ich“. – Dieses schroffe Gegeneinander ohne erkennbare Möglichkeit eines Berührens macht das Begehren nach Identität kaum glaublich, allein es ist dennoch von Anfang an da (das Gedicht selbst ist ja sein beredter Ausdruck), und es wird als das Paradox ausgesprochen, das einen Widerspruch in Worte bannt:
ihr habt mir geld aufgespart
lieber stehle ich.
ihr habt mir einen weg gebahnt
ich schlag mich
durchs gestrüpp seitlich des wegs.
sagtet ihr man soll allein gehn
würd ich gehn
mit euch.
− Die Angerufenen werden dies niemals sagen, und wenn, dann folgten Konsequenzen: die äußersten Grade von Abwesenheit, denn auch die Abwesenheit hat Stufen. Dieses Gedicht ist 1965 geschrieben, das Gedicht eines Vierundzwanzigjährigen, und sein Postulat ist so rigoros naiv wie sein Begehren naiv rigoros. Doch solches haben verblüffend ähnlich auch andere und nicht nur junge – Dichter verlangt; und es wird vielleicht immer noch formuliert, und mit immer noch einer gleichen Hoffnung. In seinem wesentlichen Inhalt aber, dem Verlangen nach unherstellbarem Einssein, nach paradoxer Identität, wurde es schon sehr viel früher gesagt. Wird man erschrecken (und wird der Autor erschrecken), wenn ich an Alfred Jarry erinnere, an die berühmten Szenen im Ubu Enchaîné, das Exerzieren der drei freien Männer?
Vierter Akt, erste Szene. Platz vor dem Gefängnis. Die drei freien Männer treten auf:
Erster freier Mann zum zweiten: Wohin, Kamerad? Zum Exerzieren, wie jeden Morgen? Hoho, ich glaube, du gehorchst.
Zweiter freier Mann: Der Korporal hat mir verboten, morgens um diese Zeit zum Exerzieren zu gehen. Ich bin ein freier Mann, also gehe ich jeden Morgen zum Exerzieren.
Erster und dritter freier Mann: Und so begegnen wir uns jeden Morgen ganz zufällig zur selben Zeit, um gemeinsam ungehorsam zu sein.
Und auf dem Exerzierplatz, beim gemeinsamen Ungehorsam, stoßen sie auf den Korporal – so begegnen einander zwei kontradiktorische Kräfte, die sich gegenseitig logisch aufheben müßten, doch da sie einander nicht im Raum des Gedachten, sondern leibhaftig, als Personen, begegnen, entsteht eine absurde Situation: Was logisch nicht sein kann, ist real da. – Morgensterns messerscharfer Schluß erscheint umgedreht. – Jarry benutzt die absurde Szene, eine Phrase ad absurdum zu führen; er läßt die in der bürgerlichen Gesellschaft als total proklamierte Freiheit sich zum Selbstbeweis die Freiheit nehmen, in einer Sphäre wirksam zu werden, deren Wesen die Unterordnung, also eben die Nicht-Freiheit ist. Die drei freien Männer Jarrys, Unentwegte der liberté, wollen freie Männer bleiben, aber zugleich auch Soldaten werden, was hieße, unfreie Mannen zu sein. Das logisch Unmögliche, der Korporal macht’s hier möglich: er kaschiert die Unfreiheit. Das ist komisch, doch diese absurde Komik ist einer tiefen Tragik entsprungen: „liberte“ ist ja ein Schlachtruf gewesen, mit dem das Bürgertum gegen den Adel gezogen; sie war Hoffnung und wurde Illusion, doch wenn auch die Hoffnung nicht eingelöst wurde und die Illusion bis zum Selbstbetrug absinkt, erlischt die Sehnsucht nach Freiheit deshalb noch nicht. Werden Surrogate verschmäht, wird sie nur brennender; stumpft sie nicht ab, wächst die Begierde nach ihr ins Paradoxe, und so bei jedem unabgegoltenen Ideal.
sagtet ihr man soll allein gehn / würd ich gehn / mit euch. – Als ob das konkrete „ihr“ das je sagen könnte; doch das paradox gewordene „wir“ war einmal Verheißung, dem Entfalten des „ich“ großen Raum zu eröffnen, und die ist nicht zurückgenommen. – Der Wunsch danach bleibt legitim. – Er ist, der Wunsch, übrigens symmetrisch, auch das „ihr“ möchte sich in vielen „ich“ erweitern, doch er zielt nun in beiden Richtungen dahin, daß der Andere nicht mehr sei, was er ist. Die Symmetrie sollte nicht vergessen machen, daß die Tendenzen der Wünsche widereinanderlaufen: mit der Verheißung und gegen sie. Die Realisierung des naiven Wunsches ergäbe eine absurde Szene, doch im Absurden steckt immer Tragik, es ist Ausdruck von Ohnmacht angesichts von Tragik, und das Gelächter, das darin gellt (und das auch in diesem Gedicht sich schon sammelt; man soll es, dies Gedicht, nicht als „rührend“ abwerten), ist als Verzweiflungsgelächter ein guter Stachel, sich mit der Ohnmacht nicht abzufinden, nicht mit der Ohnmacht von Abwesenheit, doch auch nicht mit der Ohnmacht von Anwesenheit, die nichts als Selbstentäußerung wäre, gepaart mit der wohlfeilen Illusion, ebendarum Selbstbehauptung zu sein. – Eine echte Selbstbehauptung liegt im Gelächter, das der Verzweiflung entbricht, um ihr nicht zu erliegen, und das beginnt als Hohngelächter über sich selbst. Bei diesem Autor wächst es in Selbstabrechnungen hinüber, die, weil sie so rigoros ehrlich sind, wie das Naiv-Sein rigoros gewesen, und weil das Ich, das sich da schneidend verhöhnt, ja auch einen Teil der Gesellschaft bedeutet, jenes rigorose Stück Zeit- und Gesellschaftskritik darstellen, das die Kluft zwischen Verheißung und Realität am Subjekt, in der eigenen Seele, zeigt:
ungeachtet eurer heroischen skulpturen
hinter den schaufensterscheiben eures ersatzes
von wasserfontänen die auf ihrer höhe
ein gefroren scheinen
winde ich mich noch manchmal vor dem spiegel
die mir ergrauende haut betrachtend und
flechte mir eine rose ins haar −
ich weiß noch als ich jünger war als ich noch
euer sohn war wünschte ich manchmal
meine schmutzige jacke wäre aus glas
damit ihr meine schönheit sähet −
Wiederum: das „ich“ und das „ihr“, doch nun, sieben Jahre nach dem naiven Begehren: Was ist aus euch, was aus mir geworden! – als ich noch euer sohn war – das ist nun vorbei. – Die Naivität ist reflektiert; was einst als „rührend“ noch belächelt sein konnte, hebt nun an, mächtig anzurühren; die Ohnmacht drückt sich nicht mehr im Wunsch aus, sondern beginnt sich zu begreifen und damit zu empören; und das Nähere siehe bei Hegel, unter „Herr und Knecht“. – Ohnmacht heißt ja immer: nichts als Objekt sein, und man erhebt sich aus ihr zum Subjekt nur dadurch, daß man wagt, sich als Objekt anzuschauen; bei diesem Mann in einem Selbstdistanzierungsverfahren, das solches Anschaun ganz wörtlich nimmt. – Abwesenheit auch von sich selbst; aber so, im rigorosen Willen zu sehn und zu begreifen und zu sagen, „was ist“, eine gute Abwesenheit, weil nach guter Anwesenheit dürstend.
die hand im haar so hockt er
ruhlos am tisch,
so beginnt ein Gedicht mit dem Titel „h. selbst-portrait von hinten“; in einem anderen heißt es:
− hier liegt mit mir mein blauer anzug heftig
blutend im blauen schnee
das alles ist in mir das alles wäscht mich rein und
plötzlich bin ich der unverhoffte hund der seinen schwanz
auf meine schulter schlägt und mir ins ohr raunt: faß ihn
faß ihn beiß ihn ins bein deinen bruder und piß
an diesen baum dort dem sollen die drosseln
zu durstigem holz
verdorren.
Selbstbehauptung durch Selbstzufriedenheit wäre nur die Reproduktion der Ohnmacht; im Negativen als wohliges Versinken ins Violett der vertrauten Verzweiflung; im Positiven entspräche sie der Bewußtseinslage der drei freien Männer auf dem Exerzierplatz, die von der Freiheit den Namen retten, ihre Unfreiheit damit zu etikettieren.
Ein Gedicht der abwesenheit scheint ihnen gewidmet:
ICH BEGREIFE NICHT
ich sah nicht die toten
schwarzgesichtig an stricken hangend
grünbäuchig unter algen treibend
erschlagen auf schlachtfeldern
ich sah die zuhaus
im bett starben
ich begreife nicht
die schreckliche zufriedenheit
ihrer gesichter.
Die schreckliche zufriedenheit, das ist das Genügen an einer schlechten Anwesenheit oder, um in unsres Autors Sprache zu sprechen: der Ausdruck eines Lebensgefühls, das seinen Durst verloren hat.
Es ist, glaube ich, Baudelaires Vorschlag gewesen, das Werk eines Dichters dadurch zu gewinnen, daß man die Worte zusammenstellt, die er immer wieder verwendet. Ich habe das getan und dies Register festgehalten:
Haar – Traum – Nacht – Schlaf – Durst – Sonne – Wind – Leib – Lust – Mund – trinken – schmecken – trunken – Rose – Gras – Regen – Baum – Licht – Phosphor – Feuer – Flamme – Dunst – Duft – Schweiß – Sturz – Tod, und die Farbe: blau. Es sind dies Namen elementarer Dinge, Elemente der Natur und des Leibes, und es gibt ein Wort, dem sie entstammen und in dem sie sich sammeln: ihre Quintessenz heißt durst.
Dieses Wort, ich habe es zehnmal gezählt, könnte der andere Titel dieses Bandes sein: stürmisches Begehren nach Anwesenheit.
In diesem Gedicht ist der Durst der Urtrieb, das Lebensprinzip in Natur wie Bewußtsein, der Allbeweger und Allbezwinger, unwiderstehlich bis zur Tyrannei. Er ist die Phantasie des Seins und die magische Macht der Poesie:
die wörter wollen ihre namen
die ländereien auf dem gemäuer werden verrückt
die meere mißachten die vorsehung stürmen
die ufer
die namen nehmen gestalt an schreckliche
bärtige götter sie heulen nach feuer
und schwert sie werfen mich aufs bett
und öffnen mir die schenkel.
Er ist, dieser Durst, die Begierde zu wirken, Begehren nach erfüllten Dasein, nach Sättigung des Leibes wie des Geistes, nach Befriedigung aller Bedürfnisse, derart, daß immer neue aufkeimen können; ein Durst nach Schönheit, nach Wissen, nach ·Rausch wie Bewußtheit, nach Sinn wie Sinnenhaftigkeit. Es ist der Durst nach der Anwesenheit des Fasans auf dem Brikettberg in Meuselwitz – eine Episode, die natürlich ein Traum ist, auch wenn sie wirklich geschehen sein sollte (was tatsächlich der Fall gewesen ist), aber Fasane sind nun einmal nicht grün und haben keinen gelben Schnabel und keinen roten Reif um den silbernen Hals. Der Fasan sagt die Sehnsucht nach dem Traum wie die Sehnsucht, der Träume nicht mehr zu bedürfen, da die Wirklichkeit es ihnen gleichtut, phantastischer als jede Kunst und lächelnd über die Mühen der Mythen. Diese Sehnsucht ist reflektiert und ist doch die große Kindersehnsucht, oder besser: die Sehnsucht nach einer Zeit, darin Sehen und Sein noch vereinigt waren, da die Wünsche, auch die absurden, im Spiel des Kinds sich realisierten. Es ist der Durst nach Rausch und Bewußtheit, der diesen Mann im Kesselhaus ins Abenteuer moderner Dichtung gerissen, zur Begegnung des Regenschirms mit der Nähmaschine auf dem Operationstisch, wie eine berühmte Definition des Surrealismus sie festhält, und über alles hin aufs bateau ivre Rimbauds, das Trunkene Schiff aller Jünglingsträume, dem er als Tellerwäscher in Mecklenburg in Gestalt einer getippten Abschrift begegnete und darauf er, ein großes, staunendes Kind, das Meer in Sachsen hinuntertreibt, durch Meuselwitz bis Senftenberg und Schkopau:
ich
bin ein wahnsinniges kind man erlaubt mir
das violette distelfeld eines spätsommers zu verwüsten
zu stampfen im bach mit einer haut von kohlenstaub
… ich bin das kind dem erlaubt ist
vom graugrünen meer zu wissen (doch einst
war ich älter
vom meer durchwogt von der masse seiner goldenen vegetation
erfüllt vom laich einer sonnigen brut die gottes
unglück uns verlor
vom geruch riesiger goldener tabakblätter überm meer
von der strahlenden energie des kohlenstoffs im meer
die den samen
neuer menschen gebar…
Man muß all diese Gedichte des Sinnenrausches, der Anwesenheit im Sinnen haften, des Schwelgens im Glück des Verschwendens von Schönheit vor der Folie seines Anfangs sehen; darum habe ich so lange bei ihm verweilt. – Das Paradox entspringt einem Durst nach Dasein im naiv wörtlichen Sinn des Wortes. – Es ist der Durst des Ackers nach Regen, des Zunders nach Feuer, des Blitzes nach dem Erdgrund und der Pollen nach Wind; es ist der Durst der Planeten nach einem Behauser und der Durst der Behauser nach neuen Welten; es ist der Durst Fausts, den das Pergament nicht löschte; der Durst Hiobs nach einem Sinn seiner Plagen; der Psalmendurst nach Gerechtigkeit; der Durst Don Juans und der Durst Marco Polos; der Durst, mit dem trunkenen Boot zu treiben; der Durst des armen Volks in der Wüste, der Wasser aus dem Felsen schlägt; der gute Durst Gargantuas und der Durst des Mannes im Kesselhaus nach acht Stunden vor dem Feuerloch, der Durst aller Poren im trocknen Beton, der Durst auf den sommerzerglühten Feldern, doch er schlägt in der einzigen Möglichkeit eines Gelöschtwerdens fast nur mit Surrogaten, die ihn immer brennender machen (so wie Lake den Durst nur stachelt statt stillt), in den Durst nach bloßem Ende des Dursts um, in den Durst, einer Wirklichkeit zu entfliehen, die Begierden erzeugt, ohne sie zu befriedigen; der gute Durst wird schlechter Durst, und seine Befriedigung schafft einen Zustand schrecklicher Zufriedenheit anderer Art: statt des Trunkenseins das Betrunkensein.
In dem Gedicht „aufenthalt“, Titel eines ewigen Gleichnisses, liegen, in einem Leben anwesend, das nichts andres als leere Nicht-Abwesenheit ist, die Leute dann so in ihren Betten:
in den wohnungen in denen wir hausen
bleibt das licht eingeschalten die luft
schließt öffnet die fenster schlägt
die flügel ans holz unaufhörlich
die revolution ist vorüber die kalender
zeigen den vergangenen monat an
auf den tischen stehn gläser in der tabakasche
auf den dielen bierpftützen zündhölzer scherben
schmutzige schuhe auf dem rücken
die leute in den betten
schlafen
aus den wohnungen in denen wir uns aufhalten
flüchten die stunden wie die luft auch der schlaf
hält sich nicht lange auf
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaawir bauen ein chemiewerk
für die zehnte generation flittern die gestänge
mit kalten kabeln später ein kraftwerk für
noch später doch vielleicht gibt es krieg
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam morgen
explodieren die wecker überschütten uns
mit schellendem feuer
der tag ist vorüber die schranktüren offen
das radio spricht englisch an den wänden
flattern nackte fotos auf den betten
sind wir
im unterzeug rauchen noch eine
frau das ist dann alles…
Das ist alles, denn mehr ist nicht da, vom Chemiewerk für die zehnte Generation ist ja schon die Rede gewesen, und vom „noch später“ auch, und von der Revolution auch, und vielleicht gibt es Krieg, und das war dann alles, denn mehr ist an diesem Ort, da man sich aufhält, nicht anwesend gewesen, aber das kann doch nicht alles sein. – Oder doch? – Oder dies gar, dieses:
LEBEN
einer sitzt nervös auf dem abtritt rafft
die hose auf den dürren knien quält sich
mit seinem stuhlgang der andre lehnt lässig
am pfosten der offiziellen tür raucht und während
er halblaut einspricht auf den sitzenden schiebt er
mit dem fuß zerstreut einen fetzen zeitungspapier
hin und her durch die pfützen auf dem steinboden
während nebenan ein dritter seinen harn ins becken
läßt deutlich hörbar überm geräusch
der defekten wasserspülung −
nun? wirst du fragen – nichts
nichts als dies das ist leben was
glaubtest du sonst −
Man würde den Dichter bös mißverstehen, wenn man diesen Dreizehnzeiler nur als ein Stück krassen Naturalismus abtäte; er ist eine großartige Metapher und eine sehr überlegte Komposition. – Anwesendsein auf der untersten Stufe. – Und man würde ihn ebenso mißverstehen, wenn man den Dichter für einen Zyniker hielte: sein Dürsten spricht gegen ein Zynischsein. Ein Zyniker hat sich abgefunden; der da will aus Zuständen heraus, die er als dreifach unwürdig empfindet: seiner selbst, der Gesellschaft, der Gattung Mensch, bei ihm zumeist durch Liebende repräsentiert. Ebendeshalb – so bekennt sein Gedicht „bewußtsein“ – hat er, und im Namen dieser Dreiheit, das schreiende Amt der Poesie – oder vielleicht besser: in der Poesie, und: in seiner Poesie – übernommen, um aus der Ohnmacht herauszukommen, aus der Abwesenheit, aus einem Gesellschaftsgestocktsein, in das sich eine Verheißung verkehrt hat, aus diesem warmen klebrigen brei / der kaum noch durchsichtig ist / der mich festhält der mich so / festhält. Es ist das Sich-nicht-entfalten-Können auch als Zustand der Gesellschaft, der ihn, und nicht nur ihn, so quält, dieses Brachliegen schöpferischer Kräfte, dies Vertun von Entwicklungsmöglichkeiten, dies Negieren alternativer Bereitschaft, diese Dumpfheit unkritischen Bewußtseins und darüber das satte Selbstbehagen, jene schreckliche zufriedenheit, die sich ununterbrochen selbst versichert, daß sie es so herrlich weit gebracht, und die jedes Reflexionsangebot mit der Elle dieses Versicherns läßt. Nicht, daß da nichts wäre, was in der Tat weit gebracht ist, nicht, daß es nicht wenig Errungenschaften gäbe, darauf die Gesellschaft stolz sein kann, doch man würde das Amt der Literatur – und zumal darin ein schreiendes amt – mißverstehen, wollte man von ihm ein Register all dessen erwarten, was der Gesellschaft zum Ruhm gereicht. – Von allen sozialen Funktionen ist diese am wenigsten vakant; der Durst geht nach anderm. – Für Kommende zu bauen bleibt durchaus etwas Großes, aber andere tun das ja auch und taten es vordem, und der Ruhm aller Zukunft verkommt zur Phrase, wenn er Unabgegoltnes im heute verdeckt. Dann erzeugt die Gesellschaft bestenfalls nur die Frage, ob ihr Alles denn nun auch alles sei, und in der Resignation solchen Fragens steckt die Antwort resignierender Flucht. – Was dazwischen liegt, heißt:
RATLOSIGKEIT
auf dem tisch liegen meine ellenbogen
hemdsärmlig meine hände haltlos
und meine blicke und bücher
und schweigen
bis ich mich find irre und
betrunken in den späten straßen…
Allzu viele finden sich so.
Unter den Gedichten der abwesenheit sind Gedichte eines Trinkers, der als ein poetisches Ich erscheint, das in öden Bahnhofslokalen säuft, einer öderen Öde zu entkommen; das im Trinken Vergessen sucht und trinkt, um Erinnerungen zu beschwören; das im Rausch seine Möbel als die Wölfe begrüßt, mit denen es seinen Aufenthalt teilt und die außen wie innen den Alltag durchheulen; das mit dem guten blauen Anzug im Dreck liegt, heftig blutend in Lachen von lila Erbrochenem, und das dann sein Bild im Spiegel verachtet und in dem, der ihm entgegenstiert, all das haßt, was den Menschen zur Trunksucht treibt, weil es den Durst als Produktivkraft mißachtet. – Es zeugt von der Würde dieses poetischen Ichs (die mich in vielem an die Maxim Gorkis erinnert), daß es, seine Ohnmacht überwindend, Schuld und Verantwortung so lange nur bei sich sucht, bis es ein Werk geleistet hat, dieses Resümee zu ziehen:
ich verachte die zeiten
die ich reifte.
Das Gegenbild des Verlorenen Sohnes: Würde und Qual der Einsamkeit.
Anwesenheit hat, wie Abwesenheit, manche Grade. Hier sind Gedichte eines ungewollt Einsamen, der wohl die Illusion über das Erreichen des letzten, doch nie das Recht auf jenen verlor, den ich für ein Naturrecht jedes Dichters halte: mit seinen Gedichten so dazusein, daß sie die Leser erreichen können.
Denn auch wir Leser haben ein Recht auf die Dichter, zuerst auf die Dichter unseres Landes, und zumal auf eine solche Begabung, wie sie die Zeit nur von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hervorbringt. Ich habe allzulange von ihm so gesprochen, als ob das, was er schreibt, nur Philosophie sei (wiewohl es das auch ist), und viel zuwenig von dem, was den Dichter macht. Diesen Dichter, der ein Arbeiter ist und mit der Wucht der Elemente wie mit der von Haar und Traum umgeht und die Würde der Gattung Mensch auch in der Latrinenlandschaft bewahrt; ein großes Kind, das mit Meeren spielt; ein Trunkener, der Arm in Arm mit Rimbaud und Novalis aus dem Kesselhaus durch die Tagbauwüste in ein Auenholz zieht, dort Gedichte zu träumen, darin Traum und Alltag im Vers sich vereinen und die in ihren Rhythmen und Klängen Ausdruck dieser Vereinigung sind: Durst von Worten, die gierig einander suchen, das Unerhörte erkennbar zu machen, das immer in aller Wirklichkeit da ist und das nur einer wahrnehmen kann, der trunken mit allen Sinnen wach ist −: den duft seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht. – Das ist das Legat des Fasans gewesen; das ist scheinbar ganz einfach und kunstlos gesagt, doch darin sind Nase und Auge und Ohr da, Duft, Farbe, Gelächter und die Macht des Traums, die zugleich die Nacht vor dem grauen Brikettberg mit der Kälte und dem Bahnhofslokal ist.
Doch warum soIl ich über den Dichter sprechen, wenn sein Gedicht es noch tun kann, und zumal mit der Fixierung des Momentes, da ein Zustand von Abwesenheit sich anschickt, in etwas Anderes überzugehen:
GESTE
bevor du einschläfst sprach sie schließ das fenster
in der küche wegen des winds da draußen und ganz
in ihrem duft noch ging ich und dachte nirgendwo
ist eine mütze voll wind
durch den hof fuhr ein geheul und krachend
schlug eine leiter um die gardinen sausten
reißend ins freie und ich dachte nirgends
nur eine nase voll wind
während ich dies dachte rüttelte die nacht
an den bäumen mit schweren tropfen vermischt
alle blätter jagten sich wirbelnd in die luft
und ich sagte mir es ist nichts
nichts nirgendwo ein mund voll wind
ich setzte mich an den tisch wie auf einem boot
das haar stürzte nur in die stirn und ich dachte
ach nirgends nur ein mund voll wind.
Der Sprung liegt in dem Wörtchen „ach“.
Lieber Jubilar (und es folgte der Name), ich mache Ihnen zu Ihrem siebzigsten Geburtstag das schönste Geschenk, das man einem Verleger machen kann: ich zeige Ihnen einen Dichter. Er ist hier nicht anwesend. Seine Abwesenheit quält; sein Anwesendsein wird Schwierigkeit bringen: Er ist ein Dichter.
Er heißt Wolfgang Hilbig.
Franz Fühmann, 1979
Eigenwillige Ankunft
Einige Anmerkungen zu Wolfgang Hilbig (vor seiner ersten Buchveröffentlichung)
Wolfgang Hilbig fiel mir zuerst als Leser auf. Daß er damals schon schrieb, wußte ich nicht; auch kannte ich nicht seinen Namen. Wolfgang Hilbig kam Anfang der siebziger Jahre regelmäßig während der Leipziger Buchmesse zum Suhrkamp-Stand; wir sprachen wie Fremde miteinander, dann nahm er sich ein Buch, Gedichte von Paul Celan, die Einzelheiten von Hans Magnus Enzensberger oder einen Band der zeitgenössischen europäischen Literatur, setzte sich hin und las stundenlang.
Im März 1978 lernte ich Wolfgang Hilbig kennen, wieder in Leipzig, diesmal am Stand des S. Fischer Verlags. Ich hatte inzwischen einige seiner Gedichte gelesen, deshalb beeindruckte mich besonders seine Sprachlosigkeit. Er redete wenig und nur kurz, hielt seine Sprache gleichsam in seinem kräftigen, gedrungenen Körper verborgen. Er, der immer mit einer kurzen Jacke und einer alten Tasche unterwegs war, antwortete stockend auf für ihn zu schnell gestellte Fragen. Vielleicht seines damals noch breiten sächsischen Dialekts wegen; vielleicht weil er langsam und sorgfältig dachte und formulierte; vielleicht auch weil ihm das Reden einfach keinen Spaß machte. Vielleicht auch wirkten sich die Scheu und das Mißtrauen aus: hier der schreibende Arbeiter aus der DDR, dort der studierte Vertreter eines der großen literarischen Verlage aus der BRD. – Bei diesen ersten Treffen war Wolfgang Hilbig immer mit Gert Neumann zusammen, und es kam durchaus vor, daß Gert Neumann für Wolfgang Hilbig antwortete, dieser also nur interessiert zuzuhören brauchte, wobei sein Mienenspiel verriet, daß er mit der Antwort nicht immer einverstanden war.
I „er sitzt auf dem sprung er sagt ich bin / solitair“
Wolfgang Hilbig wuchs auf als Einzelkind mit seiner Mutter bei seinen Großeltern (mütterlicherseits). Der Großvater war Bergarbeiter und Analphabet; er starb 1973, seine Großmutter 1954. Daheim gab es keine Bücher. Dennoch las Wolfgang Hilbig früh und viel, nach der üblichen Jugendlektüre vor allem die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, die ihm ein Bekannter, der später Arzt wurde, ausgeliehen hatte. Besonders hatten es ihm die Prosa und Kunstmärchen der deutschen Romantik angetan: Brentano, Eichendorff (Aus dem Leben eines Taugenichts) und Tieck (Der blonde Eckbert). Seit der fünften Schulklasse schrieb und zeichnete er Western und Comics – Imitationen der wenigen aus der BRD geschmuggelten Hefte −, die er im kleinen Freundeskreis kursieren ließ.
Nach acht Jahren Grundschule machte Wolfgang Hilbig eine dreijährige Bohrwerksdreher-Lehre, wurde Soldat und arbeitete dann als Werkzeugmacher, schrieb und schrieb, vor allem romantische Prosa mit Gedichten (bis er die Erfahrung machte, daß seine Gedichte auch für sich bestehen können). 1964 delegierten ihn die Hochfrequenzwerkstätten Meuselwitz in den Leipziger „Zirkel schreibender Arbeiten“. Auf diese Weise lernte er 1965 in einem Vorbereitungsseminar für die Arbeiterfestspiele auf Schloß Sonderhausen als ersten Schriftsteller Gert Neumann und später dann Siegmar Faust und Heidemarie Härtl kennen. 1965 vernichtete er alle bis dahin geschriebenen Texte, las nun Lenau, Hölderlin, die deutschen Klassiker, Rimbaud (in der Übersetzung von Paul Zech) und Edgar Allan Poe, die französische Lyrik der Jahrhundertwende und die des deutschen Expressionismus und ein wenig Kafka (die kurze Prosa, Tagebuch-Auszüge und das Heizer-Kapitel).
Ungefähr 1966 hatte die Zeitschrift des „Zirkels“, die unter dem Titel Ich schreibe in geringer Auflage erschien, vier frühe Gedichte von Wolfgang Hilbig veröffentlicht. 1967 verließ er den „Zirkel“ wegen eines Streits über Wolf Biermann und reiste durch die DDR – bisweilen zusammen mit Gert Neumann – auf Außenmontage in Großbetrieben, als Erdbauarbeiter, Hilfsschlosser oder Abräumer in einer Ausflugsgaststätte (z. B. am Tollensee-See). Ab 1970 war er als Heizer tätig, zuerst in Meuselwitz und später dann in Ost-Berlin.
Im Juli 1968 hatte die Zeitschrift Neue Deutsche Literatur nicht Gedichte, sondern – wider Erwarten – eine Anzeige Wolfgang Hilbigs veröffentlicht, in der er fragte: „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte?“ Der Autor hatte dies als Provokation und Verhöhnung gemeint, denn gerade diese Zeitschrift verstand sich als Sprachrohr der DDR-Gegenwartsliteratur. Es gab keine Antwort: weder aus der DDR noch aus der BRD – und so blieb Wolfgang Hilbig weiterhin unveröffentlicht. Er war niemals Student des Leipziger Literaturinstituts „Johannes R. Becher“ und wäre dorthin auch dann nicht gegangen, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte, zu negativ waren die Berichte von Gert Neumann und Heidemarie Härtl ausgefallen. Die ganze Zeit über las und schrieb er Gedichte und Prosa. Umrißhaft war Wolfgang Hilbigs Biographie schon zu Beginn der achtziger Jahre bekannt, so daß schnell, den ideologischen Umständen der DDR- wie der BRD-Literaturkritik entsprechend, das Klischee vom exemplarischen „Arbeiterschriftsteller“ entstand. Zweifellos sind seine biographische Herkunft und seine literarische Entwicklung exemplarisch: exemplarisch für einen Einzelgänger, der auch in jeder anderen Gesellschaftsform oder literarischen Szene als Außenseiter aufgefallen und gegebenenfalls ausgegrenzt worden wäre. Weder hat Wolfgang Hilbig studiert (wie etwa die älteren Christa Wolf und Uwe Johnson) noch gehörte er je einem literarischen Kreis an (wie z. B. die jüngeren Autoren aus dem Umkreis des Prenzlauer Bergs). Er nahm nicht teil am literarischen Leben dieser Zeit und seiner Umgebung (die späteren Veröffentlichungen in den nichtoffiziellen Zeitschriften verdanken sich eher seinem literarischen Ansehen als einer Gruppenzugehörigkeit).
Wolfgang Hilbig ist ein literarischer Autodidakt, der sich nicht sonderlich an der Literatur seiner Gegenwart (jedenfalls der der DDR) orientierte, sondern an der des neunzehnten Jahrhunderts und der – insoweit sie ihm zugänglich war – europäischen Moderne zu Beginn dieses Jahrhunderts. Das machte ihn von Anfang an unabhängig und einsam. In dieser unabhängigen Einsamkeit schrieb er jahrelang (von 1965 bis zum Ende der siebziger Jahre), ohne daß der Literaturbetrieb davon wußte – also auf ihn reagierte, was umgekehrt den Autor wiederum zu Reaktionen veranlaßt hätte – und ohne daß diejenigen seiner Arbeitskollegen, die ihn als Schriftsteller kannten, davon beeindruckt waren. Gerade der freigewählte Beruf des Heizers ist für diese Situation bezeichnend und ein sprechendes Bild: Einerseits hatte Wolfgang Hilbig als Heizer Zeit fürs Lesen und Schreiben in den bisweilen unterirdischen Anlagen, und andererseits ging er einem Beruf nach, der die Voraussetzung schuf für die Produktion der jeweiligen Betriebe – der Arbeiter getrennt von der eigentlichen Arbeit.
Sein Schreiben in dieser erzwungenen oder nichterkannten Isolation –
er sitzt auf dem sprung er sagt ich bin
solitair
und müde bin ich bin mir selbst
entflohn (so hockt er am tisch der fremde
wenn ich allein im zimmer bin (…)
− führte Wolfgang Hilbig in ein existentielles Dilemma (mit dem auch sein Freund Gert Neumann konfrontiert war und das dieser auf seine Weise in den Büchern Elf Uhr (1981) und Die Klandestinität der Kesselreiniger (1989) thematisierte: Wo steht, sozial gesehen, ein Arbeiter, der schreibt; fällt er schreibend aus seiner „Klasse“ heraus und in keine andere hinein; mit welcher Legitimation schreibt er überhaupt? Dieser Zwiespalt hat nichts mit dem „Bitterfelder Weg“ zu tun, aber auch nichts mit der westdeutschen Werkkreis-Literatur. Wolfgang Hilbigs jahrelange Anstrengung bestand darin herauszufinden, in welcher Sprache der Arbeiter von sich und seiner Arbeit schreiben kann, ohne seine eigenen Erfahrungen zu verfälschen oder zu denunzieren, und für wen er schreibt, wenn er von dieser Wirklichkeit, jenseits der vorgegebenen Worthülsen oder Denkschemata, erzählt. Schon die Essays Die Arbeiter (1975) und Über den Tonfall (1977) kreisen um diese Fragen: Was ist Arbeit, wer ist ein Arbeiter und wer ist das arbeitende, schreibende Ich?
1965 fand mit dem Verbrennen der früheren Texte die erste Zäsur in Wolfgang Hilbigs schriftstellerischer Biographie statt. Er schrieb nun Texte, in denen seine eigene Stimme deutlicher wurde als die, von denen er lesend gelernt hatte. 1980 folgte die zweite Zäsur, der Schritt vom Arbeiter in die Existenz eines freien Schriftstellers. Ich hatte Franz Fühmann über Hans-Jürgen Schnutt ein Exemplar von abwesenheit zukommen lassen, das er sofort las und Kontakt aufnahm zu Wolfgang Hilbig. Fühmann erreichte es auch, daß in Sinn und Form (Heft 6, 1980) acht neue Gedichte des Autors erschienen. Erst aufgrund dieser ersten offiziellen Veröffentlichung in der DDR konnte Wolfgang Hilbig eine Steuernummer beantragen, die notwendig war für die Anerkennung als freier Autor. Denn Wolfgang Hilbig war kein Mitglied des Schriftstellerverbandes, er hatte nach wie vor keinen Kontakt zur staatlich anerkannten DDR-Literatur; er war Arbeiter und Autor eines nichtgenehmigten Buches im Ausland, beim S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main.
II „Die Anwesenheit ist nicht genehmigt“
Im Herbst 1977 sendete Karl Corino in seiner für die Gegenwartsliteratur der DDR so wichtigen Reihe „Transit“ im Hessischen Rundfunk zehn Gedichte und ein Gespräch mit Wolfgang Hilbig; beides hatte er während der Buchmesse in Leipzig aufgenommen. Ende Oktober 1977 schrieb ich Wolfgang Hilbig einen Brief mit der Bitte, nur diese und andere Texte, die er sich für eine Veröffentlichung vorstellen könne, zu schicken. Ende November 1977 antwortete er mit seinem ersten Brief an den S. Fischer Verlag.
Sehr geehrter Herr Beckermann,
bitte entschuldigen Sie, daß ich erst jetzt, nach einem Monat Ihr Schreiben beantworte, und entschuldigen Sie bitte auch, daß nicht sofort, mit diesem Brief, Gedichte bei Ihnen ankommen. Doch zunächst: ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Interesse, das ich, nach anfänglichem Erstaunen, erfreut zur Kenntnis nehme.
Schon zu Beginn dieses Monats schickte ich an Herrn Corino, der mich darum bat, dreißig meiner Gedichte, und inzwischen bat ich ihn auch, er möchte die Texte an Sie weitergeben. So haben Sie vielleicht schon – ich hoffe, Herr Corino hat sie erhalten – eine erste „Lieferung“. Und ich bin dabei, für Sie etwa noch einmal soviel abzuschreiben (damit wäre ich noch nicht ganz erschöpft, aber es gibt auch eine Menge Zeug, das ich zur Zeit nicht einmal selber mehr lesen kann, und schon gar nicht jemand anderem zumuten möchte; aber solche Ansichten sind bei mir unendlich wandelbar, besser; ohne größere Ausdauer Schicksal dessen, der jahrelang das eigne Schreiben liest). Aber meine Art das zu machen! Ich schreibe nämlich alles immer wieder von vorn ab, mit einer entnervenden Schreibmaschinentechnik, und Durchschläge anzufertigen hielt ich bisher für ungerechtfertigte Kalkulation. Dazu kommen noch, am laufenden Band, plötzliche Änderungen (gleichzeitig mit der Frage, ob es Verbesserungen sind), die ich an den abzuschreibenden Texten vorzunehmen habe. Es sind ja, wie Sie an den Jahreszahlen sehen werden, fast alles ältere Gedichte (1974/75/76 schrieb ich kaum welche, fast nur Prosa; ich dachte, Gedichte gingen nicht mehr), aber es werden auch einige neuerliche Versuche dabei sein. Es scheint jetzt, daß das etwas sich lichtet, und ganz sicher wird noch im Dezember die nächste Sendung an Sie abgehen.
Sie fragen mich, ob ich DDR-Verlagen schon etwas angeboten hätte. Natürlich hatte ich das vor einiger Zeit immer mal wieder – allerdings in den letzten Jahren nicht mehr – versucht, glaubte aber feststellen zu müssen, daß in den Antworten, die ich erhielt (sofern überhaupt welche kamen), ein gewisser, womöglich unbequemer Tonfall meiner Texte gar nicht als solcher erkannt erschien, sondern daß man darin literarisches Unvermögen erblicken zu sollen glaubte. Abgesehen davon, daß mich ärgerte, daß man nicht, wie ich, ebenfalls auf die Idee kam, daß manches Unvermögen mancher Generation geradezu zu einem Vermögen entarten kann, war ich so verstimmt, dies für Rückzugs-Taktik zu halten: die zittrige Linie als falsch gemacht hinzustellen, die mit dem Lineal ausgerichtete, oder das Schiefgewickelte als schlecht verpackt anzusehen, oder, deutlicher den Versuch, das, worin man Unvorschriftsmäßiges zu wittern glaubte (wie irrtümlich auch immer) – plötzlich – mit formalen Ressentiments totzuschlagen. Und da ich zu allem Überfluß folgerte, man könne mit solcher Taktik manches kaputtmachen – besonders das, was nicht vor Selbstsicherheit strotzt, eine Eigenschaft, die ja gerade bei Schiefgewickelten häufiger anzutreffen ist – hüllte ich mich erst mal, um mich bei Laune zu halten und nicht beleidigt sein zu müssen, in Schweigen, was vielleicht verkehrt, aber für mich folgerichtig, womöglich heilsam war.
Ich bitte Sie, entschuldigen Sie diese Tirade, ich wollte nur Ihre Frage beantworten, und ich denke, es ist mehr zum Lachen.
Und ich meine auch, daß ich damit nicht nur ein rein DDR-begrenztes Problem anrühre, einer öffentlicheren Erörterung in bezug auf mich ist es nicht wert.
Zu guter Letzt hoffe ich noch, das Eintreffen meiner Gedichte bei Ihnen bewirkt nicht das vollkommene Erlöschen ihres Interesses, zumal mir einige eigentlich gar nicht so einfach, eher mit der Zeit immer „schwieriger“ werdend, vorkommen.
ich danke Ihnen herzlich für ihren Brief
und verbleibe bis auf weiteres
mit freundlichen Grüßen
Ihr
Wolfgang Hilbig (Brief vom 27. November 1977)
Was für eine Situation: Ein Autor, der jahrelang nur für sich schrieb, also sein einziger Leser blieb, reagiert auf meine interessierte Verlagsanfrage mit Selbstbewußtsein, gibt zugleich Einblick in seine Schreibwerkstatt und in seine Nicht-Beziehungen zu den DDR-Verlagen. Ende Dezember 1977 trafen die ersten 38 Gedichte im S. Fischer Verlag ein, die Wolfgang Hilbig nun freigegeben hatte, trotz seines Mißtrauens gegen sich und seine Texte. Im Frühjahr 1978 begegneten wir uns dann in Leipzig, und eben diese Kontakte hatten zur Folge; daß, noch ehe das Manuskript vollständig war, Wolfgang Hilbig wegen „Rowdytums“ – der Vorwurf lautete, er solle eine Fahne, also ein staatliches Ebenbild, verbrannt haben – in Untersuchungshaft geriet (vom 10. Mai bis Anfang Juli 1978). In den Verhören ging es aber vorwiegend um seine Kontakte zum „Ausland“.
Aber zuerst: ich grüße Sie herzlich und danke für all Ihre an mich ergangenen Grüße und Zeichen, die mich meines Wissens alle erreichten, wenn manchmal auch notgedrungen verspätet. Und dann, entschuldigen Sie bitte alles, was von meiner Seite zu dem vorübergehenden „Abbruch der Beziehungen“ beigetragen haben könnte, – wenn es da etwas gegeben hat, ich sehe da auch noch nicht ganz klar. Ich glaubte, es sei besser die Verhandlung eines Gerichts über mich abzuwarten, die es nun nicht gegeben hat au durch juristischen Sprachgebrauch schwer zu entziffernden Gründen, die zwischen Geringfügigkeit, Beweismangel und Schuldlosigkeit schwanken. Ich hätte vielleicht nicht warten müssen, denke ich jetzt, aber weil man es vorher; leider bin ich aus guten (oder schlechten?) proletarischen Gründen zur Angst vor der Ordnung erzogen.
Aber nun soll es endlich weitergehen; was fehlt noch an der Verwirklichung meines Buches („mein Buch“, das ist übrigens ein ganz neuer Tonfall für mich, wie ich soeben bemerke, und er entspringt meinem gefestigten Bekenntnis – im Kopf gelöst von Zuckerbrot und Peitsche – zu diesem Buch, das Sie und ich vorhaben), was benötigen Sie für die Verwirklichung unseres Buches sonst noch außer den Dingen, die hier beiliegen.
(…)
Ich schicke hier noch mal ein Foto – die Vergrößerung meines Paßbildes, von dem sich zum Glück die Negative noch auftreiben ließen – ich hoffe, es ist verwendbar denn ein jetzt angefertigtes Bild müßte mich mit einer in der Haft zu Ordnung gebrachten Frisur zeigen, was meine Eitelkeit tief verletzt.
(Brief vom 27. August 1978)
Diese Erfahrung der absoluten Willkür staatlicher Organe und ihrer verheerenden Folgen für das Selbstverständnis des betroffenen Ich hat Wolfgang Hilbig in „Johannis“ (1978/79) und „Die Einfriedung“ (1979) (in Unterm Neomond (1982)) thematisiert, und sie spielte seitdem in vieIer Hinsicht eine zentrale Rolle für sein weiteres Schreiben (z. B. in „Beschreibung II“ (1980/81), erschienen in Der Brief (1985), und in dem Roman Eine Übertragung (1989).
In der Zwischenzeit hatten Gert Neumann und Wolfgang Hilbigs damalige Freundin Margret Franzlik das Zusammentragen der Gedichte für den geplanten Band fortgesetzt, der zu der Zeit noch „gegen den strom“ heißen sollte. Bei unserem Buchmessen-Treffen hatte ich den Autor gebeten, einerseits diesen Titel zu überdenken und andererseits zu versuchen, die Frankfurter Veröffentlichung über das Büro für Urheberrechte genehmigen zu lassen.
Ihre Frage nach dem Titel, „gegen den strom. gedichte“, beantworte ich bis zu unserem Zusammentreffen im März noch zustimmend, d.h. bis Sie mir sagen, der Titel ginge so nicht, oder ähnliches; ich kann mich vorläufig nicht zu einem anderen entschließen, obwohl auch schon Gert Neumann sehr bedenkenswerte Argumente dagegen geltend machte. Eine Erklärung, wie ich dazu kam: der Titel ist eigentlich von Huysmans (sein Buch A rebours; bei uns erschienen als Gegen den Strich), dessen Werk in der damaligen Literatursituation in die Gegenrichtung zum immer mehr sich verhärtenden Naturalismus zeigte, ein literarisches Abenteuer; damals, dessen Ansprüchen mein Band vielleicht nicht gerecht zu werden vermag. Mein Gedicht „gegen den strom“, das eine solche Bedeutung natürlich nicht trägt, verstehe ich deshalb weniger als Titelgedicht, und wenn, eventuell nur deshalb, weil es ja nicht ein Gegen-den-Strom-Schwimmen, sondern ein Gegen-den-Strom-Deuten ausdrücken soll, eine Geste, die mir dazumal beim Lesen der „Einzelheiten“ Enzensbergers einfiel (deshalb die Widmung), deren 1. Teil, „Bewußtseinsindustrie“, bei mir, auf dem damaligen Stand meiner Unbildung, weitreichende und für mich neue Gedankengänge auslöste. Wir hier sind ja dazumal nicht eben mit allem Neuesten auf dem Gebiet der „Bewußtseinsindustrie“ gesegnet gewesen.
(Brief vom 19. Februar 1979)
Lieber Herr Beckermann,
nun erhielt ich endlich den auf dem Postweg verlorengeglaubten Brief vom Büro für Urheberrechte, mit dem vorläufigen Entscheid, daß man mir die Genehmigung zum Vertragsabschluß nicht erteilt. Ich hatte in der Zwischenzeit schon persönlich im Urheberrechtsbüro vorgesprochen und darauf bezieht sich mein Wort vorläufig.
Inzwischen habe ich meine, für den Vertragsabschluß nötigen Handlungen erledigt, den Vertrag unterschrieben, und per Eilpost/Rückschein an den S. Fischer Verlag gesandt – ein Telegramm mit dieser Nachricht für Sie folgen lassen – und das Büro für Urheberrechte brieflich davon in Kenntnis gesetzt, worauf ich heute, aber die Zeit ist zu kurz, noch keine Reaktion habe.
Ich hoffe, lieber Herr Beckermann, daß Sie den Vertrag, die letzte formale Grundlage nun für die Weiterarbeit an abwesenheit ordnungsgemäß erhalten haben.
Meine Vorsprache im Büro für Urheberrechte und das nun vor mir liegende Schreiben von dort lassen mich darauf schließen, daß der Entscheid dieser Instanz nicht definitiv war – definitiv demgegenüber für das Verständnis des Urheberrechtsbüros, war mein Schritt, Ihnen den unterzeichneten Vertrag zu senden, ihn also abzuschließen. Ich glaube, ich muß dies, für unser Verständnis, erst einmal so deutlich hinschreiben, damit wir diese Beeinträchtigungen durch Genehmigung oder Nichtgenehmigung los sind. Als Begründung für die Nichtgenehmigung wird angegeben daß „der Autor bei Vergabe eines Werkes an einen ausländischen Partner nachweisen muß, daß er sein Werk den in Frage kommenden DDR- Verlagen angeboten hat“. Und: „Wie Sie uns mitteilen, wurde Ihr Manuskript beim Aufbau-Verlag und beim Mitteldeutschen Verlag abgelehnt. Wir bitten Sie, uns den Wortlaut der Ablehnungsschreiben mitzuteilen.“ Im Schlußsatz wird mir empfohlen, mich wegen einer Veröffentlichung mit dem Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, und dem Verlag Neues Leben, Berlin, in Verbindung zu setzen.
Inzwischen habe ich aber, nach einer für meine Begriffe sehr scharfen Nachfrage an den mitteldeutschen Verlag, in dessen Schubladen ja die früher erhaltene Ablehnung vom Aufbau-Verlag und mein Manuskript verschwunden waren – Sie erinnern sich an den Bericht von meiner Tölpelhaftigkeit in Leipzig – die Aufbau-Ablehnung zurückerhalten und daneben eine ebensolche vom Mitteldeutschen Verlag; beide Ablehnungen. habe ich, in Form von Duplikaten, dem Büro für Urheberrechte, gleichzeitig mit der Information über meinen Vertragsabschluß, zugeschickt, so daß nun der Tatbestand, das vergebliche Angebot an die in Frage kommenden DDR- Verlage, erfüllt ist. Den Vorschlag des Büros, Reclam und Neues Leben betreffend, habe ich in diesem Schreiben als nicht akzeptabel abgelehnt, da, erstens, Reclam keine Debütanten bringt, was aller Welt bekant ist, zweitens, Neues Leben ein Jugendbuchverlag ist, mein Buch aber keine jugendgemäßen Ansprüche erfüllen kann. Schließlich habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß die „geforderte Einhelligkeit der Kriterien für Form und Inhalt eines Werkes bei allen Verlagen der DDR besteht“, weshalb es zwecklos sei, das Buch weiteren, zudem nicht in Frage kommenden DDR-Verlagen anzubieten. Und: ich bin mir dementsprechend sicher; die Anordnung des Ministers für Kultur – daß ein Autor sein Werk, vor einer Veröffentlichung andernorts den in Frage kommenden DDR-Verlagen anzubieten hat – nicht verletzt zu haben.“
So warte ich nun auf den endgültigen Bescheid vom Urheberrechtsbüro, der eigentlich, nach meiner Ihnen zugesandten Unterschrift – und nun grünes Licht für die abwesenheit, ich erkläre meinerseits alle formellen Rücksichten für aufgehoben! −, für mich gegenstandslos werden wird, der meines Erachtens nur noch irgendwelche finanziellen Angelegenheiten betreffen könnte, deren Klärung, Beseitigung, mich ohnehin unnnötig anstrengen würde.
Ich werde Ihnen selbstverständlich jeden weiteren Bescheid vom Büro für Urheberrechte schnellstens mitteilen.
(Brief vom 16. April 1979)
Die Arbeit am Buch wurde zudem erschwert durch die „langen Postwege“. Zum Beispiel trafen Hilbigs Fahnenkorrekturen nie in Frankfurt am Main ein, so daß der Autor sie vom Arbeitsplatz aus durchtelefonierte auch dies ein Vorgang der registriert wurde.
Übrigens hoffe ich, um noch mal auf ein bereits erledigtes Problem zu kommen, daß unsere telefonisch vorgenommene Fahnenkorrektur ihnen in ausreichendem Maße dienlich war; der hier noch fehlende Rückschein der am 5. Juli an Sie zurückgeschickten Fahnen, die ja ohnehin zu spät gekommen wären, legt mir den Verdacht nahe, daß diese Sendung auf dem Postwege „verlorenging“; dies nur, weil der dabeiliegende Brief noch einige zusätzliche Informationen, Antworten auf Ihre Fragen enthielt, ich begründete z.B. mein Bestehen auf einigen Gedichten damit, daß der Ankündigungstext des Bandes zitierend auf sie eingeht, was während des Telefonierens aus Zeitgründen etwas zu kurz kam, und Ihnen vielleicht wie ein Überdruß meinerseits an weiterem Diskutieren darüber erschienen sein mag. – Dieses Telefongespräch hafte dann noch ein kleines Nachspiel, das ich Ihnen, der Kuriosität halber, nicht verschweigen will. Wochen danach wurde ich zur Leitung meines Betriebes gerufen und es wurde mir untersagt, künftig vermittels des Betriebstelefons Gespräche mit Ihnen, oder anderen „ausländischen“ Partnern zu führen, egal, ob ich auch nicht der Anrufer; sondern der Empfänger eines solchen Ferngesprächs sei… rätselhaft oder nicht, auf welchem Weg meine Vorgesetzten überhaupt davon erfuhren… und mußte dann natürlich Rede und Antwort stehen, welchen Inhalts das Gespräch gewesen sei. Auf die Frage, ob es mir denn erlaubt sei… oder, wie ich es mir denn erlauben könne…, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, ein Buch in der BRD zu veröffentlichen, konnte ich, glücklicherweise wahrheitsgetreu, antworten, daß meine Verhandlungen mit den dafür zuständigen Instanzen der DDR noch nicht abgeschlossen seien, von einem illegalen Erscheinen also vorerst noch keine Rede sein könne. In der Zwischenzeit hatte ich nämlich eine Eingabe an den Minister für Kultur der DDR gesandt, und mich darin über die Entscheidung des Büros für Urheberrechte beschwert, und, noch mal, eine weitere Beschwerde ans Urheberrechtsbüro geschrieben. Darüber informierte ich Sie bisher nur andeutungsweise, da man sich hier allergisch gegenüber Beschwerden zeigt, die einen Umweg über die BRD machen, d.h. übersetzt, daß DDR-Autoren sich in den Massenmedien der BRD an Instanzen der DDR wenden, was in unserem Falle überhaupt weder möglich noch nötig gewesen wäre, aber ich weiß nicht, inwieweit man den Begriff von diesem Umweg auszudehnen gewillt ist, ich wollte uns auch den möglichen Vorwurf ersparen, daß mir diese Eingabe diktiert oder nahegelegt worden sei. – Auf beide Beschwerden habe ich noch keine Antwort und ich warte auch nicht mehr auf Antwort, ich halte es immerhin für möglich, daß Antworten, ganz gleich in welcher Form, überhaupt ausbleiben, in Konsequenz der Zwangslage, der Abwesenheit eines Buches in der DDR nicht auch in dieser Form spotten zu müssen.
(…)
Kürzlich erhielt ich von Gert Neumann, als Antwort auf einen Brief, in dem ich meine Besorgnis ausdrückte über den Fortbestand von Gesprächen nach dem ab 1. August in Form neuer Gesetze wirksam werdenden Verdikt über schon immer beargwöhnte Beziehungen, ein Telegramm des Inhalts: „Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, wenn die Poesie in einem Körper gesiegt hat.“ – Leider gibt es aber auch keinen Grund zur Beruhigung, denn Poesie, der für mich das Gespräch über Poesie, über ihre öffentliche Abwesenheit, und die Arbeit, die getan werden muß, um sie auf eine öffentliche Gesprächsgrundlage zu bringen, immanent sind seit dem Datum, an dem ich von der Existenz der Collection S. Fischer erfuhr; scheint mir noch in zu wenigen, ausführenden Körperschaften Platz genommen zu haben. Da aber diese Gespräche nicht enden dürfen, solange es hier möglich ist, sie am Leben zu erhalten, gleich welcher „Sklavensprache“ (Gramsci) sie sich auch bedienen müssen, bin ich gern bereit zu Gesprächen, und offen für Formen derselben, die für Sie verwendbar sind, die anderen Wege zu nutzen (ich sehe nämlich die Dürftigkeit all meiner bisherigen Äußerungen über die Antriebe meines Schreibens zum Beispiel; und es entspricht vielleicht meiner speziellen Situation, über Fertiges, die verwirklichte „abwesenheit“, mit genügendem Abstand nachdenken zu können), die nötig sind, um Bücher zu einem menschlichen Umgang mit ihren eventuellen Lesern zu verhelfen, das heißt, die Mühe, die es mir kostete, womöglich auftauchende Fragen zu beantworten zu versuchen, wäre mir eigentlich eine Freude.
(Brief vom 22. Juli 1979)
Ende Juli 1979 lehnte Klaus Höpcke endgültig die Genehmigung der Veröffentlichung von abwesenheit ab.
Aber zuerst will ich mich für Ihre Glückwünsche zum Erscheinen der abwesenheit bedanken – welch ein Vergnügen macht es, sie anwesend zu wissen… ohne daß Triumph es trübt, denn der Sieg ist nicht der meine, die Anwesenheit ist nicht genehmigt; haben wir eigentlich anderes erwartet?
(…)
Die anfangs erwähnte Bedrückung bezieht sich im wesentlichen auf die Zusammenhänge, daß das Buch bei mir nicht eingetroffen ist, was nun nicht so sehr überraschend ist, auch nicht, wenn man es nur unter dem Gesichtspunkt eines Übergriffs auf den Postverkehr sieht, vielmehr scheint es die erwartungsgemäß harte Haltung des Gemeinwesens, das sich mit seinen Herabsetzungen selbst belastet, zu sein, sowie auf die Tatsache, daß die von mir bis zuletzt ersuchte Genehmigung zum Druck des Buches endgültig, vielleicht endgültig, abgelehnt wurde in einem Schreiben des stellvertretenden Ministers der Kultur, Klaus Höpcke, vom 27.7.79 an mich, und zwar aus den gleichen Gründen, deren Absurdität ich dem Urheberrechtsbüro mit größtmöglicher Akribie erklärte. So ist nun wenigstens meine Haltung bekannt, wenn man mich begriffen hat…
Ich werde mir das Buch frühestens nach dem Urlaub bei Gert Neumann ansehen können… und bin froh, daß ich den richtigen Titel wählte … oder vielleicht schon am 30.8., denn da bin ich „zwecks Sachverhaltsklärung“ zur Zollverwaltung der DDR eingeladen.
(Brief vom 28. August 1979)
Wolfgang Hilbigs erstes Buch, der Band abwesenheit, erschien im August 1979; Mitte September schon wurde er zu einer Geldstrafe wegen des Devisenvergehens verurteilt (die er aufgrund der Haftentschädigung bezahlen konnte). Er war damit der dritte DDR-Autor – nach Robert Havemann und Stefan Heym – und der erste „unbekannte Autor“, gegen den diese Kann-Vorschrift des Gesetzes angewendet wurde.
Inzwischen haben die mit meinem Fall beauftragten Behörden ihre Arbeit an der unmittelbaren Reaktion auf das Erscheinen meines Buches formell abgeschlossen. Wie ich Ihnen schon schrieb, war ich am 30.8.79 zur Zollverwaltung der DDR vorgeladen und es fand – nach der Mitteilung, daß sich die 25 Freiexemplare von abwesenheit in den Händen des Zolls befinden – meine Vernehmung über die Umstände des Zustandekommens des Buches statt. Da es dort ja lediglich um ein Zoll- und Devisenverfahren ging und der Inhalt des Buches sorgsam ausgeklammert wurde – denn es ging dem Beamten, wie ausdrücklich erklärt, darum, Ordnung in diese Sache zu bringen – beschränkte sich mein Einfluß auf das Zustandekommen der Form des Protokolls darauf, beizubringen, daß ich das Buch nicht aus finanziellen Erwägungen veröffentlicht hätte, was mir, mit Abstrichen, auch gelang. Für den 19.9.79 wurde ich dann noch einmal zur Zollverwaltung gerufen und stehenden Fußes zum Zahlen einer Geldstrafe von 2000,- Mark verurteilt, Grund (ich zitiere aus dem mir ausgehändigten Formular der „Strafverfügung“: „Sie haben vorsätzlich entgegen den gesetzlichen Bestimmungen einen Devisenwertumlauf durchgeführt, indem Sie Forderungen gegenüber einem Devisenausländer ohne staatliche Zustimmung begründeten und damit den Tatbestand des § 18 Abs. des Devisengesetz vom 19.12.1973 erfüllt.“ Darüber wäre nun kein weiteres Wort, von mir nicht, zu verlieren, höchstens daß alle, denen ich es erzählte (Arbeitskollegen usw. diese Strafe als völlig ungerechtfertigt, und auf die Verdienstmöglichkeiten eines Arbeiters bezogen für entschieden zu hoch halten.
Weiterhin mußte ich den Text einer schon vorher angefertigten Erklärung unterschreiben, daß ich darüber belehrt worden sei, daß ich in keiner Form über die mir aus dem Verlagsvertrag zugesagte Honorarsumme und über die für mich aus den Verkaufszahlen erwachsenden prozentualen Anteile verfügen dürfe, weder in Form eines Geldbetrags noch in Form von Waren, die von diesem Geld gekauft wurden, und daß ein Zuwiderhandeln eine neue Bestrafung nach sich ziehen könne. Dieses Schriftstück wurde mir nicht ausgehändigt.
Als ich nach dem Verbleib der 25 Freiexemplare fragte, wurde mir erklärt, daß die Zollverwaltung auf Grund von Gesetzen und auf Grund der aus der DDR-Mitgliedschaft im Weltpostverein (der, ich glaube, eine Institution der UNO ist) herrührenden Verpflichtungen darüber nur mit der Deutschen Post der DDR und diese dann mit dem Absender diese Angelegenheit zu erörtern habe, was ich nicht verstehe, denn wieso folgt die Post der DDR, beziehungsweise der Zoll, nicht ihren Verpflichtungen gegenüber dem Adressaten (der weiß, wo sich die betreffende Sendung befindet), beziehungsweise den Verpflichtungen gegenüber dem Absender, die Sendung am Bestimmungsort erscheinen zu lassen. Auf meine Frage, mit welcher Rechts- oder Gesetzesgrundlage dies geschehe, erhielt ich vom Zoll keine Antwort. Ich werde mich diesbezüglich noch um das Recht kümmern.
(Brief vom 24. September 1979)
Was als Behinderungs- und Verhinderungsbemühungen seitens der DDR-Behörden angelegt war (Untersuchungshaft vor und Bestrafung bei Erscheinen des Buches), wirkte den Mechanismen der deutschdeutschen Kultur-Beziehungen entsprechend, als hätte die DDR-Bürokratie alles darangesetzt, um auf dieses literarische Debüt hinzuweisen. Der Band abwesenheit wurde auf Anhieb ein Erfolg bei der Literaturkritik und bei den Lyrik-Lesern.
Eine Zeitlang mußte sich Wolfgang Hilbig, da alle Belegexemplare konfisziert blieben, sein erstes Buch bei Gert Neumann ausleihen: eine bezeichnende Tatsache für seine persönlichen Verhältnisse und die politischen seines Landes. Aber sein erster Lyrikband war erschienen; und so konnte Wolfgang Hilbig sich von der DDR-Kultur-Bürokratie, die ihn nicht akzeptiert hatte, verabschieden – und sich nun, verstärkt, dem Prosa-Schreiben widmen.
Lieber Herr Beckermann,
Ich hoffe sehr, die Niedergeschlagenheit, in die Sie mein Brief vom 24.9. versetzen mußte (Sie verzeihen, wenn dieser Ausdruck übertrieben ist), hat sich inzwischen gewandelt. Und Sie verzeihen sicher auch, wenn mein Brief etwa mehr „kläglich“ als zornig geklungen hat, sein Anlaß war eigentlich, Sie wissen zu lassen, daß nichts meine Überzeugung hat trüben können, daß das, was wir getan, und erreicht haben, das völlig Richtige war. Es ist mir heute vollkommen klar, daß wir, und war es notgedrungen, allen Konsequenzen entsprochen haben, und daß die Reaktionen „höheren Orts“ darauf dann folgerichtig waren, alles ist sonnenklar, wenn diese Sonne auch kühl ist, ich bin sozusagen mit dem Kap einer Gewißheit gelandet: daß ich der kulturellen Szene, aus der ich komme, oder die ich hier betrachte, nichts zu verdanken habe. Das ist für einen Schreiber von meiner Machart sehr viel mehr wert, als man glauben möchte. So habe ich mir auch erlaubt, mich in einem abschließenden Brief an den stellvertretenden Kulturminister zu dem Wort „Unrecht“ und seinen geistigen Relationen in bezug auf die Poesie zu bekennen. Meine Arbeit wird nun bestimmt viel weniger mit Kompromissen zu tun haben müssen, als ich selber glaubte. Um den Eventualitäten einen Namen zu geben, ich nähre seit einiger Zeit den Gedanken, damit zu beginnen, meine kurze Prosa für eine womöglich annehmbare Zusammenstellung zu sichten (und gegebenenfalls zu überarbeiten), nur fürchte ich immer ein wenig die Zeit, die das bei mir in Anspruch nimmt und suche noch nach einer Form von Härte, die mich unduldsam gegenüber Verwischungen macht – ein Problem, für mich, dem ich damals, bei Zusammenstellung von abwesenheit fast unterlegen wäre, das ich aber, glaube ich, mit Ihrer Hilfe doch löste.
Ich habe mir inzwischen abwesenheit von Gert Neumann – dem ich übrigens zu Dank verpflichtet bin, da es ihm manchmal, wenn Sie schon in Sorge waren, aus wer weiß welchen Gründen schneller möglich war als mir, Sie über alles zu informieren – ausgeliehen (wir, G. N. und ich, sind übereingekommen, der Ironie der Verhältnisse – nicht des Schicksals – ihren „Geist“ zu lassen, indem ich mir mein Buch bei ihm ausleihe), und ich muß, in noch anhaltender Verwunderung, sagen, daß selbst meine geheimsten Vorstellungen vom Gesicht des Buches verwirklicht sind, selbst solche nämlich, die ich wegen des damaligen Zeitmangels nicht mehr mit Ihnen erörtern konnte, und in der Verteilung der Gedichte über die Seiten ist ein Bild zustande gekommen, wofür ich Einzelheiten, einen Vorwurf von Pedanterie fürchtend, überhaupt nicht zu fordern gewagt hätte, es ist ein Bild, in dem sich selbst noch Neues zu entdecken und noch nicht bedachte Assoziationen anzustellen vermag. Rund heraus, die Gestaltung des Buches hat meine Hoffnung übertroffen, ob die Texte das wert waren, sollen nun andere beurteilen.
(…)
Über Zeitmangel habe ich momentan etwas zu klagen, ich komme schlecht zum Schreiben, es ist unter anderem die Wintervorbereitungsperiode auf Arbeit, die uns dort mehr in Anspruch nimmt als gewöhnlich, ich muß bekennen, ich habe einige angefangene Sache daliegen, meist Prosa, und komme nicht so weiter, wie ich will. Aber womöglich sind es schon Konzentrationsmängel, sicher auch aus dem Willen heraus, einem „Anspruch“ zu genügen, der meiner veränderten Lage, nach dem Erscheinen von abwesenheit zu entsprechen hat, und vielleicht sind es zusätzlich auch die jüngsten – zu überdenkenden – Wirren. Aber ich verspreche mich zu bessern, ich höre stets sehr genau auf Ihre Aufforderungen zur Weiterarbeit in Ihren Briefen.
(Brief vom 24. Oktober 1979)
Für Herbst 1981 war die Veröffentlichung des Prosabandes Unterm Neomond zwischen Wolfgang Hilbig und dem S. Fischer Verlag vereinbart. Während der Leipziger Frühjahrsmesse gab es im traditionsreichen Restaurant Coffebaum ein Treffen mit Hans Marquardt und anderen Mitarbeitern des Leipziger Verlags Philipp Reclam jun. Das Gespräch – das eigentlich das schöne Thema: die gleichzeitige Herausgabe des Prosabandes in Frankfurt am Main und Leipzig hatte – wurde aggressiv geführt, so habe ich es in Erinnerung. Der Grund hierfür war, daß Franz Fühmann nachdrücklich die DDR-Anwesenheit Wolfgang Hilbigs eingefordert hatte, so daß, vermutlich im zuständigen Ministerium in Ost-Berlin, beschlossen worden war, daß dieser renommierte Leipziger Verlag einen ersten Hilbig-Band veröffentlichen solle, worüber die Verlagsleitung alles andere als glücklich war. Vereinbart wurde, der Fischer Verlag würde seine Publikation um ein halbes Jahr verschieben und dem Reclam Verlag das Manuskript zukommen lassen, damit eine gemeinsame Veröffentlichung im Frühjahr 1982 möglich sei.
Der Prosaband Unterm Neomond erschien im Frühjahr 1982 in Frankfurt am Main; in der DDR ist er nie publiziert worden. Statt dessen veröffentlichte der Reclam Verlag 1983 den Band Stimme Stimme. Gedichte und Prosa (die erste und bis zum Ende dieses Staates letzte Buchveröffentlichung Wolfgang Hilbigs in der DDR). Der Prosateil enthält nur ältere Stücke (bis 1978; einige von ihnen stehen nicht in dem Frankfurter Band). In der Abteilung Gedichte (sie enthält auch neuere Texte) sind unter anderem frühere Gedichte veröffentlicht, die nicht in abwesenheit abgedruckt sind. Warum es bei diesem Buch zu Verzögerungen gekommen und warum es letztlich mit diesem Inhalt erschienen ist, das läßt folgendes Detail erahnen: Das vierstrophige Langgedicht „das meer in sachsen“ besteht in der Leipziger Ausgabe nur aus drei Strophen, wobei, mit exakter Zahlenangabe (allen Verantwortlichen sei hierfür Dank gesagt), Strophe 4 auf Strophe 2 folgt; die fehlende dritte Strophe beginnt mit diesen Zeilen: „sachsen ist langweilig / ungastlich graurot…“
III „… der Heizer liegt erschlagen unter seiner Kohle“
Daß es in dem Band Stimme Stimme ältere Texte von Wolfgang Hilbig gibt, die nicht in den Büchern abwesenheit und Unterm Neomond enthalten sind, verweist einerseits auf die damalige Zensur-Praxis in der DDR (denn in seiner Prosa läßt sich Wolfgang Hilbig ab Mitte der siebziger Jahre immer erkennbarer auf die ihn umgebende deformierte Realität ein), und andererseits wurde dies möglich durch sein eigenwilliges Schreibverfahren. Fünfzehn Jahre lang schrieb er nur für sich, also nicht im Hinblick auf eine baldige Veröffentlichung. Auch deshalb blieben viele seiner Texte zuerst als Entwurf, als Anfang, als Fragment liegen, die er später dann weiterschrieb, ergänzte, beendete. Wolfgang Hilbigs Datierungen beziehen sich, falls nicht anders angegeben, immer auf diese erste für sich bestehende Niederschrift des Textes. So stehen z.B. in dem Prosaband Die Territorien der Seele (1986) Texte mit den Jahreszahlen 1969 und 1974; und Über den Tonfall, 1990 veröffentlicht, ist mit der Jahreszahl 1977 versehen.
Hilbigs Datierungen geben also nur Aufschluß über die Chronologie der ersten Entwürfe, nicht aber darüber, wann ein Text in seiner endgültigen Fassung vorlag. Als Datum der definitiven Textgestalt ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung anzusehen, was aber nicht immer der Fall sein muß. Dringend erforderlich ist eine Ausgabe seiner Gedichte und Kurzprosa in der Chronologie der Entwürfe, die auf diese Weise einen Überblick geben würde über die Entwicklung der Formen und Themen im Werk Wolfgang Hilbigs. (Die zur Zeit vollständigste Ausgabe beider Textgattungen enthält der Band zwischen den paradiesen (Reclam-Verlag Leipzig 1992); aber auch dieses Buch bringt weder alle Gedichte und Prosastücke noch sind sie nach den Daten ihrer Entstehung angeordnet.)
Zur Besonderheit der Voraussetzungen der Poesie Wolfgang Hilbigs gehört es, daß er frei war in der Wahl seiner Lektüre (soweit die Bücher unter den DDR-Umständen zugänglich waren), frei von der herrschenden Ideologie der offiziellen Kultur. Er brauchte keinen literarischen Vater zu stürzen – nicht Brecht oder Heiner Müller, nicht Christa Wolf oder Volker Braun −, sondern er lernte lesend nach eigenem Gutdünken und aufgrund der Defizite seiner Biographie. Und dies rücksichtslos und jahrelang für sich allein.
So entstand seine Bildsprache, geprägt von der Romantik, dem Expressionismus und der lyrischen Moderne; so eignete er sich den offenen Vers an (und die einseitige Klammer); so bildete sich der Blick von unten auf eine vielfach gespaltene Wirklichkeit aus: der Blick des Außenseiters, des Einzelgängers. Zuerst – in wenigen, ganz frühen, Gedichten – dominiert noch die Abwehr, sich nicht, unter keinen Umständen, vereinnahmen zu lassen. Dann aber, und damit kommt er zu seiner Sprache, setzt er dem Bild einer desolaten Welt („schwarz“, „leer“, „allein“, „stumm“, „kahl“, „Regen“, „Schlamm“, „Müdigkeit“, „Schnee“, „Tod“) eine Poesie der Unruhe, der Sehnsucht, des Aufbruchs entgegen („Verlangen“, „Glanz“, „Rausch“, „Wasser“, „Licht“, „Explosion“).
Wolfgang Hilbig, der Arbeiter und Leser aus Meuselwitz am Rande des Braunkohlebergbaus, ist geprägt von zwei zentralen Erfahrungen: dem Erlebnis der ausgebeuteten Natur und der, biographisch begründeten, Frage: Wer bin ich? Es ist diese Kombination aus frühestem existentiellen Erleben und der Lektüre einer ahnungsreichen Literatur, die es ihm möglich macht, an der Vision einer anderen Wirklichkeit festzuhalten, wobei diese nur noch als Verlust, als sinnentleerte Ruine oder als Erstarrung ausgesagt werden kann.
Wolfgang Hilbigs Leiden und Sehnsucht thematisiert genau diese Spaltung: biographisch durch seinen radikalen Bruch mit der offiziellen DDR-Kultur und seinen Umzug in die Bundesrepublik und – schon sehr früh, also noch vor der ersten Veröffentlichung – in dem, was sich hinter den kargen Wörtern „Arbeiter“ und „Schriftsteller“ verbirgt. Sein Schreiben geht aus von dem sicheren Wissen, daß die derzeitige, aber auch die jeweilig andere Realität nur eine Möglichkeit – und nicht die beste – des „Universums“ ist und daß die Sprache nur die bestehende Realität reflektiert, also vom „Universum“ doppelt getrennt ist. Dieser Wahrnehmungs- und Schreibansatz begründet den Konflikt mit der DDR-Ideologie und -Wirklichkeit von Anfang an. (Und deshalb auch wirkten alle staatlichen Maßnahmen gegen Wolfgang Hilbig inkongruent und hilflos.)
Indem Wolfgang Hilbig an diesem wissenden Ahnen festhielt, zielte er auf die tieferen Ursprünge von Poesie und blieb im Dialog mit dem ahnungsvollen Leser: In seinen Erzählungen deutete Wolfgang Hilbig hin auf eine Urgeschichte, für die das derzeitige Geschehen und die Dinge nur Zeichen sind. Diese Hoffnung auf eine ganz andere, die eigentliche Geschichte machte einerseits seinen erzählenden Blick auf die gesellschaftliche Realität seiner Zeit scharf und erbarmungslos und prägte andererseits seinen essayistischen, mit Reflexionen durchsetzten Erzählstil.
Lange vor seiner ersten Buchveröffentlichung war Wolfgang Hilbig bei seinen Themen und seinen literarischen Formen angekommen. Wie aus einer anderen poetischen Zeit stammend, entwirft er Naturbilder von einer Glut und Vision – als das ewig wuchernde, grüne, dunkle Andere −, um dann die Schändung der Natur durch den Menschen (durch tote Kanäle, verlassene Fabriken etc.) deutlich werden zu lassen. Für ihn ist die Natur – sind die Jahreszeiten, der Wald, das Wasser – der Gegensatz zur Stadt, zur Arbeit, zur menschlichen Ordnung und Gemeinschaft. Sie ist der Ort des Gedächtnisses einer archaischen Vergangenheit sowie das Bild einer strahlenden Zukunft und, jenseits aller realen Bedrohungen, der Freiheit einer grenzenlosen Bewegung. In den frühen Prosatexten geschieht dies im Konjunktiv („Aufbrüche“), im Vielleicht („Bungalows“), im Traum („Idylle“).
Diese Hoffnung auf grenzüberschreitende Bewegung ermöglicht es dem erzählenden Ich, in Ablehnung aller sozialen Normalität, zu seinen Ängsten und Sehnsüchten zu kommen. Mit sich eins werden kann es nur, wenn es sich löst von allem Angelernten, Erwartbaren, Funktionierenden. „Soll ich arbeiten dort, arbeiten, arbeiten. Wie öde, wie erbärmlich, zu arbeiten. Wie verkommen sich zu frisieren, zu rasieren, wie elend sich zu waschen und zu kleiden nach der Mode. Wie traurig, gesund und in Ordnung zu sein, ruhig, vergeßlich, wie langweilig, wie langweilig zu wissen, in welchem Land ich lebe und dies ohne Zorn zu wissen, und dies immer und ohne Zorn in dem öden Bewußtsein haben zu müssen.“
Das Einssein aber bleibt Utopie, kann nicht und niemals erreicht werden. In immer neuen Variationen schreibt sich Wolfgang Hilbig heran an das abwesende Ganze (das gilt, besonders in der späteren Prosa, auch für den abwesenden Sozialismus). Wirklichkeit und Wunsch führen zur Doppelperspektive (die Ich-Erzählung wechselt zur Er-Erzählung, und umgekehrt), zum romantischen Doppelgängermotiv, das zwischen Arbeiter und Schriftsteller, Verfolger und Verfolgter, Täter und Opfer etc. hin- und herpendelt. Das Doppelgängermotiv ist Darstellungsmittel und Ausdruck des sich ständig steigernden Selbstzweifels und der allmählichen Grenzüberschreitung: in grandiosen Naturmetaphern, in denen am Ende das erstarrte Jetzt, auch das alte Ich, tot zurückbleibt. „Tief in der Vergangenheit begonnener Winter, hinter den Ebenen, wo er den Nebeln nicht entweichen kann, ebenso uraltes Eis, das langsam schmilzt und langsam wieder einfriert, kalt und zerrissen hängt sein bewegungsloses Triefen aus den geplatzten Rohren, kein Wärmehauch, der das Glitzern des Todes von den Wänden löst, die Gebirge der Nebel abtaut, der Heizer liegt erschlagen unter seiner Kohle.“
Thomas Beckermann, aus: Wolfgang Hilbig. Materialien zu Leben und Werk, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994
Abwesenheit, Versprengung
Zur Lyrik Wolfgang Hilbigs
Zu den gebetsmühlenartig vorgebrachten kulturpolitischen Beschwörungen in der DDR gehörte der Ruf nach dem „kulturellen Erbe“, nach seiner Aneignung und Weiterentwicklung; zu den sozialpolitischen Lieblingshoffnungen die, daß dem vierten Stand die Aneigner und Weiterentwickler jenes Erbes entsprießen würden; zur Praxis des angeblich „realen“ Sozialismus, daß jenes Erbe verfälscht und zerstört und daß die jungen Talente, wenn sie sich als solche erwiesen, schikaniert, isoliert und verfolgt wurden.
Wolfgang Hilbig, Bohrwerkdreher, Heizer und zu einem „Zirkel schreibender Arbeiter“ delegiert, brachte biographisch nahezu musterhaft alle Voraussetzungen mit, die ihn zur Inanspruchnahme für die Kultur jenes Staates geeignet gemacht hätten – bis auf eine: die Fähigkeit zur Anpassung. Das verhinderte seine Eingliederung in die kulturpolitische Programmierung und verurteilte ihn zur Unperson, zur poetischen abwesenheit. So mußte Hilbig mit dem gleichnamigen Gedichtband im Westen, in Frankfurt am Main, debütieren; was ihm einige Wochen Haft und eine Geldstrafe wegen „Devisenvergehens“ eintrug. Vor weiteren Repressionen dürfte ihn die beträchtliche Resonanz der westlichen Öffentlichkeit bewahrt haben. Den Kritikern, die den neuen Autor begrüßten, war seine Aneignung des sogenannten kulturellen Erbes nicht entgangen. Sie verglichen ihn ungeniert mit den Großen, zählten die Einflüsse auf, die der Autodidakt verarbeitet hatte: von Hölderlin, Rimbaud und Georg Heym bis zu Brecht, Enzensberger – und (warum nicht?) Johannes R. Becher. War uns ein „Hölderlin aus Sachsen“ erschienen, gab es einen Georg Heym redivivus? Oder waren auch diese Etikettierungen bloß gutgemeinte Versuche, die von den Gedichten bezeugte abwesenheit aufzuheben? Man lese das Titelgedicht des Bandes:
ABWESENHEIT
wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet
keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt
sind wie wir in uns selbst verkrochen sind
in unsere schwärze
nein wir werden nicht vermißt
wir haben stark zerbrochne hände steife nacken –
das ist der stolz der zerstörten und toten dinge
schaun auf uns zu tod gelangweilte dinge – es ist
eine zerstörung wie sie nie gewesen ist
und wir werden nicht vermißt unsere worte sind
gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee
wo bäume stehn prangend weiß im reif – ja und
reif zum zerbrechen
alles das letzte ist uns zerstört unsere hände
zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch
geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache
einander vermengt und völlig egal in allem
und der wir nachlaufen und unserer abwesenheit
nachlaufen so wie uns am abend
verjagte hunde nachlaufen mit kranken
unbegreiflichen augen.
„Abwesenheit“ ist ein vieldeutigeres Wort als „Entfremdung“, ein poetischeres dazu. Aber es bezeichnet im Kontext des Gedichts sehr deutlich, was die Theoretiker und die Nachsprecher des Begriffs „Entfremdung“ meinten oder zu meinen vorgaben. Hilbig ist kein lyrischer Kulturkritiker, auch geht es ihm nicht um Einzelheiten. Die Heillosigkeit, von der er spricht, ist allgemein – so sehr, daß nur eine poetisch gefaßte Allgemeinheit sie bezeichnen kann. Daher der Predigergestus des Gedichts. Der Autor weiß, daß er diesen Gestus nicht durchhalten kann. So bricht er ab, schweift aus ins große Ganze oder ins Alltagsdetail, artikuliert sein Mißtrauen in eine „restlos zerbrochene sprache“ und kann ihrer doch nicht entbehren.
Man liest heute dieses Gedicht aus einem doppelten Abstand, dem seiner Entstehung (1969) und dem seiner Publikation (1979). Deutlich wird da, daß der verwendete Plural ein Pluralis majestatis war: der Plural der Majestät eines unzerstörten Subjekts, das sich aus einer „zerstörung wie sie nie gewesen ist“ erhebt.
Deutlich auch, daß dem Paradox des zerstört-unzerstörbaren Subjekts ein solches der Sprache entsprach. Was da „eine restlos zerbrochne sprache“ genannt wurde, artikulierte sich in klaren und expressiven Bildern und in rhythmischen Figurationen aus vielerlei Tradition.
Was dem flüchtigen Blick als Abhängigkeit von Vorbildern erscheinen mochte, war das Indiz von Hilbigs Unabhängigkeit. Ein Epigone hätte sich an ein einziges Vorbild angehängt. Hilbig nutzte alles, was ihm begegnete und fruchtete. In einem seiner frühesten Gedichte, dem 1965 entstandenen „ihr habt mir ein haus gebaut“ wird deutlich, daß der unbedingte Wille zur Unabhängigkeit mehr als der Last der Tradition der staatlichen „Betreuung“ gilt, ja jeglichem Anspruch eines Kollektivs:
ihr habt mir ein haus gebaut
laßt mich ein anderes anfangen.
ihr habt mir sessel aufgestellt
setzt puppen in eure sessel.
ihr habt mir geld aufgespart
lieber stehle ich.
ihr habt mir einen weg gebahnt
ich schlag mich
durchs gestrüpp seitlich des wegs.
sagtet ihr man soll allein gehn
würd ich gehn
mit euch.
Der Wille zur Unabhängigkeit gibt sich am Schluß des Gedichts selbst eine Bedingung, die ihn aufheben könnte: die Freiheit; sagen wir lieber: die Freisetzung durch das Kollektiv. Sie würde dem Subjekt Solidarität ermöglichen, den Pluralis majestatis in ein gewöhnliches Wir überführen: „sagtet ihr man soll allein gehn / würd ich gehn / mit euch.“
Man darf das ein Angebot nennen. Ein gutmütiges. Ein naives auch. Hilbigs Angebot ans Kollektiv wurde ebensowenig angenommen wie das anderer Dichter; man denke an Reiner Kunzes Bekenntnis, das fast ein Gelöbnis war: „eingesperrt in dieses land / das ich wieder und wieder wählen würde.“ Hilbig ließ man erst gar nicht soweit kommen, sich in irgendeiner Weise als repräsentativ zu verstehen (was für Kunze bis in die siebziger Jahre immerhin denkbar schien). Wenn Hilbig den Dichter, also sich selbst, als Denkenden vorführt, dann nicht in irgendwie doch noch repräsentierender Frontalsicht, sondern als einen von hinten gesehenen, vom Rücken her beobachteten Fremden – so in „h. selbst-portrait von hinten“:
die hand im haar so hockt er
ruhlos am tisch
und ahnt nicht daß die herbstnacht
die luft an seinem nacken dunkel färbt
er sitzt auf dem sprung er sagt ich bin
solitair
aaaaaaund müde bin ich bin mir selbst
entflohn (so hockt er am tisch der fremde
wenn ich allein im zimmer bin
(…)
Noch hier, in der Selbstaufspaltung in Betrachter und Betrachteten, im verfremdenden Blick auf sich selbst, in der Dialektik von Aktivität und Erschöpfung, kommt die eigentümliche Mehrdeutigkeit von Hilbigs Individualismus ins Spiel: im Changieren des Wortes solitair (das im Französischen solitaire zu schreiben wäre). Man darf adjektivisch an „einsam, vereinzelt“ denken und substantivisch an den Eremiten oder Anachoreten, an den einzeln stehenden Baum und selbst an den einzeln gefaßten Edelstein. Man mag sogar rätseln, ob das solitair(e) nicht auch zum solidaire werden könnte, wie in einer Erzählung von Albert Camus. Wobei wir erneut bei dem dieser trotzig individualistischen Lyrik inhärenten Moment des Sozialen, Gemeinschaftlichen wären. Hilbig muß zumindest zuzeiten vom Amt des Dichters geträumt haben, nämlich in dem 1967 geschriebenen Gedicht „bewußtsein“, und er hat dieses selbst für seine Verhältnisse ungewohnt emphatische Gedicht, das im übrigen die Lektüre von Enzensbergers Landessprache verrät, in den Band abwesenheit übernommen:
im namen meiner haut
im namen meiner machart
im namen dieses lands
wo die sorge sich sorglos mästet
im namen welches zerrissnen
namens den sich heimlich
die liebespaare zuflüstern
im namen welcher unerlaubten
schmerzen
aaaaaaaaadie verwirrung
in worte zu kleiden
aaaaaaaaaaaaaaaahab ich
das schreiende amt
aaaaaaaaaaaaaaaaübernommen
Hilbigs abwesenheit ist aber auch ein Gedichtbuch mit sehr realistisch behandelten sozialen und sozialkritischen Motiven. Die demonstrierte und beklagte abwesenheit meint nicht zuletzt Entfremdung vom Leben der Menschen als soziale Wesen, meint den „aufenthalt“, das Leben im Staat DDR:
in den wohnungen in denen wir hausen
bleibt das licht eingeschalten die luft
schließt öffnet die fenster schlägt
die flügel ans holz unaufhörlich
die revolution ist vorüber die kalender
zeigen den vergangenen monat an
auf den tischen stehn gläser in der tabakasche
auf den dielen bierpfützen zündhölzer scherben
schmutzige schuhe auf dem rücken
die leute in den betten
schlafen
aus den wohnungen in denen wir uns aufhalten
flüchten die stunden wie die luft auch der schlaf
hält sich nicht lange auf
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaawir bauen ein chemiewerk
für die zehnte generation füttern die gestänge
mit kalten kabeln später ein kraftwerk für
noch später doch vielleicht gibt es krieg
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam morgen
explodieren die wecker überschütten uns
mit schellendem feuer
(…)
Dieses Gedicht von 1966 beschreibt (vielleicht in einem halbbewußten Anklang an Nelly Sachs) Wohnungen des Todes, eines Todes bei Lebzeiten. Unter diesem Blick erscheinen die Projekte einer planwirtschaftlichen Industrialisierungsemphase, wie sie seinerzeit von Autoren wie Volker Braun pathetisch gefeiert wurden, als im voraus vergebliche Anstrengungen. Selbst der Krieg, der „am morgen“ ausbrechen könnte, verliert seine Bedrohlichkeit unter den Explosionen der Wecker, die Menschen in den Arbeitsprozeß, in die Produktionsschlacht treiben. – Was wunder, daß der Leipziger Reclam Verlag, als er, wohl als Folge der westdeutschen Resonanz, den Auswahlband Stimme Stimme herausbrachte, dieses Gedicht nicht berücksichtigte. Aber da war die Chance oder besser: die Versuchung, den Dichter Hilbig ins System zu integrieren, längst vertan. Auch Franz Fühmanns enthusiastische Begrüßung „Ecce poeta!“ konnte nichts daran ändern – ohnehin hat ja jegliches Ecce poeta etwas vom dolorosen Ecce Homo. Fühmann sprach nicht ohne Grund von „Würde und Qual der Einsamkeit“ Hilbigs und beschwor das „Gegenbild des Verlorenen Sohnes“, da der Angesprochene für die DDR längst verloren war.
Hilbig hatte inzwischen seine poetischen Möglichkeiten erweitert und sich die Prosa – man darf wohl sagen – erarbeitet, eine Prosa, in der er nicht bloß den künstlerischen Radius immer weiter ausdehnte, sondern auch an Radikalität der Aussage gewann. Die bittersten Konstatierungen über den Staat und das Land DDR findet man hier, beginnend mit den Texten in Unterm Neomond (1982), gesteigert in Der Brief („Dieser Ort, den sie Dresden nannten, war die Hölle“) und kulminierend in dem Roman Eine Übertragung (1989). Darf man annehmen, daß sich bei Hilbig auch so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen den Gattungen herausbildete, die der Poesie das Refugium Phantasie zuwies – freilich eine, die der Lyrik auf Dauer nicht unbedingt günstig war? Wir werfen einen Blick auf Hilbigs zweiten Lyrikband die versprengung (1986), dem bisher nur lyrische Einzelpublikationen gefolgt sind.
In versprengung versucht Hilbig einen entscheidenden Schritt weiter: abwesenheit, die ja immerhin noch als eine negative Variante von Anwesenheit gelesen werden konnte, soll versprengung werden. Der Titel zielt laut Dispersion, auf die Zerstäubung von Subjekt und Sinnbezug. Auch auf Regression, da das Ich „in schnaps ersäuft“. Sarkastisch wortspielend sucht das Ich als letzten Grund „gnädiges anwesen: unwesenheit“. Die ebenso tödliche wie befreiende versprengung scheint nur gegen enorme gedankliche Widerstände zu haben sein. Denn noch findet man die dezidierten Absagen, in denen sich das lyrische Ich ein weiteres Mal gegen Staat und Gesellschaft abgrenzt; etwa so:
(…)
in meinem qualm erstickt die freiheit die ihr meint
entscheidet gegen mich ich sammle pest in meinen kleidern
ihr wollt liköre ich den großen rausch
alles wechseln will ich
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaihr eurer hundemarken tausch
ihr wollt die rente ich den klang der seele:
reifsilber das in wäldern hinter thule weint −
an eurem herzensfrieden mußt ich scheitern
euch fesselt glück ins haus…
ich wollt auroren an die kehle.
Ein Gedicht der Verteidigung, ein defensives Gedicht. Ein Plädoyer, das rhetorisch operiert, wenn es das Ich gegen die andern setzt und zu Wiederholungen greift. Autonomie wird nur behauptet, nur gewünscht: „alles wechseln will ich“. Aber was nach der Zeilenzäsur folgt, ist bloß Fortsetzung der Beteuerung. Der (von fern an George erinnernde) „klang der seele“ erweist sich als Kunstgewerbe: „reifsilber das in wäldern hinter thule weint“. So leicht, möchte man folgern, geht es „auroren“ nicht an die Kehle.
In dieser Situation des lyrischen Voluntarismus mag der Autor die Einlösung seiner Wünsche nach „Versprengung“ in bestimmten Methoden der gezielten oder rauschhaft provozierten SprachaufIösung gesucht haben. Rimbaud, Trakl, auch Heym grüßen wieder als Vorbilder – manchmal zugleich aus ein, zwei Hilbig-Versen; etwa: „und fort war die heroensonne / die ganz in eisen durch den blutdunst rollte“. Solche Entgrenzung überzeugt poetisch, wo Hilbig der Ichauflösung auch selbstgefundene Partikel von Realität und Erfahrung mitgibt:
der gang zum wasserklosett
abgeabert
brüllendes gähnen (duplizität ermüdet
Den Duplizitäten und den Wiederholungen ist nicht so einfach zu entgehen; diese Erfahrung macht jeder Lyriker, sobald er einmal den Kreis seiner Themen und Motive abgeschritten hat. Hilbig (und das spricht für seinen dichterischen Impuls) protestiert gegen die Wiederholung, gegen die lastende Konkurrenz seiner Vorgänger: „war das gedicht der rabe von e.a. poe not / wendig“?
Eine rhetorische Frage; freilich eine, die sowohl das Ja wie das Nein zuläßt. Und so antwortet Hilbig zum einen mit Texten; die so etwas wie eine linguistische und poetologische Reflexion betreiben; zum andern mit solchen, die auf Entgrenzung der Bilder und Metaphern hinauswollen. In gewissen Momenten erfährt das lyrische Ich beides zugleich: eine Übermächtigung durch Sprache, die Gestalt angenommen hat. Teil 1 des Doppelgedichts „die namen“ schließt:
die namen nehmen gestalt an schreckliche
bärtige götter sie heulen nach feuer
und schwert sie werfen mich aufs bett
und öffnen mir die schenkel
Solch zwingende Momente, in denen der sprachliche Eros die Initiative ergreift, lassen sich nicht perpetuieren. Das zeigt bereits der Neuansatz in Teil 2 des erwähnten Gedichts:
regen zersägtes licht
rosa neon befällt gestreift die straße
die grenzen des landes meiner generation
sind fließend
aaaaaaaaaaagezeichnet von blut
und kastrationsurin ach aufgegeben
trage ich namen ein in die verwaschenen
lücken der schrift
(…)
Deutlich, wie der Autor sich auf die Höhe seines Themas zu schrauben sucht: durch preziöse Wahrnehmungsklischees, durch wabernde Verallgemeinerungen und schließlich die gröbsten Mittel („blut und kastrationsurin“). So gewinnt er sein Pathos um einen hohen Preis. Überhaupt lassen sich etliche Gedichte in versprengung zu sehr auf einen dunklen, wilden, pathetischen Dauerton ein und verstoßen gegen die artistische Maxime, das Material kalt zu halten. Wo Hitze und Spannung nachlassen, kommt es zu Sequenzen, deren künstlerischer Zusammenhang nicht mehr einleuchtet. Auch der Titel „nature morte“ legitimiert kaum das bric a brac der Zeilen:
flüchtige verantwortung des fensters
im hintergrund vor der wüste der nacht
thebanisches blau von den ufern der zukunft −
nur schatten bluten so im ausgelöschten auge der geschichte.
Derlei mag wie Routine scheinen. Aber Wolfgang Hilbig ist ein zur Routine unbegabter Poet. Er produziert zwar zwischendurch auch Ausschuß, Schlacke, gewiß; aber er zeigt sich unfähig, das Mißlungene ins Versierte zu schönen. die versprengung ist unter anderem auch ein Gedichtbuch der Krise und des Sprachzweifels. Das trunkene Schiff, das den Dichter entführt, ist längst den Lyrikstrom hinunter, das wüste Land ein Klassiker, und der Nachgeborene weiß, daß „der poet und die wüste“ ein Topos ist. Das 1978 geschriebene Gedicht dieses Titels versucht es noch einmal mit Denunziation und Selbstdenunziation, wenn es anhebt:
das wort lyrik
das so lauwarm lullt sekundärpoesie
ach eine ganze welle ausgeleierter wendungen
dritte griechisch faule metren hektikdithyramben
überspülen mich unter trüber lampe trübem schädel
singsang der sich für still erklärt die weisheit des gargekochten
kommt in meinen applaudierenden schlagadern zur ruhe
(…)
Hilbig braucht solche selbstreflexiven und selbstdenunziatorischen Passagen offenbar, um wieder und wieder (und offenbar immer mühevoller) abzuheben. Er „lullt“ jene Passagen „sekundärpoesie“ aber auch, um Klarheit über seine existentielle und literarische Position zu gewinnen. Aus den Versprengungen seiner „hektikdithyramben“ aber ist er mehr und mehr in die genaue und zugleich wilde Welt einer Prosa gelangt, der man Kraft und Meisterschaft bescheinigt hat.
Harald Hartung, 1993, aus: Wolfgang Hilbig. Materialien zu Leben und Werk, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994
Die Abwesenheit als Ort der Poesie
– Gespräch mit Wolfgang Hilbig. –
Werner Jung: Herr Hilbig, Sie sind 1941 in Meuselwitz/Sachsen geboren…
Wolfgang Hilbig: Thüringen! Das ist schon eine Merkwürdigkeit, Meuselwitz gehörte immer zum Bezirk Leipzig, und Leipzig ist ja eine ursächsische Stadt, die Länder gab es in der DDR nicht mehr – aber Meuselwitz war eigentlich Thüringen, immer schon.
Jung: Sie haben, wie man auf Klappentexten und anderswo lesen kann, in verschiedenen Berufen gearbeitet. Seit wann schreiben Sie?
Hilbig: Eigentlich schon seit meiner Kindheit, wahrscheinlich seitdem ich schreiben gelernt habe, auf der Schule; sofort habe ich versucht, irgendwas zu schreiben, ich weiß nicht mehr, wann es angefangen hat. Ich sehe mich eigentlich immer nur schreibend.
Jung: Begonnen haben Sie – und das ist auch Ihre erste Publikation, im Westen – mit Lyrik.
Hilbig: Zuerst habe ich eigentlich Prosa geschrieben. Aber ich habe immer viel Romantiker gelesen, und bei denen gibt es diese lyrischen Einsprengsel, zum Beispiel bei Eichendorff. Das habe ich dann nachzuahmen versucht. Und so bin ich auf die Lyrik gekommen.
Jung: Man kann nicht sagen: zuerst das eine und dann das andere?
Hilbig: Nein. Veröffentlicht aber habe ich zuerst Lyrik.
Jung: Das überrascht mich: Meine These wäre gewesen, daß das Schreiben von Lyrik in besonderer Weise Ausdruck von Existentiellem ist und daß, wenn existentielle Zwänge und damit auch ein bestimmter Leidensdruck wegfallen, dann eine Distanz möglich ist und damit auch ein Gattungswechsel stattfinden kann.
Hilbig: Das kann sein, das ist bestimmt richtig, aber ich glaube, bei mir ist es einfach immer nebeneinanderher gelaufen. Die ersten Texte, die ich geschrieben habe, sind Prosa gewesen. Wie das in meinem Fall mit Leidensdruck zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich skeptisch gegenüber solchen Begriffen, hinter denen die Annahme steht, daß das Leiden das Schreiben auch zeugt. Ich glaube doch eher – ja, wenn es schon ein Leiden ist, dann ist es ein Leiden am Sich-nicht-artikulieren-Können, möglicherweise.
Jung: Deshalb hatte ich vermutet, es geht einfach schneller mit der Lyrik. In Ihren frühen Gedichten merkt man noch stark die Erfahrungen belastender körperlicher Arbeit, die da in kurzen, teilweise lakonischen Gedichten verdichtet werden, die auch wenig metaphorisch sind, eine Tendenz, die man in der Bundesrepublik seinerzeit unter dem Stichwort Alltagslyrik erfaßt hat.
Hilbig: Ja, es war bei mir doch wohl mehr der Sachverhalt, daß ich öffentlich kein Schriftsteller war und immer so vor mich hingeschrieben habe. Ich wurde nicht veröffentlicht, und ich kam damit ganz gut zurecht. Es ist bestimmt nicht so, daß es schneller gegangen ist mit der Lyrik: mein erster Gedichtband enthielt Texte aus zwölf Jahren. Ich merke erst jetzt, daß Gedichteschreiben im Grunde viel länger dauert als Prosaschreiben. Prosa bedeutet für mich die Möglichkeit, schneller etwas ausdrücken zu können.
Jung: In diesem Zusammenhang ist wohl Franz Fühmann wichtig gewesen. Kann man sagen, daß er Ihr erster Fürsprecher war?
Hilbig: Fürsprecher, ja. Er hat, nachdem mein erstes Buch erschienen war und er es bei einem Aufenthalt in der Bundesrepublik gelesen hatte, mich nach der Rückkehr sofort zu sich eingeladen und gesagt, wir müssen unbedingt in der DDR etwas von Ihnen publizieren. Er war damals im Beirat der Zeitschrift Sinn und Form und hat dann durchgesetzt, daß acht Gedichte veröffentlicht wurden, was mir den in der DDR wichtigen Status eines Schriftstellers gab: Ich bekam eine Steuernummer und konnte aufhören, als Heizer zu arbeiten. Fühmann war dagegen, daß ich weiterhin arbeiten ging. Sie sollten nur noch schreiben, hat er zu mir gesagt.
Jung: Sie haben einen sehr schönen Essay zu Fühmanns 60. Geburtstag geschrieben…
Hilbig: Für die Neue Rundschau.
Jung: … über das Mythische bei Fühmann, ein Text, anhand dessen man sehr viel Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und Fühmann feststellen kann, in thematischer Hinsicht, aber auch in manchen Formulierungen.
Hilbig: Ich weiß nicht, ob man das Gemeinsamkeit nennen kann. Fühmann hat mich darauf gebracht, mich dafür zu interessieren.
Jung: Für das Thema Mythos?
Hilbig: Ja, durch seine Arbeiten zu diesem Thema.
Jung: Seine Essays, die Kinderbücher, die Prometheus-Geschichten, die letzten Erzählungen?
Hilbig: Er hat ununterbrochen davon gesprochen.
Jung: Welche Bedeutung würden Sie Franz Fühmann für die DDR-Literatur beimessen?
Hilbig: Die denkbar größte, zumindest für die sogenannte inoffizielle DDR-Literatur, für die nicht veröffentlichte Literatur, hatte er die allergrößte Bedeutung. Er war immer ein Förderer dieser sogenannten Literaturszenen, der namhafteste von denen, die sich spürbar dafür interessierten, was sich außerhalb der offiziellen DDR-Anweisungen abspielte. Er versuchte immer wieder, mit Leuten wie Uwe Kolbe oder Frank-Wolf Matthies etwas zu machen.
Jung: Ich habe die Befürchtung, daß man mit der Betonung der besonderen Rolle Fühmanns als Förderer und Mentor sein eigenes literarisches Werk zu stark in den Hintergrund drängt.
Hilbig: Das befürchte ich manchmal auch. Aber ich glaube nicht, daß das wirklich passieren wird, das wird meiner Ansicht nach gar nicht möglich sein. Wenn es um Literatur aus der DDR geht, also aus diesem Teil Deutschlands, wird es in der Hauptsache auch um Fühmann gehen, Fühmann war eine zentrale Gestalt.
Jung: Könnten Sie das noch etwas eingehender erklären?
Hilbig: Fühmann ist einen fast symptomatischen Weg gegangen vom – was ich übrigens für etwas überspitzt halte, aber es ist seine eigene Formulierung – Nazi über die Antifa-Schule zum antifaschistischen, ja sozialistischen Autor. Und ich glaube, daß er ein überzeugter sozialistischer Autor geworden ist. Dann aber hat er als einer der ersten angefangen, an dem System zu zweifeln, und er hat sich später, wie ich meine, völlig mit ihm entzweit. Ich war bei seinem Begräbnis, es durfte dort kein offizieller Funktionär auftreten, das hatte er testamentarisch verfügt.
Jung: Um wieder auf Sie, Wolfgang Hilbig, zurückzukommen, eine neue Frage: Gibt es für Sie so etwas wie Heimat?
Hilbig: Das streitet ja die Literatur immer ab. Vielleicht ist es gerade deshalb in der Literatur zu finden, das Gefühl, das durch dieses Wort beschrieben werden soll. Aber an sich sollte der Literat eigentlich darauf verzichten. Es gibt mehr als den Ort, den man als Heimat bezeichnet. Ich meine, die Verkehrsbedingungen sind heute einfach anders, auf die bezogen ist der Begriff Heimat doch ein bißchen altmodisch.
Jung: Ich möchte Sie auf Ihren eigenen Text bringen. – In dem langen Gedicht von 1990 mit dem Titel „Prosa meiner Heimatstraße“ heißt es an einer Stelle programmatisch: „Ohne Heimat sind wir.“
Hilbig: Ich glaube, daß es möglich ist, daß Aussagen in Gedichten und Prosatexten einen Augenblick lang, nämlich in dem der Niederschrift, wahr sind und dann wieder relativiert werden können in späteren Texten. Das Schreiben ist vielleicht ein Prozeß, der sich mit dem Text ändert, weshalb dann so eine Aussage sehr ambivalent sein könnte. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt hat aus dem Grund, weil es immer ein Vorwurf an die DDR-Autoren gewesen ist. Man hat als Schriftsteller aus der DDR mit diesem Begriff eine Art Geschichte, und die ist nicht so leicht auszulöschen. Deshalb kommt das Wort vielleicht mehr bei Leuten vor, die aus dem Osten stammen.
Jung: In der alten BRD oder auch in der Schweiz und in Österreich wird es immer als kritische Heimatliteratur verstanden, immer in einer sozialkritischen Richtung gedeutet. Heimat kann aber auch weit mehr bedeuten – das muß nicht unbedingt der Ort der Herkunft, eine Stadt, eine Gegend, sein, Heimat kann sich auch auf dieses Gebilde Staat beziehen. In diesem Zusammenhang fällt mir Ihre Formulierung von der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Herbst ein, daß der Geruch der DDR an Ihnen haftenbleiben werde.
Hilbig: Ja, in dem Gedicht steht das auch so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, aber ich will es einfach so sehen, ich will es immer noch als richtig ansehen, das wird haftenbleiben.
Jung: Und das hieße: Verbundenheit mit der DDR?
Hilbig: Notgedrungen. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, wenn man immer noch nach dieser berüchtigten DDR riecht, aber wenn es denn das Eigene sein soll, dann bitte.
Jung: Das ist ja eines Ihrer Themen, oder – sagen wir es mit Thomas Mann – Ihrer Leitmotive: Literatur als Prozeß der Erinnerung. Das impliziert dann selbstverständlich die Auseinandersetzung mit der Herkunft, mit der Vergangenheit, nicht zuletzt mit dem, was man Heimat nennt.
Hilbig: Zu diesem Thema fällt mir immer mehr Faulkner ein als Thomas Mann. Faulkner hat es meines Erachtens fast verwirklicht, vorbildhaft verwirklicht, dieses Gebiet um Jefferson/Mississippi in einen völlig literarischen Ort zu verwandeln. Da man bestreitet, daß die DDR noch existiert – wo könnte sie denn noch existieren außer in der Literatur?
Jung: Im Denken, in den Köpfen, in den Erinnerungen.
Hilbig: Es ist ja nicht damit abgetan, daß man die Erinnerungen hervorruft, sie haben ja dann auch wieder Auswirkungen auf die Mentalität, Auswirkungen auf das Befinden der Leute. Und damit ist es doch eine längerwirkende Geschichte mit dieser DDR.
Jung: Wenn ich Sie mit einer anderen Aussage von Ihnen konfrontieren darf: In einem Interview von 1990 sagen Sie – und das hat mich beeindruckt –, daß Sprache für Sie „nie kapriziöser Selbstzweck, sondern zwingende Suchbewegung gewesen“ ist. Suche wonach?
Hilbig: Nach dem möglichst adäquaten Ausdruck für eine Sache, die man gerade ausdrücken will, Suche nach der Möglichkeit, die Differenz gering zu halten zwischen den Sprachmöglichkeiten und dem, was man sieht oder zu sehen glaubt. Das kann etwas ganz Banales sein wie der berühmte grüne Fleck von Flaubert.
Jung: Könnte man das vielleicht auch mit Ihrem Begriff der Abwesenheit zusammenbringen?
Hilbig: Ich glaube, das wäre jetzt etwas kurz geschlossen. „Abwesenheit“ war zunächst der Titel eines Gedichts, das ich 1969 geschrieben habe. Damals schien in der DDR noch alles in Butter, es gab noch keine Biermann-Affäre, es gab noch kaum Autoren, die weggingen aus der DDR. Zehn Jahre später, als das Gedicht zum Titelgedicht meines ersten Gedichtbandes geworden war, lagen die Dinge ganz anders, der Buchtitel traf mitten hinein in die Autorenfluktuation nach der Biermann-Ausweisung, und dementsprechend wurde dieser Titel von beinahe allen Rezensenten verstanden… er wurde rein aktuell verstanden, weil man die Jahreszahl nicht beachtete, und er wurde damit mißverstanden. Wobei es trotzdem wahr bleibt, daß der von mir verwendete Begriff „Abwesenheit“ plötzlich auch diesen aktuellen Bezug erhalten hatte. 1969, als ich das betreffende Gedicht schrieb, wäre sein simpelstes Verständnis einfach die Tatsache gewesen, daß ich als Lyriker in der DDR überhaupt nicht anwesend war, ich war Industriearbeiter, der sich von seinen Arbeitskollegen nach außen hin kaum unterschied. Doch wäre ein solches Verständnis natürlich ziemlich sentimental. Ich beschäftigte mich damals viel mit den Poetiken der Moderne, und ich sagte mir, im Grunde genommen ist es der Ort der Poesie, der mit dem Wort „Abwesenheit“ beschrieben wird. Ich glaube, ursprünglich kam das aus der Lektüre von Mallarmé her.
Jung: Aber es ist ja schon auffällig, daß dieser Begriff dadurch, daß Sie ihn so häufig verwenden, fast terminologisch wird.
Hilbig: Ja, ich werde auch immer wieder darauf gebracht.
Jung: Im Gedicht von 1969 ist es programmatisch, dann heißt der ganze Gedichtband abwesenheit; man könnte es bis in den jüngsten Roman Ich verfolgen, wo an vielen Stellen dieser Begriff, dieser Topos Abwesenheit auftaucht.
Hilbig: Als ob ich das geahnt hätte: Ich wollte den Gedichtband damals nicht so nennen, aber mein Lektor ließ sich nicht davon abbringen.
Jung: Im Roman Ich wird der Gesamtzustand der DDR unter dem Begriff Abwesenheit gefaßt.
Hilbig: Das darf man ruhig provokativ verstehen. Ich meine nicht, daß die DDR ein Ort der Poesie war, das wäre jetzt zu einfach. Vielleicht war sie aber doch ein Grund, mindestens für mich, Poesie zu machen. Zwar sollte die Literatur voraussetzungslos sein, doch es war halt so, die Realitäten waren anders, und die konnte man nicht einfach leugnen.
Jung: Nun könnte man das ja auch sozusagen positiv verbuchen, indem man sagt, daß das Schreiben der Versuch ist, etwas wie Anwesenheit…
Hilbig: … herzustellen, ja sicher, aber wo ist diese Anwesenheit dann, im Buch – oder?
Jung: Im Text.
Hilbig: Im Text, ja, ja. Da fällt mir sofort die Frage ein, ist das denn wirklich die Anwesenheit im Text, das vermischt sich mit Begriffen wie Literaturbetrieb, wo man auch schon nicht mehr anwesend ist. Es bleibt ja nicht dabei. Der Text wird veröffentlicht, entfremdet sich einem sogleich. Es hält jedenfalls nicht an.
Jung: Könnte man nicht doch sagen, daß man sich aus diesem Zustand gesellschaftlicher Abwesenheit oder auch Entfremdung schreibend befreien, möglicherweise sogar eine Identität schaffen kann?
Hilbig: Das wäre Widerstand, hieße Widerstand zu leisten. Die Diktatur kann das Wort „Ich“ nicht ertragen; das Individuum widerspricht ihr, es ist selber eine kleine Diktatur; das geht einfach nicht zusammen.
Jung: Aber es geht Ihnen ja nicht darum, eine stabile Identität zu erschreiben, durch das Erinnern und das Schreiben über die Erinnerung sich eine sichere Identität zu schaffen, im Gegensatz vielleicht zu einem Autor wie Hermann Lenz.
Hilbig: Ich glaube, nicht mehr. Vielleicht ging es mir irgendwann mal darum, aber ich zweifle inzwischen, ob es mir nicht schon völlig aus dem Ruder gelaufen ist oder ob das irgendwann noch einmal zu dem Zustand zurückkehren kann, wo man von einer stabilen Identität sprechen könnte. Übrigens zweifle ich da auch ein bißchen bei Hermann Lenz. Ich glaube, das sind ebenfalls nur Versuche – ich habe seine autobiographischen Romane gelesen –, ich glaube nicht, daß ihm das gelingt, ja daß er es überhaupt noch will.
Jung: Aber zumindest der Versuch ist bei Hermann Lenz da, anhand dieser Kunstfigur Eugen Rapp herauszufinden, wer er war und ist. Daß das natürlich Annäherungsprozesse sind, das weiß er auch. Aber die Intention geht dahin, sich zu überprüfen, sich gleichsam festzustellen.
Hilbig: Insoweit könnte ich dem auch folgen, das würde ich auch für mich akzeptieren. Dann gibt es periodisch immer so leicht perverse Versuche, das wieder in Frage zu stellen, bei mir jedenfalls. Ich glaube, die gibt es – wenn ich das richtig lese – bei Lenz genauso. Er ist jedenfalls ein Ironiker, und das bringt so etwas hervor. Mir kommt die Autobiographie von Hermann Lenz vor wie ein phantastischer Roman, der eigentlich sehr poetisch ist, den in der Wirklichkeit zu erkennen und für möglich zu halten mir aber phantastisch erscheint. Und das wäre bei mir so ein Punkt, der stünde schon als Voraussetzung da, das könnte ich aus diesem Grund gar nicht mehr versuchen, ich bin ja auch jünger, Lenz hat einen viel weiteren Hintergrund.
Jung: Es gibt aber auch jüngere Autoren, die so etwas versuchen, autobiographische Romane, autobiographische Texte zu schreiben, Ludwig Harig zum Beispiel hat ein Buch über seinen Vater und dann über seine eigene Kindheit und Jugend im Dritten Reich geschrieben. Auch hier eine Poetik der Erinnerung, der Versuch, herauszufinden, wer man ist und wie man zu dem wurde, der man ist. Diesen autobiographischen Hintergrund erkennt man auch in Ihren Texten wieder, ständig werden Stationen Ihrer Biographie in den Text gebracht, aber immer wieder gebrochen. Es geht Ihnen, scheint mir, eben nicht bloß darum, ein Ich, Wolfgang Hilbig, zu fassen.
Hilbig: Ich glaube, wir, die ehemaligen DDR-Bürger, kommen aus einer gebrochenen Gesellschaft. Da hat es einfach zu viele Umbrüche gegeben, zuviel falsche Wirklichkeit, oder man hat sich immer, selbst wenn man nicht mit denen befreundet war, auf Wirklichkeiten einlassen müssen, die eigentlich gar nicht existierten. Zumindest mußte man mit einer Terminologie umgehen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatte. Das ist wahrscheinlich doch ein Bruch. Autoren wir Harig oder Lenz, die praktisch immer im Kapitalismus gelebt haben, sind von Ideologie – sehen wir von der Nazi-Ideologie ab – weitgehend verschont geblieben. Im Gegensatz dazu sind wir eigentlich Leute, die geprägt sind von ideologischen Weltbildern, während das im anderen System doch eher ökonomische Weltbilder gewesen sind.
Jung: Sie meinen, eine West-Identität wäre leichter zu finden gewesen?
Hilbig: Das weiß ich nicht, vielleicht; sie könnte auch gerade dadurch schwerer zu finden sein, das möchte ich offenlassen. Ich glaube, dieser Vergleich funktioniert nicht: ist es hier leichter oder da. Es gibt zu viele unüberwindliche Schwierigkeiten, die es auf der anderen Seite nicht gab, und umgekehrt war es ebenso. Da läßt sich nichts aneinanderlegen. Ich bin natürlich der Meinung, daß die Marktwirtschaft die Menschen und ihre Identität viel mehr und viel weitgehender entfremdet oder gar entwirklicht, als es der Kommunismus je gekonnt hätte. Der Kommunismus hat einfach nicht die ökonomischen Möglichkeiten gehabt; man braucht dazu Mittel, sonst funktioniert das nicht.
(…)
neue deutsche literatur, Heft 497, September/Oktober 1994
Wolfgang Hilbigs Poesie der „Abwesenheit“
Der 1941 geborene und aus dem Leipziger Braunkohlenrevier stammende Wolfgang Hilbig steht altersmäßig eher den Schriftstellern der ,Braun-Generation‘ nahe, war aber immer deren sozialutopischen und poetischen Intentionen sehr fern. Hilbig, der von seiner Biographie her in der DDR der ideale schreibende Vorzeigeproletarier hätte sein müssen, hat sich nie um die literarischen Regeln des „Arbeiter- und Bauernstaates“ gekümmert. „Es kostete mich keinerlei Anstrengung, zu begreifen“, läßt er den Protagonisten der essayistischen Erzählung Der Brief aus dem Jahr 1981 aufschreiben, „daß ich nicht von der Arbeiterklasse geschickt worden war, um zu schreiben… wenn das der Fall gewesen wäre, hätte es vielleicht einen Grund gegeben, mich Arbeiterschriftsteller zu nennen. Ich scheue mich nicht zu behaupten, daß von ihr, dieser Klasse, sogar meine ärgsten Behinderungen ausgingen.“43 Hilbigs poetische und thematische Kompromißlosigkeit ließ ihn lange Zeit Außenseiter und unbeachtet bleiben. In den 70er Jahren wurde er von Fühmann entdeckt, fand Kontakt zu vor allem jüngeren Autoren, lebte vorübergehend in Berlin, dann wieder in Leipzig und seit 1985 mit einem Dauervisum in der Bundesrepublik. Dort hatte er 1979 einen ersten Gedichtband publizieren können, während in der DDR nur gegen erheblichen Widerstand 1983 ein einziger bescheidener Band erschien.44 Ende der 70er Jahre wandte sich Hilbig zunehmend der Prosa zu.
Sowohl in Hilbigs Lyrik als auch Prosa manifestierten sich zuerst und energisch Veränderungen, die einen Bruch mit der herkömmlichen DDR-Literatur bedeuteten: Befreiung von deren sozialutopischer Mission, Öffnung zur künstlerischen Moderne und Beharren auf Individualität. Zu Hilbigs Tragik gehört, daß seine frühen Gedichte, die dies bereits überzeugend dokumentieren, erst spät bekannt und einflußreich wurden. Als Beispiele seien hier die Titelgedichte seiner ersten drei Bücher abwesenheit, stimme stimme und versprengung angeführt, denen poetologische Programmatik zugeschrieben werden kann. Vor allem das Thema „Abwesenheit“ zieht sich fast durch Hilbigs ganzes Werk, wobei es eine allmähliche semantische Verschiebung erfährt. Das gleichnamige Gedicht aus dem Jahr 1969 hebt an:
wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet
keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind
wie wir in uns selbst verkrochen sind
in unsere schwärze
nein wir werden nicht vermißt45
Für ein „wir“ – und auf ein das vermeintliche kollektive Gesamtinteresse symbolisierendes „Wir“ bezog sich ja ständig die DDR-Propaganda – scheint hier nicht nur jede Hoffnung auf eine humane Zukunft in seinem Lande vernichtet („tote dinge / schaun auf uns zu tod gelangweilte dinge“), als zugrundegerichtet erfährt das „wir“ jedes menschliche Identität und Gemeinschaft ausmachende Handeln, Sprechen und Denken:
alles das letzte ist uns zerstört unsere hände
zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch
geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache
einander vermengt und völlig egal in allem
und der wir nachlaufen und unserer abwesenheit 46
Der sozialen Ausgeschlossenheit einer desillusionierten Generation stellvertretend Ausdruck zu verleihen, fühlte sich Hilbigs Sprechen anfangs verpflichtet:
[…] die verwirrung
in worte zu kleiden hab ich
das schreiende amt übernommen.47
Aus dem Leiden an der Situation in seinem Land – „gnädiges anwesen: unwesenheit“ – erwächst Hilbigs gänzliche Absage an die DDR-Gesellschaft, „ihr wollt die rente ich den klang der seele“.48 Der ursprünglich der Ausgeschlossenheit inhärente Wunsch nach Anwesenheit wird, wie Fühmann in einem Essay feststellte, von Hilbig zusehends als unmöglicher Wunsch nach Identität erkannt:
Am Schluß wird sich die Erfahrung ausdrücken, daß die Identität, die naiv ersehnt war, nicht nur deshalb kein Ziel sein könne, weil sie nie erreicht werden kann; zu Beginn jedoch ist das Begehren nach Anwesenheit als der schreiende Wunsch nach dem Ein- und Aufgehen eines ,ich‘ in ein ,ihr‘ da, einem Einssein von Dichter und Gesellschaft.49
Deutlich wird der Bruch mit den Versprechungen und der Ordnung seiner Gesellschaft u.a. in dem Gedicht „versprengung“:
als hartes schweigen feindlicher fackeln starrte
aus der zeit die vorn lag
da löscht auch ich die glut die sie narrte50
Der definitive Verzicht auf utopische Sinnstiftung läßt den Einzelnen ,versprengt‘, allein zurück. In Hilbigs Erzählung „Der Brief“ findet sich die Passage:
Tatsächlich ist jeder Schriftsteller, wie ich ihn verstehe, ein Findelkind und ein Unbehauster, ein von seinem Stand mehr oder weniger Versprengter. Gerade in diesem Jahrhundert hat sich eine Art von Klassenlosigkeit in der Kunst durchgesetzt, die fast zu einem der Hauptmerkmale ihrer Form geworden ist, ein Umstand, der ihr sehr zu danken ist, der modernen Kunst.51
Kunst und Literatur können eben in der Moderne nicht mehr, wie die sozialistische Ästhetik behauptete, eine humane lebensweltliche Einheit repräsentieren. Daher verändert Literatur bei Hilbig nach und nach in ein Sprechen über die Abwesenheit einer poetisch explizierbaren Sinneinheit überhaupt: „trotzdem ich werde weiterreden rasend stumm / […] ich rede der gestürzten Hoffnung nach“52, denn „kieloben“, „voller falscher lehren“ treibt der „kontinent“.53 Im Werk Hilbigs wird Literatur zum Reich des dem Anwesenden gegenüber Anderen, ist „sehnsucht nach einer seltnen musik / nach einer hymne / die ich nicht singen kann“54.
In dem frühen Gedicht „stimme stimme“55 (1969) wird das Fehlen jeder Hoffnung in der morbiden, zerstörten Umwelt mit der Abwesenheit der Bildsprache Rimbauds in der Gegenwart verbunden:
eine trunkenheit ist gewichen aus meiner stimme
rimbaud ist gewichen aus meiner stimme
Seit Rimbaud kann man wissen („dein hundertjähriges verweigern rimbaud“), daß Wirklichkeit und Kunst sich nicht zur Entsprechung bringen lassen, denn, wie man in Hilbigs Zeilen hineinlesen kann, kapitalistische Industrialisierung und kommunistische Revolution haben diese Einheit aufgelöst „– wirklich war der mohn so grün / und rot so rot der phosphor doch / starres gold verwechselte den klang / wenn morgensonne abendsonne sang –.“ In den Blick des literarischen Sprechens, das nicht schweigen kann, gerät eine Welt zerbrochener Illusionen, gerät ein Individuum, das sich nicht mehr als Subjekt zu identifizieren vermag:
Das Individuum […] muß vom Moment seines Rückzugs aus der Masse an ganz konsequent einen selbstbeschreibenden, selbstuntersuchenden Impuls verspüren… es sieht sich plötzlich außen, weil es den eingebildeten Blick der anderen auch noch leisten muß. Weil die Medizin der Masse nicht mehr heilt, muß es sein eigener Pathologe werden. Zum Widerspruch dabei wird, daß ein Selbstheilungsversuch gerade die Verfertigung einer Spaltung ist, und nicht, wie man annimmt, ein Aufbruch in Richtung eines sogenannten heilen Ich. Und der Eindruck aus dieser Spaltung… wahrscheinlich schon seine bloße Ahnung… führt ganz folgerichtig zur Verunheimlichung aller umgebenden Dinge.56
Eine solche Selbstbeobachtung kommt dem sehr nahe, was Luhmann als Beobachtung zweiter Ordnung als Kennzeichen der Moderne identifiziert. Der metaphysische Beobachterstandpunkt, ein Zentrum, ist nach der irreversiblen Individualisierung und Funktionalisierung der Kommunikation in disparate Perspektiven zerfallen, auch poetisch ist eine Versöhnung unmöglich geworden; „ich“ ist in „stimme, stimme“ nicht nur zum Fremden, sondern zum Horrorbild eines Subjekts, zum „ungeheuer“ geworden:
saures holz meiner worte
die lüge schreit
sicher ist es lüge was ist und ich selber bins
dies ungeheuer
aaaaaaaaaaaaageschändet längst
vom händlerpack von eifernden greisen und
alles was sang (rimbaud du toter mann
in meinem kopf) war schweigen aus tropfengeklirr
stille aus sonnenglas schweigen
sanfterer nächte
Wie in diesen Schlußzeilen des Gedichts angedeutet, gestattet jedoch moderne Poesie, trotz oder gerade wegen des Verlustes von einheitlichem Sinn und Subjekt, den Verweis auf ein Anderes, auf Disparates, auf Sehnsucht, Phantasie, Glück, auf die „sonne des scheiterns“. Die „fluchtwogen unverhoffter horizonte“ sind zwar „absenzen“57, wie es in einem gleichnamigen Gedicht heißt, aber ein Schein des unbennenbar Abwesenden ist evozierbar, benennbar, „azur genug am dunkelgrund des schweigens“.58 Dichtung ist bei Hilbig Poesie der Abwesenheit. Nur konstatieren, nur verweisen kann Kunst, wenn sie modern wird, auf die Abwesenheit eines sinnhaften, ja paradiesischen Zentrums, auf ,Schönheit‘, die angesichts der grauenhaften Realität eben nur noch als Kunst zu haben ist.
Hilbigs Prosa erzählt immer aus der Ich-Perspektive, aber auch hier erweist sich das Ich im Fortschreiten der Texte schnell als nichtauktorial verwirrt sich zwischen scheinbar Realem und Imaginärem, spaltet sich und verliert seine Identität in grotesken, phantastischen und paradoxen Erzählsträngen, was „zur Verunheimlichung aller umgebenden Dinge“ und in alptraumartige Gegenden führt, die allerdings unverkennbar in der DDR liegen. In Kellern, feuchten Hinterhauswohnungen, Gefängnissen und morbiden Landschaften entwickeln sich beängstigende Szenerien, in denen Hilbigs Protagonisten mehr vegetieren denn leben. Die Schäden an Stadt und Natur sind zugleich die Schäden der in ihnen lebenden Menschen. Seine Gestalten verirren sich, suchen verwirrt nach rationalen Erklärungen, aber Fluchtwege, Hoffnung, Sinn bleiben abwesend.
Viele der Protagonisten sind, wie seinerzeit ihr Autor, Arbeiter und Schriftsteller zugleich. Diese ihre „Doppelexistenz“ ermöglicht es Hilbig erzähltechnisch, in seine Prosatexte einen Beobachter zweiter Ordnung einzuführen. Durch das Niederschreiben seiner Erinnerungen wird der Arbeiter zu einem Schriftsteller, der den Arbeiter beim Schreiben beobachtet, womit sich narrative Logik bzw. ein vermeintlich ,realistischer‘ Wirklichkeitsbezug (eine Beobachtung erster Ordnung) auflöst. Das Ich in der Erzählung „Der Brief“ beschreibt beispielsweise die Vergeblichkeit, realistisch schreiben zu wollen:
Gelächter schüttelte mich, wenn ich daran dachte, wie ich jeden meiner Sätze, bevor ich ihn notierte, an die Wirklichkeit gehalten, wie ich versucht hatte, jedes Wort mit dieser Wirklichkeit zur Deckung zu bringen. Und wie ich daran gescheitert war, wie jeder Satz endlos meine Unfähigkeit abspiegelte, eine reale Existenz zu gewinnen, wie alle Wörter letzten Endes der Wirklichkeit fremd blieben.59
Durch die Doppelperspektive aber kommt die „Herrschaft der Grammatik“, der Erzählen ausgeliefert ist und die den „Frieden“ mit der repressiven Wirklichkeit will60, in den Blick der Literatur. Namentlich die Machthaber seines Landes erklärten die Daten der Wirklichkeit nach formalen Gesetzen, nach ideologischen Ursache-Wirkung-Schematas; Logik und Empirie „waren Instrumente der Machterhaltung und sie waren herabgewürdigte Mittel, denn ihre Gültigkeit war zensiert.“61 Wenn Literatur in der Gesellschaft Berechtigung haben will, müsse sie die „Zerstörung des scheinbaren Zweckes der Grammatik“ betreiben:
Inmitten des Organismus dieser Welt, dieser Zeit kann die einzig menschenwürdige Sprache nur aus unbeendeten Sätzen bestehen. Freiheit, dir ein Ende selbst zu finden, kann keine noch so glückliche Ordnung gewähren.62
Mittels solch dezidierten Anknüpfens an Lyrik und Prosa der Moderne (an vielen Stellen verweist Hilbig explizit oder implizit auf Kafka, Poe, Stevenson, Trakl, Gide, Pirandello, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Chlebnikow und andere) forciert er seine Absage an eine Gesellschaft, die die Figuren seiner Texte verfolgt, quält, einkerkert, ihrer Sinnlichkeit und Sexualität beraubt. In der Erzählung „Die Weiber“ beispielsweise konstatiert das Ich ratlos das Verschwinden der Frauen, bis es wahrnimmt, daß deren Verschwinden, ebenso wie das parallele Verschwinden seiner Identität, eine Krankheit der Sprache, der Entindividualisierung durch den Staat war:
offenbar hatte ich sogar meinen Namen verloren, ja, ich wußte nicht mehr, wer ich war, mein Name war das Eigentum einer fremden Figur, nur dadurch war er bei den Weibern, und sie ahnten nichts davon.
Schließlich entdeckt der Erzähler die Weiber wieder, als Insassen eines riesigen Gefängnisses. Als er sich ihnen bemerkbar macht, machen sie ihm ein Zeichen:
Ich verstand, sie machten mir ein schmutziges Zeichen, das schmutzigste, das möglich war, sie hatten sich mit mir verbündet, es war ein Zeichen gegen den reinen Staat. Und es bedeutete auch: warte auf uns… warte noch einige wenige Jahre…63
Solch radikaler Bruch mit der DDR war auch ein Bruch Hilbigs mit deren Literatur, die sich freiwillig ihrer Literarität begeben habe, weil sie sogar ihre eigene (realistische) Ästhetik verriet. Von den wirklichen Zuständen im Lande sei in ihr nichts zu finden, schreibt Hilbig im Roman Eine Übertragung, ihre Produzenten hätten Angst und Haß der Menschen und die Verbrechen des Staates gekannt, aber ignoriert:
In allen Verwaltungen, in aufsteigender Linie, sind diese Vorfälle bekannt. In den Ministerien des Landes sind diese Vorfälle bekannt. Im Kulturministerium des Landes sind diese Vorfälle bekannt. Den realistischen Schriftstellern des Landes, die auf der Suche nach Wirklichkeit sind sind diese wirklichen Vorfälle vollauf bekannt.64
Der Roman bündelt die von Hilbig in seinen Gedichten und Erzählungen angeschlagenen Motive und Themen. Auch hier bildet ein Arbeiter und Schriftsteller die Ich-Gestalt. Sein Protagonist schreibt, weil „es nötig sei, einer durch die offizielle Sprache längst entlarvten Welt anderes entgegenzusetzen als nur Spott oder Klagen“65. Weil aber „der Staat unfehlbare Mittel […] die Literatur zu kriminalisieren“ habe, sei eine Literatur, die diesen Namen verdiene, in der DDR zur Geheimhaltung gezwungen. Nur als nichtöffentliche Untergrundliteratur war sie nicht zu verbieten, konnte sie als „Nicht-Literatur“ gedeihen66. Ausgiebig berichtet Hilbigs Roman-Ich von den Verkrümmungen, die jemand erfuhr, der zum Schriftsteller in der DDR aufsteigen wollte.
Unverkennbar sind in Hilbigs Poetik Ideen postmodernen Denkens, namentlich Derridas, eingeflossen. Das Signifikat entzieht sich, das Geheimnis läßt sich nicht lüften. Wörter bringen die Textmaschine in Gang, spulen Assoziationsketten ab, Anfang oder Ursprung von Bedeutungen sind verloren. Die Abwesenheit eines letzten, ordnenden Signifikanten und die Folgen für die literarische Semantik werden vielfach durchgespielt. Beispielsweise wird der Erzähler in Eine Übertragung verhaftet und in den Vernehmungen durch die Beschuldigung, die ihn in Haft gebracht hat, zum Erinnern immer neuer Details vergangenen Geschehens gezwungen. Da die Macht aber für die Logik ihrer Wirklichkeitsinterpretation passende Details braucht, sieht sich der Erinnernde gezwungen, dieser Interpretation entgegenzukommen und Unwahrheiten zuzugeben, und somit veranlaßt, Wirklichkeit geheimzuhalten. Fiktivität gewinnt dadurch auf Romanebene Realität. Signifikationen werden zu einem sowohl paradigmatischen als auch syntagmatischen unendlichen Substitutionsgeschehen, denn das Verstehen von Ereignissen unterliegt sowohl unterschiedlichen Paradigmen – je nach dem, ob die Organe der Macht, der sich anpassende Arbeiter oder der reflektierende Schriftsteller sie interpretieren – als auch syntagmatischen Verschiebungen, da jede neue Deutung einer Episode, die der Protagonist vorbringt, die vorabgegangenen Deutungen verändert. Wirklichkeit und eigenes Ich entziehen sich dem Erzähler in die „Abwesenheit“. Seine Art des Erzählens sei zum Mißlingen verurteilt, weil er sich nicht von narrativer Rationalität befreien könne, weil er „ein von Gott übernommenes oder erlerntes Verhalten angewendet“ habe 67. Das Subjekt erfährt erzählend bzw. schreibend, daß es mit Rationalität, aber ohne zentrierendes Weltbild, ohne Religion oder Ideologie, rat- und hilflos, entmachtet ist.
Die Hilbigschen Protagonisten jedoch scheitern nicht, sobald sie vermögen, als Schriftsteller die Grammatik und angebliche Logik der Realität zu transzendieren, sich der Phantasie anzuvertrauen:
Da ich auf keine Art die Möglichkeit sah, die Gesellschaft der Arbeiterklasse zu verlassen, ordnete ich mich ihr unter und begab mich, wo ich meine Phantasie nicht zügeln konnte, mit ihr ins Abseits. […] es war, als schriebe ich nur aus dem Willen, die Übermacht meiner Phantasie zu bändigen.68. Gerade die Herrschaftssemantik zwang, die Realität als unwirklich und phantastisch zu erfahren, da sie allen marxistischen ,Gesetzen‘ zuwider lief. Sinngebung und Wirklichkeit widersprachen sich:
war sie es wirklich, die bestehende Realität, oder war ihre Sichtbarkeit eine phantastische Übertragung des Irrealen auf die Leerstellen der Logik.69
„Übertragung“ ist auch der Titel von Hilbigs Roman, in dem der Erzähler erkennt:
Ich war eine Art Symptom für die Würdelosigkeit, wie sie die Diktatur braucht, um sich für existenzberechtigt zu halten. Ich kam mir vor wie eine Metapher, wie eine Übertragung der Übergangsgesellschaft auf meine Person. Die griechische Metapher heißt auf deutsch Übertragung!70
Dieser sozialistischen Verkrümmung setzt schließlich der Schriftsteller des Romans seine eigene „Übertragung“, seine Phantasie entgegen, also nicht eine Welt, wie sie die Ideologie der „Übergangsgesellschaft“ DDR suggerieren wollte. Hilbigs Protagonist lernt, die Suche nach der Poesie als Suche nach der treffenden Metapher für das Abwesende zu verstehen:
In einem Strahl vielleicht, in einer Art poetischem Lichtstrahl hätte es mir gelingen können […] die Divergenzen der Namen und Geschehnisse, der Überlagerungen und Spaltungen, der Anklänge und bloßen Gleichzeitigkeiten zu überbrücken.71
Diese Inkarnation des Poetischen herbeizubeschwören sei ein Akt, dem Dichten Homers zu vergleichen, der als blinder Mann das Meer sah.
Mnemosyne, die Mutter der Musen, das, denke ich, ist das Thema. 72
Hilbigs Erzählern gelingt es daher, wie im Roman Eine Übertragung, Momente der Phantasie, des Poetischen zu erleben, auch wenn sie in einer verkommenen Berliner Wohnung, auf einem Brett in der Speisekammer sitzen:
Hier, in der Diagonale zum Kühlschrank, hörte ich das Einschalten des Geräts am besten, ich hörte das rhythmische Strömen der Apparatur in der Endphase des Laufs; um mich war der Geruch der moorfeuchten Wand, mit Kalkgeruch vermischt, und ich dachte an den kalkigen Geruch der See, an den Stränden jenseits meines Horizonts; es war, als hörte ich, unendlich fern, die See auf das Ufer rollen, oft genug glaubte ich sogar das Knistern und Zischen des Schaums an der Küste, des Schaums der sich überschlagenden Wellen zu hören. Homer, so dachte ich… Homer.73
Hilbig greift für das Ziel, Unbeschreiblichem, Abwesendem Ausdruck zu verleihen, Poesie werden zu lassen, für die „Hoffnung, zusammen mit diesem Sprachlosen eine Sprache zu finden“74, auf poetische Symbole zurück, die, wie er in der Erzählung „Die Einfriedung“ schreibt, die „Funktion von Indizien“ für den Verlust der Wirklichkeit, den der Mensch in der Welt erfährt, haben. 75 Wie in obigem Zitat wählt Hilbig mit Vorliebe als Metapher hierfür das sonnenüberflutete, südliche Meer, eine antike Küstenlandschaft: Arkadien. Bereits seine frühen Gedichten verweisen mehrfach auf arkadische Visionen: „nichts wissen vom süden die bahnhöfe / nichts von patmos“, oder: „der glanz der gesänge versprach mir abend und morgen und reines leuchten sonnengefärbter wasser“76 usw. Der Kontrast zwischen einem idealischen Paradies, dem Meer („merigarto“77), und dem irdischen Hades wird in vielen seiner Texte verwendet. Das Meer als mythische Quelle des Lebens und der Hoffnung verspricht sogar, wieder „meer in sachsen“ zu werden:
ich weiß das meer kommt wieder nach sachsen
es verschlingt die arche
stürzt den ararat.78
Literatur hat somit nicht die Weltbilder anderer Sinnzusammenhänge zu wiederholen, sondern auf das abwesende, riesige „Monopol des menschlichen Unbewußten, das wie eine zweite antimaterielle Erde simultan mit der uns bekannten Erde, und unsichtbar neben ihr, durch das All kreist“, zu verweisen.79 Hilbigs Protagonist begreift:
Der Zusammenhang war das Abwesende! Mir blieb nichts anderes übrig, als die Einzelheiten […] endlich so zu betrachten, wie sie in ihrer banalen Wirklichkeit beschaffen waren: zusammenhanglos und für sich stehend. […] Feige hatte ich mich an die Kette der Erkenntniswillkür schließen lassen, einer Willkür, die dem Glauben an ein totales Erfassungssystem des Lebens entsprungen war.
Mit dieser Erkenntnis klärt sich der Erzähler über Rationalität und Marxismus auf:
Mit einem Gelächter, das ich vorerst besser unterdrückte, stand ich vom Bett auf und machte endlich Licht.80
Das nichtkonsistente Wiedergeben und Interpretieren von Episoden schält sich als Aufgabe der Poesie heraus, das Ausfüllen der Lücken zwischen den Daten mittels Phantasie kraft des Vorstellungsvermögens:
Das Abwesende, das der Zusammenhang zwischen einander ausgeschlossenen Einzelheiten hätte sein können, war […] der formende Geist… die Poesie.81
Phantasie verweist auf das Andere der Logik, der Vernunft. Kunst und Poesie haben, mit Hinweis auf Nietzsche, kein erlösendes, erklärendes Zentrum:
die Poesie war die Abwesenheit, wie sie denkbar konsequent, wie sie absolut zu verstehen war, nämlich als die Abwesenheit Gottes.82
Systemtheoretisch formuliert, symbolisiert für Hilbig das literarische Werk bzw. das Kunstwerk mit seinen Setzungen, seinen Formentscheidungen die imaginäre Einheit der Welt, die es aber nicht beschreiben, sondern nur mittels kunst- bzw. literaturinternen Generalisierungen reflektieren kann.83 Der ,Sinn‘ der Kunst liegt nicht außerhalb der Kunst. Diese moderne Umstellung der Poetik auf Selbstreferentialität, dieser Abschied von einer Literatur, in die Sinn aus einer Utopie, die Sozialität binden soll, hinein-„übertragen“ wird, vollzog Hilbig bereits Anfang der 70er Jahre, wodurch sein Werk für junge Autoren ein wichtiger Bezugspunkt und er selbst „von den jüngeren kollegen […] als qualitätsvoller literat eingeschätzt“84 und geschätzt wurde.
Ekkehard Mann, in Ekkehard Mann: Untergrund, autonome Literatur und das Ende der DDR. Eine systemtheoretische Analyse, Peter Lang Verlag, 1996
Brüder-Grimm-Preis für Wolfgang Hilbig
Laudatio
Es muß im Sommer 1976 gewesen sein, als mir Siegmar Faust, gerade nach West-Berlin übersiedelt, Gedichte seines sächsischen Landsmanns Wolfgang Hilbig zusandte. Welche Texte es im einzelnen waren, müßte ich ziemlich mühsam rekonstruieren, aber noch ganz präsent ist mir das Gefühl jenes Sommernachmittags: da ist ein neuer Autor, ein Evidenz-Erlebnis, auf das man immer wartet, wenn man ungedruckte Texte zu lesen bekommt, und das sich doch recht selten einstellt.
Ich saß an meinem Schreibtisch und sah zwischendurch immer wieder vom Lesen auf: auf den großen Kirschbaum vor meinem Fenster, auf das hessische Wiesental dahinter, das von allen Seiten angegriffen wurde: da von einer neuen Umgehungsstraße zerschnitten, da ein Wasserturm, da ein Sportplatz mit seinen Flutlichtmasten, und vor mir stieg die wüste sächsische Landschaft auf, die Hilbig in seinen Gedichten zeigte, eine Landschaft aus Abraumhalden und tiefen, kilometerbreiten Trichtern, aus denen die Braunkohle gebrochen wurde. Ich las „erinnerung an jene dörfer“:
die bagger blieben die dörfer sind fort
ein dürstender der sonnen flieht und wolken
so floh aus jedem dorf der teich
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamorast
schwarz aufgeschlagen lag am wege
ein durst von lila fliegenschwärmen flog
ein durst von stäubender zerstampfter kohle über wiesen
ein blättergras von wildem rotem rost blühte von hängen
mir war der abend nah
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrockene gewitter
scheiterten in hellen himmeln
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaunfarben ein
verstörtes mittagslicht in fremdes feld geworfen
Noch bevor ich das Gedicht zu Ende gelesen hatte, schon nach einem Drittel durchzuckte es mich: ein Hölderlin des Tagebaus, und vielleicht noch mehr; nicht erfaßbar von einer solchen Spitzmarke. Da ist endlich einer, der dieses grausig-schöne Ineinander von Zerstörung und Produktion in Verse fassen kann, und die Gewalt, die man der Erde antat, wie fand sie ihren Widerpart in einer sprachlichen Gewalt, die den Kräften der Vernichtung die Schöpfung des Geistes entgegensetzte. Und ich las weiter:
mir war der abend nah
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamir wollte schlaf nicht nahn
schon nächtelang
gerüche warn in mir erstickt und brannten
geruch von arbeit fertig und vertan
der dörfer teichgerüche zogen mich in tagebaue
der dörfer dasein war in mir verworren und gespalten
die feuerluft
aaaaaaaaaader tage war der flammenschatten jener nächte
glutsinne flammennerven bauten
verflogner mauern spiegelungen auf
die dörfer fort die bagger
blieben wittern faulen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaalangsam in die erde
die erde ebnet sich
aaaaaaaaaaaaaaaadie dunkle krone
treibt den dorn die schattennamen
spalten sich
aaaaaaaaaaerinnerung stieß durst
in meinen leib und warf mich in den wahn
des abends der den kopf mir rollt
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaageflohnen teichen hin
wo straßen schienen schlaflos früher jahre
steigt die vision von wassern die das frührot spaltet
glühend in meiner seele langen sommern.
Ich legte die Zettel aus der Hand, die nur das Format kleiner Schulhefte hatten, in Perlschrift betippte, und war wie benommen. Welche Diskrepanz zwischen äußerem und innerem Format. Ganze Landstriche, Himmelsstriche wurden aufgerissen in drei Dutzend Versen. Und ich suchte zu begreifen, was mich ergriff, wollte den rätselhaften Details, den literarischen Mitteln auf die Spur kommen, die den großartigen Gesamteindruck erzeugten, und stellte bald fest, welch unglaubliche Verbindung hier das Pathos mit der Subtilität eingegangen war, daß ein sächsischer Proletarier die Elemente der Iiterarischen Rhetorik handhabte, als sei er mit dem Quintilian aufgewachsen. Schier unfaßbar, welcher Reichtum an stilistischen Formen sich fand – ganze germanistische Hauptseminare hätten da Arbeit gefunden. Ich stieß auf die anaphorische Reihung, auf gleichlautende Zeilenanfänge:
ein durst von lila fliegenschwärmen flog
ein durst von stäubender zerstampfter kohle
Und ich stieß auf die Umkehrung.
Zuerst: die bagger blieben die dörfer sind fort
Dann: die dörfer fort die bagger
blieben wittern faulen
Und die Umkehrung kombiniert mit dem Asyndeton, der unverbundenen Reihung:
die dörfer fort die bagger
blieben wittern faulen
Das Asyndeton sofort übergehend in eine Reduplicatio, bei der das letzte Glied einer Wortgruppe zu Beginn der nächsten wiederholt wird: Typus: „langsam in die erde / die erde ebnet sich“. Ich stieß auf Inversionen, auf die Umstellung der Wortfolge, gemessen an den Regeln der Alltagssprache, etwa auf vorweggenommene Genitive à la „verflogner mauern spiegelungen“, begriff sie als ein wesentliches Vehikel dieses lyrischen Pathos. Und ich fand immer wieder kühne Neologismen, Wortneubildungen wie „blättergras“, „unfarben“, „glutsinne flammennerven“, „schattennamen.“ Ich will es damit genug sein lassen, obwohl es längst nicht genug ist für eine exakte strukturale Interpretation. Obwohl noch längst nicht genau genug gezeigt ist, wie genau diese Hilbigsche „erinnerung an jene dörfer“ gebaut ist, als sollte sie in ihrer sprachlichen Architektur, auch in ihrer sprachlichen Architektur, ein Bild der verschwundenen menschlichen Ansiedlungen aufbewahren. Und je mehr ich mit fortschreitender Lektüre über Wolfgang Hilbigs Biographie erfuhr, desto unglaublicher wurde mir seine sprachliche Technik. Gab es, wie bei musikalischen Wunderkindern eine angeborene musikalische Technik, auch eine angeborene literarische Technik? Der Großvater Kasimir noch Analphabet, und der Enkel Autor von Gedichten wie dem folgenden:
DIE GEWICHTE
die gewichte zum pflaumenabwiegen
liegen auf ihrem platz in der küche
zylindrische schwarze eiserne gewichte
als in galizien das währungssystem eingeführt wurde
kam mein großvater des lesens und schreibens unkundig
und verzweifelt (so viele hundert werst entfernt von wien
warfen die zahlen mystische schatten und säten nichts aus)
nach europa trug den honigduftenden samen
für meine mutter meine onkel tanten vorbei an den habsburgen
hierher grub nach schwarzer sächsischer kohle fürs abendland
wie das steppengras zischte und die halme sich rieben so
klangen seine polnischen flüche in seinem lachen
grollten hufe und gewitter seine stirn ein feuer
wetterleuchtete fern die rote kolchis
unwissend und tief im orkus.
meine mutter unter allen umständen wollte
deutsch werden doch war ihr haar von der farbe des honigs
der aus den früchten floß. ich habe von den deutschen
das lesen und schreiben von meinem großvater die art
zu sehen scharf wie den deutschen weibern das rohsa fleisch
durch die haut scheint und die lust
den honig in der stille zu riechen.
großvater kaufte (von seinem kohlegeld)
einen wüsten garten am tagebau und die gewichte sie
werfen ihre schatten im gelben licht
der sonne die durchs fenster bricht der abend tropft
süß und klebrig und er duftet
die gewichte liegen in der küche herum
wer drauf tritt schlägt
lang aufs kreuz fällt tiefer
und tiefer.
Ein Gedicht, in dem eindrucksvoll die Familiengeschichte aufgehoben ist und gezeigt wird, wie sich die Identität des jungen Wolfgang Hilbig bildete: zwischen den Rassen, über den Völkern, auf einer Ebene, auf der die scharfen Instinkte eines mythischen Ostens mit den Traditionen westlicher Kulturlandschaft zusammenfinden, zugleich auch eine Widerlegung jenes Rassenwahns, Reinrassigkeitswahns, dem Wolfgang Hilbigs Vater zum Opfer fiel, als er auf Befehl Hitlers gegen die sogenannten „slawischen Untermenschen“ zu kämpfen hatte und bei Stalingrad blieb. Große Begabungen, so hatte schon Gottfried Benn behauptet, tauchen besonders häufig da auf, wo verschiedene Stämme einander begegnen, wo Gene ganz unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen.
Wolfgang Hilbig wuchs in einem Milieu auf, das unter dem Gesetz des Tages, der täglichen harten Arbeit stand, unter dem Diktat der Notdurft, und doch öffnete er sich Fenster, die den Blick aus seiner sächsischen Wohnküche freigaben auf den griechischen Mythos, auf die „rote kolchis“, in die die Argonauten zogen und aus der Medea kam, auf den Orkus. Wolfgang Hilbig wuchs im Schatten eines Großvaters auf, der nicht lesen und schreiben und rechnen, nur wiegen konnte, und lernte, das immaterielle Gewicht von Worten zu wägen, bis „endlich jede Wendung“, um Goethe zu zitieren, „sich selbst ins Gleiche“ stellte. Er lernte Bohrwerksdreher und Werkzeugmacher und schrieb Verse, deren exaktes Gliederspielman nicht genug bewundern konnte: so leicht und unauffällig bewegten sie sich in ihren dialektischen Gelenken. Man nehme nur Anfang und Ende dieses Gedichts über die Gewichte:
die gewichte zum pflaumenabwiegen
liegen auf ihrem platz in der küche
zylindrische schwarze eiserne gewichte.
So die drei Zeilen des Beginns. Und der Schluß:
die gewichte liegen in der küche herum
wer drauftritt schlägt
lang aufs kreuz fällt tiefer
und tiefer.
Kleine Änderungen und schwerwiegende Folgen: Die Gewichte liegen nicht mehr auf ihrem Platz, sondern wurden, unachtsam oder absichtlich, in der Küche umhergeworfen, und so bringen sie jeden zum Straucheln, der sie mit oder ohne Willen mit Füßen tritt. Eine quasi magische Rache des Großvaters: Die zylindrischen Eisenstücke sind das Äquivalent der Früchte, die er dem wüsten Garten am Tagebau abgewann, und wehe dem, der die Ordnung stört, die er gestiftet hat.
In Wolfgang Hilbigs Gedichten wurde mir ein eigentümlicher Widerspruch offenbar. Einerseits nahm er bestimmte Eigenheiten der Familientradition an, übernimmt er Einstellungen und überkommene Haltungen; andererseits wehrt er sich aufs Heftigste gegen sie und stößt alles ab, was von außen auf ihn zukommt.
ihr habt mir ein haus gebaut
ihr habt mir ein haus gebaut
laßt mich ein andres anfangen.
ihr habt mir sessel aufgestellt
setzt puppen in eure sessel.
ihr habt mir geld aufgespart
lieber stehle ich.
ihr habt mir einen weg gebahnt
ich schlag mich
durchs gestrüpp seitlich des wegs.
sagtet ihr man soll allein gehn
würd ich gehn
mit euch.
Dies ist ein Gedicht, das über das häusliche Milieu in Meuselwitz, im Haus des Großvaters, hinausgeht; es läßt sich auf die ganze Gesellschaft der DDR beziehen, ja, es übersteigt sogar deren Grenzen und formuliert den Generationenkonflikt so, daß er z. B. auch für die Gesellschaft in der Bundesrepublik gilt, und dies ist ja ein Kennzeichen für Poesie, daß sie nicht nur für jene Weltgegend Bedeutung hat, in der sie entsteht. Soziologen, Psychologen, Ethnologen haben sich schon überall die Köpfe zerbrochen über den Krieg, der die Gesellschaften in Ost und West zerreißt: den Krieg der Jungen gegen die Alten, als seien jene, die sie in ein gemachtes Nest setzen wollen, ihre erbitterten Feinde. Dicke Bücher wurden über dieses Problem geschrieben – die plausibelste Formel dafür hat meines Erachtens Wolfgang Hilbig gefunden. Die Starrheit der Welt, gegen die er mit seinesgleichen anrennt, spiegelt er in einer eisernen Anaphorik, in einem stählernen Parallelismus, in einem fünfmaligen „ihr habt“; der Widerstand dagegen läuft zwar immer auf dasselbe hinaus, aber in stets anderen Bahnen. Da wehrt sich ein Ich gegen den aufgezwungenen Kollektivismus, entschieden, aber beweglich, und erst wenn das Einzelgängertum verordnet würde, wäre es bereit, sich einzuordnen.
Wolfgang Hilbig hat es in früheren Stadien seines Lebens nicht unversucht gelassen, Anschluß an das Kollektiv zu finden, an Gruppen, die er für gleichgesinnt hielt. Als Erdbauarbeiter, als Monteur, als Hilfsschlosser und was er jeweils auch gewesen sein mag – er versuchte, in sogenannten „Zirkeln schreibender Arbeiter“ und an Lyrikseminaren für die Arbeiterfestspiele der DDR mitzuwirken. Dieses Vorhaben scheiterte jeweils bald, und nach der letzten Suspendierung gab er derlei endgültig auf. Die Kumpel, die da getreu der alten Formel des Bitterfelder Wegs zur Feder griffen, schrieben offenbar auf, was die Zirkel-Leiter hören wollten, und bei dem, was Hilbig zu bieten hatte, verging denen anscheinend Hören und Sehen. Da gab es nicht den versifizierten Schmus aus dem politischen Katechismus, sondern, wenn überhaupt, Arbeiter-Dichtung, wie sie allein diesen Namen verdient, Dichtung der Arbeit, gearbeitete Dichtung: Arbeit in jenem umfassenden Sinne von menschlicher Aneignung der Welt. Hilbig, der, noch ein wenig naiv, angetreten war, die „Höhen der Kultur zu erstürmen“, merkte schließlich, daß ihm eine Masse aus süß-saurem Konformismus entgegenquoll, durch die er sich nicht hindurchfressen konnte. In einem Moment der Klarheit muß er das folgende Gedicht geschrieben haben – es ist nicht Umsonst das erste seines Gedichtbandes abwesenheit:
,LASST MICH DOCH‘
laßt mich doch
laßt mich in kalte fremden gehn
zu hause
sink ich
in diesen warmen klebrigen brei
der kaum noch durchsichtig ist
der mich festhält der mich so
festhält
laßt mich in die einsame fremde
dort will ich um mich haun
mit meinem schatten fechten daß
hiebe pfeifen in wasserklarer luft
hier würgt mich stille
hier saugt zäher brei an meiner hand
laßt mich
wo die sicht klar ist
oder in steine in hohe steinwände
in mauern für meinen schädel −
Auch bei diesen Versen ließe sich in ausführlichen und der Ausführlichkeit würdigen Untersuchungen demonstrieren, wie kunstvoll hier Ängste und Forderungen artikuliert werden, wie Analogie und Variation das Gedicht durchwalten. Gleich vier Hammerschlägen die Wiederholung des
laßt mich doch
Iaßt mich in kalte fremden gehn
laßt mich in die einsame fremde
Iaßt mich
wo die sicht klar ist…
Freilich, so wie die Dichtung die Wirklichkeit beim Wort nimmt, tut es mitunter die Wirklichkeit mit der Dichtung. Man spricht dann von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Der Bitte
laßt mich
(…)
in steine in hohe steinwände in
mauern für meinen schädel −
dieser Bitte wurde pünktlicher vielleicht, als dem Autor lieb war, von der Gesellschaft entsprochen, die seine Literatur gleichermaßen wörtlich nahm und zu vernichten oder doch wenigstens zu entschärfen und zu steuern suchte. Ich will es bei diesen Andeutungen belassen, und nicht der Polemik geziehen zu werden, aber alle, die Näheres wissen wollen, seien auf die Prosa-Texte Hilbigs Unterm Neomond verwiesen. Zwei Erzählungen nennen die Ereignisse, die sich bei der ersten Lektüre 1976 noch nicht ahnen ließen und die darauf abzielten, Hilbigs Literatur im strengsten Sinne zu sekretieren, hinlänglich beim Namen.
Indes, Hoffnung ist immer. Auch Apparate sind lernfähig; daß Wolfgang Hilbig heute hier sein darf und daß dieser Tage beim Reclam-Verlag in Leipzig eine Auswahl aus seinem frühen Werk erscheinen wird, zum Teil mit ungedruckten Texten, ist ein schlagender Beweis dafür. Als ich vor ein paar Wochen auf der Frankfurter Buchmesse den stellvertretenden Kulturminister der DDR, Klaus Höpcke, fragte, ob Hilbigs Buch noch in diesem Herbst publiziert werde, stand ich seiner Zusage recht skeptisch gegenüber. Ich freue mich in diesem Falle herzlich, daß ich widerlegt wurde, und möchte von dieser Stelle aus eines Mannes gedenken, der seine ganze literarische Autorität geltend machte, um die „Abwesenheit“ Wolfgang Hilbigs in seiner Heimat in Anwesenheit zu verwandeln. Ich spreche von Franz Fühmann, der ursprünglich an meiner Statt die Laudatio halten sollte und der von schwerer Krankheit daran gehindert wurde. Ihm gelten – ich glaube, ich darf für die gesamte Jury und vielleicht auch für Sie, verehrte Gäste, sprechen – Franz Fühmann gelten die besten Genesungswünsche.
Hoffnung ist immer, sagte ich, und: selbst Apparate sind lernfähig. Die DDR hätte sich meines Erachtens selbst das Recht verscherzt, sich Arbeiterstaat zu nennen, falls ein schreibender Arbeiter, wie Wolfgang Hilbig es bis vor einigen Jahren war, ehe er die Existenz eines freien Schriftstellers wählte, auf Dauer in ihr mundtot geblieben wäre. Es gibt noch immer eine Reihe bedeutender Lyriker in den Grenzen der DDR, ich nenne nur Karl Mickel, Rainer Kirsch, Adolf Endler, Heinz Czechowski, Wulf Kirsten; aber Gedichte wie Hilbig schreibt keiner von ihnen, weil keiner von ihnen jahrzehntelang körperlich gearbeitet hat, weil keiner von ihnen einen vergleichbaren Erfahrungshorizont hat. Gedichte wie das folgende kann nur ein Mann verfassen, der Tausende von Stunden Heizer war, bis jener unwahrscheinliche Zufall eintrat, den die Dichter seit Novalis anbeten:
EPISODE
im düstern kesselhaus im licht
rußiger lampen plötzlich auf dem brikettberg
saß ein grüner fasan
aaaaaaaaaaaaaaaaaein prächtiger clown
silbern und grün den leuchtend roten reif am hals mit
unverwandtem aug mit dem großen gelben schnabel aufmerksam
zielte er auf mich
aaaaaaaaaaaaaaaso war er herrlicher und schöner
als ein surrealistischer regenschirm auf einer nähmaschine
wie er dort saß genau und furchtlos verirrt
auf seinem schwarzen gipfel
konversation fand nicht statt
ich bewegte mich und er flog davon durch die offene tür
doch von weit her den geruch der sonne den duft
seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht
und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen
und als das kausale grinsen meines kopfes
von energie und frost gefressen in die nacht verschwand
glaubte ich nicht mehr an den untergang der
wahrnehmungen in der finsternis.
Wolfgang Hilbig hat seinem Fürsprecher Franz Fühmann bei einem Gespräch in Berlin einmal gestanden, daß die Episode auf Wahrheit beruhe, daß er dem geschilderten Zaubervogel tatsächlich auf einem Brikettberg in seiner Heimatstadt Meuselwitz gesehen habe. Und Fühmann meinte in seiner „imaginären Rede“ unter dem Titel Praxis und Dialektik der Abwesenheit, der Fasan sage die Sehnsucht nach dem Traum, wie die Sehnsucht, „der Träume nicht mehr zu bedürfen, da die Wirklichkeit es ihnen gleichtue, phantastischer als jede Kunst und lächelnd über die Mühen der Mythen“; aber, abgeschnitten von entsprechenden Nachschlagewerken in seiner Spreewald-Klause, ließ Fühmann sich zu einer kleinen Schulmeisterei hinreißen. Er behauptete, die Episode sei selbst als Vorkommnis der Wirklichkeit ein Traum, denn Fasane seien nun einmal nicht grün, hätten keine gelben Schnäbel und keinen roten Reif um den silbernen Hals. Vertrauend auf Hilbigs Realismus, auf sein Jägerauge, das auch flüchtigste Wahrnehmungen hindert, in der Finsternis unterzugehen, befragte ich die Farbtafel meines zwölfbändigen großen Brockhaus und fand auf Anhieb einen Vogel, der alle im Gedicht genannten Merkmale aufwies: der Glanzfasan ist grün-silbern und trägt einen roten Halsring.
Ein schlagender Beweis, wie ich meine, daß die Sinnbilder Hilbigs – hier der überwältigende Einbruch des Schönen in den kruden Alltag – den Sinnen entstammen, daß sie sich gerade deshalb als Symbole eignen, weil sie auf der Ebene der Unmittelbarkeit der Überprüfung standhalten. Damit will ich ihm aber keinesfalls einen platten Naturalismus nachsagen. Die Form ist ihm wichtiger als der Stoff; denn schon Karl Kraus sagte, was vom Stoffe lebe, sterbe mit dem Stoff, was aus der Sprache lebe, lebe mit der Sprache. Der Formwille durchwirkt Hilbigs Prosa und Lyrik, und bei thematischer Ähnlichkeit ergeben sich interessante Vergleiche. Hilbig hat auch eine 40 Seiten lange Erzählung unter dem Titel Der Heizer veröffentlicht, der bereits im ersten Satz auf Büchners Lenz anspielt und das gleichnamige Heizer-Fragment Franz Kafkas in manchem übertrifft – in dem zitierten Gedicht freilich ist seine Existenz als Heizer und die aller anderen Heizer auf eine unnachahmliche Weise zusammengefaßt und zur Metapher verdichtet, gültig für die Gesamtheit jener, die „drunten“ ihre Arbeit tun und „drunten“ sterben müssen und denen sich die Schönheit nur zuweilen in Form einer Epiphanie offenbart.
An Hilbigs Dichtung sei so bestechend, nein: überzeugend, sagte ich, wie die unvoreingenommene, unbestochene Wahrnehmung zum Sinnträger werde. Noch viel Rühmendes ließe sich darüber sagen. Aber lassen Sie mich zum Schluß kommen, in dem ich vorführe, daß bei Hilbig noch das Gegenteil, das Nicht-Wahrhaben-Wollen unbestreitbarer Wirklichkeit zum poetischen Ereignis wird. Ich meine sein Gedicht geste, das für mich zu den schönsten Gebilden Hilbigs zählt und zum Hinreißendsten, was die deutsche Lyrik in den letzten 20, 30 Jahren hervorgebracht hat:
GESTE
bevor du einschläfst sprach sie schließ das fenster
in der küche wegen des winds da draußen und ganz
in ihrem duft noch ging ich und dachte nirgendwo
ist eine mütze voll wind
durch den hof fuhr ein geheul und krachend
schlug eine leiter um die gardinen sausten
reißend ins freie und ich dachte nirgends
nur eine nase voll wind
während ich dies dachte rüttelte die nacht
an den bäumen mit schweren tropfen vermischt
alle blätter jagten sich wirbelnd in die luft
und ich sagte mir es ist nichts
nichts nirgendwo ein mund voll wind
ich setzte mich an den tisch wie auf einem boot
das haar stürzte mir in die stirn und ich dachte
ach nirgends nur ein mund voll wind.
Immer wieder im Lauf der vergangenen sechs, sieben Jahre habe ich über diese Verse nachgedacht, ohne ihren Zauber ganz ergründen zu können – das Nicht-Kommensurable, der unauflösbare Rest als entscheidendes Merkmal des Gedichts. Alles Zergliedern dieses ebenso unüberhörbaren, unübersehbaren und ebenso heftig geleugneten Winds, dieser „mütze voll“ „nase voll“, „Mund voll“ Winds, das vom lyrischen lch vermißt wird und doch so sprechend gegenwärtig ist, alles Zergliedern schuf keine endgültige Gewißheit, weswegen die Sensationen des Draußen vor diesem Ketzer keine Gnade finden. Ist es die Liebe, die eine eigene Realität hervorbringt, oder ist es die beginnende Nicht-mehr-Liebe? Kann dieser Mann die kürzeste sinnvolle Trennung von seiner Geliebten nicht ertragen? Ist ihm jede Realität diskreditiert, die diese Frau bezeichnet? Ist er ein Gefangener ihres Dufts, gegen den selbst Orkane nichts vermögen? Ich weiß es nicht und werde es vielleicht nie wissen. Versuchen Sie doch, verehrte Zuhörer, dieses Rätsel zu lösen, und ich verspreche Ihnen, es ist nicht das letzte, auf das Sie bei der Lektüre von Texten Wolfgang Hilbigs lustvoll stoßen werden.
Ich danke Wolfgang Hilbig, daß er sich durch nichts abhalten ließ, seine Verse und Prosasätze zu schreiben, nicht durch Hitze und Kälte, Hunger und Durst, „hohe steinwände“ und den Übermut der Ämter. Wir danken der DDR im Namen der Poesie, daß sie diesen Autor nun ihrem eigenen Publikum zugänglich macht und daß sie ihn hierher reisen ließ. Dies ist ja leider keine Selbstverständlichkeit. Und wir, die Mitglieder der Jury, danken der Stadt Hanau, daß sie uns die Freiheit ließ, im Namen der Brüder Grimm einen Schriftsteller auszuzeichnen, der, obwohl ausgezeichnet, noch jeder Auszeichnung entbehrt.
Karl Corino, 1984, aus: Deutschland Archiv, Heft 3/1984
Die Epiphanie des Schönen in Meuselwitz
– Erinnerung an Wolfgang Hilbig. –
Bei einem Gespräch mit dem Schriftsteller Siegmar Faust, der den Tigerkäfigen der DDR entronnen und in den Westen entlassen worden war, fielen auf die Frage, um welche jungen Literaten in der DDR man sich aus literarischen Gründen besonders kümmern müsse, mir gegenüber zum erstenmal Name und Adresse Wolfgang Hilbigs. Ein paar Zeilen in die Rudolf-Breitscheid-Straße 19 b in Meuselwitz und die Bitte um Manuskriptproben führten etliche Wochen später zu einem braunen DIN-A-5-Couvert mit einer Reihe von Gedichten und kurzen Prosatexten. Es war ein schöner Frühlingstag des Jahres 1977 – vor meinem Fenster in Bad Vilbel bei Frankfurt blühte ein großer Frühkirschenbaum –, als mir binnen Minuten klar war, hier seien die Texte eines neuen großen Autors. Ich redigierte und moderierte seit Mai 1973 im Hessischen Rundfunk das Magazin TRANSIT. Kultur in der DDR und konnte Hilbig so ein Forum bieten. Ich schlug ein Treffen zur nächsten Internationalen Buchkunst-Ausstellung in Leipzig vor. Es kam, um den 6. Mai 1977, – so zeigt es mein alter Pass mit dem Visumsstempel der DDR – zu einem ersten Treffen mit dem Autor bei meinen Freunden Jochen und Usch Stein in der Kurt-Eisner-Str. 5, zu einer ersten Lesung seiner Gedichte und einem Rundfunk-Interview für den hr.
Da Thomas Beckermann damals bei S. Fischer eine neue Reihe für junge Literatur, die Collection S. Fischer, eröffnet hatte, lag es nahe, ihm die Gedichte Hilbig auf den Tisch, nein, ans Herz zu legen und ihm dringend zu empfehlen, sie möglichst bald in seine Serie aufzunehmen. So geschah es. Auch Beckermann las, traf sich mit Hilbig, man wurde sich einig und schloß am 22. Januar 1979 einen Vertrag über den Gedichtband abwesenheit, in dem sich das Lebensgefühl jener Generation, der damals knapp Vierzigjährigen in der DDR, artikulierte.
Hilbig, 1941 im sächsischen Braunkohlengebiet geboren, vaterlos auf- und in die DDR hineingewachsen, war zugehörig zur angeblich herrschenden, in Wirklichkeit machtlosen Klasse, der Arbeiterklasse, ,ehrendienend‘ in der NVA, tätig in vielen Berufen, zuletzt als Heizer, zeitweilig, immer bis zur nächsten Relegation eingebunden in die Zirkel schreibender Arbeiter, aber in der DDR ohne Publikationschancen, weil seine Texte nicht den Gesetzen des sozialistischen Realismus folgten: sie waren einfach zu gut, zu poetisch, zu wenig propagandistisch, und so war das Inserat Hilbigs 1966 in der Neuen Deutschen Literatur, der Zeitschrift des DDR-Schriftstellerverbands, welcher deutsche Verlag Interesse an seinen Arbeiten habe, natürlich ohne jede Resonanz geblieben – bis auf eine Zuschrift seiner ehemaligen Meuselwitzer Lehrerin, die wußte, daß dieser Hilferuf von jemandem kam, der seit frühester Jugend schrieb. Wie sollte es auch möglich sein, im Zeichen des „Bitterfelder Wegs“ ein Titelgedicht, ein Generationsgedicht wie „abwesenheit“ in diesem sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat zu veröffentlichen:
ABWESENHEIT
wie lang noch wird unsere abwesenheit geduldet
keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind
wie wir in uns selbst verkrochen sind
in unsere schwärze
nein wir werden nicht vermißt
wir haben stark zerbrochne hände steife nacken –
das ist der stolz der zerstörten und tote dinge
schaun auf uns zu tod gelangweilte dinge – es ist
eine zerstörung wie sie nie gewesen ist
und wir werden nicht vermißt unsere worte sind
gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee
wo bäume stehn prangend weiß im reif – ja und
reif zum zerbrechen
alles das letzte ist uns zerstört unsere hände
zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch
geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache
einander vermengt und völlig egal in allem
und der wir nachlaufen und unserer abwesenheit
nachlaufen so wie uns am abend
verjagte hunde nachlauftn mit kranken
unbegreiflichen augen.
Diese Verse, 1969, im Jahr nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts in Prag, entstanden, waren ein Aufschrei – und für die Kulturpolitiker der SED wie ihre Hintermänner in den Stasi-Zentralen ein Schlag ins Gesicht. So etwas in den Druckfahnen zu lesen, die natürlich nicht unter Wahrung des Postgeheimnisses nach Meuselwitz kamen, verlangte offenbar sofort drastische Maßnahmen. Und Hilbig selbst schien im ersten Gedicht des bei S. Fischer geplanten Bandes ja den Weg zu weisen:
laßt mich doch
laßt mich in kalte fremden gehn
zu hause
sink ich
in diesen warmen klebrigen brei
der kaum noch durchsichtig ist
der mich festhält der mich so
festhält
laßt mich in die einsame fremde
dort will ich um mich haun
mit meinem schatten fechten daß
hiebe pfeifen in wasserklarer luft
hier würgt mich stille
hier saugt zäher brei an meiner hand
laßt mich
wo die sicht klar ist
oder in steine in hohe steinwände in
mauern für meinen schädel – –
Genau dies, was Hilbig in den letzten beiden Zeilen formulierte, war das Rezept, das der Stasi gefiel: hohe Steinwände und Mauern für Hilbigs Schädel. Am Vorabend des 1. Mai 1979, so erfuhr man später, saß er in einer Meuselwitzer Gaststätte. Da bat ihn ein Bekannter vor die Tür und bot ihm eine Zigarette an, und mit der selben Flamme, mit der er Hilbig Feuer gab, zündete er eine hinter Hilbigs Kopf hängende Fahne der DDR an, die dem Kampftag der Arbeiter entgegenflatterte. Das Tuch brannte sofort lichterloh, vielleicht war es präpariert. Hilbig soll etwas gesagt haben wie „Bist du verrückt“, und er versuchte, dieses symbolisch hoch befrachtete, strafbewehrte Stück Stoff zu löschen, freilich vergeblich. Bald darauf wurde er wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen und in den Leipziger Stasi-Knast überführt. Ein infames Komplott. Bei den Verhören stellte sich rasch heraus, daß es der Stasi nicht um die abgefackelte Meuselwitzer DDR-Fahne ging, sondern daß ihr die Druckfahnen von Hilbigs Gedichtband in der Collection S. Fischer auf den Nägeln brannten. Hilbig wurde ausführlich nach seinen Beziehungen zu Corino und Thomas Beckermann befragt, und man übte auf ihn Druck aus, entweder einzelne Gedichte zurückzuziehen oder am besten das ganze Buch. Man machte alle Anstrengungen, ihn binnen ca. zweier Monate systematisch ,weichzukochen‘. Er lag mit einem angeblichen Boxer auf der Zelle, der den ganzen Tag vor ihm herumsprang und Schattenboxen machte, so daß „Hiebe pfiffen in wasserklarer Luft“, soweit sie nicht getrübt war vom Sperma eines halb Schwachsinnigen, der als dritter im Zellenbunde den ganzen Tag auf der Pritsche lag und onanierte. Man sagte Hilbig nach zahlreichen Verhören, man sei fertig mit ihm, er solle seine paar Sachen packen – und sperrte ihn anschließend in die Nachbarzelle. Ein systematischer Psychoterror, der offenbar nicht ganz ohne Folgen blieb.
Nach etwa acht Wochen schien er wohl zu gewissen Zugeständnissen bereit, auch bereit, die Herren von der Stasi gelegentlich wiederzusehen. Aber wieder auf freiem Fuß – im Westen, in meinem DDR-Kulturmagazin TRANSIT war sofort nach Eintreffen der Nachricht von Hilbigs Haft entsprechender Alarm geschlagen worden, der der Stasi signalisierte, ihre Machenschaften seien nicht unbemerkt geblieben – also: wieder auf freiem Fuß und nach Gesprächen mit alten Freunden wie Gert Neumann besann sich der Autor eines Besseren und schickte zum nächsten vorgesehenen Treff einen Vertrauten als Späher auf jenen Parkplatz, auf dem zwei Herren in einem Auto saßen und vergeblich warteten. Der freundschaftliche Dienst und Hilbigs Weigerung, den Gedichtband beim Verlag zurückzuziehen, blieben nicht ungeahndet. Der Späher Hilbigs wurde überfallen und verprügelt, und Hilbig selbst erging es nicht besser. Als er eines Abends aus seiner Kneipe nach Hause ging, wurde auch er überfallen und in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts geworfen. Zum Glück und wie durch ein Wunder kam er ohne schwerere Verletzungen davon. Bemerkenswert: schon am anderen Morgen war diese große Scheibe wieder ersetzt – so prompt arbeitete nur e i n e Firma in der DDR.
Sinnigerweise wurde Hilbig für die ungenehmigte Veröffentlichung des Bandes abwesenheit bei S. Fischer mit einer – für ihn enorm hohen – Strafe von 2.000 Mark der DDR belegt (der einzige mir bekannte Fall neben dem Stefan Heyms, der allerdings mit 9.000 Mark zur Kasse gebeten wurde), aber auf der anderen Seite bekam er dann, was ungewöhnlich war, eine Haftentschädigung von 2.000 Mark, so daß das Ganze in finanzieller Hinsicht ein Null-Summen-Spiel wurde.
Die Geschichte, so paradox und symptomatisch sie ist, war damit noch nicht zuende. Denn durch meinen Freund Hans-Jürgen Schmitt, der als Lektor bei Piper und S. Fischer gearbeitet hatte und nach einem Zwischenspiel im hr bei Hoffmann und Campe ein Lektorat für deutsche Literatur übernahm, wurde Franz Fühmann auf Hilbig aufmerksam. Fühmann, nach seiner persönlichen Wende von 1968 immer mehr zum Anwalt der jungen Autoren-Generation in der DDR geworden, erkannte die unglaubliche Qualität dieser Verse sofort und beschloß, sich für Hilbig einzusetzen. Zum nächsten runden Geburtstag seines Verlegers Hans Marquardt hielt Fühmann eine – wenn man nach dem für Hilbig so folgenreichen Desaster mit der verbrannten DDR-Fahne so sagen darf – flammende Rede mit der Forderung, diesen wahren Arbeiter-Dichter, diesen auf höchstem literarischem Niveau dichtenden Heizer dem DDR-Publikum nicht länger vorzuenthalten. Und er hatte damit zumindest einen Teilerfolg. Nach heftigem ideologischem Hickhack hinter den Kulissen und lange lastendem Stehsatz erschien im Herbst 1983 bei Reclam-Leipzig der Band Stimme Stimme. Gedichte und Prosa, wenn auch ohne Hinweis darauf, daß ein Großteil dieser Texte zuvor in Frankfurt am Main herausgekommen war. (Es blieb das einzige Buch Hilbigs in der DDR bis zu ihrem Ende.) Freilich, manche Gedichte – wie das Titelgedicht „abwesenheit“ fehlten in der ersten DDR-Ausgabe Hilbigs ganz, andere waren verstümmelt, wie z.B. „das meer in sachsen“, wo der dritte Teil des Zyklus, wenn auch durch die Numerierung sichtbar, völlig weggelassen worden war. Aber alles in allem war es doch ein Sieg der Vernunft – und der literarischen Qualität. Was hätte es auch für eine Logik gehabt, wenn die DDR das größte literarische Talent aus der „herrschenden Klasse“, der Arbeiterschaft, auf Dauer auf dem eigenen Territorium mundtot gemacht hätte. Und es war auch ein Beispiel dafür, wie im deutsch-deutschen Literatur-Verkehr mitunter „über die Bande“ gespielt wurde, daß aus der DDR stammende Texte über die Bundesrepublik in ihr Herkunftsland zurückprallten.
Im Herbst 1983 erhielt Hilbig dann seinen ersten Literaturpreis, den erstmals verliehenen Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau. Er durfte ihn erstaunlicherweise sogar selbst in Empfang nehmen. Von dem teilweise schwarz getauschten, „umgerubelten“ Geld konnte er eine Weile leben, bis ihm im Frühjahr 1985 ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds zuerkannt wurde, das Herbert Heckmann eingefädelt hatte. Am 10. Januar 1986 meldete Hilbig sich in Hanau an. Es klang zunächst alles sehr positiv. Die Stadt Hanau besorgt ihm eine preiswerte kleine Wohnung in der Französischen Allee 21, aus Darmstadt trifft jeden Monat pünktlich und nicht wenig Geld ein, er hat eine Remuneration von 12 mal 2.500 DM, im Herbst 1986 wird das Stipendium in der selben Höhe um ein halbes Jahr verlängert – der S. Fischer-Verlag, sein Verlag, ist in einer guten halben Stunde erreichbar, in die Kommunikation mit seinem Lektor Thomas Beckermann mischt sich keine Post- und Telefonkontrolle mehr ein, – alles paletti, wie es auf neudeutsch heißt. Aber bald drangen die ersten Nachrichten von seinen Schwierigkeiten an unsere Ohren – Probleme mit dem Alkohol und in deren Folge die Verwicklung in Schlägereien. Auch von Selbstmorddrohungen war die Rede – und man weiß, sie sind immer ernst zu nehmen. Wenn man Hilbigs ersten Gedichtband durchblätterte, stieß man immer wieder auf Todesmotive und Todeswünsche. Gleich das dritte Gedicht, bitte aus dem Jahre 1966, gehörte in diese Reihe:
laßt mich ein wenig
noch sterben
laßt mich auf dem stuhl sitzen
senken in den nacken den kopf
den mund die augen steil öffnen
schlaff die arme hängenlassen
in die augen mir fallen
lassen das licht der lampe dann
auslöschen
laßt mich
einen augenblick noch sterben
schnell bevor ihr
ewiges leben endlose helle
auf der welt weckt
einen winzigen augenblick noch
laßt mich sterben ach
gönnt mir daß ich
nicht vergess – –
Wie wörtlich war das zu nehmen, was da 20 Jahre zuvor formuliert worden war, dieser Wunsch nach einem Sekundentod, galt er auch unter anderen gesellschaftlichen Umständen, in den hellen Städten des Westens, in denen es dank der Straßenbeleuchtung, der illuminierten Schaufenster überhaupt nicht mehr dunkel wurde? Offenbar gab es in Hilbigs Leben Zustände, die auch nach dem Wechsel über die deutsch-deutsche Grenze galten. Man denke nur an den „sturz“, das zehnte Gedicht des Bandes abwesenheit.
lenkt das licht ab leute
das letzte dieser nacht mit
dunklen decken oder schwarzem
sand verbergt diesen sturz
das lahme schwanken der straße
der schlüpfrige schlick
zertretnes gras und schleim
haben mich geschluckt
kein komplott
nicht fremde füße nicht frost
kein lumpiger trick keine kugel
haben mich zerstört allein
die torkelnde besoffne straße
und ich
haben mich gefällt
das gebiß durch den schlamm
geschlagen auf kalten stein
gebet und fluch und fußspur
im mund zermalmt zu modder
das weitere die worte die wut
erstickt von kotze so
habt ihr mich den
judas im dreck
rudernd auf allen vieren
die ausgelaufnen augen suchend
im schlammigen grab der straße.
Ob Meuselwitz, ob Hanau – offenbar gab es Konstanten der Selbstzerstörung, die nach dem Umzug für die Außenstehenden nicht sofort sichtbar wurden, aber bald nicht mehr zu leugnen waren. Hilbig lebte nach der Übersiedlung, die zunächst ja als nur provisorisch galt, in einer bis dahin nie gekannten Isolation: getrennt von seiner Herkunftsfamilie, von seiner Mutter, von seiner ersten Lebensgefährtin und Mutter seiner Tochter Constanze in Berlin, von seiner Leipziger Freundin Silvia Morawetz, befreit von den Zwängen der Arbeitswelt, die dem Alltag aber doch Struktur gaben, war er nun ganz auf sich zurückgeworfen und damit jener Camus’sche „solitair“, als den er sich in dem „selbst-portrait von hinten“ apostrophiert.
Ich lud Wolfgang Hilbig, zunächst ohne das Ausmaß seiner Gefährdung zu erkennen, gelegentlich zu mir nach Hause, nach Bad Vilbel ein (einmal zusammen mit Hans-Josef Ortheil) oder besuchte ihn in Hanau, wo wir uns in irgendeiner Kneipe trafen. Vor allem warb ich im Fischer Verlag dafür, die Verbindung der Autoren durch gelegentliche Treffen und gemeinsame Reisen zu fördern, speziell der Autoren Thomas Beckermanns, die in der Collection S. Fischer versammelt waren. Der Vorschlag fand bei Thomas Beckermann und der Verlegerin Monika Schoeller Gehör. Das erste Treffen sollte im Frühjahr 1986, kurz nach Tschernobyl, auf einer österreichischen Burg stattfinden, – wenn ich mich recht erinnere, sollten Judith Kuckart, Katja Lange-Müller, Evelyn Schlag, Lothar Baier, Hermann Burger, Otto Marchi und neben anderen selbstverständlich auch Wolfgang Hilbig teilnehmen. Es war verabredet, daß sich die deutschen Teilnehmer in Frankfurt, im S. Fischer Verlag treffen und daß man danach in mehreren Autos nach Österreich fährt. Es war ein Freitagnachmittag, wenn ich mich recht erinnere. Nach und nach trafen die deutschen Autoren im S. Fischer Verlag ein – die Österreicher und Schweizer fuhren direkt an den Zielort –, und allmählich war man komplett. Es fehlte nur Wolfgang Hilbig. Nach einiger Wartezeit nahm mich Thomas Beckermann beiseite und fragte mich, ob ich bereit sei, schnell nach Hanau zu fahren und nach Hilbig zu sehen und ihn vielleicht mitzubringen. Vielleicht habe er verschlafen, – hatte er schon den verschobenen Rhythmus, tags zu ruhen und nachts zu arbeiten? – vielleicht habe seine Säumigkeit aber auch schlimmere Gründe. Ich zögerte nicht lange, düste über die Autobahn nach Hanau und klingelte an der Wohnung in der Nähe der Niederländisch-Wallonischen Kirche – damals wie heute ein sog. „sozialer Brennpunkt“. Ich klingelte lang und heftig, immer wieder. Keine Reaktion. Ich geriet in Panik. Was, wenn Hilbig bewußtlos, im Koma lag und wenn man ihn mit entsprechenden Maßnahmen retten könne? Man müsste sich, so sagte ich mir, ewig moralische Vorwürfe machen oder sich gar juristisch verantworten wegen unterlassener Hilfeleistung. Kurz entschlossen ging ich zur nächsten Telefonzelle – das Handy-Zeitalter war noch nicht angebrochen – und schilderte der Polizei den Sachverhalt, bat sie, einen Schlosser mitzubringen und die Tür zu öffnen. Es dauerte nicht lange, und zwei Polizisten trafen ein, begleitet von einem Handwerker. Er verstand sein Metier, nach kurzer Zeit war die Tür offen. Beklommen betraten wir die Wohnung, die Türen zu den zwei Zimmern standen offen, auf Rufen keine Antwort. Um die herumliegenden Gegenstände kümmerten wir uns nicht, aber auf dem Wohnzimmertisch lag ein aufgeschlagenes Heft, leer bis auf einen Satz am Kopf der ersten Seite. Er lautete: „Wie soll ich mich töten?“ Das gab mir förmlich einen Stich und verschärfte den Alarm, auch bei den Polizisten. Vorsichtig guckten wir in alle Ecken, lugten ins Badezimmer – nichts. Die Wohnung war leer. Was nun? Die Polizisten fragten, ob es Andeutungen gebe, wie sich Herr Hilbig möglicherweise zu Tode befördern wollte. Ich überlegte kurz und sagte: das Ophelia-Motiv spiele in seinen Texten eine gewisse Rolle. Vielleicht sei es sinnvoll, sich an den Gewässern Hanaus, speziell am Main umzusehen. Die Uniformierten bedankten sich und versprachen, sich nun auf Streife zu begeben. Ich fuhr bedrückt nach Frankfurt zurück, und während der Fahrt gingen mir Teile seines Ophelia-Gedichts durch den Kopf:
doch zeitenlos in allen fluten treibt opheliens licht
und ruht in glatten lachen im entfernten moor
ophelia
aaaaaaader leckgeschlagnen regentraufen trübes speien
der leitungsrohre schlick und schleim verdorbner strände
in hohen forsten bricht im herbstlaub nieder
ihr blut von wurzeln sommers aufgesogen
in tatsperren in riesigen turbinen
und in vergraster tümpel grünen dünsten
die in felder ziehn wo nach dem schweiß von ihrer scham
düfte sind im rübenkraut so fade wie in algen
ihrer verwirrung schnee
düngte mit weißen flügeln eine tote bucht
in diesem wannsinn sterben schwäne ab und
werden schlamm wie sie einst ward
in tranen fusel lilabraunen laugen
verbrennt ihr stoff in chlor benzin in fluten von fäkalien
breitbeinig liegt sie
inmitten grauer menschenasche
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaus krematorien tonnenweis
im fluß versenkt ein weicher wirbel spült sie in sie ein
sie liebt mit allen toten sich und sie
und alle toten essen sich und trinken sich
Besonders diese letzte Strophe hatte sich mir eingeprägt, weil sie Ophelias Schicksal mit der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert verband und vor allem mit den Opfern der Konzentrationslager, mit denen sie sich in schauriger Weise vereinte. Ganz hoffnungslos war ich indes für Hilbig nicht. Es gab nämlich auch eine heftige Ambivalenz, ein Aufbäumen in diesen Ophelia-Motiven wie in dem (Hans Magnus Enzensberger gewidmeten) Gedicht „gegen den strom“, ebenfalls gleich zu Beginn des Debüt-Bandes:
ich sah unsre leiber
mit den flüssen hinabschießen
weißgrüne wirbel ach erfrischend
warfen uns an kalte steinbäuche
willenlos trieben wir
tranken die toten münder uns voll
allein unsre arme wiesen
so oft wir auftauchten störrig
gegen den strom
immer wieder.
An diesen gegen die Fließrichtung weisenden Armen wollte ich mich festhalten, nach der Devise, die mir Zbigniew Herbert, ein anderer begnadeter Trinker, einmal genannt hatte: Gegen den Strom schwimmen ist schwer, aber es stärkt die Muskeln.
So betrat ich wieder den S. Fischer Verlag, informierte Thomas Beckermann, und wir beschlossen, nun ohne Wolfgang Hilbig nach Österreich aufzubrechen. Ich weiß nicht mehr, wann wir dann erfuhren, weshalb er in Hanau nicht zu finden war, vielleicht noch auf unserer ,Burg der fröhlichen Gespenster‘: Hilbig hatte sich, ohne jemandem ein Wort zu sagen, in den Zug gesetzt und war nach Leipzig gefahren. Ein Anfall von Einsamkeit, bürokratische Notwendigkeiten, Panik vor dem Zusammensein mit anderen Autoren und ihrem flinken Mundwerk, alkoholische Amnesie – ich weiß es nicht, jedenfalls war sein Verhalten ein Indiz dafür, daß Hilbig nichts hielt von „Europens übertünchter Höflichkeit“, vom Halten von Zusagen, vom Respekt vor der Konvention, eine Verabredung abzusagen, auch wenn derlei den Umgang mit anderen erleichterte.
Wenn man Hilbigs erstes Buch nach einem Abstand von fast dreißig Jahren durchblättert, stößt der Blick immer wieder auf ein Vokabular, das signalisiert: hier äußert sich ein tragisches Lebensgefühl, das dem Trakls nicht unähnlich war. Gewiß war vieles den Verhältnissen in der DDR geschuldet, aber manches war dort ja nur graduell verschieden von den Verhältnissen im Westen – ich denke an die Braunkohlen-Tagebaue in Sachsen, denen Hilbig in seinen „Erinnerungen an jene Dörfer“ sozusagen ein melancholisches Industrie-Denkmal setzte, und jene in Nordrhein-Westfalen à la Garzweiler. Es ist schwer zu sagen, wie Hilbigs Leben und Werk ausgesehen hätten, wenn er von Anfang an im Westen Deutschlands gelebt hätte – vielleicht wären sie auch dann Teil jener tragischen Literaturgeschichte geworden, von der Walter Muschg einst sprach. Jenseits solcher Spekulation bleibt festzuhalten: Er ist im Grunde aus Meuselwitz nie herausgekommen, er trug diesen kleinen verkommenen Ort mit seinen Industrie-Brachen und Tagebau-Wüsten unverlierbar mit sich herum – insofern ist es ein gewisser Widerspruch, daß er in Berlin begraben ist und nicht an seinem Heimatort. Durch ihn ist dieses Kaff zu einem Ort der Dichtung geworden mit all seinem Schlamm und Schlick und Ruß und Grus, und es ist die Leistung von Hilbigs Lyrik, all die unsauberen Materien, auch die des gesamten menschlichen Stoffwechsels mit der Natur, zu transsubstantiieren. Was die Kulturfunktionäre des Arbeiter- und Bauernstaats vielleicht als Kloakenpoesie und Afterkunst verdammten –
einer sitzt nervös auf dem abtritt rafft
die hose auf den dürren knien quält sich
mit seinem stuhlgang…
rückt durch Hilbigs genaue Verskunst – greifen wir ruhig hoch – auf die Ebene von Horazischen Oden und Epoden. (Vergessen wir dabei nicht, wie drastisch die antike Dichtung oft war!). Mein Lieblingsgedicht ist seine „episode“ aus dem Jahr 1977. Eine Epiphanie des Schönen in der Welt des Heizers, unvorhersehbar und unvergesslich:
EPISODE
im düstern kesselhaus im licht
rußiger lampen plötzlich auf dem brikettberg
saß ein grüner fasan
aaaaaaaaaaaaaaaaaein prächtiger clown
silbern und grün den leuchtend roten reif am hals mit
unverwandtem aug mit dem großen gelben schnabel aufmerksam
zielte er auf mich
aaaaaaaaaaaaaaso war er herrlicher und schöner
als ein surrealistischer regenschirm auf einer nähmaschine
wie er dort saß genau und furchtlos verirrt
auf seinem schwarzen gipfel
konversation fand nicht statt
ich bewegte mich und er flog davon durch die offene tür
doch von weit her den geruch der sonne den duft
seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht
und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen
und als das kausale grinsen meines kopfes
von energie und frost gefressen in die nacht verschwand
glaubte ich nicht mehr an den untergang
der wahrnehmungen in der finsternis.
Karl Corino, aus Michael Buselmeier: Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Verlag Das Wunderhorn, 2008
„1979“
– Frühe Erfahrungen mit Wolfgang Hilbig. –
die ländereien auf dem gemäuer werden verrückt
die meere mißachten die vorsehung stürmen
die ufer
(„die namen“)
In meiner Erinnerung liegt ein merkwürdiges Licht auf den Druckseiten seines ersten Gedichtbands abwesenheit. Ich war verzaubert, noch bevor ich etwas begriff. Die durchgehende Kleinschreibung sämtlicher Wörter schien die magische Ausstrahlung nur zu verstärken. Kleinschreibung in der deutschsprachigen Lyrik hatte damals, obwohl sie nicht ohne Tradition war, durchaus noch den Reiz des Neuen, sie konnte einiges bedeuten: Nötigung zu genauerem Lesen, auch Hinweis der Verbundenheit mit anderen Sprachen…
Das Licht, das meinem Lesen zugute kam, kann auch das einer nachmittäglichen Sonne im Herbst des Jahres 1979 gewesen sein, als ich den schmalen Band zum ersten Mal aufblätterte, vielleicht war es auch schon Abend geworden, und die Gedichte bekamen es mit dem konzentrierten Schein einer Schreibtischlampe zu tun, unter der ich sie las. Aber ich meine natürlich etwas anderes. Sie waren von etwas umgeben, das man mit Walter Benjamin nur noch als Verlust zu begreifen gewohnt war: Aura. Der Begriff der Aura ist schwierig, in der Medizin bedeutet er das Anzeichen eines epileptischen Anfalls, und seine religiöse Bedeutung sei hier ebenso wie seine kunsthistorische ausgeblendet. Die Aura war trotzdem vorhanden, ein aus den Wortfügungen kommendes, auf den Zeilen tanzendes Flackern. Und die durchgehende Kleinschreibung leuchtete mit, weil sie einleuchtete. Sie leuchtete ein, weil sie wegließ, was an der Orthografie am augenfälligsten deutsch war. So wirkte sie unter der Hand wie eine Geste der Vergewisserung über die Richtung der Poesie – die Welt, was sonst, doch das hieß damals, in der Dämmerrepublik, eben auch: der Ort so vieler Länder, die zu sehen einem gesetzlich verboten war. Die Kleinschreibung, das war ihr im Eifer von Für-und-Wider-Diskussionen übersehener Aspekt in der DDR, ließ die Grenzen zu den Ländern offen, in denen sie nicht gegen eine Regel verstieß.
Ich möchte die Beschreibung meiner ersten Eindrücke nicht zu sehr mit heutigem Wissen vermischen und den Hintergrund der realen Lebensumstände im Auge behalten – das Nischendasein, von dem man meinte, daß es keines sei; das graue Milieu, mit dem es einem jedem Tag zu bunt werden konnte; das Bewußtsein von Spaltung und Abgetrenntheit, das so gut für das Lesen war; die an Gefängnisfantasien scheiternde Sehnsucht nach etwas, das man damals ein freies oder zumindest freieres Leben genannt hätte; das ganze gefühlte Gefüge aus Staatswesen und Mangelerscheinung, in dessen Lücken man sich irgendwie zurechtfand, bis man kaum noch wußte, ob man drinnen war oder draußen.
Vor diesem Hintergrund hob sich die Sprache der abwesenheit ganz enorm ab. Prägnant und ausgreifend zugleich, schien die Präsenz ihrer Gedichte des Titels, unter dem sie versammelt waren, zu spotten. Ihre große Ausdruckskraft verwandelte das neugierige Lesen in ein gebannten Sehen. Es war so, als hätte „der farben redezwang“ („langes leben. an chlebnikow“) Gestalt angenommen. Unter dem Horizont meiner damaligen Lesererfahrung las sich manches wie aus einer romanischen Sprache übersetzt, und der förmliche Magnetismus der Metaphern, die meinungslose Wucht der Aussagen unterschieden sich sehr von jeder anderen mir bekannt gewordenen Lyrik, deren Verfasser durch die höheren Schulen des DDR-Bildungswesens gegangen war:
ich gehe mit leergetrunknem gesicht
durch die stadt und sammle die stimmen
derer die meinen tod befürworten
(„weiterreise des dichters“)
Die Bedeutung dieser Zeilen schlug bei mir ein, sie fuhr sozusagen wie eine Axt durch das Eis der längst brüchig gewordenen Überzeugung, daß man mit dem Glauben an das letztlich Gute im Menschen über die Feindseligkeiten und habituellen Heucheleien der Gesellschaft schon irgendwie hinwegkommen könne. Von Entfremdung will ich nicht sprechen, dafür war man aus den Verhältnissen noch viel zu wenig herausgekommen. Mein Problem bestand eher in der Frage, warum das Vertraute das Gefährliche war. Wenn man als Jugendlicher selber wie ein Hippie in den DDR-Regionen jener (späten Ulbricht- / frühen Honecker-)Jahre herumlief, brauchte man keine weitere Interpretation dieser Verse. Man kannte den Haß auswendig, der einem in jeder besiedelten Gegend unvermittelt entgegenschlagen konnte, nur weil man aussah wie eine dahergelaufene Idee von persönlicher Freiheit, die man vielleicht haben, jedoch nicht an sich selber ausstellen durfte, ohne mit den ungeschriebenen Gesetzen der Unauffälligkeit in Konflikt zu geraten.
(Die modischen Signaturen solchen Außenseitertums mögen auch damals schon standardisiert gewesen sein und somit im Widerspruch zu ihrer Bedeutung als Zeichen der Eigensinnigkeit gestanden haben, aber sie trugen, im Unterschied zu heute, nicht die Bedeutung einer Massenware, was damit als bewiesen gelten kann, daß man sie nicht einfach kaufen konnte. Sie mußten individuell aus dem Westen importiert werden, nahmen sich, auch wenn sie dort keine waren, hier wie Raritäten aus und zeugten dann glücklich am eigenen Leibe von einem Willen zur Absonderung von der sozialistischen Realität. Die harmlose Mode wurde mit der Zeit von der autoritär eingestellten Umgebung halbwegs toleriert, nur beim Haarwuchs hörte ab einer bestimmten Länge die Nachsichtigkeit auf. Die offizielle Propaganda deckte sich da mit dem Geschmack der Eltern und ging in ihrer Angst vor dem Fremden innerhalb der eigenen Ordnung so weit, zu behaupten, daß sogar die Haarlängen ein dekadenter Auswuchs des Westen seien. Aus der reinen Geschmacksfrage wurde schnell ein handgreiflicher Machtanspruch, indem die Polizei einen in Gewahrsam nehmen und einem mit der Begründung, daß die Ähnlichkeit mit dem Paßbild im Personalausweis nicht mehr gegeben sei, die Haare einfach abschneiden durfte. Als Heranwachsender träumte ich manchmal, auf der Flucht vor Scheren zu sein, die es auf meinen Kopf abgesehen hatten. Es gelang mir jedesmal, mit knapper Not ungeschoren davonzukommen, und insofern waren diese Angstträume eigentlich Wunschträume. Solcherart „Scherereien“, ob nun in geträumter oder real erfahrener Weise, bedeuteten wenig im Vergleich mit der „Schere im Kopf“, also jenem Spaltungsmechanismus im Bewußtsein, der auf politisch-moralischer Ebene, und es war stets nur diese gemeint, wenn „Schere im Kopf“ gesagt wurde, das Gewissen von seiner Äußerungsfreiheit trennte. Doch dies wäre ein anderes Thema, zu dem dann auch das Problem der literarischen Selbstzensur gehören würde.)
Man war ohnehin auf der Flucht: Als Bürger vor den zweifelhaften Ordnungsautoritäten, die von Mitsprache und richtiger Überzeugung redeten und Bevormundung und Unterdrückung praktizierten, und als geistiges Individuum vor der Gefahr einer Vereinahmung durch die falschen Begriffe. Schon das Wort „Bürger“ hörte sich falsch an, klang lächerlich oder bedrohlich, etwa so wie in den großen satirischen Romanen der Stalin-Ära, die schon verblaßte, noch ehe das Ausmaß ihres Terrors allmählich zur Sprache kam. In einer von Angst geprägten Atmosphäre, in der sich alles als verboten erweisen kann, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, verbietet sich das Leben irgendwann von selbst. Das Dilemma: daß einem der Sozialismus umso herrischer über den Mund fuhr, je genauer man ihn beim Wort nahm, wurde einem beizeiten zu dumm. Besser dran war, so dachte ich zumindest, wer von vornherein nicht aus „sozialistischem“ Elternhaus war. Man brauchte dann den Streit in der Schule zu Hause nicht fortzusetzen. Der Gedanke an ein endgültiges Abhauen, eine Republikflucht, lag mir jedoch fern, weil mir nach dem Abschied von der mit dem System verwachsenen Familie das Abenteuer der Existenz als solcher vollauf genügte und es aufregend genug war, ein Bewohner des Weltalls zu sein. Es ist leicht zu meinen, daß sich so eine Art von Selbsternennung zum Kosmopoliten in der DDR lediglich insofern bewahrheitete, als man gezwungenermaßen hinter dem Mond lebte. Doch sollen hier weder der Spott noch die Nostalgie der DDR-Nachwelt von Interesse sein, sondern allein das gravierende Ereignis der ersten veröffentlichten Gedichtesammlung Wolfgang Hilbigs, dessen Beschreibung nicht ganz ohne Umriß der inneren Situation auskommt, in der ich zuerst dem Buch und kurz darauf dem Mann hinter dem Buch begegnet bin.
Etwas drängte mich damals, in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, mit dem, was man später aus Bequemlichkeit DDR-Erfahrungen nennen sollte, zu irgendeinem Ergebnis zu kommen: Worauf lief das hinaus? Was wollte man wirklich? Wer waren die anderen eigentlich? Sollte man sich am Ende noch selber als den verstehen, der andauernd wie ein Sicherheitsrisiko behandelt wurde, und sei es nur darum, um überhaupt jemand zu sein, der in die Verhältnisse paßt? Oder sollte man zum Misanthropen werden, um so die strukturelle Menschenfeindlichkeit der Systemzwänge komplett zu machen? Und wieviel von der Beantwortung solcher Fragen würde bei einem selber liegen? Schwierigkeiten über Schwierigkeiten, die noch mit der Befürchtung verbunden waren, sie nicht einmal artikulieren zu können. Man mußte den Kampf aufnehmen, aber gegen wen? Es herrschte doch Frieden im Land, dessen Vergleich mit einer Friedhofsruhe als Provokation angehen mochte, aber in seinem Anspruch auf Lebende als folglich Tote nicht überzeugend war. Wir waren nicht im Jenseits, allenfalls stellten wir uns jenseits von Politik oder wenigstens taub gegenüber ihrem ideologischen Getön, das wir, wie noch während der Schulzeit, nicht einmal mehr parodieren mochten. Was also tun? Bis auf weiteres möglichst nichts. Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber, je länger einer auf sie hört, desto mehr wird er kaum zu etwas anderem als einem Teil des Systems, das auf sie gegründet ist. Und stellt man sich außerhalb der Gesetze, kommt man umso zwangsläufiger mit ihnen in Berührung. Ich fühlte mich damals von einem diffusen Gefühl der Falschheit aller mir möglichen Entscheidungen umgetrieben und war unbewußt gespannt wie nie zuvor auf irgendetwas anderes, auf eine dritte Perspektive, die weder Verzweiflung bedeuten noch auf Religion hinauslaufen müßte (eigene Schreibversuche empfand ich als peinlich, und Politik schied von vornherein aus).
In dieser abwartenden Verfassung erreichten mich die Gedichte der abwesenheit. Dem augenblicklichen Eindruck, mit etwas Außergewöhnlichem in Berührung zu kommen, gesellte sich die Information hinzu, daß der Verfasser dieser sanft-schroffen Wortwunderwerke auch in der DDR lebte, und dies erfüllte das Lesen mit einer Gegenwärtigkeit, die ich in dieser Intensität bis dahin bei der Lektüre zeitgenössischer Lyrik nicht erlebt hatte. Lyrik im allgemeinen – dem von gehobenen Erwartungen belagerten, geschriebenem und vor allem gedrucktem Wort sei es geschuldet – war damals mehr als Lyrik, man traute ihr, gerade weil sie als die intimste der literarischen Gattungen galt, auch das äußerste zu: Erweckung, Entrückung, Schärfung der Sinne für das real Absurde, Trost, Aufruhr, Prozedur des Erkennens, was auch immer, jedenfalls erhebliche mentale und geistige Wandlungskräfte. Und wie kritisch eingestellt war man doch gewesen, wie gefaßt darauf, daß das meiste dann den Anspruch nicht erfüllen konnte, Abfindung mit Geringerem war, Dekoration statt Deklaration, Blendwerk statt Ausstrahlung, faule Witze statt Wortarbeit, von den Frömmeleien weltanschaulicher Bekenntnisse gar nicht zu reden. Aber jetzt, mit der Ankunft der abwesenheit, trat etwas ein, dem ich auf der Stelle Glauben schenkte: rätselschöne, schmerzlich wahre Poesie, Sätze wie aus einem Zustand eines vor Schreck über sich selber erstarrenden Verfalls herausgebrochen, gewaltige Gesten der Verwerfung, von deren Dynamik man sich mitreißen ließ wie von einem gezielten Umsichschlagen des Bewußtseins gegen einen bösen Traum:
längst zerren an mir die schmutzigen stricke
der niedertracht längst gehe ich schwanger mit
einem mörder das verbrechen ach unbefleckte
empfängnis ist die wurzel meines bewußtseins schon lange –
schon lange hasse ich mich und meinen hass und
meines hasses schwäche und kaum noch kann ich ihn tragen
den heulenden buckel der angst
(„flaschenpost“).
Oder:
und meine stimme verwandelt sich in die kränkeste
aller verachteten krähen und schüttelt
ihr schwarzes gefieder
(„vorfrühling. mundtot“).
Vor dem „ich“, das sich so bekannte, hätte man auch instinktiv zurückweichen können, aber der beherrschte Tonfall machte das Unerhörte daran zu einer verführerischen Musik.
was sag ich nun noch da das lied
mich so zerriß daß ichs
nicht mehr vermiß
(„anbeginn“).
Andererseits:
im namen welcher unerlaubten
schmerzen
die verwirrung
in worte zu kleiden
hab ich
das schreiende amt
übernommen
(„bewußtsein“).
Immer wieder tauchten Formulierungen auf, die den Schmerz, die Entschlossenheit und die Grenzen der Möglichkeit betrafen, etwas Unerträgliches in Worte zu fassen, manchmal zeigte sich das „ich“ als nachträgliches Opfer des Krieges, manifestiert in gegenseitigen Potenzierungen der Trauer und des Zorns über das unwiderruflich Geschehene – es beschäftigt mich nachträglich, wie wenig mir damals klar wurde, daß die Sprache dieser Gedichte auch einen Kampf gegen den Wunsch und die Unmöglichkeit führte, in Zeiten vor dem Ausbruch des Unheils zurückkehren zu können. Die Sprache wich nicht zurück, sie bildete vorandrängende Bergungen von Entsetzlichkeiten heraus und gab dabei dem Schauerlichen etwas Reliefartiges und insofern zwiespältig Erhabenes:
breitbeinig liegt sie
inmitten grauer menschenasche
aus krematorien tonnenweis
im fluß versenkt ein weicher wirbel spült sie in sie ein
sie liebt mit allen toten sich und sie
und alle toten essen sich und trinken sich
(„ophelia“).
Gerade bei „ophelia“ ist es fragwürdig, hier nur ein paar Zeilen aus dem Textfluß des über vier Seiten gehenden Gedichts zu reißen, Wolfgang Hilbigs „ophelia“ drehte sich wie ein Strudel um die Verwüstungen ganzer Epochen, war Gesang und zugleich Abgesang der Moderne, Nekrolog und Wiederbelebung in einem. An die Ophelia-Gedichte Artur Rimbauds, Georg Heyms und Bertolt Brechts anknüpfend, inszenierte es das nekrophil-romantische Motiv, das Bild der ertrunkenen Geliebten Hamlets, noch einmal neu und wie zum allerletzten Mal: Ophelia gibt es nicht mehr, sie hat sich aufgelöst in allen Wassern dieser Erde und ist zur unerschöpflichen Klage über eine sich selbst zugrunde richtenden Welt geworden. „ophelia“ wurde 1976/77 geschrieben.
Man hat Wolfgang Hilbig schon bald nach seinen ersten Veröffentlichungen als ein bzw. „das“ Schreibwunder bezeichnet, also als ein literarisches Phänomen, das sich aus den Bedingungen seiner Zeit nicht so ganz erklären läßt. Ich selber konnte ihm in den Jahren unserer persönlichen Freundschaft das Ausmaß meiner Bewunderung nicht zeigen, es wäre sofort eine Zumutung geworden, nicht nur darum, weil wir mit zeremoniellen Gesten nichts anfangen konnten, sondern auch deshalb, weil ich davon ausging, daß er zuverlässigere Drogen kannte, als jene der Lobhudelei. Als er mir 1982 eines seiner wenigen Belegexemplare des eben gerade im Westen herausgekommenen zweiten Buchs, der Prosasammlung Unterm Neonmond schenkte, las ich mich auf der Heimfahrt in der S-Bahn so sehr darin fest, daß ich den rechtzeitigen Ausstieg um mehrere Stationen verpaßte. Beim Einstieg ahnte ich noch nichts davon, daß die Art dieses Buches mit einem pünktlichen Zuhausesein schlecht vereinbar war. Bücher, die solches vermochten, Bücher, die wie eine Ohrfeige waren oder wie ein Traum mit weit aufgerissenen Augen, stammten normalerweise nicht von deutschen Gegenwartsautoren. Nach der Lektüre von Unterm Neonmond stand ich zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren vor der Frage, wie ich Wolfgang Hilbig überhaupt noch einmal begegnen sollte, ohne vor Ehrfurcht nur dummes Zeug zu reden. Die abwesenheit hatte bereits wie ein delphischer Meteor in mein Lesergemüt eingeschlagen, und jetzt folgte auch noch Prosa von solcher Erschütterungskraft, hypnotische Texte, die sich von der Realität nicht zum Realismus erpressen ließen und trotzdem mit der statischen Alltagswirklichkeit, die man selber kannte, auf das anschaulichste aufgeladen waren: vor Dreck starrende Straßen, brütende Häuser, lärmende Fabriken, alptraumartige Industriegebiete: Kulissen für naturromantische Scheinfluchten, durchkreuzt von Erhebungen der Wut und Verzweiflung über lähmende Verhältnisse bis hin zum phantasmagorischen Exzeß, und dennoch: bei allem Fieber zogen sich Spuren hochgradiger Analytik durch das Ganze, die den Eindruck vermittelten, daß hier einer geht und vorgeht, der nichts Unwahrscheinlicheres zu unternehmen scheint, als die Urbarmachung einer verödenden Gesamtsituation. Als ich ihn einmal aufsuchte, öffnete er die Tür und sagte:
Ach du bist’s, komm rein. In zwei Stunden fängt meine Schicht an… Ich koch uns erst mal n Tee.
Und, etwas später:
In einer Rezension hat man mich mit Kafka verglichen.
Ich antwortete darauf so etwas ähnliches wie: Wenn du eine Erzählung mit dem Titel „Der Heizer“ schreibst, mußt du wohl damit rechnen. Und er darauf:
Soll ich mir deswegen eine andere Arbeit suchen? Ich bin nun mal Heizer.
Den Wortlaut der Rezension konnte er mir nicht zeigen, ein Exemplar der Zeitung, irgendeine überregionale aus dem damaligen Westdeutschland, besaß er nicht. Vielleicht muß man erwähnen, daß westdeutsche Tageszeitungen sehr viel seltener noch als Bücher aus der anderen Hälfte des Landes einen Weg in ostdeutsche Wohnungen fanden, weshalb sich auch unser Begriff von Feuilleton, falls wir überhaupt einen haben konnten, aus verschiedenen älteren Quellen wie z.B. dem ein feuilletonistischen Zeitalter voraussagenden Einführungstext zum Glasperlenspiel Hermann Hesses einerseits sowie andererseits der Fackel von Karl Kraus und den Textsammlungen diverser anderer Kritikergrößen aus dem ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts gebildet haben dürfte. Das Gespenst eines Vergleichs mit Kafka kam sicher nicht von ungefähr, sondern aus der Schublade eines reflexhaften Einordnungswesens, das man vielleicht auch vernachlässigen konnte. Denkbar, daß es Wolfgang für Momente erschreckte, da er bestimmt nicht geschrieben haben wollte, um am Ende ein ganzes unterirdisches System von literarischen Einflüssen auf einen einzigen reduziert zu sehen. Auch ein gewisser Bezug auf Baudelaire war seiner Lyrik in einer westdeutschen Rezensionsarbeit nachgewiesen worden, wie er mir bei einem anderen Mal in einem verhalten beipflichtenden Tonfall mitteilte – im Unterschied zu seiner Reaktion auf den Kafkavergleich, der ihn unbehaglich stimmen mußte, zumal der Name Kafkas damals nahezu unvermeidlich zur Bewertung wie Abstempelung eines jeden literarischen Versuchs, die absurden Zustände bürokratisch geregelter Gesellschaftsverhältnisse zu beschreiben, herhalten mußte. Was gehobener Anspruch im Westen des geteilten Landes an Gegenwartsliteratur für lesenswert erachtete, wußten wir nur in Ausnahmefällen, wir lebten ja doch relativ isoliert in einer historischen Sonderzeitzone, und so wäre ich damals beispielsweise nicht auf den Gedanken gekommen, daß die Westveröffentlichung eines in der DDR nicht gedruckten Schriftstellers mitunter etwas anderes als literarische Wertschätzung bedeuten konnte. Zu dieser Naivität paßte auch unser altmodischer Gebrauch der Begriffe des Originellen und des Epigonalen. „Lieber agonal als epigonal“ – nein, so ein vorwitziges Motto entsprang wohl erst dem (von Wolfgang nicht geschätzten) Neo-Sponti-Geist der achtziger Jahre, aber das stilistische Nachahmungstabu nicht zu verletzen, verstand sich mehr oder weniger von selbst.
„Bobrowski“, sagte er einmal in einem Gespräch über Stationen seiner Entwicklung zum Dichter, „war für mich eine große Versuchung“. Ich vernahm es staunend, wie die überraschende Anspielung auf ein großes Licht, dessen Schatten er lieber nicht sein wollte, und dachte mir seine Auseinandersetzung mit Bobrowskis Poesie in einer Zeit, in der ich selber wahrscheinlich noch nicht einmal lesen gelernt hatte. Zwischen uns bestand ein Altersunterschied von sechzehn Jahren. Das ganze Gebiet der Gegenwartslyrik erschien mir damals als ein labyrinthisches Asyl, in dem es vielleicht geheime Könige gab, und solche für sich zu entdecken versprach einen lohnenden Zeitvertreib, doch mehr noch wimmelte es darin von Prätendenten, deren Anspruchsechtheit von vielen Seiten gewissenhaft geprüft und größtenteils bezweifelt wurde. Wer aber sich sträubte, in dem Urheber der wie aus dem Nichts aufgetauchten abwesenheit einen seit Johannes Bobrowski und Uwe Greßmann in der DDR nicht mehr dagewesenen Dichter von besonderer Leuchtkraft zu erkennen, der mußte bestochen oder blind sein oder ein Problem mit künstlerischer Rangordnung schlechthin haben. Mit Schulweisheiten war diesem dunkelschönen Solitär nicht beizukommen. Durch Zufall geriet mir einmal um die Zeit, in der seine Glut noch frisch war, während des Besuchs bei einem anderen Autor ein diesem gehörendes Exemplar in die Hände. Darin fanden sich die zu dem Titelgedicht gehörende Worte „wir haben stark zerbrochne hände“ unterstrichen und daneben die metaphernkritische Randbemerkung, daß Hände lediglich insofern gebrochen seien, als sie Finger hätten. Dies machte mich nachdenklich bis zu dem Schluß, einen kurzen Einblick in die Grundlagen einer Dichterschule genommen zu haben, die Wolfgang offenbar nicht besucht hatte. Vielleicht war er ihr einfach ferngeblieben, so dachte ich, weil ihm Begriffshubereien fremd waren. Er war sich der Geschichte wie der Gegenwart der Anpassungszwänge des sozialistisch genannten Systems viel zu bewußt, um nicht zu wissen, daß Hände zerbrochen worden waren. Zahllose Male mußte dies geschehen sein, man kannte es nicht nur aus den Berichten über die Foltermethoden der Nazizeit, sondern auch aus den verbotenen Büchern über die Stalinära, die offiziell als überwunden galt. „wir haben stark zerbrochne hände“ – das bedeutete doch auch ein Bekenntnis zu all jenen, denen als Überlebende und selbst noch als Nachgeborene „das Jahrhundert der Erschießungskommandos“ (Imre Kertész) für immer in den Knochen stecken würde. Nein, die als verfehlte Metapher bekrittelten Worte waren keine Metapher, sondern realistische Bezeichnung eines noch lange nicht in Behandlung genommenen Traumas. Das ganze Gedicht, 1969 entstanden, wirkte wie ein Aufschrei aus einem Alptraum, als bitteres Bekenntnis eines von den herrschenden Zuständen um das Leben Betrogenen, der endlich eine Form gefundene hatte, seinen Schmerz so zur Sprache zu bringen, daß er nicht mehr ignoriert werden konnte. Vielleicht irrte darin auch ein Echo auf den von sowjetischen Panzern niedergewalzten Prager Frühling umher, doch hätte dies wohl nicht viel zu einer Erklärung seiner ausdrucksstolzen Desolation beigetragen. Hier hatte ein Gefühl von Entrechtung das Wort ergriffen, für das es keine politische Lösung geben würde. Diese Abwesenheit strebte kein Erscheinen in der Geschichte an. Sie bewegte sich in einem unruhigen Aufschein von finsterer Endgültigkeit eingehüllt. Ihre Sprache war die eines Verzweifelten, der mit einem endlosen Ende beginnt. Die Zeit war „reif zum zerbrechen“ – man war versucht, dabei eher an die sprengkräftige Wirkung von Eis zu glauben und weniger an ein Tauwetter.
Die mit desperadohafter Wucht die Wände des Ungesagten wegreißenden Bilder in vielen Gedichten des Bandes waren, was Gedichte ansonsten meist nicht mehr sein konnten und vielleicht auch gar nicht sollten: überwältigend. Und in der anschaulichen Weise, in der sie außerdem auch noch von Überwältigungen redeten, zeugten sie entweder von ungeheuren Verbrechen oder von einer gigantischen Tautologie. Sie verliefen wie unterschiedlich angelegte Fluchten, die es auf schwerwiegende Folgen abgesehen hatten, sie kämpften mit Ursachen und verwandelten sich dabei selber in so etwas wie: Ursachen. Das Ich – er sollte es viel später in seinem Stasiroman Ich zu einem spaltungsirren Antihelden werden lassen – schlug sich mit dem Elend seiner eigenen Degeneration herum, und alles, was von ihm noch übrig war, erhob sich wie ein zum äußersten entschlossener Gegner, der mit nichts als dem Trotz des Traums seine Kräfte mit den Gewalten der Vernichtung zu messen gedachte. In dem Gedicht „das fenster“, dem letzten in abwesenheit, kristallisiert sich aus dem Ich am Ende die Figur einer mythologischen Majestät heraus – es erscheint plötzlich als ein gestürzter König, der zu seinem Ursprung zurückkehren will, zurück in das nun lang genug von ihm getrennt gewesene „meer das greulich / kocht von gewürm und schaum…“, und es bezeichnet diesen letzten Sprung in die totale Selbstauflösung als Sünde, die jede Rechtfertigung überflüssig macht. Ich sprach ihn damals einmal speziell auf dieses Gedicht an, und er reagierte irgendwie dankbar, in dem er sagte:
Du bist der einzige, der mich danach fragt, bisher (der Band hatte bereits kein geringes Echo erfahren) wollte sich noch niemand darauf einlassen…
Wir blätterten manchmal gemeinsam in dem einen oder anderen Buch, das entweder ihm oder mir gerade von Interesse war, und ich erinnere mich an einen Moment, da wir die Anthologie Gedichte aus Belgien und den Niederlanden bei ihm zu Hause auf dem Küchentisch flüchtig durchgingen, wobei es kürzere Gedichte natürlich leichter damit hatten, beim Erleiden solcher Prima-vista-Torturen ihre Wahrheit unverzerrt preiszugeben, und er nach unserem synchronen Ablesen eines Vierzeilers von Gerrit Achterberg ein Wort uneingeschränkter Zustimmung fand: „Grandios.“ „Grandios“ war übrigens ein Urteil, mit dem er damals nicht gerade sparsam umging, aber es kamen oft genug auch die Worte „schrecklich“ und „scheußlich“ aus seinem Mund, so daß anzunehmen war, daß jener Vierzeiler etwas von seinem Innersten anrührte:
Du kannst meinen Namen streichen aus dem bürgerlichen Bestand.
Was je an mich erinnert sei vergessen und verbrannt.
Wenn dieses Lied dich noch erreicht, vernimm es einzig
als Wind und Ewigkeit – Blume in deiner Hand.
(„Code civil“, übertr. von Johannes Piron)
„Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin ein Rolling Stone!“ hat Wolfgang Hilbig noch ganz zuletzt geäußert, als es nur noch um die testamentarische Frage ging, an welcher Stelle des Dorotheenstädtischen Friedhofs in Berlin sein Grabstein aufgestellt werden sollte.
Eines Abends im Spätwinter des Jahres 81 gab er mir Durchschlagskopien einiger eng mit noch unveröffentlichten Gedichten beschriebener Manuskriptblätter zur Aufbewahrung – sicherheitshalber, weil er mit allem rechnete, was sein Werk in Gefahr bringen könnte, hauptsächlich mit erneuter Verhaftung und der Beschlagnahmung seiner Manuskripte. Unter den Gedichten befand sich auch das dann 1986 in seinen zweiten Lyrikband die versprengung eingegangene „war das gedicht der rabe von e. a. poe not / wendig…“, in dem es heißt:
warn all diese räder ketten transmissionen
trans
subskriptionen notwendig – und alle schande
die den zenit unterbaut tunnel schluchten röhrensysteme
…
Diese Zeilen haderten mit Edgar Allen Poes Essay „Die Philosophie (bzw. Theorie) der Komposition“, jenen berühmten Text, in dem der Glaube ans Dichten als einem Akt ekstatischer Intuition systematisch enttäuscht wird. Poe rekonstruiert darin die Stufen und Schritte, die ihn zu seinem „Der Rabe“ geführt hatten, und er vergleicht den Hintergrund der Entstehung eines Gedichts mit den technischen und requisitären Ausrüstungen eines Theaters. Nichts ist mysteriös, sagt der Essay, man muß nur wissen, welchen Effekt man erzielen will und nach welchen Mechanismen man dafür zu greifen hat, es ist alles eine Frage der klugen Inszenierung. Diese Art der Entschleierung muß in ihrer scheinbaren Rückhaltlosigkeit so zwiespältig auf Wolfgang Hilbig gewirkt haben, daß er in seiner Reaktion darauf die Notwendigkeit der Preisgabe von dichterischen Betriebsgeheimnissen in Frage stellte. Seinem Einwendungsgedicht ist nicht zu entnehmen, ob er den Enthüllungsgedanken grundsätzlich von sich wies. Es verharrt in assoziativen Abstufungen einer abgrundtief gehenden Skepsis gegenüber… was? Dem kühlen Sinn der Dekonstruktion? Dem menschlich Schöpferischen als solchem? Dem Zustand der Zivilisation? Sich selbst? Wohl von allem etwas, und alles in der unausgesprochenen Klammer seiner Idiosynkrasie gegen Entmythologisierung und Entzauberung. Die gebrochene Schreibweise des Worts „not/wendig“ zielte dabei einerseits auf eine Reinigung seines geläufigen Gebrauchs und verstand sich andererseits mit einem Satz von Günter Eich:
Notwendig ist mir allein das Gedicht.
(„Der Schriftsteller vor der Realität“)
Ich fragte ihn nie nach seiner Vorarbeit. Ich stellte mir seinen Schaffensprozeß als eine Art von vulkanischer Tätigkeit vor, die mit glaubwürdiger Notwendigkeit unter hermetischen Bedingungen stattfinden oder ansonsten überhaupt nicht stattfinden würde. Nebenbei bemerkt bewegte man sich damals in Ostberlin in den unterschiedlichsten Begegnungskreisen unter einer großen paranoiden Dunstglocke, einer von Verdachtsmomenten verkrümmten Atmosphäre, in der die Fähigkeit des Vertrauens in den anderen zu merkwürdigen Schleichwegen und Übersprungshandlungen verurteilt war. Und nicht nur die Anwesenheit diverser Stasiverdachtsgespenster, die jedem unglücklich bewußt gewesen sein dürfte (Devise: unter Zehnen muß mindestens Einer bei der „Firma“ sein), belastete das Klima der Zusammenkünfte in Wohnungen, Kneipen und kirchlichen Einrichtungen, sondern auch anderweitig verursachte zwischenmenschliche Überspanntheiten, ein kollektives Taumeln zwischen Euphorien und Depressionen, das der systemkomatösen Gesamtsituation geschuldet war, drückten jede Unbefangenheit über kurz oder lang an die Wand. Man gelangte als lernfähiger Neuling bald zu der Einsicht, daß es so etwas wie unschuldige Neugier gar nicht geben konnte.
Die Frage nach der Machart des evokativen Zaubers, der expressiven Anschaulichkeit und surrealen Exotik von Wolfgang Hilbigs Gedichten beantwortete sich wie von selbst, wenn man, wie ich damals, der glückliche Besitzer eines Exemplars von H. M. Enzensbergers museum der modernen poesie war, jener längst legendären Zusammenschau einer Weltpoesie der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, die von mir gelesen wurde wie Nachrichten von einem Stern, dem selber zu folgen ich mich zu unberufen oder viel zu spät dran fühlte, was nichts an der Begeisterung änderte, mit der ich die Beiträge von Ungaretti, Kavafis, Pessoa, Majakowski, Pasternak, Ekelöf, Stevens, Senghor und allen anderen der annähernd hundert dort vertretenen Dichter in mich aufnahm. Wolfgang Hilbigs Gedichte wirkten auf mich wie versprengte Exponate eben dieses „museums“. Manchmal sprangen mir Verse aus dem „museum“ und auch anderen Textquellen ins Auge, beispielsweise von Oskar Davico: „Frischer Schnee berührt mein rauhes Verschmachten / … Ich fliehe über Reihen entzündeter Lider“ (Anatomie/Traum mein Mörder), die eine gewisse/ungewisse Nähe zu Wolfgangs Metaphorik aufwiesen, wie es überhaupt der Duktus so mancher seiner Gedichte war, der mit dem gebrochenen und dadurch überzeugenden Pathos der poetischen Avantgarden der Vorkriegsjahrzehnte auf einer ähnlichen Frequenz zu schwingen schien. Die künstlerische Avantgarde – keineswegs einst aufgekommen, um dem Fortschritt der Moderne vorauszueilen (wie es ein hartnäckiges Mißverständnis sehen wollte), sondern im Gegenteil: um dem modernen Fortschritt etwas Bewahrenswertes, das unter die schneller und tödlicher werdenden Räder geraten war, in deformiertem Zustand hinterherzutragen – diese internationale Avantgarde schien in Wolfgang Hilbig den einzigen nachgeborenen Dichter in der DDR zu haben, der sich das Erbe nicht hatte stehlen lassen, und es blieb sein Geheimnis, wie ihm das möglich wurde. Die Schwierigkeiten und Gefahren bei der Beschaffung von verboten oder unerwünscht gewesenen Lesestoffen bildeten ein mittlerweile bekanntes schwarzes Kapitel für sich. Der Charakter des Verbotenen oder Unerwünschten oder einfach nur nicht Zugänglichen erhöhte die Lust an der Aneignung; man war auf die Gnade seltener Zufälle angewiesen, die einem die richtigen Texte zum richtigen Zeitpunkt in die Hände spielten, in Form von oft nicht durchkommenden Buchsendungen aus Westdeutschland, in Form von Giftschrankaffären mit befreundeten und risikobereiten Bibliothekaren, oder als private Leihgaben, die, je nach dem Inhalt des Buchs, einen entweder politischen oder ästhetischen, in erster Linie jedoch rein menschlichen Vertrauensbeweis darstellten. Bevor „rimbauds stimme“ aus Wolfgang Hilbigs Stimme weichen konnte, mußte sie ja zuerst einmal in sie eingedrungen sein, durch die Staatsgrenzen der antagonistischen Blocksysteme, an alles fleddernden Zollbehörden vorbei; Rimbauds „Une saison en enfer“ sowie die „Illuminations“ konnte man vor 1976 auf legale Weise nicht für sich entdecken, während das Gedicht „stimme stimme“ („(rimbaud du toter mann / in meinem kopf)“) bereits 1969 den mühsamen Abschied von einer jugendlichen Illusion verkörperte, wie ein poète maudit, ein Verfemter Dichter des neunzehnten Jahrhunderts sprechen zu können. Mit der Hinterlassenschaft Lautréamonts, Rimbauds und Baudelaires, der Surrealisten, die jene zu ihren Propheten ernannten, sowie all der Schätze aus dem „museum“, das kein Museum war, ergab sich ein Vermächtnis, das sich gegen die Unterwerfung unter das Diktat von Industrialisierung und Entfremdung ebenso aufrichtete, wie es gleichzeitig jeden Traditionalismus ablehnte, der nur die kitschige Kehrseite einer unmündigen Ergebenheit in den Fortschritt bezeichnete. Der hellhörige, sehnsüchtige junge Mann zwischen den Mauern des ostdeutschen Nachkriegsdaseins hatte die Klopfzeichen der vom Wiederaufbau verdrängten Avantgarde vernommen, ihre Zukunftsansprüche mit dem Zustand des zum „Sieger der Geschichte“ erklärten Menschen in der DDR verglichen und die Verbundenheit mit den Opfern aller Verwüstungen zur Sache seines Gedichts gemacht. Die Realitäten der sozialistischen Variante des Fortschritts hatte er als einen Zynismus der Geschichte erfahren, als kryptische Weiterführung der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten unter nur scheinbar alternativem Vorzeichen. Das wortkarge, fatalistische Arbeitermilieu, in dem er aufwuchs, die von Kohle- und Chemie-Industrie ausgeplünderten und in Alptraumgebilde verwandelten Landschaften, die seine „Heimat“ ausmachten, müssen ihm als Erfüllung einer unbegreiflichen Unheilsgeschichte erschienen sein, auf die er antworten würde, und zwar „im namen meiner haut / im namen meiner machart / im namen dieses lands“ (bewußtsein). Das „schreiende amt“ – er hatte es „übernommen“, und es würde sich allmählich herumsprechen müssen, daß die Kraft der Verzweiflung zu Äußerungen fähig war, die man, im Unterschied zu ihrem Urheber, nicht mehr einsperren konnte, weder in die oberfaule Identität eines von der Diktatur des Proletariats unterdrückten Proletariers, noch in eine tatsächliche Gefängniszelle.
1979 erschien neben abwesenheit noch ein anderes Buch eines in der DDR lebenden und dort nicht veröffentlichten Schriftstellers, Gert Neumanns Die Schuld der Worte, dessen Lektüre einen in einen ähnlichen Taumel versetzte, in eine Art geläuterter Abkehr von einem allgemeinen Schwindel, der in der Überzeugung besteht, das Wirkliche mit den Mitteln von sprachlichen Geläufigkeiten in den Griff zu bekommen. Anders als in Wolfgang Hilbigs Gedichten, in denen es häufig ein „ich“ war, das sich wie ein vermißt Geglaubter immer wieder, mal drohend, mal verzweifelt, mal gefaßt in Begriffen absurder Wirklichkeitserfahrung zu erkennen suchte, umkreisten Gert Neumanns Sätze etwas wahr(bis wahn)haft Unaussprechliches, etwas, das zu bevormunden oder nicht erfassen zu können die „Schuld der Worte“ bedeuten mochte. Man hat sehr viel später diese außergewöhnliche Literatur einer grundsätzlichen Vermeidung und Blamierung sprachlicher Herrschaftsansprüche die „Arbeit an einer Poetologie des Schweigens“ genannt, aber das könnte ein Mißverständnis sein: eher handelt es sich um einen kaum auf einen Nenner zu bringenden Versuch, das Verschwiegene solange vor den falschen Geständnissen zu schützen, wie es nicht Freiheit genug gibt, es von sich aus sprechen zu lassen. Die Geschichte des modernen Fortschritts ist (bekanntlich?) auch die Geschichte von einander abfolgenden Wahrheitsdiskursen, deren jeweils nächster seinen Vorgänger zum Schweigen brachte. Ein Diskurs des Schweigens wiederum, wenn er denkbar wäre, müßte jedoch bereits an dem Paradox seiner Vernehmbarkeit scheitern. Gert Neumanns poetische Arbeit bestand/besteht eher darin, ein ganz bestimmtes Schweigen zu brechen, nämlich das Schweigen darüber, daß das, was Wirklichkeit sei, nicht eigentlich eine Sache von sprachlichen Verabredungen sein kann.
Das Hilbigwort „abwesenheit“ verband sich damals mit einem kollektiven Gefühl, auf der dunkleren Seite der Geschichte gefangen zu sein, und es ließ sich daher nach der Aufhebung der innerdeutschen Staatsgrenzen für überwunden betrachten. Es wurde insofern zum Schweigen gebracht, als die neuen, plötzlich den Gesetzen des freien Marktes unterworfenen Lebensverhältnisse kein starres Machtzentrum mehr über sich wußten, dessen Unterdrückungsmechanismen so viel Sprachlosigkeit produzierten, daß ein Schrei als eine verständliche Reaktion auf das ganze politische System gedeutet werden konnte. Dementsprechend gespannt hielt man sich in der DDR an das gedruckte Wort, weil es sowohl Sprachrohr der Repression als auch Raster der Wahrheitsfindung verkörpern und jederzeit auch Tatsachen schaffen konnte, die von lebensentscheidender Bedeutung waren. In diesen Kontext, wo der Buchstabe des Geistes und der Buchstabe des Gesetzes wechselseitig an den Denkzetteln und Armutszeugnissen der Macht wirkten, schlugen 1979 zwei poetische Bücher gleichzeitig ein, abwesenheit und Die Schuld der Worte, von denen jedes auf seine Weise sagte:
All eure Geläufigkeiten und Gewißheiten, eure Anpassungen und Absprachen, eure ideologischen Überzeugungen und ästhetischen Dogmen sind… nichts, sind Symptome einer großen Paralyse, der wir nicht mehr unterliegen. Ihr wolltet uns vernichten, es ist euch auch häufig gelungen, aber wir stehen wieder auf, als Schatten, als Worte, als Poesie des Verfalls, den ihr in Folge einer vielleicht noch nie dagewesenen Verblendung Aufbau, Fortschritt und Normalität nennt.
Ich weiß nicht, wie groß der literarische Ereignischarakter der beiden Bücher in „objektiver“ Hinsicht damals gewesen war – für meine Begriffe aber gehörten sie zusammen wie zwei Blätter einer Schere, die das schmierige Tischtuch zwischen literarischem Geist und realpolitischer Macht für immer zerschnitt.
„während wir erneut durch mürbe wüsten wanken / auf wegen die zu keinem ende reichen“ – so beginnt ein mit „gleichnis“ überschriebenes Gedicht Wolfgang Hilbigs von 1970, ein gewissermaßen den Fluch eines immerwährenden Verfolgtwerdens an die Wand malendes Orakel, das mit den Zeilen schließt: „schlägt über unsren jägern / das rote meer zusammen“. Als ich es zum ersten Mal las, fiel mir unwillkürlich Marina Zwetajewas, aus ihrem „Poem ohne Ende“ stammendes, Zitat „alle Dichter sind Juden“ ein, das Paul Celan seinem Gedicht „Und mit dem Buch aus Tarussa“ als Motto vorangestellt hatte. Und, das assozierende Lesen und Verstehen ist ja auch Antenne für den synchronen Empfang weit auseinander liegender Quellen, es fiel mir Kierkegaard ein:
Das Resultat meines Lebens… wird Ähnlichkeit haben mit dem Gemälde jenes Künstlers, der den Durchgang der Juden durch das Rote Meer malen sollte und zu dem Ende die ganze Wand rot anstrich, indem er erklärte, die Juden seien schon hindurchgegangen und die Ägypter ertrunken.
(„Entweder Oder“)
Nun war wahrscheinlich niemand von uns in dem Sinne religiös, daß er vertrauensvoll in die Bibel geschaut hätte, wenn er nicht mehr weiterwußte, aber ebenso sah man als literaturgläubiger Mensch auch keinen Grund, an der zeitlosen Wahrheit und Schönheit biblischer Texte zu zweifeln. Man las nur nicht so ohne weiteres in ihnen, fand sich jedoch von ihren Auswirkungen auf Kunst und Literatur bis in die Gegenwart hinein umgeben und daher auch unabhängig von konfessionellen Verbindlichkeiten dazu motiviert, ihre Geschichten und Lieder zu kennen. Hatte nicht der von Wolfgang Hilbig hoch verehrte Borges in den Psalmen sogar einen Ursprung der modernen Poesie gesehen? Ja, und er hatte sie andererseits davor gewarnt, sich poetologisch auf die Verrätselungen der altgermanischen Metaphern (Kenningar) zurückzubesinnen, dies führe auf den Holzweg. (Man sollte also z. B. lieber „Sonne“ schreiben, wenn man „Sonne“ meinte, und nicht etwa „Das Verderben der Zwerge“.) Das gejagte „wir“ in dem 1970 geschriebenen „gleichnis“ schöpfte seine Konsequenzen aus der alttestamentarischen Exoduserzählung, ließ jedoch die Zuversicht auf das Gelobte Land unausgesprochen und erschöpfte sich in der rückwärtsgewandten Prophezeiung eines sicheren Untergangs „unsrer jäger“. Worum ging es dabei wirklich? Die Themen der biblischen Vorlage: Sklaverei, Flucht aus Ägypten, Verfolgung, Wüstenwanderung, Kanaan kulminierten mit ihren naheliegenden Übersetzungen in: entfremdete Arbeit, Ausbruch, Verfolgungswahn, zu sich selbst Kommen, Utopie um das entwaffnende Bild einer irgendwann an ihrer eigenen Ideologie: im „Roten Meer“ zugrunde gehenden Diktatur. Überinterpretation? Nicht für die damalige Situation. Das Adjektiv „rot“, ganz gleich in welchem Zusammenhang, erweckte automatisch die Assoziation mit der Staatsmacht, die auf irgendeine Weise immer hinter einem her war und wurde vom Volksmund (Bevölkerungsmund?) regulär zur Erinnerung an die fremd bleibende Macht gebraucht. Glaubte Wolfgang Hilbig an ein Gelobtes Land? Er glaubte an das Wort, in einem wohl nicht religiösen, aber dennoch Befreiung versprechenden Sinne. „Denn nichts außer Sprache konnte ihn retten“, heißt es bei ihm an anderer Stelle (im Gedicht „die demarkationslinie“), und dieser Satz umschreibt vielleicht sein eigenes grundsätzliches Entweder Oder – nicht eines zwischen Ästhetik und Moral, sondern eines zwischen totaler Sprachlosigkeit und sprachlicher Totalität.
Das Wort „Morgen“, ein anderes, sanfteres Wort für „Utopie“, ist der Titel eines dritten Buchs von 1979, das ein ostdeutscher Autor schrieb und nur in einem westdeutschen Verlag veröffentlichen konnte. Morgen, Gedichte von Frank-Wolf Matthies, der damals seine Wohnung für illegale Leseveranstaltungen geöffnet hatte und ein Jahr später dafür mit Untersuchungshaft und erpresserischer Nötigung zur Ausreise aus der DDR gemaßregelt wurde. Bei einer der ersten dieser Lesungen lernte ich Wolfgang Hilbig kennen. (Der Paragraph, der „ungenehmigte Veröffentlichungen im Westen“ als „staatsfeindliche Hetze“ definierte, war seit einem halben Jahr rechtsgültig.) Ungefähr zwölf Jahre später, als die von den Ereignissen nach dem 9. November 1989 ausgelöste Umbruchseuphorie noch nicht völlig verebbt war und der Nachholebedarf an bestimmten Büchern und Schallplatten, die man in der DDR vermissen mußte, seine Unschuld noch nicht verloren hatte, fischte ich einmal auf einem Flohmarkt aus einer Ramschkiste die Schallplatte One Nation Under Ground der amerikanischen Acid-Folk-Band Pearls Before Swine, überspielte davon den Song „Morning“ (nicht zu verwechseln mit dem ungefähr gleichaltrigen und wohl auch bekannter gewesenen „Morning“ von Richie Havens) mit diversen anderen Liedern auf eine Tonbandkassette und schenkte sie Wolfgang, da ich ihn auch als Musikfan mit einem unermüdlichen Interesse an Rock, Blues, Folk, Jazz sowie vor allem deren Mischformen kannte. „Morning“ löste bei ihm etwas Unerwartetes aus, er hob den Song bei unserem nächsten Treffen besonders hervor, ohne daß mir verständlich wurde, was daran im Vergleich zu den Vorzügen der anderen Liedbeiträge auf der Kassette so ganz besonders für ihn war. Bald darauf schrieb er die Erzählung „Morning“, deren Protoganist sich auf der Suche nach einer Schallplatte einer Band, deren Namen er vergessen hat, einen halben Samstag lang die Hacken wundläuft. Er ist übermüdet und von den Überangeboten des Schallplattenhandels überfordert, während sein Gedächtnis um die Erinnerung an den Namen der Band und den Titel des bestimmten Songs kämpft, von dem er glaubt, daß er wahrscheinlich „Morning“ heißt, was aber auch ein Irrtum sein kann, der sich angesichts des alle Sinne betäubenden Konsumterrors kaum noch klären lassen dürfte. Zwischen den Zeilen handelt die Erzählung von der Entwertung einer groß gewesenen Hoffnung zur reinen, wenn auch suchenswerten Ware. Ich kann bezeugen, daß der mit einiger Wahrscheinlichkeit die Erzählung „Morning“ veranlaßt habende Song „Morning“ seine Seele wirklich berührte. Der Schriftsteller jedoch, der er war, der den (und den der) Terror der Realitäten verfolgte, kannte die ästhetischen Gefahren des entzückten Verweilens und vermied das Sentimentale, indem er „Morning“ nicht feierte, sondern als Phantom in seinem Kopf beschrieb, das ihn ein paar Stunden durch die Metropole einer zukunftsvergessenen Gegenwart scheuchte.
Im Laufe der neunziger Jahre ließ er sich mit mir gelegentlich mit einer solchen Unbedenklichkeit auf das Palavern über Schallplatten und CDs ein, daß es einer Fortsetzung früherer Berauschungsgewohnheiten mit weniger gesundheitsschädlichen Mitteln gleichkam. Es war die Zeit, in der seine Befürchtungen um „die Literatur“ mit der überall wahrnehmbaren tatsächlichen Marginalisierung der gesellschaftlichen Bedeutung von Literatur um die Wette liefen. Es schien auf einmal nicht mehr viele zu geben, die „überhaupt noch lasen“ und sich der sich von allen Seiten heranschleimenden Reizüberflutung geistig zu entziehen verstanden. Er mißtraute selbst dem eigenen Publikum und kämpfte während mancher seiner Lesungen mit dem starken Bedürfnis, mitten im Satz plötzlich aufzustehen und den Raum zu verlassen. Die Neigung zum Abrupten, zum Gestus einer jähen Wende der Situation, saß ohnehin in ihm tief, und er hat, wie die überraschenden Schlußformeln mancher seiner Gedichte belegen, daraus immer wieder etwas Umwerfendes zu machen gewußt. Vielleicht narkotisierte die Leidenschaft für das Hören von Rockmusik zeitweise sein Entsetzen über die Verdrängung der Literatur aus ihrer Funktion als Königsmedium einer gesellschaftlichen Verständigung.
Die Hörpassion für diverse Hits des angelsächsischen Underground sowie der darüberliegenden Etagen wäre hier nicht unbedingt der Rede wert, wenn es nicht Grund zu der Annahme gäbe, daß sie partiell auch sein Schreiben beschäftigte. „Morning“ ist da nur ein spätes und eher resignierendes Beispiel. Ein frühes und eher sprengkräftiges ist Bob Dylans „Maggie’s farm“, das in der Gefängniserzählung „Johannis“ (1978/79) von einem langsam irre werdenden Mithäftling gegen die Zellenwand gesungen bzw. als sich endlos wiederholendes Textbruchstück gestammelt wird. „Farm“ klingt dabei wie „faamn … faamn“, wie ein magische Silbe von bannfluchartiger Bedeutung und wird so am Schluß der Erzählung von dem Ich-Erzähler noch einmal aufgegriffen, indem er es bei seiner Entlassung aus der Haft mit einem grimmig beschwörenden Aufruf verbindet, nie wieder für diese Macht zu arbeiten, die das Sprechen so entstellt hat, daß die einzige menschenwürdige Sprache nur noch aus unbeendeten Sätzen bestehen kann. Ein weiteres, wenn auch nur zu vermutendes Beispiel wären die Schlußzeilen des Gedichts „die spaltung“: „nur einmal winkt ich einem windzerrissnen licht / das eine hand mir in ein fenster stellte“ – ein Bild aus der Zeit der Romantik, wo ein Licht im Fenster eine Orientierungshilfe für nächtlich Reisende darstellte, die ohne dieses Signal vom Weg ab und in gefährliches Gelände kommen konnten. Das „licht“ wird in „die spaltung“ allerdings verschmäht, wird lediglich gegrüßt wie eine gut gemeinte Einrichtung, die dem ruhelos Umgetriebenen jedoch keine Aussicht auf Ankunft verheißt.
Put a candle in the window
cause I feel I’ve got to move
though I’m going going
I’ll be coming home soon
long as I can see the light.
Diesen CCR-Song hat er geliebt, und wenn die lyrics darin auch treuherzig am Licht-im-Fenster-Bild festhalten, ist es vielleicht nicht zu weit hergeholt zu denken, daß „die spaltung“ an ihrem Ende ein gebrochenes Echo darauf zitiert. Daß ohnehin immer wieder Bruchstücke romantischer Herkunft in den englischen Rocktönen tanzten, könnte für Wolfgang Hilbig, als der sich selbst überholende Romantiker, der er wohl auch war, von zusätzlichem Interesse gewesen sein. Zwar wurde mangels ausreichender Kenntnis das Englisch von Songtexten in allgemeinen damals mehr oder weniger als eine Art von Fantasiesprache oder zusätzlichem Musikinstrument empfunden, doch reichten „ein paar Brocken“ schon aus, um zu verstehen, worum es inhaltlich ging, und so bin ich mir relativ sicher, daß Wolfgang sich auch an der Unbekümmertheit freute, mit der manche Songtexter romantische Motive für die neue „Volksmusik“ in ihren vielen unterschiedlichen Rockspielarten wiederbelebten. Sein dichtungsgeschichtliches und poetologisches Problembewußtsein verbot seinem Schreiben ein ledigliches Herbeisingen des literarischen Erbes der Romantik, und es war ihm auch klar, daß die Wirkungsmöglichkeiten einer echten Dichtung nicht am Siegeszug der Popularmusik gemessen werden durften, aber die überraschende Wiederkehr des neunzehnten Jahrhunderts in der westlichen Jugendkultur der späten sechziger und frühen siebziger Jahre, die songförmigen Symptome eines kollektiven Aufbruchstaumels, der Radiozauber des die Alten mit den Jungen verkrachenden Drei-Minuten-Glücks (das seit der zweiten Hälfte der Sechziger von Jahr zu Jahr länger und komplexer wurde,) müssen ihn interessiert und fasziniert haben wie damals nur wenige aus seiner noch in der DDR lebenden Generation. Der von den ideologischen Überzeugungen des Kommunismus prophezeite „Neue Mensch“, der im Osten „entwickelt“ werden sollte und aus dem gesellschaftlichen Experiment des Sozialismus als – um es sarkastisch zu sagen – anthropomorphes Rädchen in einem staatsbürokratischen Unterdrückungsmechanismus hervorging, kam plötzlich, allen „geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten“ zum Trotz, aus dem Westen: in Gestalt einer außerpolitischen Internationale, einer blocksystemwidrigen Völkerverständigung, er kam mit den Beatles und den Rolling Stones. Ihre Fans im Osten wurden verfolgt wie die Anhänger einer Häresie; je weiter östlich das Land gelegen war, um so brutaler ist die Polizei gegen die Zelebrationen des neuen Jugendideals vorgegangen. In der DDR verbreitete es sich durch den privilegierten Westradioempfang vergleichsweise unkompliziert, wenn man dagegen nur an die Notlösungen etwa in der Sowjetunion denkt, deren eine darin bestand, aus Krankenhäusern entwendete Photoplatten, auf denen sich Röntgenaufnahmen von den eigenen Knochen befanden, für die Aufzeichnung und Weiterverbreitung bestimmter Songs umzufunktionieren.
Also: Motive der Romantik, durch den Rock vor ihrem Anachronismus gerettet und so zwar nicht direkt brauchbar für das dichterische Werk, aber, sehr wahrscheinlich, ein inspirierendes Agens für den Schaffensrausch eines Autors, der sich aller möglichen Einstimmungshilfen für den eigentlichen Kraftakt des Schreibens bedienen kann. (Mittels welcher Reize sich Schriftsteller auf den Schreibvorgang einstimmen, wäre allerdings ein Kapitel von nicht nur literarischem Interesse. Der Satz von R. G. Dávila: „Wer sich für die Pathologie des Schriftstellers interessiert, interessiert sich nicht für die Literatur“, dient mir als Warnung, die Spur der anregenden Mittel zum Zweck nicht weiter zu verfolgen.)
„Ich wandle in der Finsternis. Doch mich leitet der Duft des Ginsters.“ Auch dies ein Satz von R. G. Dávila, den Wolfgang Hilbig seinem letzten Roman Das Provisorium als Motto voranstellte. Zu dem ins Naturmystische gehenden Bekenntnis will die kuriose Beobachtung passen, daß Wolfgang Hilbigs Physiognomie ((ich habe es mir nur sagen lassen (Peter Rühmkorf: „Hilbigs verhauene Genet-Visage“) und selber übersehen)) eine Ähnlichkeit also mit der von Jean Genet aufwies. Genet heißt – Ginster. Der Duft des Ginsters als Leitmedium – davon muß aufklärerische Gesinnung sich an der Nase herumgeführt fühlen. Nur, es geht kein Lebewesen vorsätzlich in die Irre, auch nicht das vorsatz- und vernunftbegabte Tier Mensch, und gewiß nicht der Dichter, der die Zerstörungstatsachen einer sich gegen den Menschen richtenden Ordnung immer wieder beschrieb, einer, der nach Monaten im Gefängnis die Gefahren des daran Irrewerdens mit analytischem Scharfblick förmlich durchbuchstabierte. Die Erzählung „Die Einfriedung“ (1979) schildert die Situation eines Gefangenen, der ohne eine Nennung von Gründen verhaftet wurde. Da er nicht weiß, was ihm zur Last gelegt wird und er davon ausgehen muß, daß der Grund für seine Freiheitsberaubung in einer reinen Willkür der Macht besteht, beginnt er damit, den dunklen Plan, der hinter seinem brutalen Sturz ins Ungewisse stecken muß, in allen möglichen Varianten zu dechriffieren. Der institutionalisierten Logik der Zerstörung der Persönlichkeit auf die Schliche zu kommen, wird zur einzigen realen Möglichkeit, den eigenen Geist vor der Verwirrung zu schützen. Er leistet Widerstand gegen die Mechanismen der totalen Entrechtung, indem er den Wahnsinn, der ihm droht, als den eigentlichen Zustand der Macht durchschaut. Im Unterschied zu Kafka, bei dem das Schicksal die fremde Macht ist, die einen umbringt, wenn man ihr nicht gehorcht, und die einen erst recht tötet, wenn man ihr folgt, fehlt bei Wolfgang Hilbig der Glaube an „die Macht“. Ihre Legitimation ist kein Mysterium, sie steht in keiner heiligen Schrift, sondern in der Verfassung des Staats. Der Inhaftierte kann ihr bei der Arbeit zusehen, indem er selber zusieht, seinen Verstand für den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Willkür nicht zu verlieren. Er unternimmt zwar eine gewisse „kafkaeske“ (also vergebliche) Anstrengung, auf die Unergründlichkeit der Machtabsichten nicht hereinzufallen. Aber er tut dies als Gefangener einer tyrannischen Ordnung, von der er weiß, daß sie ihn allein darum ins Unrecht gesetzt hat, weil er als Bewohner eines stacheldrahtbewehrten Halblands dazu gezwungen war, sich innerhalb paranoider Grenzen zu bewegen. Die Gesichtslosigkeit der Macht bildet keinen Anlaß für Spekulationen über deren wahren Charakter. Der wahre Charakter zeigt sich bereits als Gesichtslosigkeit, und so geht es dem Ich nur noch darum, in dem Prozeß der systematischen Entwürdigung als Zeuge in eigener Sache aufzutreten und die Gespenster, die es dabei sieht, gegen das Angstsystem, das sie hervorbrachte, sprechen zu lassen. In dieser Weise unternimmt der nach seiner Haftentlassung wieder zum Autor Gewordene nichts anderes, als der Macht den Spiegel vorzuhalten, also etwas, das für sie unerträglich war, weil sie sich in einem Spiegel aus von ihr selbst geschaffenen Tatsachen nicht sehen konnte, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren – Paradox der Realität, Wahrheit der Kunst. In der Realität drohten einem bereits wegen geringfügiger Abweichungen von den undurchsichtigen Normen des gesellschaftlichen Wohlverhaltens Haftstrafen. Der Usus, die politischen Gefangenen zu den kriminellen zu stecken, sollte die Unterschiede zwischen niederen und höheren Beweggründen verwischen und bekundete so einmal mehr die moralische Unzurechnungsfähigkeit des ganzen Machtapparats. Im Gefängnis sah man, was der Staat vom Menschen dort übrigzulassen bereit war: seine Funktion als Marionette von Vorschriften, deren Befolgung nicht einmal die nackte Existenz garantiert.
Wolfgang Hilbig glaubte nicht an „Identität“, er begriff sie als das, als welches Adorno sie beschrieb: Instrument der Vergewaltigung und Reglementierung der Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Es genügte ein Blick in den eigenen Personalausweis, um zu sehen, daß man weder Gott noch sich selbst noch einer Gesellschaft sondern einem staatsbürokratischen Moloch gehören sollte. Die hohe ästhetische Disziplin seiner Gedichte und Prosatexte wiederum ist da eben ein Ausweis vollkommen anderer Art. Die realen Schauplätze des Verfalls, auf denen der größte Teil von ihnen angesiedelt ist, sind schon längst nicht mehr wiedererzukennen, doch so sehr man ihn nachträglich als den Dichter des Untergangs einer industriellen Region bezeichnet hat, so wenig erklärt dies den Zauber seiner Wortkunst – und jene erklärt nicht die tiefe Verstörung und Empörung, die in ihr rumoren. „I cannot be more than / the man who watches“ – dieses Zitat des Blackmountain-Poeten Robert Creely steht als Motto über einem aus dem Jahr 1968 stammenden Gedicht mit dem Titel „abwertung eines unverständlichen gegenstands“, in dem es heißt: „dämmer-worte aus leerem mund / in ein halbdunkles zimmer gesagt“. Es geht darin um die Klärung einer Ausdrucksnot, deren Anlaß (vermutlich in Beziehung zu einer Frau) im Dunkeln bleibt, so wie der Mensch Wolfgang Hilbig oft lieber im Dunkeln blieb, weil es ihm Schutz vor kausalen Erklärungen bot; er wollte gehört und nicht ergründet sein. Das Motto klingt wie eine Beschwörung seiner eigentlichen und letztlich einzigen Aufgabe: Sehen, Beobachten, Schauen. Dem Schaurigen standzuhalten, die Beobachter zu beobachten, das Gesehene in Visionen zu steigern – so könnte eine Formel lauten, die seine Arbeit betraf. Die Bezeichnung „Weltliteratur“, die auf Wolfgang Hilbigs Werk anzuwenden man sich gewöhnt hat, scheint mir aus folgendem Grund nicht mehr passend zu sein: „Unter Weltliteratur stellen sie sich etwas vor, was sie zusammen vergessen dürfen.“, bemerkte Elias Canetti vor etwa vierzig Jahren. Man möchte sich fragen, ob das feierliche Wort seither etwas von dieser Tücke verloren hat. Vielleicht war es unter dem DDR-Vorzeichen trotzdem angemessen, indem es einen Verdacht des Provinziellen vom Tisch fegte. Vielleicht hätte es etwas klargestellt, bevor es im Zuge der Globalisierung zu einer trademark für Literatur ohne Verfallsdatum verkam. Die „Welt“, um die sich einmal „die Literatur“ drehte, konnte uns als dieselbe Welt erscheinen, die sich um die Literatur drehte. Heute jedoch dreht sich die Literatur um den Literaturbetrieb, der Literaturbetrieb dreht sich um den Markt, und der Markt dreht sich weltenzerstäubend um sich selbst. Das Pathos des zweihundert Jahre alten deutschen Begriffs der Weltliteratur bedeutet unter anderem auch: „beruhigend tot“, und gerade dies sollte man der schwarz funkelnden Tiefenschärfe und traumatischen Unversöhnlichkeit von Wolfgang Hilbigs Literatur nicht zuweisen. Gerade weil sie lebendigen Ranges ist, brauchte sie eigentlich kein Abzeichen, das entweder Verstaubtheit signalisiert oder nur eine Hülse ist, in die sich literaturbetriebsbeflissene Beteuerung von Aktualität hineindrängt.
Andreas Koziol, 2012, ungekürzte Fassung aus Peter Braun und Stephan Pabst (Hrsg.): Hilbigs Bilder. Essays und Aufsätze, Wallstein Verlag, 2013
Den Rimbaud aus Hilbigs Hand
– Gespräch mit Tom Pohlmann. Tom Pohlmann, 1962 in Altenburg geboren und in Meuselwitz aufgewachsen, Schriftsteller, lebt und arbeitet in Leipzig. –
Karen Lohse: Warum gab es in Meuselwitz seit Anfang der 70er Jahre eine so starke inoffizielle Kulturszene?
Tom Pohlmann: Das hatte viele unterschiedliche Gründe. Ein auslösender Moment verweist auf die Verwundungen und Traumata, die durch die Bombardierungen der Stadt in den Einwohnern entstanden waren und als Seelenlage an die nächste Generation weitergegeben wurden. Die intensivere Beschäftigung mit Literatur und Kunst kann man durchaus bereits als eine Gegenreaktion im Sinn einer Aufarbeitung der Traumata verstehen. Dann hatten der Wiederaufbau und der neue wirtschaftliche Aufstieg nach dem Krieg dieser Kleinstadt kurzzeitig den Charakter einer Boomtown gegeben. Mit den Umsiedlern und der Gründung der DDR wurden viele vorhandene Industrien intensiv ausgebaut und brachten der Stadt insgesamt einen Zuwachs an Bevölkerung. Innerhalb der Bevölkerungsstruktur erzeugte das eine eigenartige Gemengelage – und wo Gegensätze aufeinanderprallen, entsteht für künstlerische Betätigungen oftmals ein günstiger Nährboden.
Lohse: War er in Meuselwitz ein Außenseiter?
Pohlmann: Die Kunstszene in dieser Stadt empfand sich selbst nicht in einer Außenseiter-Rolle. Die Szene war jedoch ohnehin vom Geist der Achtundsechziger gespeist und nicht elitär organisiert. Mit der Außenseiter-Rolle wurde eher gespielt. Wir sahen uns mehr als Insider, an die Fremde von außen nur sehr schwer herankommen konnten. In diesen Kreisen wird sich Wolfgang Hilbig nicht als Außenseiter empfunden haben, möglicherweise jedoch innerhalb seiner eigenen Generation.
Lohse: Hat Hilbig sein Schreiben nach außen getragen, wusste man in Meuselwitz, dass er schrieb?
Pohlmann: In einer Kleinstadt zuzugeben, dass man Gedichte schrieb, war immer ein wenig gefährlich. Es galt als etwas Feminines, zumindest in seiner Generation. In unserer Generation sah das schon wieder ganz anders aus, da gehörte es fast zum guten Ton und war eher ein Makel, sich nicht auf die eine oder andere Art künstlerisch auszudrücken.
Lohse: Wie haben Sie Wolfgang Hilbig kennengelernt?
Pohlmann: In Meuselwitz musste man sich früher oder später über den Weg laufen, wenn man ähnliche Interessen hatte. Als ich ihn 1978 kennenlernte, war ich 16. Innerhalb der Kunstszene gab es aber insgesamt keine strikte Trennung nach Generationen und Altersgruppen, es war die Normalität, auf eine freundschaftliche und gleichberechtigte Art miteinander umzugehen. Er behandelte mich als jungen Erwachsenen, und ich nahm einen solchen Umgangston dankbar an. Ich erinnere mich an ein Gespräch, bei dem er meine Faszination für die Texte Rimbauds bemerkte. Irgendwann lud er mich zu sich nach Hause ein, und während meiner Abiturzeit besuchte ich ihn dort auch mehrfach. Kurz vor den Abschlussprüfungen hatte er für mich einmal eine Tasche mit Büchern vollgepackt und sagte:
Schau sie durch. Was dir gefällt, behältst du, den Rest kannst du weitergeben.
Darunter waren Bücher, die für mich später immens wichtig wurden, zum Beispiel eine Gesamtausgabe von Novalis, ein Band mit Selbstzeugnissen von Paracelsus und der Simplicissimus von Grimmelshausen.
Lohse: Sie haben ihn einige Jahre nach der Wende wiedergetroffen. Hatte ihn sein Erfolg im Literaturbetrieb verändert?
Pohlmann: Vielleicht behandelt man Menschen, die in den Medien Erfolg haben, selbst auch ein wenig anders als vorher, zumindest für einen Moment. Gesprochen haben wir über seine Geltung im Literaturbetrieb aber nie. Wir unterhielten uns über die Veränderungen nach dem Mauerfall, gemeinsame Freunde, frühere Begebenheiten, kaum über Literatur. Ich hatte inzwischen in Meuselwitz eine eigene Wohnung, und er besuchte mich dort, wenn er bei seiner Mutter zu Besuch war. Einmal kamen wir auf die Beweggründe seiner Ausreise zu sprechen, aber nur kurz. Er sagte mir damals, er habe durch die Arbeit als Heizer viel Zeit verloren. Mit dem Wissen, dass er noch mehr Zeit verliert, wenn er in der DDR bleibt, war er in der Bundesrepublik geblieben und nicht zurückgekehrt. Wie vielen anderen war ihm der Schritt nicht leicht gefallen, alles hinter sich zu lassen, denn der Fall der Mauer war um diese Zeit noch nicht absehbar. Mental gesehen, war das für ihn ganz sicher ein Abschied für immer.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
„Fiebrige Wurzeln“ eines Ortlosen
– Wolfgang Hilbig und die DDR. –
Bei dem Titel Literatur ohne Land?, den die Herausgeberinnen für den ersten Band des Projektes gewählt haben, in dem Fragen zu Schreibstrategien von in der DDR sozialisierten Autoren im Zentrum stehen, schwingt ein leicht melancholischer Unterton mit – zumindest will es mir so scheinen.85 Es ist ein subjektives Empfinden, denn die Aussage selbst ist nicht anzuzweifeln – das Land DDR existiert nicht mehr. Allerdings gibt es weiterhin die in diesem Land oder vor dem Hintergrund der DDR geschriebene Literatur, die – wenn man so will nach dem Verschwinden der DDR „heimatlos“ geworden ist. Verschwundenes kann, wenn es erinnert wird, verklärt werden. In seinem Beitrag über Volker Braun geht Stephan Krause mit gutem Recht davon aus, dass sich der Titel Literatur ohne Land? direkt auf Braun beziehen ließe: man müsse nur an das Gedicht „Das Eigentum“, denken.86 Braun, weit davon entfernt, Vergangenes durch den Schleier der Wehmut zu betrachten, hält in dem Gedicht den Moment des Vergehens fest, wobei er das Wort ,Gehen‘ durchaus wörtlich nimmt, wenn es im Gedicht heißt:
Mein Land geht in den Westen.87
Das Verschwinden der DDR veranlasst den Autor, der geblieben war, als Gehen sich noch als Alternative anbot, nach dem eigenen und dem zukünftigen Platz seiner Dichtung zu fragen.
Damit aber die Verhältnisse beim Blick auf dieses Land nicht in eine Schieflage geraten, muss die Formulierung von der ,Literatur ohne Land‘ durchaus eine erweiterte Lesart erfahren. Denn das in Rede stehende Land, die DDR, meinte über lange Jahre hinweg, auf eine bestimmte Literatur verzichten zu können, was gleichbedeutend damit war, dass nicht wenige Autoren, die in diesem Land schrieben, faktisch nicht anwesend waren, da sie ihre Texte nicht veröffentlichen konnten. Einige von ihnen zogen aus dieser Abwesenheit die Konsequenz und verließen das Land. Fortan fehlten diese Autoren und ihre Texte in der DDR, weshalb an diese fehlende Literatur erinnert werden muss, wenn man von dem inzwischen verschwundenen Land spricht. Erst wenn über das Abwesende gesprochen wird, das abwesende Land und die in diesem Land nicht gelittene Literatur, kann man den Ursachen für das Verschwinden näher kommen.
Einer dieser abwesenden Autoren war der 1941 in Meuselwitz (Thüringen) geborene und 2007 in Berlin verstorbene Wolfgang Hilbig. Mit dem Schreiben hatte Hilbig bereits während seiner Schulzeit begonnen. Nach dem Besuch einer achtklassigen Grundschule erlernte er den Beruf eines Bohrwerksdrehers. Später arbeitete er in verschiedenen Berufen, u.a. als Schlosser, Kesselwart, Abräumer und Heizer. Den „abwesenden“ Dichter Wolfgang Hilbig bezeichnet Franz Fühmann in einer 1976 gehaltenen imaginären Rede als einen Dichter, der mit der „Wucht der Elemente wie mit der von Haar und Traum umgeht und die Würde der Gattung Mensch auch in der Latrinenlandschaft bewahrt; ein großes Kind, das mit Meeren spielt; ein Trunkener, der Arm in Arm mit Rimbaud und Novalis aus dem Kesselhaus durch die Tagbauwüste in ein Auenholz zieht, dort Gedichte zu träumen, darin Traum und Alltag im Vers sich vereinen“.88
Seit 1964 war Hilbig bemüht, seine Texte in DDR-Verlagen zu veröffentlichen, aber fast zwei Jahrzehnte lang fand sich kein Verlag, der sie drucken wollte/konnte. Erst 1983 erschien mit STIMME STIMME ein Buch des Autors im Leipziger Reclam Verlag – es blieb Hilbigs einzige selbständige Publikation in der DDR, wo die Ideologie den Blick auf seine Poesie verstellte, sodass die einzigartige Schönheit dieser Dichtung übersehen wurde. In welcher Situation er sich als in der DDR schreibender, aber aus Gründen der Zensur nicht gedruckter Autor befand, das legte Hilbig Klaus Höpcke in einem Brief vom 16. Februar 1981 dar. Höpcke, der seit 1973 die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel leitete, entschied in dieser Funktion darüber, welche Bücher in der DDR gedruckt und veröffentlicht werden durften. In dem zweieinhalbseitigen, einzeilig mit Maschine geschriebenen Brief setzt Hilbig den Minister davon in Kenntnis, dass er auch seinen Prosaband Unterm Neomond (1981) im S. Fischer Verlag veröffentlichen wird. Die Entscheidung begründet er wie folgt:
Geehrter Herr Minister, da das Leben eines Menschen nicht unendlich ist, und da die Poesie, wartete sie fortwährend darauf, sich, von außer literarischen Bestimmungen sanktioniert, auf Abruf in das scheintote Dasein einer aus nur machtpolitischen, ideologischen Erwägungen ermöglichten Öffentlichkeit zu begeben, ihren Namen nicht verdiente, habe ich mich entschlossen, mein zweites Buch, den Prosaband Unterm Neomond, im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, zu veröffentlichen, unter Bedingungen, die keinerlei in der DDR eventuell erwachsende Ansprüche auf dieses Buch beeinträchtigen. Eingedenk dessen beabsichtige ich, das vollständige Manuskript dieses Buches für eine unzensierte Veröffentlichung in der DDR dem Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, zu überlassen, druckbar zu einem Zeitpunkt, der diesem Verlag genehm ist. Ich unterwerfe mich nicht der Zensur, Sie oder eine andere Institution der DDR um eine Erlaubnis für diese beiden Veröffentlichungen zu bitten.89
Der Ton lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Entscheidung unwiderruflich ist. Hilbig ist nicht gewillt, sich der Zensur zu unterwerfen. Er fragt auch nicht um Erlaubnis, ob er den Prosaband im Westen veröffentlichen darf. Das war noch anders, als sein Lyrikdebütband abwesenheit (1979) in der von Thomas Beckermann – er war Hilbigs erster Lektor – herausgegebenen Reihe Collection S. Fischer erscheinen sollte. Da hatte er beim Büro für Urheberrechte der DDR noch eine Genehmigung beantragt, um das Buch in der Bundesrepublik veröffentlichen zu dürfen. Als ihm diese aber nicht erteilt wurde, setzte sich Hilbig über das Verbot hinweg und unterschrieb den Vertrag mit dem S. Fischer Verlag. Der Gedichtband abwesenheit erschien 1979 ohne die Zustimmung der staatlichen DDR-Stellen. Hilbig konnte und wollte nicht länger warten zu viele Ablehnungen von DDR-Verlagen hatten ihn zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht. Im Oktober 1964 etwa hatte ihm der Union Verlag mitgeteilt:
Sehr geehrter Herr Hilbig! Sie haben uns Ihre Gedichte geschickt, und wir haben sie gelesen [einer der Leser war der im Union Verlag als Lektor arbeitende Lyriker Johannes Bobrowski; M. O.]. Bitte, nehmen Sie es uns nicht übel, wenn wir Ihnen sagen, daß keins der Gedichte die nötige Reife und das nötige Gewicht für eine Veröffentlichung hat.90
Dass Hilbig in seinen frühen, vor 1965 entstanden Gedichten noch nach seinem unverwechselbaren Ton sucht, belegt ein im Nachlass gefundenes Heft, das Gedichte aus dieser Zeit enthält und den Titel „Scherben für damals und jetzt“ trägt. Die frühen lyrischen Zeugnisse des Autors kreisen zwar bereits um Motive wie Nacht, Einsamkeit und Alleinsein, aber ihnen fehlt noch der unverwechselbare Ton, den die Gedichte aufweisen, die sich im Band abwesenheit finden.
Das mit „Scherben für damals und jetzt“ betitelte Heft war offensichtlich von der Staatssicherheit beschlagnahmt worden und gelangte nach dem Untergang der DDR wieder in den Besitz des Autors. Es ist aber nicht identisch mit dem Heft, das der Union Verlag an Hilbig zurückschickte. Das von den Lektoren im Brief erwähnte Gedicht „Des Stillen Frühe“, das, wie die Absender meinen, eine gelungene Gedichtzeile enthält, findet sich in diesem Heft nicht. Welche Gedichte Hilbig an den Union Verlag geschickt hat, lässt sich wohl nicht mehr rekonstruieren. Den Lektoren war aber trotz des ablehnenden Bescheids Bemerkenswertes an Hilbigs Gedichten aufgefallen:
Es gibt überraschende Wendungen und präzise Bilder. Es gibt ein deutliches Bemühen, sich nicht mit der abgegriffenen Umgangssprache zufrieden zu geben, sondern die Sprache auf neue Möglichkeiten hin anzustrengen. Aber das alles sind erst Voraussetzungen für ein Gedicht und noch nicht das Gedicht selber.91
Sie sahen zwar keine Möglichkeit, Hilbigs Gedichte im Union Verlag zu veröffentlichen, aber sie hielten ihn für eine „Begabung“. Das formulierten sie zurückhaltend, denn sie verliehen nur einer „Vermutung“ Ausdruck. Ob aus dem Talent tatsächlich ein Dichter werden würde, müsse Hilbig allerdings erst noch beweisen. Es ist eindeutig, dass man dem jungen Autor Mut machen wollte, denn am Schluss des Schreibens heißt es:
Wir sind neugierig, wie Sie in ein zwei Jahren schreiben werden.92
Zwei Jahre später schickte Hilbig seine Gedichte nicht mehr an den Union Verlag, sondern er bot sie der Zeitschrift Sinn und Form zur Veröffentlichung an – allerdings erneut ohne Erfolg. Ein Jahr zuvor hatte er „Inventur“ gemacht, und den überwiegenden Teil seiner bis dahin geschriebenen Texte verbrannt. Erstaunlich ist im Nachhinein, wie hartnäckig und wie entschlossen Hilbig sein Ziel verfolgte, in der DDR gedruckt zu werden. Der Autor, der seit 1964 verschiedenen „Zirkeln schreibender Arbeiter“ angehörte, wollte unbedingt als Schriftsteller wahrgenommen werden:
Ich wollte Schriftsteller werden. Mich hat niemand dazu gezwungen, und das hat keiner von mir verlangt. Es war mein Wille, das zu werden. Also hatte ich gefälligst auch damit fertigzuwerden. Natürlich entsteht aus der Tatsache, daß man schreibt und nicht veröffentlichen kann, immer eine Verletzung. Aber diese Verletzung ist eine sehr allgemeine gewesen in der DDR.93
Im Mai 1968 entschloss sich Hilbig zu einem ungewöhnlichen Schritt, der in der literarischen Landschaft der DDR einmalig blieb. In der vom Schriftstellerverband der DDR herausgegebenen Zeitschrift ndl erschien im Heft 7 ein von Hilbig aufgegebenes Inserat mit folgendem Wortlaut:
Darf ich Sie bitten, in einer ihrer nächsten Nummern folgende Annonce zu bringen: „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte. Nur ernstgemeinte Zuschriften an: W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b.“ Ich bitte, nach Abdruck der Anzeige, mir die Rechnung zuzuschicken.94
Hilbig wird später sagen, dass diese Annonce eigentlich als Witz gedacht war. Reaktionen auf seine Anfrage sind anscheinend ausgeblieben, was daran gelegen haben mag, dass das Inserat auch so verstanden worden war. Doch spätestens nach dem Erscheinen von Hilbigs erstem Gedichtband abwesenheit dürfte in den Redaktionsräumen der ndl niemand mehr über den vermeintlichen Witz gelacht haben. Hilbig, der in der DDR keinen Verlag finden konnte, war vom Westen entdeckt worden, was in erster Linie ein Verdienst von Karl Corino war. Er erkannte und förderte das außergewöhnliche Talent, indem er Hilbigs Gedichte am 26. Oktober 1977 im Hessischen Rundfunk in der Sendereihe Transit vorstellte. In der DDR hingegen wurde einer der sprachmächtigsten Schriftsteller der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts übersehen, wobei das Übersehen politisch motiviert war. Hilbig, der seit 1968 als „feindlich-negativer Nachwuchsschriftsteller“95 galt, wurde seit 1977 von der Staatssicherheit als „OPK“ Deckname „Literat“ bearbeitet.
Bedenkt man den zeithistorischen Hintergrund, vor dem die in der ndl veröffentlichte Annonce erschienen war, scheint sie von eher marginaler Bedeutung zu sein. Das Jahr 1968 war ein Jahr des Umbruchs. In Paris und in Westberlin sorgten die Studentenunruhen für internationales Aufsehen, und in der ČSSR versuchte man sich an einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz, einem Traum, den sowjetische Panzer beendeten. Aus einem andren Traum erwachte am 30. Mai 1968 die Leipziger Bevölkerung. An diesem Tag wurde die Leipziger Universitätskirche, weil sie nach Auffassung der Ulbricht-Regierung nicht ins städtebauliche Ensemble einer sozialistischen Stadt passte, gesprengt. In dieser sowohl außen- wie auch innenpolitisch hoch brisanten Zeit trafen sich am 26. Juni 1968 auf dem Leipziger Elsterstausee junge Autoren zu einer von Siegmar Faust organisierten Motorbootlesung. Faust, der am 1. April 1968 vom Literaturinstitut Johannes R. Becher relegiert worden war, arbeitete auf dem Stausee als „Dampferfahrer“. Die jungen Poeten, die er eingeladen hatte, sollten auf dem Schiff ihre Texte vortragen und sich der Diskussion stellen. Zu den Teilnehmern der Lesung gehörten u.a. Andreas Reimann, Bernd-Lutz Lange, Dietrich Gnüchtel und auch Wolfgang Hilbig. Hilbig war von Gert Neumann eingeladen worden, der ihn seit 1965 kannte.
Er kam ja aus der Arbeiterklasse. (…) Und für mich war ja – und das ist bis heute ungeklärt – sehr faszinierend, woher diese Sprache, die in seinen Gedichten ankam, woher die eigentlich kommen kann. Das waren ziemliche große Hoffnungen, die ich hatte, die mit dem Menschen so allgemein zu tun hatten. Ich habe damals Jacob Böhme, glaube ich, gelesen. (…) Der hat ja keine Bildung gehabt und trotzdem hat er das alles gemacht, die Haufen Bücher, die er geschrieben hat. Und die beschäftigen sich mit dem Ort, wo die Sprache sich bildet. So eine ganz entscheidende Frage. (…) Und mir ging das auch so mit Wolfgang. Ich habe mich gefragt, wo kommt das her, was ist das.96
Etwa 30 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, auf dem Motorboot zu lesen, wobei Hilbigs Gedichte in der Diskussion den größten Raum einnahmen. Die auf den ersten Blick idyllisch anmutende selbstorganisierte Kulturveranstaltung hatte jedoch – da sie vom MfS überwacht worden war – ihren realpolitischen Hintergrund. Autoren, denen in der DDR keine Öffentlichkeit zugestanden wurde, hatten sich zu einer privaten Lesung auf einem Motorboot zusammengefunden. Damit reagierten die in der literarischen Landschaft der DDR „Abwesenden“ darauf, dass sie nicht wahrgenommen wurden. Als sie sich aber durch Eigeninitiative eine eigene Öffentlichkeit schufen, wurden sie verdächtigt, eine Gegenöffentlichkeit herstellen zu wollen. Die Übersehenen, die sich mit ihrem Nichtvorhandensein nicht abfanden, riefen das MfS auf den Plan, das dieses Treffen als „konspirative“ Zusammenkunft einstufte, und die Teilnehmer, die als potentielle „Staatsfeinde“ angesehen wurden, registrierte und beobachtete. Überzeugt davon, dass von den jungen Schriftstellern, die sich auf dem Motorboot zu einer Lesung trafen, eine Gefahr ausgehen würde, erklärte das MfS die Vermutung zu einer Tatsache, sodass eine Observierung der Teilnehmer gerechtfertigt war.
Diese Lyrik hat vielfach antisozialistische Tendenzen zum Inhalt. Die Gruppe plant für 1968 die Herausgabe eines „Lyrischen Manifestes“. Da in den Zusammentreffen dieser Leute antisozialistische Diskussionen geführt werden, muß erwartet werden, daß durch das Manifest der Sozialismus in der DDR angegriffen wird.97
Diese Arbeit nannte das MfS Aufklärungs-Arbeit, wodurch der Aufklärungs-Begriff pervertiert wurde. Dieser Begriff ist zentral in Hilbigs Roman Ich (1983), in dem die im Mittelpunkt stehende Figur Cambert, ein IM, als Aufklärer Spitzeldienste für die Staatssicherheit leistet. Seine Tätigkeit orientiert sich an der Gesamtausrichtung der staatssicherheitsdienstlichen Arbeit, die darin besteht, die Wirklichkeit so zu interpretieren, dass sie den Vorstellungen, die das MfS von der Wirklichkeit hat, entspricht.
Aber es war schwer, aufzuklären ohne eine Vorstellung davon, was durch Aufklärung sichergestellt und gegebenenfalls verhindert werden sollte, möglichst im Ansatz schon verhindert, wie es unser ausdrückliches Ziel war. Darum war es notwendig, zu simulieren, daß die Wirklichkeit im Ansatz unseren Vorstellungen entsprach.98
Hilbig, der in dem 1993 erschienenen Roman Ich die Absurditäten des Ministeriums für Staatssicherheit aus der Perspektive eines IM beschreibt, war selbst mehrere Jahre von der Staatssicherheit, die Matthias Braun als eine Art „Generalauftragnehmer für Sicherheitsfragen“ bezeichnet, beobachtet und am 9. Mai 1978 auch verhaftet worden.99 Man beschuldigte ihn, eine DDR-Flagge von einem Fahnenmast gerissen und angezündet zu haben. Offensichtlich hatte man aber schnell einsehen müssen, dass die Anschuldigung haltlos und nicht zu beweisen war. Davon unbeeindruckt, verhörte das MfS Hilbig während der Untersuchungshaft, wobei auch versucht wurde, ihn als IM anzuwerben. Um das eigentliche Delikt, das ihm vorgeworfen wurde, ging es weniger, sehr viel mehr interessierte man sich für Hilbigs Kontakte zu Journalisten und Lektoren aus der Bundesrepublik, da man erfahren hatte, dass sein erster Gedichtband in der Bundesrepublik erscheinen würde. Die Fahne wurde zu einem nebensächlichen, bedeutungslosen Requisit, aber Hilbig beobachtete fortan sehr genau das Land, das sie symbolisierte. Vordergründige Systemkritik allerdings übte er nicht:
Ich habe eigentlich noch nie über das Staatsgebilde DDR geschrieben, sondern eigentlich immer versucht, über einen landschaftlichen oder einen Zustand der Menschen zu schreiben, und der existiert ja eigentlich weiter. Obwohl es vielleicht großspurig klingt, muß ich zugeben, daß ich mich einfach als Schriftsteller begriffen habe und gar nicht diese Eingrenzung „DDR-Schriftsteller“ wollte. Ich halte auch die Bezeichnung „deutscher Autor“ für eine Einengung. Ich glaube, der Schriftsteller ist etwas Internationales.100
Die Verhaftung stellte in seiner Biographie eine Zäsur dar. Mit der Kriminalisierung hatte der Staat dem arbeitenden Schriftsteller unmissverständlich zu verstehen gegeben, wie er mit „staatsfeindlichen“ Autoren umzugehen gedachte. Die Crux aber bestand darin, dass die Zensur Hilbig erst zu einem „Staatsfeind“ gemacht hatte. Seine Texte, die vom Leben und Arbeiten in der DDR handeln, die die Gegend um Meuselwitz beschreiben und sich der Natur zuwenden, wurden von einem in der DDR lebender Autor geschrieben. Auf diesen Umstand wies er Höpcke in dem bereits erwähnten Brief unmissverständlich hin:
In einem früheren Brief (…) forderte ich Sie auf, zu bedenken, (…) daß das, was ich schreibe, Ergebnisse meiner literarischen Tätigkeit in der DDR sind, sein müssen, ich unterließ leider zu konkretisieren, daß das bedeutet, daß niemand in diesem Land das Recht hat, mein Werk auf Fremdbestimmung hin zu kontrollieren. Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, daß ich einer Generation angehöre, die sich nicht mehr zensieren läßt, aus logischen Gründen, denn diese Generation hat bisher nirgends als in der DDR existiert, und daß dies eine Weigerung, mich einer Zensur, gleich in welcher Form, zu unterziehen zur Folge hat, die ein logisches Ergebnis meines Lebens und meiner Arbeit in der DDR ist. Stattdessen aber ist diese Zensur ungehindert und in einem Dunkel, fern von Legalität in Kraft.101
Mit dem Brief brachte der Arbeiter Wolfgang Hilbig den Minister des Arbeiter-und-Bauern-Staates in Verlegenheit, denn er machte Höpcke auf einen absurd anmutenden Zustand aufmerksam. Als Autor fand Wolfgang Hilbig seine literarischen Themen in dem Land, in dem seine Texte nicht erscheinen durften, da die von ihm beschriebenen Verhältnisse angeblich nicht die real existierenden Zustände widerspiegeln würden. Der Minister aber wusste ebenso gut wie der Autor, dass das, worüber Hilbig schrieb, nicht erfunden war. Ihre Anschauungen waren unvereinbar: Höpcke war seinem Amt, Hilbig hingegen allein seinem literarischen Werk verpflichtet, weshalb er Bevormundungen nicht akzeptieren wollte – worüber er schrieb, war „logisches Ergebnis seines Lebens und Arbeitens in der DDR“. Durch die Kriminalisierung war Hilbig endgültig zum Außenseiter geworden, der als Heizer und als Vorbestrafter in der sozialen Hierarchie nicht mehr tiefer sinken konnte. Er war aber auch weniger angreifbar geworden, denn weder mit Gefängnis noch mit der besonders häufig gegen Intellektuelle verhängten Disziplinierungsmaßnahme, sich in der Produktion bewähren zu müssen, konnte man Hilbig drohen: im Gefängnis hatte er bereits gesessen und in der Produktion arbeitete er tagtäglich.
Weiterhin bot Hilbig seine Literatur verschiedenen Verlagen in der DDR an, wodurch er den Konflikt mit dem Staat in jenen Bereich verlagerte, in dem er hätte ausgetragen werden sollen: den literarisch-künstlerischen. Er konfrontierte die Verlage mit seinen Texten, wobei er sich mit den Ablehnungen, die er erhielt, literarisch auseinandersetzte – etwa in der Erzählung „Über den Tonfall“ (1977). Darin überdenkt ein Schriftsteller die offiziellen kulturpolitischen Verlautbarungen, um dahinterzukommen, aus welchen Gründen seine Texte nicht gedruckt werden und wo sein Platz im Literaturensemble des Landes, in dem er lebt, sein könnte. Der namenlos bleibende Erzähler des 1977 geschriebenen Textes setzt sein Schreiben ins Verhältnis zu den Poeten, die, wie er gelesen hat, ausdrücklich gelobt werden, weil sie sich der „Realität“ zugewandt hätten, da diese Hinwendung zu Realität zu einer „gewachsenen Breite und Vielfalt“ der Lyrik geführt habe:
Ich hatte mir gesagt, daß dort, wo dergestalt Breite und Vielfalt herrschten, möglicherweise alle Positionen schon besetzt waren, und es mir daher nicht gelang, selbst einen geschmähten Nebenplatz, der mich schon zufriedengestellt hätte, in der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit zu erringen, – von stärkerem Ausschlag für mein Schicksal aber schien mir das zu sein, was mit dem Hinweis auf den Realitätsbezug verbunden war.102
Hilbig übte von der Peripherie aus Druck auf das im Zentrum agierende System aus, indem er an seinem Wunsch festhielt, seine Texte in der DDR veröffentlichen zu wollen.
Hinwendung zur Realität: es sagt schon in seiner Sprachfigur, daß wir im Irrealen sitzen, während wir schreiben, und uns verzweifelt davon abwenden. Ich könnte, Nachgeborener aller Ursprünge, auf jede Weise nur dem Tonfall zum Opfer fallen, der uns auf die sichtbare Realität festgelegt hat.103
Wenige Wochen nach seiner Haftentlassung schickte er seine Gedichte an den Aufbau-Verlag und an den Mitteldeutschen Verlag mit der Bitte zu prüfen, ob die von ihm eingereichten Verse eine Chance hätten, gedruckt zu werden. Erneut stellte er so die Frage nach seiner An- resp. Abwesenheit in der DDR-Literatur. Auf den Brief vom August 1978 reagierte die Lektorin des Aufbau-Verlages im September. Zunächst bedankte Sie sich für das eingereichte Gedicht-Manuskript Gegen den Strom (später abwesenheit), aber sie teilte ihm zugleich auch mit, dass es aus folgenden Gründen zu keiner Zusammenarbeit mit dem Aufbau-Verlag kommen werde:
Ich habe mir die Arbeiten angesehen, mein Eindruck motiviert allerdings keine engeren Arbeitskontakte zwischen uns. Es ist wohl weniger Ihre „ästhetische Haltung“, wie Sie schreiben, als vielmehr Ihre menschliche, die zu solchen Entscheidungen veranlaßt. […] Sie bleiben in einer trotzigen Kontra-Haltung gegenüber einer Umwelt, die so opportunistisch, unsensibel und tot ist wie das lyrische Ich das offensichtlich einzige leidensfähige Wesen.104
Während die Lektoren des Union Verlags noch bemüht waren, dem damals Dreiundzwanzigjährigen Mut zuzusprechen, ist der Ton, in dem Hilbig nun mitgeteilt wird, dass man an einer Zusammenarbeit nicht interessiert sei, belehrend. Die Lektorin bemängelt nicht nur seine „ästhetische Haltung“, sondern sie stößt sich vor allem an seinem Menschenbild. Vorgeworfen wird ihm eine trotzige, unsensible und wenig kompromissbereite Haltung – deshalb passe er nicht in den Kanon einer sozialistischen DDR-Literatur. Die schroffe Ablehnung richtet sich gegen den Band, der ein Jahr später, 1979, unter dem Titel abwesenheit bei S. Fischer erscheinen wird.
Der Brief des Aufbau-Verlages ist als Dokument höchst aufschlussreich, weil in den Band STIMME STIMME, der 1983 schließlich in der DDR erschien, ein Großteil der in abwesenheit veröffentlichten Gedichte aufgenommen wurde. 1978 waren diese Gedichte wegen Hilbigs „Kontra-Haltung“ noch abgelehnt worden; dass sie 1983 schließlich erscheinen durften, hatte allerdings erneut politische und weniger literarisch-ästhetische Gründe. Anfang der achtziger Jahre fürchtete man, dass Franz Fühmann Hilbigs Schicksal auf dem Schriftstellerkongress der DDR öffentlich machen könnte, was unbedingt vermieden werden sollte. Ein weiterer Grund war, dass Hilbig mit zwei im Westen erschienenen Büchern für die DDR-Behörden den Status eines Dissidenten hatte, woran man nur etwas ändern konnte, wenn man ein in der DDR veröffentlichtes Hilbig-Buch erlaubte. Durch das Erscheinen von abwesenheit hatte Hilbig in der Bundesrepublik endlich die künstlerische Anerkennung erhalten, die ihm in der DDR so lange versagt geblieben war. Auf das Erscheinen des Bandes reagierten die Kulturverantwortlichen der DDR mit der Zustellung eines Strafbescheides: Hilbig wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Mark verurteilt, weil er sich über die nicht erteilte Genehmigung des Büros für Urheberrechte hinweggesetzt hatte.
Matthias Braun macht in Thesen zur Editionsgeschichte von Wolfgang Hilbigs Stimme Stimme im Reclam-Verlag Leipzig darauf aufmerksam, dass das MfS die Publikation des Bandes aktiv vorangetrieben habe. Der Reclam Verlagsleiter Hans Marquardt (IM „Hans“) wurde vom MfS 1981 angewiesen, für den „Autor Wolfgang Hilbig Möglichkeiten zur Veröffentlichung nicht schadender literarischer Texte zu prüfen und Voraussetzungen für eine positive Beeinflussung des Hilbig zu schaffen“.105 In dem bereits erwähnten Brief an Höpcke, in dem sich Hilbig u.a. auch darüber beschwert, dass seine Frau von der Stasi aufgefordert worden sei, Auskünfte über ihn und über seine literarische Arbeit zu erteilen, erwähnt er auch, dass seine Post häufig verloren gehe und er nicht gewillt sei, dabei an Zufälle zu glauben. Dabei wird der Reclam Verlag ins Gespräch gebracht, mit dem sich eine Zusammenarbeit anbahnte:
So gibt es Äußerungen des MfS, daß man von da aus meine Zusammenarbeit mit dem Reclam-Verlag protegieren werde; ich muß Ihnen wohl nicht sagen, daß meine Zusammenarbeit mit Reclam sofort zum Erliegen kommen müßte, wenn dieser Fall einträte, bewiese er doch, nicht zuletzt, die völlige Ohnmacht eines Verlages, die Poesie überhaupt zu erkennen, geschweige denn sich frei dafür zu entscheiden, gäbe ein solcher Fall doch tatsächlich das schaurige Bild einer vom Geheimdienst regierten Kulturpolitik, bewiese dieser Fall die Nichtexistenz einer Kulturpolitik.106
Texte an den Reclam Verlag hatte Hilbig 1982 geschickt. Am 21. April 1982 beantragte der Verlag bei der HV Verlage die Druckgenehmigung. Im Antrag werden die Außengutachterinnen, Karin Hirdina und Ursula Heukenkamp, zitiert, die Hilbig einen „seltenen Dichter“ nennen. Beide sind sich darin einig, dass „Gleichartiges in unsere Lyrik gegenwärtig kaum zu finden“ sei.107 Der Verlag als Antragsteller weist aber fast entschuldigend darauf hin – wohl wissend, dass es zu Diskussionen kommen würde dass man sich diese „schwierige Aufgabe“ (die Veröffentlichung von Hilbigs Texten) nicht ausgesucht habe, sondern dass der Verlag „während der komplizierten Arbeit am Trakl-Essay [von Franz Fühmann; M. O.] mit diesem gesellschaftlichen Auftrag konfrontiert wurde“, den man erst nach Rücksprache mit der HV Verlage übernommen habe.108
Es spricht viel dafür, dass Hilbig mit seiner im Brief an Höpcke erwähnten Vermutung recht hatte. Es war nicht die poetische Kraft seiner Texte, die letztendlich den Ausschlag gab, seine Gedichte und Prosaarbeiten im Reclam Verlag zu veröffentlichen. Das MfS gab grünes Licht, weil ein Band mit Hilbig-Texten in die kulturpolitische Situation passte. Beabsichtigt war, günstige Bedingungen für die Integrierung Hilbigs in die DDR-Literatur herzustellen. Nicht um Poesie ging es dabei, sondern um Politik, und der Geheimdienst der DDR spielte dabei eine entscheidende Rolle. Höpcke teilte am 31. März 1983 Franz Fühmann mit, dass er mit „Gewissheit“ davon ausgehe, „daß in der nächsten Zeit ein Band mit Prosatexten und Gedichten von Wolfgang Hilbig im Reclam Verlag erscheinen wird“.109 Auch in diesem Fall war die Absicht eindeutig: Fühmann, der gedroht hatte, den „Fall“ Hilbig öffentlich zu machen, sollte beruhigt werden. Die HV Verlage aber sah sich durch die vom Reclam Verlag ins Gespräch gebrachte Auswahl auch mit einer Reihe bisher ungewohnter Fragen konfrontiert:
Wir machen darauf aufmerksam, daß mit der Druckgenehmigung (Aufnahme von etwa 70% aus dem Band abwesenheit – S. Fischer, 1979, und ca. 50% von der Prosa aus dem Band – Unter [sic!] Neomond – Erzählungen – S. Fischer, 1981 [)], eine bisher nicht praktizierte kulturpolitische Entscheidung gefällt wird. […] Betont sei abschließend noch einmal, dieser Band muß bei Erscheinen sorgfältig rezensiert werden, das sollte Reclam mit vorbereiten.110
Als ein weiteres Problem wurde angesehen – und so wurde es auf einem mit „Hilbig-Manuskript“ beschriebenen Zettel auch formuliert:
Artikulierung eines leidvollen Verhältnisses zur Gesellschaft – wenn man das stilisiert, kommt man zu falschen Schlüssen.111
Es müsse deshalb auf das Buch mit entsprechenden Besprechungen in Zeitungen und Zeitschriften reagiert werden.
Neben „Entwirklichung“ ist „Gewordensein“ eines der zentralen Themen von Hilbigs Texten, wobei ihn das Gewordensein des Landes, in dem er lebte, ebenso interessierte wie das der Natur, deren Wunden sich in der vom Tagebau zerschundenen Landschaft um Meuselwitz deutlich zeigten. Indem er sich dem Land und der Landschaft zuwendet, spricht er von Erfahrungen, die in diesem Land und in der Landschaft ihre Wurzeln haben.
Ich glaube, ich bin einer von den Schriftstellern, die ewig an einem Thema hängen und nie glauben, das Thema bewältigen zu können. Die DDR und die Landschaft um Meuselwitz werden für mich unausrottbar vorhanden sein; ich habe ja geradezu fiebrige Wurzeln in diese schwarze Erde geschlagen. Man kann nur von dem schreiben, was man selber ist, was man gerochen, gesehen, geschmeckt hat, was man durchleiden mußte. Alles ist immer wieder in mir gegenwärtig. Natürlich werden es auch Themen aus meinem Leben in der Bundesrepublik sein. Aber auch sie werden durch meinen in der DDR mir zugefallenen Blick gebrochen sein.112
Hilbig hat die herrschenden Verhältnisse in der DDR nicht direkt kritisiert, sondern er hat sich mit dem das Bewusstsein bestimmenden Sein befasst und war Marx somit näher, als es den DDR-Offiziellen lieb sein konnte. Allerdings war seine Perspektive auf die DDR nicht kompatibel mit der, die in diesem Land als die allein gültige angesehen wurde. Hilbig ging vom Existierenden aus, die Staatslenker hingegen vom antizipierend Möglichen, ohne dabei auf Ernst Bloch zurückzugreifen, dessen Beharren auf der utopischen Kraft des Möglichen zu sehr am veränderungswürdig Seienden orientiert war. Veranlassung, seine Perspektive auf die DDR-Wirklichkeit zu korrigieren, hatte Hilbig nicht. Zwar wollte er auch in der DDR gedruckt werden, aber nicht um jeden Preis. Eine IM-Mitarbeit hat er ebenso abgelehnt wie eine Korrektur der ästhetisch-inhaltlichen Ausrichtung seiner Texte. „Ich habe einen bestimmten Haushalt von Themen, oder von Ideen“, so Hilbig in einem Interview, „den ich mit mir herumtrage und der darauf wartet, bearbeitet zu werden. Diese Komplexe von Stoffen stammen – es ist leicht einzusehen aus der ehemaligen DDR“.113 Das Leben in der DDR hat Hilbigs Schreiben beeinflusst, denn er fand seine Themen in diesem Land. Er kannte das System, das ihn als „Besitz“ betrachtete und das glaubte, ihn reglementieren zu können.
Als ihm 1985, nach der 1983 erfolgten Auszeichnung mit dem Brüder-Grimm-Preis, ein Stipendium verliehen wurde, beantragte Hilbig ein Visum, das ihn zur mehrmaligen Aus- bzw. Einreise in die DDR. berechtigte. Seit dieser Zeit lebte er in der Bundesrepublik. Mehrmals aber fuhr er zurück in die DDR. Kam er mit einer literarischen Arbeit nicht weiter, machte er sich auf den Weg nach Meuselwitz, wo seine Mutter noch bis 1999 in dem Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19b wohnte, in dem Hilbig geboren worden war. Das Pendeln zwischen Ost und West bot ihm nicht nur die Möglichkeit, die beiden gesellschaftlichen Systeme miteinander zu vergleichen, es erlaubte ihm auch die Analyse der beiden sehr unterschiedlichen literarischen Märkte. Aufgabe der Literatur sei, so Hilbig in einem Interview, „die Artikulation solcher subjektiven und objektiven Lebenssituationen, die vielleicht sprachlich noch unzerstört sind: also gesellschaftliche Bewegungsströme in und um uns, die sozusagen ihre Sinnerklärung verweigern, zu denen man sich durcharbeiten muß, die man retten muß vor den verbalen Müllhalden des Alltags“.114 In dem drei Jahre nach diesem Interview erschienenen Roman Ich wird ein radikalerer Ton angeschlagen, wobei es bizarr anmutet, dass diese engagierte, die Literatur betreffende Forderung vom Chef des MfS in A. vorgetragen wird:
[D]er Schriftsteller muß in seinem Denken so weit gehen, daß er strafrechtlich belangt werden kann, wenn es für nötig gehalten wird… ja, so weit muß er gehen wollen! Was hätten wir denn für eine dürftige Literatur, wenn in dieser das Denken eingeschränkt und kanalisiert wäre? Ach wissen Sie, man muß ehrlich zugeben, wir haben diese dürftige Literatur, und genau aus den genannten Gründen.115
Hilbig thematisiert in seinem letzten Roman Das Provisorium (2000) die Situation eines DDR-Schriftstellers, der durch ein Stipendium die Möglichkeit erhält, im Westen zu leben. Es handelt sich dabei um einen der wenigen Hilbig-Texte, der zum größten Teil in der Bundesrepublik spielt. Die Erfahrungen, sich mit einem Markt konfrontiert zu sehen, der auf Bestseller wartet, teilt die literarische Figur mit ihrem Autor:
Es war auch beim Provisorium immer klar, dass ich mich beschreibe. Aber durch die formale Distanz sah ich mich eher von außen, als Figur. Einer literarischen Figur kann man sonstwas andichten, die größten Schweinereien. Es ist das Autobiographischste meiner Bücher, trotzdem kann ich mich dahinter verstecken.116
Dem Schriftsteller C., der sich im Westen Bücher über den Holocaust und den Gulag gekauft hat – sie füllen zwei Bücherkisten, die in seiner Wohnung stehen –, stellt sich die Frage, worüber noch zu schreiben wäre, angesichts des gesammelten Wissens über das 20. Jahrhundert, das in diesen beiden Kisten liegt. Dem damit vorgegebenen Anspruch würde er gern gerecht werden. Aber den Literaturbetrieb interessieren eher Bücher, die sich gut verkaufen lassen. Darin besteht das Dilemma des Autors, der sich in einer Schreibkrise befindet. Eingekeilt zwischen eigenem Anspruch, dem er momentan nicht genügen kann, und einer Erwartungshaltung, die einzulösen er nicht gewillt ist, findet er keinen Ausweg aus der Krise. Weder der Westen noch der Osten bieten sich als Alternative an.
Als 1989 die Bilder vom Mauerfall um die Welt gingen, saß Hilbig zusammen mit Natascha Wodin – mit der er von 1994 bis 2002 verheiratet war – in Edenkoben vor dem Fernseher. Die Wende – so Wodin – sei ein „entscheidender“ Grund für den Rückgang von Hilbigs literarischer Produktion nach dem Erscheinen seines Romans Das Provisorium gewesen. Nach Ansicht der Autorin von Nachtgeschwister (2009) kam die Maueröffnung für Hilbig fast einem „Todesurteil“ gleich, da die DDR „seit dem Mauerfall nicht mehr vorhanden war“.117 Hilbig sieht das in einem Interview mit Harro Zimmermann durchaus anders:
Die DDR existiert ja eigentlich noch, ausgenommen ihre Bezeichnung, ihre Regierung, die die Bezeichnung erfunden hat, und das Ideologie-System, mit dessen Hilfe sie versucht hat, zu funktionieren. Es sind also nur Nebensächlichkeiten verblichen, und mit denen sollte sich ein Schriftsteller nicht etikettieren. Das andere, also das Überwiegende, zu beschreiben – auch dessen Veränderungen und, wenn es denn sein soll, seinen Untergang – das ist, denke ich, eine große (und atemberaubende) Aufgabe für einen Schriftsteller. Und ein solcher Versuch wäre keineswegs provinziell. Die ganze Welt der Literatur besteht aus diesen kleinen poetischen Provinzen à la DDR … siehe das Yoknapatawpha von Faulkner.118
Nach dem Weggang aus der DDR blieb Hilbig bei seinen Themen, an denen er auch nach dem Fall der Mauer festhielt. Hilbigs Schreibarchiv bestand aus in der DDR gemachten Erfahrungen. Dieses Archiv, das ihm als Fundus für seine Texte diente, hatte er 1985, als er in die Bundesrepublik gegangen war, nicht entsorgt. Den Fall der Mauer nahm er in dieses Archiv auf, das eine Erweiterung, aber keine Neuausrichtung erfuhr. „Die ,Wende‘“, so Hilbig, nahm fortan an seinem „Schreibprozeß teil“. Er konnte die Welt „nicht mehr so sehen […], wie sie einmal war“, aber er sah sie nach 1989 auch nicht grundsätzlich anders.119
Die „Wende“ von 1989 ist das Ereignis, auf das die Handlung in Das Provisorium zuläuft. Allerdings versetzen die Ereignisse des Jahres 1989 den mit einem DDR-Visum in der Bundesrepublik lebenden Schriftsteller C. kaum in Erstaunen: Botschaftsbesetzungen, Massenausreise von DDR-Bürgern, Grenzöffnung in Ungarn, der westdeutsche Außenminister in Prag. Demonstrationen in Leipzig, Berlin, Dresden; Gründung neuer Parteien in der DDR: Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, SDP… der 40. Jahrestag der DDR… Rücktritt der Honecker-Regierung. – Die Ereignisse blieben ihm fern.120
C., Hilbigs Alter Ego, macht die Erfahrung, dass er keinen Ort findet, an dem es ihm möglich wäre zu schreiben. Aus der DDR war er ausgereist, weil seine Texte – die eines in der Produktion arbeitenden Schriftstellers – nicht gedruckt wurden. Unbedingt musste er die Zustände in diesem Land verlassen, da er nur „herumstagniert“121 hatte. Durch die Übersiedlung in den Westen hoffte er, auch aus seiner Schreibkrise herauszufinden.
Aber auch im Westen bringt er keine vernünftige Zeile zu Papier. Bis zum Beginn der Schreibkrise konnte er in der DDR schreiben, obwohl er nicht gedruckt wurde. In der Bundesrepublik findet er aus der Krise nicht heraus, weil man viel lieber druckt, was C. nicht bereit ist zu schreiben. Er will und kann den literarischen Anspruch, den er unter widrigen Umständen in der DDR aufrechterhalten hat, unter den Bedingungen des freien Marktes nicht aufgeben. Er, der immer in den Westen wollte, fürchtet nun, dass man ihn nicht in die DDR einreisen lässt, da er den Zeitpunkt versäumt hat, sein Visum zu verlängern.
Hilbigs C., diesen Ortlosen, zieht es zu den Transiträumen. Er sucht die Nähe von Bahnhöfen, weil sie Orte des Versprechens sind. „Der Schreibende hat in Europa keinen Platz mehr“,122 heißt es im Roman. C., der beide Systeme kennengelernt hat, nennt das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Lügen. Ein einziger Zug von Lügen sei das Jahrhundert gewesen und der
Schienenstrang für diesen Zug sei die Fortschrittslüge gewesen. […] Die Luft dieses Jahrhunderts ist verseucht von Lüge, die Städte sind krank vor Lüge, die Erde fault in der Lüge. Wenn Wahrheit erforderlich wäre für die Existenz eines Jahrhunderts, dann dürfte es das zwanzigste nicht gegeben haben.123
Texte, die von diesem Jahrhundert handeln, bewahrt C. in zwei Kisten auf, die Bücher über die Lager und den Gulag enthalten. Dass C. keine Worte mehr findet, ist Ausdruck der Textur, die das 20. Jahrhundert geschrieben hat. Hilbigs Das Provisorium nimmt sich sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik vor, wenn im Roman mit dem Jahrhundert abgerechnet wird. Als einzige Chance bleibt der zentralen Figur des Romans, diesem Jahrhundert schreibend zu begegnen, einer Aufgabe, der sich C. stellen will – es gilt das Jahrhundert bloßzustellen, was einschließt, dass er sich als Schreibender entblößt. Der dafür nötige Ort kann nur das Schreiben selbst sein, da sich die Orte, an denen C. sich aufhält, nur als Provisorien erweisen.
Michael Opitz, aus Mirjam Meuser, Janine Ludwig (Hrsg.): Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland Band II, fwpf, 2014
Über Arbeitsplätze:
E.T.A. Hoffmann im Poetenstübchen
und Wolfgang Hilbig im Heizkeller124
Der Dichter am Schreibtisch, das ist, wie jeder weiß, eine höchst intime Angelegenheit. Der Schreibtisch ohne Dichter, Jahre später, wird dann zur öffentlichen Stätte. Er findet sich in der Regel in sogenannten Geburts- und Sterbehäusern, also Museen, und wartet dort auf Besucher.
Im E.T.A. Hoffmann-Haus am Bamberger Schillerplatz, Dachgeschoss, gibt es zum Beispiel das sogenannte „Poetenstübchen“, das der Autor, Komponist und Zeichner einst selbst so benannte. Wir, die Stipendiaten des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia, erhalten eine Sonderführung von Professor Bernhard Schemmel, dem Leiter der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft. Insgesamt viereinhalb Jahre lang lebte Hoffmann in Bamberg. Er wurde dort weder geboren noch starb er dort, und doch gibt er selbst rückblickend seinen Bamberger „Lehr- und Marterjahren“, eine „ganz entscheidende“ Bedeutung in seiner Vita:
Hier, in den Jahren bitterer innerer und äußerer Not, reifte ich zum Dichter heran.
Das Poetenstübchen ist möbliert mit Bett und Pianoforte, und direkt unter der Dachschräge steht der Schreibtisch, der allerdings, wie die gesamte Einrichtung, kein Original ist, ja, nicht einmal der Nachbau des Hoffmann’schen Schreibtischs, da man nicht weiß, wie dieser aussah. Schemmel erzählt, er habe den Tisch anhand einer Skizze Hoffmanns, die ihn arbeitend zeigt, nachfertigen lassen. Eigentlich wisse man ja genauso wenig, wo im Poetenzimmer sich das Schreibpult befunden habe. Da jedoch das kleine Fenster, durch das die Katze den Schreibenden nachts gerne besuchte, mehrfach bei Hoffmann beschrieben wird, geht man davon aus, dass der Tisch so richtig steht.
So habe ich also ein Bild des schaffenden Hoffmann im Kopf, als ich das Museum verlasse: ein kleiner Mann zwischen vielen leeren Weinflaschen, der mit schier unerschöpflicher Energie winzig kleine, kalligrafisch schöne Manuskriptseiten bedeckt. Besucht habe ich eine Stätte dieser Abwesenheit.
Eine Wohnstätte ehemals, aber damals schon mit allen Implikationen der Unbehaustheit. E.T.A. Hoffmann, so berichteten seine Nachbarn, hätte sich, während er dichtete, leicht in eine Furcht vor seinen eigenen Gestalten hineingesteigert, so lebendig erschienen sie ihm, und dann suchte er Trost bei seiner Frau. Nachts um zwei oder drei Uhr, eine Kerze in der zitternden Hand, sei der Dichter oft den dunklen Hang die Altenburg hinabgegangen, erzählt wiederum eine andere Quelle – wie eine Spukgestalt habe er gewirkt.
Wolfgang Hilbigs unheimliches Gedicht „stätten“125 fällt mir ein,
stätten gibt es – schamlosen sterbens voll – doch wer
der sich empörte soll hier leben
In dem höchst lesenswerten Band Hilbigs Bilder findet sich eine Interpretation Jan Röhnerts zu diesem Gedicht, das zu einer Federzeichnung von Urs Graf entstand.126 Röhnert weist auf die interessante Semantik und Etymologie des Wortes „Stätten“ hin. Eine „Stätte“, schreibt er, „bildet das Domizil dessen, der zur Abwesenheit verdammt ist.“ Hilbigs Werk scheint ausschließlich von solchen Stätten der Abwesenheit zu handeln, das wahrnehmende Ich wird von ihnen gleichsam durchdrungen und aufgelöst. Oder ist es umgekehrt, handelt es sich um die nach außen gestülpte Leere des Individuums, stellt der es umgebende Raum aus Nebel, Rauch, Industriegerüchen und archaisch-utopischen Ruinen nur ein hübsches Ablenkungsmanöver dar? Hilbigs Arbeitsplatz jedenfalls bleibt für mich immer mit dem rauchigen Kämmerchen des „Heizers“ aus seiner Erzählung verbunden: ein aus Wahrheit und Fiktion zusammengesetztes Fantasiebild, wobei ich den Schreibenden und das beschriebene Papier in unmittelbarer Nähe eines lodernden Feuers platziere, praktisch brennend. Ich stelle mir vor, die latente Bedrohung durch das archaische Feuer zittere in jedem Satz des Autors nach. Im Heimatmuseum Meuselwitz bei Leipzig, wo Hilbig herstammt, gibt es meines Wissens keinen Schreibtisch, aber wozu auch, in diesem Fall? Der Autor und sein Werk sind Chiffre für Unbehaustheit geworden. In den Aufsätzen in Hilbigs Bilder, die sich mit dem Verhältnis des 2007 verstorbenen Autors aus der ehemaligen DDR zu einzelnen Kunstwerken sowie der Bildlichkeit seiner Texte beschäftigen, finden sich dazu bestechende Lesarten.
Ist das Arbeitszimmer des Dichters dann die Stätte par excellence? Röhnert nennt „Stätte“ den Ort, wo man nie wirklich heimisch ist, denn ihre Berechtigung ergibt sich eben nur aus dem Umstand, dass es den anderen, „richtigen“ oder „wahren“ Ort, an dem „man“ tatsächlich zu Hause sein könnte, gar nicht (mehr) gibt und (noch) nie im Leben gegeben haben mag. Die Stätte ist das Substitut eines Ortes, zu dem das Ich keine organische Beziehung, keine innere Verwandtschaft aufbringen kann – „das vorübergehende Domizil eines Subjektes, das zu ewiger Vorläufigkeit und dauernder Unbehaustheit geboren ist“.
(…)
Silke Scheuermann, aus Silke Scheuermann: Und ich fragte den Vogel. Lyrische Momente, Schöffling & Co., 2015
FÜR WOLFGANG HILBIG
IN DEUTSCHLAND GIBT ES KEINE DICHTER MEHR.
Der letzte hat die Weiber mitgenommen.
Ein Kesselhausfasan ist mitgeschwommen,
Auf einer Badewannenschnur aus Teer.
Er konnte sogar Puppen niederschlagen,
Im Schaufenster, auf Kellertreppenresten.
Es gab genügend Gleisbetten im Westen,
Granit und Pisse, leere Speisewagen.
Er hat jetzt Wasserweiber in den Knochen.
Sie fahren Lift und tanzen sich zugrunde.
Ich nehme Brasch und Born mit, als Vertraute.
Auf Bahnhöfen hat er das Meer gerochen.
Ich lieb nur wenig Dichter: nie gesunde,
Und den Geruch nach Schotter, Jod und Flaute.
Thomas Kunst
UM DIE HÄUSER, MEIN FREUND
für Wolfgang Hilbig
I.
Auf den Straßen streunende Jungs
in kurzen Hosen trotzen dem Winter
den wir die Hänge hinabrollen spüren
wir räumen die Gläser vom Tisch
die Flaschen werden verschenkt an alle
denen wir blau aus den Mündern quellen
in diesen Kneipen wischt der Wirt die Stadt
vom Tresen die achtlosen Tränen darunter
die Bierdeckel weichen mithin die Strichlisten
am Rand: fünf sind voll und niemand bringt
den anderen nach Haus man macht sich längst
nichts mehr vor und weiß man ist sicher
bis die Kneipe schließt.
II.
Komm zieh deinen blauen Anzug an
sobald die Laternen die Lichter schließen
und die Müllabfuhr schon auf den Beinen
deine Schätze sortiert ist unsere Zeit
fallen wir durch die Kneipen mein Freund
du stürzt durch die Pfützen so irre dass ich mir
den Kopf breche am Dunkel von dem du jaulst
dass es dich höhle und du ganz jenseitig wirst
glaubt keiner den geplatzten Adern schreiben alle
ein Unglück zu dem du hättest weichen können
zwischen den Grenzen in deinem Pass steht es
eindeutig du wusstest nicht wohin gehen
was du weißt schreibst du auf: leb wohl.
III.
Du hast mich in dein Zimmer gesperrt
so kahl hier sind alle Dinge vorausgestorben
so kahl an deine Wände hänge ich Bilder
die ich heimlich von dir machte: ein Seefahrer
gebeugt über die schiefen Wörter der Schreibtisch
kentert in deiner zerhausten Bude darauf ein Becher
in dem du dein Gewicht in Asche messen kannst
vor deinem Fenster steigt der Pegel und ich gehe
so weit ohne zu wissen unter welchem Himmel
so weit du nun deine Füße strecken kannst
suche ich die schönsten Friedhöfe ab und lese
die Inschriften den Toten vor sage ihnen
daraus hättest du etwas gemacht.
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Katrin und Volker Hanisch: Gespräch über Wolfgang Hilbig
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, 3.8.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Interview + KLG + IMDb +
YouTube + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die WindeDie Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003
Keine Antworten : Wolfgang Hilbig: abwesenheit”
Trackbacks/Pingbacks
- Wolfgang Hilbig: abwesenheit - […] Klick voraus […]









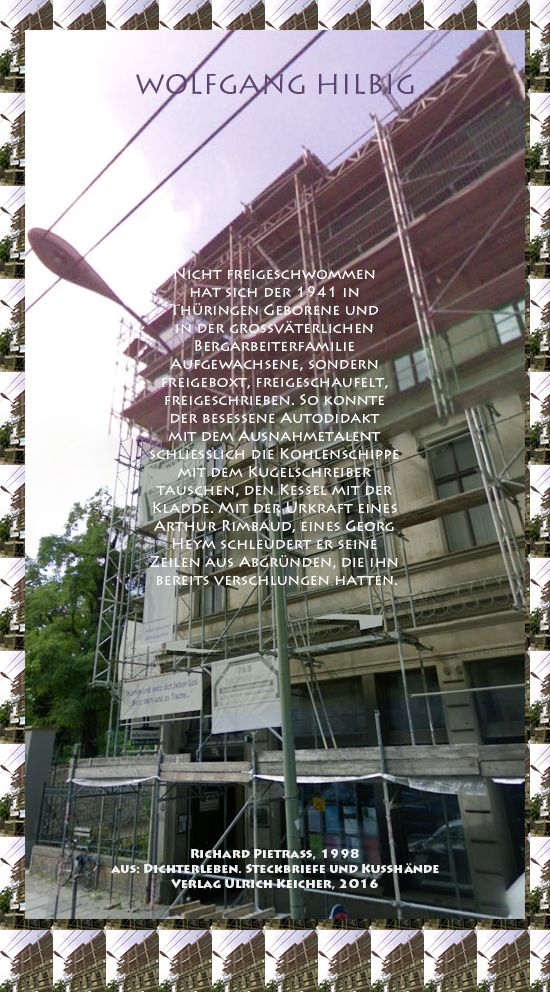












Schreibe einen Kommentar