Wolfgang Hilbig: Bilder vom Erzählen
DER ZUFALL
Gedicht zu meinem 60. Geburtstag
So viel der Guten hab ich überlebt – Erbarmen!
Daß ich mir Jahre nahm die ihnen zur Vollendung
aaaaafehlten −
so viele Todesstunden überstand ich und aus keiner
hinterblieb ich weise
aaaaaaaaaaaaaaaaaniemals lernt ich draus auf meiner
aaaaaBahn.
Nicht ich bin einer jener nachtverwehten Armen
die tauben Ohrs die Welt verließen schweißbedeckt und kalt
die Oberwelt:
aaaaaaaaaaabin keiner dieser schönen allzu früh Entseelten −
ich blieb zurück und nach mir schlug der Wahn…
auch er schlug fehl: ich bin des Zufalls schiere Ungestalt −
und nun müßt Ihr mich überstehn: erbarmt euch meiner!
Traumbuch der Moderne
− Wolfgang Hilbig im lyrischen Gespräch. −
Nicht jeder, den die genaue und zugleich wilde Welt seiner Prosa fasziniert, weiß, daß Wolfgang Hilbig als Lyriker debütierte: nämlich 1979 mit dem Band abwesenheit. Dieses Buch machte seinen Verfasser in der DDR zur Unperson: Es trug ihm einige Wochen Haft und ein Verfahren wegen Devisenvergehens ein. Die Gedichte des ehemaligen Bohrwerkdrehers und Heizers malten expressive Bilder der Entfremdung. Sie drückten aber auch Hilbigs Willen zur Unabhängigkeit aus. „ihr habt mir ein haus gebaut“, hieß es in einem dieser Gedichte, „laßt mich ein anderes anfangen.“
Doch aus diesem Haus wurde nichts. Der DDR-Bürokratie war der Dichter unbequem geworden. 1985 konnte Hilbig in die Bundesrepublik übersiedeln. Sein im Jahr darauf erschienener Band versprengung kulminierte in Chiffren von Auflösung und Regression, aber er führte auch an die Grenzen von Hilbigs lyrischen Möglichkeiten. Der düster pathetische Ton ließ sich nicht unendlich fortschreiben. Routine drohte, und der Lyriker griff zur Selbstbezichtigung:
das wort lyrik
das so lauwarm lullt sekundärpoesie.
Was Resignation schien, war schon Rettung: Hilbig hatte die erzählende Prosa als Möglichkeit der Selbst-Objektivierung entdeckt. Er delegierte seine Zweifel und Verzweiflungen an die Gestalten seiner Erzählungen und Romane. Etwa an die Spiel- und Spiegelfigur W., die uns im Roman Ich (1993) in die Labyrinthe der Stasi führt. Seinem bisher letzten Roman Das Provisorium (2000) gab Hilbig ein Motto von Strindberg. Darin ist vom Opfer der Biographie und der Person die Rede, aber auch von der Möglichkeit, das Leben „von allen Seiten“ zu sehen:
Das versöhnte mich mit dem Unglück, und es lehrte mich, mich selbst als Objekt aufzufassen.
Nun ist Hilbig nach fünfzehnjähriger Pause zur Lyrik zurückgekehrt. Der sechzigste Geburtstag mag den Anlaß zu einer lyrischen Lebensbilanz gegeben haben. Ihr Titel Bilder vom Erzählen scheint eine Referenz zur Arbeit des Epikers zu liefern. Eines der Gedichte heißt „Nach der Prosa“, doch aus ihm spricht durchaus nicht der Stolz des Erzählers Hilbig, sondern Desillusion und Verzweiflung:
Nun bin ich alt und in den Staub geworfen
Aller Gesang gesungen und zu grauser Asche ward mein Vers.
Hilbig spricht als Lyriker und von Lyrik – fast so, als hätte es seine Erzählprosa nie gegeben.
So erstaunt nicht, daß auch im Titelgedicht „Bilder vom Erzählen“ vom Erzählen nicht die Rede ist. Der Dichter überläßt sich dem Sog der Bilder. Sein hymnisch-elegischer Text evoziert das Meer. Es fasziniert ihn womöglich deshalb, weil es nicht zu erzählen ist:
Niemand weiß etwas zu sagen vom Meer.
Doch am Schluß erscheint ein schwarzer Mystagoge, ein riesiger amerikanischer Rabe:
Wer bist du? so schien er mich zu fragen. – Und ich fragte ihn ein Gleiches.
Dieser Mystagoge, der sein Geheimnis verbirgt, mag von Edgar Allan Poe abstammen. Ihm nämlich galt seinerzeit in versprengung die Frage:
war das gedicht der rabe von e.a. poe not
wendig?
Offenbar schon. Denn Hilbig kommt in diesen späten Gedichten erstaunlich oft auf die klassische Moderne zurück. In dem Gedicht „Die Zisterne“ heißt es rührend ungeschickt:
Einmal ihr Musen noch blättern
im Traumbuch der Moderne.
In dieses Traumbuch gehört auch ein anderer Erzvater, nämlich Ezra Pound. Das Langgedicht „Saturnische Ellipsen“ kreist um ein Zitat aus Pounds „Canto I“, aber gleichsam in negativer Absicht, wie Hilbig in einer Anmerkung erläutert:
Die Stelle wird hier zitiert (und später entstellt zitiert) aufgrund ihrer Zusammenhanglosigkeit mit dem Text, in dem sie erscheint.
Solch ein Dementi ist natürlich ambivalent: der Leser stellt den negierten Kontext für sich her. Und sei es, indem er Hilbigs Entstellung von Pounds Text realisiert.
Odysseus-Pound bricht auf, um Ithaka wiederzufinden. Ziemlich zu Anfang heißt es:
Came we then to the bounds of deepest water,
To the Kimmerian lands, and peopled cities
Hilbigs lyrisches Alter ego, das vermeint, in einer Stadt zu sein, die es nicht mehr verlassen kann, operiert mit der Negation: aus Pounds „peopled cities“ werden „unpeopled cities“ – also offenbar solche, die den Aufbruch nicht lohnen. Hilbig wird keine Odyssee schreiben. Aber seine poetische Abendphantasie hat einen großen und reichen Ton.
Die Bilder vom Erzählen sparen den Epiker Hilbig aus. Seine erzählerischen Arbeiten, die ihn doch berühmt machten, scheint der Sechzigjährige hinter sich zu lassen wie verbrannte Schiffe. Spielend und anspielend ergeht er sich im Traum- und Musterbuch der lyrischen Moderne. Selbst wo Hilbig eine Formel für sein eigenes Leben sucht, bemüht er einen der Alten Meister, nämlich den Eliot der „Four Quartetts“: „Ein Spott / mein End gewirkt in meinen Anfang“. Man möchte dem Dichter, der sich in bitterschönen Bildern von Zweifel und Resignation ergeht, eine Zeile vorhalten, die er selbst als groß bezeichnet:
Das Eisen selbst sucht sich den Mann.
Diese Zeile gilt auch heute, wo es wenig aussichtsreich scheint, sich an den großen Schmieden zu messen.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.11.2001
Anwesend!
− Wolfgang Hilbig zum 60. −
Der Gedichtband, für den Wolfgang Hilbig 1983 den Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau erhielt, trug den Titel abwesenheit. Die Behörden der DDR haben den unbequemen, zornigen, nicht mehr ganz jungen Mann, der doch ihr Vorzeigearbeiterdichter hätte werden können, mit einem Ausreisevisum beschenkt, dennoch war abwesenheit so wörtlich und so eindeutig nicht zu nehmen, wie manche seiner Freunde und Gefährten taten, weil sie Hilbig wieder anwesend wissen wollten.
Es sind freilich vor allem seine unverwechselbaren Prosaarbeiten, die seinen Ruhm begründet haben, so die Alte Abdeckerei, um nur ein Buch beispielhaft zu erwähnen. Doch immer wieder schrieb Hilbig, sparsam, Gedichte, ein Traumwandler auf einem alten Fabrikhof, auf einem schmalen Stück Erdoberfläche, das in die tiefen Wüsten der Tagebaubrüche abzugleiten droht.
Traumwandler zeichnen sich kaum durch intensive Anwesenheit aus: Sie sind abwesend, wenn sie da sind. Man muss sich fragen, ob Hilbig in seiner Autorschaft sich selbst als „abwesend“ erfährt oder ob nicht vielmehr die Abwesenheit von Wirklichem ihm als eigentliche Wirklichkeit erfahrbar wird.
Gegenwärtigkeit schimmert auf im Entschwinden, in dem sie erst fassbar wird.
Solches scheint auch für den neuen Gedichtband zu gelten, der höchst sorgfältig ausgestattet, mit Radierungen von Horst Hussel versehen, zum 60. Geburtstag Hilbigs, gewissermaßen als Geschenk des Verlages erscheint. Das heißt nun beileibe nicht, dass der Verfasser sich wiederholt. Einsame Tätigkeit ist ihm offenkundig wichtiger als das zweifelhafte Vergnügen, dem Publikum ständig präsent zu bleiben. Es spricht sich in den Gedichten ein merkwürdiges Halb-Bewusstsein aus, das von Entgrenzungen und mythischen Erinnerungen gekennzeichnet ist, aber auch das Fremdwerden von Erinnerungen noch wahrnimmt. Zugleich hat sich der Ton verändert. Die rhythmische Festigkeit erlaubt rhythmische Brüche, die vielleicht nur den Zweck verfolgen, das Glatte und Gefällige zu vermeiden:
Ohne Erinnerung und ohne Grund
der Götter Zeichen gleich Worten die wir flüchtig
kannten
fügten sie ihre Spur der Oberfläche zu und stiegen dann in Höhen auf wo Tage still
verbrannten
und weiter – vogelgleich mit ihresgleichen – einem
Dunkel zu.
Das ist weit weg von der gleissenden Geschwätzigkeit und gesuchten Künstlichkeit mancher zeitgenössischen Viel-Dichter: Ach der ganze Garten überschwemmt vom / Mond – / und Schwärme von Fischen am Weg / wie Federn leicht wie zuckende Klingen im Licht. Ob sich der, welcher sich in diesen Gedichten zu vergewissern sucht, nicht bereits abhanden gekommen ist, wird zur schmerzhaften Frage. In manchen Augenblicken scheint es nur die Obsession des Schreibens noch zu geben. Auch nicht schreibend scheint, wer hier spricht, noch schreibend tätig zu sein. Nicht selten nimmt er vorweg, was eintreten wird.
Es kommt zu Szenen, die konzentriert viel von dem enthalten, was die Prosa Hilbigs an markanten Stellen so unverwechselbar macht:
Ach meine Zeit ist um −
war schon vorbei als ich zum ersten Mal von ihr
gehört −
kann nicht mehr fort aus dieser Stadt wo ich nie
eintraf…
Verbrauchte Zeit, verbrauchtes Dasein, Szenerien überwucherten Verfalls, die motivischen Entsprechungen zur Erzählprosa sind unverkennbar, und auch insofern haben wir es hier mit Bildern vom Erzählen zu tun. Es bleibt nichts als ein träumend Salz, von dem Welle einatmend sich zurückzieht: ausatmend wiederkehrt. Wovon also soll einer erzählen? Unruhe durchzittert als Frage diese Verse. Selten sind die kurzen Momente des vollkommenen Ausgleichs:
O dieser Augenblick im Gleichgewicht der den
Atem anhält
bevor das Bild kentert.
Wer spricht eigentlich? Von nur subjektiven Einsichten, Erfahrungen, gar Empfindungen kann die Rede nicht sein. Ein poetisches Ich wird in seinen Gefährdungen sichtbar Vergeblichkeit droht. In diesen Gedichten ist von überpersönlichen Erfahrungen die Rede, hin und wieder sind es aber auch Erfahrungen, die der Schreibende schreibend erst gewinnt. Zum 60. Geburtstag schreibt Hilbig auch ein Gedicht für sich und nennt es „Der Zufall“. Es endet mit den Versen:
Ich blieb zurück und nach mir schlug der Wahn…
auch er schlug fehl: ich bin des Zufalls schiere Ungestalt –
und nun müsst Ihr mich überstehn: erbarmt euch meiner!
Dem Leser wird die Mühe langsamen, geduldigen Lesens abverlangt. Aber er wird belohnt. Das Geschenk, das der Verlag dem Autor macht, wird zum Geschenk des Autors an seine Leser.
Ralph-Rainer Wuthenow, Die Zeit, 30.8.2001
Bilder vom Erzählen: Die Geburt eines Schriftstellers
Wolfgang Hilbig ist der einzige unter den bedeutenden zeitgenössischen deutschen Autoren, der noch nicht den Büchner-Preis bekommen hat. Nichts kann das Fragwürdige von Gremienentscheidungen, von Abstimmungsmodalitäten besser verdeutlichen. Prosastücke wie Alte Abdeckerei oder Die Weiber gehören zu dem Wenigen, was von der Literatur des letzten Drittels des letzten Jahrhunderts wirklich Bestand hat. Hilbigs Sprachmächtigkeit, seine expressiv auflodernden Endzeitgemälde des verrottenden DDR-Sozialismus haben keinen Vergleich. Dass er, obwohl er alle anderen Preise schon längst bekommen hat, den wichtigsten nicht erhielt, mag daran liegen, dass er mit den Medien nicht kompatibel ist.
Er ist kein Mann für Podien, kein Mann fürs öffentliche Räsonieren. Leben und Schreiben sind für ihn auf eine Weise verbunden, wie sie sonst nur noch in der Literaturgeschichte aufzufinden ist. Hilbig ist der letzte naive deutsche Dichter, im ursprünglichen, Schillerschen Sinne.
Sein Verlag hat ihm und auch seinen Lesern zum 60. Geburtstag in diesem Jahr ein repräsentatives Geschenk gemacht. Mit filigranen Radierungen von Horst Hussel, die das Ganze umgarnen und in seiner Rätselhaftigkeit visualieren, sind hier dreißig neue Gedichte Hilbigs versammelt. Nach der tabula rasa mit dem Roman Das Provisorium im letzten Jahr sind dies die ersten neuen Texte des Autors: im Provisorium hatte Hilbig zum ersten Mal fast unverhüllt autobiografisch geschrieben und die Verankerung seiner bisherigen literarischen Existenz außer Kraft gesetzt. Mit diesem Gedichtband kehrt Hilbig nun zu den Anfängen zurück: seine erste Buchveröffentlichung war 1979 der Gedichtband Abwesenheit, der nicht nur programmatisch das Selbstverständnis eines DDR-Schriftstellers aufkündigte, sondern vor allem in seiner Sprache etwas völlig Losgelöstes hatte. Hilbig knüpft jetzt an diese Geburt eines Schriftstellers in der DDR wieder an, die rein aus der Schrift heraus erfolgte, unbeeinflusst von den literarischen Diskussionen ringsumher. Das Expressionistische spielte für Hilbig eine große Rolle, Rimbaud, der Surrealismus.
Der Titel des Gedichtbandes allerdings kündet von einem Paradox: Bilder vom Erzählen. Hilbig vermischt die Gattungen, und das Erzählen, das er mit dem Provisorium an einen End- und Höhepunkt getrieben hat, holt ihn jetzt als lyrische Anrufung wieder ein. Das titelgebende Gedicht unternimmt mehrere Anläufe, um das Meer zu beschreiben – das Meer, das auf anonymen Hotelfernsehern aufflimmert, vornehmlich nach Sendeschluss, verstellt zunächst den Blick auf das reale Meer hinter den Gardinen, es wird verstellt von Wörtern und vom Bewusstsein, bis sich langsam, in kurzen Schüben, ein poetischer Rhythmus einstellt, der sämtliche Fragen wieder aufhebt.
Diese Gedichte sind tastende Versuche, an etwas anzuknüpfen, was lange Zeit liegengeblieben war, durch Prosa verdeckt: Hilbigs schwarze Romantik irrlichtert in diesen Zeilen, die gelegentlich auch wieder das Expressive zitieren und es mit einem fragenden Unterton versehen; es bleibt ein dissonanter Nachhall. „Nach der Prosa“, heißt so ein Gedicht: „Nun bin ich alt und in den Staub geworfen“…, und die alte, lyrische Sprachmächtigkeit hebt wieder an, etwas Existenzielles zu umreißen, das neu scheint, aber doch die alten Fährten wieder aufnimmt.
böt, Der Tagesspiegel, 6.10.2001
„Einmal noch den trüben Spiegel plündern
ohne Selbst und ohne Sendung“
− Zu Wolfgang Hilbigs Gedichtband Bilder vom Erzählen. −
Seit damals vor über zwanzig Jahren, als ich den Leipziger Luxemburg-Turm bestieg, um mir bei Lutz Nitzsche seine abwesenheit für ein paar Tage anzueignen, bin ich süchtig nach Gedichten von Wolfgang Hilbig. In seinen Versen funkelten „hauchdünne worte einer halbbewußten / trostlosen sprache“, die Poesie der Wartesäle, absurdes Auflachen im Abwinken:
wenn der bahnhof abfährt seht uns trinken
gefangenschaft trinken aus schmutzigem glas
trinken bis der teufel kommt sprechen
zu keinem und alternd noch immer
Die Faszination erwuchs nicht zuletzt aus der Fallhöhe zwischen gnadenlos-genauer Zeichnung all der zerbröckelnden, vermodernden Örtlichkeiten und dem infernalischen Phosphorlicht der Bilder, die Hilbig ihnen entgrenzte. Die allerdings brannten sich ins Gehirn und hatten die Eigenschaft, in bestimmten Wahrnehmungssituationen Kurzschlüsse auszulösen, die mit dem Schlag, den sie erteilten, auch eine leichte Trance ermöglichten. Zu diesen merkwürdigerweise sehr haltbaren Ritzungen in meinem Gedächtnis gehört eine mit quitschendem Geräusch vom Wind hin und her geschaukelte Lampe über dem provisorischen Appellplatz eines winterlichen Armeefeldlagers, gehört die in den Novembersmog geschluckte Riebeckstraße im Leipzig der achtziger Jahre, gehört das schmutzige Fahllicht zwischen sächsischen Braunkohledörfern, das morgens um vier aus dem Zubringerbus zum Tagebau, wohin man mich als Hilfskipper von der Universität abkommandiert, zu sehen war: Jähe Memento mori, fröstelnde Winke der Verkommenheit, der Vergeblichkeit, und doch immer auch bestimmt durch ein so grelles Aufleuchten geschundener Schönheit, dass es schmerzte. Diese engrammatischen Eindrücke verdanke ich vermutlich nicht unwesentlich den Texten Wolfgang Hilbigs, die fortan durch die Jahre begleiteten.
Und jetzt also ist ihr Verfasser Jubilar, und zum 60. liegt ein fein gemachter Band mit neuen Gedichten und filigranen Radierungen des genialen Horst Hussel unter dem scheinparadoxen Titel Bilder vom Erzählen vor, und sofort ist es wieder da, dieses Gleißen. Wenn es Hilbig in der Prosa stets schon weniger um das Erzählen einer Geschichte denn um das genaue Heraufholen von Atmosphären angelegen war, dann flutet er in den Gedichten den Raum des Eingedenkens mit Bildern. Dass die sich verwirbelnden, strömenden Bilderfluten ihrerseits Raum brauchen, mag dazu bewogen haben, das Fließende als Akt des Erzählens anzuempfehlen. Das nun wäre tiefgestapelt, bezöge es sich auf die moderne Gattung Prosa. Vielmehr ist es ein Erzählen der Bilder, das durchlässig ist für ältere Arten des Erzählens, das antike Epos etwa, und orientiert an den Grenzentwürfen der lyrischen Gattung im 20. Jahrhundert, den Cantos Ezra Pounds oder T.S. Eliots The Waste Land. Und der Titel eines so bewegenden Gedichts „Nach der Prosa“ führt sowieso in die Irre, denn es zieht in einem der schrecklichsten Momente im Leben eines Dichters, wenn eine lange, quälende Prosaarbeit (Das Provisorium) abgeschlossen ist, Bilanz.
…
ich hörte mich singen schluchzend zwischen den Lichtern
der Sterne: die mir zu Füßen lagen wüst verstreut
wie Trinkgeld in der Spelunke des Dunkels…
Nun ging ich aufrecht: eine Nachtviole war mein Ziel
und wankte doch – ein einzig falscher Schritt wars bloß –
dir wollt ich eine Blume pflücken und ich fiel
der Erde in den Schoß.
Es ist eine Selbstkasteiung, die an Grausamkeit noch gewinnt, weil die Rede an ein Du gerichtet ist. Aber was für Bilder unerhörter Schönheit findet Hilbig dafür:
Sterne: die mir zu Füßen lagen wüst verstreut
wie Trinkgeld in der Spelunke des Dunkels…
Es sind Epiphanien der Heillosigkeit, Labyrinthe der Zermarterung, „Saturnische Ellipsen“, die mit schier alttestamentarischer Wucht Wort werden. Dieser hohe, pathosbestimmte Ton gehörte immer schon zu den Erkennungszeichen Hilbigscher Poesie – man denke nur an Großgedichte wie „Das meer in sachsen“ −, und er hat an Eindringlichkeit eher gewonnen. Dieser Eindruck rührt von einem komplexen Geschehen auf unterschiedlichen Sprachebenen her. Gestisch ist Wolfgang Hilbig meines Wissens der einzige deutschsprachige Lyriker der ersten Reihe, der Interjektionen wie „O“ und „Ach“, also Ausrufezeichen höchster Not, höherer Klage, hohen Erstaunens ohne Ironie in seine Gedichte stellen kann. Das ist in der nachexpressionistischen Dichtung ein Vabanque-Spiel geworden, zu leicht kippt Pathos in die Groteske. Mehr noch, es werden Gebetsformen wieder aufgenommen, gleichsam als „Palimpseste auf dem Licht von gestern“:
O Herr was suchten mich die alten Götter heim?
Die lange schon entmachteten Gestalten: was sahn sie vor für mich
in jenen Zeiten vor der Zeit und was an Jahren
war für mich errechnet?
Auf lexikalischer Ebene fällt auch im neuen Gedichtband die Konzentration auf Topoi der erhabenen Naturerscheinungen und der Urelemente auf – das Meer, das Gewitter, die Wüste, der gestirnte Himmel, Wasser, Licht, Dunkel, Schatten, Feuer – aber: der Mond ist nackt, die Sterne frostig, der Regen betäubend, das Licht bitter oder „wie von Aschen“. Wahrlich, die Befunde fallen nackt, frostig, bitter auf den Sprecher zurück. Und das Ich, in den Stimmen des Odysseus, Hiobs, Ahasvers, das ist vor allem „Bruder der Nacht, der in schattenloser Finsternis das Unsichtbare suchte“. Auf der Schwelle zum Unsagbaren, Unsäglichen auch, erzählen die Gedichte von einem Kämpfen gegen den Sog der Vergeblichkeit, gegen das Verdämmern der Worte und das Sich-Entfernen der Kindheit: „O Kindheit… ein Alluminiumteller wars im Küchenlicht / daran er mich erinnerte der Mond“, aber „jener Mond mit seinem Grabgeruch in seiner welken Blöße / mit mir gealtert und vergangen…“ Syntaktisch schließlich fallen besonders die anaphorischen Reihungen, das geradezu hämmernde Insistieren ins Gewicht:
Ich schlief mit dem Regen bis tief in den Abend
ich schlief und schlief: niemand der schlief…
ich schrieb im Schlaf und ich schlief im Traum:
und bis zum schwefelgelben Saum
am Horizont der Kindheit träumte ich den Traum.
(„Increatum“).
Gestus, Lexik, Syntax – nun gut, das sind so Beschreibungsmomente; doch wie erklärt sich, warum dieses Pathos der Verzweiflung, auch des Scheiterns gänzlich unpeinlich ist, ja Bewunderung bei Dichterkollegen, Freunden und Kritikern erheischt? Natürlich ist es die Kunstfertigkeit, mit der Hilbig aus diesen Momenten jenen Sog zu erzeugen vermag, den Adolf Endler treffend mit dem Poeschen Maelstrom verglichen hat. Beispielweise, wie er, ohne die Grundgebärde zu verändern, surreale Bildkorrelate in das Sprechen einschließt und ihnen damit den Schein größter Selbstverständlichkeit verleiht. Franz Fühmann hatte in seiner Rede auf Hilbig „Praxis und Dialektik der Abwesenheit“ anhand des berühmten Gedichts „episode“ aus dem Jahre 1977 auf diese Eigenart aufmerksam gemacht. Auch im neuen Band stehe ich staunend vor Gedichten, in denen Imagination als Wahrnehmung an die Sprache übereignet wird. So beginnt „Aqua alba“ mit den Versen:
Ach der ganze Garten überschwemmt vom Mond –
und Schwärme von Fischen am Weg
wie Federn leicht wie zuckende Klingen aus Licht.
Wenn Hilbig 1981 vor DDR-Hintergrund in die realismusgeschädigte Runde fragte war das gedicht der rabe von e.a. poe not / wendig, so schildert er nun im Titeltext des neuen Bandes die mystagogische Begegnung mit Poes „Nevermore“ in Gestalt eines „riesigen amerikanischen Raben.“ In mehreren Kritiken las ich, Hilbig knüpfe wieder an etwas an, „was lange Zeit liegengeblieben war, durch Prosa verdeckt“ (H. Böttiger). Ich denke eher, dass Wolfgang nicht an etwas anknüpfen musste, weil nie etwas aufgehört hatte zu arbeiten: Poesie ist für ihn immer grundsätzlich Daseinsform gewesen, mit all den Qualen und Ängsten, die solche Unbedingtheit einschließt. Es haben sich aber die Ahnungen von Endgültigkeiten schärfer in den Vers gebracht, härter der Aufeinanderprall von Begierden nach Schönheit, sinnnlicher Erfüllung und den unaufhörlichen Zerreisskräften, denen das Ich ausgesetzt ist, nicht selten in knappe Fügungen gegossen wie „traumgefesselt und verrückt“ oder „Steine und Schreie wuchsen in mich ein.“ Die Bedrohung durch Selbstverlust, die Kehrseite von Rauschverlangen, wird mehr denn je durch Objekt-Subjekt-Umkehrungen transparent, wenn das Ich als von den Dingen gepeinigt, bedrängt, beherrscht erklärt wird: „Das Eisen selbst sucht sich den Mann“; „Die Linden kamen auf mich zu wie torkelnde Skelette / schlugen nach mir mit Qualm und aufgespießtem Unrat“; „o dieser Augenblick im Gleichgewicht der den Atem anhält / bevor das Bild kentert“ „dort wo gewirkt aus bleichem Staub ein Wehen nach dir faßt“. Dieses Vortasten in die Grenzbereiche des Erfahrungs-Möglichen, den „Welten Rand“ war von Anbeginn das bestimmende Movens in Hilbigs Schaffen – man lese übrigens unter diesem Aspekt noch einmal die Eingangsszene seines letzten Romans – und dieses Ungesuchte beschwor er bereits in dem 1978 geschriebenen Gedicht „der poet und die wüste“. Wenn die neuen Gedichte Kunde von Reisen geben, so sind es bezeichnenderweise jene Orte der amorphen Magie, die zum Gedicht drängen: Meer und Wüste, Passagen:
O lasset mich des Lebens Ordnung tief verletzen –
selbst über Wüsten türmen Sterne ihren stumpfen Kreis
und stürmen kalt in ihren Grenzen und Gesetzen.
Genau hier bäumt sich ozeanisches Gefühl:
das Ungeformte kehrt zurück das Unterlassne
entsteigt dem grünen Überfluß der Stille –
und am Abend die Hügel hinter uns
bewachen im Schatten ihr Licht.
Und doch greift jede vorwiegend psychologisierende Betrachtungsweise wiederum zu kurz, denn sie fasst nicht die Intention, im weiten Rückgriff zu den Anfängen der „Zivilisation“ – ein gerade viel mißbrauchtes Wort – das Fehlgehende in dieser späten Zeit zu benennen. Denn Hilbig buchstabiert nichts weniger als die Träume, Entwürfe, Utopien der Moderne noch einmal durch, die, bevor sie sich einschwärzten, in den Romantikern und in Hölderlin den Menschentraum von Emanzipation und befreitem Leben wenigstens auf das Subjekt zurückbiegen konnten. „Einmal ihr Musen noch blättern / im Traumbuch der Moderne“ überschreibt Hilbig den Anfang von Hölderlins „An die Parzen“. Diese Ungeheuerlichkeit des Traums aber ist es, die Hilbigs einsames Gehen ins Unbegangne so beunruhigend leuchtend Gestalt werden läßt. Und wie die Kohlestifte in jenen alten Lampen finden die energische Beleidigung des Lebens und die Energetik der Bilder zueinander in einem unsteten Bogen gehärteten Lichts.
Peter Geist, neue deutsche literatur, Heft 2, 2002
Als wäre ich ein Schriftsteller
– Wolfgang Hilbig im Gespräch. –
Marie-Luise Bott: In Ihrem neuen Gedichtband Bilder vom Erzählen dominiert ein Metaphernvokabular, das immer wieder schon in früheren Gedichten zu beobachten war: Meer, Schiff, Salz, Wüste. Woher kommen diese Bilder?
Wolfgang Hilbig: Ich glaube, das sind Urwörter, also Wörter, die mit der Entstehungsgeschichte im weitesten Sinne zu tun haben. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der die Erde andauernd umgeschichtet wurde, Tagebaue und Abraumhalden entstanden. Und es war viel Wald in dieser Gegend. Also hatte man praktisch Bilder. Die Tagebaue soffen mit der Zeit ab und wurden von verschiedenen Grundwassern gespeist und waren teilweise sogar verschiedenfarbig. Die einen leuchteten gelblich, die anderen bläulich und dazwischen lagen weißgelbe Abraumhalden von Sand. Also hatte ich meine ganze Kindheit über Wüste, Wasser und Wald vor Augen. Das ist logischerweise so ein Ursprungsgefilde für mich. Aber wenn man Leser von moderner Lyrik ist, und das bin ich – ich lese meistens nichts anderes als Gedichte –, kann man diese Art von Metaphorik durchgehend in der ganzen Moderne finden. Das sind also teilweise auch Lektüreergebnisse. Wahrscheinlich geht es bei mir immer um Atmosphäre. Und wenn ich ähnliche Atmosphären bei anderen Lyrikern finde, könnte man Gift darauf nehmen, dass die mich beeinflusst oder bestärkt haben.
Bott: Nimmt man die Bilder vom Erzählen als Zyklus ernst, so ist das eine unhomerische Odyssee ohne heimatliches Ufer durch die Wüsten des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens. Spielt die Suche nach Heimkehr für die Figur dieser Odyssee eine Rolle?
Hilbig: Sie hat einmal eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, die Figur ist gerade dabei, sich von diesem Gedanken zu trennen, weil er immer sinnloser wird. Man kann Heimat als Schriftsteller nur noch in der Sprache finden, glaube ich. Der Autor für ehemalige DDR-Bürger wäre eigentlich William Faulkner, der ein mythisches Land mit einer ganzen Population von Leuten erschaffen hat, die niemals existierten. Und da die DDR genauso verschwunden ist, wie dieses Land für Faulkner verschwunden war, müsste es eigentlich neu erfunden werden.
Bott: Welchem Leitstern folgt diese Odyssee heute?
Hilbig: Zu einem Urzustand des Schreibens zurückzukehren, der vermutlich ursprünglich einmal bei mir dagewesen ist und jetzt zerstört wurde durch den Literaturbetrieb: durch die Veröffentlichungspraxis und die Entfremdung von den eigenen Texten, die man dauernd erfährt. Ich habe bis jetzt den Schiller-, den Lessing-, den Fontane-, den Huchel– und den Büchner-Preis bekommen. Also zu wem soll ich mich nun zugehörig fühlen? Das hat eine dauernde Entfremdung zur Folge, weil es einen aus seiner eigentlichen Bildwelt herauszieht und in eine andere hineinversetzt, die immer wieder dazwischenfunkt in die Gedankenwelt, die man als Lyriker hat.
Bott: Gäbe es nicht die Freiheit zum Rückzug aus dem Literaturbetrieb?
Hilbig: Das ist unmöglich. Da müsste man den Nobelpreis bekommen wie Günter Grass. Er kann das. Gut, wenn ich den Büchnerpreis bekomme, wird es erst einmal ein paar Jahre ruhiger werden. Ich bin heilfroh, wenn das vorbei ist. Dann bekommt man auch nicht so schnell wieder einen Preis. Dann werde ich Zeit haben, etwas zu schreiben. Die Verlage haben es natürlich gern, wenn man auf allen Hochzeiten tanzt, weil sie den Absatz der Bücher wollen, glauben, davon steige der Absatz. In meinem Fall ist das gar nicht so. Ich werde immer als intellektueller und schwieriger Autor von der Kritik dargestellt. Ich habe noch nie gut verkäufliche Bücher geschrieben, außer einem, ,Ich‘. Aber da war es ein Zufall, weil alle glaubten, es sei ein Buch über die Stasi, und das war damals gerade das große Modethema in der Presse.
Bott: Ein Gedicht der Bilder vom Erzählen, „Salz, das ich vergaß“, ruft die sprachliche Revolte im November 1989 in Erinnerung. Es ist aus dem Schluss Ihres Poems „Prosa meiner Heimatstraße“ herausgewachsen, das unmittelbar zur Wendezeit 1988–90 entstand. Es scheint, als wäre die Idee von Heimat für Sie um 1989 für kurze Zeit doch mehr als nur ein geistiger Ort in der Kunst gewesen?
Hilbig: Ich kann mich schon mit etwas identifizieren. Aber ich würde dazu nicht das Wort Heimat verwenden. Ich halte das für ein so stark belastetes Wort. „Prosa meiner Heimatstraße“ – den Ausdruck verdanke ich Gert Neumann – habe ich geschrieben in Rheinland-Pfalz, knapp neben dem Elsass. Da war nichts zu spüren. Man konnte sich informieren über die Massenmedien, aber mehr nicht. Ich habe eigentlich nicht teilgenommen an diesem Umbruch. Da ich unter westdeutschen Linken gelebt habe, war ich vielleicht früher gewarnt als andere über das, was da herauskommt. Ich hatte keine Gespräche mit Teilnehmern der Bürgerbewegung hier im Osten, sondern immer nur Gespräche mit westdeutschen Intellektuellen. Und denen standen die Haare zu Berge. Für sie war die DDR noch so etwas wie ein Abglanz von Hoffnung. Ihr Feind war ja der Konsumkapitalismus, der sie in eine Art weiträumige Gummizelle versetzt hat, einen nachgebenden Widerstand. Also ich habe damals mit solchen Leuten geredet und eigentlich viel mehr Skeptizismus erfahren über diese ganze sogenannte Revolution im Osten.
Bott: Das kann auch das Problem der westdeutschen Linken gewesen sein, die sich für die Wirklichkeit auf der anderen Seite ihres ideologischen Horizonts sehr wenig interessiert haben. Aber wie haben Sie den Umbruch empfunden?
Hilbig: Es ist das Problem der westdeutschen Linken gewesen, selbstverständlich. Aber ich bin damals mit diesen Leuten umgegangen. Ich war mit einer Frau verheiratet, die aus der westdeutschen Linken kam. Und es gab keinen unter ihnen, der von diesem Umbruch begeistert war. Wenn ich darüber gejubelt hätte, hätte man mir dort das Maul verboten. Ich habe es als eine Befreiung von dem Ungebilde DDR empfunden, das ich noch nie ausgehalten habe. Es war mir letzten Endes schon eine Genugtuung.
Bott: Im Gedicht „Nach der Prosa“ aus Ihrem neuen Band gibt es den Vers: „Kopfunter ging ich aus und liebte / lange zu wandeln im schwanken Grund der Himmel“. Sie zitieren da ein Bild aus Büchners Erzählfragment Lenz.
Hilbig: Ich weiß nicht so genau, ob ich jedes Mal an Lenz denke, wenn ich so etwas hinschreibe. Diese Art von Metaphorik bei Lenz ist so eindrücklich, dass sie einfach im Hinterkopf bleibt. Es ist fast eine frühe, von dem sehr jungen Büchner vielleicht gar nicht beabsichtigte surrealistische Metapher.
Bott: Sie steht für den beginnenden Wahnsinn des flüchtenden Außenseiters Lenz. Welche Beziehung haben Sie zu Georg Büchner?
Hilbig: Was mich am meisten beeindruckt hat bei Büchner, sind kurze Fragmente zum Woyzeck. Sie handeln davon, wie er übers Land geht und meint: „Alles unter mir ist hohl.“ Da habe ich Büchner richtig beneidet, wie ich das las. Wenn man in einem Bergbaugebiet aufgewachsen ist, spielt das eine Rolle: „Alles ist hohl.“ Die Lebensenergie hat man unter dem Fuß. Und diese Energie, die man zum Leben braucht, wird dem Boden, auf dem man geht, entzogen. Das ist eigentlich eine Absurdität. Sie wird einem so lange entzogen, bis man den Boden nicht mehr begehen kann.
Bott: Im Gedicht „Mond. Verlust der Gewißheit“ gibt es das Bild: „O Kindheit… ein Aluminiumteller wars im Küchenlicht / daran er mich erinnerte der Mond.“ Ist das auch die Atmosphäre des Märchens aus dem Woyzeck?
Hilbig: Ich habe dabei an etwas anderes gedacht: an Jakob Böhme. Es gibt dieses berühmte Erweckungserlebnis bei Marcel Proust, wie er die Madeleine in den Lindenblütentee taucht und ihm alles wieder einfällt. Das gab es viel früher schon viel besser bei Jakob Böhme, der in seiner Schuhmacherwerkstatt saß und auf einem Regal an die Wand gelehnt einen Zinnteller hatte. Dort ist ein Sonnenstrahl hereingefallen und hat plötzlich die ganze Wohnung strahlend erhellt. Und da ist Jakob Böhme aufgesprungen und hinausgegangen und hat einen Bewusstseinsstrom in sich verspürt, der ihn an alles wiedererinnert hat. Bei mir war’s ein billiger Aluminiumteller.
Bott: Die Bilder vorn Erzählen sind von einem großen Formenreichtum. Dass so etwas wie eine Reimode, „Die Zisterne“, im Deutschen noch gelingen kann, ist einfach erstaunlich.
Hilbig: Ich will die Form nicht verfallen lassen. Also ich sitze wahrscheinlich immer noch in einer Art angeschimmeltem Elfenbeinturm und will eigentlich, dass die Form nicht vergessen wird. Dass sich Lyrik von Prosa unterscheidet, das will ich.
Bott: Im Roman Das Provisorium dagegen hatte sich Ihre Sprache im Vergleich zu früheren Werken verändert. Zum ersten Mal begegnet hier die untere Stilebene, auch emotional-aggressive Umgangssprache. War das eine bewusste Entscheidung?
Hilbig: Ab irgendeinem Punkt war es eine Entscheidung, und zwar um Distanz zwischen diesen Er im Buch und mich selber zu bringen. Ich glaube, es ist das Buch, in dem ich am meisten und so ehrlich wie möglich zu schildern versuche, welche Atmosphäre mich umgibt, während die früheren Bücher viel reflexiver waren. In diesem Fall wollte ich wirklich aus einer gewissen Distanz erzählen. Das hat aber genau den Grund, dass es mein bisher autobiographischstes Buch ist, das ich geschrieben habe. Ich brauchte die Distanz. Meine eigene frühere Sprache misslang mir in diesem Buch. Also ich konnte mit diesem Buch nicht anschließen an frühere Texte. Eigentlich ist das Buch im Großen und Ganzen eine Metapher, nämlich für eine Figur, die sich provisorisch zwischen zwei Welten aufhält und in keiner richtig da ist.
Bott: War es ein Schock für „C.“, im Westen plötzlich nur noch Schriftsteller zu sein? Ihr Freundeskreis im Osten wusste, wer oder was alles Sie waren. Da gab es keinen Erklärungsnotstand.
Hilbig: Aber mir selber gegenüber hatte ich ihn doch immer, diesen Erklärungsnotstand. Franz Fühmann hat das hervorgerufen: Bist du verrückt? Deine Knöpfe drücken, das kann jeder. Aber das Schreiben kann nicht jeder. Wieso gehst du noch arbeiten? Das sagte mir Franz Fühmann eines Tages und besorgte mir eine Veröffentlichung in Sinn und Form. Und da bekam ich, aufgrund von ein paar Texten in Sinn und Form, eine Steuernummer und plötzlich war ich „freischaffender Schriftsteller“. Da kam mir die schon etwas bange Frage: Bin ich denn wirklich einer? Kann ich das überhaupt rechtfertigen? Da meine Entwicklung eigentlich in die andere Richtung zu laufen schien, obwohl ich immer geschrieben habe, schon als Kind, kam es mir doch immer so vor, als müsste ich mich verstellen und so tun, als wäre ich ein Schriftsteller. Und das ist ganz schwierig abzulegen, wenn man es jahre-, jahrzehntelang gemacht hat. Das wird fast zu einer Art Pawlow’schem Reflex. Das nimmt Platz in der Seele, die man hat. Das wird man nicht so schnell wieder los. Eigentlich habe ich mich bewegt und gelebt wie ein Arbeiter und müsste mich jeden Tag unter schweren Mühen in einen Schriftsteller verwandeln, der versucht hat, keine Brigadetagebücher zu schreiben, sondern artifizielle Texte. Und das kam mir immer wie eine Verstellung vor. Das konnte einfach nicht anders sein. Wenn man in einer Kleinstadt lebt, wohin soll man gehen und fragen: Bin ich Schriftsteller oder bin ich’s nicht? Wer kann einem das bestätigen? Niemand. Eigentlich muss man sich in einer Art von Gewaltakt selbst sagen: Du bist Schriftsteller. Aber man hat keine Beweise dafür. Nie gibt es dafür den Beweis.
Bott: Hatte ihn Gerhard Altenbourg, der unweit von Meuselwitz lebte und nicht mehr ausgestellt werden durfte?
Hilbig: Haben Sie schon einmal sein Haus gesehen oder seinen Garten? Ich habe es mir einmal ansehen dürfen. Also wenn der keinen Beweis dafür hatte! Er hat eigentlich inmitten eines Gesamtkunstwerks gelebt und war hoch anerkannt von allen möglichen Akademien. Gut, das bin ich inzwischen auch.
Bott: Altenbourg hielt vielleicht einfach für sich den Mythos „Maler“ hoch.
Hilbig: Ich glaube, das passiert bei solchen Leuten, die in einer Welt leben, in der es eigentlich keine Bezugspunkte gibt zu dem, was man tut. So ähnlich kann es bei mir auch gewesen sein. Es kommt ja in diesem Gedicht der Bilder vom Erzählen, „Der Garten von Gerhard Altenbourg“, nicht umsonst das Wort „Inzucht“ vor. Man hat natürlich das Gefühl, nur noch mit sich selber und aus sich selber so eine Art Leben zu produzieren.
Bott: Dem Provisorium vorangestellt ist ein Motto von Strindberg: Er habe seine eigene Biographie dem Werk zuliebe geopfert, damit er darin sein Leben von allen Seiten betrachte.
Hilbig: Es stammt aus Schwarze Fahnen. Das ist ein Roman der Jahrhundertwende und Das Provisorium auch, nur ist der 15 Jahre früher angesiedelt. Es gab eine Riesenwende, sie wird darin fast ein bisschen zu sehr am Rand thematisiert, nämlich Tschernobyl. Da ist der Welt plötzlich die Beherrschung dessen, was sie selber sich aufgebaut hat, aus den Händen geglitten. Inzwischen ist man dem Monstrum von Technisierung ausgeliefert, man beherrscht sie nicht mehr. Das ist die eigentliche Wende, die um die Jahrhundertwende von 1980 bis jetzt stattfand. Bloß wagt das niemand mehr auszusprechen, weil alle niedergeschrien werden mit dem Argument der Arbeitslosigkeit.
Bott: Geht es nicht im Roman, statt um das Opfern der eigenen Biographie, vielmehr darum, das Zerstörerische des eigenen Lehens durch die Darstellung von sich abzuwehren und zu entäußern?
Hilbig: Anlass des Buches ist, dass es eine bestimmte Zeit in meinem Leben gegeben hat, die ich selber nicht verstanden habe, die mir rätselhaft gewesen ist. Das ist fast immer bei mir der Anlass, einen Text darüber zu schreiben. Dann scheint sich mir das zu erschließen. Antworten gibt es zum Schluss doch nicht, aber zumindest einen Text!
Bott: Für nächstes Jahr sind Kindheitserzählungen von Ihnen angekündigt.
Hilbig: Es sind Kurzprosatexte, in denen ein Kind eine Hauptrolle spielt. Ich gehe einfach – wenn es eine gewisse Chronologie bei meinen Texten gibt – vor meine Anfänge zurück. Mich interessiert die Frage: Wie ist es möglich, Schriftsteller zu werden in der Situation, in der du gelebt hast? Inzwischen scheine ich es also nun zu glauben, dass ich Schriftsteller bin, das setzt dieser Satz voraus. Mich interessiert: Wie fängt man an zu erzählen oder Gedichte zu schreiben, was sind die Anlässe dafür? Es geht um eine bestimmte Atmosphäre, die ich noch glaube zu erinnern und die ich einfach nicht untergehen lassen will. Wenn es sein muss, wird vielleicht auch ein blaues Pionierhalstuch vorkommen, aber nicht unbedingt!
Bott: Kunst also als ein Weg, etwas zurückzuholen, was einem genommen wurde?
Hilbig: Etwas zurückzuholen! Was nicht wirklich funktioniert, weil sich beim Schreiben die Wirklichkeit, die es einmal gegeben har, verändert. Es ist eben ein Traumbild der Moderne, an dem man weiterhäkelt.
Bott: Im deutschen Idealismus ging man davon aus, daß der „Altersstil“ eines Schriftstellers in „Milde, Heiterkeit und Nachsicht“ bestehe. Das ist wohl kaum von Ihnen zu erwarten?
Hilbig: Ich könnte so etwas nicht erzwingen. Ich muss meinen Texten die Initiative dazu überlassen. Wenn sie aus mir herauswollen, dann muss ich sie so schreiben, wie sie es mir vorschreiben. Dass man dem so ausgeliefert ist, kann man schon mit einer gewissen Heiterkeit sehen und braucht nicht nur wütend darüber zu sein. Ich bin nicht unbedingt gegen Unterhaltung oder Leichtigkeit, das sind nicht meine Feindbilder in der Literatur. Ich bin gegen Anpassung an gewisse Strömungen, die uns vorgeschrieben werden. Aber meine Themen müssen nicht immer schwergewichtig sein.
Bott: Sie sagten einmal, wenn überhaupt, dann wollten Sie nur noch aus dem Abseits heraus und durch „Dauerhaftigkeit“ wirken.
Hilbig: Selbst daran zweifle ich heute sogar. Benn hat es einmal so ausgedrückt: Man wirkt nur über die Gene. Aber praktisch kann ich mir das nicht vorstellen (lacht). Man wirkt nur über Überlieferung. Das wäre viel besser, finde ich. Wenn es die Möglichkeit gibt, Texte zu überliefern, könnte es passieren, dass die Literatur an einem Thema fortschreibt, das literarisch ist und nicht mehr abreißt. Das wäre eine Wirkung, die ich mir wünschen würde. Also wenn ich beispielsweise Ezra Pound zitiere, dann versuche ich so etwas in der Richtung.
Bott: Den Faden aufnehmen.
Hilbig: Genau. Bei Benn heißt es: „Trotzdem die Schwerter halten.“ Kriminelle Metapher.
Bott: „Die Arbeiter“, ein Text aus der damaligen DDR von 1975, und „Gewebe“, ein Prosastück von 1993, haben gedanklich eine ganz ähnliche Struktur. Dort ein Ich unter dem lastenden „Turm der Ökonomie“, hier im „Gewebe des Mehrwerts“, der nichts als Mehrwert erzeugt. Offenbar gibt es ein Problem, das sich durch das Hinüberwechseln in die andere Staatsform nicht gelöst hat: Wie kann sich der unfrei gehaltene Einzelne freidenken?
Hilbig: Ich glaube, was noch sehr viel problematischer ist, ist die Furcht des Menschen vor der Freiheit. Ich sehe diese Angst auch in mir: Immer wieder feststellen zu müssen, dass die Freiheit oder das, was als Freiheit bezeichnet wird, keine ist. Das ist ein schwieriger Gedanke.
Neue Rundschau, Heft 3, 2002
Urwörter der Moderne
– Zum Werk von Wolfgang Hilbig. –
Im März 1983 trat Wolfgang Hilbig bei einer Lesung in der Wohnung des Ost-Berliner Bürgerrechtlers Gerd Poppe auf. In der kleinen Drei-Zimmer-Wohnung von 70 Quadratmetern drängten sich über 100 Leute. Hilbigs erster Gedichtband abwesenheit war vier Jahre zuvor in Westdeutschland erschienen. In der DDR hatte ihm daraufhin Franz Fühmann eine erste Gedichtveröffentlichung vermittelt, und 1983 erschien endlich auch ein Band Lyrik und Prosa bei Reclam Leipzig. Hilbig – damals 41 Jahre alt, einst Industriearbeiter in Meuselwitz, jetzt im prekären Status eines „freien Schriftstellers“ – war also kein Unbekannter mehr.
Poppe – heute Bundesbeauftragter für Menschenrechtspolitik im Auswärtigen Amt, damals von der Akademie der Wissenschaften abgelehnter Physiker, der als Maschinist in einem Schwimmbad arbeitete – war seit dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings in die politische Opposition gegangen. Er gehörte zu den bestüberwachten Bürgerrechtlern der DDR. Daher wurde die Lesereihe, die er 1980 von dem Schriftsteller Frank-Wolf Matthies übernommen hatte, sehr genau dokumentiert.
IM „Monika“ berichtete der Staatssicherheit drei Tage später:
Die Lesung wurde von Wolfgang Hilbig eröffnet, der Gedichte und Prosa vorgetragen hat. Sie trugen negative[n] und pessimistischen Charakter, schilderten die ,Orientierungslosigkeit‘ und ,Angstzustände‘ junger Leute und richteten sich gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR. (…) Eine Diskussion kam nicht zustande, obwohl Poppe dazu aufgefordert hatte. (…) Poppe brachte unter anderem zum Ausdruck, daß die Lesungen dazu beitragen sollten, den ,grauen Alltag‘ da[r]zustellen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Nur die Autoren hätten einen Ausweg gefunden, indem sie die Probleme aufschreiben. Er halte Hilbig für den größten ,deutschen Schriftsteller der Gegenwart‘.
Hilbigs Werke brachten das Verdrängte, politisch Problematische in einer neuen Sprache zum Ausdruck Das stimmte den Bürgerrechtler hoffnungsfroh. Die Staatssicherheit dagegen hörte in der Darstellung von „Orientierungslosigkeit“ und „Angstzuständen“ mit Recht ihr Sterbeglöcklein läuten. Und das nannte sie dann „Pessimismus“.
Gerd Poppe hatte Hilbig 1982 unter den Literaten kennengelernt, die zu seiner Lesereihe kamen. Nachdem er einige seiner Texte gesehen hatte, kam Hilbig sofort in Frage für eine Lesung.
Die Texte waren außerordentlich bemerkenswert, also die im Heizungskeller entstandenen Erzählungen. Man merkte: Hier kommt jemand auf die deutsche Literatur zu, an dem sie nicht vorbeikommen wird. Und das war damals vor 20 Jahren eigentlich schon klar.
1. Ein Arbeiter wird Dichter
Poetische Sprache kann zum Medium für Revolte werden. Bei Hilbig begann es spielerisch. Er wuchs südlich von Leipzig in der Kleinstadt Meuselwitz auf, die vom Braunkohletagebau lebte. Der Vater fiel bei Stalingrad. Die Mutter, Lebensmittelverkäuferin, lebte mit dem Kind in der Wohnung ihrer Eltern. Dem Großvater, einem aus Polen zugewanderten Bergmann und Analphabeten, war Hilbig zugetan.
In Deutschland war so etwas peinlich, wenn jemand nicht lesen und schreiben konnte. Und das führte dazu, daß er eine gewisse Verachtung gegen alles Geschriebene entwickelt hat. Das Geschriebene war ihm unheimlich, undurchschaubar, und er hat es denunziert mit Sätzen wie: „Alles auf dem Papier, was schwarz ist, ist Lüge. Nur das Weiße ist wahr.“ Das werde ich nie vergessen, ein sehr interessanter Satz. Aber es war auch Neid dabei gegen alle, die lesen und schreiben konnten. Na ja, und das prägt einen dann wahrscheinlich. Mir ist einmal das Bonmot eingefallen: Wenn er Germanist gewesen wäre, dann wäre ich der Analphabet geworden.
(Wolfgang Hilbig im Gespräch mit Richard Pietraß, Literaturforum im Brecht-Haus, 16.12.1998).
So aber begann die Lust am Lesen und Schreiben und der Kampf um Zeit dafür.
Ich habe immer heimlich geschrieben. Es hat, glaube ich, schon sehr früh eine Trennung von dem praktischen Leben, so würde ich es einmal nennen, und von dem Leben als Schreiber eingesetzt bei mir. Ich weiß noch, daß ich mir immer Zeit oder auch freie Plätze zum Schreiben erkämpfen mußte. Ich mußte einfach warten, bis die anderen schlafen gegangen waren, und ging dann am nächsten Tag in die Schule und schlief da.
Die ersten Eigenprodukte entstanden während der Schulzeit aus Mangel an spannender Lektüre. Denn die war immer auch die offiziell verbotene oder geächtete. Zuerst schrieb Wolfgang Hilbig mit Freunden eine Fortsetzungsserie nach dem Muster der aus dem Westen eingeschmuggelten Westernhefte.
Die waren verboten in der DDR. Das war ,Schund- und Schmutzliteratur‘, obwohl sie eigentlich harmlos gewesen sind. Und da es davon immer zu wenig gab, haben wir die selber angefertigt. Ich weiß noch, daß es bestimmte Lehrer gab, die sich die ausgeliehen haben von uns.
Dann las er die Romantiker: Tieck, Novalis, Brentano, E.T.A. Hoffmann. Sie gehörten in der DDR der 50er Jahre noch nicht unstrittig zum kulturellen „Erbe“, sondern galten, einem Verdikt von Georg Lukács zufolge, aus unterschiedlichen Gründen – Brentano, weil er zur katholischen Kirche übertrat – als „reaktionär“.
Und das war natürlich das Anziehende. Gereizt hat mich an der Romantik der Versuch, das Unwirkliche darzustellen, wie zum Beispiel bei E.T.A. Hoffmann. Das Gespenstische, das hat mich gereizt. Das lag in der Nähe der Hefte, die ich da geschrieben hatte. Also das Kriminelle, das reizte mich. Und das war bei der Romantik auch zu finden, das Kriminelle und das Dubiose!
Die Wirkung dieser Lektüre, die von Anfang an den Realismus-Kanon der DDR hinter sich ließ, sollte erst später sichtbar werden. Auf acht Jahre Grundschule folgte für Wolfgang Hilbig zunächst eine Lehre als Bohrwerksdreher. Nach Ableistung der Wehrpflicht arbeitete er bald in unterqualifizierter Stellung als Heizer, um so mehr Zeit zum Schreiben zu gewinnen. Die ersten Gedichte, die er gelten ließ, stammen von 1965. Da war er 24 Jahre alt. Doch bis 1980 blieb er Arbeiter und schrieb daneben immer weiter, ohne zu veröffentlichen. Das sagt sich so dahin. Aber wer kann es sich körperlich und seelisch vorstellen? Die Kraft und Konzentration, sich nach einem achtstündigen Arbeitstag abzusondern und in einen anderen zu verwandeln, der nicht anerkennt, wohin ihn Familie und Staat meinten für ein ganzes Leben gestellt zu haben, wurde später von der Literaturkritik immer wieder bestaunt. Uwe Kolbe, jüngerer Dichterfreund von Wolfgang Hilbig, hält sich damit nicht weiter auf. In seiner Hommage „Meister H.“ (1994) kommt er frisch zur Sache: Er ist der größte von uns allen! Und: Nun schreibt das endlich mal! Nun laßt das mal mit der sächsischen Kohle und mit dem Heizerphänomen. Laßt das mal mit dem intellektuellen Komplex der Arbeitswelt gegenüber.
Tatsächlich gibt es das in der Geschichte der Literatur immer einmal wieder: Schriftsteller mit „Praxisnähe“. Hilbig selbst erinnert in einem Gespräch (Neue Rundschau 3/2002) an den Schuster Jakob Böhme. Karl Marx war es im übrigen, der in Bezug auf Böhme fragte: „Oder soll die Befugnis an einen Stand geknüpft sein?“ Wolfgang Hilbig wußte sich selbst gelehrt: von den Büchern der Romantik und der Moderne, und von seinem eigenen Lesen und Schreiben. Welcher Ernst dazu gehörte und welche Lust eines sich widersetzenden, eigenverantwortlichen Denkens, läßt sich nur ahnen.
Wie, fragte ich mich, wie soll man es machen, Kontakt finden zu sich selbst… praktisch. Doch wohl nicht, indem man sich den Beschreibungen anderer beugt, die an Grausamkeit öfters nicht zu wünschen übriglassen. Ganz sicher also, indem man selbst eine Beschreibung von sich liefert, eine Beschreibung für den eigenen Blick, und damit eine für die Welt draußen vor dem Fenster… einen Steckbrief. Der Welt draußen fehlt jener Blick, der der meine ist, hatte ich mir manchmal gesagt.
(Die Weiber, 1983)
Letztlich bleibt der Weg vom Arbeiter- zum Schriftsteller-Ich ein Geheimnis, das sich der Analyse entzieht. Aber in den Texten des Autors „fängt das Rätsel selber zu singen an“ („die sommersee“). Hilbig prägte früh die Metapher eines Lebens „in der Wüste“ für die Situation, aus der heraus seine Texte sprechen. Das gleiche Bild gebraucht übrigens Franz Kafka in seinem Tagebuch 1922 für den Ort des sich immer weiter vereinzelnden Schreibenden:
Jetzt bin ich schon Bürger in dieser Welt, die sich zur gewöhnlichen verhält wie die Wüste zum ackerbauenden Land (ich bin 40 Jahre aus Kanaan hinausgewandert) (…). Freilich, es ist wie die umgekehrte Wüstenwanderung mit den fortwährenden Annäherungen an die Wüste und den kindlichen Hoffnungen: (besonders hinsichtlich der Frauen) ,ich bleibe vielleicht doch in Kanaan‘ und inzwischen bin ich schon längst in der Wüste und es sind nur Visionen der Verzweiflung.
1975 entstand der Essay „Die Arbeiter“. Ohne die Lektüre des in der DDR offiziell geächteten Franz Kafka und seiner Erzählung „Der Heizer“ (eine spätere Erzählung Hilbigs von 1980 trägt denselben Titel) ist dieser Text nicht zu denken. Bei Kafka hindert den Heizer seine ungeschickte, unklare, weitschweifige Rede daran, sich vor den Arbeitsherren Recht zu verschaffen. Bei Hilbig ist es der Heizer, der mit seiner radikalen Gedankenarbeit die Sprachlosigkeit der Arbeiter durchbricht. Zugleich desavouiert er jenes „mechanische Bewußtsein“ von Ökonomie, mit dem die DDR die angeblich staatstragende Klasse der Arbeiter weiter im Zustand der Entfremdung hielt.
Hier wußte ein Schriftsteller, eben weil er auch Arbeiter war, die sklavisch ineinandergreifende Unfreiheit der Produktionsverhältnisse zu beschreiben. Die genaue Kenntnis dieser Arbeitswelt mit all ihren Formen von Demoralisierung und Entfremdung war jedoch der Sprengsatz, der eine Veröffentlichung von Hilbigs Texten in der DDR undenkbar machte. Darin artikulierte sich eine Sehnsucht nach freier Mitsprache, die die regierende Ideologie des Landes zu erfüllen vorgab, tatsächlich aber unterdrückte. Indessen schrieb Hilbig Gedichte, in denen er sich „seitlich des wegs“ schlug, ins Abseits jeglicher Anpassung. Seine Texte bergen eine Dimension von sozialem Protest, die auch im gegenwärtigen Literaturbetrieb eher Befremden auslöst. Auch hier ist er ein Fremder und Außenseiter geblieben, trotz aller Ehrungen und Preise.
Wenn überhaupt, dann wäre das Ereignis „Ein Arbeiter wird Schriftsteller“ nur wieder aus der magischen Kraft der Literatur heraus zu begreifen. Ingeborg Bachmann gehört zu jenen Nachkriegsautoren, die für Hilbig wichtig waren, weil sie das öffentliche Bewußtsein nicht so beließen, wie es gerne hätte bleiben wollen. Mitte der 50er Jahre schrieb sie eine Studie über die französische Philosophin Simone Weil, die in den 30er Jahren Fabrikarbeiterin wurde und mit noch nicht 34 Jahren über dem unauflösbaren Unglück der Arbeiterexistenz zugrunde ging. Kurz darauf, 1959, entstand Bachmanns Erzählung „Der Schweißer“. Es ist die Geschichte eines Arbeiters, der nach Feierabend zufällig auf ein Buch stößt – Die Fröhliche Wissenschaft von Nietzsche –, darüber zum Leser wird und schließlich an die Grundfesten eines ungerechten Lebens rührt. In Hilbigs Prosastück „Der Leser“ (1973) wird der Leser zum Schreibenden: Wachgerufen von dem aufgeschlagenen Buch vor sich, muß er es, zornig über die Leere darin, mit seiner Wahrheit füllen, bis er sich endlich freigesprochen hat.
II. In der DDR: gespaltene Existenz und Triumph des Absurden
Über ein Erlebnis seiner Jugend in der DDR, das Schließen der Grenzen, hat Hilbig erst 30 Jahre später schreiben können, nachdem seine Landsleute die Mauer gewaltlos zu Fall gebracht hatten. Die Erzählung „Die Kunde von den Bäumen“, 1992 erschienen und 1994 in zweiter Fassung vorgelegt, geht von der Wahrheit des eigenen Erlebens aus. Damit bot sie Orientierung in der damaligen heillosen Debatte über ostdeutsches Verhalten vor 1989 und westdeutsches Urteilen darüber im nachhinein. „Die Kunde von den Bäumen“ spricht ohne jede Beschönigung aus, was der Mauerbau im Leben jedes Einzelnen in der DDR bedeutet hat, auch wenn 98 Prozent der Bevölkerung dies sofort unterdrückten oder wegrationalisierten, um sich anpassen und weiterleben zu können: Es war eine Verletzung, ein Verrat an der Freiheit und Würde des Einzelnen. Wie sollte ein Zwanzigjähriger nach dieser Einmauerung weiterleben? Wie noch Geschichten über sein weiteres Leben erzählen? „Waller“ kommt über den ersten Satz nicht hinaus:
Die Kirschallee ist verschwunden…
Und es ist noch ein weiter Weg bis hin zu jenem Tag, an dem Waller sich die Mitschuld an der fortschreitenden Zerstörung eingesteht und ihm der zweite Satz seiner Erzählung gelingt:
Die Scham ist vorüber!
Dazwischen liegt der August 1961 und Wallers Abfallen von seinem Volk:
Noch im Herbst nach jenem Sommer begann seine Verwandlung (…); er selbst erklärte sich das ganze damit, daß sein vergangenes Leben vom Ast des Kirschbaums heruntergewelkt sei. Dies klang metaphorisch und sentimental (…) es war immerhin noch besser, als sich dem Verhalten aller übrigen in der Stadt anzuschließen. In der Stadt schienen alle, beinahe gewaltsam gegen sich, nur beschäftigt, ein bestimmtes Datum aus dem Sommer zu ignorieren und, trotz dieses Datums, weiter zu leben wie bisher. Es gelang ihnen schließlich (…), doch eigentlich konnten sie es nur um den Preis, mit diesem Datum im Sommer auch ihr Leben vor diesem Sommer zu vergessen. (…) Wie sollte ich sie nennen: meine Kollegen, meine Bekannten, meine Mitschüler, meine Landsleute, meine Nächsten… (…) die Mitglieder der Gesellschaft, (…) alle, die dazu gehörten, (…) alle, über die ich hatte schreiben wollen, so als seien sie in mir: alle, an denen meine Geschichten gescheitert waren. Tatsächlich, sie waren die Bevölkerung meiner Geschichten! Sie waren das Volk, und ich glaubte nicht daran, daß sie sich jemals ändern konnten. (…) Erst wenn die Maske des Normalen abgerissen war, gab es wieder Gründe für Geschichten. (…) Es waren keine legalen Geschichten mehr. Es waren Geschichten des Abfalls von diesem Volk!
Die „abweichende Sprache“ für das Unerledigte im Abseits dieser Gesellschaft findet Waller in der stummen Gestik der Bäume, deren Bilder ihm immer wiederkehren, um Erinnerung anzumahnen. Für die Bürger „voller Einverständnis“ dagegen findet er keine Sprache, er fällt ab von ihnen. Und er haßt sich selbst, weil er seine „vorgezeichnete Laufbahn“ weitergeht, obwohl sie doch eingemauert und damit schon hoffnungslos abgeschlossen ist. Waller will sich das Leben nehmen. Aber dann faßt er einen anderen Vorsatz: sofort unbrauchbar werden in dieser Gesellschaft.
Das Leben, das noch vor mir lag, befand sich im Würgegriff von Grenzen… Und ich wußte in diesem Augenblick, daß ich nicht die mildeste Form einer Grenze akzeptieren konnte. Nein! – Vorbei war die Jugend, ich konnte sie auf den Müll werfen. Ich hatte mich zu beeilen, in allerhöchster Eile hatte ich mich dorthin zu bewegen, wo ich alt war… krank, invalid, altersschwachsinnig, ein Wrack, ein Störfaktor. Ich mußte ein unbrauchbares Stück in der Gesellschaft sein, wenn ich ihre Grenze überschreiten wollte.
Hilbig selbst führte bis Ende der 70er Jahre eine klar getrennte Doppelexistenz. Nur wenige Freunde wußten von seinem Schreiben. Nach außen hin blieb er Arbeiter, allerdings in immer gleichgültiger werdenden Stellungen. Ausgrenzung und vermeintlichen sozialen Abstieg nahm er dabei in Kauf. In den Frankfurter Poetikvorlesungen 1995 begründete Hilbig die Notwendigkeit dieses Doppellebens:
Die Arbeiter der DDR waren tatsächlich eine Art schweigende Mehrheit, die sich nicht artikulieren wollte, da sie den zwischen Realität und offiziellem Sprachgebrauch klaffenden Widerspruch als unaufhebbar hingenommen hatten. (…) Selbst die Staatssicherheit fand kaum einen Zugang zu dieser Sphäre, und das Schweigen hielt bis zum Ende der DDR an. (…) Ich muß es eher einen Instinkt nennen, daß ich mich lange davor gehütet habe, vor meinen Arbeitskollegen (…) etwas über meine schriftstellerischen Absichten verlauten zu lassen. Damit hätte ich mich sofort selber aus dem Verband der Beziehungen, der in den Arbeitsbrigaden der DDR-Betriebe notgedrungen herrschte, ausgestoßen. (…) Ich könnte nicht sagen, ob ich mir damals klarmachte, welchen Bruch ich hätte vollziehen müssen, wäre es mir möglich gewesen, in der DDR etwas zu veröffentlichen. (…) Ich kann das Wesen dieses Bruchs nur andeuten: Ich glaube, die Arbeiter, unter denen ich lebte, stellten für mich eine Art subversives Element dar. (…) Der pragmatische Stoizismus, die unsentimentale Haltung, die Unbestechlichkeit der Arbeiter übten eine starke Verführungskraft auf mich aus. (…) Das erklärt mein Schwanken, mein Taktieren, kurz gesagt, mein Doppelleben: Ich war Arbeiter und Schriftsteller, nicht aber ein Arbeiterschriftsteller. Wenn ich in der DDR ein Buch veröffentlicht hätte, wäre ich mit einem Schlag weder Arbeiter noch Schriftsteller gewesen.
(Abriß der Kritik, Frankfurt am Main 1995, 3. Vorlesung)
Dennoch drängte diese Art von Selbstverleugnung als Selbstschutz nach einer Lösung. Der Arbeiter Hilbig war in Wahrheit längst Schriftsteller und mußte Leser finden, Gesprächspartner. So war es eine fabelhafte Ironie der Geschichte, daß ihn sein Meuselwitzer Betrieb 1964 zu einem „Zirkel schreibender Arbeiter“ nach Leipzig delegierte. Dort war Hilbig unter Studenten, Hausfrauen und Schülern der einzige Arbeiter, dessen Umgang mit Sprache und dessen Kenntnis moderner Poesie verblüfften. Aber dort lernte er auch die Schriftsteller Gert Neumann und Siegmar Faust kennen, damals noch Studenten am Leipziger Literaturinstitut. Im Jahr darauf vernichtete Hilbig alle bis dahin geschriebenen Texte, las Hölderlin, Lenau, Rimbaud, die französische Lyrik der Moderne und Kafka. 1968 wurden Neumann und Faust im Zuge einer ZK-Kampagne gegen die freisinnigen subkulturellen Milieus exmatrikuliert. Hilbig hatte den „Zirkel schreibender Arbeiter“ schon vorher verlassen und verkehrte weiter im Freundeskreis von Faust und Neumann, die nach dem Vorbild der französischen Symbolisten eine literarische Gruppe bildeten. Siegmar Faust erinnert sich:
In meiner zeitweiligen funktion als rundfahrtenkapitän auf einem Leipziger stausee veranstaltete ich auf einem motorboot im sommer 68, quasi auf dem siedepunkt des Prager Frühlings, eine unangemeldete lesung, auf der wolfgang hilbig das erste mal vor etwa 35 jungen leuten unzensierte gedichte vortragen konnte, die alle anwesenden in erstaunen versetzen sollten. Denn beispielsweise in seinem gedicht „eingeborener abgesang“ sagte er etwas aus, was sich auf diesem niveau und mit dieser radikalität noch kein lyriker der DDR wagte:
wer, wenn ich schreie hört mich denn ihr
meine beiden völker im gemäßigten notstand die ihr
mir abwechselnd am arsch und am herzen liegt
wer denn in diesem meinem land wo
ich erschlagen lieg von den uralten
wipfeln in güldener ruh
o du mein armes inniges land mit den namen
aus alten liedern hier nimm meine weinende liebe
und fahr zur hölle
mit mir.
(„Über Wolfgang Hilbig“, in: L 76, Heft 10/1978)
Die Lesung machte Hilbig unter den Autoren seiner Generation bekannt. Er hatte Freunde unter den Literaten gefunden, auch wenn er weiter Einzelgänger blieb und keiner literarischen Gruppe angehörte. Seine Freunde waren ebenfalls „Abgefallene“, die nicht oder nicht mehr zur staatlich anerkannten Literatur der DDR gehörten. Der Dichter Adolf Endler begegnete Hilbig erst 1982 auf den Lesungen bei Poppe.
Wir hatten, so unterschiedlich wir sind, doch eine gewisse ähnliche Vorstellung von Literatur. Und zwar eine – ob wir auch Satire geschrieben haben wie ich und gelegentlich auch Hilbig – auf Kunst ausgerichtete Vorstellung und weniger kritisch-politische Literatur. Ich habe Hilbig immer für einen sehr bedeutenden Autor gehalten. Allerdings habe ich ihn nicht in direktem Zusammenhang mit der Underground-Literatur, die damals in der DDR vor sich hinweste, gesehen. Er war einer, der seinen eigenen Weg ging, der auch seinen eigenen Weg gehen wollte. Auch das hat uns verbunden, obwohl es mir Spaß gemacht hat, in Untergrund-Zeitschriften zu schreiben und irgendwelchen Unsinn loszulassen. Das war nicht seine Sache. Da war er schon ein bißchen ernster. Für mich war er ein Vertreter dessen, was ich einmal die Leipziger Schwarze Romantik genannt habe. Dazu gehörten Gert Neumann, Hilbig u.a. Für mich war Hilbig so ungefähr der wichtigste Autor, der in der DDR damals schrieb. Er gehörte nicht zu den Experimentierern oder etwas mystischen Modernen. Für mich war das einfach, was das auch immer war, fast der wichtigste Autor der DDR, obwohl ich ja noch gar nicht so viel von ihm kannte. Das heißt, er ist dann immer wichtiger für mich geworden.
Seine Texte wollen auf ihrer Oberfläche nicht politisch sein. Es ist eher, wie Uwe Kolbe das einmal genannt hat, ein Renegatentum „kraft Poetologie“ („Renegatentermine“, 1998). So lehnte Hilbig z.B. auch die Mitarbeit in der Leipziger Untergrund-Zeitschrift Anschlag ab.
Der Anschlag hat dann den Brief von Hilbig veröffentlicht, der darauf hinausläuft, daß er nicht mit irgendwelchen scheinliterarischen Dilettanten, die eigentlich auf etwas ganz anderes hinauswollen, zusammen auftreten will, sondern daß es ihm um literarische Kunst geht. Eine Absage eigentlich an die politische Richtung des Underground, wie sie etwa von Lutz Rathenow und ähnlichen Leuten vertreten wurde.
(Gespräch mit A. Endler)
In Wolfgang Hilbigs Werk geht es um Zerstörung von Natur und Menschen nicht allein durch die Industrialisierung, sondern auch durch die verheerende Spur deutsch-deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert. Prominente Akteure sind hier Landschaften, Gewässer und vor allem Bäume. Sie mahnen in einer phantastisch-gestischen Sprache an Verdrängtes und behaupten allen Verletzungen zum Trotz noch im Verschwinden souverän ihre Würde. Die Kirschbäume der „Kunde“, die Weide in „Über den Tonfall“, die Kastanien der Erzählung „In der Schillerstraße“ – sie sind aus den phantastischen Erzählungen der Romantik hergekommene Vorbilder des Widerstands gegen eine in ihren Verdrängungen geradezu wahnwitzig irreale Wirklichkeit. Und sie sind Brüder jener drei Bäume von Balbec, die Marcel Prousts Erzähler das Erinnern lehren. Auch dies eine Lektüre Hilbigs im Kesselhaus:
wo ist der kohlendreck alkalihauch der asche
und proust dazwischen auf dem klapptisch mit den kalten beinen
combray und balbec schmeckten gut
im kellerloch in dem der dampf gefror…
( „eine art abschied“, in: die versprengung, 1986).
Zum andern fragt Hilbig nach dem Woher und Wohin des eigenen Ich, ja setzt es schreibend in all seinen Möglichkeiten überhaupt erst zusammen. Ob seine Schriftsteller-Figuren .C.“, „W.“ oder „Er“ heißen, ihr autobiographischer Anlaß ist immer unverkennbar. Die Art und Weise, in der diese Geschichten des Verlusts oder des Noch-Nicht für Hilbig einzig zu schreiben sind, entwirft sein Prosastück „Herbsthälfte“ (1973): Es ist ein Abdriften – „lans“, hier zitiert er Beckett – vom vorgegebenen Kurs eines konventionellen, eindimensionalen Realismus. Diese, wie es heißt, „altgewordene Methode“ sieht von allem nur „die Hälfte“. „Das Ganze“ sehen hieße aber, „den ungesehenen Teil ahnen lassen“, „die niemals wahrhaft begonnene Wirklichkeit“. Und dann erscheint für die alle Grenzen und Ideologien durchbrechende, aufs Ganze gehende Poesie bei Hilbig jenes surreale Bild, das Georg Büchner in seinem Fragment Lenz geprägt hat und das auch Paul Celan in seiner „Meridian“-Rede 1960 aufnahm:
Ich wußte, man geht plötzlich ohne Bewußtsein im Unsichtbaren, die Füße in der Höhe zwischen die Sterne setzend, schwerelos, aller teuer gewordenen Schwere los, man steigt, lans, kopfunter über die Sterne.
(„Herbsthälfte“)
Diese Poetik ließ die Literaturdoktrin der DDR einfach hinter sich und konnte nur noch in Konflikt mit ihr geraten. Wolfgang Hilbig war von Anfang an zuhause in einer Literatur des Absurden, die von der menschlichen Tragik zeugt, aber ebenso auch von der menschlichen Freiheit. Seine Erzählweise verweigert sich der Fortschrittssucht am Ende des Industriezeitalters: Sie schreitet nicht linear voran, sondern kreist das Verschwiegene, Unsichtbare beharrlich so lange ein, bis es sich ergibt. Hilbigs Erzählungen sind für den Leser von einer starken Sogwirkung, so wie sie selbst von einer spiralförmigen Suchbewegung in Abgründe hinabgetrieben werden. (Selten, aber desto herrlicher gelingt der trotzig übermütige Aufschwung in phantastische Glücksvisionen wie in dem frühen Prosastück „Idylle“ oder die Darstellung eines ekstatischen Glücksmoments wie in Das Provisorium.) Ziel dieser Erzählbewegung scheint immer wieder ein verneinender Bruch zu sein, in dem das Ich des Autors seine subjektive Wahrnehmung gegen den zunehmend selbstzerstörerischen gesellschaftlichen „Mainstream“ zu behaupten versucht, ohne sich ihm doch entziehen zu können.
… willenlos trieben wir
tranken die toten münder uns voll
allein unsere arme wiesen
so oft wir auftauchten störrig
gegen den strom
immer wieder
(„gegen den strom“, 1966).
Die große Erzählung Alte Abdeckerei etwa handelt von dem stillgelegten Kohlenschacht „Germania II“ und nähert sich immer dichter und phantastischer der auch in der DDR verdrängten NS-Vergangenheit. Adolf Endler nannte das „höllische Prosa“:
Was da beschrieben wird, ist die Hölle. Und die Hölle trägt in diesem Prosastück DDR-Züge. Für Hilbig war die DDR ein ziemlich höllisches Ding, was da ablief. Und es war nicht mit diesen Nettigkeiten zu erfassen, mit denen heute gewisse Sammler von Kuriositäten die DDR beschreiben. Daß es außerdem noch äußerst kurios war, das ist klar. Ich habe es dann eher als Absurdes und Kurioses beschrieben. Hilbig hat das als Hölle empfunden, was da an Kaputtheit, Korruption, Doppelbödigkeit, Verlogenheit, Spitzelei usw. passierte. Man konnte das übersehen. Aber wenn man den bösen Blick hatte, wie Hilbig ihn hatte, dann war das vollkommen klar, daß das etwas sehr Kaputtes war, was dann noch kaputter gegangen ist.
(Gespräch mit A. Endler)
Hilbig umgekehrt sprach in einer Laudatio auf seinen Freund Endler von „Liebe“ zu dessen Büchern, die immer wieder auch zum befreienden Lachen reizen. Adolf Endler:
Es war eine Freundschaft, die nichts mit Prenzlauer Berg oder Sächsische Dichterschule zu tun hatte, sondern sicher mit unserer unterschiedlichen Einzelgängerei. Es kann sein, daß darin auch der Kern unserer Beziehung steckt. So unterschiedlich, obwohl das ganz andere Wirkungen hat und andere Formen annimmt, waren wir auch in unserer Literatur nicht. Es ging uns um Sprache. Es ging mir nicht um Witze. Es ging uns beiden um Sprache. Und natürlich auch um ein gewisses Bild von der DDR oder von der Welt. Für mich war die DDR die Absurdität in der Nußschale, aber die Absurdität der ganzen Welt! Nur in der DDR – in der Nußschale! Ich wollte die DDR also nicht so als etwas Besonderes attackieren, sondern diesen Wahnwitz, der da meiner Meinung nach ablief, als den Wahnwitz, der eben sozusagen auf der Welt dominiert. Ich hatte also ein bestimmtes Bild. Und das war, obwohl mein Stil ein ganz anderer war, von diesem höllischen Bild Hilbigs so weit nicht entfernt. Was mich von ihm dann ganz unterscheidet, ist, daß für ihn offensichtlich der Ekel eine große Rolle gespielt hat. Ich konnte da nur noch lachen. Vielleicht hängt das mit meiner Herkunft aus dem Rheinland zusammen. Ich habe das dann karnevalesk geschildert, während das Hilbig in ganz anderer Weise geschildert hat. Aber wir beide hatten ein nicht ganz so weit voneinander entferntes Bild von den Verhältnissen. Und ich nehme an, daß Hilbigs Bilder sich auch nicht nur auf die DDR bezogen, sondern daß darin doch eine ganz schwarze Vorstellung von der Welt eine Rolle spielt, was sich jetzt in seinen politischen Artikulationen ja auch zeigt.
Welche ermutigende Wirkung Hilbigs Schreibweise auf einige jüngere ostdeutsche Autoren hat, beschreibt Ingo Schulze, der 1995 mit dem abgründigen Erzählband 33 Augenblicke des Glücks debütierte:
Hilbig war wirklich wie von einem anderen Stern, sowohl in seinem Stil, als eben auch in seiner Haltung. Und er gehörte natürlich zu denen, deren Bücher man sich in den Osten zurückschicken ließ. Für mich war – gerade auch nachdem ich seine Landschaft kennengelernt hatte – in seiner Prosa immer das große Ereignis, welche Sprache er gegen diese Steppe, diese Vernichtung von Kultur und von Landschaft und damit eben auch von Menschen setzt; eigentlich eine Sprache, an die man in diesem Zusammenhang zuallerletzt denken würde. Er ging dagegen mit einer Schönheit an, die das regelrecht dematerialisierte. Das steigert sich ja meistens in eine Dichte hinein, wo es schwer ist, zwischen Lyrik und Prosa zu unterscheiden, und wo es regelrecht surreal wird. Das war so ein Überstrahlen der Wirklichkeit – das meinte ich mit Dematerialisieren –, so eine wunderbare Art von Widerstand. In dieser Unglaublichkeit, wo eben Tristesse eine Beschönigung wäre, selbst dort schafft er Schönheit. Er überwindet eigentlich damit diese Scheußlichkeit. Also ich war nie deprimiert, wenn ich Hilbig gelesen habe, ganz im Gegenteil.
Als Siegmar Faust 1976 nach mehrjähriger Gefängnisstrafe in den Westen ausgebürgert wurde, nahm er Gedichte seines Freundes Hilbig mit. Der Hessische Rundfunk sendete sie und kurz danach schlug der S. Fischer Verlag dem Autor in Leipzig einen Gedichtband vor. Zensurbehörde und Staatssicherheit nahmen Hilbig zur Abschreckung zwei Monate in Untersuchungshaft. Er blieb unbeugsam. Aber diese Erfahrung, die er in den Erzählungen „Johannis“ und „Die Einfriedung“ (1978/79) gestaltete, machte ihn in seiner Haltung nur noch entschiedener. Im August 1979 erschien in Frankfurt am Main Hilbigs erstes Buch,„abwesenheit. Der Ost-Berliner Autor Franz Fühmann las es und setzte sich in einer fulminanten Rede für die Anwesenheit des Dichters in der DDR ein. Daraufhin druckte 1980 die Zeitschrift Sinn und Form, etwa 50 Seiten nach einer Gruppe „Gedichte der DDR“ (Lothar Walsdorf, Klaus Rahn, Ursel Dirlam, Willi Sagert), acht „Gedichte“ von Wolfgang Hilbig ab.
Die Maske der Selbstverleugnung war gefallen. Aber die Zweifel waren damit für den Schriftsteller nicht vorbei.
Der erste Satz, den ich gedacht habe, war: Bin ich denn wirklich einer? Franz Fühmann hat das hervorgerufen: Bist du verrückt? Deine Knöpfe drücken, das kann jeder. Aber das Schreiben kann nicht jeder. Wieso gehst du noch arbeiten? Diesen Satz hat mir Franz Fühmann eines Tages gesagt und mir eine Veröffentlichung in Sinn und Form besorgt. Und da kriegte ich eine Steuernummer und plötzlich war ich ,freischaffender Schriftsteller‘. Da kam mir die schon etwas bange Frage: Kann ich das überhaupt rechtfertigen? Da meine Entwicklung eigentlich in die andere Richtung zu laufen schien, obwohl ich immer geschrieben habe, schon als Kind, kam es mir doch immer so vor, als müßte ich mich verstellen und so tun, als wäre ich ein Schriftsteller. Und das ist ganz schwierig abzulegen, wenn man das jahre-, jahrzehntelang gemacht hat. Das wird fast zu einer Art Pawlow’schem Reflex. Das nimmt Platz in der Seele, die man hat. Das wird man nicht so schnell wieder los. Eigentlich habe ich mich bewegt wie ein Arbeiter und habe gelebt wie ein Arbeiter und mußte mich jeden Tag unter schweren Mühen in einen Schriftsteller verwandeln, der versucht hat, keine Brigadetagebücher zu schreiben, sondern artifizielle Texte. Und das kam mir immer wie eine Verstellung vor. Das konnte einfach nicht anders sein. Wenn man in einer Kleinstadt lebt, wohin soll man gehen und fragen: Bin ich Schriftsteller oder bin ich’s nicht? Wer kann einem das bestätigen? Das kann einem niemand bestätigen. Eigentlich muß man sich in einer Art von Gewaltakt selbst sagen: Du bist Schriftsteller. Aber man hat keine Beweise dafür. Nie gibt es dafür den Beweis. Selbst jetzt habe ich den noch nicht.
Aber auch der Maler Gerhard Altenbourg z.B., der unweit von Meuselwitz lebte und in der DDR nicht mehr ausgestellt werden durfte, hatte ihn nicht (ein Gedicht aus Hilbigs jüngstem Band bezieht sich auf Altenbourg). Er hielt einfach für sich den Mythos „Maler“ hoch.
Ich glaube, das passiert bei solchen Leuten, die in einer Welt leben, in der es eigentlich keine Bezugspunkte gibt zu dem, was man tut. So ähnlich kann es bei mir auch gewesen sein. Es kommt ja in diesem Gedicht „Der Garten von Gerhard Altenbourg“ nicht umsonst das Wort ,Inzucht‘ vor. Man hat natürlich das Gefühl, nur noch mit sich selber und aus sich selber so eine Art Leben zu produzieren.
III. Im Westen: Provisorium und Odyssee ohne Heimkehr
1985 erhielt Wolfgang Hilbig ein westdeutsches Literaturstipendium und konnte mit einem einjährigen Visum ausreisen. Hier geriet sein Leben in eine Krise, über die er zehn Jahre später den Roman Das Provisorium zu schreiben begann. Nicht autobiographisch an dieser Geschichte über den Schriftsteller C. mit befristetem Visum zwischen zwei Ländern, zwei Frauen und zwei Berufsexistenzen ist die Schreibhemmung, die C. im Westen plötzlich befällt. Der Autor selbst war in jener Zeit äußerst produktiv und veröffentlichte mehrere Bücher. Zweifellos aber wollte er mit diesem literarischen Konstrukt die Banalisierung und Gefährdung der Schriftstellerexistenz durch den Literaturmarkt darstellen.
Nach Meinungen abgefragt oder auf Deutungen festgelegt zu werden, das eigene Schreiben öffentlich zu reflektieren oder in den Medien aufzutreten liegt ihm nicht und stört ihn auf seinem eigenen Weg („Über den Literaturbetrieb. Rede zum Bremer Literaturpreis 1994“). Wolfgang Hilbig ist alles andere als ein Plauderer. Sein Mandat ist das Schreiben. Dafür will er sich freigehalten wissen. Deshalb beherrscht ihn in der Welt kommerzieller Medien nur eine Sehnsucht:
Zu einem Urzustand des Schreibens zurückzukehren, der vermutlich ursprünglich einmal bei mir dagewesen ist und der jetzt zerstört worden ist durch den Literaturbetrieb: also durch die Veröffentlichungspraxis und durch die Entfremdung von Texten, die man dauernd erfährt. Ich habe bis jetzt den Schiller-, den Lessing-, den Fontane-, den Huchel– und den Büchner-Preis bekommen. Also zu wem soll ich mich nun zugehörig fühlen? Das hat eine dauernde Entfremdung zur Folge, glaube ich. Weil es einen aus der eigentlichen Bildwelt herauszieht und in eine andere hineinversetzt, die einem immer wieder dazwischenfunkt in die Art Gedankenwelt, die man als Lyriker z.B. hat. Gut, wenn ich den Büchnerpreis bekomme, dann wird es erst einmal ein paar Jahre ruhiger werden. Also ich bin heilfroh, wenn das vorbei ist. Dann kriegt man auch nicht so schnell wieder einen. Dann werde ich Zeit haben, etwas zu schreiben. Aber die Verlage haben es natürlich gern, wenn man auf allen Hochzeiten tanzt, weil sie den Absatz der Bücher wollen, glauben, davon steigert sich der Absatz der Bücher. In meinem Fall ist das gar nicht so. Ich werde immer als intellektueller und schwieriger Autor in der Kritik dargestellt. Ich habe noch nie gut verkäufliche Bücher geschrieben, außer einem: Ich. Aber da war es ein Zufall, weil alle glaubten, es wäre ein Buch über die Stasi, und das war damals gerade das große Modethema in der Presse.
Trotz alledem ist der Literaturbetrieb nur ein Randthema in Hilbigs Roman Das Provisorium (2000). Worum es eigentlich geht, signalisiert das vorangestellte Motto aus Strindbergs Roman Schwarze Fahnen. Wie dieser auch ist Das Provisorium eine Bilanz zur Jahrhundertwende: Gesellschaftssatire und Selbstbildnis des Autors in einem. Zum Zeitbild, das Hilbig mit metaphorischem Sarkasmus ausschreibt, gehören das Ende der Industriearbeiterschaft, der Beginn atomarer Katastrophen, Konsum als Glaubensersatz, Pornographie als Liebesersatz, Psychoanalyse als Lebensersatz und Autowahnsinn statt Ich-Erfahrung. Eindrückliche Passagen schildern die Kehrseite der Wohlstandsgesellschaft: Suchtabhängige und Randexistenzen. Die schonungslose Autorenbeichte konfrontiert mit einem Leben, das ständig unter der Spannung des Schreibens stand, zu dem C. aus zu großer familiärer und staatlicher Enge floh, das ihn aber wiederum vom Leben selbst abhielt. In der westlichen Konsumgesellschaft sieht er sich unschönen Gefühlen wie Gier und Neid ausgeliefert, danach von Scham gepeinigt. All das, was nach einem Arbeiterleben im ständigen Zwiespalt zwischen Schreiben oder Leben nicht mehr nachgeholt werden kann, entlädt sich in Wut über die ihm vom Zwangsstaat DDR gestohlene Zeit und Wut über sich selbst, der hier im Westen die große Liebe seines Lebens versäumte.
Ziel der schonungslosen Beichte von C. ist: „Ich muß zusehen, daß ich mich selbst wieder zu einer Person machen kann.“ Dabei stört ihn beständig der Aberwitz des Literaturbetriebs, aber auch der Alkohol. Die Hoffnung auf eine gelingende Verbindung von persönlichem Glück und Schreiben in dieser neuen Freiheit scheint vorerst vorbei. Am Ende steht C. weniger unter dem Kapitalismussymbol „AEG“, als unter der Romantikerchiffre „f.a.e.“: frei, aber einsam. Ein anderer, noch wenig begangener Weg tut sich auf:
Hatte er sie denn wirklich nicht geliebt? (…) Vielleicht hatte er sich die falschen Fragen gestellt, vielleicht hätte er fragen müssen, ob er überhaupt gelebt hatte. Ob er überhaupt aufgewacht war zum Leben. Immer schon, solange er denken konnte, befand er sich wie im Halbschlaf kurz vor dem Erwachen. Und es gelang ihm nicht, zu erwachen. Man mußte aber wach sein, man mußte gelebt haben, um an der Liebe teilzunehmen…
Hilbigs Roman Das Provisorium riskiert den Bruch mit bestimmten Kreisen oder setzt ihn bereits voraus. Er beschreibt eine problematische deutsch-deutsche Gesellschaft am Ende des Jahrhunderts und seinen angstbesetzten Kampf um menschliche Nähe in ihr. Der schonungslose Blick auf eigene Abhängigkeiten scheint die einzige Voraussetzung für eine mögliche Wandlung zu sein. Auch wenn man die frühere Kurzprosa vorziehen mag, so ist doch Das Provisorium unverkennbar aus einer inneren Notwendigkeit heraus geschrieben. Unverkennbar ist auch, daß es Wolfgang Hilbig immer mehr zu politischer Kritik drängt, ohne daß er dabei von den DDR-Nostalgikern zu vereinnahmen wäre.
Im Roman Das Provisorium herrscht nicht mehr die hochliterarische Sprache der früheren Erzählwerke vor, sondern hier begegnet erstmals die untere Stilebene, auch emotional aggressive Umgangssprache.
Ab irgendeinem Punkt war das eine Entscheidung. Und zwar eine, Distanz zwischen diesen Er im Buch und mich selber zu bringen. Ich glaube, es ist das Buch, in dem ich am meisten zu schildern versuche, welche Atmosphäre mich umgibt, während die anderen Bücher früher immer viel reflexiver waren. In dem Fall wollte ich wirklich aus einer gewissen Distanz erzählen. Das hat aber genau den Grund, daß es mein bisher autobiographischstes Buch ist. Ich brauchte die Distanz. Meine eigene frühere Sprache mißlang mir in diesem Buch. Also ich konnte damit nicht anschließen an frühere Texte. Eigentlich ist das Buch eine Metapher im Großen und Ganzen, nämlich für eine Figur, die sich provisorisch zwischen zwei Welten aufhält und in keiner richtig da ist.
Die Literaturkritik zeigte sich angesichts der Radikalität des Romans beeindruckt, aber gleichwohl ratlos. Eine Fährte des Verstehens legt vielleicht, was Bruno Schulz 1938 über „Ferdydurke“ schrieb, Witold Gombrowiczs groteske Umkehrung eines Entwicklungsromans. Ähnlich wie Gombrowicz hat Hilbig im Provisorium das Schamhafte, „Unreife“, aus dem offiziellen Erscheinungsbild des Schriftstellers C. wie von uns allen sonst Ausgegrenzte zum öffentlichen Thema seines Schreibens gemacht. Und gerade weil er diesen subkulturellen Bereich, diese heimliche inoffizielle Schattenexistenz mit ihren gewaltigen emotionalen Spannungen nicht beschweigt, sondern in ihr die mächtigste Lebenskraft erkennt, konnte danach die wahrhaft sublime Höhe der Bilder vom Erzählen (2001) gelingen.
Dieser Gedichtzyklus ist eine Reaktion auf den Befund des Provisoriums: Wenn es auch in dieser Gesellschaft der neuen Freiheiten kein Zuhause in menschlicher Nähe gibt, dann bleibt nur, es in der Dichtung zu suchen. Die Bilder vom Erzählen sind eine moderne Odyssee ohne Heimkehr durch die Wüsten des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens. Heimat entsteht allein als ein geistiger Ort, gewoben im Dialog mit den Stimmen, denen sich der Autor verbunden weiß: Rimbaud, Hölderlin, Büchner, Celan, Eliot, Pound… „Man wirkt nur über Überlieferung. Wenn es die Möglichkeit gibt, Texte zu überliefern, könnte es passieren, daß die Literatur an einem Thema fortschreibt, das literarisch ist und nicht mehr abreißt. Das wäre eine Wirkung, die ich mir wünschen würde. Also wenn ich z.B. Pound zitiere, dann versuche ich schon so etwas in der Richtung… Bei Benn heißt es: Trotzdem die Schwerter halten oder so ähnlich.“
In den Bildern dominiert eine Metaphernwelt, die auch in früheren Gedichten immer wieder zu beobachten war: Meer, Schiff, Salz, Wüste…
Ich glaube, das sind Urwörter: Meer, Salz… Also Wörter, die mit der Entstehungsgeschichte im weitesten Sinne zu tun haben. Man muß bedenken, daß ich in einer Gegend aufgewachsen bin als Kind, in der die Erde andauernd umgeschichtet wurde und Tagebaue entstanden. Und es war viel Wald in dieser Gegend. Also hatte man praktisch Bilder. Die Tagebaue soffen mit der Zeit ab und wurden von verschiedenen Grundwassern gespeist und waren teilweise sogar verschiedenfarbig. Und dazwischen lagen weißgelbe Abraumhalden von Sand. Also hatte man Wüste, Wasser und Wald. Das habe ich meine ganze Kindheit über vor Augen gehabt. Und das ist logischerweise so ein Ursprungsgefilde für mich. Aber wenn man Leser von moderner Lyrik ist, und das bin ich – ich lese meistens nichts anderes als Gedichte –, kann man diese Art von Metaphorik durchgehend in der ganzen Moderne finden. Das kommt natürlich hinzu: Das sind also teilweise auch Lektüreergebnisse. Wahrscheinlich geht es bei mir immer um Atmosphäre. Und wenn ich ähnliche Atmosphären bei anderen Lyrikern finde, dann könnte man Gift darauf nehmen, daß die mich beeinflußt oder bestärkt haben.
Ein Gedicht der Bilder vom Erzählen, „Salz, das ich vergaß“, ruft die sprachliche Revolte im November 1989 in Erinnerung. Das Gedicht ist aus dem Schluß von Hilbigs Poem „Prosa meiner Heimatstraße“ herausgewachsen, das unmittelbar zur Wendezeit entstand. Es scheint, als wäre die Idee von Heimat für ihn um 1989 doch mehr als nur ein geistiger Ort in der Kunst gewesen.
Ich kann mich schon mit etwas identifizieren. Aber ich würde dazu das Wort Heimat nicht verwenden. Ich halte das für ein so stark belastetes Wort. Das habe ich geschrieben in Rheinland-Pfalz, knapp neben dem Elsaß. Da war eigentlich nichts zu spüren. Man konnte sich informieren über die Massenmedien, aber mehr nicht. Ich habe eigentlich nicht teilgenommen an diesem Umbruch. Da ich unter westdeutschen Linken gelebt habe, war ich vielleicht früher gewarnt als alle anderen über das, was da herauskommt. Also ich habe keine Gespräche mit Teilnehmern der Bürgerbewegung hier im Osten gehabt, sondern immer nur Gespräche mit westdeutschen Intellektuellen. Und denen standen die Haare zu Berge. Für sie war die DDR noch so etwas wie ein Abglanz von Hoffnung. Ihr Feind war ja der Konsumkapitalismus, der sie in eine Art weiträumige Gummizelle versetzt hatte, einen nachgebenden Widerstand. Also ich habe damals viel mehr mit solchen Leuten geredet, aber eigentlich viel mehr Skeptizismus erfahren über diese ganze sogenannte Revolution im Osten… Wenn ich darüber gejubelt hätte, hätte man mir dort das Maul verboten. Ich habe es als eine Befreiung von dem Ungebilde DDR empfunden, das ich irgendwie noch nie ausgehalten habe. Und das war mir schon letzten Endes eine Genugtuung.
Ein anderes Gedicht, „Nach der Prosa“, greift wieder die frühe surrealistische Metapher aus Büchners Lenz auf: „Kopfunter ging ich aus und liebte / lange zu wandeln im schwanken Grund der Himmel“. Bei Büchner steht sie für den beginnenden Wahnsinn des flüchtenden Außenseiters und Dichters Lenz. Doch Hilbig beschäftigt noch eine andere Metapher:
Was mich am meisten beeindruckt hat bei Büchner, das erste Mal, sind kurze Fragmente zum Woyzeck, die davon handeln, wie er übers Land geht und meint: „Alles unter mir ist hohl.“ Da habe ich ihn richtig beneidet, wie ich das gelesen habe. Wenn man in einem Bergbaugebiet aufgewachsen ist, spielt das eine Rolle: „Alles ist hohl.“ Die Lebensenergie hat man unter dem Fuß. Und diese Energie, die man zum Leben braucht, wird dem Boden, auf dem man geht, entzogen. Das ist eigentlich eine Absurdität. Sie wird einem so lange entzogen, bis man den Boden nicht mehr begehen kann.
Die Bilder vom Erzählen klagen über das Altern: das Leiden an all dem Ungetanen, den Verlust an Kraft und den nahenden Abschied vom Leben. Aber die Verwandlungen des Dichter-Ichs in diesem Zyklus – vom „Sauhirt“ und „Niemand“ des Anfangs durch alle Masken hindurch bis hin zum Ich des Autors selbst, um zuletzt nur wieder zu neuer Verwandlung aufzubrechen – veranschaulichen poetisch, worin für Hilbig der Beruf des Dichters besteht: zu erinnern an ein keinerlei Vorbestimmung anerkennendes, keinerlei „System“ oder Produktivzwängen untergeordnetes, zweckfreies Wachsen durch alle Verwandlungen hindurch, wie es jedermann gebührt. Und so steht am Ende, im Hausspruch „Pro domo et munde“, die Hoffnung auf erneute Wandlung für sich und diese Zeit.
Hoffnung auf Veränderung erscheint immer unbegründet. 1993, als man die Ergebnisse, zu denen die ostdeutsche Revolte geführt hatte, längst kritisch diskutierte, entstand Hilbigs Prosastück „Gewebe“ (in: Akademie der Künste, „Kunstpreis Berlin 1997“). Es hat gedanklich eine ganz ähnliche Struktur wie sein früher Essay „Die Arbeiter“: dort ein Ich unter dem lastenden „Turm der Ökonomie“, hier im gottlosen „Gewebe des Mehrwerts“, der weiter nichts als Mehrwert erzeugt. Es gibt also ein Problem, das sich nicht durch das Hinüberwechseln in die andere Staatsform gelöst hat: Wie kann sich der unfrei gehaltene Einzelne freidenken? Im Gespräch erwiderte Hilbig:
Ich glaube, was noch sehr viel problematischer ist, ist die Furcht des Menschen vor der Freiheit. Ich sehe diese Angst auch in mir: Immer wieder feststellen zu müssen, daß die Freiheit oder das, was als Freiheit bezeichnet wird, keine ist. Das ist ein schwieriger Gedanke.
Marie-Luise Bott, neue deutsche literatur, Heft 549, Mai/Juni 2003
Nicht einzeln nachgewiesene Zitate stammen aus Gesprächen, die die Autorin im Juni 2002 mit Wolfgang Hilbig (siehe Neue Rundschau 3/2002) sowie Adolf Endler, Gerd Poppe und Ingo Schulze führte.
Odyssee 2001
– Einsam und ausgestreckt auf groben Leinwandstücken,
Drin er schon Segel roch mit heftigem Entzücken!
Arthur Rimbaud, „Die siebenjährigen Dichter“, 1871
Auf den Segeln meiner Gedichte werden alle hinausfahren aufs offene Meer,
nur ich nicht. Denn ich bin nur der Weber, der Weber der sitzt.
Marina Zwetajewa, 1932
Und in meinem Auge flackert ein irres schwarzes Weberschiffchen,
das manische Weberschiffchen der Zivilisation.
Wolfgang Hilbig, „Gewebe“, 1993
Wolfgang Hilbigs Gedichtband Bilder vom Erzählen – der dritte nach abwesenheit 1979 und die versprengung 1986 – erschien zum 60. Geburtstag des Autors im August 2001 in bibliophiler Auflage und war kurz darauf vergriffen. Gedichte müssen sich rar machen, um überhaupt noch bemerkt zu werden: als das Fehlende.
Die zumeist 1999–2001 entstandenen „Bilder“ beschreiben in der Rahmensituation einen Zustand des Alterns und der Stagnation, der Aufbruch fordert. Dazwischen reihen sich im erinnernden Rückblick Stationen einer unhomerischen, dantesken modernen Odyssee: ohne Meer, ohne heimatlichen Hafen, durch die Wüsten des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens. Diese Bilder vom Erzählen, seit den 80er Jahren parallel zur Prosa Hilbigs entstanden und zum Teil selbst noch mit deren Schlacken behaftete Prosagedichte, stammen aus demselben Erzählfluß oder reflektieren dieses Schreiben, daher der Titel. Aber als Kondensate daraus und in Form einer navigatio vitae geordnet sind sie zugleich Bilanz. Das Schlußgedicht „Pro domo et mundo“ mahnt in eigener wie öffentlicher Sache, „anders“ zu werden. – Die folgende Lektüre sucht Klarheit zu gewinnen über die Bedeutung des Zyklus’ insgesamt sowie über drei Stilmerkmale Hilbigs: Humor, Hyperbel und literarisches Zitat.
I.
Heimat ist das wovon man ausgeht.
T.S. Eliot: Vier Quartette (1935–1942)
Der Eingang „Und dann erscheint das Abendlicht: die Zeit sich fortzustehlen –“ evoziert die konkrete Situation des Autors, das beginnende Alter, und zugleich die Tradition elegischer Dichtung. Ossip Mandelstams Gedicht „Tristia“ (1918) hebt an:
Ich lernte Abschied: eine Wissenschaft,
In Klagen – nachts – von unbedecktem Haar
Es geht zurück auf die „Tristia“ des Ovid, vor allem dessen Elegie in Erinnerung an die letzte Nacht im heimatlichen Rom vor dem Gang in die Verbannung ans Schwarze Meer. Hilbigs „Ich“ legt nicht Revolution noch kaiserlicher Bann den Gedanken nahe „sich fortzustehlen“, sondern der „antwortlose Lärm“ seiner Gegenwart, in dem selbst das geschliffenste literarische Wort („entworfen ganz aus dem Silber der See“) unterginge. Daher auch jetzt, am Beginn des Alters, nicht Lobrede, sondern elegischer Ton.
Den Aberwitz des „Literaturbetriebs“ hat Hilbig zweimal zum Gegenstand seines Schreibens gemacht. In den Frankfurter Poetik-Vorlesungen Abriß der Kritik (1995) analysierte er das Simulative sowohl einer medialen „Vergnügungsindustrie“, die jeden aufklärerischen Anspruch von Kritik abgegeben hat, wie einer ihr entsprechenden, widerstandslosen Literatur.
Dabei weiß Hilbig natürlich, daß zwischen der Literaturverwertung der Medien und dem literarischen Leser zu unterscheiden ist, dessen Formen der Resonanz längerfristig und leiser sind. Aber es ging ihm darum, den kritischen Anspruch für Literatur und Literaturkritik anzumahnen in einer bundesdeutschen Gegenwart, die mit soviel Hoffnung auf demokratische, d.h. kritische Öffentlichkeit nun auch die der ostdeutschen Autoren wurde.
Zum andern ist Hilbigs autobiographischer und gesellschaftssatirischer Roman Das Provisorium (2000) – über die Lebenskrise des Schriftstellers C. 1985–1989 mit befristetem Visum zwischen zwei Ländern, zwei Frauen und zwei Berufsexistenzen – auch eine mit radikaler Wucht ausgeschriebene Provokation jenes „Literaturbetriebs“. Wenn einziger kurzatmiger Zweck dieses Unterhaltungsmarktes ist, „irgendeine Denkbarkeit, gleich welcher Art, so aufzubereiten, daß sie sich zum Verkauf eignete“, so sollte er am existentiellen Ernst dieser schonungslosen Autorenbeichte zu Schanden gehen.
C. erkannte, heißt es im Provisorium, „daß die Bücher hier im Westen nichts mehr wert waren. (…) Zweimal im Jahr wurden (…) dem übersatten Markt eine Unmenge Bücher aufgebürdet, innerhalb kürzester Frist gilbten und schimmelten sie in den Ramschkisten vor den verödeten Buchhandlungen.“ C., der nur für die Idee gelebt hatte, ein Schriftsteller zu werden, glaubt sein Leben verpfuscht.
Auch der Industriearbeiter, der C. einmal gewesen war, gehört zu den „ökonomischen Auslaufmodellen“ dieser Gesellschaft am Ende des Industriezeitalters:
Beide Lebensformen hatten keine Zukunft mehr, er war komplett in die Irre gelaufen…
Da, wie C. meint, der Schreibende in Europa seinen Ernst und seine Bedeutung verlor, taucht hier erstmals bei Hilbig der Gedanke auf „aufzuhören, ein öffentlicher Schriftsteller zu sein“.
Das erscheint jedoch seinem alter ego C. „vollkommen und ohne Rest unmöglich“, und nicht allein deshalb, weil er den DDR-Oberen mit ihren Warnungen vor westlichem Kapitalismus nicht Recht geben will:
C. war ein Angestellter des Literaturbetriebs, von da aus gab es keinen Weg mehr zurück.
Neben ironischen Fluchtphantasien wie:
den Debilen markieren… und dann vielleicht klammheimlich schreiben, das Sozialamt durfte davon keinen Wind bekommen
taucht noch eine andere, absolute Bezugsmöglichkeit auf: C. denkt „plötzlich wieder an Gott“, so wie er vor seinem Bekanntwerden nur alleine für sich und „einen anonymen Gott“ geschrieben hatte. Auch in den „Bildern“ korrespondiert der Wunsch, „sich fortzustehlen“ aus „dem antwortlosen Lärm“, mit der Anrede Gottes („Saturnische Ellipsen“).
Der heimgekehrte Odysseus
Die Entscheidung für Klage als Grundton dieses Zyklus’ um des „Wahrheitsgehalts“ willens leitet in ambivalenter Form über zur Odysseus-Allegorie:
Die myrrhenverhängten Höfe der Klage: niemand betritt sie…
Es blieb davon ein Blitzen in der Takelung
irrend von Mastbaum zu Mastbaum.
Die Unmitteilbarkeit der Lebensklage an ein Zerstreuung suchendes Publikum changiert zur Trauer des „Ich“, selbst etwas auf seiner Lebensreise abgewehrt zu haben; im Bild des Odysseus: an den Schiffsmast gebunden, dem Gesang der Sirenen nicht gefolgt zu sein.
Das Übrige ist „Sumpf“, in dem der Weltenfahrer nun „am Saum von Ithaka“ stagniert. Während Homers Odysseus als Bettler verkleidet bei seinem Sauhirten Aufnahme findet, identifiziert sich Hilbigs „Ich“ ganz mit dieser Maske und rückt ab vom Bild des heroischen Kämpfers:
Ein Sauhirt bleibst du gehst in Lumpen
Ausgangssituation dieses Zyklus’ ist also der heimgekehrte Odysseus. Aber alle semantischen Zeichen deuten daraufhin, daß die Rückkehr an „faule Gestade“ und in die „Maske der Verstellung“ nicht Heimat sein kann. Ein zweiter Aufbruch, zumindest im erinnernden Rückblick auf die Ausfahrt des Lebens, kündigt sich an. So konnte auch die literarische Moderne – etwa Nikos Kazantzakis’ Odyssee (1938) –, anknüpfend an Dantes Odysseus-Gesang im achten Kreis der „Hölle“ nicht an eine Heimkehr des Weltenfahrers in häusliche Zufriedenheit glauben. Das zweite Gedicht nähert sich von unerwarteter Seite dem Motivbereich der Meeresfahrt:
Salz das ich vergaß – unerschöpftes Salz in den Tiefen
jeglicher Spur
Die Salz-Metapher kann bei Hilbig einfach für das aus der erinnerten „Meerflut“ des Lebens gewonnene literarische Werk stehen (so am Schluß der „Saturnischen Ellipsen“). Doch mit dem Signalwort „wiederholter November“ bezieht sich das 1999 datierte Gedicht auf das engagierte Sprechen des November 1989:
Reinheit die plötzlich austritt in der Straße
unbeschrieben von den Dichtern auf ihrem Rückzug –
unsichtbar für die Sprachlosen auf der Flucht aus der Dunkelheit –
Hilbig preist jene mit Protest gewürzte kritische Sprache („unerschöpftes Salz“), die aufklärte, was den nicht Sprachmächtigen nicht erkennbar war, und die benannte, was eine Literatur überging, die sich von ihrer kritischen Rolle zurückgezogen hatte und deshalb mit Grund fade und einflußlos geworden war.
Eine Variante dieses Gedichtanfangs erschien 1990 in Hilbigs Poem prosa meiner heimatstraße, das im Schlußteil die bis dahin unerhörten Sprachereignisse des November 1989 auf den Straßen der DDR reflektiert:
o salz das ich vergaß… versunken in jeglicher spur
tief verborgen: nur einzelner dichter vision –
reiner bodensatz der plötzlich austritt
in der straße…
in der straßen vermummung gründ ich mein wort
Während eine Gruppe von DDR-Autoren, noch immer auf der Suche nach „dem wahren Sozialismus“, sich von der demonstrierenden und schließlich feiernden Bevölkerung verlassen sah, konnte Hilbig sich 1989/90 mit ihr identifizieren:
verwundert erwachte das salz der sprache…
undurchsichtiges wäscht sich fein im november;
mit einem mal haben die wörter die straße betreten
aufgereiht in zeilen (…)
schulter an schulter: so erinnert
die straße sich geschluckten sinns der wörter
endlich geformt zu zeilen…
Das biblische „Ihr seid das Salz der Erde“ war für eine kurze Zeit realisiert und zu feiern: „schön ist ein volk in waffenlosem aufruhr“, „schön ist das salz der schöpfung das zu leuchten beginnt“. Natürlich flicht Hilbig auch Skepsis ein: „schön ist die rebellion der korrumpierten“, „der unbelehrbaren“ etc. Doch es dominiert der Lobpreis für diese „zwischenzeit“ des November 1989:
schön seid ihr endlich in der revolte
die ihr nicht vergessen werdet denn ihr seid gepriesen
waffenlos gewaltlos rückhaltlos und gepriesen
die ihr die straße mit euren lange verschütteten worten
gefüllt
Kaum noch eine Spur davon blieb in der Stadt heute. Das Gedicht der „Bilder“ schließt:
Aroma einer ozeanischen Wolke
(…) das in den starren Gabeln toter Äste hängt
Aber diese sprachliche Revolte, getragen weniger von der Schriftsteller-Elite als von einem Volk, das plötzlich zum „Salz der Erde“ wurde, ruft sich Hilbigs „Ich“ ins Gedächtnis.
„Wenn die Uhr tickt…“
Das dritte Gedicht evoziert den schöpferischen Zustand schlechthin, dem Dichter durch alle Zeiten hin Verse widmeten: die Schlaflosigkeit und ihr unerläßliches Requisit, die Uhr. So Mandelstam im Gedicht „Schlaflosigkeit. Homer“:
Homer, die Meere, beides: die Liebe, sie bewegt es.
Wem lausch ich und wen hör ich? Sieh da, er schweigt Homer…;
oder in:
Wenn die Uhr tickt: Grillenlieder
Fieberheißes Rauschen – fremd,
(…)
Feinen, dünnen Lebensboden
Den durchnagt der Mäusezahn,
Schwalbenmädchen, Schwalbentochter
Band mir los schon meinen Kahn…
In diesem Zustand wird selbst das leiseste memento mori vernommen. Die Frage nach der zubemessenen Lebenszeit erhebt sich und ob noch Wesentliches gelingen wird, bevor die Seele den Lebenskahn losmacht.
Hilbig folgt dieser Tradition:
Blicklose Uhr sie steckt im Schatten der Tapete…
Ihr mechanisch monotoner Ablauf hält das „Ich“ in quälender Reglosigkeit, in der nichts ein Ende und nichts einen Beginn hat:
In Endlosschleifen denkt ihr Hirn
die Wege meines Traums voraus
dahin ich ihr nicht folgen will
in tiefe Räume voller Unrast deren Wände Schatten sind.
Das hermetische Ticken der Zeit, gefaßt in stumpfe Reime, erzeugt nichts als Unruhe, die an den Todesvogel gemahnt:
Nicht Tod nicht Leben nichts beginnt –
wie ein schlafender Rabe röchelt die Uhr
und ich wache und wandle und träume doch nur.
„ruhlos am tisch“ lautet ein frühes Schlüsselwort Hilbigs in „h. selbstportrait von hinten“ (1966).
Im Roman Das Provisorium heißt es:
Es war unmöglich, einen gemeinsamen Nenner zu finden für das, was einen Dichter ausmachte. Bis auf die innere Unruhe vielleicht, (…) die sie ausnahmslos zu kennen schienen (…). Man wußte, sie war auch bei einem zu finden, der sich niemals vom Fleck rührte.
Was sich in dieser Unruhe staut, löst sich nicht durch Bewegung von Ort zu Ort, sondern verlangt Aufbruch zu sich selbst.
Das dunkle Bild „Aqua alba“ verweist im Titel auf das provenzalische Tagelied, das den Abschied von Mann und Frau nach heimlicher Liebesnacht beim ersten Licht des anbrechenden Morgens („alba“ oder „aube“) besingt. Ezra Pound aktualisierte die Form in seinem Distichon „Alba“.
Hilbig entwirft in seiner Meeresvariation auf das Tagelied der Troubadoure die Szenerie eines von Mondlicht überfluteten Liebesgartens. Ihn bevölkern Fische, die „den Trost / der Gemeinsamkeit“ kennen, und weißblühende Hortensien. „Wassergeister“ finden „endlich Heimstatt hier in diesem Blühn“. Im Gegensatz zum Wortfeld Wüste-Dürre-Durst deutet die Wasser-Metaphorik auf eine erotisch erfüllte Situation, in der auch das poetische Sprechen neu fließt. Doch bleibt die Bildebene in Hilbigs Gedicht eher rätselhaft verschlossen, als daß sie Sinn eröffnete.
Der Blumenname in „Aqua alba“ aber, die weiße Hortensie, erinnert an „H“, ein ebenso rätselhaftes Stück aus Arthur Rimbauds Illuminationen (1873–1875):
H. Die scheußlichen Entartungen schänden Hortensias harte Gebärden. Ihre Einsamkeit ist die Mechanik des Eros, ihr Ermatten der dynamische Antrieb der Liebe. In Zeiten schützender Kindheit war sie die heiße Hygiene der Rassen. Heute ist ihre Tür dem Elend geöffnet. Da entleibt sich in ihrer Leidenschaft oder Aktion die Moral der gegenwärtigen Wesen. – O schreckliche Schauder erster Umarmung auf blutendem Boden und im strahlenden Dunstkreis der Zeugung! – Findet Hortensia.
Das imperative „trouvez Hortense“ aus dem Mund des knapp 20jährigen Rimbaud ist Klage und Aufforderung an eine soziale Mehrheit, die verlorene, nicht entstellte Liebe früherer Zeit zu suchen.
Für Hilbig gehört Rimbaud zu den verwandtesten Stimmen, auf die er von früh an literarisch Bezug nahm („stimme, stimme“ 1969, „Ophelia“ 1976/77). Das Wiederauffinden von „Hortensia“ wäre gleichbedeutend mit dem Gewinnen von erfüllter „Gemeinsamkeit“ und „Heimstatt“, wie es in Hilbigs mondüberflutetem „Aqua alba“ geschieht.
Sein Bild des Unterwasser-Liebesgartens gleicht einem sagenhaften Vineta und der Hoffnung auf seine Wiederkehr. Man könnte mit Ernst Bloch von der utopischen Kraft eines „Nach-Bildes der Liebe“ sprechen. Hierin hat die Ausfahrt des Lebens, die in den anschließenden „Bildern“ beginnt, ihr verlorenes, aber aus der Erinnerung vorausleuchtendes heimatliches Ufer. Auf seiner Odyssee wird sich das „Ich“ noch des Liebesgartens von „Aqua alba“ erinnern.
II.
Und glaub ich noch ich ans Meer, so hoffe ich auf Land.
Ingeborg Bachmann, „Böhmen liegt am Meer“, 1964
„Neujahr – und ich sehe das Meer / Thalatta! Thalatta!“ So beginnt das Gedicht „Bilder vom Erzählen“, datiert auf die Jahrtausendwende 1999/2000. Mit dem Ruf „Das Meer! Das Meer!“ eilten, so berichtet Xenophon, die geschlagenen Söldner des Kyros nach langem Marsch über die Berge hinab zum Schwarzen Meer.
Und so rief es schon einmal ironisch in einem anderen Neujahrsgedicht Hilbigs aus dem Jahr 1973, als er die vom Meer überfluteten und zu Kohle gepreßten Wälder der Urzeit um seine Geburtsstadt Meuselwitz her noch in den Werköfen verheizte:
laßt mich das alte jahr zu früh verlieren
fließende formen
winter mache euch gefrieren
(…) das meer das meer wo war das meer
vor jahrmillionen war es hier: ich hing
an müden gründen die verbrannten
thalatta schrie ich
als ich in die wüste ging –
Die Wüste des „Ich“ jetzt ist die „Einsamkeit“ vor einem Hotelfernseher in Lissabon, dessen grauer Bildschirm ihm gegen Morgen das Meer vorspiegelt. Jegliche romantische Erwartung, die die Eingangszeile wecken könnte, wird sogleich ironisch gebrochen:
Thalatta! Thalatta!
Ich sehe das Meer
auf dem Bildschirm…
Diese Einsamkeit steht im größten Gegensatz zur „Gemeinsamkeit“ von „Aqua alba“. Hilbigs Humor setzt stilistisch immer dann ein, wenn das „Ich“ im Abseits äußerster Verzweiflung gezeigt wird und sich zu verlieren droht. Der Roman Das Provisorium ist voll von Beispielen dafür, wie Leiden an sich selbst und der eigenen Entfremdung ins Humoreske abgerückt wird, um ihm so Widerstand zu bieten. Es ist ein Humor von provozierend abgründiger Art, der gegen alle Konventionen bitterwahre Kapriolen schlägt. Ein Humor, der weiß, daß auch die Wahrheit der Verzweiflung zumutbar ist, aber ästhetisch in die Schwebe gebracht werden muß, die gegenhält gegen das zutiefst Verstörende der menschlichen Existenz. Hilbigs „Ich“ wird von keinem „Weltauge“ mehr und am wenigsten von dem des Hotelfernsehers gehalten. Doch in seiner Einsamkeit findet es sich wieder im Versuch, das Wesen des wirklichen Meeres auszusagen: „Ruhlos“ ist es. Und „es ist nicht zu engagieren das Meer. Sein Ziel ist die Mitte und sein Weg führt zum Rand. (…) Es mißt nicht seine Zeit. Es hütet kein Gesetz und es hortet keine Ehren und dennoch ist es reich und dennoch ist es voller Ruhm. / Und dennoch ist es ohne Schlaf das Meer“, weil es „seelenlos“ ist. Nur darin vergleicht sich das „Ich“ dem Meer:
Schlaflos bin ich: nicht mehr suche ich nach meiner Seele.
Schreibend wäre es auf der Suche danach. Tatsächlich aber ist hier analog zur Elementarkraft Meer auch eine Bestimmung des Dichter-Ichs gegeben: „Es ist nicht zu engagieren“, es geht auf den Grund und über jede Begrenzung hinaus .
Niemand = Jedermann
Hilbig handhabt frei die traditionelle Zuordnung von Bild und Sinn der christlich-religiösen oder der erotischen Schiffs- und Meeresallegorie. Bei ihm können alle Bildelemente zwischen der persönlich-existentiellen, der erotischen und der gesellschaftlichen Bedeutungsebene hin- und herwechseln. Schon 1938 hieß es in Nikos Kazantzakis’ prometheischer Odyssee:
Ich bin das Schiff, das Meer, die Fremde, bin der wilden Stürme Wehen.
Im Mittelteil des Gedichts greift die Metaphorik von Meer, Flut und Salz über auf Stadt und Zimmer im Novembernebel:
Ich schwimme durch meine Gedanken die ich nicht mehr beherrsche. Immer weniger habe ich die Dinge beherrscht die mein Leben ausmachen.
Schließlich wird die Meer-Metapher zur Hyperbel:
Brandungsdonner vor den unsteten Ufern im Himmel.
Die Ordnung von Himmel und Erde kehrt sich um:
Alles kann sich in sein Gegenteil verwandeln. Und in noch weiteres…
Die Hyperbel veranschaulicht und intensiviert das Entgleiten in eine tiefe existentielle Verunsicherung. Zuletzt tritt der Rabe als Todesvogel und spöttisch beäugter „schwarzer Bruder“ des „Ich“ hinzu.
Im Gedicht „Increatum“ ist einer geboren, aber noch unerschaffen. Schreibend macht er sich daran, den „Niemand“ abzutun und „Ich“ zu werden:
Ich schrieb ich schrieb: niemand der schrieb –
So begann es in der Jugend. „Ich schlief und schlief: niemand der schlief … / ich schrieb im Schlaf und ich schlief im Traum“. So setzte es sich fort mit der Listigkeit eines Odysseus, der es angesichts des Zyklopen Polyphem vorzog, „Niemand“ zu heißen.
Die Gedichte Hilbigs sind Selbsterkundungen vor dem Hintergrund einer Herkunft, die ihn sozial als Arbeiter und politisch in der DDR nicht als Schriftsteller-Ich vorsah und in der es nicht ungefährlich war, aus dem Schutz des „Niemand“ herauszutreten. Selbstverleugnung als verdeckte Form der Selbstbehauptung erzeugt gleichwohl Zweifel.
Im Roman Das Provisorium jagt der junge Arbeiter C. einem Beweis dafür nach, „daß er ein wirklicher Schriftsteller sei“. Er schreibt täglich. Aber die flüssig entstehenden Texte „vertieften noch seinen Unglauben, sie gründeten in dem Nichts, als das er sich fühlte. Sie versuchten, seine Nicht-Existenz zum Ausdruck zu bringen, (…) indem sie sich vom Boden der realen Welt vollkommen lossagten; ihre rudimentären Handlungen fanden in einer erfundenen Umgebung statt, in der weder Licht noch Dunkel herrschten, wo eine Schattengestalt, vereinzelt und ziellos, an anderen Schattengestalten vorüberhastete, durch die phantastischen Gefilde eines Schattendaseins.“
Da diese Texte von den Verlagsredaktionen der DDR abgelehnt wurden, scheint es dem schreibenden C. erwiesen, daß er „ein Lügner“ und Niemand sei.
Doch dieser „Niemand“ ist von Hilbig als ein „Jedermann“ gedacht. Jeder hat in sich die natürlichen Voraussetzungen und die Sehnsucht, erzählend, im Dialog sich selbst zu erschaffen.
In der Rede „Unfähigkeit zur Anonymität“ zur Verleihung des Brüder-Grimm-Preises 1983 sprach Hilbig von den namenlos überlieferten mythischen Stoffen und Sagen, die ihren „dialogischen Charakter“ niemals verloren, also für das Vorhandensein eines, wenn auch anonymen, individuellen Elements zeugen, das sich von Sprecher zu Hörer im Weitererzählen erhält. Darin erkennt er „den tröstlichen Sinn, den das Dasein von Anonymität auch haben kann: den Glauben daran, daß in jedem Menschen natürliche geistige Quellen für ein Denken vorhanden sind, die eine Verständigung a priori ermöglichen“, „eine Art Urgemeinsames zwischen den Menschen“, welches die Literatur weiterträgt.
Mit der Suche nach Herkunft und Bestimmung des eigenen Ich fort von Entfremdung und Stagnation setzt eine zweite Erschaffung in der Dichtung ein. Von dieser unabgeschlossenen Reise zu sich selbst handeln die Bilder vom Erzählen. Doch scheint jetzt die Beunruhigung dazugekommen, es könnte beim „Increatum“ bleiben und der Dialog nicht mehr gelingen.
Im Provisorium heißt es:
Es geschah ihm in der letzten Zeit immer öfter, daß er sich fragte, wie er geworden war, was er geworden war… und immer häufiger hatte er das unheimliche Gefühl, daß es zu diesem Nachdenken eigentlich zu spät sei;
ich werde allein bleiben mit meiner Vergangenheit, dachte er, und mit meiner nicht mitteilbaren Angst.
Da es eine Reise zum Tod ist und die Zeit begrenzt („Abendlicht“), liegt Melancholie über ihr. Für die mittelalterliche Temperamentenlehre stand die schwarze Melancholie unter dem Einfluß des Kronos-Saturn, der als höchster, der Erde fernstehendster Planet die menschliche Seele auf die erdabgewandte Seite zog, sie zu Kontemplation und Selbsterkenntnis rief und mit höchstem Wissen und prophetischer Gabe beschenken konnte. Zur Dialektik dieses Melancholieverständnisses gehörte andererseits die Gefährdung durch Trägheit des Herzens und Trübsinn bis hin zu Wahnsinn. Entscheidend für die Theoretiker der Melancholie war die Frage, „wie es gelingen könne, dem Saturn die Geisterkräfte abzulauschen und doch dem Wahnsinn zu entgehen.“
„Ach meine Zeit ist um…“
Hilbigs großes dreiteiliges Gedicht „Saturnische Ellipsen“ setzt ein mit einer Nüchternheit und Endgültigkeit, die an Günter Eichs „Inventur“, dieses Muster der „Kahlschlagliteratur“ nach 1945, erinnert:
Das ist die Stadt die ich nicht mehr verlassen kann…
dies der Sonnabend den ich versäumte wie die Tage zuvor
Unruhe befällt das „Ich“, denn es kennt nicht „die Fortsetzung“ seiner selbst, sei es in der Zeit oder im Werk.
Da das Wohin unklar ist, wendet es sich in den elliptischen Bahnen der Melancholie zurück zum Woher seiner Jugend, um von dorther Klarheit zu gewinnen:
Und sann auf die Zeit dort vor den Toren: im wüsten
Feld war ich allein und hörte schon die See
doch sah sie nicht und floh den Rand der unsichtbaren Klippen –
Das Wortfeld Wüste-Dürre-Durst ist im Roman Das Provisorium verbunden mit dem Entbehren der Frau, „dieser endlosen Wüste von Versäumnis in sich“. Wenngleich nicht explizit zitiert, gehört doch zum Hintergrund der Bilder vom Erzählen insgesamt T.S. Eliots Poem Das wüste Land (1922): die Wiederbelebung und Erneuerung herbeisehnende Bestandsaufnahme eines unfruchtbar gewordenen Daseins (die mythische Figur des Fischer-Königs, die Gralslegende), zerstörter, zu öder Mechanik entwürdigter Liebesbeziehungen und einer agonisierenden Gesellschaft in den Steinwüsten der Stadt. Ausdrücklich dagegen zitiert Hilbig, um sich davon abzusetzen, den ersten der Cantos (1917ff.) von Ezra Pound. Dessen Dichter-Held Odysseus holte sich gleich zu Beginn seiner Irrfahrt am Gestade der Kimmerier, dem Ende der Welt, richtungsweisende Auskunft von den Toten. Für Hilbigs „Ich“ dagegen ist das Todesreich ein unbewohnter Schreckensort („unpeopled cities“) ohne jede sinnstiftende Orientierung.
Dem „wüsten Feld“ von einst nahe am Ausgang des Lebens entkommen, führt das „Ich“ gleichwohl Klage:
Ach meine Zeit ist um –
war schon vorbei als ich zum ersten Mal von ihr gehört –
kann nicht mehr fort aus dieser Stadt wo ich nie eintraf –
Anerkennung und Existenz als freier Schriftsteller kamen für den Autor spät. Die Stadt ist nicht Heimat, die Lebensreise stagniert, die Fluchtwege sind „verbraucht“. Das „Ich“ klagt über vertane „Mannesjahre“ und klagt an im Pathos des geprüften Hiob oder Jesaja, der weiter Leid künden muß:
O Herr was tat ich dir daß du nicht nimmst
den Fluch aus meinem Mund die Schmach von meiner Stirn
Protestierend variiert Hilbig einen Vers aus Eliots „Vier Quartetten“:
Ein Spott
mein End gewirkt in meinen Anfang.
Der anschließende Teil der „Saturnischen Ellipsen“ fragt einem anderen Vers von Eliot nach:
Heimat ist das wovon man ausgeht.
Wenn Hilbig dabei von „den Wäldern die es nicht mehr gibt“ spricht – und im Roman Das Provisorium von „den Wäldern seiner Kindheit“ –, so klingt hier Friedrich Hölderlins Ode „Die Heimat“ mit:
Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom
Von fernen Inseln, wo er geerntet hat;
Wohl möcht auch ich zur Heimat wieder;
Aber was hab ich, wie Leid, geerntet? –
Ihr holden Ufer, die ihr mich auferzogt,
Stillt ihr der Liebe Leiden? ach! gebt ihr mir,
Ihr Wälder meiner Kindheit, wann ich
Komme, die Ruhe noch einmal wieder?
Der Übergang zu dem, was Heimat hätte bedeuten können, vollzieht sich bei Hilbig über das Motiv der „dunklen Wolke“ zu Häupten des „Ich“. Dieses Bild löst eine andere Ode von Hölderlin auf:
Zu lang schon waltest über dem Haupte mir,
Du in der dunkeln Wolke, du Gott der Zeit!
Zu wild, zu bang ist’s ringsum, und es
Trümmert und wankt ja, wohin ich blicke.
Ach! wie ein Knabe, seh ich zu Boden oft,
Such in der Höhle Rettung von dir, und möcht,
Ich Blöder, eine Stelle finden,
Alleserschüttrer! wo du nicht wärest.
Die drohende Macht von Endlichkeit und „Zeitgeist“ manifestiert sich in Hilbigs konkreter Gedichtsituation der Stadt am Samstag Abend in Autos, die feststecken „im Mastdarm der Straße“, in Zeitungsfetzen der „Prawda und Berliner… Saturday Evening Post… Today“ und geldzählenden Kellnern im „toten Raum“ eines Cafés. Plötzlich aber zieht ein Erinnerungsbild herein, ausgestattet mit den Motiven des Liebesgartens von „Aqua alba“:
[War da] ein weißer Schatten aus den Wäldern die es nicht mehr gibt?
Aus einem Garten bei den Wäldern
darin das Mondlicht der Hortensien war… wie Salz
von dem die Welle sich zurückzog?
Der Kontrast dieses unerreichbar fernen Zufluchtsbildes von Heimat, Ruhe und schöpferischer Sprache („das weiße Salz der Wasser“) zum „strahlenden Geröll der Stadt / wo jeder Traum verbraucht und abgegolten ist / bezahlt wie greller Schund im Bahnhofskino…“, treibt das „Ich“ ruhelos fort:
Ich ging davon wie Parzival
der nichts von seiner Herkunft weiß und nicht die rechte Frage
stellt im offenbaren Reich voll Siechtum und Gestank.
Die Altersklage erhebt sich von neuem („Ach meine Zeit ist um“) und endet mit der Vision einer Saturn-Nacht, da der Tod heranreitet und sich das Nichts auftut.
„Blättern im Traumbuch der Moderne“
Den Schlußteil der „Saturnischen Ellipsen“ beherrscht demgegenüber ganz das Erinnerungsbild des „Gartens“:
Es bleibt mir nur der Einen zu gedenken:
an dich zu denken die mit mir dort draußen war…
Hilbig kehrt zurück zu seinem frühen Gedicht „erinnerung an einen apfel“ (1966) und gestaltet es aus zu einer Liebesgartenszene, die auf das Parzival-Epos Bezug nimmt. Wie flüchtig auch immer diese Oase in der Wüste war, hier war fruchtbares Dasein. Das „Ich“ befriedet sich im Gedanken daran, daß von ihm selbst „ein träumend Salz“ bleiben wird, auch wenn es sich von jener Heimstatt der Liebe entfernen mußte. Dieses Stück steht wie eine „Ruhe auf der Flucht“ im Zyklus der „Bilder vom Erzählen“.
Der Titel der folgenden strophigen Reimode, „Die Zisterne“, bezeichnet einen Brunnen in der Wüste. Für Hilbig war ein solcher lebensspendender Brunnen die Literatur. Neben Hölderlin, den Romantikern, Rimbaud konnte er die europäische Moderne in einem außergewöhnlichen Buch eingesammelt finden: Hans Magnus Enzensberger – dem Hilbig 1966 das Gedicht „gegen den strom“ widmete – hatte 1960 mit dem Museum der modernen Poesie einen frühen Bewässerungsversuch der deutschdeutschen Wüste unternommen.„Einmal ihr Musen noch blättern / im Traumbuch der Moderne“, setzt Hilbigs Gedicht ein. Auch hierin ist Zeitklage enthalten. In Hölderlins Anruf „An die Parzen“ heißt es:
Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen;
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Hilbigs „Ich“ stellt bereits das zweifelnd in Frage:
Einmal noch den trüben Spiegel plündern
ohne Selbst und ohne Sendung…
Mit euch im Verein?
Der Musenanruf schlägt dialektisch um in Zeitklage. In größtmöglichem stilistischem Gegensatz wird dem „heiligen Hain“, der noch aus Hölderlins hymnischer Sprachwelt herstammt („das Heil’ge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht“), „Handel und Wandel“ des gegenwärtigen Literaturbetriebs entgegengehalten:
Ihr rieft mich zu spät in den heiligen Hain…
dort stritten schon Makler um unser Gebein…
und Nattern sah ich züngeln aus den Mündern
der Nymphen aus ergrautem Stein.
Die Bilanz des abschließenden Quartetts scheint auf Verlust des Dichtens in dieser Zeit hinauszugehen:
Wir zielten auf die Schönheit doch die war in der Ferne
was bleibt uns nun von allem was wir ausgelitten?
O Musen in den dunklen Wasserspiegel schütten
die nächtlichen Himmel ungereimtes Licht der Sterne.
Die hohe Kunst der Reimode aber, in der das ausgesprochen wird, ist in einer zweiten dialektischen Volte allem zum Trotz Hilbigs Bekenntnis zum Dichterberuf.
„Der Schlaf der Dämmerung“ setzt die Reise aus den Stadtwüsten hinaus in nächtlich surreale Wüsten fort. Dabei wird die phantastische Einschiffung zu Beginn des Gedichts elliptisch reflektiert. Das Schlüsselwort kann „am Ende der Neuzeit“ ohne Glaube, Liebe, Hoffnung und damit auch ohne Gedichte nicht mehr selbstverständlich gebraucht werden:
Dereinst von Gott gesetzt in die großen Häfen der Welt –
sie sind noch immer haltbar: doch ohne Grund an diesem Ende ohne
Gewicht und Ziel.
Diesen elliptischen „Schiffen“, die eine schiere Unmöglichkeit in dieser Zeit zu sein scheinen, entsprechen poetische Texte:
Zeilen auf den Blättern eines Toten
Sie werden gefügt und vollendet „auf dem Tisch eines Flüchtlings“, „wie eine Klage ohne Gewicht und ohne Laut in der Stille“, wie eine „große Verrufung“, die in der Stille verhallt, unter surrealer Anteilnahme allein der Dinge:
Und nur die Vorhänge an den Fenstern beginnen leise zu bluten.
Ein Inferno ohne Purgatorium
Auf diesen Schiffen der Poesie der Moderne nimmt das „Ich“ nächtliche Ausfahrt, „erfüllt von brunnentiefer Schlaflosigkeit die irgendwo in einer Wüste begann“. Weit reicht die Tradition der Wüsten-Metapher in Hilbigs Dichtung zurück. In „gleichnis“ etwa heißt es:
während wir erneut durch mürbe wüsten wanken
auf wegen die zu keinem ende reichen
zu keinem ziel zu keinem hoffnungsvollen zeichen
(…)
schlägt über unsren jägern
das rote meer zusammen –
Konnte das 1970 noch auf das „rote“ Land seiner Entstehung bezogen werden – zahllos die Beispiele aus Hilbigs Prosa, in denen die DDR ein wüster, „höllischer Landstrich“ und die Arbeitswelt um Meuselwitz schlechthin „Acheron“ genannt wird –, so war das doch, wie Adolf Endler nachdrücklich betont hat, von Anfang an radikaler und über das Lokale hinaus grundsätzlich gemeint: Das Leben im ausgehenden 20. Jahrhundert war aus der Sicht dieses Dichters ein Inferno ohne Purgatorium und Deutschland nur sein spezieller Eingang in die Unterwelt, ja selbst schon gespaltene „Schattenwelt“. Konsequent dauert die Wüsten-Metaphorik deshalb bei Hilbig fort – etwa in „der poet und die wüste“ 1986 – und erreicht hier in den Bildern vom Erzählen als Essenz einer Lebensreise ihren Höhepunkt. Kazantzakis’ moderner Odysseus segelte zu den Quellen des Nil, begegnete der Natur und den großen Religionsführern und strandete schließlich im Sargboot in der eisigen Einsamkeit der Antarktis. Hilbigs „Ich“ folgt den Bahnen der Zugvögel Kranich und Schwalbe – bei Mandelstam Bilder für die Kraft des poetischen Wortes – an den Nil, zu den Tempelruinen Ägyptens, und weiter zu den Grabfeldern Smyrnas, wo er im Garten eines Alchimisten sich des Vergessenen bewußt wird, das noch zu sagen ist. Hier endlich stellt sich ruhige Gelassenheit ein, „lauschend den Stimmen der Wasser die in den Quellen sprachen“.
„Die Brise“ datiert aus dem Jahr 1986, als Hilbigs einjähriges Visum für Westdeutschland auslief und er nicht in die DDR zurückkehrte. Es ist ein Liebeslied in der u.a. von Dante geprägten Form größtmöglicher Freiheit und Beweglichkeit der Reimdichtung, des Madrigals. Es kehrt zur erotischen Bedeutung der Meeresallegorie zurück. Mitten im schwärzesten Ennui, „der uferlosen Schritte“ müde und bis zum Selbstüberdruß umgeben von „Lüge“, kommt im abschließenden Verspaar dem „Ich“ plötzlich aus dem Haar der Geliebten neuer Wind des Begehrens auf. Hier, und nicht in einem wie auch immer gearteten „Land“, findet es endlich Heimstatt. „Seestück für C.“ bringt eine Krise ins Bild. Es ist Hilbigs literarischem alter ego C. aus dem Prosawerk zugeeignet. Im Dialog mit seinem Doppelgänger fällt das „Ich“ ihm zur Seite: „unsichtbar“, „ruhmlos“, „haltlos“. Es beklagt seinen verfehlten Weg aus dem Schatten ins „Licht“ der Öffentlichkeit, das ihn verführte. So nahm auch Odysseus Schaden, als er im Augenblick des Triumphs die Tarnkappe des „Niemand“ abwarf und seine Identität zu erkennen gab: Fortan stand sein Leben unter einem Fluch.
Das großartige Gedicht „Mittag“ setzt in sieben Zeilen die ganze Existenz in die Schwebe. In einem Moment der Stille und des Gleichgewichts – „Balance der eingelegten reglos ruhenden Ruder“ – unter dem Mittagslicht und über der Meeresfinsternis steht spürbar das ganze Leben auf dem Spiel. Das Bild ist von derselben Magie wie jener große metaphorische Ausblick kurz vor Schluß des Romans „Eine Übertragung“. Dort erblickt C. plötzlich in einem Meeresbild jene „Geschichte“ seines Schreibens, die er schreibend gesucht hatte und jetzt in eine weitere, ältere von Homer an einbezogen sieht: Auf einer reglos in gleißendem Mittagslicht daliegenden Seebucht zieht fern „ein winziges Boot über die Fläche“. Seine Bugwelle erreicht den Küstenbogen, schwingt zurück, neue vom Horizont herkommende Wellen kreuzend, bis hin zum Boot und bewirkt „inmitten großer Windstille“ eine „winzige Kursänderung“.
„Jedes Schiff einmal kreuzt der Argonauten Route…“, folgert der Erzähler. Der hinter seinem Horizont eingeschlossene C. nimmt den Schlag der sich kreuzenden Bugwellen wahr, ausgelöst durch Homers Gesang von einem Schiff „auf driftender Irrfahrt im Jenseits aller bekannten Region. Und in tiefer Flaute des Mittags war da der Nachhall einer Bugwelle, deutlich, den alle bezeugten, doch es gab kein zweites Schiff auf diesem Meer seit einem Jahrhundert, es konnte nicht sein…“ So setzt sich die literarische Überlieferung von Grenzüberschreitungen über alle ideologischen Begrenzungen hinweg in Bildern des Erzählens fort.
Das Madrigal „Die Antwort“ (1987) besteht aus zwei Fragen, die die ganze Lebensreise in Bewegung halten auf eine Antwort hin, die ausbleibt: „Was war ich gestern“ und „Wer bin ich späterhin“? Die Leben erhaltenden oder beendenden Schicksalsschwestern schweigen jedoch und das „Ich“ träumt weiter „Wirklichkeit“. „Unsicheres Ufer (M.)“ gibt ein Bild der Rückkehr an den Ort der Kindheit zehn Jahre nach dem Herbst 1989. Hier ist der „Strand“, von dem aus die Reise zur Selbsterkenntnis begann. Doch er ist nicht Heimat:
Gestaltlos setzt Erinnerung die Spur –
unkenntlich kamst und gingst du in das Unbekannte fort.
Ein letztes Liebesmadrigal ist betitelt „Inverto“, was etwa „umgewandt“ oder „Umkehr“ bedeutet. Wie in „Seestück für C.“ klagt das „Ich“, zu lange im öffentlichen „Licht“ geblieben und dabei sich selbst abhanden gekommen zu sein. In diesen „Spleen“ hinein – Baudelaires Signalwort aus den Fleurs du Mal bezeichnet den Zustand größtmöglicher Entfernung vom „Ideal“ – fällt im abschließenden Reimpaar als Traumbild rettend die Erkenntnis dessen, was nicht verlorengehen darf und deshalb Umkehr verlangt: „dein Gesicht“. Das erotische Thema in „Der Garten von Gerhard Altenbourg“ gewährt ein kurzes Intermezzo zwischen dem, was ruhelos andrängt: „das Ungesagte“, „Ungestalte“, „Ungeformte“, all „das Unterlassne“ auf dem Weg zu sich selbst, das geformt werden will.
Es nimmt im folgenden Reimgedicht die Gestalt eines Revenants und Nachtmahrs an. In „Nachtstück mit Erlen“ klagt das „Ich“ über die immer wieder mißlingende „Ankunft“ in seiner Zeit, solange ihn „der toten Ahnen Macht“, „die trübe Mahr“ an seiner Seite angreift. Anders als im Gedicht „Der Erlkönig“ gibt es hier keine verklärte letale Reise „zurück zur Natur“. Nicht Verlockung, nur lebenszehrendes Grauen geht von der Todeslandschaft aus. Beschwörend spricht sich der Wegfahrer Mut zur Fortsetzung seiner Lebensreise zu:
Geh weiter wend den Blick von diesem Irrstern der dir blinkt
„Elaborat in M.“ kehrt zu den Anfängen des Schreibens im Geburtsort Meuselwitz zurück:
Schlaflos ließ mich meine Nacht: Seit Jahr und Tag
und länger noch: und dennoch lebt ich nur indes ich schlief –
Die Lösung dieses Paradoxes wäre der „Traum“, d.h. der poetische Entwurf von einem anderen, noch unerfahrenen Leben:
Nachts aber in der Mitte allen Schlafs der Welt
begann sich neben mir das Leben loszumachen
und schlich ins Unbegangene fort
Es ist das, was Hilbig mit dem Titelwort „Elaborat“ selbstironisch ein wenig herabsetzt zum nicht sehr sorgfältigen Geschreibsel. Dabei war es doch die Ausarbeitung einer hoch bewußten Sprache als Gegenlebensentwurf, befeuert vom „Haß“ auf das Vorgegebene.
Das nächtliche Geräusch rangierender Züge weckt Träume von der „großen Fahrt“, während das „Ich“ in den Tagebaugebieten von „M.“ in ein Dasein ohne Freizügigkeit gebannt scheint: „erstarrt und unerwecklich / und ungeboren“. Über der Landschaft der Jugend liegt fortwährend der Fluch des Krieges: der tote Vater „fern im Osten“, die Mutter „ruhlos“ im dunklen Haus und dazwischen ein rastlos nach Glück Suchender. „Und da ich nicht den Anfang sah / des Unglücks kann es mir nicht enden seit Tag und Jahr“.
Der Himmel – ein Abgrund
Das dreiteilige Gedicht „Nach der Prosa“ (1999) hebt an mit Altersklage: „Nun bin ich alt und in den Staub geworfen“, klagt im Gegensatz zu seinem Titel nicht über das Ende der Prosa, sondern der Gedichte („aller Gesang gesungen und zu grauer Asche ward mein Vers“), und geht über zur Anrede eines Du:
Vergessen wird mich Durst Verachtung Heuchelei
worin ich glänzte – eh ich dich besang: dir wollt ich eine Blume pflücken und brach dabei ins Knie.
Der Mittelteil schaut zurück zum Einst: „Ah! früher liebte ich fluchend“, „zu trinken liebt ich mit der Hand am Schalter / des Lebens: kopfunter ging ich aus und liebte / lange zu wandeln im schwanken Grund der Himmel – / kein Gott der mir ein Halt gebot… / ich hörte mich singen schluchzend zwischen den Lichtern / der Sterne: die mir zu Füßen lagen wüst verstreut / wie Trinkgeld in der Spelunke des Dunkels…“
Dieses hyperbolische Bild vom Gesang in Einsamkeit und Dunkel begegnet bereits in Hilbigs Erzählung „Herbsthälfte“ 1973. Dort signalisiert das programmatische Motto lans das künftige Abweichen des Ich-Erzählers vom Kurs eines „käuflichen Realismus“, überdrüssig „einer folgsamen Zukunft“ und leid, „das Feld unter der Hirnschale einem Zensor des Jenseits zu räumen“. Soziale Ausgrenzung wird riskiert. Ab jetzt soll es darum gehen, auch den anderen, „ungesehenen Teil“ der Dinge ahnen zu lassen:
Ich wagte nicht, weiter zu gehen, als fürchtete ich zur Unzeit aufs Ganze zu gehen, ich wußte, man geht plötzlich ohne Bewußtsein im Unsichtbaren, die Füße in der Höhe zwischen die Sterne setzend, schwerelos, aller teuer gewordenen Schwere los, man steigt, lans, kopfunter über die Sterne, über dem Kopf das tiefe Wasser, über dem Fuß den tiefen Himmel.
Dieses surreale Bild hat literarisch Geschichte. Zu Beginn von Georg Büchners Erzählfragment Lenz (1836) heißt es:
Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf-, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehen konnte.
Diesen Satz, der auf den beginnenden Wahnsinn des Dichters und flüchtenden Außenseiters Jakob Michael Reinhold Lenz hindeutet, übersetzte Paul Celan 1960 in seiner Büchner-Preis-Rede „Der Meridian“ in einen poetologischen Zusammenhang:
Ich suche Lenz selbst, ich suche (…) seine Gestalt: um des Ortes der Dichtung, um der Freisetzung, um des Schritts willen.
Celan meint dabei nicht die konkret-biographische Person, sondern, wie er sagt, „den wahren, den Büchnerschen Lenz“, also die dichterisch verwandelte Gestalt. Er findet „den Ort, wo die Person sich freizusetzen vermochte als ein befremdetes Ich“ in Büchners Satz: „nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehen konnte.“ Und er kommentiert:
Wer auf dem Kopf geht, (…) der hat den Himmel als Abgrund unter sich.
In welchem Sinn schreibt Hilbig diese Hyperbel weiter aus?
In Celans Konzept der „Meridian“-Rede bedeutet Dichtung „Gegenwort“, „Akt der Freiheit“ und „Majestät des Absurden“, da sie im Vergleich gegen die jeweils herrschende Konvention „für die Gegenwart des Menschlichen“ zeugt. Dichtung geht mit dem Ich des Autors in einen nicht- konventionellen, „un-heimlichen Bereich“ voran – „den Himmel als Abgrund unter sich“ – und setzt es dort frei.
In diesem Sinn bezeichnet Celan Dichtung als „Atemwende“. Sie hebt die Entfremdung für einen Augenblick auf und macht für die Begegnung mit einem Gegenüber frei. Vielleicht war schon Hilbigs Gedichttitel „Inverto“ in diesem Sinn als „Atemwende“ zu verstehen.
Celan begreift Dichtung als Utopie, insofern sie mit der Frage nach dem Woher und Wohin der gegenwärtigen Dinge „ins Offene“ führt. Diese Wege der Dichtung – kreisförmige Umwege einer Stimme „auf der Suche nach sich selbst“ zu einem wahrnehmenden Anderen hin – nennt Celan schließlich „eine Art Heimkehr“. So verstanden wäre auch Hilbigs frühe Dichtung Freisetzung und Bewegung auf eine utopische Heimat hin gewesen, die ihren Ort nur im Gedicht selbst hatte. Auf dieses frühere Singen „kopfunter“ am Rande des Abgrunds blickt das „Ich“ zurück, um sich zum Schluß, im Kreuzreim gebunden, wieder einem ambivalenten Jetzt zuzuwenden:
Nun ging ich aufrecht: eine Nachtviole war mein Ziel
und wankte doch – ein einzig falscher Schritt wars bloß –
dir wollt ich eine Blume pflücken und ich fiel’ der Erde in den Schoß.
Offen bleibt, ob das Freisetzung bedeutet oder ein aus der Höhe prometheischer Herausforderung gefallenes Ende „allen Gesangs“ – „nach der Prosa“.
„… ein Reisiger auf seinem Stuhl“
Daß Melancholie in Tobsucht münden kann, wußte schon die Humoralpathologie der frühmittelalterlichen Ärzteschule von Salerno. Ein Tanz solcher Raserei ist die Tarantella. „Mondsüchtige Tarantella“ betitelt Hilbig sein folgendes Reimgedieht, das die Absurdität einer Fahrt ins Bild setzt, die das Meer verlor:
Wir tragen das Schiff über den Berg
wir tragen das Schiff durch den Wüstensand
und wir finden nicht wieder zum Strand.
Bildassoziationen aus der „Anabasis“ und dem Medea-Mythos kreuzen sich hier. So trugen die Argonauten, als sie mit Medea auf der Flucht am afrikanischen Wüstenufer strandeten, ihr Schiff tagelang durch die Sandböden. Hilbig hat diese Szene in seinem Fragment „medium medea. Chöre“ im Zusammenhang mit Verlust des Liebesbegehrens und Verarmen der poetischen Stimme gestaltet. Hier wird das zu tragende „Schiff“ der Dichtung, einst rettende „Arche“, schließlich zum „Sarg“, unter dessen Last der Gesang verstummt („und singen schon lange nicht mehr“). Jedes verlorene „Glück“ auf dieser Irrfahrt wird „mit Silber“ entlohnt. Aber ein Ende der absurden Reise ist nicht in Sicht. Das folgende Gedicht kontrastiert wieder Jetzt und Einst. Gradmesser für die Veränderung des „Ich“ dazwischen ist der von Hilbig oft – und am eindrücklichsten in „der poet und die wüste“ – beschriebene Mond. Schon in einem frühen Selbstportrait von 1966 war er Wegbegleiter und Dialogpartner des ruhelosen Dichters „h“:
dem mondeslicht das schwächer in die kalten
haine hängt (…)
glaubt er davonzufahren auf dem Stuhl.
In prosa meiner heimatstraße nennt Hilbig den Mond „seiner wahrheit weißer fleck / hinter den wimpern / seiner jugend weißer erdteil“ und „aluminiumteller voller verdunstender wirklichkeit“.
Das Gedicht der „Bilder vom Erzählen“ zeigt schon im Titel eine Krise an: „Mond. Verlust der Gewißheit“. Der Mond des alternden „Ichs“ ist nackt, „ohne Gott und ohne Schatten“. Die Nacht unter ihm gleicht nicht mehr den rauschenden „unbezähmbaren Wassern des Ozeans“ von einst (Das Provisorium), sondern einer galligen „verblichenen See“. Der „Schatten“, das dichtende Doppelgänger-Ich, ist verstoßen, seine Zukunft „abgegolten“. Die zurückliegende Vergangenheit erscheint in zwei großen Einsamkeitsmetaphern als „Steinanger meines Glücks“ und „Bergwerk meiner Trauer“.
Die nächtliche Ausfahrt des Dichtens war damals:
mein durstiges Geschäft
in trocknen Sätzen auszuschreiben was ich nicht erkannt –
ein Reisiger auf seinem wurzellosen Stuhl – ein Schatten.
Zum Bild des heimatlosen Landsknechts auf Heerfahrt tritt jetzt der Mond des Alters:
mit seinem Grabgeruch in seiner welken Blöße
mit mir gealtert und vergangen…
und dennoch hob er etwas aus dem Nichts für mich…
oder für ihn den Schatten nur (mit mir gealtert und vergangen).
Hilbigs Bild für das dichterische Erweckungserlebnis, das vergangenes Leben wiederbringt, ist nicht der erlesene Geschmack einer Madeleine. „O Kindheit… ein Aluminiumteller wars im Küchenlicht / daran er mich erinnerte der Mond.“
Der zweite Teil ruft kontrastiv diesen Mond der Jugend auf „der in ein andres Land schien / in ein anderes Bewußtsein… / und welche Energie die mir ein andres Meer vor Augen hielt“. Für dieses „Meer“, die aus Wäldern und Wassern entstandene sächsische Kohle, schuf Hilbig in seinem großen Gedicht „das meer in sachsen“ (1977) eine ureigene poetische Logik. Unter diesem „jugendlichen Mond“ erfuhr das „Ich“ schreibend, „was niemals wir gewesen“. Jetzt aber beklagt es den Verlust jener unbezweifelten Gewißheit, Dichter zu sein. Und damit ginge die letzte Hoffnung auf Heimat verloren.
„… des Zufalls schiere Ungestalt“
Das Gedicht des Autors zu seinem 60. Geburtstag, „Der Zufall“, hält reflektierend inne im Stationendrama seines Lebens – gleichsam ein Monolog des Protagonisten vor seinem Publikum:
So viel der Guten hab ich überlebt – Erbarmen!
Daß ich mir Jahre nahm die ihnen zur Vollendung fehlten –.
Zu jenen „nachtverwehten Armen“ oder „allzu früh Entseelten“ gehören bis auf T.S. Eliot auch all jene Dichter, mit denen die Bilder vom Erzählen im anverwandelten Zitat oder in mittelbarer Anspielung Zwiesprache halten: Rimbaud, Hölderlin, Lenz, Büchner, Mandelstam, Celan, Bachmann.
In diese Kette der Tradition stellt sich auch Wolfgang Hilbig. Seine Bitte um Nachsicht, noch unter den Lebenden zu sein, ist nicht Koketterie. Bei ihrer Begründung schlägt das jambische Metrum für diesen einen Vers in sein Gegenteil um, der auszusagende Gedanke machte es notwendig:
So viele Todesstunden überstand ich und aus keiner hinterblieb ich weise niemals lernt ich draus auf meiner Bahn.
Eines der letzten, von Ingeborg Bachmann zur Publikation gegebenen Gedichte, „Böhmen liegt am Meer“ (1964), spricht in meisterhaft leichter, beinah heiter gelöst scheinender Weise von der Verfassung eines „zugrund gerichteten“ Menschen, der von dorther zu Brüderlichkeit („Kommt her, ihr Böhmen alle“) und Hoffnung auf immaterielle Heimat befähigt ist und doch immer nur irrt:
Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand.
Ingeborg Bachmanns Grundgestus „ich will nichts mehr für mich“ ist ein Gestus der „letzten Worte“. Er gilt auch für Hilbigs Gedicht. Es schließt, die Bitte um Nachsicht ein weiteres Mal begründend:
Ich blieb zurück und nach mir schlug der Wahn…
auch er schlug fehl: ich bin des Zufalls schiere Ungestalt –
Das Titelwort „Zufall“ unmittelbar neben „Wahn“, dessen Attacken der Autor entkam – Das Provisorium beschreibt Alkoholgefährdungen –, weist zurück auf das Wort „Zufälle“, mit dem Büchner die Wahnsinnsanfälle des Dichters Lenz bezeichnete. Ingeborg Bachmann machte es zum Schlüsselwort ihrer Büchner-Preis-Rede 1964, der sie ursprünglich den Titel „Deutsche Zufälle“ gab, ihn dann aber in „Ein Ort für Zufälle“ abwandelte. Wie Celan wählte auch sie, die damals in Berlin gegen ihre Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit kämpfte, Büchners Lenz, um sich über ihn in Gestalt eines namenlosen Kranken in der vom Konsumwahn verwüsteten deutschen Stadt mit „Krankheitsbildern“ auseinanderzusetzen, deren tiefere Ursachen verdrängt wurden.
Einem solchen „Zufall“ in mehrfacher Bedeutung sieht sich auch der Autor der Bilder vom Erzählen ausgesetzt, wobei hier der Wahnsinn der deutschen Geschichte (Alte Abdeckerei), das zeitweilige „kopfunter“ der eigenen Biographie (Das Provisorium, Nach der Prosa) und die von den ursprünglichen Lebensumständen nicht vorgesehene „zufällige“ Entwicklung zum Dichter ineinanderfließen.
Hilbig schließt mit der Apostrophe:
Und nun müßt Ihr mich überstehn: erbarmt euch meiner!
Diese angesprochenen Nächsten könnten im Sinne von Hilbigs Rede „Unfähigkeit zur Anonymität“ wieder zu Erzählern werden, die die literarische Überlieferung im Dialog weitertragen und damit die Kette der Tradition nicht abreißen lassen.
Das Gedicht „Passage“ führt das Thema „Wahn“ über das Subjektive hinaus im Gesellschaftlichen fort. Es erschien identisch bereits in Litfass 14/1990, doch entstand es noch in der DDR vor 1985. Das Eingangsquartett gehört zu den großen Versen dieses Zyklus’:
Fern in den Wüsten wechseln Nacht und Tag
sich feindlich ab mit schallendem Schlag
indes hier Macht und Ohnmacht Seit an Seite hinken
um graue Straßenwinkel die nach Frieden stinken.
Das ist eines Lebens „Ordnung“, die mit nichts zu einem klaren Ende kommt und deshalb nichts wirklich neu beginnen kann. Sie beruht auf Verdrängung und trägt den Unfrieden weiter. Man mag das auf die Entstehungszeit des Gedichts beziehen, doch gilt es für das gesamte deutsche Nachkriegsleben. Eine apokalyptische Vision verfolgt das „Ich“: „des Weltalls letzter Atemzug“, „heiß von rotem Sand“, „blau von weißem Eis“. Sie leitet über zum Schlußterzett, das die Bedeutung der Hyperbel in Hilbigs Dichtung erklärt:
O lasset mich des Lebens Ordnung tiefverletzen –
selbst über Wüsten türmen Sterne ihren stumpfen Kreis
und stürzen kalt in ihren Grenzen und Gesetzen.
In diesem Bild bricht eine radikale Freiheitssehnsucht durch, die sich selbst gegen die einförmige Bahn der Gestirne noch auflehnt. („sachsen sinnt gottes ordnung zu ändern“!) Da „des Lebens Ordnung“, wie in den Eingangsversen geschildert, verlogen und falsch ist und ihr Maß ein Unmaß, kann es nur durch ein Übermaß aufgebrochen werden. So war die Hyperbel schon immer bevorzugtes Stilmittel und immerwährende Aufgabe radikaler geistiger Rebellen, von Rimbaud bis zum frühen Majakowskij. Dahinter steht eine Poetik der Selbstentgrenzung, wie sie der 17jährige Rimbaud im Brief an Georges Izambard 1871 entwarf:
Ich arbeite an mir, um aus mir einen Seher zu machen. (…) Es geht darum, durch ein Entgrenzen aller Sinne am Ende im Unbekannten anzukommen. (…) Ich ist ein anderer. Schlimm genug für das Holz, das als Geige erwacht
und an Paul Demeny zwei Tage später:
Zuerst trachte ein Mensch, der Poet sein will, nach völliger Selbsterkenntnis. Er suche seine Seele, durchforsche sie, versuche sie, begreife sie. Und wenn er sie kennt, dann soll er sie formen! (…) Alle Formen der Liebe und des Leidens, des Wahnsinns
und – man „kommt an im Unbekannten“. Daß Wolfgang Hilbig diesen Entwurf – „Ich ist ein anderer“ – auch zu seinem Credo machte, das ihn zur Ausfahrt auf dem Schiff der Dichtung trieb, bekräftigt die Überschrift des Gedichts. „Passage“ bedeutet hier Überfahrt übers Meer beziehungsweise Durchgang eines Gestirns durch den Meridian. Es kündigt die Wiederaufnahme des Odysseus-Mythos in seiner ungebändigten, modernen Form im letzten Gedicht dieser Odyssee an.
„Passat“ heißt ein trockener Wind, der über dem Atlantischen Ozean in Richtung Äquator weht. Hilbig nimmt unter diesem Titel die letzte Fahrt über den Weltenausgang hinaus vorweg:
Und dann nahmen wir eine Grenze. Sahen die Doppelfeste des Herakles das enge Tor zwischen den Säulen wir sahn den verbrannten Basalt. Und fuhren hindurch und fortan sahen wir nichts mehr. Abschüssig die See ohne Ende fuhren wir hinab.
Diesen Weg nahm in Dantes Göttlicher Komödie auch Odysseus. Ihn bewog – anders als in der vernunftgebändigten Fassung des Mythos bei Homer – nicht die Zärtlichkeit für den Sohn noch die Liebe zur Frau zur Heimkehr. Er folgte seinem Abenteurer- und Entdeckerdrang, der ihn „die Welt und Tugenden wie Laster / Der Menschen weiter noch erkunden hieß“, über die Grenze der Welt hinaus, „wo Herkules das Zeichen setzte“, in „jenen Teil / Der Welt, der unbewohnt ist“. Schließlich sahen er und seine Gefährten „neues Land“, – den Monte Purgatorio mit dem Paradies an seiner Spitze. Aber sie landeten nicht, sondern büßten ihre vermessene Grenzüberschreitung mit dem Untergang in Sturm und Höllenpein.
Leben: Eine permanente Grenzüberschreitung
Hilbigs Reisender auf seinem „letzten Schiff mit den letzten Männern“ gibt als Ziel an: „Laßt uns erkennen die See“. An ihr wird sichtbar, was das Altern an Erkenntnis bereithält: Kürze und Vergänglichkeit des Lebens, „denn schneller altern wir als eine Welle weiß wird auf ihrem Kamm über der Tiefe. Wir sind nicht geboren zu bleiben.“ Oder, wie es in den „letzten Ermahnungen“ an die Hebräer heißt: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt“ (Hebr. 13,14). Oder mit Hölderlin:
Doch uns ist gegeben,
Auf einer Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen
Wenn Heimat im Irdischen aber ein Trug ist, so folgert Hilbigs Odysseus-Gestalt in prometheischem Trotz daraus:
Also laßt uns den Bug in die Leere lenken. Fort von der heiligen Heimat die ein Grab ist für Hunde.
Dargestellt wird das jedoch aus der Perspektive der Gefährten, die mitmüssen, obwohl sie der „Stimme des Einen“ im Vorschiff „nicht glauben“ und ihr nur skeptisch „staunend“ folgen:
der Stimme jenes Idioten der Unrast. Der sich selbst nicht kannte jener eine ohne Vorfahr.
Mit einkomponiert ist also eine kritische Distanz des „Wir“ zu jenem Titanen der Unrast. In der Prosa spaltete sich Hilbigs Erzählperspektive oft in ein alle Gebote und Grenzen überschreitendes schreibendes „Ich“ und ein an seiner Entfremdung leidendes Arbeiter-„Er“. In den Bildern vom Erzählen hat das „Wir“ seine Zweifel an jenem ruhelosen „Ich“, das sich selbst nicht erkennt, aber über alle Grenzen hinaus nach Erfahrung drängt. Dennoch geht die Fahrt von „Ich“ und „Wir“ am Ende der Bilder vom Erzählen weiter:
Wir überquerten die Äquinoktien wir fuhren in dauerndem Licht.
Bis wir eine neue Grenze gewahrten.
Für Hilbigs Dichter-„Ich“ bleibt Leben eine permanente Grenzüberschreitung und Verwandlung bis hin zum Tod. Dieser wird ohne jeglichen „Küstenblick“ schlicht als eine weitere Grenze gesehen, die es zu nehmen gilt. Doch beinhaltet das nach allem Vorangegangenen mehr Revolte, Sehnsucht und kämpfende Suche als das buddhistisch – kontemplative dritte der „Vier Quartette“ (1942) von Eliot, dem Unterwegssein als das „wirkliche Ziel“ gilt. Wenn Leben eine Reise in den Tod ist, dann verbleibt dem Dichter-„Ich“ in nachmetaphysischer Zeit als letzte Würde nur, sie frei nach den eigenen Gesetzen auf Neues hin zu gestalten. Das Heimkehrdrama der Bilder vom Erzählen hat seine Vorbilder eher in der radikalen literarischen Moderne als im Prinzip Hoffnung (1947/1959) des letzten Nachkriegs-Utopisten Ernst Bloch. Charles Baudelaires Schlußgedicht „Le Voyage“ aus dem Kapitel „La Mort“ der Fleurs du Mal (1857) zieht nichts als „bitteres Wissen“ aus der Lebensreise: Die Welt – „eine Oase des Schreckens in einer Wüste von Ennui“, der ärgste Feind der rastlos Umherziehenden – „die Zeit“, der ersehnte Kapitän – der Tod, um mit ihm auf dem „Meer der Finsternis“ in den Abgrund hinabzutauchen:
Hölle oder Himmel, was tut’s?
Auf den Grund des Unbekannten, um Neues zu entdecken!
Auch „Das trunkene Schiff“ (1871) des jungen Rimbaud ist eine bildmächtig beschworene Reise aus Europa und einem Leben heraus, das seine Leitsterne Liebe und soziale Revolution (im Niedergang der Pariser Kommune) verlor: „Ich Boot, im Haar der Buchten verloren“, „Ich irres Brett, das lief“, „Mit trunkener Taubheit hat die Liebe mich geschlagen. / O bräche doch mein Kiel! O sänk ich in das Meer! // Ich kann nicht mehr, o Flut, durchtränkt von deinem Rauschen, / (…) Nicht in die furchtbaren Galeerenaugen sehn!“ Beide Werke sind Ausdruck des Leidens an der individuellen und sozialen Existenz und einer versuchten Befreiung im dichterisch vorweggenommenen Aufbruch zu „neuer“ Wirklichkeit.
Auch für Hilbigs „Ich“ bleibt Heimkehr, d.h. Ankunft und Dauer in welcher Denkfigur oder Existenzform auch immer, ein Problem. Es gibt keine „Odyssee des Stilliegens“, argumentiert Ernst Bloch, wenngleich die ganze Reise von Sehnsucht nach einer „präsent erfahrenen Erfüllung“ in der Wirklichkeit geleitet wird. Das Hoffen kommt in der vorhandenen Wirklichkeit nicht an.
Es bleibt ein utopischer Rest, der auf Realisierung drängt. Und Bloch hielt das in einer demokratischen Revolution auch für erreichbar. So gehört Dantes Odysseus, der nicht in Ithaka starb, sondern zur unbewohnten Welt weiterfuhr, für Bloch zu den „Wunschbildern des erfüllten Augenblicks“. Er ist eine jener „Leitfiguren der Grenzüberschreitung“, die auf den utopischen Endzustand vorausweisen, „wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden (…). Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“
Dichtung als letzte Heimat
Wenn auch die Bilder vom Erzählen Blochs Werk zweifellos manches verdanken, so ist Wolfgang Hilbig doch kein Utopist. Die Rede von sozialer Utopie ließe ihm vermutlich wie C’s Großvater im Provisorium den Angstschweiß auf die Stirne treten. Man lese seine ironische Reisebeschreibung „Die elfte These über Feuerbach“ (1992), in der „W.“ für eine Diskussion an der Universität Leipzig 1991 nicht „ein einziger sagbarer Satz über Utopie“ einfällt, nicht einfallen darf, geprägt wie er ist von einer bereits stattgehabten „Utopie“.
Obgleich also die Vorstellung von Heimat in Hilbigs Werk nicht verbunden ist mit einer politischen oder philosophischen Utopie, sind viele der Bilder vom Erzählen Reisebilder des Heimwehs. Zwei sind geradewegs dem Poem „prosa meiner heimatstraße“ entwachsen, in dem es u.a. hieß: „ohne heimat sind wir denn es fanden / die revolutionen niemals ihr ziel“, „tradition der revolte / die wir zerbrochen haben wie / einen fernen stern“. Von welcher Qualität also ist Heimat bei Wolfgang Hilbig?
Die Dialektik der Aufklärung (1947/1969) von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno enthält einen Exkurs über „Odysseus oder Mythos und Aufklärung“. Hilbig bezog sich darauf schon 1991 in seinem „die aufklärung“ betitelten Gedicht (ndl/9/1991). Es spitzt die auch bei Horkheimer/Adorno reflektierte äußerste Station der Odyssee, den Besuch im Totenreich, ironisch zu auf die dialektische Aufklärung der Seelen in der Unterwelt:
– achill auch du?
du zögest eines taglohns bleiches blech
den finsternissen jener küste vor…
– jetzt nicht mehr! sag ich dir.
In Horkheimer/Adornos Exkurs gibt es einen Gedanken, der auch die Altersklage der Bilder vom Erzählen grundiert: Zivilisation ist die Geschichte der Entsagung, des nach innen genommenen Opfers mythischer Tradition, und Odysseus ihr „Opfer für die Abschaffung des Opfers“:
das Selbst, das immerzu sich bezwingt und darüber das Leben versäumt, das es rettet und bloß noch Irrfahrt erinnert.
So entsteht Subjektivität und zugleich Sehnsucht nach Heimat. Ihre Voraussetzung, „Seßhaftigkeit“ und „festes Eigentum“, hat aber die Entfremdung der Menschen zur Folge, aus der wiederum „Heimweh (…) nach dem verlorenen Urzustand“ entspringt. Heimat sei, so die Dialektiker der Aufklärung, zu gewinnen nur in der Erzählung des Entronnenseins aus allen Abenteuern: im Sich-Besinnen des Erzählers, der das geschehene Unheil erinnernd festhält, in Vergangenes verwandelt und sich selbst damit freisetzt.
Das ist ein Gedanke, der Hilbig naheliegen könnte. Was sein „Ich“ vor entfesselter Individualität bewahrt, scheint kaum noch eine gesellschaftliche Wert- oder Vernunftordnung zu sein (welche wäre noch nicht von Wirtschaftsdenken überwuchert und entstellt?), sondern Dichtung als letzte, der individuellen Irrfahrt abgerungene Heimat – mit aller in dieser Geschichte der Vereinzelung enthaltenen sozialen Kritik.
Gedichte als „eine Art Heimkehr“, wie Celan es vorsichtig formulierte („Der Meridian“, 1960); als „Versuch, Richtung zu gewinnen“, zu „sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden, wo ich mich befand und wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen“ (Bremer Rede, 1958). Hierfür steht als Chiffre bei Celan dann Mandelstams Idee vom Gedicht als „Flaschenpost“, der Hilbigs Metapher von den poetischen „Schiffen“ zuzuordnen ist.
In dieser Konzeption haben Gedichte wie menschliches Blut das Salz des Ozeans und damit das „Prinzip der Reise“ bereits in sich (Mandelstam, Gespräch über Dante, 1933). Sie wollen heraus aus allem Unzureichenden – „planetarisch, solar, salzig“ –, um mit neuer Wirklichkeit beladen bei einem wahrnehmenden Anderen anzulanden. Hilbigs Odysseus der Bilder vom Erzählen ist Dichter, Ahasver und rastlos Fahrender unter dem Mond. Doch das romantische Bild ist in kritische Distanz gerückt. Mit dargestellt ist auch die von sich selbst wegführende, destruktive Richtung dieser Unruhe des Herzens. Es ist beeindruckend, wie hier Altern – das Leiden an all dem Ungetanen, dem Verlust an Kraft und dem nahenden Abschied vom Leben – ins Bild gebracht wird.
Die Reihe der Verwandlungen aber vom „Sauhirt“ und „Niemand“ des Anfangs durch alle Masken und Bilder hindurch bis hin zum Ich des Autors selbst, um zuletzt nur wieder zu neuer Verwandlung aufzubrechen – veranschaulicht poetisch, worin für Hilbig „Der Beruf des Dichters“ eigentlich besteht: zu erinnern an ein keinerlei Vorbestimmung anerkennendes, keinerlei „System“ oder Produktivzwängen untergeordnetes, zweckfreies Wachsen durch alle Verwandlungen hindurch, wie es „Jedermann“ gebührt.
Ziel der erinnerten Irrfahrt bleibt es, sich selbst und die eigene Richtung zu erkennen. Dabei gibt es für Hilbigs „Ich“ auf seiner Reise zwei Orientierungswerte: Dichtung und Liebe. Beide sind der Inbegriff des Humanen, beide das dialektisch Andere zur Entfremdung und beide gefährdete Daseinsformen, in denen die Aporie des „Ich“, zur Welt zu gehören und doch nicht heimisch sein zu können in ihr, schmerzlich offenbar wird.
Heimat schließlich entsteht bei Hilbig als ein geistiger Ort, gewoben aus dem Dialog der Stimmen, in die sich das „Ich“ kulturell und ethisch einbezogen weiß. Dies ist die Bedeutung der literarischen Zitate in den Bildern vom Erzählen. Sie knüpfen aus den Stimmen der vielen „Guten“, „allzu früh Entseelten“ der Moderne und Vormoderne eine Kette brüderlicher literarischer Tradition, die im Dialog fortgesetzt wird und in der Heimat aufscheint. Hilbig hatte sich dieses „Zuhause“ schon lange vor 1989 über alle politischen Mauern hinweg erobert. Es gilt auch weiter in dieser Zeit, in der er ebenso fremd ist. Aber der Dialog mit den Stimmen der Dichter gibt jetzt zusammen mit der Odysseus-Thematik den Bildern vom Erzählen eine Weiträumigkeit, die seine Dichtung bisher so nicht kannte. Gar nicht erst zu reden vom Formenreichtum (Elegie, Tagelied, Ode, Madrigal) und der sprachlichen Meisterschaft. – Wie oft gelingt heute noch Reimdichtung im Deutschen, die nicht sofort trivial wirkt? Hier ist sie von einer Natürlichkeit, die erst bei näherem Hinsehen als kunstvoll erkannt wird.
III.
Ich lieb das Weiterspinnen all der Fäden: Ein Schiffchen fliegt, und eine Spindel surrt…
Ossip Mandelstam, „Tristia“, 1918
Doch was nützt ein Erkennen, das, wie Bloch sagt, „nicht auf die Schiffe geht“! Wolfgang Hilbig kehrt am Ende des Gedichtzyklus’ zur alten Gattung des Hausspruches (oratio pro domo) zurück. Er datiert aus der Nachwendezeit 1993, als sein Roman Ich erschien und man die Ergebnisse, zu denen die demokratische ostdeutsche Revolte geführt beziehungsweise nicht geführt hatte, längst kritisch diskutierte. „Pro domo et mundo“ formuliert, zumindest im Titel, eine Ermahnung in eigener wie öffentlicher Sache. Der erste Vers schließt auf einer neuen Ebene den Kreis zur Rahmensituation. Seit dem „Abendlicht“ des Eingangs ist Zeit vergangen und das memento gewinnt an Eindringlichkeit:
Nun wird es dunkel: du mußt anders werden
die Wasser fließen schneller
Es ist die Aufforderung nicht nur zur erneuten Verwandlung in den, der dichtet, sondern auch zur thematischen Umkehr:
Und nichts mehr zählen die noch glücklich Heimgekehrten
jetzt zählen die schon lang vergessen und verloren sind.
Nicht mehr das entronnene „Ich“ Odysseus, „erfüllt von Raum und Zeit“ – soll weiter Gegenstand des Erzählens sein, sondern die auf seiner Lebensreise Verlorenen. Das mag auf die angekündigte Arbeit Hilbigs an Erzählungen über seine Kindheit vorausdeuten. Die thematische Umkehr steht unter dem Eindruck der schwindenden Zeit, dem ganz die mittlere Strophe gewidmet ist:
Es ist ein Fluten das sich nicht mehr wendet:
der Urwellen Anfahrt hat begonnen.
Die letzte Strophe problematisiert das Finden einer gültigen Sprache für das neue Thema:
Nun fällt die Nacht: die Zeit die dauernd endet
und dir gebrichts am Wort mit dem du ferner handelst.
Ihr Schlußvers kehrt zur ersten Aufforderung zurück, die eben auch pro mundo gesprochen sein soll:
Und es ist Nacht und Zeit daß du dich wandelst.
Die variierte Wiederholung ebenso wie der kunstvolle Kettenreim durch alle Strophen hindurch geben der Mahnung etwas Magisches, als wolle sie die Wandlung herbeibeschwören. So wie fortgesetzte Grenzüberschreitung das Lebensgesetz des Dichter-„Ichs“ ist, soll es neuer Aufbruch – nach der Revolte – für diese Zeit sein: Anders werden, Wandlung. Hans Magnus Enzensberger hatte in The Times Literary Supplement 1968 eine für deutsches Denken charakteristische Entweder-Oder-Alternative formuliert:
Tatsächlich sind wir heute nicht dem Kommunismus konfrontiert, sondern der Revolution. Das politische System in der Bundesrepublik läßt sich nicht mehr reparieren. Wir können ihm zustimmen, oder wir müssen es durch ein neues System ersetzen. Tertium non dabitur.
Der Spiegel bat u.a. den Galizier Paul Celan um eine Stellungnahme zur Frage „Ist eine Revolution unvermeidbar?“ Dieser hoffte, „nicht nur im Zusammenhang mit der Bundesrepublik und Deutschland, immer noch auf Änderung, Wandlung. Ersatz-Systeme werden sie nicht herbeiführen, und die Revolution – die soziale und zugleich antiautoritäre – ist nur von ihr her denkbar. Sie fängt, in Deutschland, hier und heute, beim Einzelnen an. Ein Viertes“ Krieg, Diktatur – „bleibe uns erspart“.
An diesen alten Gedanken, daß Revolution mit der Wandlung des Einzelnen beginnt, die auch zu neuer furchtloser Sprache begabt, knüpft das „Pro domo et mundo“ von Wolfgang Hilbig an. Seine Aufforderung, „anders“ zu werden, offenbart schließlich, daß sich vom Humor des Verzweifelnden über die Hyperbeln des Rebellen bis hin zum Zitat-Gewebe des Heimatsuchenden subtil der Faden eines politischen Denkens spinnt, das noch auf die Tradition von Revolte hoffen möchte.
Wie immer weniger begründet das erscheint, versinnbildlicht Hilbigs Prosafragment „Das Gewebe“ aus derselben Zeit 1993. In das gottlose „Gewebe des Mehrwerts“, der nichts als Mehrwert erzeugt („Webstühle, die Webstühle nach sich zogen“), wird von Revolte zu Revolte immer wieder Blut und Klage eingesponnen, um den Faden der Zivilisation nicht abreißen zu lassen. Doch danach laufen die Spulen des Mehrwerts nur wieder von neuem heiß, während das „Ich“ mit aller Kraft „den Anfang eines anderen Gedankens“ zu denken sucht, der wirklich ins Freie führte.“
Die gedankliche Struktur dieses Textes gleicht der von „Die Arbeiter. Ein Essai“ (1975), dessen Figur des Heizers sich unter dem lastenden „Turm der Ökonomie“ freizudenken suchte. Ein Problem also, das sich aus der Sicht des Autors durch den Systemwechsel von Ost nach West nicht löste.
Hoffnung ist immer irrational. Dennoch: Auch Hilbigs Odyssee 2001 wirkt weiter am Faden der Zivilisation, aus dem die unzerreißbaren Segel auf eine andere Wirklichkeit hin gemacht sind.
Marie-Luise Bott, die horen, Heft 207, 3. Quartal 2002
Das produktive Scheitern der Odyssee
in Wolfgang Hilbigs Gedichtband Bilder vom Erzählen (2001):
eine Poetik des Abgrunds?
To be an artist is to fail, as no other dare fail, that failure is his world and the shrink from it desertion, art and craft, good housekeeping, living.
Samuel Beckett
In Wolfgang Hilbigs 2001 publiziertem Gedichtband Bilder vom Erzählen, der von der Literaturkritik aufgrund der „unerhörten Schönheit“1 seiner Bilderwelt außerordentlich gelobt wurde, geht es dem alternden Dichter darum, seinem Gefühl des inneren Exils und der unmöglichen Verwurzelung im wiedervereinigten Deutschland Ausdruck zu verleihen. Auffallend ist Hilbigs simultane Aktualisierung von Homers Odyssee und der literarischen Moderne, um rückblickend eine äußerst melancholische Bilanz seiner poetischen und existentiellen Odyssee in der Jetztzeit zu ziehen.2 Für Stephan Pabst spielt die Erfahrung des Scheiterns eine zentrale Rolle in Texten der Post-DDR-Literatur, vor allem in Hilbigs Gedichtband Bilder vom Erzählen:
In nahezu allen Gedichten spricht ein Ich am Ende eines Lebens, das es für gescheitert hält.3
In seiner Rede zur Verleihung des Peter-Huchel-Preises hat Gregor Laschen bereits die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit des Motivs des Scheiterns im Gedichtband Bilder vom Erzählen gelenkt: es umfasst sowohl Biographisches wie Poetologisches, denn es bezieht sich nicht nur auf Hilbigs Schreibkrise im Westen, sondern kondensiert auch das Selbstbewusstsein der Moderne:
In oft hohem Ton […] beklagen diese Gedichte in singenden Bildern der Unruhe, der Schlaflosigkeit, einer überdrehten Müdigkeit und verzweifelten Schattendeutung den Weg des Reisenden in die Irre, ins Scheitern, in die Einsamkeit, in den Untergang: hier wo das Selbstbewusstsein der Moderne sich am radikalsten artikuliert, besteigt dies Ich noch einmal Rimbauds „Bateau ivre“, das trunkne Boot, mit dem Wissen des historisch später Kommenden […], dass das Ziel immer in der Irrfahrt liegt, Wiederholung, wenn auch auf besondere Art notwendige Wiederholung ist.4
Laschens Begriff der Wiederholung ist an dieser Stelle keineswegs als epigonale oder anachronistische Nachahmung der literarischen Moderne zu fassen: In seinem letzten Gedichtband geht es Hilbig um eine existentielle und poetologische Positionsbestimmung innerhalb der Tradition der Moderne, wie es folgende Eingangsverse aus dem Langgedicht „Der Schlaf in der Dämmerung“ bezeugen:
O diese langen Traditionen der Dämmerung
am Ende der Neuzeit –
der einst von Gott gesetzt in die großen Häfen der Welt –
sie sind noch immer haltbar: doch ohne Grund an diesem Ende ohne
Gewicht und Ziel.
(Werke Band 1, S. 186)
Wie lässt sich Hilbigs Selbstbestimmung als später Erbe der literarischen Moderne in der Jetztzeit erklären? Welche Funktion erfüllt der poetische Dialog mit der Moderne, der im Band Bilder von Erzählen durch die Fülle von intertextuellen Anspielungen bekundet wird?
Um Hilbigs spezifisches Moderneverständnis zu bestimmen, widmet sich der erste Teil dieses Beitrags der Analyse der sogenannten Lexington Rede, die anschließend mit der immanenten Gedächtnispoetik des Gedichtbands Bilder vom Erzählen konfrontiert wird. Anhand der Interpretation von zwei exemplarischen Gedichten, „Elaborat in M.“ und „Mond. Verlust der Gewißheit“, wird in einem zweiten Teil die enge Wechselwirkung zwischen Hilbigs melancholischem Gedenken an die Moderne und seiner Thematisierung des sowohl existentiellen wie auch poetischen Scheiterns beleuchtet.
Es wird sich zeigen, dass der Begriff des Scheiterns in diesen Gedichten keineswegs nur negativ zu fassen ist. Einerseits bezieht er sich auf Hilbigs schmerzhaftes Bewusstsein der wachsenden Kluft zwischen Literatur und Leben im Band Bilder vom Erzählen, das mit der Einsicht in die Unmöglichkeit der Wirklichkeitsgewinnung durch das Schreiben einhergeht. Anderseits spiegelt das Scheitern, wie bei Kafka5 oder Beckett,6 sein Selbstverständnis als Künstler und wird somit zur ästhetischen.Kategorie der Moderne erhoben.7 Hilbig verleiht in der Tat dem Scheitern ein außerordentliches schöpferisches Potential durch die Konstruktion einer poetischen Pathographie und das Festhalten an seiner Schreibkonzeption als wiederholte bzw. vergebliche Expedition nach dem Absoluten in der Kontinuität von Becketts berühmter Anweisung in Worstward Ho (1983) „Try again. Fail again. Fail better“. Im Laufe der Analyse soll dabei die kognitive Funktion der Intertextualität als Mittel der poetischen Identitätskonstruktion, der Traditionsbildung und der Reflexion über die ästhetischen Utopien bzw. Aporien der Moderne ans Licht gebracht werden.
1. Von der subversiven Konzeption der Moderne zu DDR-Zeiten zum melancholischen Gedenken an die Weltsprache der modernen Poesie nach der Wende
Wenn man Hilbigs Zyklus Bilder vom Erzählen mit seinen zwei ersten Gedichtbänden abwesenheit (1979) und die versprengung (1986) vergleicht, so bemerkt man einen deutlichen Funktionswandel des Modernebezugs vor und nach der Wende. Für Wolfgang Emmerich ist Hilbigs Werk repräsentativ für den Prozess der nachgeholten Modernisierung der DDR-Literatur in den 1970er-Jahren, der angesichts der antimodernistischen Kulturpolitik von den oppositionellen Schriftstellern hart erkämpft wurde.8 Trotz der Zensur hat sich Hilbig andauernd bemüht, an die verfemte moderne Literatur heranzukommen, um sie intensiv zu rezipieren:
Das war für mich die Literatur, die ich immer zu kriegen und zu lesen versucht habe. Hier im Osten war das schwierig.9
Hilbigs Moderneverständnis zu DDR-Zeiten steht im Zentrum des Vortrags, den er 1988 an der Universität in Lexington gehalten hat und in dem er seine eigene Situation als Lyriker in der DDR reflektiert. Am Anfang des Vortrags dient die Beschreibung der verstörten Figuren in den manieristischen Bildern, die zum Genre des „fermes“ gehören, als Allegorie des fremdbestimmten Lebens in der DDR-Diktatur. Auffallend ist die Betonung der physischen, geistigen und sprachlichen Einschlusssituation des Dichters im geteilten Deutschland. Seine Hinwendung zur Moderne wird als Folge einer Glaubenskrise gedeutet, das heißt einer radikalen Ablehnung der horizontalen Religion des Sozialismus. In diesem Kontext des Utopieverlusts spricht Hilbig vom Erscheinen einer „zweiten Moderne“ in der DDR, die weniger dem Innovationsprinzip der westlichen Moderne verpflichtet ist, als der Suche nach dem authentischen Ausdruck des „verdunkelten Zustands“ des Ich im totalitären Regime:
Im Gegensatz zu einigen Schreibweisen abendländischer Lyrik, mit denen banal gewordenen Inhalten durch Verdunkelung des Ausdrucks neue Töne entlockt werden sollten, entstand in der DDR eine Lyrik des verdunkelten Zustands als Voraussetzung, die auch durch bohrendes Hinterfragen dieses Zustands oft genug nicht zu seiner Erhellung durchdrang.10
Damit erscheint Hilbigs gesellschaftlich bedingte Hinwendung zur Moderne nicht nur als Akt der Rebellion gegen das Regime und als Ideologiekritik, sondern auch als Mittel der Erforschung einer entfremdeten Subjektivität. Diese existentielle Beziehung zur Moderne geht mit der zentralen Forderung nach der Erschaffung einer subjektiven Sprache einher, die sich vor allem durch ihren Autonomie- und Wahrheitsanspruch auszeichnet („die Wahrheit einer subjektiven Sprache“).11 Deutlich ist an dieser Stelle Hilbigs sprachliche Opposition gegen die „Sprachdiktatur“ oder die gelenkte „Sprache der Macht“ zugunsten des Bekenntnisses zur Weltsprache der modernen Poesie als Medium der Emanzipation des fremdbestimmten Ich und der Sprache. Im Unterschied zu Enzensbergers Feststellung der Vergangenheit der Moderne in der BRD, die im 1962 verfassten Nachwort seines Museums der modernen Poesie bereits zur Tradition gehört,12 gewinnt die Modernerezeption bei Hilbig eine durchaus „sprengende und befreiende Kraft“.13 Sie fungiert ganz offensichtlich als subversive Gegensprache und provokative Grenzüberschreitung aller vom Regime gesetzten Grenzen. Hilbig übernimmt die Grundprinzipien der ästhetischen Moderne wie die Autonomie der Kunst, die Emanzipation von der Mimesis zugunsten der Poïesis, die leere Idealität14 und den radikalen Subjektivismus,15 um sein subversives Programm der Befreiung der Dichtung, der Sprache und des Ich durchzusetzen:
Immer wieder muss er handeln, als ginge es darum, sein Ich aus einer Begrenzung, die mit ihm handelt, zu erlösen.16
Die Entgrenzung des Ich ist ein wesentliches Merkmal der literarischen Moderne, die sich insbesondere bei Baudelaire und Rimbaud durch die Erforschung der unbekannten Tiefen der Innenwelt mittels der kreativen Phantasie auszeichnet.17 Hilbigs innovative Fortführung der Moderne dient ebenso der Exploration seines inneren Infernos und der Schöpfung einer Seelensprache.18 Neben Octavio Paz erscheint Rimbaud als Gewährsmann von Hilbigs Ideal einer Poetik der Entgrenzung, denn trotz der erlittenen Unterdrückung besteht die Hoffnung auf die Überführung der Kunst ins Leben im Sinne von Rimbauds Losungswort „changer la vie“:19
Aber es kann ein Mehr oder Weniger an Leben geben.20
Dadurch gewinnt der Modernebezug in Hilbigs Frühwerk auch ein utopisches Potential als Möglichkeit der Selbsterkenntnis, der Identitätskonstruktion und der Wirklichkeitsgewinnung.
Während Hilbigs moderne Schreibweise im Frühwerk als subversive „Gegensprache“ konzipiert ist, erscheint dagegen in seinem lyrischen Spätwerk der Dialog mit der Moderne als Kampf gegen das Vergessen der Literatur im wiedervereinigten Deutschland. Dieser Paradigmenwechsel steht einerseits in Verbindung mit der veränderten Situation des ehemaligen DDR-Schriftstellers in der demokratischen BRD, wo er sich nicht mehr mit der Rolle des Aufklärers und der Ersatzöffentlichkeit identifizieren kann.21 Andererseits kreisen Hilbigs Frankfurter Poetikvorlesungen um das zentrale Problem des Endes der Moderne („eine utopische Ruine“)22 und des Verschwindens der Kritik als ihr ureigenstes Element im gegenwärtigen Literaturbetrieb. Die Folge der Verkümmerung der kritischen Botschaft der Moderne ist die zunehmende Wirkungslosigkeit der anspruchsvollen Literatur, die sich in der aktuellen Mediengesellschaft in einem Zustand der Agonie befindet.
Hilbig tritt aber weniger als Nekrologe, denn als Weiterführer der Moderne auf: Er plädiert für den Kampf um das Überleben der Literatur durch die Aufrechterhaltung des kritischen Erbes und des Wahrheitsanspruchs der literarischen Moderne.
Hilbigs Programm des „Schreibens gegen das Vergessen“23 der Moderne nach der Wende wird in einem Gespräch mit Marie-Luise Bott an lässlich der Publikation von Bilder vom Erzählen explizit formuliert:
Ich will die Form nicht verfallen lassen. Also ich sitze wahrscheinlich immer noch in einer Art angeschimmelten Elfenbeinturm und will eigentlich, dass die Form nicht vergessen wird.24
Neben Hilbigs Festhalten an der Tradition des „l’art pour l’art“ enthüllt dieses Zitat die implizite Gedächtnispoetik, die dem Band Bilder vom Erzählen zugrunde liegt: sie wird als Kampf des Dichters gegen das Vergessen des Erbes der literarischen Moderne in der oberflächlichen Mediengesellschaft der BRD verstanden. Hilbigs poetische Erinnerungsarbeit, die sowohl memento mori, individuelles, historisches, mythisches und literarisches Gedächtnis umfasst, steht im Dienste der mühsamen Rekonstruktion und Deutung der eigenen Lebensgeschichte. Diese Archäologie des Ich25 geht mit der Klage über den Verlust der poetischen Berufung einher, wie es nun anhand der Interpretation von „Elaborat in M.“ (2000) und „Mond. Verlust der Gewißheit“ (2000) nachgewiesen werden soll.
2. Die poetischen Selbstporträts als Figurationen des Scheiterns der existentiellen und poetischen Odyssee
In seinen Frankfurter Poetikvorlesungen deutet Hilbig die solipsistische Hypertrophie des Ich in seinem Werk nachträglich als Symptom einer erlittenen Verwundung zu DDR-Zeiten:
Wunden aber schließen sich bekanntlich nicht durch Konklusionen, im Gegenteil, durch den ,Systemwandel‘ hat sich so manches erst als Verletzung offenbart.26
Diese retrospektive Erforschung der Leidensgenese des Ich steht im Mittelpunkt seiner lyrischen Selbstporträts „Elaborat in M.“ und „Mond. Verlust der Gewißheit“, in denen Hilbig mit seinen bevorzugten poetischen und existentiellen Identifikationsfiguren in einen Dialog tritt (Trakl, Rimbaud, Baudelaire), um über die Sinnhaftigkeit seines introspektiven Schreibens in der Jetztzeit zu reflektieren. Im Unterschied zu seinem frühen Gedicht „h. selbst-porträt von hinten“ geht es Hilbig nicht mehr um die Thematisierung der Doppelexistenz, sondern um die verzweifelte Klage über das Vergessen der Zeit und des Lebens im Laufe seiner Schriftstellerexistenz. Nun überwiegt bei Hilbig das tragische Gefühl, sein Leben dem Schreiben geopfert zu haben:
Als Schriftsteller vergeudet man ja seine Zeit. Das ist ja nicht das Leben, sondern nur ein schriftliches Leben. Wenn man wie ich jetzt plötzlich 61 geworden ist, da hat man das Gefühl: Was hast du sonst noch gehabt? Also leben habe ich nicht gelernt, aber schreiben – denke ich manchmal.27
Die Eingangsverse des Gedichts „Nachtstück mit Erlen“ „Die Ankunft in der Zeit die dein war: sie mißlingt.“ (Werke Band 1, S. 197) sind kennzeichnend für Hilbigs durchaus melancholische Zeiterfahrung im Gedichtband Bilder vom Erzählen. Sie illustrieren seine späte Einsicht in die unüberbrückbare Kluft zwischen Schreiben und Leben, die einem bitteren Erwachen gleich kommt:
Aber möglicherweise bin ich inzwischen dabei, den Schritt in den Wachzustand zu vollziehen.28
Wie manifestiert sich dieses späte Erwachen in „Elaborat in M.“ und „Mond. Verlust der Gewißheit“, das mit einer retrospektiven Deutung seiner Schriftstellerexistenz als geopfertes Leben einhergeht?29
a) „Elaborat in M.“ oder Kaspar Hauser als Projektionsfigur der Abwesenheit
ELABORAT IN M.
Schlaflos ließ mich meine Nacht: seit Jahr und Tag
und länger noch: und dennoch lebt ich nur indes ich schlief –
am Grund des Schlummers wärmte mich der Haß
ich wußt es nicht – ich hielt den Tod
für einen Thermometersprung
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaund so umgab mich Schatten
so hüllte mich das heulende Gerücht der Wälder
aus weiter Zeit und Vorzeit ein in unbewußte Stille…
nachts aber in der Mitte allen Schlafs der Welt
begann sich neben mir das Leben loszumachen
und schlich ins Unbegangne fort.
Seit wieviel Jahren lauscht ich atemlos den Atemzügen
den eisernen die fernab überm Bahnhof schallte
wo man Waggons rangierte für die große Fahrt…
Ah! dies schwarze Tam-Tam im Dunkel über den Gleisen
in Dunkel und Nebel – welch ein Dasein ohne mich
der ich in Wäldern war: erstarrt und unerwecklich
und ungeboren – atemloser Toter ohne Tag
wenn fern im Osten jene Sonne aufstieg überm Gebein
meines Vaters
aaaaaaaaaaaaund während ich durch die Stadt irrte
(die einst ein Wald gewesen)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauf der Suche nach dem weißen
Arm einer Frau die es nicht gab…
Nacht für Nacht durchquerte ich die unwegsame Zeit
mit einem schmutzigen Schafsfell über meiner Räude
auf Suche und auf Fahrt
aaaaaaaaaaaaaaaaa aa(und wußte sie begatten sich jetzt
da im geschlossenen Bahnhofsausschank…)
Und anderswo lag Mutter und schlief
oben hinter einem Fenster in der finstern
ziellosen Schneise die die Straße schlug: ruhlos
ihr Schlaf zu dem nicht Vater
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanoch ich je traten…
Krieg: er hatte die Wälder gefällt und mit Schwefel
verwünscht die Häuser.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaUnd da ich nicht den Anfang sah
des Unglücks kann es mir nicht enden seit Tag und Jahr.
(Werke Band 1, S. 198)
Dieses Gedicht in freien Rhythmen ist beispielhaft für Hilbigs Auseinandersetzung mit der bisher verdrängten Hölle seiner Kindheit:
Die Hölle der Kindheit war wortlos, stumm, ihre Eigenschaft war das Schweigen. Und ich begann diese schweigende Hölle mit Wörtern zu füllen.30
In „Elaborat in M.“ läuft dieser Abstieg in die Abgründe des Ich parallel zum Versuch der Einkreisung der erlittenen Traumata zu DDR-Zeiten, die ihn zu einem modernen Kaspar Hauser verurteilt haben. Bemerkenswert sind die zahlreichen intertextuellen Anspielungen auf Trakls Gedicht „Kaspar Hauser Lied“ (1913), in dem der expressionistische Dichter hinter der Maske seiner persona sein tragisches Lebensgefühl der Unbehaustheit in der Welt artikuliert:
Ich werde endlich doch immer ein armer Kaspar Hauser bleiben.31
So lautet Trakls Klage in einem Brief aus dem Jahre 1912 an seinen Freund Erhard Buschbeck. Welche Funktion hat der Kaspar Hauser-Bezug in Hilbigs Gedicht?
In „Elaborat in M.“ dient Kaspar Hauser vor allem der Objektivierung von Hilbigs beständigem Gefühl der Abwesenheit oder Nichtexistenz, das mit dem Schreiben assoziiert wird.32 Insofern ermöglicht die Kaspar Hauser-Figur sowohl die autobiographische Selbstdeutung wie die Erfassung seiner Autorposition.33 Der Titel des Gedichts bezieht sich auf Hilbigs Geburtsstadt Meuselwitz,34 die eine Reflexion des schreibenden Ich über seine vergangene Schriftstellerexistenz in der DDR auslöst. Die Anamnese geht mit der Analyse der Ursachen seiner Sprachlosigkeit und seines Bewusstseinszustands der Abwesenheit als „Fall aus der Zeit“ einher. Damit erweitert Hilbig seine bisherige Darstellung der Auslöschung des Ich im totalitären System der DDR, indem er nun die traumatische Kindheit35 in seine Phänomenologie der sowohl gesellschaftlich wie individualgeschichtlich bedingten Abwesenheit einbezieht.
In der ersten Strophe des Gedichts interpretiert das Dichter-Ich seine nächtliche Schriftstellerexistenz als Negierung des Lebens und Verharren im Zustand des selbstvergessenen Schlafs („und dennoch lebt ich nur indes ich schlief“). Das schreibende Ich tritt als „Pathologe“ auf36 und enthüllt die verschiedenen Symptome seiner radikalen Selbstentfremdung zu DDR-Zeiten: rückblickend wird es sich seiner damaligen Determination durch den Hass als Lebens- und Schreibimpuls bewusst. Diese verhängnisvolle Zeitvergessenheit des Ich wird auch in der Erzählung Die Kunde von den Bäumen erwähnt:
Wir haben in einem Land gelebt, abgeschnitten, zugemauert, in dem wir auf die Idee kommen mussten, dass die Zeit für uns keine wirklich relevante Größe war. Die Zeit war draußen, die Zukunft war draußen… nur draußen rannte alles auf den Untergang zu.37
Der zweite Teil der Strophe beschreibt die negativen Folgen („so“) dieser existentiellen Abwesenheit, die eine progressive Verdunkelung des Ich verursacht. In der Tat leidet das schattenhafte Ich nicht nur an Selbstentfremdung, sondern auch an Wirklichkeitsverlust. Wie in Trakls Gedicht betont Hilbig die Verbundenheit des Ich mit dem Wald als Refugium und poetische Gegenwelt zugleich („das heulende Gerücht der Wälder“).38
Bemerkenswert ist auch Hilbigs Wiederaufnahme des Topos von Kaspar Hausers Sprachlosigkeit in der Wendung „unbewusste Stille“, die man mit der Thematisierung der Sprachskepsis und des Elends seines „verbalen Ghettos“39 in seinem Werk verknüpfen kann.
In den letzten Versen der Strophe deutet das nun erwachte Dichter Ich diese „Entwirklichung“40 des Ich zu DDR-Zeiten als verhängnisvolle Lebensvergessenheit. Das Präfix „fort“ in Vers II unterstreicht das schmerzhafte Bewusstsein der Unwiederbringlichkeit der Zeit in der Schreibgegenwart.
Die zweite Strophe entwickelt das Thema der unerfüllten Sehnsucht nach dem Leben und der Liebe. Implizit ist dabei die Widerlegung von Rimbauds Forderung nach einer Revolutionierung des Lebens mittels der Dichtung. Die Sehnsucht nach Aufbruch wird in der mehrdeutigen Metapher der Züge („Atemzügen“) exemplifiziert, die mit der Erstarrung des Ich kontrastiert. Individuelle und historische Erinnerung gehen nun ineinander über. In Vers 14 erscheint die Wendung „große Fahrt“ als Montage des Titels von Jorge Sempruns Buch Le Grand voyage,41 das von seiner Reise nach Auschwitz berichtet: damit wird die ersehnte Reise ins Leben als Reise in den Tod umgedeutet. Die Assoziation mit den Vernichtungslagern findet ihre Fortsetzung in Bildern der Dunkelheit und vor allem in der intermedialen Anspielung auf Alain Resnais berühmten Film über die Konzentrationslager Nuit et Brouillard (1956) in Vers 16 („in Dunkel und Nebel“). Insofern wird der Lebensdurst des Individuums durch die Barbarei der Geschichte im 20. Jahrhundert negiert. Man denkt auch an Marx’ Bild der Lokomotive der Geschichte, die sich nach dem Zusammenbruch der Utopie des Kommunismus als Reise in den Tod entpuppt hat. Die Aposiopese in Vers 16 suggeriert das Schweigen der Schreibinstanz angesichts der unsagbaren Verbrechen im 20. Jahrhundert. In poetologischer Hinsicht situiert sich Hilbig in der Kontinuität der Gedächtnispoetiken von Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Neben Auschwitz übernimmt das von der Geschichte traumatisierte Ich auch das Gedenken an die Opfer des Archipel Gulags.
Diese Erinnerungen an die Jugend kulminieren in der pathetischen Klage des Ich über sein Ausgeschlossensein aus dem Leben in Vers 16:
welch ein Dasein ohne mich.
Die Häufung von negativen Adjektiven („erstarrt“, „unerwecklich“ und „ungeboren“) trägt zum Selbstporträt als lebendigen Toten bei. Die Montage von Trakls Partizip „ungeboren“42 bezeugt wiederum Hilbigs Seelenverwandtschaft mit dem expressionistischen Dichter. Der Zustand der inneren Erstarrung wird in den folgenden Versen mit dem Tod von Hilbigs Vater assoziiert, der während des Krieges in Stalingrad gefallen war.
Am Ende der zweiten Strophe vervollständigt Hilbig das tragische Selbstporträt durch den Hinweis auf die Fremdheit des Ich unter den Menschen und seine Erfahrung der Lieblosigkeit.43 Wie Trakl legt Hilbig den Akzent auf die Negativität der Großstadterfahrung, um die Außenseiterposition des modernen Dichters zu veranschaulichen. Die radikale Einsamkeit des Ich gipfelt im Bekenntnis seiner vergeblichen Suche nach Liebe in Vers 24, wobei Rimbauds Ideal einer Neuerfindung der Liebe negiert wird.44
In der letzten Strophe gewinnt die negative Lebensbilanz eine mythische Dimension durch die Einführung des Bilds der existentiellen Odyssee. Wie im Eingangsgedicht der Sammlung übernimmt Hilbig wieder die Maske des Odysseus. Aber im Unterschied zur heroischen Ich-Konstruktion bei Homer entwirft Hilbig das Bild eines gescheiterten Odysseus, dem es nicht gelungen ist, den Weg ins Leben zu finden. Das Bild der „unwegsamen Zeit“ bestätigt die unüberbrückbare Kluft zwischen Leben und Poesie. Die verhinderte Ich-Konstruktion findet auch ihren Ausdruck in der Ästhetik des Hässlichen: die ekelhafte Räude verrät den Selbsthass und das Gefühl des Ausgestoßenseins des Ich-Odysseus. Schließlich wird das negative Selbstbildnis des Dichters als Paria der Liebe durch den Hinweis auf seine verdrängte Sexualität im parenthetischen Einschub verstärkt.45 Der Neid der Schreibinstanz auf die enthemmte Sexualität des Paars im Bahnhofsausschank spiegelt die Intensität von Hilbigs Wut auf die sexuelle Tabuisierung in der DDR wider:
Dieses Land da drüben hatte seine Zeit geschluckt! Dieser Vorhof der Realität. […] Dieses Land hatte ihn mit Vergängnis gefüttert und seine Reflexe gelähmt, es hatte ihm die Lust aus den Adern gesogen […]. Er war diesem Land zu spät entwichen…46
Das Gedicht endet mit dunklen Erinnerungsbildern an die Mutter und das Geburtshaus, die eine progressive Heraufbeschwörung von Kindheitstraumata initiieren. Das Bild des einsamen und unruhigen Schlafs der Mutter im dunklen Haus ruft Assoziationen von verdrängter Gewalt („schlug“), Trauer und Einsamkeit hervor. Schließlich gipfelt die Erkenntnisbewegung des Gedichts in der traumatischen Erinnerung an den Krieg als Chiffre des Bösen in dieser trostlosen Kindheit.
Das Gedicht endet mit Hilbigs Selbststilisierung als poète maudit in der Nachfolge von Trakl und Rimbaud. Das Unglück als Wesensmerkmal der Künstlerexistenz wird somit zur Inspirationsquelle erhoben und schöpferisch umgedeutet gemäß Rimbauds programmatischer Formel in „Une saison en enfer“:
Le malheur a été mon dieu.47
Damit ist dieses Gedicht repräsentativ für die Leidensgemeinschaft und Filiationen der poètes maudits von Baudelaire bis Hilbig.
b) „Mond. Verlust der Gewißheit“: Der Abschied von der Poesie
MOND. VERLUST DER GEWISSHEIT
1
Ruch und Schaum aus längst entwehten Wäldern…
unter uns eine andere Jahreszeit (unter uns ein anderer Strand)
unter uns ein anderes Kontinuum: der eherne Flöz der Nacht –
und jene druckversteinten Holze und ihr Starren
aus der bitteren Dünstung verblichener See –
o diese Augäpfel gefüllt von der Galle der See
wie schwer durch die Straßen zu tragen unterm nackten Mond
ohne Gott und ohne Schatten
unter frostigen Sternen die uns nicht gewogen
und nicht erschienen sind zu guter Stunde…
Licht wie von Aschen wo ich hinschritt
hinweg über den Leichnam meines Schattens (ich verstieß ihn)
über sein flaches Aas hinweg
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadurch seine abgegoltne Zukunft
die nicht mehr hier auf Erden war
und hinter mir Vergangenheit: Steinanger meines Glücks –
und ich allein
aaaaaaaaaaaaselbst wie ein Schatten stumm
der ich in schattenloser Finsternis das Unsichtbare suchte…
fand nichts und kehrte um
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawieder vor mein durstiges Geschäft
in trocknen Sätzen auszuschreiben was ich nicht erkannt –
ein Reisiger auf seinem wurzellosen Stuhl – ein Schatten
oder ich – nur noch im Lampenschein real
mit gelbsüchtigen Flügeln aus Nebel.
Das Haus stak wie ein hohler Zahn im toten Grund…
verlorne Zeiten die ich nicht mehr wußte reiften
eisglitzernd an der schwarzen Kellerwand.
Brackwasser fraß sich durch die Mauerfugen aufwärts –
und vor dem Fenster fiel durch gelbes Licht ein gelber Schnee
o jener Mond mit seinem Grabgeruch in seiner welken Blöße
mit mir gealtert und vergangen…
und dennoch hob er etwas aus dem Nichts für mich…
oder für ihn den Schatten nur (mit mir gealtert und vergangen).
O Kindheit… ein Aluminiumteller wars im Küchenlicht
daran er mich erinnerte der Mond.
2.
Das war ein andrer Mond (ein jugendlicher Mond)
der in ein andres Land schien
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaain ein anderes Bewußtsein…
und welche Energie die mir ein andres Meer vor Augen
hielt: ein abgeworfnes Feuer durch die Wogen jagend –
ein anderer Strand unter uns ein anderer Sand…
spurloser Traum der keinen Eindruck hinterließ im Sand.
Und wir erfuhren in dem Traum was niemals
wir gewesen
aaaaaaaaaaund erwachten ohne noch zu wissen.
Und so geh ich hin über Vergangenheit und Zukunft
und so bleibt es wenn ich nicht denke an die Schatten
meiner Ahnen
aaaaaaaaaa adie in dem Schnee sind und im Mond
im Sog des Mondes: Staub und Schnee und Ruch der See…
Ich ging geräuschlos hin über das Bergwerk meiner Trauer
und hörte unter mir das mahlende Räumen der Flut
und hörte hohl es rauschen in der Tiefe wie ein Meer.
(Werke Band 1, S. 203f.)
In seinen Frankfurter Poetikvorlesungen evoziert Hilbig mehrmals die Beziehung zwischen Literatur und Scheitern, die auf den hohen Ansprüchen des Schriftstellers zurückzuführen sei, der selbst beim Schreiben ein existentielles Risiko eingehe:
Es gibt aber für die Literatur – und es klingt hart, wenn ich es so sage – keinerlei Verpflichtung, dass sie nicht scheitern darf: Siegesgewißheit gehört nicht zu den Voraussetzungen für die Literatur.
Es gibt weder einen Vertrag noch eine Garantie dafür, dass man mit der Literatur nicht untergehen kann – […] – ein einzelner Literat aber kann immer zerbrechen. Man riskiert also etwas, wenn man sich auf die Literatur einläßt, und das Risiko bleibt einem erhalten, da man in dem Metier nie ganz genau weiß, ob man schon gescheitert ist, oder ob diese unbequeme Erkenntnis noch aussteht.48
Diese Thematisierung des produktiven Scheiterns der Poesie und des Dichters steht im Mittelpunkt des Gedichts „Mond. Verlust der Gewißheit“, dessen Titel bereits die dargestellte Schreib- und Sinnkrise antizipiert. Im Unterschied zum Frühwerk steht der Mond nicht mehr im Zusammenhang mit der Inspiration des Dichters, sondern mit einem radikalen Zweifel an seiner Berufung. Die Zweiteilung des Gedichts entspricht der Gegenüberstellung von gegenwärtiger und vergangener Schreibkonzeption. Während der erste Teil um den Verlust der Inspiration in der Jetztzeit kreist, trauert der zweite Teil der ehemaligen Poetik des Absoluten zu DDR-Zeiten nach, die sich rückblickend als Illusion entlarvt hat.
Die erste Strophe des Gedichts erscheint als Mimesis eines Bewusstseinsstroms und konfrontiert den Leser unmittelbar mit den düsteren Reflexionen des Dichter-Ich in der Schreibgegenwart. Nun geht es der Schreibinstanz um den Versuch einer Standortbestimmung der Poesie in der BRD. Auffallend ist die Verwendung eines gemeinschaftlichen „wir“: es scheint sich hier weniger auf die ehemaligen DDR-Bürger zu beziehen, als auf die Dichtergemeinschaft aller zitierten Leitfiguren aus dem „Traumbuch der Moderne“. Das Ich versteht sich zugleich als später Erbe und Sprachrohr der Geschichte der Poesie von Homer bis zur Gegenwart. Exil und Orientierungslosigkeit gehören zu den Grunderfahrungen des „wir“ in der dunklen Jetztzeit. Das Ich lenkt in der Tat die Aufmerksamkeit auf den Schiffbruch der Poesie („druckversteinte Holze“) in der Gegenwart. Das Meer der Dichtung, in dem Rimbauds entgrenztes Ich einst ekstatisch badete,49 steht nun im Zeichen des Verschwindens („verblichen“): es ist nicht mehr der Ort des poetischen Aufbruchs und des erstrebten Ideals, sondern es dient einzig als Spiegelbild der Melancholie des Dichter-Odysseus, der eine äußert negative Bilanz der vergangenen Odyssee der Poesie zieht. Die Verse 7 bis 10 sind repräsentativ für das moderne Selbstbewusstsein „am Ende der Neuzeit“: Bedrückende Melancholie („schwer“), Ich-Verlust („ohne Schatten“) und „transzendentale Obdachlosigkeit“50 sind wesentliche Kennzeichen der gegenwärtigen Poesie („Ohne Gott und ohne Schatten“) nach dem Zusammenbruch des Glaubens an die sowohl vertikalen wie horizontalen Religionen im 20. Jahrhundert.
Durch den Hinweis auf die „frostigen Sterne“ wird die melancholische Erinnerung an die poetische Odyssee mit dem tragischen Schicksal des Ich und der Barbarei der Geschichte assoziiert. In Vers 11 klingt das Bild der Asche („Licht wie von Aschen“) wie ein intertextuelles Echo auf Celans Gedicht „Engführung“ und verweist auf die Determination des Schreibens durch die Schrecken der Geschichte des 20. Jahrhunderts, die das Diesseits zur Hölle gemacht haben.51
Mit der wiederholten Anspielung auf den Tod des Schattens („Leichnam meines Schattens“) wird Rimbauds Programm der Entdeckung des unbekannten Ich („Car JE est un autre.“)52 radikal in Frage gestellt. Neben Rimbaud als zentraler Projektionsfigur der Rebellion und poetologischem Mentor in Hilbigs Dichtung bemerkt man in „Mond. Verlust der Gewissheit“ zahlreiche intertextuelle Bezüge zu Baudelaire. Die Identifizierung des Schatten-Ich mit Baudelaires Aas in seinem Gedicht „Une charogne“ verleiht ihm widerliche Züge und suggeriert die Gleichsetzung des Anderen mit dem Unglück53 und dem Tod. Im Roman Das Provisorium wird dieses selbstzerstörerische, abgründige Ich oft als Bestie, Ungeheuer oder Monstrum charakterisiert:
Was jenes Tier betraf, das er in sich verbarg – er hatte es ein Monster oder eine Bestie genannt –, so war es vielleicht ein Ergebnis davon, dass er immer an sich vorbei gelebt hatte.54
Die Klage des Ich erreicht ihren Höhepunkt in der negativen Selbstdarstellung als einsamer und stummer Dichter („selbst wie ein Schatten stumm“). An dieser Stelle bekundet das Verstummen des Ich die Intensität seiner gegenwärtigen Schaffenskrise nach dem Scheitern des Programms der „Suche nach dem Unsichtbaren“. Diese Formel ist von zentraler poetologischer Bedeutung: sie illustriert den vergangenen Anspruch des Ich auf die Weiterführung der Poetik des Absoluten von Baudelaire und Rimbaud, die auf dem Begriff des Unbekannten gründet.55 Die impliziten Prätexte dieser Stelle sind Baudelaires Gedicht „Le voyage“56 und Rimbauds Seher-Briefe. Der Schlüsselbegriff des Unsichtbaren befindet sich am Ende des zweiten Seher-Briefs:
Mais inspecter l’invisible et entendre l’inouï étant autre chose que reprendre l’esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu.57
Das Scheitern der poetischen Expedition nach dem Unbekannten wird in der lakonischen Wendung „fand nichts“ zusammengefasst. Dieser Satz erscheint auch in Büchners Lenz als Ausdruck der inneren Verödung der Hauptfigur.58 In diesem Zusammenhang ist das Nichts auch metaphysisch zu deuten als leere Idealität und nihilistische Erfahrung des Abgrunds in der Nachfolge von Baudelaires Gedicht „Le Gouffre“. In den Fleurs du Mal ist dieses zentrale Motiv mehrdeutig, denn es umfasst Baudelaires „Gout du Néant“, den Ennui, die abgründige Tiefe des Innenraums, die Verzweiflung und den Tod.59 Der gemeinsame Nenner ist die existentielle Angst vor dem Nichts wie es Ingeborg Bachmann am Ende ihrer Dissertation treffend formuliert:
Wer dem „nichtenden Nichts“ begegnen will, wird erschüttert aus Goyas Bild Kronos verschlingt seine Kinder die Gewalt des Grauens und der mythischen Vernichtung erfahren und als sprachliches Zeugnis äußerster Darstellungsmöglichkeit des „Unsagbaren“ Baudelaires Sonett „Le Gouffre“ empfinden können, in dem sich die Auseinandersetzung des modernen Menschen mit der „Angst“ und dem „Nichts“ verrät.60
Im Unterschied zu Baudelaire, der in seiner Dichtung die ästhetische Verschleierung der Schrecklichkeit des Abgrunds intendiert,61 geht es Hilbig in der zweiten Strophe um eine Versprachlichung dieses Abgrunds als eigentlicher Ort der Dichtung. Die Umkehr („und kehrte um“) des Dichter-Odysseus besiegelt das Ende der Expedition nach dem Unbekannten und das Scheitern ihres ontologischen Anspruchs. Damit distanziert sich Hilbig von der Poetik des Absoluten seiner symbolistischen Vorgänger: Wie Baudelaire und Rimbaud assoziiert er in der Metonymie „das durstige Geschäft“ die Dichtung weiterhin mit dem Rausch, aber sie ist nun zum idealistischen Höhenflug der „elevation“ unfähig geworden. Der Dichter kann nur noch das Scheitern seines absoluten Erkenntnisanspruchs und die Unerreichbarkeit des utopischen Ideals der Wirklichkeitsgewinnung sowie der Anwesenheit62 registrieren („in trocknen Sätzen aufzuschreiben, was ich nicht erkannt –“). Durch die Negierung der utopischen Dimension des Gedichts geht Hilbig einen Schritt weiter in den Abgrund als Ingeborg Bachmann und Paul Celan, deren Dichtung weiterhin „das Licht der U-topie“63 bewahrte.
Die zweite Strophe endet mit dem Selbstporträt als sitzendem Reisiger,64 das den vergeblichen Kampf des modernen Don Quichottes gegen das allgegenwärtige Nichts im nachmetaphysischen und postideologischen Zeitalter objektiviert. Hilbigs Kunstkritik findet ihre Weiterführung in Bildern der Vergeblichkeit der ästhetischen Existenz, die als Krankheit und Sucht entlarvt wird („mit gelbsüchtigen Flügeln aus Nebel“). Wiederum bemerkt man poetologische Affinitäten zwischen Hilbig und Ingeborg Bachmann, die in ihren späten Essays Schreiben und Krankheit miteinander verbindet:
Es ist ein Zwang, eine Obsession, eine Verdammnis, eine Strafe.65
Nach der Abkehr von der Poetik des Absoluten evoziert die dritte Strophe die Ergebnisse der introspektiven Erinnerungsbewegung im Sinne von Prousts Suche nach der verlorenen Zeit auf die hier angespielt wird („verlorne Zeiten“). Das Schreiben wird nun als Kampf gegen das Vergessen der eigenen Lebensgeschichte aufgefasst. Das Bild der schwarzen Kellerwand ist eine Metapher in absentia des Gedächtnisses, das vom Wasser der Zeit bedroht ist. Nun kreisen die Gedanken des Dichters um Alter und Krankheit: die Wiederholung des Adjektivs „gelb“ in den Versen 25 und 30 verbindet das Schreiben mit verschiedenen Formen der Sucht. Nach seiner Trennung von Natascha Wodin im Jahre 1999 verfiel Hilbig wieder dem Alkoholismus, was ihn vom Schreiben abhielt.66 Das Memento mori gipfelt in der parenthetischen Anrufung des Monds, der nun mit dem Tod verknüpft wird („o jener Mond mit seinem Grabgeruch“). Das adversative „dennoch“ markiert eine positive Wende im Gedicht: die plötzliche Kindheitserinnerung an einen Aluminiumteller entspricht einem epiphanischen Augenblick der „mémoire involontaire“, wie es Hilbig in einem Gespräch mit Marie-Louise Bott präzisiert:
Es gibt dieses berühmte Erweckungserlebnis bei Marcel Proust, wie er die Madeleine in den Lindenblütentee taucht und ihm alles wieder einfällt. Das gab es viel früher schon viel besser bei Jakob Böhme, der in seiner Schuhmacherwerkstatt saß und auf einem Regal an die Wand gelehnt einen Zinnteller hatte. Dort ist ein Sonnenstrahl hereingefallen und hat plötzlich die ganze Wohnung strahlend erhellt. Und da ist Jakob Böhme aufgesprungen und hinausgegangen und hat einen Bewusstseinsstrom in sich verspürt, der ihn an alles wiedererinnert hat. Bei mir war’s ein billiger Aluminiumteller.67
Die Anrufung des Mondes schafft eine bildliche Assoziation mit dem zweiten Teil des Gedichts, der nun um Erinnerungen an die vergangene Dichtungskonzeption in der DDR kreist. Das Ich erinnert sich wehmütig an seine Jugend und den poetischen Enthusiasmus, der seine damalige Revolte befeuerte. Man kann Hilbigs zentrales Bild des Meeres68 als Metapher der Grenzenlosigkeit und der Freiheit der Imagination deuten: es versinnbildlicht den Horizont des Absoluten, der vom rebellischen Ich damals voller Energie erobert wurde. In dieser Hinsicht lässt sich das „abgeworfene Feuer“ als Anspielung auf Baudelaires Gedicht „Les Phares“, d.h. auf die Beflügelung der Inspiration durch die poetischen Vorbilder der Moderne, interpretieren. Unterschwellig ist dabei Hilbigs Identifizierung mit Rimbauds Konzeption des Dichters als prometheischer „voleur de feu“.69 Dieses poetische Ideal ist nun im wiedervereinigten Deutschland endgültig verschwunden („spurloser Traum“).
In der letzten Strophe zieht das ernüchterte Ich die Bilanz seines bisherigen Schreibens, das sich als Irrweg erwiesen hat: anstatt der erhofften Selbsterkenntnis steht am Ende der poetischen Odyssee die bittere Feststellung der Selbstverfehlung („was niemals wir gewesen“) und der Verlust der schöpferischen Energie. Die Verse 46 bis 48 sind Ausdruck des sinnlosen „Dahinlebens“ der Schreibinstanz in der erstarrten Gegenwart. Unverkennbar ist die Anspielung auf den letzten Satz von Büchners Lenz „So lebte er hin.“,70 mit dem sich das Ich nun identifiziert.
Das Gedicht endet mit dem Gedenken an die verstorbenen poetischen Ahnen: wie das Ich sind sie zugleich tragische und heroische Opfer ihres leidenschaftlichen Drangs nach dem Absoluten („im Sog des Mondes“). Durch die Verwendung des Präteritums gewinnt der Leser den Eindruck, dass das Ich bereits Abschied von der Poesie genommen hat und von sich selbst als vergangenes oder totes Subjekt spricht. Der Verlust der Hoffnung auf Rimbauds Imperativ „changer la vie“ und die Rettung des Ich durch das Schreiben führt zu einem Abschied von der Dichtung.71 Die drei letzten Verse klingen wie das Fazit seines mühsamen Abstiegs in das Bergwerk der Psyche. Wie Rimbaud, der seine endgültige Abkehr von der Dichtung in den Gedichten „Alchimie du verbe“ und „Adieu“ aus dem Band Une saison en enfer antizipierte, inszeniert Hilbig im letzten Vers den Untergang des schiffbrüchigen Ich72 im Mahlstrom der Poesie.
Neben dem Bekenntnis zu einer Poetik des Abgrunds, die der durchaus prekären Situation der Poesie nach Auschwitz und Gulag entspricht, verleiht Hilbig dem Gedicht eine zentrale Erkenntnis- und Gedächtnisfunktion: Mit der progressiven Konstruktion eines vielstimmigen Gedächtnisraums im Band Bilder vom Erzählen ist es dem späten Erbe der Moderne gelungen, ein Museum der modernen Poesie zu schaffen, das das Gedächtnis des Ich, der untergegangenen DDR, der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der modernen Lyrik bewahrt. Dieses verbale Museum der modernen Poesie zeugt von Hilbigs Festhalten an Baudelaires Konzeption der Dichtung als „Mnemotechnik des Schönen“73 und seinem lebenslangen Engagement für das Überleben der Literatur in der ehemaligen DDR wie in der BRD:
Ich einigte mich mit mir selbst darauf, dass ich zumindest Widerstand zu leisten habe gegen den Zerfall der Literatur.74
Nadia Lapchine, aus Bernard Banoun, Bénédicte Terrisse, Sylvie Arlaud und Stephan Pabst (Hrsg.): Wolfgang Hilbigs Lyrik. Eine Werkexpedition, Verbrecher Verlag, 2021
Der Schlaf der Gerechten am 30.7.2003 im Literarischen Colloquium Berlin
Weitere Beiträge zum Buch:
Stefan Wieczorek: Abgewandte Areale
literaturkritik.de
Sibylle Cramer: Ich bin des Zufalls schiere Ungestalt
Frankfurter Rundschau, 10.11.2001
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.2002
Dem Schreiben das Leben geopfert
– Gespräch mit Jayne-Ann Igel. Jayne-Ann Igel ist Schriftstellerin. 1954 in Leipzig geboren, lebt und arbeitet sie heute in Dresden. –
Karen Lohse: Wie haben sie Wolfgang Hilbig kennengelernt?
Jayne-Ann Igel: In meinen Freundeskreis waren viele, die aus Meuselwitz stammten – Tom Pohlmann, Volker Hanisch, Lutz Nitzsche-Kornel. Seit dem Ende der 70er Jahre haben wir uns regelmäßig bei Lutz Nitzsche-Kornel in der Rosa-Luxemburg-Straße zu diversen Happenings getroffen. Irgendwann tauchte Wolfgang zu so einer Veranstaltung auf und gehörte fortan mit dazu.
Lohse: Was waren das für Happenings?
Igel: Sehr unterschiedliche Sachen. Beliebt waren Lesungen auf der Leiter. Wir haben aber auch kleine Stücke aufgeführt, teils aus dem Stegreif, teils vorher geprobt. Aber alles fand privatim statt. Eine Öffentlichkeit in dem Sinne gab es nicht und konnte es auch nicht geben. Das Extravagante war allerdings nicht Wolfgangs Sache. Wenn er las, dann ganz normal auf einem Stuhl sitzend oder im Stehen. Trat Kaschie mit seinen Texten in Erscheinung, war das immer ein beeindruckendes Erlebnis. Zum Beispiel das an E. A. Poe’s „the raven“ angelehnte Gedicht („war das gedicht der rabe von e.a. poe“ K. L.]), in dem Kaschie das von Poe Gesagte auf so eindringliche Weise transparent macht.
Lohse: Kaschie?
Igel: So haben wir ihn immer genannt. Wolfgang sagte von uns niemand zu ihm. „Kaschie“ ist von Kaszimier abgeleitet, dem Namen seines Großvaters.
Lohse: Wolfgang Hilbig gehörte zu dieser Zeit auch dem Kreis um Gert Neumann und Heidemarie Härtl an. Haben sich die verschiedenen Künstlergruppierungen damals gemischt? Gab es untereinander Kontakt?
Igel: Ja, wir kannten uns. Mit Gert Neumann haben wir später die inoffizielle Zeitschrift Anschlag herausgegeben. Wolfgang stand dieser Heftekultur anfangs sehr skeptisch gegenüber. Er bemängelte die Qualität der aufgenommenen Texte. Teilweise musste ich ihm in seiner Kritik recht geben. Wir wollten damals für alles offen sein und haben dadurch manchmal auch schauderhafte Texte abgedruckt.
Lohse: Fühlten sie sich damals politisch motiviert?
Igel: Wir haben uns intensiv mit der Beatnik-Bewegung beschäftigt. In erster Linie war das eine Frage der Lebenseinstellung, auf einer anderen Ebene wurde dadurch aber auch eine politische Bewusstseinslage transportiert. Das ruhelose Unterwegssein in der Prosa von Jack Kerouac, William S. Burrough oder Allen Ginsberg war uns vertraut.
Lohse: Wie haben Sie ihn als Mensch wahrgenommen?
Igel: Er war kein expressiver Typ, eher ruhig und bedächtig, kein Mensch, der viele Worte machte. Aber wenn man etwas von ihm wissen wollte, war er sehr auskunftsbereit. Wenn allerdings Literaturwissenschaftler ihm intellektuelle Gespräche aufdrängen wollten, ließ er sich nie darauf ein. Das, was er zu sagen zu hatte, stand in seinen Texten. Weil man ihm sein literarisches Potenzial nicht auf den ersten Blick ansah, wirkte er im Literaturbetrieb immer ein bisschen verloren.
Lohse: Wieso hatte er als Schriftsteller in der DDR keine Chance? Sein äußeres Leben passte doch wunderbar zur Doktrin vom schreibenden Arbeiter.
Igel: Seine Texte waren dunkel und mehrdimensional. Er schrieb, was er schreiben wollte und nicht das, was die Funktionäre von einem schreibenden Arbeiter erwarteten: Eindeutigkeit, Optimismus und Fortschrittsglaube. Mit dem sozialistischen Realismus aus den 6oer Jahren konnte Wolfgang nichts anfangen. Auch als sich die Bestimmungen in den 70er Jahren etwas gelockert hatten: Kaschie blieb seiner Art zu schreiben treu und damit im Literaturbetrieb in der DDR außen vor.
Lohse: Hat er unter diesem Nicht-gehört-Werden in der DDR gelitten?
Igel: Er hat das nie thematisiert. Ich glaube aber schon, dass er sehr darunter gelitten hat. Die Anzeige, die er damals in die NDL gesetzt hat – „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernstgemeinte Zuschriften an W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b“ – ist natürlich in erster Linie ein Schelmenstück. Sie zeugt aber auch von einem ungeheuren Leidensdruck: Einer der sich diszipliniert Nacht für Nacht nach der Arbeit hinsetzt und schreibt, möchte natürlich, dass etwas davon an die Oberfläche kommt. Er war sich des Wertes dessen, was er macht, schon bewusst, aber ohne Selbstüberschätzung. Dass die Verlage ihn immer wieder abgewiesen haben, war für ihn eine bittere Erfahrung. Aber er hat diesen Konflikt nie nach außen getragen, nie gejammert oder lamentiert.
Lohse: Warum hat er solange an seinem Dasein als Arbeiter festgehalten?
Igel: In der DDR gab es eine verfassungsrechtlich verankerte Arbeitspflicht. Wer keinen festen Arbeitsvertrag vorweisen konnte, schwebte immer in der Gefahr, den Behörden aufzufallen, die dann wiederum pedantisch nach einem Grund für eine strafrechtliche Verfolgung suchten. Die Arbeiter-Jobs waren für Wolfgang unter anderem eine Möglichkeit, dieser latenten Kriminalisierung zu entgehen.
Lohse: Was hat er von seinen ersten Jahren in Westdeutschland erzählt? Wie hat er diesen „Systemwechsel“ wahrgenommen?
Igel: Er hat anfangs nur aus dem Koffer gelebt, was der Titel Provisorium sehr gut beschreibt. Er befand sich permanent auf der Durchreise, fuhr oft in die DDR zurück. Ich glaube, er war sehr einsam zu dieser Zeit. Sicher gab es auch im Westen einzelne Menschen, an die er sich wenden konnte – sein Verleger Thomas Beckermann und später Natascha Wodin – aber die ganzen Alltagskontakte, die er hier in Leipzig hatte, fehlten. Sein Alkoholkonsum nahm damals wohl auch rapide zu. Endgültig zurück in die DDR konnte er aber nicht, es hätte für ihn bedeutet, nicht mehr veröffentlichen zu können. Ich glaube, das war für ihn schlimmer als das Gefühl der Einsamkeit.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
Alexandru Bulucz: Requisiten, Reliquien (für Wolfgang Hilbig)
Michael Hametner im Gespräch mit Johannes Heisig
WOLFGANG HILBIG IST TOT
Es sind die Abwesenden, die zurückbleiben.
Die akademischen Affen pokern um den versotteten Balg.
(es ist als ob ich wiederkommen sollte
und etwas auch als wollt es mich vertreiben)
Die Abdecker kannten einst keinen Unterschied:
Grubenschnaps oder Demarkationslinie.
Der Mohn gedeiht prächtig in diesem Jahr (ja, blütenscherben und blutäther.)
Im Weizen, im Raps, in der Gerste stimmt er sein Jakobinerlied an.
Der Staub über den Feldern ist gläsern geworden.
Wir vergehen am Unsichtbaren, en passant.
Schweiß und Gift, Gift und Schweiß – wir nahmen es hin.
Jeder Vers, der uns ausschloß, der uns
die Schamröte ins Gesicht messern sollte.
Zeitweise erlagen wir wohl einer Illusion,
ohne zu ahnen, wie wenig es dir um ein gelungenes Bild ging.
Das Sprechen mühevoll. Es war die den Kellern,
den Krematorien abgerungene Sprache,
die Mundorgel eines geschundenen Landstrichs.
Sie wird uns fehlen. Die Finsternis
hat ihre zärtlichste Stimme verloren.
Thomas Böhme
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Katrin und Volker Hanisch: Gespräch über Wolfgang Hilbig
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, 3.8.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Interview + KLG + IMDb +
YouTube + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die WindeDie Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003



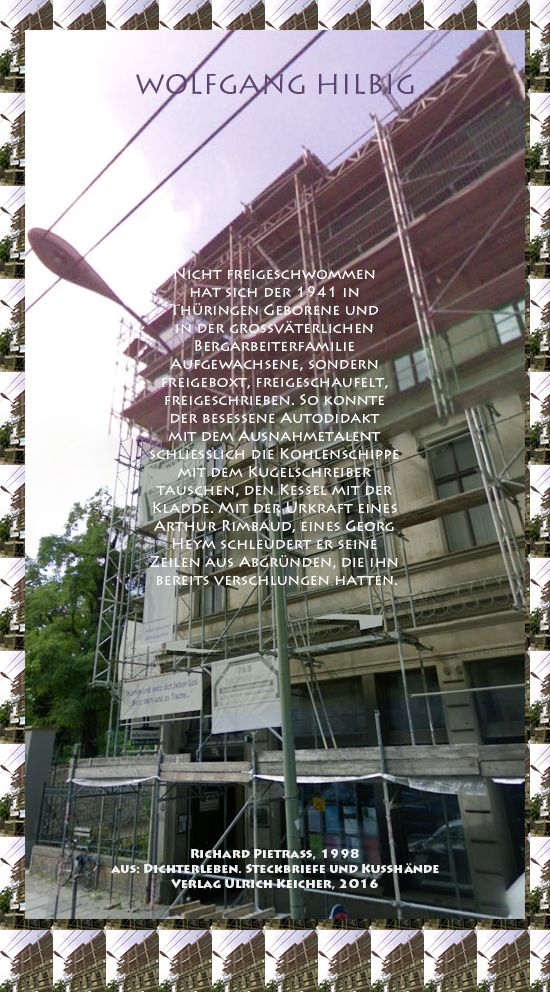












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Meinen Vater habe ich nicht kennengelernt, er wurde schon 1942 bei Stalingrad als vermißt gemeldet, und ich wuchs in der Wohnung meiner Großeltern mütterlicherseits auf, mit meiner Mutter zusammen, die nicht auszog, weil sie auf die Rückkehr ihres Mannes wartete: sie wohnt noch heute in derselben Wohnung, wenn ich dort zu Besuch bin, schlafe ich noch heute in dem Bett, in dem ich wahrscheinlich auch geboren wurde, – 1941, in Meuselwitz, einer Kleinstadt im ehemaligen sächsisch-thüringischen Braunkohlenrevier, vierzig Kilometer südlich von Leipzig gelegen. Ich habe also die Bombenangriffe auf das Industriestädtchen Meuselwitz noch erlebt, wie unbewußt auch immer: da mein Großvater Bergmann war und unter Tag arbeitete, hatten wir, als Familienangehörige, das Recht, bei Fliegeralarm Schutz in den Kohlenschächten zu suchen, die sicherer waren als Luftschutzbunker. So bin ich schon als Zwei- oder Dreijähriger hunderte Meter tief unter die Erde gefahren, auf dem Höhepunkt der Luftangriffe mehrfach in einer Nacht; und ich weiß nicht, was prägender auf mich gewirkt hat: die Unruhe dieser Zeit, die später, notwendig vielleicht, zur Unbeweglichkeit geführt hat, oder die bewegungslosen Familienverhältnisse, die irgendwann in Unruhe umschlugen. Bis 1978 habe ich – nur durch ein paar Jahre wechselnden Aufenthalts in Wohnlagern einiger Außenmontagefirmen unterbrochen – bei meiner Mutter in dieser Wohnung gelebt, in einem Mietshaus im Besitz der Bergbaubehörden in einer Straße, da ausschließlich Arbeiter lebten. 1978 zog ich zum ersten Mal nach Berlin, kehrte aber nach einem Jahr wieder nach Meuselwitz zurück – seit 1980 bin ich (ich habe nachgezählt) zwölfmal umgezogen – manchmal mehrfach in einer Stadt -, und nun bin ich in Edenkoben, in einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, gelandet.
Bis 1980 habe ich in der ehemaligen DDR in verschiedenen Industrieberufen gearbeitet, aber immer, nebenbei und insgeheim, geschrieben, als Kind schon habe ich irgendwann zu schreiben begonnen: wahrscheinlich war dieses Schreiben ein Lektüre-Ergebnis, oder auch das Ergebnis fehlender Lektüre; Lesen war für mich eine Hauptbeschäftigung in der Kindheit, und dies, obwohl ich mich damit dem dauernden Argwohn des Großvaters aussetzte: er stammte aus einem winzigen Dorf der polnischen Ukraine, war Waise und hatte nie eine Schule von innen gesehen. Er konnte weder lesen noch schreiben, verständlich, daß er sich um einen Teil der Wirklichkeit betrogen fühlte und allen seinen Nächsten das Lesen am liebsten verboten hätte. Alles was zwischen Buchdeckeln stand, war für ihn Lug und Trug, es führe mit der Zeit zur Trübung des Verstandes oder gar zum Irrsinn, und er wußte Beispiele dafür zu nennen. Als ich einmal, mit zwölf oder dreizehn Jahren, eine Biografie über Edgar Allan Poe las, glaubte ich die Worte des Großvaters bestätigt, und ich hörte mit dem Schreiben wieder auf: für ein Jahr ungefähr, bis ich, unter dauerndem schlechten Gewissen freilich, noch einmal von vorn begann.
1978 wurden einige Gedichte von mir im Hessischen Rundfunk gesendet, aus den daraus sich ergebenden Verlagskontakten entstand mein erster Gedichtband, den ich 1979 in Frankfurt am Main veröffentlichte, ohne Erlaubnis des sogenannten Urheberrechtsbüros der DDR, illegal also, was ich für folgerichtig hielt, da ich doch stets – von Ausnahmen abgesehen – in einer sonderbar natürlichen Form von Illegalität geschrieben hatte. Neben einigen unangenehmen Reaktionen auf diese Publikation erhielt ich plötzlich unerwartete Fürsprache von namhaften Schriftstellern: allen voran von Franz Fühmann, dem unermüdlichen Mentor der debütierenden oder noch nicht debütierenden Literaten der DDR, aber auch von Stephan Hermlin, Christa und Gerhard Wolf und anderen. Daraus resultierte sogar eine Buchveröffentlichung im Leipziger Reclam-Verlag und schließlich die Möglichkeit, in der DDR als freischaffender Schriftsteller zu leben. 1985 erteilten mir die Kulturbehörden der DDR eine befristete Reiseerlaubnis in die Bundesrepublik Deutschland; dieses Visum überschritt ich um ein Jahr, fuhr dennoch in die DDR zurück und das Visum wurde mir verlängert; es wäre ausgelaufen, als die DDR schon nicht mehr existierte.
Seit 1985 also lebe ich in der Bundesrepublik bzw. auf dem Territorium der alten Bundesländer, in Hanau zuerst, dann in Nürnberg und jetzt in Edenkoben. Ich habe seither eine Reihe von Büchern mit Lyrik und Prosa veröffentlicht, bin in die USA, nach Griechenland und Frankreich gereist, nun unter den Bedingungen des kapitalistischen Buchmarkts, die oft schwieriger zu bewältigen sind als die halb illegalen, oder pseudo-Iegalen, in der ehemaligen DDR. Aber sie sind ehrlicher, und darauf kommt es an.
Nun lebe ich mit meiner Lebensgefährtin Natascha Wodin zusammen, die, als Tochter ehemaliger russischer Asylanten, eine Außenseiterin in der deutschen Literatur ist… oft genug glaube ich, daß auch mir eine solche Rolle angemessen wäre. Von ganz unten her haben es ihre großartigen Bücher vermocht, die Poesie in der deutschen Literatur weiterzutragen, in eine Zukunft, in eine Ungewißheit: dies ist mir Unruhe und Beruhigung zugleich.
Ich danke der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung für die Zuwahl meiner Person zum ordentlichen Mitglied.
Wolfgang Hilbig 1990, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.