Wolfgang Hilbig: STIMME STIMME
STIMME STIMME
eine trunkenheit ist gewichen aus meiner stimme
rimbaud ist gewichen aus meiner stimme –
einst flossen die worte schwer aus meinem mund
es war meine mohnblüte im mundwinkel
ich sah phosphor über phosphor
o so grün
aaaaaaaaund gras
aaaaaaaaaaaaaaaaund graue herden
von wolken wandernd zu den violetten abenden
sooft ich den weg durch den garten nahm
und hörte die geräusche des nahen sees
schossen die blumen bis unter die sterne
wind war der sand so hell in der nacht
sang mir der see herüber ins haus
I
aber rimbaud (gewichen aus meiner stimme)
wo sind wir denn jetzt sag wer
ersäufte was wir sangen
das holz ist sauer
ausgelaugt und klanglos
aaa− in den höfen berge von flaschen
aaadie hälfte zertrümmert
aaaholzwolle modert nasse asche
aaaverfaulte bretter ziegelsteine
aaabröckeln – lärm
aaaaaaaaaaaaaaaaein toter lärm −
ein ohnmächtiges mißgeschick
mißgeschick ohnmächtiger schmerzen
schrilles seufzen unsrer schritte
auf haltbaren brücken
o welch ein november
zwischen den rosen des sommers
2
hundert heuschrecken jagen durch meinen hals
(dazu dein hundertjähriges verweigern rimbaud) die haut
die brannte ist im kalten laken erstickt brackwasser
quietscht im holz der worte
aaa− alte narren gehen fluchend durch den garten
aaawühlen mit grober pfote nach glitschigen würmern
aaazottige katzen mästen sich mit fischen
aaader sand ist mit schilfern besät –
o neurosen des gewinns es schleift
ein wächsernes münzgeklingel durch
die violetten abende des sees o hinterhof
einer finsteren kneipe heimstatt da ich
an die angel ging (wer verlor uns rimbaud
was ist das wohin wird die chemische rose
aus unseren köpfen verkauft)
aaa− wirklich war der mohn so grün
aaaund rot so rot der phosphor doch
aaastarres gold verwechselte den klang
aaawenn morgensonne abensonne sang –
3
war es chemie
oder schweißtropfen
von ungeheuren engeln schmelzend
was sprach denn waren es ströme
von brücken verwirrt und was
in den bleichen auen rauchenden teichen
war es was sang
aaa− ungeheuer steig du
aaaaus meinem bett du stinkst nach essig
aaadurch deine brust fährt froschgeschrei
aaadein mund schmeckt nach fisch und tinte
aaawie schwitzt dein schuppiger wanst wie kalt
aaaist dein kurzer schlaf –
saueres holz meiner worte
die lüge schreit
sicher ist es lüge was ist und ich selbst bins
dies ungeheuer
aaaaaaaaaaaaageschändet längst
vom händlerpack von eifernden greisen und
alles was sang (rimbaud du toter mann
in meinem kopf) war schweigen aus tropfengeklirr
stille aus sonnenglas schweigen
sanfterer nächte
Wolfgang Hilbig, Jahrgang 1941 stammt aus Meuselwitz
im sächsischen Braunkohlegebiet. Da sein Vater bei Stalingrad gefallen war, wuchs er in der Bergarbeiterfamilie des Großvaters auf. Nach einer Lehre als Bohrwerksdreher war er in verschiedenen Berufen tätig: als Werkzeugmacher, Erdbauarbeiter, bei der Außenmontage in Großbetrieben, als Hilfsschlosser einer LPG, vor allem als Heizer. Daneben schrieb er Gedichte und Prosatexte, die von bemerkenswertem Talent zeugen ( Der vorliegende Band enthält eine Auswahl von Arbeiten, die seit 1965 entstanden sind.)
Hilbig nimmt literarische Traditionen auf – so der Romantik, des französischen Symbolismus und des Expressionismus – und vermag der Herausforderung dieses Erbes auf eigene, kräftige Weise standzuhalten. Seine Texte, leidenschaftlich, oft elegisch und grüblerisch, sind Monologe, die den Dialog suchen und brauchen.
Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, Klappentext, 1983
Suche nach dem Einklang von Mensch und Welt
− Texte von Wolfgang Hilbig bei Reclam. −
Seine Verse sind kantig. Der Rhythmus entzieht sich schon dem leisesten Anflug von Glätte. Reime werden kaum verwendet, eingängigen Formen mißtraut der Autor. Wolfgang Hilbig (Jahrgang 1941) ästhetisiert nicht, er lädt den Leser vielmehr ein, ihn auf seinem Weg durch die Entfremdungsphänomene der modernen Zivilisation zu den wirklichen Empfindungen hin zu begleiten.
STIMME STIMME ist das im Reclam-Verlag erschienene Bändchen überschrieben, das dem Autor auf Anhieb einen herausragenden Platz in der deutschsprachigen Lyrik sichern dürfte. Der kürzlich so früh verstorbene Franz Fühmann hat sich um diese Edition, die neben Gedichten zwischen 1965 und 1981 auch einige Prosatexte vereint, verdient gemacht.
Hilbigs Dichtung greift literarische Traditionen unterschiedlicher Sprachräume auf. Das Titelgedicht von 1969 notiert programmatisch: „eine trunkenheit ist gewichen aus meiner stimme / rimbaud ist gewichen aus meiner stimme –“. Hier wird jener sprachgewaltige französische Dichter angerufen, der nach abrupter Wandlung zum gefürchteten Aufseher über unterdrückte Sklaven werden sollte. Und Hilbig befragt dessen Schicksal und weist damit auf die latenten Gefährdungen, denen Dichtung, Kunst und das ihnen inhärente Postulat Humanität ausgesetzt sind: „aber rimbaud (gewichen aus meiner stimme) / wo sind wir denn jetzt sag wer / ersäufte was wir sangen“. Doch ist das, auch wenn zuweilen Bennscher Ekel die Verse durchzieht, von nihilistischen Konsequenzen weit entfernt.
Der deutsche Expressionismus ist in Hilbigs Dichtung kaum mehr als formal lebendig. Viel näher scheinen ihm die Romantiker, auch wenn er sich klassischer Formen nur in Ausnahmen, etwa in einem „Novalis“ überschriebenen Sonett, bedient. Hier – wie auch in anderen, weitaus aggressiveren Gedichten – bedingt die Fähigkeit zum Leiden den hoffnungsvollen Ausblick: „für meinen schmerz in dem die liebe ruht / und gottesnah und frei von hab und gut geh ich und unerschöpflich wird mein träum.“ Angerufen werden diese Leiden, dieser Schmerz Trakelscher Dimension, aus der berechtigten Sorge über Irrwege menschlicher Existenz. So in dem längeren Gedicht „Ophelia“. Jene dem Wahnsinn verfallene Figur aus Shakespeares Hamlet ist bei Hilbig „an ahnungen erkrankt vorzeiten“. Der Dichter beschwört ihren Geist, erweckt mit ihm ein lebendiges Mahnbild:
o asche die am abend
ophelien gleich vergessen ist −
elektrisch strahlen häfen auf
die großen erdölschiffe laufen ein
am abend des wohlstands
verfällt geschichte faules blut −
opheliens wasser sinken
durchs dumpfe gas der gräber
Hilbig will sensibilisieren, will Leiden, Schmerzen bewußt machen. Seine darauf aufbauende Hoffnung erscheint im Zweifel relativiert. Lösungen oder gar Patentrezepte weist er von sich. Seine Suche nach Wahrheit mündet in lyrische Zwiesprache, kreist um den aus Camus’ Jonas bekannten Gegensatz „einsamgemeinsam“.
So ließe sich diese Dichtung vielleicht am ehesten beschreiben: als ein Kreisen um das Leben in dieser Welt, ein Kreisen, das wohl immer auch Einkreisen bedeutet, ein Versuch, Wege für den Einklang von Mensch und Welt aufzuzeigen. Gleiches gilt für die im Schildern äußerst minutiös gehaltenen Prosaskizzen, die in ihrer nachgerade seismographischen Genauigkeit an Kafka erinnern. Das sind zunächst Naturbeobachtungen und Selbstreflexionen, durchsetzt von mystischen Traumbildern, die dann aber zunehmend kräftige Konturen gewinnen, die – wie auch die Lyrik – aus dem Widerstreit zwischen Zweifel und Hoffnung lebensbejahende Kraft erlangen.
Regina Köhler, Neue Zeit, 22.10.1984
„und alle Tage wäre das Fest“
62 Gedichte von Wolfgang Hilbig: Der bei Reclam erschienene Band läßt die Masse dessen ahnen, was der strengen Auswahl zum Opfer fiel. Kaum ein Text ist zu entdecken, der als ein nur mäßig geglückter oder gar mißratener zu bezeichnen wäre. So aber kommt es, daß der Leser, sofern ihn nicht Ressentiments regieren, ununterbrochen und unbedingt beteiligt bleibt.
Beteiligt an der (immer wieder das Äußerste fordernden) Widerstandsleistung des Gedichts gegenüber einer Welterfahrung, welche nun freilich die eines „Harmlosfröhlichen“ (Mickel) nicht ist. Franz Fühmann, der Hilbig für die literarische Öffentlichkeit der DDR entdeckt hat – und dem dafür großer Dank gebührt –, gab Stichworte zur Biographie des Mannes:
Jahrgang 41, geboren in der Kohle in Sachsen, in Meuselwitz… Der Vater bei Stalingrad gefallen, das Kind unter Kumpeln aufgewachsen, in der Familie seines Großvaters… Lehre als Dreher; Wehrpflicht; diverse Berufe: Werkzeugmacher, Monteur, Erdarbeiter, Heizer, LPG-Schlosser, Aufräumer in einer Ausflugsgaststätte;… Kesselwart in einer Berliner Großwäscherei.
Es ist wichtig, diese Lebensfakten zu kennen. Sie sagen einiges über den Mikrokosmos der Hilbigschen Erfahrungswelt aus. Daß ihn inmitten dieser Welt jedoch das Verlangen nach einer Sprache überkam, welche geeignet sein konnte, die Erfahrung aufzunehmen, aufzuheben, sie zu brechen, darüber geben die Fakten keine Auskunft. So wären die Gedichte selbst zu befragen. Die frühesten, die der Band mitteilt, sind indessen solche des schon Fünfundzwanzigjährigen; und in ihnen ist Sprache bereits gefunden: als Ausdrucksmöglichkeit einer durch sie selbst faßbar gewordenen großen Sehnsucht – und als eines durch sie selbst faßbar gewordenen Elends:
mein bett ist leer und es regnet
ich liege im leeren bett
es ist kalt und
regnet
…
ich liege allein abgedeckt
ist das dach zerschlagen
die fenster in mir
schreit es und
es regnet
niemand liegt im leeren
bett laßt mich
aufstehn –
(„befindung“, 1966)
Mehr als fünfhundert Jahre zuvor hatte ein Dichter, dessen Verse zum Volkslied wurden, geschrieben:
Mein haus hat keinen gibel,
es ist mir worden alt,
zerbrochen sind die rigel,
mein stüblein ist mir kalt.
So scheint in Hilbigs Gedicht eine poetisch archetypische Situation aktualisiert: das Ich in der Kälte einer trostlosen und tristen Einsamkeit, die zugleich Nichtswürdigkeit und Lebensleere empfinden läßt. War allerdings in dem alten Text am Ende der Ruf nach einem „lieb“ gefolgt, das sich „erparmen“ möge, so bittet das Ich des Hilbigschen Gedichts schließlich eine anonyme kollektive Instanz, es „aufstehn“ zu lassen. Und hervor tritt so die Begier des Ichs, aus einem als elend begriffenen Dasein auszubrechen und eine Lebensmöglichkeit zu gewinnen, die im Sinne eines Gegensatzes zum „Darniederliegen“ bestimmbar wird und deren Aufschein in den Gedichten insgesamt das Hölderlinsche „… und alle Tage wäre / Das Fest“ in Erinnerung ruft. Wie aber wäre sie auszudenken?, unter der Voraussetzung einer Ich-ihr-Beziehung, die als eine erfahrener Beziehungslosigkeit beschrieben erscheint?
Gedichtanfänge: „laßt mich ein wenig / noch sterben…“. („bitte“, 1966); „manchmal erstarren / die lachenden lippen euch plötzlich…“ („störungen“, 1967); „lenkt das licht ab leute…“ („sturz“, 1966). Die Kluft, so erweist es sich, ist tief und breit – zwischen dem Ich und den Leuten seiner Erfahrungswelt, deren Gesichter selbst im Tode noch eine unbegreifliche „schreckliche zufriedenheit“ („ich begreife nicht“, 1966) ausstrahlen, und auch denen, die gedächtnis- und bedenkenlos „ewiges leben endlose helle / auf der welt“ („bitte“) zu wecken suchen. Aber eben diese anderen werden von dem, der, wie er auch weiß, realiter alternativlos zwischen ihnen existiert, noch immer als Adressaten verstanden. Er wendet ihnen sich zu, vertraut, in seinen Verzweiflungen und in seiner brennenden Sehnsucht, ihnen sich an, hofft gerade auf sie, im Grunde, als Ansprechbare.
Und solange eine derartige, ambivalente Ich-ihr-Beziehung aufrechtzuerhalten war, vermochte Hilbigs poetische Sprache, bei aller Individualität, durchaus noch traditionsgebunden zu bleiben: Das Verlangen nach einem Medium, das Widerstand gegenüber dem blinden Andrang der Erfahrung ermöglichte und das dennoch fähig sein sollte, den Wunsch nach schöner Verständigung und Austausch zu transportieren, ließ eine Rede als angemessen erscheinen, der dichterisch Vor-Gebildetes entschieden entgegenkommen mußte. Dabei ist es unwesentlich, ob Hilbig im Falle des Gedichts „befindung“ auf den alten Volkslied-Text bewußt zurückgegriffen (oder aber ihn gar nicht gekannt) hat; die gewählte bildsprachliche Struktur erweist sich als traditionsgebunden schlechthin: von ihrer Typik her. Eindeutig dagegen die direkte Bezugnahme auf Hölderlinsches Sprechen. („die sorgenvollen gesichter“, 1968: „wo jetzt hingehn wenn der winter / kommt und der lästige schnee / fällt –“) Desgleichen lassen sich sprachliche Figurationen ausmachen, die an Brecht orientiert sind. („rechenschaft“, 1967; „die ihr mich fragt euch sag ich…“) Vor allem aber waren es deutsche Romantiker und französische Symbolisten, die Anhalt bieten konnten.
Im zentralen Gedicht „stimme stimme“ (1969) jedoch konstatiert das Ich:
eine trunkenheit ist gewichen aus meiner stimme
rimbaud ist gewichen aus meiner stimme –
Fortgeschrittene Welt- und Selbsterfahrung, zu dichterischer Neubesinnung zwingend, geboten eine Sprachsuche im Weglosen. (Für die vormals Erworbenes natürlich weiterhin, freilich in stärker gebrochener Weise, belangvoll bleiben sollte; und dabei dürften nicht minder wichtig jetzt auch deutsche Expressionisten geworden sein.) Denn vor der Sprache des Gedichts stand die Aufgabe, rettende Artikulationsmöglichkeit nun auch eingedenk eines Bewußtseins zu sein, von dem aus sehnsüchtiges Schwelgen im sinnenhaft-trunkenen Traum mit einemmal als fragwürdig erschien – und von dem aus eben auch jener Rest kindlich-naiven Welt- und Selbstvertrauens, der sich bis dahin noch immer erhalten hatte, mitnichten mehr zu bestehen vermochte. Rigorose Zerstörung bis dahin bewahrter Illusionen, nüchternste (und ernüchterndste) Wahrnehmung von Sachverhalten, die mit dieser Illusion nicht mehr zu vereinbaren waren – „sicher ist es lüge was ist und ich selber bins“ („stimme stimme“) –; und folgerichtig die bohrende Frage:
woher
in meiner sprache sprech ich immer
mit einem der ich heißt
(„verse um an frühere zu erinnern“, 1972)
So hatte das Gedicht fortan das „Verworfensein“ dessen, der da spricht, nicht minder zu bezeugen als die Erfahrungslast des ihm auf der Brust Liegenden – und dennoch durfte dieses Gedicht nicht in die Nähe von Zynismus geraten. Die Alternative Benn mußte sich einem Lyriker wie Hilbig streng verbieten.
Und Hilbig fand, der Intention gerecht zu werden, den Weg zum weit ausladenden, gleichwohl mit konzentriertestem Ernst gefügten und Pathos sich nicht verweigernden Deskriptionsgedicht: Mehr und mehr werden „geballte“ Wahrnehmungen, lastende Wirklichkeitsträume, Visionen beschrieben. Dabei erlangt der Erfahrungsraum des Gedichts eine große geschichtliche Dimension; auf eine geradezu atemberaubende Weise gewinnt etwa im Gedicht „das meer in sachsen“ (1977) – das es vollständig zu kennen lohnt – die ungeheure Biographie der sächsischen Braunkohlenlandschaft Gestalt; extensiv und intensiv holen die Verse Partikularitäten der Welt poetisch ein – und diese, erlebt von einem, der sich ihr uneingeschränkt stellt, tritt schließlich in ihrer Zerklüftung und in ihrem „mörderischen concentus“ (Bobrowski) sinnfällig hervor. (Vergleichbares gibt es nur in der modernen Dramatik: bei Heiner Müller.) Außerordentlich aber sind diese Gedichte dadurch, daß in ihnen dem gewaltig in sie Eindringenden die Herrschaft nicht überlassen wird. Denn die beschreibend-verdichtende Reproduktion bleibt unüberwältigt. So drückt sich höchste menschliche Aktivität in den Versen aus: Der, welchem (nochmals mit Bobrowski:) der „Fels in den Mund“ wachsen will, weiß sich mit unerhörter Kraftanstrengung zu behaupten – seine Stimme bleibt trag- und artikulationsfähig. Doch mehr noch: Der Sprechgestus des Gedichts ist ein äußerst beherrschter; das aus elementarer Betroffenheit hervorgehende Leiden an Welt und die ihm entgegnende klare poetische Bewußtheit konstituieren eine ebenso spannungs- wie maßvolle Metaphorik; mit disziplinierender Kraft scheint eine farbkräftige Bildphantasie gebändigt, die ganz im Sinnlichen wurzelt – und in der sich die Sehnsucht des Sinnenmenschen nach schöner Daseinserfüllung noch immer unverkümmert Ausdruck verschafft. Nicht zuletzt dort, wo das Gedicht ganz Klage ist, macht sich dies deutlich, wobei hier wiederum der metaphorisch-großen Sprache ein elegisches Pathos eignet, durch das nicht nur dem menschheitlich-philosophischen Gegenstand der Verse gültig Genüge getan wird, sondern das zugleich auch jenes dichterische Ethos repräsentiert, das klarste (und in hohem Maße: poetisch-traditionsbewußte) Formung gebietet:
diese von lichtahnen überkommene nacht
wird dunkler dunkler von nachfahr zu nachfahr
die väter im finstern schon immer
niemals mehr sichtbar ach
in der kälte reifumschlossener hirne geschmiedet
der trügerischste ihrer Namen
gott
und ganz bewohnt von diesem dunst der raum
und eh der sohn den enkeln sich entweihte
auch er schon trug im unerhörten unsichtbaren
weltentfernter stern der unbeachtet stürzte (vaterstimme
oh weißes verheeren vergangener parke
im fatumslaub der frühlingsnacht
fleischduftender neuschnee
und im dunkel gebliebenen blut jene kalten nabel von namen
(1981)
Doch auch so ein enormes Gedicht wie „episode“ (1977) findet sich: Das Ich erinnert sich, im „düstern kesselhaus… auf dem brikettberg“ plötzlich einen grünen Fasan erblickt zu haben („ein prächtiger clown / silbern und grün den leuchtend roten reif am hals mit / unverwandtem aug mit dem großen gelben schnabel aufmerksam / zielte er auf mich“). Eine Bewegung des Ichs, und er, der „furchtlos verirrt(e)“, flog auf und davon – „doch von weit her den geruch der sonne den duft / seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht“; und das Ich selbst, wenngleich nach wie vor gebunden an sein nächtlich-tristes Heizerdasein, war mit einmmal ein verwandeltes: „das kausale grinsen“ seines „kopfes / von energie und frost gefressen… verschwand“, nicht mehr glaubte es „an den untergang / der wahrnehmungen in der finsternis“. Eindringliche dichterische Aneignung einer Reminiszenz, die dem Gedächtnis – und mit ihm: dem poetischen Bewußtsein – unverloren bleiben soll.
Schließlich die Verse (1981) „war das gedicht der rabe von e.a. poe not / wendig…“: Wenn es sich hier um einen aufschrei handelt, so um einen solchen, der sich bestürzender Vergegenwärtigung entringt; was sich zudrängt, sind quälende Fragen nach dem Sinn menschlich-menschheitlicher Existenzgeschichte schlechthin; in kühn verdichteter Form stellt sich so das Resümee einer Anschauung von Welt dar, die aufs entsetzlichste trostlos ist. Doch die Stimme, die sich erhebt, kündet von der sehnsüchtig entgegengedachten „violettbekrönte(n) alp“ noch immer. Und die Spannung, schmerzhaft, bis an die Grenze des Erträglichen gehend, bleibt aufrechterhalten. „… der käfig der unsterblichkeit / an dem dies röcheln sich wetzt…“: Der vom „Röcheln“ spricht, vermag ihm gegenüber hohe, bild- und ausdrucksstarke Rede zu fügen. Sie ist es, in der aufscheint, das zur Rede Gebrachte so strikt wehrt: Hoffnung.
Nach der Lektüre dieses Gedichts das Blatt umwendend, findet man sich mit dem ersten der sich nun anschließend noch vorgelegten acht Prosastücke Hilbigs konfrontiert: Der Eindruck muß ein schwächerer sein. Gewiß, auch diese (die Grenze zum Lyrischen streifenden) Prosastücke sind als Teil jener poetischen Widerstandsleistung, die in den Gedichten exemplarischen Ausdruck gewinnt, deutlich erkennbar; manches zudem liest sich als kommentierendes Pendant. Aber gerade deswegen, weil das Medium der Prosa in einer der Lyrik so verwandten Weise benutzt wird, muten die Texte wie ein zweiter, verwässerter Aufguß an. Und man entdeckt sich dabei, daß man anfängt, die, „Irgendwos“ und „Irgendwanns“ auszuzählen, die „Als-ob“-Nebensätze anzukreuzen, die Verbarmut der Hauptsätze zu registrieren.
So blättert man, nach Abschluß der Prosa-Lektüre, unwillkürlich zurück. Erneut beginnt man, Vers für Vers, die Gedichte zu lesen. Und man kommt schwer wieder los: von diesem lyrischen Stationen weg; über dessen (vorläufiges) Ende hinaus man dringlichst hofft, ihn sich fortsetzen sehen zu können. Wird es Hilbig gelingen, das Gespenst der Sprachlosigkeit auch fürderhin zu bannen?
Bernd Leistner, Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 1985
Geschichte einer Hilbig-Rezension
Erinnere ich mich recht, so habe ich Martin Herzig im Sommer 1983 kennengelernt, und zwar in Schwerin beim Poetenseminar. Kurz zuvor war Herzig Chefredakteur der Zeitschrift Temperamente geworden. Er wünschte, mich als Beiträger für die Zeitschrift zu gewinnen. Ich brachte das Gespräch auf Wolfgang Hilbig und den bei Reclam erschienenen Band Stimme Stimme. Wir vereinbarten, dass ich den Band bespreche. Im Herbst schrieb ich den Text und sandte ihn an die Redaktion. Nach einiger Zeit ließ mich Herzig allerdings wissen, dass er leider nicht akzeptiert werden könne. Er stelle mir aber anheim, ihn zu überarbeiten und jedenfalls kritischer zu gestalten. Ich lehnte dies ab und verfiel stattdessen darauf, ihn noch etwas auszuweiten und der Sinn-und-Form-Redaktion anzubieten. Seit einigen Jahren publizierte ich gelegentlich in der Zeitschrift. Querelen hatte es bislang nicht gegeben. Ebenfalls in dieser Zeit vereinbarte ich mit der NDL-Redaktion einen Besprechungstext über Elke Erbs im Aufbau-Verlag erschienenen Band Vexierbild. Ich bekam, nachdem ich die Rezension geliefert hatte, ein sogenanntes ,Ausfallhonorar‘ überwiesen. Gedruckt wurde sie also nicht. In puncto der Hilbig-Besprechung jedoch erreichte mich eine zustimmende Reaktion. Auch diesmal teilte mir die Sinn-und-Form-Redaktion mit, dass der von mir vorgelegte Text angenommen sei und demnächst eingerückt werde. Zwar schob man ihn dann noch eine Weile vor sich her, aber im ersten Heft des Jahres 1985 erschien er.
Freilich ist da noch von einem Nachspiel zu berichten. Irgendwann im weiteren Verlauf des Jahres 1985 tagte der sogenannte Wissenschaftliche Rat für marxistisch-leninistische Kultur- und Kunstwissenschaften. Dieser Rat, angebunden bei der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, war das einschlägige Leitungs- und Lenkungsgremium für die DDR. Als Vorsitzender fungierte der Direktor des Akademie-Instituts für Kultur- und Kunstwissenschaften, Hans Koch.1 Mein damaliger Chef in Weimar, Professor Hans-Dietrich Dahnke, war in diesen Rat berufen worden. Zurückgekehrt von der Berliner Tagung, berichtete er aufgeregt, Hans Koch habe in seinem Einleitungs- und Grundsatzreferat mir und meiner Hilbig-Besprechung einen ganzen Redeabschnitt gewidmet – und dies nach Maßgabe des Imperativs: So nicht, Genossen!
Dies war ein Signal, das vernommen wurde. Nicht zuletzt vom stellvertretenden Minister für Kultur und Leiter der Hauptabteilung Verlage und Buchhandel, Klaus Höpcke. Im August 1985 hielt er den Eröffnungsvortrag zum Schweriner Poetenseminar; Auszüge aus seiner Rede konnte man in Heft 1/1986 der Temperamente lesen. Und auch hier nun wurde ich mit einer längeren, eine ganze Druckseite einnehmenden Passage bedacht. Der Tonfall war vergleichsweise milde, aber deutlich genug bekundete der Minister sein Missfallen darüber, dass ich den hilbigschen Gedichten gegenüber eine „kritische Position“ habe vermissen lassen. Dabei bezog er in seine Ausführungen auch meine mittlerweile in Sinn und Form erschienene Besprechung von Gedichtbänden Steffen Menschings und Hans-Eckardt Wenzels ein. Und er gab mir väterlich mit auf den Weg, ich möge doch bitte hinfort einen „zu Bruch“ gehenden „Bogen zwischen Lebenswahrheit und Gedichtaussagen“ – dies attestierte er den Hilbig-Gedichten – genauso scharf rügen wie die zu Bruch gehenden Distichen Wenzels.
Nicht wieder hervorgekramt habe ich die gegen mich gerichteten Polemiken, deren es einige dann auch in der NDL und (sofern ich mich nicht täusche) in den Weimarer Beiträgen gab. Nochmals angesehen habe ich mir aber diejenige, die ein Ehepaar verfasste, dessen männlicher Part ein Mitarbeiter an dem von Koch geleiteten Akademie-Institut war: Rudolf Dau. In Sinn und Form 2/1986 zersäbelte er, mit Schützenhilfe seiner Frau Mathilde, meine Mensching-/Wenzel-Kritik auf wahrlich ingrimmige Weise. Dass mir freilich am stellvertretenden Gegenstand vor allem der Hilbig-Besprechung wegen die Leviten gelesen wurden, gab eine Bemerkung zu erkennen, die sich in Klammern gesetzt findet. Da wird, meine Maßstäbe attackierend, hämisch bedeutet, es seien eben just die, die meiner „überaus mitgehenden Besprechung“ der Hilbig-Gedichte zugrunde gelegen hätten.
Die Sinn-und-Form-Redaktion fragte mich damals, ob ich denn nicht gesonnen sei, eine Gegenpolemik zu publizieren. Doch hätte ich mich tatsächlich einlassen sollen auf die Daus? Auch hatte ich damals begonnen, mich in Stifters Nachsommer zu versenken; ich war dabei, über den eine essayistische Studie zu schreiben. Es lag mir fern, mich herauszureißen aus dieser Beschäftigung.
Bernd Leistner, aus Ingrid Sonntag (Hrsg.): An den Grenzen des Möglichen. Reclam Leipzig 1945–1991, Ch. Links Verlag, November 2016
Anwesenheit
Wolfgang Hilbig, Jahrgang 41, als Kesselwärter tätig gewesen, legt eine Auswahl von Texten vor, die in den Jahren 1965 bis 1981 entstanden. Er geht dabei im wesentlichen chronologisch vor; unübersehbar ist zugleich, daß das eine Gedicht auf das andere antwortet. Ich denke an Gedichte wie „variation zu einer diagnose“ oder „reisefieber“, „die namen“ oder „zwischen den paradiesen“, „déjà vu“ oder „gewöhnlicher rassismus“, „sprache“ oder „berlin. flaneur de la nuit“. Sie sind Ausdruck einer Haltung:
für dies leben diesen fels
einen schweren lobgesang – („sehnsucht nach einer orgel“, 1968).
Die meisten Gedichte sind in freien Rhythmen geschrieben. Diese lassen bei aller Eindringlichkeit Raum für kritisches Mit- und Weiterdenken; wesentliches Aussagemoment ist der Gedankenstrich, der den Leser zu eigener Fortsetzung einlädt, Aber auch die Sonettform wird von Hilbig überzeugend gebraucht, wie im Gedicht „das ende der jugend“ oder „sonett“.
Im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft sucht das lyrische Ich Hilbigs nach fruchtbarer Anwesenheit. Der Band enthält Gedichte und mit ihnen gedanklich korrespondierende Prosa, die Hilbigs Sehnsucht nach Humanem hörbar werden lassen. Aber da kann es passieren, daß einen „ratlosigkeit“ (1966) befällt, denn:
all meine gesichter die
auf den tischen dort liegen
die wortlosen bücher sind
verblättert
was nun – –
Eine Frage, die nach Antwort drängt. Das Ich, das sich im Gedicht „Störungen“ ( 1967) ausspricht, weiß um „einbrüche der nacht in den morgen“, zugleich jedoch verheimlicht es auch nicht:
… allein
die torkelnde besoffne Straße
und ich
haben mich gefällt („sturz“, 1966).
Mit dieser Selbsterkenntnis verbindet sich das Verlangen, „aufzustehn“ („befindung“, 1966) und leere Einsamkeit zu überwinden. Die Erfüllung, die in der Liebe gesucht wird („ein dunkles zimmer“, 1967), reicht jedoch nicht aus („träum dir“, 1966). Sie bedarf der Freude über „eine art morgen“ (1967):
o herrlich aufzustehn bei taganbruch
mit noch schläfrigem aug um
kaltes wasser zu trinken ohne
die angst zu verdursten.
Reiz und Reizbarkeit der Poesie Hilbigs erweisen sich aber auch als produktiv, wenn in anderen Dimensionen ermittelt wird. Das Ich des Dichters kein Zeuge faschistischer Verbrechen: zeigt sich bestürzt über „die schreckliche zufriedenheit“ in den Gesichtern von Menschen, „… die zuhaus / im bett starben“. Und es mahnt, keinen Tag zu vergessen, was Menschen widerfahren ist, um mit wachen Sinnen einer lähmenden Zufriedenheit Paroli zu bieten. Mit dieser Sentenz steht das Gedicht „ich begreife nicht“ (1966) in widersprüchlicher Korrespondenz zum folgenden Gedicht „gegen den strom“ (1966), gewidmet Hans Magnus Enzensberger. Das „gegen-den-strom“-Weisen der Arme verbindet sich für mich allerdings mit der Frage, wogegen „immer wieder“ anzugehen sei. Die Haltung, die aus dem Gedicht „h. selbst-portrait von hinten“ (1966) spricht, deutet auf Rückzug:
und müde bin ich mir selbst
entflohn…
Aber Hilbig ist mehr als nur ein Beobachter von Geschichte, mag dieses Urteil auch mit dem Motto von Robert Creeley zum Gedicht „abwertung eines unverständlichen gegenstands“ (1968) und der Aussage in den Schlußversen nicht vereinbar sein:
und ein kaltes herz bleibt zurück
und rauch ein rauchendes aug –
Das Dichter Ich aber, das sich „rechenschaft“ (1967) gibt über Position und Entwicklungsweg, ist sich der Tatsache bewußt, sich nicht spurlos entfernen zu können, da es „euch doch gesehn hat und gefühlt / den halt wie das schwächste / glied in einer kette“.
Wolfgang Hilbig sieht sich nicht ohne Geschichte, ohne Vorfahren („die gewichte“; „das meer in sachsen“, beide 1977). Das Gedicht „episode“ (1977) reflektiert, was seinem Ich „im düstern kesselhaus“ an Außergewöhnlichem begegnet und ihn zum Entschluß gelangen läßt, keine Kraft mehr zu verschwenden, „… das Leben mythisch zu sehen“. Daß die Schmerzen in Hilbigs Dichtung der Geschichte erwachsen, macht das Gedicht „alibi“ (1968) auf bestürzende Weise offenkundig:
abwesend war ich
hier abwesend da wo das blut blühte
Und diese durch das Alter bedingte Tatsache erfährt als abschließender Gedanke in diesem Gedicht eine visionär-mahnende Dimension:
ich war noch tot als die großen kriege begannen
ich werde sterben vor dem nächsten…
Was sich im Ich „gebärdet“, ist „der beißende rauch und die asche / der krematorien –“ („grober rückfall“, 1972).
Der Herbst ist für den Dichter von hoher poetischer Anziehungs- und Aussagekraft. Das Verhältnis des Menschen zur Natur spiegelt sich in vielen Gedichten variantenreich im Sinngehalt gerade dieser Jahreszeit. Das lyrische Ich zeigt auch hier dadurch seine Stärke, daß es nicht beim Betrachten, im Passiven verharrt, sondern durch Fragen zur Aktion drängt. Das gilt nicht nur für die Herbstgedichte. So endet das Gedicht „die sorgenvollen gesichter“ (1968) mit der Frage:
wo jetzt hingehn wenn der winter
kommt und der lästige schnee
fällt –
Und das Ich sucht nach Antwort:
wann gelingt uns jenes lied vom licht
das dich weckt aus dem einverständnis deiner tiefe („die sommersee“, 1971).
Im Gedicht „geflüster“ (1966) ist die „Süße der Rosen“ nicht ohne das „Dunkel des Efeus“ vorstellbar. Gerade aus dieser Wechselseitigkeit beziehen viele Gedichte des Bandes poetischen Reiz, vermitteln sie Lust auf Leben in all seiner Dialektik.
In den Gedichten Hilbigs sind die Traditionen der symbolistischen und der expressionistischen Lyrik des neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts lebendig, in manchen wirken sie übermächtig. Mir kommt ein Satz aus Novalis’ „Historischen Fragmenten“ in den Sinn:
Manche Menschen leben besser mit der vergangenen Zeit und der zukünftigen, als mit der gegenwärtigen.
Und ich frage mich, ob Hilbig vielleicht einer dieser Menschen sein könnte? Vor allem ist es Arthur Rimbaud, aus dessen Werk sich in vielem Hilbigs poetische und gesinnungsmäßige Konzeption und Konfession speist. Darum gewinnt das Gedicht „stimme stimme“ (1969), das Titelgedicht des Bandes, besonderes Gewicht. Es beginnt fast klagend:
eine trunkenheit ist gewichen aus meiner stimme
rimbaud ist gewichen aus meiner stimme –
Weiter dann fragend:
aber rimbaud (gewichen aus meiner stimme)
wo sind wir denn jetzt sag wer
ersäufte was wir sangen.
Und bekennend:
hundert heuschrecken jagen durch meinen hals
(dazu dein hundertjähriges verweigern rimbaud)…
Erneut eine Frage:
… (wer verlor uns rimbaud
was ist das wohin wird die chemische rose
aus unseren köpfen verkauft).
Und die Antwort:
… (rimbaud du toter mann
in meinem kopf)…
Dieses Wissen ist schmerzlich, nimmt auf vielfache Weise poetische Gestalt an. „Auch das Genie ist einem Gestaltenwandel unterworfen“, heißt es bei Johannes R. Becher mit Blick auf Rimbaud, „aber es findet sich wieder in den Werken all derer, die ihm nachfolgten und sein Vermächtnis zu erfüllen vermochten…“ Hilbig hat sich auf diesen Weg begeben, die Aussagekraft seiner „verse um an frühere zu erinnern“ (1972) bestätigt das. Und andere Dichter und Künstler kommen in sein Blickfeld. Ich denke an das „novalis“-Sonett ( 1970), das mit den Worten schließt:
… und unerschöpflich wird mein traum
folgerichtig daher die Aufforderung:
erwachen endlich um nicht
zu stürzen („barlach“, 1970).
Die Prosa Wolfgang Hilbigs fließt nur scheinbar „geruhsam“ dahin. Sehnsucht ist eingebettet in Krisen und „Aufbrüche“ (1968). Überdrüssig eines Wohlstandes, der satt und träge macht, „hatte… ich großes Verlangen nach einem anderen Wohlstand“. Die „Bungalows“ (1969) erinnern an Pfahlbauten, Eingeborene, Urwald. Auch das Erzähler-Ich lebt in „unwegsamer“ Gegend. Die „Idylle“ (1970), die Hilbig beschreibt, ist keine. Vielmehr ist sie ein Ort beunruhigender Gedanken, diese Mühle.
Und an den Winterabenden, wenn das Haus widerhallt von unserem Gelächter, werden wir wissen wofür ich gut bin. Dann werde ich Holz schlagen, daß der Rauch unseres Feuers, sichtbar, und mit Macht aus dem alten Schornstein fährt.
In der Geschichte „Die verlassene Fabrik“ (1971) wird Vergangenheit lebendig:
Ich spüre mein Alter, daß ich es, war, der mich einschloß, der uralte Mann, der hier eingesperrt wurde, hier werde ich wieder hergestellt, werde wieder in meinen Vater verwandelt, in meinen Großvater, in meinen Urahn…
In der Geschichte „Der Leser“ (1973) macht sich der Autor selbst zum Gegenstand der Betrachtung. „Die Beschreibung“ (1973) läßt uns Einblick nehmen in ein dörfliches Domizil, wohin er sich zu rückgezogen hat, in seine Umwelt mit ihren Menschen. Und der Gedanke, mit dem er die Geschichte „Glasasche“ (1973) abschließt, „… nichts nimmt ein Ende – kann immer noch gerettet werden“, korrespondiert mit der Aussage von „Herbsthälfte“ ( 197 3), dem Schlußtext des Bandes:
… der Anfang ist offen.
Für das Erzähler-Ich und den Dichter ist dies eine gleichermaßen zutreffende Aussage. Wolfgang Hilbig ist ein Dichter, der sich mit origineller poetischer Stimme in die Dialoge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einmischt.
Armin Zeißler, Neue Deutsche Literatur, Heft 3, März 1984
Wie war es möglich?
– Zu Wolfgang Hilbigs Erstveröffentlichung in der DDR. –
Wolfgang Hilbig war nicht besonders mitteilsam in allem, was seine Arbeit betraf. Erst später, Mitte der neunziger Jahre mit den Frankfurter Poetikvorlesungen, gab er diese Zurückhaltung auf und bewies darin, dass er die Mechanismen des Literaturbetriebs und der -kritik all die Jahre über sehr genau analysiert hatte.
Ich selbst besitze nur einen einzigen schriftlichen Hinweis von ihm, in dem seine Zusammenarbeit mit dem Reclam Verlag erwähnt wird, und auch der bezieht sich nicht auf den Band Stimme Stimme. Die Karte ist datiert vom 24. Januar 1981:
Ich habe grade zwei Gedicht-Übersetzungen von Dylan Thomas für den Reclam-Verlag fertig, mit denen ich sehr unzufrieden bin. So etwas sollte eigentlich interessant sein. Aber es wird immer mehr zum Störfaktor für die große Wut, die man für das eigene Schreiben braucht.
Tatsächlich erschienen fünf Gedichte von Dylan Thomas in der Übertragung Hilbigs in dem Band Arbeit am Wortwerk (Nr. 1077), herausgegeben von Bernhard Scheller bei Reclam im Jahr 1985.
Das Zitat ist insofern interessant, als es zwei Dinge benennt, die für Hilbigs Schreiben symptomatisch waren: erstens die Unzufriedenheit mit dem Geleisteten – sie bezog sich bei Weitem nicht nur auf Nachdichtungen, sondern immer auch auf die eigenen Texte. Zweitens „die große Wut, die man für das eigene Schreiben braucht“. Dem ist nichts hinzuzufügen, höchstens die Feststellung, dass Hilbig, anders als die Schreihälse nachfolgender Lyriker-Generationen, im persönlichen Umgang sich nie als „zorniger junger Mann“ gebärdete, vielmehr wirkte er auf Außenstehende eher schüchtern, gehemmt und vor allem bescheiden. Er machte kein Aufhebens um seine Bücher. Als ich ihn Ende der siebziger Jahre kennenlernte, war sein erster Gedichtband Abwesenheit schon im S. Fischer Verlag erschienen, doch davon erfuhr ich nicht etwa von ihm, sondern durch den beflissenen Meuselwitzer Freund, der uns miteinander bekannt gemacht hatte.
Zum Band Stimme Stimme stellen sich in diesem Zusammenhang zwei Fragen. Zum einen, wie war es möglich, dass ein Lyriker, der von Anfang an eine eigenständige und originäre Handschrift vorzuweisen hatte und dessen Gedichte präzise Wahrnehmungsprotokolle aus der inneren Provinz eines am Wortwerk schürfenden Arbeiters darstellten, fast zwei Jahrzehnte lang trotz intensiver Bemühungen um Veröffentlichung in der DDR ignoriert worden war? Zum anderen die zweite, spannendere Frage: Wie war es möglich, dass ein Dichter, dessen Abkehr vom verordneten Optimismus, von den öffentlichen Sprachregelungen, einschließlich ihrer Tabus und ihres Traditionsverständnisses, so deutlich und konsequent wie bei keinem anderen zum Ausdruck kam, im Traditionshaus Reclam Verlag mit einer schmalen, aber profunden Auswahl von Gedichten und Prosa im Jahr 1983 doch noch der DDR-Öffentlichkeit vorgestellt wurde?
Erstens: Alles, was für Hilbigs Lyrik sprach und von den klügsten Köpfen im Lande von Anfang an erkannt wurde, sprach zugleich gegen eine Veröffentlichung in der DDR, in der das geschriebene Wort in irgendeiner Weise kanonisiert sein musste: sei es durch die Zugehörigkeit zu einem als fortschrittlich legitimierten kulturellen Erbe – obwohl die Verlage als Schnittstellen zwischen Geist und Macht sich um ein möglichst weitgefasstes Verständnis des literarischen Erbes bemühten –, sei es durch das Bekenntnis zum Sozialistischen Realismus, dessen enggefasste Begrifflichkeit dennoch eine große Bandbreite verschiedener literarischer Stile und Haltungen zuließ.
Hilbigs Gedichte aber waren von Anfang an abgründig und subversiv. Sie feierten den Rausch und das Elend danach, eröffneten halluzinogene Räume inmitten einer trostlosen Industrielandschaft und boten keinen Anhalt für irgendeine Art von Erlösung. Wer sich so offen in die Tradition der literarischen Moderne eines Rimbaud und der deutschen Frühromantik eines Novalis stellte, von Untergang und Finsternis, von Scheitern und Verzweiflung in den Farben Georg Trakls schrieb, rüttelte am wichtigsten Grundpfeiler sozialistischer Machtlegitimation: der Glücksverheißung für seine Bürger, für den Arbeiter vor allem, wenn auch nicht sofort, so doch in absehbarer Zukunft. Selbst moderate Kritiker an den realen Verhältnissen stellten dieses Ziel nicht infrage. Wer sich auf Wolfgang Hilbigs Gedichte einließ, war für den sozialistischen Aufbau nicht mehr zu gebrauchen. Das hatten die Redakteure der Literaturzeitschriften, die Lektoren und Verlagsleiter intuitiv erfasst. Es konnte kein Zweifel daran bestehen, dass Hilbig in der DDR keine literarische Zukunft beschieden war.
Für mich stellt sich, zweitens, das Erscheinen von Stimme Stimme aus heutiger Sicht vor allem als Symptom für das sich abzeichnende Ende der DDR dar. Das mag pathetisch klingen und in seiner Zuspitzung für eine nach den historischen Ereignissen zurechtgebogene Behauptung gehalten werden. Doch man braucht ja nur genau lesen, um zu erspüren, dass aus dem Dichter die Stimme des Propheten spricht:
ich weiß das meer kommt wieder nach sachsen
es verschlingt die arche
stürzt den ararat.
(„das meer in sachsen“)
oder
schon ist die erde ganz von farben leergefegt
und schwärenhafte träume streifen in den weiten.
(„das ende der jugend“).
Jedem, der die apokalyptischen Offenbarungen Hilbigs, gegen die sich der düsterste Punk als pubertäres Geblubber ausnahm, in den Händen hielt, musste klar sein: Wenn ein Staat, der über das Mittel der Zensur als Einschüchterungs- und Kontrollorgan verfügte, sie zum Druck freigab, hatte er den Kampf um die kulturelle Deutungshoheit aufgegeben. Dass Hilbigs Poesie nicht für den Straßenkampf taugte, war zweitrangig. Seine Untergangsvisionen betrafen nicht nur die DDR. Sie galten der gesamten Zivilisation, der Menschheit wie dem Individuum. Das war ein viel größeres Sakrileg als alles, was sich hinter Schlagworten wie dem der „Verbesserung von Mitteleuropa“ an reformerischen und utopischen Ansätzen verbarg.
Das Erscheinen von Stimme Stimme bedeutete weit mehr als ein den Umständen abgetrotztes singuläres Ergebnis verlegerischer Weitsicht und Hartnäckigkeit. Das Buch wurde als Seismograph für die kommenden Erschütterungen und Umbrüche mit Signalcharakter wahrgenommen. Die Auswahl, die nicht einmal die bittersten und schwärzesten von Hilbigs Gedichten und Prosa enthielt, erreichte in der DDR genau die Leser, die dafür sensibilisiert waren. Sie teilten mit dem Dichter den täglichen Blick in den näher rückenden und immer tiefer klaffenden Abgrund.
Thomas Böhme, aus Ingrid Sonntag (Hrsg.): An den Grenzen des Möglichen. Reclam Leipzig 1945–1991, Ch. Links Verlag, November 2016
Weiterer Beiträge zu diesem Buch:
Michael Hähnel: stimme stimme
Sonntag, 8.7.1984
André Schinkel: Buch des Monats
pirckheimer-gesellschaft.org, 26.10.2023
Lieber Wolfgang Hilbig,
Ostern 81
ich bin Ihnen nun schon fast acht Wochen eine Antwort schuldig, habe des öfteren auch dazu angesetzt, aber mich immer wieder in jenem Gestrüpp Hunderter Für und Wider verloren, das mir eine erörternde Arbeit auch geringen Umfangs zu einem Weg durch Monate macht. Ihnen wird es vielleicht ähnlich gehen. Ich möchte Sie daher einfach fragen, ob Sie in den nächsten Wochen einmal in Berlin sind, so daß wir uns dort, oder gar in Märkisch, treffen und miteinander reden könnten. Ich suche verzweifelt eine Möglichkeit, in nächster Zeit nach Meuselwitz zu kommen, und finde keine vor Mitte Juni, bloß das scheint mir schon zu spät zu sein.
Das Einzige, was ich Ihnen heute darum schreiben möchte, ist dies: Lieber Wolfgang Hilbig, ich bitte und beschwöre Sie, mit der Edition Ihres zweiten Gedichtbandes keine vollendeten Tatsachen zu schaffen, ehe die Möglichkeiten mit Reclam nicht erschöpft sind. Ich bitte Sie als Ihr Leser und im Namen Ihrer Leser hierzulande, und deren sind mehr, als Sie vielleicht glauben. Zwar könnte ich mir oder könnten Stephan Hermlin oder Christa Wolf sich auch Ihr Buch beschaffen, wenn es in Frankfurt am Main statt zu Leipzig an der Pleiße gedruckt werden sollte, bloß wird das die Masse Ihrer Leser hier nicht können, und das Gespräch über diesen Band, auf den wir alle warten, wird dann in Konvertikeln stattfinden. Die Veröffentlichungen Ihrer Gedichte in Sinn und Form haben dem lesenden Publikum hier sehr viel bedeutet, ich weiß das, und ich möchte Sie daher beschwören: brechen Sie diesen Kontakt nicht ohne zwingende Not ab.
Gewiß, was Sie mir von der Praxis gewisser Leute und einer gewissen Behörde da schreiben, ist unglaublich und empörend, und da Sie davon in einem Offenen Brief berichten, brauche ich Sie nicht um die Erlaubnis bitten, diese Vorfälle an anderer Stelle, etwa gegenüber dem Staatssekretär im Ministerium für Kultur, zur Sprache zu bringen, einem Manne, dem ich vertraue und der sich, wie schon früher auch (gewiß nach seinen Möglichkeiten, die in solchem Bezug ja auch beschränkt sind), gegen das Unrecht engagieren wird. Ich verstehe da jede Erbitterung, aber darum doch nicht jede Konsequenz. Sollten wir nicht trotzdem versuchen, Ihren Band hier herauszubringen, da, wo Ihre originären Leser sind, und nicht zuletzt auch aus Trotz gegen jene Leute, die Sie insultieren? Ihre Leser werden es Ihnen in einem Maß danken, das jene Mißhelligkeiten übersteigt.
Nun könnten Sie einwenden, daß es dem Reclamverlag ja frei stehe, das Buch von S. Fischer zu übernehmen, daß Sie ihm die Lizenz offenhielten – lieber Wolfgang Hilbig, wir sollten uns hüten, in eine Praxis zu verfallen, die wir in bezug auf unsre eigene Person mit Recht uns verbitten – nämlich zu vergessen, daß der Andre auch Mensch ist und nicht bloß eine Art Mechanismus. Sie schrieben mir, Sie seien bereit zum Dialog – diese Bereitschaft muß vielen Prüfungen standhalten, das weiß ich nur zu gut, aber so lange sie da ist, dürften Sie nicht vergessen, daß Beziehungen zwischen Verlag und Autor Partnerschaftsbeziehungen sein sollen, Beziehungen zwischen Menschen, die Gefühle haben und also auch Empfindlichkeiten, Verletzlichkeiten – und das gilt nicht bloß für den Autor. Schaun Sie, Sie müssen doch den Verlag brüskieren, will sagen die Menschen dort brüskieren, die versuchen, etwas zu erwirken, wenn Sie ihnen gegenüber einen ultimativen Standpunkt einnehmen, den eines Alles oder Nichts, den man in einer Partnerschaft schwer vertreten kann, ohne daß sich die Gegenseite dann auch auf so eine Position stellt, vielleicht sogar auf so eine Position stellen muß. Ich nehme gleich Ihnen für mich in Anspruch, mich nicht mehr zensieren zu lassen (lange Zeit habe ich’s getan), doch ich sehe den Sinn dieses Satzes (für den ich Ihnen danke) darin, als Autor auf dem Meinen zu bestehen, jedoch im Wissen meiner Stärke und Souveränität ein Gespräch nicht von vornherein abzulehnen, vielmehr offen für jeden Ratschlag zu sein, im Sinn einer Bereitschaft, ihn anzuhören und ernsthaft zu überdenken. Ob man ihm dann folgt, wird von Fall zu Fall entschieden werden müssen, und es wäre möglich, daß dann jeder Fall „Nein“ heißt, aber die Bereitschaft sollte bestehen. Darf ich Ihnen etwas aus meiner Erfahrung berichten? Ich bin beispielsweise von Suhrkamp weg und zu Hoffmann & Campe gegangen, weil die dortige Art, mich zu zensieren (höhnende Ablehnung aller meiner erzählerischen Versuche in Richtung Mythos; läppisch besserwisserische stilistische Eingriffe; schließlich das Verlangen, mein Sprachbuch von den Dampfenden Hälsen in jenen Passagen, die sich konkret auf die DDR beziehen, in ein Vokabular „West“ umzuformulieren) – weil also diese von Suhrkamp praktizierte Art mir unerträglich geworden ist; ich bin also zu H & C gegangen, und natürlich macht man mir dort auch bestimmte Vorschläge, und ich diskutiere darüber. Andererseits bin ich auch nach dem Tode von Dr. Kurt Batt und dem Weggang von Konrad Reich zum Unterschied von andren Kollegen bei Hinstorff geblieben, weil ich die Zusammenarbeit mit meiner dortigen Lektorin Ingrid Prignitz einfach nicht mehr missen möchte, unter anderem nicht ihren Mut missen möchte, mir auch schmerzhafte Änderungsvorschläge zu unterbreiten, mitunter, so in meinem letzten Erzählband, Streichungen von der Länge mehrerer Seiten. Sie kommen, diese Vorschläge, das hat mich eine jahrzehntelange Zusammenarbeit gelehrt, dem Werk in meinem Sinn zugute, sie präzisieren es, arbeiten sein Profil heraus, eliminieren Mißlungenes, verschärfen – ich würde ja keine Silbe streichen und würde auf jedem Komma beharren (und tue das auch), wenn durch eine vorgeschlagene Veränderung meine Absicht entschärft, mein Wollen verdunkelt, meine Diktion verunklärt würde. Noch ein Beispiel: Ich habe auf Grund einer insgesamt zehntägigen Diskussion mit Herrn Witt vom Reclamverlag in meinem Trakl-Manuskript Änderungen akzeptiert (Änderungen im Sinn von Umschreibungen), die mir zwar zusätzlich schwere und unangenehme Arbeit gebracht, aber das Manuskript doch auch wesentlich verbessert, und zwar verschärft, haben – ich habe, grob geschätzt, etwa ¼ seiner Vorschläge akzeptiert, mich aber andrerseits dort auf die Hinterbeine gestellt und bin absolut unnachgiebig geblieben, wo ich gewußt habe, daß er nicht recht hat.
Nun ist Lyrik gewiß etwas Anderes als Prosa, ein Gedicht verträgt sehr viel seltener einen Eingriff – aber Sie sollten doch zumindest auch die Möglichkeit einräumen, einmal eine im Rahmen des Ganzen schwächere Zeile geschrieben zu haben, über die nachzudenken Sie bereit wären. Ich wiederhole: Das Recht auf das Ihre ist voll bei Ihnen, und Sie sollen darauf bestehen, doch dieses Recht verträgt auch einen Rat. Ich bitte Sie, lieber Wolfgang Hilbig, sich zu überlegen, wie sehr Sie die Menschen dort im Verlag kränken, wenn Sie sich von vornherein auf den Standpunkt stellen: Nehmt alles oder laßt es bleiben. Sie sollten den Verlag nicht für die – ich wiederhole auch hier – schändlichen und empörenden Umtriebe jener Herren verantwortlich machen.
Nun können Sie den Spieß natürlich umdrehen und sagen: Das Gleiche gilt doch auch für S. Fischer, ich kränke die doch ebenso, wenn ich denen eine Lizenznahme anbiete (denn darauf läuft Ihr Vorschlag an Reclam hinaus). – Nur besteht halt der Unterschied beider Fälle darin, daß Sie, den Bedingungen deutscher Zweistaatlichkeit nun einmal unterworfen – hier leben und Ihre originären Leser hier haben, Leser, die Ihnen dann halt solche Briefe schreiben wie diesen hier.
Lieber Wolfgang Hilbig, ich weiß nicht, ob dieser Brief nicht schon zu spät kommt, ich mache mir Vorwürfe, nicht eher geschrieben zu haben, aber von den 8 Wochen war ich auch 4 Wochen auf Reisen. Bitte überdenken Sie diese Sache noch einmal, und bitte fühlen Sie sich nicht irgendwie bevormundet, wenn ich Ihnen bei Schwierigkeiten mit Reclam meine Hilfe anbiete. Ich kenne das Lektorat dort geraume Zeit und weiß, daß leicht Mißverständnisse möglich sind, ich weiß, daß Hubert Witt ein sehr schwieriger Mann ist, mit einer unangenehmen Art (die aus bestem Willen herrührt), einen unablässig betreuen zu wollen; ich kenne die unangenehmen Eigenschaften des Verlagsleiters (von dem man sich nichts gefallen lassen darf) – aber dennoch, wir haben hier wenig Anderes. Wenn Sie wollen, stehe ich Ihnen da immer zur Verfügung – ich weiß, daß Sie Manns genug sind, Ihre Sache allein zu vertreten, da brauchen Sie meine Hilfe nicht, aber sie könnte dort nützlich sein, wo man letzte Möglichkeiten wahrnimmt oder versucht, aus verfahrenen Lagen noch einmal herauszukommen.
Das ist ein langer Brief geworden, ich laß ihn aber, wie er ist, in all seiner Unbeholfenheit, sonst wird es noch Mai, das Jahr nimmt bald ab. Ich danke Ihnen, daß Sie hier sind; bleiben Sie hier.
Ich drücke Ihnen ganz herzlich und fest die Hand. Kann Constanze schon Papier zerreißen? Wenn Sie sich ärgern, geben Sie ihr diesen Wisch da und sagen Sie bitte 1 Gruß von mir, und an Margret
immer Ihr
Franz Fühmann, Sinn und Form, Heft 2, März/April 1994
ICH ist nicht MEIN −
Ein Toten-Gedeck für Wolfgang Hilbig
in der Volksbühne am 14. April 2012
Mitropa – Text aus Wolfgang Hilbigs Erzählung „Fester Grund“
(Lesung des Autors, CD)
Mitropa – Text aus Tilo Köhlers Erzählung „Das abgefahrene Tablett“
(Lesung des Autors)
Zeitgenossen mit einer Affinität zu Bahnhofs-Klausen haben meist Gründe für eine solche Neigung, und in der Regel sind es keine guten; denn seltener treiben sie kulturelle und historische Motive um, eher schon gastronomische und sehr gegenwärtige Interessen. Man muss dabei vielleicht sogar von einer absoluten Augenblicks-Neugier sprechen, von der ausschließlichen Interessiertheit Wohl, augenblicklich ein Bier zu bekommen. In vollem Zuge den Gleichmut zu spüren, der sich mit dem ersten Schluck endlich wieder über sie senkt, nach der Tagesreise einen Platz zu finden und hier all die anderen Abgehängten zu treffen, die gleich ihnen den Anschluss verpasst haben. Wunderbar. Grauenvoll.
Wolfgang Hilbig und ich haben sich nicht in den 80er Jahren in einer Reichsbahn-Pinte getroffen, so groß die Wahrscheinlichkeit, es hätte geschehen können, auch gewesen sein mag. Gleichwohl sind wir uns offenbar in der Faszination für diese bizarren Orte begegnet, die zu beschreiben beinah eine ebenso intensive Sucht bescheren kann wie der reale Aufenthalt in ihren rauchverhangenen, bierschwadigen Sälen.
Allerdings – selbst wenn wir am gleichen Tisch nieder gekommen wären, hätte sich unser Blick deutlich unterschieden: Wolfgang Hilbig hätte sich den Anblick der traurigen Gestalten zu Herzen, ich mir den hagestolzen Kellner zur Brust genommen. Er hätte sich um die verlorenen Seelen der Anfechtbaren gekümmert, ich mich um das seelenlose Personal. Er hätte die Ohnmacht in den ewigen Verlierergesichtern beschrieben, ich die Machtfresse des immer siegreichen Tresenchefs.
Viele Wege führen mithin in die Bahnhofswirtschaft, wenige hingegen aneinander vorbei.
Klar also, dass wir uns irgendwann getroffen haben, später und an Orten, die sich stets wichtiger gaben als es Bahnhofskneipen je sein wollten und die fast immer farbloser waren als noch der graustichigste Wartesaal. Literatur-Cafes, Künstlerkaschemmen, Debattierclubs, in denen all jene saßen, die durch bloße piepsige Wortgewalt für tektonische Verschiebungen in den Massiven der Literaturlandschaft sorgen wollte. Unter ihnen Wolfgang Hilbig – natürlich ein Fremder, natürlich ein „Abwesender“, sichtbar nicht dazu gehörig, spürbar unvereinnahmbar. In seiner unvergleichlichen Physis, mit einer Körperlichkeit, die nichts auszudrücken schien als Lebensanstrengung und grenzenlose Müdigkeit, ein Lino Ventura unter lauter spilligen Gerard Philipps, ein Mann in Wut, homme colerè und homme de lettre in einem.
Es ergab sich eine für mich überraschende – und, das versteht sich bei Wolfgang Hilbig von selbst: für ihn stumme – Übereinkunft: Der Heizer stellte dem Hochseefischer ein Bier auf den Tisch, der Fußballer dem Boxer das nächste, der Dichter dem Schreiberling das übernächste usf. Es wurde ein langer Schwatz zum kurzen Abriss, in dem nichts fehlte von A bis Z, also zwischen Adorno und Zatopek, Absinth und Zaratustra, Anbetung und Zauseltum. Und vielleicht hätte es ja der Beginn einer ganz großen, also filmreifen Freundschaft werden können, aber: Trinker schließen keine Freundschaften, sie pflegen allenfalls Zweckbündnisse, und hin und wieder sitzen sie unverbrüchlich beieinander.
Immerhin – wir kannten uns. Aber was heißt das schon. Meine beste Freundin kenne ich seit 35 Jahren, meinen besten Freund wohl fast genauso lange. Kenne ich sie? Und – je länger ich sie kenne, die Frage: Möchte ich sie wirklich kennen? Eines Tages, ganz und gar und dann endgültig? Eher nicht. Vielleicht.
Ich kannte Wolfgang Hilbig, wie viele, erst seit 1983, genauer: Seine „Stimme“. Ich las diese Gedichte, und es erging mir damals genau so, wie es Natascha Wodin in ihren Nachtgeschwistern” beschreibt: Ich wollte diesen Mann kennen lernen, der mit seinem Transportarbeitergesicht aus den Fotos blickte, die mir gelegentlich unterkamen – schnell und unbedingt. Viel zu selbstverliebt ins eigene Bild vom letzten Schreibenden Arbeiter, der schließlich i c h w a r, konnte ich mir gar nichts anderes vorstellen als das wir uns auf Anhieb verstehen würden.
Ein wenig hat es dann doch gedauert, und man darf das getrost im doppelten Wortsinn verstehen; wirklich nah sind wir uns nicht gekommen, auch täte ich mich mit einer behaupteten Nähe schwer. Freundschaft ist ein großes Wort, in seinem Gebrauch sollte man behutsam sein: Wo Freundschaft nicht ist, sprich das Wort nicht aus, allemal nicht gegenüber Wolfgang Hilbig. Denn eines war dieser Dichter niemals: Aller Welt Freund. Und es ist schon zutiefst erstaunlich, wie viele Bekannte sich – im Nachhinein – seiner Freundschaft rühmen, er muss regelrecht umstellt von ihnen gewesen sein. Für jemanden, von dem man weiß, dass er immer nur schrieb und höchst selten sprach, dass er seine Höhle fast nie freiwillig verließ und Gesellschaft mied wie ein waidwundes Tier feindliche Reviere, scheint so viel an- und nachgetragene Zuneigung ungewöhnlich, zumal mir auch scheint, dass Wolfgang Hilbig bereits heute, also nur fünf Jahre nach seinem Tod, in der tätigen Erinnerung all dieser zahlreichen Freunde nur noch noch selten anwesend – oder besser: schon wieder einmal a b w e s e n d – ist.
Freundschaft hin – Kumpanei her, wir haben uns hin und wieder gesehen, zufällig oder verabredet, und jede Begegnung mit Wolfgang Hilbig ist mir auf ihre Art unvergesslich. Unsere zaghaften „Zyklen“ deckten sich selten, mal trank er gerade nicht, mal war ich eben wieder auf dem Pfad der Tugend unterwegs, manchmal allerdings „deckten sich“ die selbsttherapeutischen Unternehmen, und so ist mir eine Begegnung in ganz besonderer Erinnerung: Eine säkulare Sause zwischen acht Uhr abends und vier Uhr morgens, zwischen Bornholmer Hütte und Metzer Eck, einmal die Schönhauser im Sationsbetrieb von Nord nach Süd, über Nordring und Venezia, Lotos und Lolot, also durch die einschlägigen Kneipen und sogenannten „Bars“, eine Seemeile in acht Stunden, einen kompletten Werktag zur Nacht gemacht. Am Ende habe ich ihn in der Metzer Straße zurück gelassen, den vielleicht traurigsten Mann der Welt, der wieder einmal „Nur Zigaretten holen“ gegangen und doch wieder einmal zurück gekommen war.
Ich erwähne diese Tour de force nicht aus Trinkerseligkeit: In dieser grausig schönen Nacht traten mir alle Schatten aus den Seiten all seiner Büchern leibhaftig entgegen: der Mann, der ein vaterlose Junge war, der noch mit 12 im mütterlichen Bett schlief, aber auch der zusammengeschlagene Boxer, der an seinem Anspruch immer wieder verzweifelnde Dichter, vor allem aber der in der Liebe restlos Gescheiterte. Am Morgen danach erwachte ich wieder einmal mit einer neuen Hutgröße; ich fühlte mich zerschlagen w i e i m m e r nach solchen exzessiven Wanderungen über die nächtlichen Pisten, und zugleich war ich bis ins Tiefste erschüttert w i e n i e: Mir schien, ich hatte erstmals eine Vorstellung davon bekommen, was ozeanische Verlorenheit, was endgültige Verlassenheit, was ein für allemal es heißt, das „Trost-Los“ gezogen zu haben. Ich schrieb das erste Gedicht meines Lebens – und das letzte.
Für W. H.
AN DEN KIOSKEN
DER TROSTEN LOSE
lehnt die ausgespülte stimme
früher zechen dunkel immer
eher zwischen all den leeren
batterien bauchiger bouiteillen
unumstößlich aufgedreht verschlossen
mitten draußen
halt ist in der kleinsten hütte
stehen die gerüche länger
wenn die tage kürzer werden
geht er eben zigaretten holen
und kommt nur noch
dieses eine mal zurück
gezuckt hat das im alten flatterherzen
aus dem keine junge magengrube mehr
zu machen ist mit stetem tropfen
haken schlagen über flüssig und
doch glasklar durchgezogen nur noch
dieses eine mal nach oben
so ein heber ungeschlachte anmut
ist es was am ende auszählt
bis die schwarte kracht so
kurz und trocken auf die bretter
die das seilgevierteilte bedeuten
ring und blaue ecke wanken wie
zertorkelt nach der kalten dusche
heizt der jubel ein verlorenes glühen
für den langen schlaf der sehnsucht
nach der großen stille vor dem rückweg
in den angeschliffenen morgen dämmern
klingen schärfer auf zur letzten runde
bar in die bezogenen hochsitze gesackt
zum horrido der aufgespürten flintenweiber
kommen die absinthenen feenversprechen
darf man halten fest am saum der umnacht
zieht er los auf los gehts heiter
weiter noch sind malz und hopfen unverloren
abhanden gehen kann man sich schon heute
morgen fühlen ist wie sich entgegen kommen
sehen der man niemals anders war als
hall und rauch und lauter ruf von
flasche zu flasche laub zu laub
zerrascheln schankwirte tragen ihn
zu seinem grabe wird er euch erzählen
wie es wirklich war in einem fort
verschlossen halt den wahren grund
beschweigen dieses unerhört verklungenen
gefangenensolos aus dem freiheitskorps
der unumschlungenen
von alter platte abgedeckt
verstummt der nie erloschene
durst nach ingrimmiger liebe
grotten tiefer kummer
geht zur neige und
der trost zieht los
Einmal noch ging mir später, Wolfgang Hilbigs Schreiben betreffend, ein geradezu gleißendes Licht auf; das war im Jahr 2005. Ich hatte ein dreimonatiges Stipendium in Edenkoben in der Pfalz angetreten, das dortige Künstlerhaus ist von einem ziemlichen Renommee, und es liegt in einer vermutlich ausnehmend schönen Gegend, auf einem Hang inmitten malerischer Weinberge, von denen aus man weit in die Tiefen dieser sanften Landschaft hineinblicken konnte und wohl auch sollte, alles in Blickweite zum berühmten Hambacher Schloss, in der Nähe zur Neuen Weinstraße und zu all den anderen Postkartenidyllen dieser für einen hoffnungslos verstädterten 50jährigen so seltsamen Region. I c h floh das hinreißende Örtchen schon nach nur sieben Wochen – Wolfgang Hilbig, der das Stipendium 1987 erhielt, blieb sieben Jahre!
Ich nehme nicht an, dass es die Schönheit der Hügelketten war, die das Kind im Manne erweckt, ihn an seine frühen Jahre erinnert und zum Bleiben bewegt hätten. Auch nicht der ewige Flammekuche, das alljährliche Brimborium um den fürchterlichen Federweißer, schon gar nicht das liebliche pfälzische Idiom, das – ja, man mag es kaum glauben – noch um ein Vielfaches schrecklicher und unverständlicher war als das von ihm selbst bekannte. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem zum Künstlerhaus gehörigen Hausmeister, der eine halbe Stunde auf mich einplauderte, ohne dass ich ein einziges Wort verstanden hätte, dabei höre ich mich eigentlich schnell und gern in fremde Dialekte ein. Dennoch, hätte der nette Mann nicht hin und wieder mit der Hand nach oben gewiesen, ich wüsste bis heute nicht, dass er offenbar die Vorzüge seines heimatlichen Apfelbaumes lobte, unter dem wir gestanden hatten.
All das also hat ihn vielleicht nicht so lange dort gehalten, schon gar nicht eine gewisse Amüsiertheit, wie sich mich gelegentlich in der Not befällt. Ich glaube, dass Wolfgang Hilbig hier für – ihn selbst überraschend – Szenen eines Lebens wiedergefunden hatte, von denen auch er längst annahm, sie gehörten in eine Zeit, die ein halbes Jahrhundert weit zurück lag. Die Straße etwa, die vom Künstlerhaus in den Ort führte, war eine graubraune Schlucht, Gehöft an Gehöft, Ziegelbau an Ziegelbau. In jedem zweiten Haus war das Hoftor weit geöffnet, üble säuerliche Gerüche wehten heraus, von der Straße aus konnte man in die Höfe blicken, in denen der gummistiefelbewehrte Bauer stand und durch Berge irgend einer Maische oder welcher Masse auch immer stapfte. Manchmal winkte der Hausherr einen herein, jeder der Weinbauern war zugleich auch sein eigener Grossist – „Den müssche Se noch probiere!“ – Widerspruch zwecklos unter einem Liter. Es gab in der ganzen Straße keinen Laden, vor allem keine Kneipe, in die man abends noch hätte auf ein Bier huschen können oder wollen. Wein war Lebensmittel, ihre Erzeuger waren meist mittags schon angeschickert und zudem gnadenlose Erzähler, obwohl oder gerade weil sie sich zum Teil noch nie im Leben weiter von hier fortbewegt hatten als nach Kaiserslautern im hohen Norden oder Stuttgart im tiefen Süden von Edenkoben.
Ich habe, nachdem ich dort in der Pfalz also gewissermaßen r e – s i d i e r t e, Texte wie „Die Weiber“, „Die Flaschen im Keller“, allen voran natürlich die „Alte Abdeckerei“, die ich nicht müde werde zu besingen und auf immerdar für den großartigsten Text halte, den er je geschrieben hat – und der, nebenher gesagt, ohnehin einer der einzigartigsten ist, die überhaupt und ebenfalls in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Literatur geschrieben wurden – ja, ich kann auch pathetisch – ich habe also seine Texte seither nicht völlig neu gelesen. Aber ich sehe den Fundus, dem sich ihre ihre Entstehung verdankt, ein wenig anders, ein bisschen größer, über Meuselwitz und jene frühen Jahre hinausweisend, die er in Edenkoben zweifellos wiedergefunden haben muss. All diese morbide Schönheit, der muffige Verfall, die verklemmten Witzelein, das tägliche archaische Schuften: Nur blickt nun nicht mehr das staunende Kind auf die Szenerie, sondern der schaudernde Dichter. Ein Paradies für das Heraufdämmern der Erinnerung, die Hölle für das Umgehen in den realen Kulissen des Ortes: Sieben Jahre Glück, sieben Jahre Pech in einem −
Eden und Koben.
„Es gibt einen Dichter, der ein Arbeiter ist und mit der Wucht der Elemente wie mit der von Haar und Traum umgeht und die Würde der Gattung Mensch auch in der Latrinenlandschaft bewahrt; ein großes Kind, das mit den Meeren spielt; ein Trunkener, der Arm in Arm mit Rimbaud und Novalis aus dem Kesselhaus durch die Tagebauwüste in ein Auenholz zieht, dort Gedichte zu schreiben, darin Traum und Alltag sich im Vers vereinen“ – als Fühmann dies schrieb, da war noch keine Zeile von Wolfgang Hilbig in der DDR erschienen. Kein Wort von Kafkas sächsischem Heizer hatte es bis dahin zum Druck gebracht, wieder einmal war es erst der Ruf aus Böhmen am Meer, der dem Dichter aus den Höhen des Heizungskellers in die Niederungen eines offiziellen Verlages verhalf – eine notwendige Abkürzung über den Umweg, den Fühmann auch Wolfgang Hilbig, wie manchem anderen, ebnete. Ich halte es im Übrigen für keinen Zufall, dass mich neben Hilbigs Texten nur wenige so angerührt haben wie manche Fühmanns; allenthalben sehe ich Verbindungen zwischen ihnen, ihrer völligen Verlassenheit, ihren Ausbruchsversuchen, ihrem bisweilen auch Rauschhaften, zwei große Rhapsoden, lyrisch, episch, real, surreal, der Moderne verbunden wie den ältesten Überlieferungen. Ich sehe beider poetische Urgewalt, ihre Wucht, und zugleich ihre lebenslangen Anstrengungen, all die vergeblichen Versuche, ihrer selbst Herr zu werden, sich der Anfechtungen zu erwehren, die Mitgift ihrer Biografien auszuschlagen, ihre Ausweglosigkeit und – ihren Lebensernst, der offenkundig nur in der Poesie seinen Ort finden konnte.
Wolfgang Hilbig hat ungern poetologische Selbstauskünfte gegeben, allzu intim lebte er mit der Poesie, allzu ausschließlich in ihr – und nur in ihr. Er wusste: Wenn er über Literatur sprach – auch das tat er eher selten und ungern – dann gab er sich selbst preis. Niemand tut das freiwillig und gern, von Wolfgang Hilbig konnte man es am wenigsten erwarten oder gar erhoffen. Geschah es doch einmal, schien er unendlich fern, und doch war klar, nur in diesen seltenen Momenten war er gleichermaßen bei sich u n d vielleicht sogar für Augenblicke beim anderen. Gesucht hat er solche Übereinkünfte sicher gelegentlich, gefunden wohl eher selten oder doch eben nie. Es war unglaublich schwer auch für sein Gegenüber, obwohl er ein freundlicher Mann, zumindest mir gegenüber, war; ich fürchtete ständig die eigene Banalität und ebenso seine scheinbare Humorresistenz. Irgendwann, erinnere ich mich, sprachen wir über Verlaine und Baudelaire, und es war das erste Mal, das ich zu v e r s t e h e n begann oder es zumindest glaubte, dass er diese Autoren nicht einfach las, sondern sie auf die altmodischste, treueste Art verehrte, ich glaube, ich begriff das erste Mal, was es heißen könnte: Den Poeten wirklich die T r e u e z u h a l t e n. Ich ließ dennoch und vermutlich wieder nach ein paar Bieren irgendwann alle Vorsicht fahren und erzählte ihm, wie Verlaine meine Französisch-Prüfung an der Uni rettete. Ich hatte, statt mich solide vorzubereiten, lieber in der deutsch-französischen Reclam-Ausgabe von Verlaines Gedichten geschmökert und beim mündlichen Examen die Prüferin zu einem Einsehen verführt, indem ich ihr theatralisch daraus einige Zeilen entgegen schmetterte: Et c’est mon couer, Madame, qui ne bat que pour vous – ja, dies ist mein Herz, Madame, und es schlägt nur für sie. Wolfgang Hilbig kollerte einen seiner seltenen, dröhnenden Lacher zu Tage, ich sah mich nun ermutigt, ihm auch noch m e i n e n Baudelaire nahe zu bringen: Es war das wunderbare Buch Die Blusen des Böhmen, in dem das ebenso wunderbare Dreigestirn Bernstein – Gernhardt – Waechter in den Siebzigern einen knödelfressenden und biersaufenden Dickwanst geschaffen hatte, der nun, Weiß Gott, wirklich mehr sprengte als nur das lyrische Maß und dennoch so gekonnt von einem Versfuß auf den anderen trat, dass es auch für Wolfgang Hilbig eine helle Freude gewesen sein könnte, sich dieser ehrfürchtigen Verballhornung Baudelaires durch die Kollegen zu überlassen. Und natürlich wäre es auch nicht die ganze Wahrheit, wenn ich behauptete, m e i n damaliges Verhältnis zu Verlaine, Baudelaire, zur Moderne überhaupt hätte sich n u r in solchen Kalauern erschöpft – die völlige Unwahrheit allerdings wäre es wiederum auch nicht.
Zum nahenden Schluss möchte ich aber vielleicht noch eines sagen:
Ich sehe ganz absichtsvoll davon ab, an diesem Abend auch noch in Wolfgang Hilbigs große Romane einzutauchen, mich in Deskriptionen ihrer Handlungen oder gar in deren Nacherzählung zu ergehen. Ich will nicht die Umstände ihrer Entstehung referieren, nicht weiter ausführen, wie den Dichter selbst die Rezeption dieser Seite seines Werkes angemutet haben mag. Möglicherweise aber haben just diese hoch- und höchst gepriesenen Bücher ihn wiederum in neue Krisen taumeln lassen, schließlich war er auch insofern ein aufmerksamer Autor, der sehr genau wusste, dass er offenbar ein preiswürdiger, aber eher wenig gelesener Dichter war. Wolfgang Hilbig befand sich, wenn man so will und ein Bonmot von Tucholsky aufnimmt, in der gegenteiligen Situation des historischen Kollegen. Ich habe Erfolg, aber keine Wirkung, dekretierte Tucholsky, Wolfgang Hilbig hatte für wenige zweifellos eine enorme Wirkung, aber wenig Erfolg.
Selbst i c h bin bei der Lektüre der Romane niemals in einen vergleichbaren Sog geraten wie beim Lesen seiner Gedichte und Erzählungen, ICH war vielleicht nie ganz MEIN, obwohl oder gerade weil dieser Roman ja jene seltene Komik herstellt, die für Wolfgang Hilbig bislang als eher ungewöhnlich gegolten hat. Und auch das Provisorium war mir natürlich zu nah, geradezu körperlich vertraut, nun: zu verwandt in seiner so völligen Halt- und Beziehungslosigkeit. Und vielleicht ist ja ein Minimum an absoluter Fremdheit, wie sie mir in früheren Texten begegnet ist, tatsächlich die Voraussetzung für diese maximale Selbstauslieferung an seine Erzählungen, die mich wie beschrieben wirklich ergriffen hatten. Das zu beurteilen, überlasse ich aber gern dem germanistischen Zölibat, den Suchttherapeuten, der Partnerschaftsanalyse oder wem auch immer.
Abschließend: Die Vorstellung, eine Autor bzw. sein Werk könne seien Leser verändern oder auch nur bewegen, in ihrem Leben etwas zu ändern, ist selbst zu einem Gutteil Literatur. Allerdings ist es schon so: Einige Texte von Wolfgang Hilbig haben durchaus einige meiner Vorstellungen geändert, wenn nicht sogar überhaupt erst etabliert: Ich glaube, ich hatte vor ihrer Lektüre eine andere oder vielleicht noch gar keine Idee von Wucht, Verlorenheit, Untröstlichkeit, von Nichtzugehörigkeit. Und vor allem von Schönheit und davon, dass gerade sie all diese Bekümmerungen, Selbstzweifel, Unauflöslichkeiten nicht überwinden kann, sondern zur Voraussetzung hat.
Aus der Erzählung „Alte Abdeckerei“ von Wolfgang Hilbig
(Lesung Autor, CD)
Ich möchte, dass so einer nicht vergessen wird. Und ich möchte nicht, dass man in dreißig Jahren – ähnlich wie bei Fühmann – kaum noch weiß, wer Wolfgang Hilbig war.
Ich möchte, dass unsere Erinnerungen eine Zukunft haben.
Tilo Köhler
Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
– Momente mit Wolfgang Hilbig. –
1. Die Abwesenheit
Unsere Begegnungen in den Endsiebzigern und Anfang achtziger Jahre – ich kannte schon seinen Namen, ehe wir uns das erste Mal sahen, von jenen Freunden, die aus M., einem ca. dreißig Kilometer entfernten Industriestädtchen, nach Leipzig gezogen waren, Lutz, Volker… Von ihnen hatte ich auch erfahren, daß er schrieb, und es war nichts ungewöhnliches für mich, daß es in der Öffentlichkeit von einem, der schrieb, nichts zu lesen gab – schrieben von uns doch fast alle. Zumindest jene von uns, die sich 1974 über einen vom Kulturbund im Club der Intelligenz in Leipzig installierten Schreibzirkel kennen gelernt hatten, aus dem sich dann ein eigenständiger und in Teilen noch heute existierender Freundeskreis herausschälen sollte. Wir machten ein paar Jahre mit im Zirkel, fuhren zu verschiedenen Bezirks-Poetenseminaren, profitierten von den besten Literaturwissenschaftlern, die dieses Land aufzubieten hatte und ab und an als Mentoren für die Werkstätten gewonnen werden konnten. Und einige von uns begannen das Schreiben mit einer Ernsthaftigkeit zu betreiben, die es nach und nach zur Hauptsache werden ließ. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich Wolfgang Hilbig das erste Mal vor dem Klubhaus Steinstraße begegnet bin, zu einer Zeit, da sein Debüt (abwesenheit) gerade erschienen war, bei S. Fischer, 1979. Wahrscheinlicher scheint mir, daß er schon zuvor gelegentlich in unserer Runde aufgetaucht ist, die sich seit Mitte der Siebziger ziemlich regelmäßig bei L. traf, weil er als einer der ersten von uns über eine eigene und dazu geräumige Wohnung verfügte, und auch so offen war, sich auf Bekannte wie Unbekannte einzulassen, was nicht Jedermanns Sache. Noch bevor der Gedichtband herausgekommen war, der von der Abwesenheit seiner Dichtung in dem Lande kündete, in dem er lebte, was ich anfangs aber unter diesem Aspekt noch gar nicht gesehen… Als Abwesende, Außenseiter oder Aussteiger wurden gern Personen aus Kreisen tituliert, in denen auch wir verkehrten, Personen, die sich nicht vereinnahmen ließen oder in irgendeiner Weise nicht subsummierbar waren, vom System.
Hilbig, der doch alle Kriterien aufzuweisen hatte, um als Erfolgsbeispiel eines Schreibenden Arbeiters gelten zu können, als Beispiel für die Sinnhaltigkeit jener von oben inszenierten breitenkulturellen Kampagne „Greif zur Feder Kumpel“, die man auf der Bitterfelder Konferenz 1959 beschlossen hatte, war von Verlagen, öffentlichen Einrichtungen und der Druckgenehmigungsbehörde offenbar ignoriert worden. Und man konnte nur Vermutungen anstellen, was sie an diesem Arbeiter und Dichter störte: Das Dunkle oder Abgründige, das sie zu erkennen glaubten und das tatsächlich gleich Einschlüssen in einem Gestein in seinen Texten opalisierte, etwas, das für sie nicht einzuordnen war, das sie verunsicherte und das sie also folgerichtig gewittert hatten (das Dunkle, das noch 1986 als Argument herhalten mußte, um eine meiner Lesungen in der Messestadt zu verbieten. Als handelte es sich dabei um einen Stoff der Gefahrenklasse III, einen Stoff, der doch schon längst in ihre Funktionärsleiber eingesickert war, wenn sie es nicht gar selbst verkörperten…). Und weil der Autor dieser Texte weit über das hinausgegangen, was man von einem Autor seiner Provenienz erwartete, er kein Realist in ihrem Sinne war. Bis in die 70er Jahre wirkte in Rudimenten eine Doktrin fort, die als Sozialistischer Realismus in die Geschichte eingegangen ist und zuvörderst Parteilichkeit einforderte, im Sinne der Sache… Vor allem in den Amtsstuben und Behörden verschiedenster Couleur, die noch von alten Kadern dominiert, ihrem proletarisch verbrämten Kulturbegriff.
Ich muß gestehen, so viele Gedanken habe ich mir damals nicht gemacht, es war eher meiner Sensibilität für Ungerechtigkeiten geschuldet, daß ich wahrnahm: hier ist einer beiseite geschoben, ignoriert worden, weil er nicht in die von Partei- und Staatsführung indizierte Wirklichkeitssicht passte und das, was er schrieb, einfach unannehmbar war, diese Vielzahl weißer oder dunkler Flecken, die in seinen Texten heraufbeschworen wurden, Flecken, die, wie sie meinen mochten, dieser jungen Republik nicht gut anstehen konnten. Also Aussteiger, Abwesende, obgleich es offensichtlich war, daß einer wie Hilbig, den wir wie selbstverständlich und sofort in unseren Kreis integrierten, zuvörderst anwesend war, in diesem Land, dieser Wirklichkeit, und Ausdruck dieser intensivierten Anwesenheit in der Wirklichkeit bildeten doch gerade seine Gedichte… Im Innersten war ich nicht einverstanden mit dem Buchtitel und hatte das wohl auch gelegentlich geäußert, sogar ein Antwortgedicht darauf verfaßt, das anhob: „ja, ich bin anwesend“… Ich verfiel erst nach wiederholtem Lesen darauf, daß der Titel womöglich die Abwesenheit eines ganz Anderen, einer anderen Dimension in dieser Wirklichkeit umriß oder bezeichnete. Wahrscheinlich war ich eine der wenigen, die einerseits von den Gedichten gefangen genommen wurden, die ich zum Teil mit der Hand abschrieb (weil ich keines der raren Freiexemplare abbekommen, die er in M. und L. unter seinen Freunden verteilt hatte), und sich zugleich an diesem Titel rieb, der geeignet schien, den Autor zu denunzieren, seine Wahrnehmungsintensität und Verbindlichkeit ad absurdum zu führen. Der es ihnen, so meinte ich, leicht machte… Das war doch der Vorwurf, den die unangepaßten Paßgänger und Gratwanderer hierzulande immer wieder zu hören bekamen: daß sie nicht angekommen, in der Gesellschaft, der Verbindlichkeit von Tatsachen…
Dabei erschien mir unausweichlich, was von ihm zu lesen war:
ihr habt mir ein haus gebaut
laßt mich ein anderes anfangen…
Ein Gedicht, das 1965 entstanden war und uns in unserem Lebensgefühl traf – wir versuchten in unserem Kreise doch nichts anderes… Hier hatte einer zehn, zwölf Jahre vor uns im Stillen, abseits der Öffentlichkeit vorformuliert, was uns umtrieb, beunruhigte, was wir zu beanspruchen gedachten: nichts weniger als auszubrechen aus den uns zugedachten Strukturen, aus dem Rahmen zu fallen, dem vorgefertigten – und hatte diese Zeilen verfaßt als einer, der dennoch im Lande blieb. Möglicherweise ist er es gewesen, er vor allem, der uns von unseren Nirvana- und Beatnik-Trips Ende der siebziger Jahre, Schopenhauer, Stirner… in die Schichtungen der Gegenwart, die Gegenwart von Tagebaurevieren, Kellern, aufgelassenen Flächen, Fabrikhallen… zurückgebracht hat. In eine Gegenwart, aus deren Nährböden, der Mitgift, er das Wesentliche bezog, das, was seine Existenz bestimmte, aus den Nährböden, Nährlösungen, unverhohlen unterwegs im Tagebruch… Während wir noch darüber spekuliert hatten, ob es nicht eher von Nachteil, ortbar zu sein, in dieser Zeit, wir uns an Vorbildern aus Bauernkrieg oder Vormärz orientierten, an Gestalten, die sich mittels wechselnder Identitäten dem drohenden Zugriff der Häscher zu entziehen gewußt… Was nicht Hilbigs Sache war, auch wenn er, vor allem in den Geschichten und kurzen Erzählungen, die ich in jenen Jahren kennenlernte, zuweilen spielerisch mit dem eigenen literarischen Ich umzugehen pflegte, mit einem Ich, das doch unverkennbar das seine war… Hatte uns herausgerissen aus dem Nichts mittels seiner Texte, die schwer von dieser rauchhaltigen Luft, dem Gas und der Geschichte von Ablagerungen. Etwas, das doch allerorten wahrzunehmen war.
Das Gros seiner Gedichte bis zu diesem Zeitpunkt ist ab Mitte der 60er entstanden, die von schärfsten kulturpolitischen Auseinandersetzungen geprägt waren, vor und nach jenem berüchtigten 11. Plenum im Dezember 1965, das für nicht wenige Autorinnen und Autoren zum Verhängnis werden sollte. Obwohl Hilbig, oder Kaschy, wie die Meuselwitzer und auch wir ihn schon nach kurzer Zeit nannten (Kaschy, die Koseform des großväterlichen Namens, der aus Polen stammte), eine ganze Generation älter war als wir, ein Kriegskind, war dieser Altersunterschied kaum zu spüren. Auch uns war die Schwarzschrift der Ruinen vertraut, und die weiße, die in Gestalt eines elterlichen Schweigens, in Gestalt der Aussparungen in Häuserzeilen, Lebensläufen, auf Personalbögen… Und im Gegensatz dazu das militaristische und nazistisch verbrämte Vokabular, das nach wie vor im Schwange, „auf breiter Front, an vorderster Linie“… Jene Entsatzarmee von Worten, hierarchisch geordnet, die den Rückzug aus der Wirklichkeit forcierten… Ich vermag mich nicht zu erinnern, daß er je sein Alter, seinen Erfahrungsvorsprung in einem der Gespräche, die wir führten, in den Vordergrund gespielt hätte. Mein Erstaunen hingegen, an das ich mich zu erinnern vermag, als die Gedichte dann erschienen waren, daß deren Entstehungszeitraum weit vor dem Beginn des eigenen Schreibens gelagert: dies war etwas, das mich verwirrte, irritierte, oder eher mein Gefühl von Zeitgenossenschaft, das doch das dominierende gewesen.
Es war nicht seine Art, jedenfalls nicht, bevor wir uns näher gekommen, viel von sich zu erzählen, zumal in größerer Runde. Gelegentlich hatte er einige seiner Gedichte und kurzen Prosastücke vorgetragen und erklärt, wie er beispielsweise zu einem Text wie „war das gedicht der rabe von e.a. poe notwendig“ gekommen. In unserem Kreis zunächst, und später auch im Jugendklubhaus Steinstraße 18, dessen Leitung eine engagierte junge Kulturwissenschaftlerin, Brigitte Schreier, übernommen hatte, die nicht den einschlägigen Vorgaben der Kulturbehörden zu folgen gewillt war. In einer Zeit, Ende der 70er Jahre, da sich in der DDR nach einer Phase der Erstarrung im Zusammenhang mit der Ausweisung Biermanns neuerdings so etwas wie eine alternative Szene herauszubilden, zu regen begann, die sich gleichermaßen sowohl politisch als auch kulturell artikulierte. Eine Szene, die sich Freiräume auch in öffentlichen Einrichtungen (z.B. Klubhäusern) zu erobern verstand, nicht zuletzt, weil sie sich nach und nach der Ängste vor Observation und Schikanen entledigt hatte. Und diese Szene, bestehend aus alternierenden und lose miteinander verbundenen Gruppierungen, von denen im Lande unzählige existieren mussten, in denen der Drang, aus dem Vorgegebenen auszubrechen, ebenso bestimmend wie der unsägliche Durst, der mit Alkohol kaum zu löschen war, konnte sich durchaus mit Subkulturen vergleichen, wie sie sich seit den Endsechzigern in der BRD konstituiert hatten.
2. Eine Übertragung
Im Frühjahr 1978 hatten wir erfahren, Hilbig sei inhaftiert worden. Der Grund sollte sich erst allmählich herauskristallisieren, zunächst hatte es geheißen, er habe mit einem Freund eine Fahne heruntergerissen, im Suff, eine Fahne, was nur bedeuten konnte: eine der Flaggen mit dem Emblem der Republik, die an Feiertagen auf dem Platz vor dem Stadthaus aufgezogen wurden. Dies konnte in unseren Augen nur ein Gerücht sein oder mochte als Vorwand gelten, weil es für uns kaum vorstellbar war, daß Kaschy zu einer solchen Dummheit fähig. Letztendlich war dann zu hören, daß man gegen ihn wegen vermeintlichen Devisenvergehens ermittelt hätte, obgleich sein Buch noch nicht einmal erschienen war. Man hat ihn nach mehreren Wochen U-Haft wieder entlassen müssen. Von unserem Kreis konnten nur S., einer seiner engsten Freunde in M., und ich ermessen, was es hieß zu sitzen… Eine nicht abschätzbare Anzahl von Tagen im irdenen Mörser der Haftanstalten, Tage, die man mit den Fingerknöcheln zerstoßen, des nachts, im Klopfzeichen-Alphabet jener, denen das Sprechen versagt war.
Wenig später zog Hilbig nach Berlin, wo ich ihn einige Male besuchte, zuerst in Köpenick, später in seiner Lichtenberger Behausung. Hatte ihn gelegentlich von der Arbeit abgeholt, in einer der Filialen jener volkseigenen Großstadtwäscherei namens „Rewatex“, vielleicht drei Straßen von der Köpenicker Wohnung entfernt gelegen, wo er als Heizer beschäftigt war. Er hatte in einem zum Teil verglasten Kabuff seinen Dienst verrichtet, der Schaltwarte, angefüllt mit einem blaßgelben Licht, das wirkte, als spähte man durch ein Glas Helles in den Raum, in dem er vor einem Pult mit verschiedenen Knöpfen und Armaturen saß, die Temperatur, Wasser- oder Dampfdruck anzeigen mochten… Davor der Tisch, an dem er Pause machte, Wachstuchdecke, in der Ecke ein Kofferfernseher, schwarz-weiß, der stets eingeschaltet war. Nein, er musste keine Kohlen mehr schaufeln oder mittels Kipploren zu den Kesseln bewegen, wie noch in der Maschinenfabrik in M., wie es in der kleinen Erzählung „Der Heizer“ beschrieben ist. Der Dampf wurde von einem der Kraftwerke an der Peripherie erzeugt, erreichte als Fernwärme die Wäscherei. Es gab kaum mehr zu tun, als in Abständen zu prüfen, ob Temperatur, Druck, Wasserstand den Erwartungen entsprachen. Alles war angegilbt in diesem Raum, vom Zigarettenrauch, die Wände, der Vorhang – was mir den Eindruck vermittelte, in einem der trostlosen Reichsbahnabteile zu sitzen, in denen man sich letztendlich verloren fühlen mußte, eingeschlossen…
Nach und nach wurde mir klar, dass es eigentlich die Straßen, Spreeüberbrückungen und schmalen Durchgänge von Köpenick sind, die den örtlichen Bezugsrahmen seines Romans Eine Übertragung bilden, wie überhaupt seine persönlichen Erfahrungen nur leicht verfremdet in die Gestalt des C. Eingang gefunden haben: Die Erfahrungen von Haft und das Ankommen im Unbekannten, in Berlin, der Teilhauptstadt. Und ich erkannte im Nachhinein so manches wieder, was ich selbst, wenn ich bei ihm in Köpenick zu Besuch war, wahrgenommen hatte von diesem Viertel, es erscheint stimmig, bis in die F.-straße und die Parterrewohnung hinein, in der er mit der Freundin und dem gemeinsamen Kind lebte. Dieser Roman, der im Frühherbst 1989 erschienen war, zum Ende der Republik, erscheint mir im Übrigen als eines der besten und zugleich rätselhaftesten Prosastücke Hilbigs. Rätselhaft wie jener Kassiber, den C. von einem Mithäftling ausgehändigt bekommen und der vom Verschwinden einer Person kündete, die nicht weniger rätselhaft…
Jayne-Ann Igel, aus Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerung an Wolfgang Hilbig, Verlag Das Wunderhorn, 2008
Er kämpfte hart um seine Texte
– Gespräch mit Volker Hanisch. Volker Hanisch, geboren in Altenburg und aufgewachsen in Meuselwitz, ist Lektor. Er lebt und arbeitet in Leipzig. –
Karen Lohse: Wie haben Sie Wolfgang Hilbig kennengelernt?
Volker Hanisch: Ich bin Mitte der 70er Jahre in Meuselwitz auf ihn aufmerksam geworden: Unter den vielen, die am Wochenende im Stadthaus, der Tanzdiele des Ortes, vor ihrem Bierglas saßen, war da einer, von dem mir mein Bruder erzählt hatte, er schriebe seit Jahren Gedichte. Das gemeinsame Interesse an Literatur führte uns zusammen. Ähnliche Kindheitsbezüge – auch wenn „Kaschi“, wie ihn alle nannten, etliche Jahre älter war – kamen später, wenn wir uns außerhalb von Meuselwitz trafen, als verbindendes Element hinzu.
Lohse: Seit Ende der 70er Jahre gab es in Leipzig eine sehr rege inoffizielle Kulturszene mit verschiedenen Künstlergruppen, in denen Sie und Hilbig sich bewegten. Wie ist man damals mit dem Wissen umgegangen, dass die Stasi möglicherweise jede Veranstaltung infiltriert hatte?
Hanisch: Das war von Gruppe zu Gruppe und je nach persönlichen Erfahrungen sicher unterschiedlich. Der Kreis jedenfalls, der sich in der Wohnung von Lutz Nitzsche-Kornel traf und zu dem auch ich gehörte, sah das eher locker. Wir versuchten, sowohl die Stasi als auch den Staat an sich nicht allzu ernst zu nehmen. Der künstlerische Ausdruck, den wir dafür gefunden hatten, war eine Art Spaßgegenkultur mit Feten, Musik, experimentellem Theater usw. Nach Möglichkeit verbanden wir Lesungen, Vorträge und Diskussionsrunden aber auch mit dem halboffiziellen Klubhaus- und Universitätsleben.
Lohse: Sie kannten Hilbig über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren. Sie lernten ihn kennen, als er noch ein Arbeiter war, der schrieb und nicht veröffentlichen konnte. Dann die erste große Zäsur seines Lebens: die Publikation von abwesenheit, und schließlich trafen Sie ihn nach der Wende als im Literaturbetrieb fest etablierten Autor wieder. Was war er für ein Mensch? Hatte er sich in dieser langen Zeit verändert?
Hanisch: In seinem Charakter habe ich ihn als relativ konstant in Erinnerung. Natürlich ist der Publikationserfolg an ihm nicht spurlos vorbeigegangen, aber sein Wesen hat er nicht berührt. Ich glaube, er lebte sehr aus seiner Innenwelt. Er war ein stiller Mensch, dem man seine Herkunft aus der Arbeiterklasse sofort ansah, ebenso seine Skepsis gegenüber allem Intellektuellen und gegenüber pseudointellektuellem Gequatsche. Einmal habe ich ihn zornig erlebt: Es ging in einer Diskussion um die Unterschiede zwischen einem Arbeiter, der schreibt, und einem Akademiker, der über Literatur schreibt. Ich glaube, er fühlte sich in seinem Schreiben abgewertet und ertrug das nur schlecht. Dafür hatte er als Autodidakt zu hart um jeden seiner Texte gekämpft.
Lohse: Was an Hilbig immer wieder fasziniert, ist die unglaubliche Energie, mit der er sich nach acht Stunden voll harter körperlicher Arbeit noch an seine Texte setzt.
Hanisch: Neben diesem Innere-Natur-Umstand, dass er ohnehin irgendwie schreiben musste, denke ich, war sein Schreiben auch ein Anschreiben gegen einen grauen, entfremdeten Arbeitsalltag, ein kleinstädtisches, literaturfeindliches Dasein, das er dadurch versuchte zu bewältigen. Vieles in seinen Texten sollte man metaphorisch sehen. Wie bei Edgar Allan Poe oder E.T.A. Hoffmann bildet die Realität sozusagen die Kulisse, in die das Fantastische eingebunden ist. Die Fantasie war die treibende Kraft in seinem Leben und seine Überlebensstrategie. Das begann schon recht früh, als Hilbig in seiner Schulzeit Wildwestgeschichten schrieb.
Lohse: Ein ambivalentes Verhalten: Einerseits die gedankliche Flucht in die Fantasie. Andererseits hätte er sich die Welt anschauen können, nachdem er im Westen war. Er verreiste jedoch so gut wie nie und wenn, dann meist nur in eine Richtung: gen Osten, in seine Heimat.
Hanisch: Ja, er hing trotz allem noch sehr an Meuselwitz, wo seine Mutter wohnte und noch wohnt. Ich erinnere mich gut an eine Begegnung, die ich mit ihm im Dezember 1985 hatte: Ich traf ihn im Bus nach Meuselwitz. Wir unterhielten uns und er erzählte mir, wie er für seine Wohnung in Hanau eine Brikettzange gekauft hatte. Hilbig war durch ein westdeutsches Kaufhaus geirrt, und nach langem Suchen entschied er sich für eine Kohlenzange aus dem untersten Regal: unscheinbar, preiswert und mit dem Stempelaufdruck „Made in GDR“. Am Schluss der Geschichte sah er mich mit einem merkwürdig verlorenen Lächeln an.
Lohse: Dann war ihm die Arbeitswelt in der DDR mehr als nur das Sujet seiner Texte?
Hanisch: Einerseits hasste er sie, andererseits hatte sie eine stabilisierende Funktion für sein Leben. Die Arbeit band ihn, wenn auch widerwärtig, in diese diese Gesellschaft ein. Ab dem Zeitpunkt, als er nur noch schrieb, litt Hilbig beständig unter der Angst, nicht mehr schreiben zu können. Er fing an, die Abgabetermine für seine Bücher zu überziehen, manchmal um einen Zeitraum von ein oder zwei Jahren.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
Der Westen wurde immer mehr zum Fixpunkt
– Gespräch mit Silvia Morawetz. Silvia Morawetz ist promovierte Anglistin und arbeitet als Übersetzerin anglo-amerikanischer Literatur. Sie lebte von 1982 bis 1985 mit Wolfgang Hilbig zusammen. –
Karen Lohse: Frau Morawetz, Sie haben die Schwierigkeiten, die der Publikation von stimme stimme vorausgingen miterlebt. Was war das für eine Atmosphäre?
Silvia Morawetz: Es war zähes, viele Monate dauerndes Hin und Her, bis es schließlich zu der Veröffentlichung kam. Vom ersten Auftauchen der an Hilbig herangetragenen Idee, bei Reclam einen Gedichtband zu machen, bis zur Publikation verging über ein Jahr, und es bedurfte des Engagements vieler, bis das Vorhaben tatsächlich verwirklicht war. Franz Fühmann hatte ja 1930 mit seinem „Ecce Poeta“ einen sehr kraftvollen Anstoß gegeben, der immer noch uneingelöst war und nachwirkte. Die eigentliche verlegerisch-betreuende Arbeit lag in den Händen von Hilbigs Lektor Hubert Witt, dem zusätzlich zur Arbeit am Manuskript auch die undankbare Aufgabe zufiel, Hilbig über den jeweiligen Stand des für durchsetzbar Gehaltenen informieren zu müssen. Schließlich wurde er noch zu einem alles entscheidenden Gespräch in die Wohnung von Hans Marquardt, dem Leiter von Reclam Leipzig, gebeten. Das war überraschend und ein bisschen beklemmend. Wir hatten bisher nicht gehört, dass ein DDR-Verleger ein Mitglied aus der subkulturellen Szene zu sich nach Hause einlud, noch dazu wenn derjenige aus dem tiefsten Bauch der Arbeiterklasse kam. Ich habe ihn damals begleitet und kann mich noch sehr gut an den Besuch erinnern: Marquardt auf der einen Seite, aus unserer proletarischen Perspektive mit großbürgerlichen Habitus. Ein rede- und weltgewandter Intellektueller. Sah man ihn mit seinem wehenden schwarzen Mantel und seinem weißen Schal auf der Straße, musste man unwillkürlich an einen Theaterdirektor denken. Auf der anderen Seite Wolfgang Hilbig, der aus einem ganz anderen Milieu kam.
Die Entfernung zwischen den beiden war sehr groß. Umso peinlicher wirkte es dann, als Marquardt quasi schulterklopfend mit Wolfgang von Literat zu Literat sprechen wollte. Dem Ganzen haftete etwas Paternalistisches an. Wolfgang hatte überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit diesen Kreisen, kannte die dort üblichen Verhaltensweisen nicht und war dementsprechend unsicher und gehemmt. Das machte es für alle Beteiligten sehr anstrengend.
Lohse: Was wollte Hans Marquardt mit diesem Gespräch erreichen?
Morawetz: Ich denke, er wollte Wolfgang mit dieser Publikation besänftigen. Nach dem Motto:
Wir haben dir jetzt ein Buch erlaubt, dafür fügst du dich künftig bei uns ein.
Wolfgang war allerdings nicht bereit, sich vereinnahmen zu lassen. Er dachte nicht mal in dieser Kategorie.
Lohse: War für Hilbig damals die Stasi ein Thema, fühlte er sich durch sie bedroht?
Morawetz: Ja, natürlich. Das war Thema vieler Gespräche, bei allen möglichen Begebenheiten, mit den verschiedensten Bekannten und Freunden, zuhause und wenn wir unterwegs waren. Mit Gert Neumann und Heidemarie Härtl haben wir häufig darüber gesprochen. Einmal gingen wir zum Beispiel zur Buchmesse und wollten uns mit Thomas Beckermann treffen, Wolfgangs Lektor aus dem S. Fischer Verlag. Wir waren gerade auf dem Weg dahin, da kamen auf der Straße zwei Polizisten auf uns zu und wollten unsere Ausweise kontrollieren, aus heiterem Himmel, ohne Anlass. Oder wir waren mit Karl Corino in der Milchbar im Seminargebäude verabredet, damals ein Treffpunkt für viele Autoren und Journalisten. Es saßen auch viele von der Stasi dort, wie man später, zum Teil aus den Akten, erfuhr.
Lohse: Er war in Leipzig wegen seiner Westveröffentlichung schon beinah eine Legende. Wie hat das auf ihn gewirkt?
Morawetz: Er hatte diesen Legendenstatus nicht nur wegen seiner im Westen publizierten Bücher, sondern auch, weil viele sahen, wie außergewöhnlich, wie neu und gut seine Texte waren. Er war bestimmt so etwas wie ein Vorbild für viele Kollegen, sowohl in Leipzig als auch in Berlin, gerade für die jüngeren unter ihnen. Wie eine „Legende“ behandelte ihn aber niemand. Das wäre ihm auch furchtbar unangenehm gewesen. Er selbst hat mit jedem von ,Kollege zu Kollege‘ gesprochen, nie von oben herab.
Lohse: Als 1983 der Brüder-Grimm-Preis an ihn verliehen wurde: Welche Bedeutung hatte er für Hilbig? War er sehr stolz?
Morawetz: Er war schon stolz und es war auch eine gewisse Genugtuung dabei. Aber dem Procedere der Preisverleihung sah er mit unguten Gefühlen entgegen: Er musste öffentlich sprechen, eine Rede halten. Das war ein grausiger Gedanke für ihn. Der Preis bedeutete für ihn nicht nur Anerkennung seiner Arbeit und finanzielle Hilfe, sondern bot auch einen gewissen Schutz. Je stärker ein ostdeutscher Schriftsteller in Westdeutschland wahrgenommen wurde, desto besser war er vor eventuellen Übergriffen in der DDR geschützt.
Lohse: Wie haben Sie ihn erlebt, was war er für ein Mensch?
Morawetz: Als Mensch war er so widersprüchlich wie vielschichtig, wie ein Schriftsteller nur sein kann, für den alles seinem Schreiben nachgeordnet ist. Als er in meine kleine Wohnung einzog, mussten wir schauen, wie wir den vorhandenen Platz so aufteilten, dass wir dort beide arbeiten konnten. Das war nicht immer einfach, weil wir verschiedenen Rhythmen und äußeren Anforderungen unterworfen waren und nicht zuletzt, weil Wolfgang Alkoholiker war.
Lohse: Auch schon zu dieser Zeit?
Morawetz: Ja.
Lohse: Eher latent?
Morawetz: Nein. Ich kannte mich mit so etwas gar nicht aus und wusste anfangs nichts über Alkoholismus, über seine Symptome, die möglichen Auswirkungen auf die Persönlichkeit, auf den ganzen Alltag.
Sonst war Wolfgang eher ein ruhiger und besonnener Mensch. Bei Gesprächen mit ihm war es häufig so, als erlebe man das, was Kleist „Die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ nannte, in einer extremen Form. Er hat immer lange nach dem richtigen Wort, nach dem richtigen Ausdruck für das gesucht, was er sagen wollte, im Prinzip so, wie er es beim Schreiben auch tat. Dort ergab das verschiedene Fassungen nacheinander, so lange, bis er das richtige Wort hatte. Im Gespräch ging das so nicht, da brach er oft mittendrin ab und setzte neu an, wenn er sich korrigieren wollte. In den Interviews, die es mit ihm gibt, kann man das gut verfolgen, die stockende Suche nach dem richtigen Wort.
Lohse: Was für ein Leben hat er geführt?
Morawetz: Ein doch eher unstetes und ruheloses. Er war viel unterwegs, ist nicht nur zwischen Meuselwitz und Leipzig hin- und hergereist, sondern auch oft nach Berlin zu seiner Tochter gefahren. Manchmal kamen Mutter und Tochter auch nach Meuselwitz und Wolfgang fuhr von Leipzig aus dahin.
Lohse: Wolfgang Hilbig ist 1985 mit einem für ein Jahr gültigen Visum nach Westdeutschland gereist. Er ließ das Visum auslaufen und kehrte nicht zurück. Welche Reaktionen gab es darauf in Leipzig?
Morawetz: Es wurde natürlich darüber gesprochen, und die Meinungen dazu waren geteilt. Im Freundeskreis dachten wir damals, dass es für weitere Veröffentlichungen in der DDR das Aus bedeuten würde. Seine persönliche Entscheidung wurde sicher von den meisten als das akzeptiert, was sie war: eine persönliche Entscheidung, die mancher mit Bedauern, mancher auch nur überrascht zur Kenntnis genommen haben mag. Mitte der 8oer Jahre wurden die Reisen in den Westen als Thema immer wichtiger.
Lohse: Welchen Stellenwert hatte das Thema „Ausreise“ in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis?
Morawetz: Es war ein immer gegenwärtiges Thema, das den Freundes- und Bekanntenkreis aber auch strapazierte. Viele kannten inzwischen jemanden, der ausgereist war oder eine Ausreise erwog, oder trugen sich selbst mit dem Gedanken. Andere wiederum lehnten die Ausreise ab, wohl weil sie sie als verfrühtes Aufgeben verstanden. Von der Biermann-Ausbürgerung bis zum Ende der DDR war das eine Entwicklung, die immer weitere Kreise erfasste und mit der sich nicht nur Schriftsteller beschäftigten. Durch die Reiseerleichterungen, die im Laufe der Zeit gewährt wurden, hielt der Westen Einzug in die einzelnen Wohnungen und Familien.
Lohse: Also war der Westen schon lange vor der Wende im Osten anwesend?
Morawetz: Ja, so ungefähr. Überall wo man hinkam, hörte man, wer schon mal im Westen war, wer noch wollte und wer nicht durfte. Der Westen wurde zum Fixpunkt, rückte näher und näher.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
Siegmar Faust: Diesem Land zu spät entwichen. Über Wolfgang Hilbig, Merkur, Heft 702, November 2007
„ich schreibe. Wolfgang Hilbig und die Kulturpolitik der DDR“. Thorsten Ahrend im Gespräch mit Bernd-Lutz Lange und Karim Saab im Zeitgenössischen Forum Leipzig am 9. Juli 2021.
Karl Corino im Gespräch mit Wolfgang Hilbig „Jeder Text müßte erscheinen können“ am 15.10.1984 in Frankfurt am Main.
Interview mit Georg Katzer über Wolfgang Hilbig
DER SCHACHT/VEREINIGUNG
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafür W. Hilbig
Du kannst mir die Zeilen erpressen,
vom Mund weg den Dampf noch formen,
was mir sonst nicht bleibt, auf Fahrt,
auf Einfahrt in drängender Not.
Mein Bruder, ich höre uns beten,
mein Freund, ich seh die Umarmung
im Spiegel, die drehende Lagerstatt,
wo statt in ein Leben durch Ruß,
durch bleierne Senken und Rippen
wir stoßen. Verflucht dieses Netzen,
daraus wir geboren, darein wir ziehn!
Und zögen an Strängen? Wir nicht.
Der Aufstand kopfunter, das täglich
gebrochnere Brot: soviel Oberfläche.
Du wirst mich verfluchen, wo nicht,
gerinnen wir in einen einzigen Stein.
Uwe Kolbe
JASMINGESCHICHTEN
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafür Hilbig
Wir suchten ihn das Zimmer war leer
Die vielen Wässerchen bis tief in die Nacht
Birne Mirabelle Quitte
Er saß auf dem Kaiserstuhl
Mit baumelnden Beinen intim
Unter den Geistern. Zum letztenmal
Sahen wir ihn in der Bahnhofshalle
Vor einem großen Glas
Er wunderte sich über
Die vielen Matrosen so weit im Süden
Der Republik.
Rolf Haufs
STIMME STIMME
(für wolfgang hilbig)
Die zuckstaffel zu beiden seiten der
aaaaaaaaaaaaaaaaume
aaaaaaaaaaruhig bist du hinzu
aaaaaaaaaagetreten mit deinem
aaaaaaaaaaschlimmzettel
aaaaaaaaaaund ahst ihn quer
aaaaaaaaaaüber den schlitz
aaaaaaaaaagelegt
aaaaaaaaaaso fanden die ränder
aaaaaaaaaaes vergingen keine
aaaaaaaaaawieder still
aaaaaaaaaazueinander
Thomas Kunst
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan.
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Katrin und Volker Hanisch: Gespräch über Wolfgang Hilbig
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, 3.8.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Interview + KLG + IMDb +
YouTube + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die WindeDie Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003



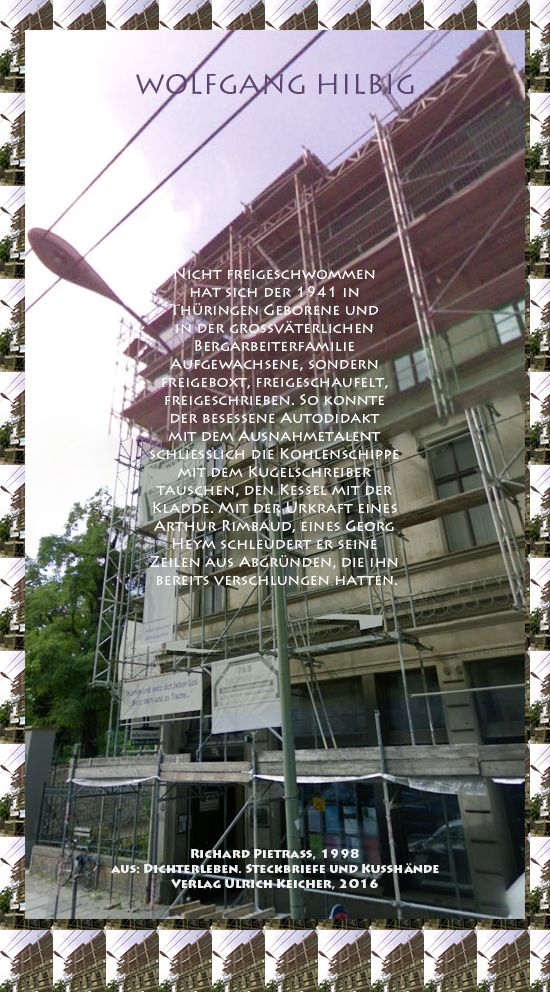












Schreibe einen Kommentar