Wolfgang Hilbig: zwischen den paradiesen
APRIL OHNE DATUM
draußen glänzt regen
in einer iris aus chlorophyll: die welt
in einem riesigen zyklopenauge
regnet hellen und gleichmaße
und begehren ist gestrichen aus dem licht
das nichts mehr spiegelt
draußen wäscht regen
die matten gemäuer der zeit
die noch stehn als wäre
zu leugnen daß ich sichtbar werde
doch wieviel sonne muß regnen durch mich
um in der unform aus tod
das leben zu erleuchten.
draußen fällt regen draußen fällt licht −
Wolfgang Hilbig (geb. 1941) ist ein Dichter,
der „mit der Wucht der Elemente wie mit der von Haar und Traum umgeht und die Würde der Gattung Mensch auch in der Latrinenlandschaft bewahrt; ein großes Kind, das mit Meeren spielt, ein trunkener, der Arm in Arm mit Rimbaud und Novalis aus dem Kesselhaus durch die Tagbauwüste in ein Auenholz zieht, dort Gedichte zu träumen, darin Traum und Alltag im Vers sich vereinen“ (Franz Fühmann).
Die Texte von Wolfgang Hilbig sind verzweifelt-kraftvolle Versuche, sich einer Realität zu versichern, die als Hölle erfahren wird; Wahn und Wirklichkeit, Traum und Träume fließen auf atemberaubende Weise ineinander. „Falls es Hilbig überhaupt um eine ,Botschaft‘ ginge, dann hieße sie hier grob und einfach: Lassen Sie, meine Damen und Herren, alle Hoffnung fahren!“, schreibt Adolf Endler über den Schriftstellerkollegen und zitiert ihn selbst: „es ist nicht wahrheit zu scheiden / aus den rätseln es fängt aber / das rätsel selber zu singen an… – Der Kenntnis dieses Rätsels ein wenig näherzukommen, wenn auch nicht der Lösung hilft das hier vorgelegte Buch.“
Reclam-Verlag Leipzig, Klappentext, 1992
„sprachgeflacker in den schläfen der selbstsucht“
Ein knappes Jahrzehnt ist es her, da erschien mit fast gleichem Untertitel (stimme stimme. Gedichte und Prosa, Reclam Leipzig 1983) die erste und einzige Buchveröffentlichung von Wolfgang Hilbig im östlichen Teil Deutschlands, ein schmales Bändchen, vom namenlosen Herausgeber streng selektiert. Die Vorgeschichte – erinnert man sich noch dieser absonderlichen Angst vor dem Wort in diesem seltsamen Land DDR? – war die „übliche“; erst nach Jahren konnte der Band erscheinen: „Es war eine merkwürdig gespaltene Situation: die Produkte meines Kopfes waren im Westen und ich war hier. Das war zum Teil zwar witzig, aber doch kein Zustand, der auf die Dauer auszuhalten war.“ Nach Erhalt eines Jahresstipendiums des Deutschen Literaturfonds vollzog Hilbig 1985 den „Wechsel des Wohnsitzes, mit allen irritierenden Konsequenzen“, er ist wohl einer der faszinierendsten literarischen Entdeckungen des letzten Jahrzehntes.
Nun ist verlegerischer Mut ganz anderer Art vonnöten, sich auf solche Literatur einzulassen. Reclam Leipzig hatte ihn – und praktizierte nebenbei und auf produktive Weise „Geschichtsbewältigung“ im eigenen Hause. Das Ergebnis ist ein fulminanter Band, der sich sehen lassen kann. Versammelt sind Arbeiten aus drei Jahrzehnten: Gedichte, Kurzprosa und Erzählungen, Vorträge und essayistische Annäherungen – Ausgewähltes und Unveröffentlichtes, verstreut oder an entlegenem Ort Ediertes. Der vorliegenden Auswahl ist zu bescheinigen, daß sie verschiedene Leserinteressen bedienen kann: als erste Begegnung zeichnet der Band ein relativ komplexes Bild von seinem Autor – man weiß nun, worauf man sich einläßt, folgt man den Texten Wolfgang Hilbigs. Der eingeweihte Leser, man könnte in diesem Falle wohl auch vom Wiederholungstäter sprechen, wird Neuentdeckungen machen, auch erschließt sich Bekanntes im neuen Kontext auf einmal anders. Erstveröffentlichungen geben einer Auswahl stets etwas besonderes, der vorliegende Band offenbart diese – in einer bescheidenen editorischen Anmerkung – erst auf den zweiten Blick.
Die Erzählung „Er, nicht ich“ (1981/1991) sei daher besonders hervorgehoben, der mit sechzig Seiten umfangreichste Text ist durch und durch „ein Hilbig“. Die nüchterne Beschreibung eines gewöhnlichen Vorganges reißt sofort andere, metaphorische Ebenen an sich, Alltäglich-Banales wird zu kaum Bewältigbarem, das Schreckliche ist das Herkömmliche; der Menschenhandel der „Verwaltung“ etwa entbehrt durchaus der Originalität, das hatten wir bereits in der deutschen Geschichte: „Auf nach Amerika!“
Das Grauenhafte unserer Existenz aber ist nicht mehr als wütender Aufschrei zu fassen, es ist schon so verkommen-banal, daß es niemand wahrhaben wird: „es ist die Tortour um ihrer selbst willen.“ Die dem „dritten Grad“ entkommen sind, führen eine Existenz, die allein dem Augenblick verhaftet ist: ein Leben, das nicht mehr dem Entwurf, sondern nur noch dem Moment dient, ein Vegetieren eher, abgründig auf sich geworfen – und doch sind sie die einzig Sehenden, das Entsetzen hat sie zu Wissenden gemacht. Allein es bleibt ungewiß, ob der Erzähler, der doch als einer der ihren erkannt ist, noch über die Kraft für eine Geste der kreatürlichen Brüderlichkeit verfügt.
Immer wieder raunen die Hilbigschen Texte von den Verschwundenen, in abwesenheit vorhanden, zur Legende geworden und geleugnet. Die „Möglichkeiten, sich zurechtzufinden, ohne eine Weltidee“ sind spärlich, „der bloße Gebrauch es Wörtchens ich“ ist bereits subversiv. Die Chimären der Imagination erweisen sich als übermächtig; sie insistieren auf Autonomie und brauchen den Gebärenden nicht mehr.
„Er nicht ich“ lag ein Jahrzehnt in den Schubladen Wolfgang Hilbigs (dies ist fast wörtlich zu nehmen) – doch anders als die meisten der Texte, die jetzt hier und da aus den Versenkungen der Selbstzensur auftauchen, scheint diese Arbeit an Tiefendimension eher gewonnen zu haben; der Enkel des Josef K. und des Mannes vom Lande hat einen (selbst)mörderischen Weg gefunden, vor das Gesetz zu gelangen: „Nur aus alter Gewohnheit (aus längst erschöpfter Gewohnheit) darf man an einen Prozeß glauben, in dem eine unschuldige Person schuldig wird und so zu ihrer Existenz gelangt.“ „Ich rieche, rieche Menschenfleisch“, wissen die Märchen.
„Wir und nicht sie“, wollte einst Volker Braun das deutsche Dilemma, in Umkehrung der Klopstockschen Revolutionsode, vergessen machen; Hilbigs rigoroser Individualismus wurde solcherart Epochedenken gar nicht erst teilhaftig: „sagtet ihr man soll allein gehen / würde ich gehen / mit euch“, heißt es schon in einem Gedicht von 1965. Hilbig war da vierundzwanzig.
Das Phänomen Wolfgang Hilbig: bescheidener Schulabschluß, Hilfsschlosser, Abräumer, Heizer…; schmeckt das Wort Naturtalent nicht so himmelblau, wäre es hier wohl angebracht. Hilbig, lakonisch: „Jeder Schriftsteller, der sich eigentlich ernst meint, ist Autodidakt.“ Man sollte sie einmal auf der Zunge fühlen, diese klebrige Luft des Leipziger Südens, die trüb beleuchteten, mit aschenem Staub bedeckten Straßen dieser trostlosen Kleinstädte durchwandern, diese Nester, die dem Abraum weichen mußten oder als Marginalie einer gewesenen Landschaft vor sich hin verfallen, jäh aus ihrem Dorfsein gerissen:
furchtbare unglücke
katastrophen im tertiär preßten
das meer in die kohle in sachsen
Der Autofahrer schließt die Fenster, gerät er auf der Fahrt nach Chemnitz oder Gera durch diese Gegend; zuweilen ist es nötig, die Scheinwerfer einzuschalten, auch am Tage.
„Wie kommt man in Meuselwitz dazu solche Texte zu schreiben“, wunderte sich ein Leipziger Literaturprofessor. Des Wunderns gibt Hilbig wahrlich Anlaß, wenn auch ganz anderer Art: daß sein Schreiben überhaupt gedieh und nicht verröchelte, versiegte, verendete;
im namen welcher unerlaubten
schmerzen
die verwirrung
das schreiende amt
übernommen
(1967). Und dies in einer Sprache, die alles Provinzielle weit hinter sich läßt: die Ängste des Hades sind nicht lokalisierbar.
In letzter Zeit verlangte – zu Recht – vor allem der Prosaautor Aufmerksamkeit, die treffliche Zusammenstellung scheint geeignet, auch dem Lyriker wieder den gebührenden Platz einzuräumen. Die Gedichtauswahl überzeugt: Der Sänger der weggebaggerten Dörfer webt am Wortgeflecht wie der entsagende Seher; wir erfahren „die amorphen wunder der wüste“, schmecken Verwesungsgeruch und sehen das Zwielicht der Höllendüsternis „hinter der gedankenplüschmauer“.
Vereinnahmt durch das „sprachgeflacker in den schläfen der selbstsucht“, „traumverdunsten“, nehmen wir kaum wahr, in welch strenger Manier diese Gedichte gehalten sind: Vokalharmonie und Binnenreim, ja selbst Endreim und das „klassische“ Sonett sind zu finden. Nichts wirkt hier aufgesetzt, alles scheint „aus dem Bauch“ (gallebitter und magensauer aus Säuferleber und Raucherlunge) zu kommen.
„Welch eine Formbeherrschung, welch eine Sprachwu(ch)t!…
so
in der folge des flockenfalls
schneit der schaum dieses verirrten trojanischen
pegasus ins abendland o wahnsinnsweiße
beschreibung einer zu früh erlösten explosion. taumelnd
von netzhäuten verdunkelt sinken die wirren wörter zurück
… wir vernehmen es und beginnen, etwas von dem gestockten Jähzorn dieses Schattenbruders von Inkubus und Pan zu erahnen.
Von Traditionslinien zu sprechen hat immer den Beigeschmack von Beflissenheit oder aber degradiert den Dichter zum Epigonen. Sie sind aber da, die Gäste im Hause Hilbig, werden von ihm begrüßt und bewirtet: Trunken irrlichtern Rimbaud und Novalis durch die heruntergekommenen Korridore, Enzensberger, die Wut den grauschwarzen Halden deklamierend, watet durch den warmen Modder der Tagebaulachen, Robert Walser und Franz Kafka warten mit dem schallenden Gelächter des Grauens in der verschlissenen Baracke vor der Fabrikruine.
Adolf Endler verweist auf die von Franz Fühmann vorgenommene Wort- und Bildwahl (Fühmann: „Es ist, glaube ich, Baudelaires Vorschlag gewesen, das Werk eines Dichters dadurch zu gewinnen, daß man die Worte zusammenstellt, die er immer wieder verwendet…“) und ergänzt jenes festgestellte „sprachliche Urwurzelwerk“ mit dem Hinweis auf die „glitschigen und schäumenden Substanzen“, auf die Verwesungsgerüche, die Farbschattierungen von Blau über Grau zu Schwarz.
Ein ergiebiger Ansatz: habe ich richtig gezählt, so kommt in Endlers Nachwort „Hölle / Maelstrom / Abwesenheit. Fragmente über Wolfgang Hilbig“ die Bezeichnung „DDR“ achtzehnmal vor, von synonymischen Wendungen zu schweigen, und doch wird der globale Charakter in diesem „edlen Essay“ (Adolf Endler über Adolf Endler) immer wieder betont. Genau hier wird das Paradoxon der Schriften Hilbigs offenbar: so weit entfernt und doch so tief verwurzelt diesem ehemals real existierenden Staat, Wolfgang Hilbig „möglicherweise“ als „die einzige große Ausnahme“ der DDR-Literatur (A.E.).
Besonders deutlich wird dies, ihrem Charakter gemäß, in den essayistischen Schriften; in der Abteilung V der Textauswahl liegen sie, auch dies eine editorische Besonderheit des Reclam-Bandes, erstmals versammelt vor. Die Vorträge, „Vorblicke“ und Annäherungen sind, ihren Anlässen entsprechend, sehr unterschiedlicher Natur: sie gelten einzelnen Dichtern (Fühmann, Kafka, Igel) oder literarischen Zusammenhängen („Literatur als Dialog“, Lyrik in der DDR), sind ernsthafte Reflexion („Der Mythos ist irdisch“) oder sarkastisches Grinsen („LA BELLA ITALIA“ – „grinsen“ hat etymologisch etwas mit „weinen“ zu tun).
In dem Aufsatz „Über Jayne-Ann Igel“ kommt ein besonderes, m.E. bis heute wirkungsträchtiges Problem der DDR-Literatur zur Sprache, deshalb sei auf diesen hier kurz eingegangen: jene „Küchen- und Korridor-Szene (…) in den obersten und am wenigsten noch bewohnbaren Stockwerken von halb verbrannten, halb durchnäßten Mietskasernen“, die sich als Gegenkultur begriff und geeint war vor allem in der mangelnden Öffentlichkeit. Die Aktualität dieser Gruppen liegt weniger in den jüngsten Enthüllungen – auch wenn z.B. die Nischen des „Prenzlauer Berges“ (ich weiß: der Begriff ist eine Krücke – aber was hilft’s) nun eher als Bunkergänge, denn als Katakomben zu sehen sind, aus jenen, in verschiedenen Städten existierenden Kreisen kamen beeindruckende literarische Ergebnisse. Wolfgang Hilbig benennt das eigentliche Dilemma wie folgt:
… es war in dieser Szene an der Tagesordnung, mit Texten überschüttet zu werden, denen Publikationsmöglichkeiten verweigert wurden, was man zu bedauern und als katastrophales Unrecht anzusehen hatte… während man, insgeheim, womöglich selber nicht an die öffentliche Qualität dieser Texte glaubte…
Genau hier liegt der gegenwärtig problemhafte Umgang mit DDR-Literatur überhaupt begründet: Literaturkritik funktioniert(e) in deutschen Landen zu oft als kulturpolitisches, denn ästhetisches Regulativ, im Osten war die Zugehörigkeit zum „Underground“ Anlaß für Repressalien, im Westen Bonusgarantie; Überbewertungen und / oder Ignoranz waren die Folge – auf allen Seiten.
Die „Wende“-Häme des Feuilletons im Umgang mit DDR-Literatur liegt wohl hier, in der Scham ob des eigenen Funktionierens, begründet. Die Psychoanalyse kennt diesen Mechanismus: Verdrängung durch Identifikation mit dem Gegenteil. Was fehlte und – sicher gibt es Ausnahmen – noch immer als vermißt anzuzeigen ist: ein kunstgemäßer, der Literatur angemessener Umgang mit jenen Texten.
Es wird noch so manches nachzuholen – wie Hilbig bei Igel – und zu entdecken sein, anderes wird zurechtgerückt oder neu verkannt werden. Ein Prozeß der Normalisierung sollte endlich einsetzen, mit allen Ecken und Kanten, die moderne Kunst nun einmal zu bieten hat: der Experimentator ist dem Scharlatan verwandt. Hemmschwellen sind hierbei, scheint es mir, vor allem im Osten abzubauen (hier sitzt einem die Crux der Doktringeschichte noch schwer im Nacken – wer traut sich da einst Verfemte zu kritisieren); im Westen sind sie wohl eher wieder anzumahnen, zu schnell geraten mir die Pauschalisierungen.
Hilbigs essayistische Entwürfe sind (noch) nicht jene großen, theoriegewichtigen Selbstverständigungen, wie sie bei anderen Schriftstellern anzutreffen sind, auch wenn aufs Allgemeine zielende Bemerkungen hier und da aufblitzen: man darf wohl bald mehr erwarten. Es sind Annäherungen, auf Details zielend, persönlich, mit originellem Blick.
„Die Literatur“, so Hilbig, „spricht nicht von der Regel. (…) Die oft gehörte, gute Meinung, daß Literatur sich bis zur Grenze vorwage, ist ein schlichtes Klischee: die Literatur beginnt auf der Grenze. Oft genug widerspricht sie auch noch solcher Festlegung; in ihren besten Beispielen verkörpert sie geradezu Grenzfälle.“
*
zwischen den paradiesen lautet die Topographie der Texte Wolfgang Hilbigs; Orientierungshilfen aber sind nicht zu erwarten. Zwischen Evolution und Apokalypse, zwischen schwärzestem Humor und abgründigem Schaudern, zwischen Lebenlassen und Getötetwerden haben wir uns „in einer sonne tot wie kohlenglut“ auf die Wahrheiten einzuüben. Gute Literatur, so wird gesagt, hat Sogwirkung, sie läßt einen weder in Ruhe noch los – in bezug auf Wolfgang Hilbig sollte man wohl eher von einem Strudel sprechen, der Leser sei gewarnt. Er wird ihm folgen müssen: hinab, hinab…
Jürgen Krätzer, die horen, Heft 166, 1992
Balanceakt an der Grenze zur Stille
− Berliner Literaturpreis: Betrachtungen zu Lyrik und Prosa von Wolfgang Hilbig. −
Soeben wurde dem Autor Wolfgang Hilbig – gemeinsam mit sechs anderen Schriftstellern – der Berliner Literaturpreis 1992 zuerkannt. Ausführliche Auskunft über Hilbigs bisherigen Beitrag zur deutschen Gegenwartsliteratur gibt der jüngst bei Reclam erschienene Band Zwischen den Paradiesen.
Zerfurchte Landschaften, fahle Industriegiganten, chemisch verseuchte Gewässer, zermürbte und absterbende Orte – das sind die Objekte von Wolfgang Hilbigs Poesie. Der Expressionist Georg Heym beschwor einst den „Dämon der Städte“, der auf düstren Straßen regiert. Bei Hilbig findet man eine Steigerung bezüglich der Symptome des Zerfalls. Die Attribute des Dichters sind stark, so stark, daß sie die Vorgänge der Zerstörung auf viel elementarerer Ebene erfassen. Aus seinen Texten kristallisiert als Ursache des Niedergangs das Wüten der Zivilisation. Hilbig leuchtet hinter die Dinge, er gibt sich nicht mit oberflächlichen Analysen der Situation zufrieden. Unerbittlich setzt er das Tranchiermesser an, um wider die schüttere eigene Existenz zu fabulieren, denn Literatur „bezweifelt das Unmögliche, das sprachlos ist“, und sie „widerspricht den Identitäten des Vorgegebenen“, den verlockenden Klischees.
Die Region südlich von Leipzig, das Braunkohlerevier zwischen Markkleeberg, Zeitz und Meuselwitz ist immer konkreter Gegenstand von Hilbigs Anfechtungen. In dem Gedicht „das meer in sachsen“ komprimiert er seine Empfindungen angesichts des verwüsteten Gebietes:
tagelang strahlt nacktes sonnenlicht gegen die erde
dann wieder wochenlang eisiger regen fressende kälte
die bagger versinken im schlamm telegraphendrähte
schwimmen im sand in den verödeten tagebauen
kilometerweit geht der wind unangefochten…
Auf noch ausgeprägtere Allegorien des Untergangs stößt man in „ophelia“; Hilbig läßt die tragische Shakespearsche Gestalt „im unrat eines toten flußarms“ ankern, wo „müll zerweicht im mond im schattendickicht“. Dagegen setzt er eine Vision mit „golfen von kupfer in reichtum und pracht“. Aber die Darstellung des Ersehnten ist nur ein schöner, aber blutleerer und starrer literarischer Kontrast. Hilbig operiert viel zu perfekt mit der Ästhetik des Häßlichen, als daß er den Leser durch das Vorgaukeln einer unechten, ja heilen Welt verführen könnte. Dumpfe Töne triumphieren, die Formulierungen sind ihrem Wesen nach nihilistisch. Daran scheint nichts mehr korrigierbar zu sein. Im Bannkreis zukunftsloser Vokabeln vermag Hilbig es nicht, seinem Temperament einen heiter-ausgeglichenen Anstrich zu geben; er bevorzugt die dramatische Gestik, weil die Epoche des späten zwanzigsten Jahrhunderts kaum Anlaß für lockere und ausgelassene Stilübungen bietet. Wenn man Hilbigs Werk unter musikalischem Aspekt betrachtet – und gerade seine Sprache weist eminent melodische Merkmale auf −, so hat seine Begabung überwiegend Moll-Charakter, für Eskapaden in Dur scheint kein Raum vorhanden. Adolf Endler summiert das Ansinnen dieses Dichters in einem Satz: „Falls es Hilbig überhaupt um eine Botschaft ginge, dann hieße sie… grob und einfach: Lassen Sie, meine Damen und Herren, alle Hoffnungen fahren!“
Es drängt sich beim Durchdenken von Hilbigs Texten bisweilen die Idee auf, daß es bei den Beschwörungen von schwelenden Zersetzungen und drohendem Verfall um ein lokales Problem geht, um eine Sache also, die gebunden bleibt an Herkunft und Erfahrungsbereich des Autors. Überdies könnte man hinsichtlich Hilbigs melancholischem Sprachwillen, der in entscheidenden Belangen auf Schopenhauer und Nietzsche, manchmal auch auf Benn und Oswald Spengler zurückgeht, mutmaßen, dies sei eine typische deutsche Angelegenheit, die sich auf die intellektuelle Sphäre zwischen Rhein und Oder reduzieren lasse, zumal die schwermütige, dichtgefügte und wegen ihres Symbolgehaltes etwas schleppende Diktion ganz offenkundig dem Erbe solcher Schriftsteller wie Hamann und Bobrowski geschuldet ist. Hier sollte man indessen Vorsicht walten lassen; Hilbigs Intentionen sind nämlich durchaus von globaler Natur, sie beinhalten Wesenszüge unserer Epoche, die man mit den Worten Ausdrucks-, Öko- und Seelenkrise grob umreißen kann. Gerade als Lyriker ist Hilbig wie viele seiner Zeitgenossen – etwa Krolow, Kunert und Meister – von einer Müdigkeit in bezug auf das noch Sagbare befallen, die alle Prognosen aus Wittgensteins „Tractatus logico philosophicus“ zu bestätigen scheint. „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“, heißt es bei dem österreichischen Philosophen, und in diesem Sinne wendet sich auch Hilbig gegen eine „ganze welle aus geleierten wendungen“, die ihn in seinem kreativen Drang behindern. Er will nicht ersticken an „faulen metren“, und dennoch begegnet er mit jedem neu begonnenen Vers wieder der Gefahr, etwas nicht mehr gültig und aussagekräftig weitergeben zu können. Seine Poesie ist mithin ein Balanceakt an der Grenze zur Stille. Dazu gesellt sich die Ernüchterung in Anbetracht des kaum faßbaren Ausmaßes der Umweltvernichtung. Wenn Hilbig in der Erzählung Alte Abdeckerei die arg lädierten Landstriche seiner Heimat auf grandiose Art schildert, so läßt sich aus diesem Mosaiksteinchen eine Schablone konstruieren. die auf große Bereiche Europas paßt.
Aber die Verkümmerung ist nicht bloß ein äußerlicher, von chemischen und physikalischen Faktoren gesteuerter Prozeß, sondern er weitet sich aus auf die Psyche des Menschen. Die Seele des einzelnen hat bereits Schaden genommen, die psychischen Defekte sind das Resultat einer steten Disharmonisierung:
wie eine graue Vegetation, die ohne Gegenleistung von den Nährstoffen des Bodens fraß, siedelten wir in den öden Provinzen, die der Hort der Bosheit waren, siedelten wir uns an zwischen Abraum und Schutt, wo wir geil und kampflos wuchern konnten…
Dieses Zitat birgt einen versteckten Fingerzeig auf die geistige Armseligkeit der abgeschotteten DDR, aber gleichwohl könnte man die Sentenz verallgemeinern und auf eine Vielzahl von Staaten – nicht nur jene des untergegangenen Ostblockes – projizieren. Hilbig wählte den „Weg an den Rand der Gesellschaft“, weil er nicht mehr gewillt war, das wohlgefällige „Weichbild des Aufbaus“ und die sattsame Pseudomoral des Sozialismus zu ertragen. Natürlich sind seine Angriffe daher hauptsächlich auf die institutionalisierte Ideologie der abgetretenen ostdeutschen Politgreise gerichtet, doch wohnt ihnen ebenso eine generelle Kritik an Ideologie und ihren Funktionsprinzipien inne. Im dritten Kapitel seines Romans Eine Übertragung hält Hilbig fest, welche Zwänge die Systemkonformität der Kultur für den Literaten erzeugt:
Dennoch war es ein gräßliches Gefühl, wenn ich mir vorstellte, daß ich vielleicht Erklärungen abgeben mußte, mit denen ich die Daseinsberechtigung der Literatur verteidigen mußte, ich stellte mir vor, opportune Phrasen über die Bedeutung der Kunst predigen zu müssen, die aus den Verlautbarungen der offiziellen Kulturpolitik stammten…
Diese resignative Bemerkung kündet von der Verzweiflung des Autors an der Wirklichkeit; er empfindet das Sein als Hölle und ist darum bestrebt, es von sich wegzuschieben. Insbesondere in der Lyrik verdrängt er die störende „Latrinenlandschaft“ (Franz Fühmann) aus seinem Bewußtsein, um Platz für phantastische Assoziationen zu schaffen. Dennoch beklagt er immer wieder die Trostlosigkeit und Herbheit moderner Gedichte: „Die Lyrik… ist der Realität zum Opfer gefallen… Die Spürhunde der Realität haben die Sprache ausgerauft…“, liest man in dem 1977 entstandenen Aufsatz „Über den Tonfall“.
Unverkennbar groß ist der Einfluß von Hilbigs Werdegang auf sein vielschichtiges Werk. Dem jüngst im Reclam Verlag erschienenen Sammelband zwischen den paradiesen ist eine Anekdote vorangestellt, deren schmerzliche Ironie das Ringen des Dichters um Aufmerksamkeit dokumentiert; 1968 sandte er an die Redaktion der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur einen Brief mit folgendem Wortlaut:
Darf ich Sie bitten, in einer Ihrer nächsten Nummern folgende Annonce zu bringen: „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte! Nur ernstgemeinte Zuschrift an W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstr. 19 b.“ Ich bitte, nach Abdruck der Anzeige, mir die Rechnung zuzuschicken.
Damals war Hilbig „… nahe daran zu verzweifeln, kaputtzugehen, sich totzusaufen. Über acht Stunden führte er täglich eine Montagetätigkeit in einer Braunkohletagebau-Landschaft aus, die ihn… nicht nur physisch ermüdete. Seine Arbeitskollegen konnten mit seinen Gedichten absolut nichts anfangen, dennoch teilte er fast seine gesamte Zeit mit ihnen, tags auf der Arbeit, nachts im Wohnwagen…“ (Siegmar Faust).
Fast zehn Jahre hatte Hilbig bereits als Heizer in einer verrotteten Firma zugebracht, ehe es ihm gelang auszubrechen.
Wie ungeheuer bist du Tier
vor den Maschinen, die dein Dasein steil umdämmern.
Du bist mit deinem Samen noch…
lieblos hineingewürgt in Gram und Gier
wußte Paul Zech, der in den zwanziger Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, in seinem Gedicht „Der Prolet“ zu berichten. Hilbig mußte diese Existenz mit all ihren Bitterkeiten auskosten; er führte ein klassisches Doppelleben und verbarg sich hinter der Mauer seiner trivialen Tätigkeit, um im Geheimen die „Schwarzarbeit des Schreibens“ voranzutreiben. Im Grunde benutzte er einen Mechanismus, der in der Biologie als Mimikry bezeichnet wird: er tarnte sich mit Farben vor dem Feind. Das half ihm, jene unwirtlichen Jahre zu überstehen, in denen er als wortmächtiger Anachoret „die wahrheit aus dem flüstern“ löste.
Ulf Heise, Neue Zeit, 17.6.1992
Weitere Beiträge zu diesem Buch
Helmut Böttiger: Der Tagebau als visionärer Ort
Frankfurter Rundschau, 25.8.1992
Kurt Drawert: Ende der Illusionen
Die Zeit, 2.10.1992
Werner Jung: Abwesenheit – Anwesenheit
Neue Deutsche Literatur, Heft 9, 1993
Hölle / Maelstrom / Abwesenheit
− Fragmente über Wolfgang Hilbig. −
… Es beginnt in der Mitte der Sechziger mit Versen, die bei aller Kraft doch noch gelegentlich zum „Lyrismus“ tendieren, ja, hier und da altklug-schlagerhaft daherkommen, um uns (mit der Stimme Milvas oder Juliane Werdings eventuell?) zu sagen: „träum den traum daß der herbst bleibt“; oder: „laßt mich ein wenig noch sterben…“. (Das ändert sich bald, wie Franz Fühmanns Essay über Hilbig und dessen Poesien anfangs der Achtziger darlegt.) Einer der ersten, die in der DDR der Lyrik Hilbigs ihre Aufmerksamkeit schenken, ist der Kritiker der ndl, der außer der starken Begabung eine gewisse „Weltfremdheit“ des Poeten wahrzunehmen glaubt (ndl 3/84), dann aber doch noch über Zeilen stolpert („Wenickstns een kleenet Bißken Positives“, möchte man rufen), die schließen lassen, daß Hilbig noch nicht gänzlich verloren ist, nämlich diese: „für dies leben diesen fels / einen schweren lobgesang“. (Der Rezensent bleibt dennoch einigermaßen ratlos; mein Gott, was müssen wir im März 84 gelacht haben, als wir des bild-zergrübelnden Z. Bemerkung gelesen haben: „Das ,gegen-den-Strom‘-Weisen der Arme verbindet sich für mich allerdings mit der Frage, wogegen ,immer wieder‘ anzugehen sei.“) Das alles hat sich erledigt; es könnte sein, daß ein Prosastück wie „ÜBER DEN TONFALL“ von 1977 den Einschnitt zwischen dem frühen und dem späteren Œuvre Hilbigs markiert, eine Prosa, die notizbuchartig beginnt: „Geschwätzig vor Trauer; endlose Nacht…“; die nach einigen Seiten endet mit der Wendung:
Es ist die Lockung einer anderen Existenz, eines Tonfalls, gelöst von der Trauer, Stille… nach dem Aufschrei der Alraune.
Nein, an Hanns Heinz Ewers’ schwülen Kolportageroman Alraune ist dabei gewiß nicht gedacht worden; gedacht aber wohl doch an den Umstand, daß die Pflanze Alraune den braven Christen des Mittelalters als anrüchiges Geschenk des Teufels gegolten hat, ein Gewächs mit „üblen, die Türen zum Paradies verschließenden Wirkungen“. Hier irgendwo muß der Punkt gesucht werden, will mir scheinen, wo Hilbig – wie er später die Grenzen des Landes überschritt – die nicht so präzis zu markierenden Grenzen dessen hinter sich ließ, was man „DDR-Literatur“ nennt; und er hat es gewußt, daß er’s tat; und zweifellos hat die Wut über derlei nicht nur von ihm als medioker empfundenen Begrenzungen zu den vorwärtspeitschenden Elementen, den „Batterien“ seiner staunenswerten Produktivität gehört – bis heute immer einmal wieder in seinen Texten neu angerufen, diese Wut, neu angefacht, als gelte es, die unermüdliche Lokomotive auch von dieser Seite her für weitere Wegstrecken unter Dampf zu halten. Der „Aufschrei der Alraune“, das wäre die Grenzüberschreitung, das ist sie gewesen, angekündigt 1977; mit dieser „Tonlage“ hat sich Hilbig aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, ehe er auch nur Kandidat hätte werden können. Hilbig hat es gewußt und in seinen Werken niedergeschrieben: „… es würde niemals geschehen, daß in der proklamierten Literaturkonzeption dieser Republik für mich ein Platz war…“ (Ach, eigentlich hatten wir dieses Thema vermeiden wollen als allzu minderwertiges; doch nun, sickert es doch in diesen edlen Essay:) „Sie würden mich als Literaten niemals akzeptieren…“ Ein doppelt genähtes „Niemals“! Nicht auszudenken, die wunderherrliche DDR als acherontischen Kleinstaat deklariert zu sehen („Und dann nichts wie weg mit ihr per Expreßpost!“), zumindest als eine der spezielleren Abteilungen des Schattenreichs, die mit den „ddr-spezifischen“ Schatten geschwängerte sozusagen! Insofern erscheint einem nicht erst seit heute der Protestbrief, den Hilbig am 16. Februar 1981 an den Stellvertretenden Kulturminister Klaus Höpcke gerichtet hat, weniger als ein verbaler Bittgang um Verständnis und Hilfe, sondern mehr als stolze (freche) Selbstbehauptungs-, als Scheidungsurkunde, mit Bedacht nicht nur in die Clara-Zetkin-Straße 90 geschickt, sondern in Durchschlägen auch einigen Kollegen zur Kenntnis gegeben, die ein für alle Male wissen sollten, „daß niemand in diesem Land das Recht hat, mein Werk auf Fremdbestimmung hin zu kontrollieren. Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, daß ich einer Generation angehöre, die sich nicht mehr zensieren läßt, aus logischen Gründen, denn diese Generation hat bisher nirgends als in der DDR existiert, und daß dies eine Weigerung, mich einer Zensur, gleich in welcher Form, zu unterwerfen zur Folge hat…“ Wolfgang Hilbig hat sich daran gehalten, in diesem Punkt sehr viel unerbittlicher als mancher andere Repräsentant der „Generation“ der heute Fünfzigjährigen, als deren Sprachrohr er sich in seiner Epistel tollkühn empfiehlt; in ähnlicher Weise jedoch wie z.B. jene seltsame Gruppe vor allem Leipziger Autoren, die der Verfasser vor einigen Jahren mit dem Etikett „Leipziger Schwarze Neo-Romantik“ beschenkt hat (wieder mal so ’ne neckische Exzentrizität aus dem Werbebüro Adolf Endler), neben Wolfgang Hilbig Autoren wie Gert Neumann (Elf Uhr, Die Schuld der Worte), wie in gewisser Weise der 1983 nach Hamburg ausgewanderte Wolfgang Hegewald, wie die jüngeren Jayne-Ann Igel und neuerdings, aus Waldheims Düsternissen hergeflügelt, Ulrich Zieger; sie alle Jahre um Jahre betroffen von Verbot, Bespitzelung, „Verladung“ (Abtransport zum Verhör), Vernehmung, Gefängnisaufenthalt, Vertreibung (was sich ihrem Werk unauslöschlich eingeprägt hat vermutlich bis an ihr Lebensende): Manches bei Hilbig mutet einen an, als müßte man demnächst von einem literarischen Genre „Vernehmung“ sprechen – und natürlich fällt einem dabei Dostojewskis Großinquisitor ein −, weiterentwickelt zur „Selbstvernehmung“, z.B. nicht ohne Sarkasmus am Ende des Romans EINE ÜBERTRAGUNG: „Hier stellen wir die Fragen, hatte es geheißen, und ich ordnete mich dem Prinzip auch jetzt sofort unter…“ – Lassen wir’s vorerst, diesen Faden bis werweißwohin weiterzuspinnen, hier bis zu Jürgen Fuchs, dort bis zu Detlef Opitz ausschwenkend; jedenfalls hat sich Wolfgang Hilbig solche u.U. lebensbestimmenden, u.U. existenzvergiftenden Erfahrungen auf seine besondere Weise zunutze gemacht, begierig auf den „Aufschrei der Alraune“, einem „riesigen Lager von Gestank“ ausgeliefert, „das müde unter den Wolken kreiste…“ Das Extraordinaire der hilbigschen Leistung wird einem bewußt, wenn man ihn sich als Teilnehmer einer Dichterlesung vorstellt, wie sie wirklich jüngst stattgefunden hat, als etwas monoton sächselnden Vorleser seiner Texte in einer Reihe mit Rainer Kirsch, Fritz Rudolf Fries, Christoph Hein, Thomas Rosenlöcher; der Zeitungsbericht über die Veranstaltung vermerkt, daß Thomas Rosenlöcher das Publikum „wieder mal so richtig lachen“ hat lassen, daß Christoph Heins Beitrag als „sachlich präzise“ aufgefallen ist – vermutlich im Unterschied zu dem Wolfgang Hilbigs, über dessen Auftritt es hieß:
Wolfgang Hilbig… beeindruckte durch opulente Bildhaftigkeit seiner Texte, die eine ruhelose Benommenheit, ein irritierendes Gefühl von Bedrohung verstrahlen…
Man möchte ergänzen: Ah ja, und tüchtig „verstrahlt“ verließ die Gemeinde den Raum! Im Ernst: Obwohl es sich in der Tat um „opulente Bildhaftigkeit“ handelt, wären mir diese Vokabeln angesichts der Prosa Wolfgang Hilbigs im Hals oder Füller steckengeblieben! Und was die „ruhelose Benommenheit“ und das „Gefühl von Bedrohung“ betrifft – ja, was erwarten Sie sich, Madame, unter der schwarzen Sonne Satans? Wolfgang Hilbig in DIE WEIBER:
… und ich glaubte zu wissen, daß ich mich mit allen Fasern in der Hölle befand.
Das ist der Point. Man muß bereit sein, das offenbar schwer Glaubwürdige wahrzuhaben; viele Rezensenten in Ost und West senken lieber den Blick und murmeln freundliche und in der Regel lobende Halbwahrheiten beiseite. Einem Autor aus der Bronx oder von der Lower East Side, ist das nicht kurios?, würde man die Botschaft, daß er so oder so in der Hölle lebt oder zu leben wähnt, ohne allzu große Schwierigkeit „abnehmen“, ist das nicht absurd?, einem aus Werneuchen oder Mittweida eben nimmermehr.
(…)
„Abwesenheit“, „Abwesenheit“ – hier endlich ist er, der Begriff, auf den vielleicht mancher schon gewartet hat, in einer seiner schlichtesten Bedeutungen nebenher, der schillernde und für Hilbig von Anfang an so wichtige Begriff (ABWESENHEIT ist der Titel seines ersten Gedichtbandes von 1979), womit wir endlich auch beim zweiten der Mottos zu EINE ÜBERTRAGUNG wären, einem Satz des rumänisch-französischen Schriftstellers E.M. Cioran, in welchem der Begriff nahezu mystische Dimensionen gewinnt (ein Satz, dem obigen Hilbig-Zitat in seiner Zwiegesichtigkeit durchaus verwandt):
Sich der Angst bedienen, nicht um die Abwesenheit zu einem Mysterium zu machen, sondern das Mysterium zur Abwesenheit.
Für künftige tiftelnde Interpreten hat Hilbig, der sich im Unterschied zu seinem ehemaligen Kompatrioten lieber als puren Artisten sieht, kaum weniger „vorgesorgt“ als der vorzeiten mit ihm korrespondierende Gert Neumann, welcher sein beunruhigtes und zweifelndes Verhältnis gegenüber der Sprache von jeher mit Hilbig teilt – Hilbig ganz Neumann-nahe: „… die Abwesenheit von Praxis in aller Sprache ein fast atmosphärisches Grundgefühl…“ −, doch inzwischen ein seher- und predigerhaftes Sendungsbewußtsein, einen mystisch-philosophischen Furor entwickelt und darlebt, wie sie Hilbig ziemlich fernliegen dürften; in diesem Zusammenhang unterscheidet sich Hilbig von Neumann auch in der sehr viel mißmutigeren Beurteilung der Gestalt des Arbeiters, der bei Neumann als der „Mensch der Praxis“ und der wahrhaftigeren Diskurse „von unten“ bzw. von „ganz, ganz, ganz oben“ und unter durchaus wiedertäufernahen Gesichtspunkten doch wieder beinahe zum Hoffnungsträger wird… Mit dem Begriff der „Abwesenheit“ hat Hilbig indessen eine Vokabel gefunden, die kaum weniger zum Angelpunkt eines quasi mystisch-theoretischen Apparats hätte werden können, etwas erschwert (und erleichtert zugleich) durch den Umstand, daß die „Abwesenheit“ eben die Abwesenheit ist; ich male mir aus, daß Hilbig in enger Tuchfühlung mit Gert Neumann seinen „Abwesenheits“-Faden gesponnen hat, zumal er fast gleichzeitig mit Neumanns Schuld der Worte am Ende der Siebziger ans Licht tritt, um sogleich aufgenommen zu werden: Schon die erste größere Würdigung, im August 1980 zu Papier gebracht von Franz Fühmann, ernennt die Vokabel zu ihrem Mittelpunkt („Praxis und Dialektik der Abwesenheit“, aufzusuchen in Fühmanns Essays Gespräche Aufsätze 1964–1981). – Leider ist der von Fühmann bereits in seiner Viel-Dimensionalität erkannte Begriff dann für eine Weile vor allem in heruntergestockter und reduzierter Bedeutung umhergereicht worden, nämlich als ein auf die fehlende Präsenz des hilbigschen Œuvres in der DDR anspielender; Fühmann hat das vielleicht mitverschuldet, da er den Begriff aus taktischen Gründen am Ende differenzierter Darlegung in etwas neckisch-feuilletonistischer Manier verwendet, um dem „Staat“ und speziell dem damaligen Leiter des Reclam – Verlags die Drucklegung dieses Werks ans „Herz“ zu legen:
… ich zeige Ihnen einen Dichter. Er ist hier nicht anwesend. Seine Abwesenheit quält; sein Anwesendsein wird Schwierigkeiten bringen: Er ist ein Dichter.
Mittels Veröffentlichung in der DDR wären Hilbigs Ur-Probleme, wäre sein Identitätsproblem freilich auch nicht gelöst gewesen; Fühmann hat es selbstverständlich gewußt und ausgesprochen, daß es um etwas Erheblicheres geht bei den Widersprüchen dieses Poeten als nur um einen Konflikt mit dem Staat: „Er ist ein Dichter“ und immer schwieriger in nur ein Schubfach, nur einen Schrank zu kriegen mit der Zeit, in einer späteren holländischen Rezension nicht unzutreffend, als „Mister Hilbig und Mister Hyde“ aufgerufen, „anwesend“ oder „abwesend“ oder wie oder was?
Natürlich haben sich nicht alle Kritiker auf die alleinige und bequeme Fährte „Schwierigkeiten mit der Zensur“ u.ä. locken lassen; dem „Eigentlichen“ schon sehr viel näher kommt z.B. Manfred Jäger, wenn er im Jahr 84 vermutet, daß es sich letzten Endes um das Phänomen der „Entfremdung“ handelt; das Hilbig mit seinem Begriff „Abwesenheit“ bezeichne, das ebenso Hilbigs kritisch fragendes Verhältnis zur Sprache bestimme. Man könnte sicher mit dem gleichen Recht eine Verbindung zu Ernst Blochs Prinzip Hoffnung herstellen, das ein skeptisches oder gar hämisches Naturell ja leicht als „Prinzip Abwesenheit“ zu bestätigen imstande wäre. Ebensowenig würde es mich wundern, wenn sich auf die Dauer Seher und Deuter einstellen würden, die den Begriff als religiös aufgeladenen empfehlen würden, den „unsichtbaren“, „abwesenden“, den „gestorbenen“ Gott im Kopf. (In seiner bislang letzten und zwischen 1981 und 1991 entstandenen Erzählung ER, NICHT ICH tangiert Hilbig tatsächlich das „Gott ist tot“, und zwar im Zusammenhang mit Schaudern machenden Erwägungen über den „Menschenhandel“ durch die Behörden der DDR, von dem man auch ohne Anführungsstriche sprechen könnte; Hilbig: „Dies gab es schon immer in diesem Land! Nur daß die Geschichte damals mit einem anderen Vokabularium getätigt wurde, nur daß der Leichnam damals noch nicht erwähnt worden war: Mit Gott nach Amerika! Hier aber ist er vergessen, und wahrhaftig, sie haben das Land derart verpestet, daß man den Gestank seines Hirnwesens nicht mehr riecht!“) Hilbig würde vermutlich auch diesen lauschen, um dann in seiner manches offenlassenden Art zögerlich zu nicken und auf einen endgültigen Bescheid zu verzichten; dies um so sicherer, als ihm die mögliche Verknüpfung seines „Abwesenheits“-Begriffs mit den Szenarien des Unterwelthaften als Karl-Philipp-Moritz-Kenner, der er zweifellos ist, als Kenner der „Götterlehre“ zumindest des Goethefreundes, nicht fremd sein kann, einer „Götterlehre“, in welcher u.a. erklärt wird:
Der König der Unterwelt hieß bei den Griechen Ades oder Aides, der Unsichtbare, Unbekannte; – selbst sein Name bezeichnete das Dunkel, in welches noch kein sterbliches Auge blickte. Er hieß auch der Unterirdische oder Stygischer Jupiter…
Und, siehe da, schon 1981 läßt Hilbig in der Erzählung DIE ANGST VOR BEETHOVEN eine fleischfressende bzw. mit Fleischbrühe zu ernährende Orchidee aufblühen, die „Subterrania“, die „Unterirdische“ genannt wird, Inkarnation eines gestorbenen Mädchens für ihren Vater, um es vereinfacht zu sagen… Als zentrale Auseinandersetzung mit dem, was Hilbig als „Abwesenheit“ bezeichnet und zu verstehen versucht, stellt sich jedoch der 1989 erschienene und vielgepriesene Roman EINE ÜBERTRAGUNG dar, welcher im gleichen Maß eine vielfältig gebrochene hilbigsche Selbst-Versicherung seiner Existenz als Schriftsteller bedeutet, „A Portrait of the Artist as a middle-aged Man“; so gut wie alles, was sie hervorbringt, darf er (wie jeder wichtige Autor) auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Entwicklung als ein „Gesamtwerk mit geheimnisvollen Zusammenhängen“ überblicken (als was es auch anderen erscheinen muß), Zusammenhängen, die sich auf in der Tat „geheimnisvolle“ Weise (und das ist das, Besondere der Poetik Wolfgang Hilbigs) im wesentlichen dank der Anwesenheit der „Abwesenheit“ herzustellen scheinen, ohne daß schlüssig erklärt werden könnte, wie… Einen langen Augenblick lang blickt man nächtens, von den Schriften Wolfgang Hilbigs dazu animiert, zum Himmel der Milchstraßen-Milliarden empor und bemüht sich, eines der berühmt-berüchtigten SCHWARZEN LÖCHER auszumachen, von denen auch Erich Arendt in den Jahren vor seinem Tod so sehr angetan war, „Abwesenheiten“ auch sie, und stellt es sich vor als unaufgeklärtes, schwer erfaß- und erfahrbares Zentralgestirn eines von ihm dominierten Kosmos, dem poetischen des Wolfgang Hilbig (Essayisten-Chuzpe!) vielleicht vergleichbar. Nein, so ganz abwegig wird dem Leser des Romans EINE ÜBERTRAGUNG das Bild nicht vorkommen, nachdem er z.B. erlebt hat, wie Hilbig des „Abwesenden“ als des eigentlich nicht zu benennenden Zentrums seiner Poetologie wieder und wieder habhaft zu werden versucht, und sei es mit fast schon alchimistisch anmutenden Formeln: „Das Abwesende“, heißt es einmal, „das der Zusammenhang zwischen den einander ausgeschlossenen Einzelheiten hätte sein können, war, wie mir die Ahnung sagte, der formende Geist… die Poesie…“; ein anderes Mal wird die Formel ergänzt: „… immer hatte ich die Poesie, die ich das Abwesende nannte, mit dem Weiblichen verquickt…“ (Siehe auch die Erzählung DIE WEIBER über deren schockierende plötzliche Abwesenheit!) Die Poesie, die Liebe; weshalb nicht der Tod am Ende? Ja, leuchtet nicht der Tod bzw. die Todesgewißheit am sinnfälligsten und augenblicklich als permanent anwesendes „Abwesendes“ ein? Und wieder die Unterwelt und die schwer zu fangenden Grüße der Schatten am See Avernus… (Und vielleicht kommt das alles nur davon, erlaube ich mir zu lächeln, daß der Knabe aus mütterlichem oder großväterlichem Mund allzuoft die vorwurfsvolle Frage vernommen hat: „Kind, was bist du nur wieder so abwesend heute!?“, abwesend, wegwesend, verwesend, mh?) – Wer über das spitzige Sensorium für derlei „abweichende“ poetische Elemente verfügt, wird wahrscheinlich spätestens an dieser Stelle sich fragen, ob bei Hilbig möglicherweise ein Umschlag ins Schwarzhumorige „ins Haus steht“, ja, ob nicht ein sublimer Geist wie André Breton, hätte er’s noch zur Kenntnis nehmen können, auch schon das bisherige Werk Wolfgang Hilbigs zu großen Teilen als „schwarzhumorig“ interpretiert hätte: Man lese unter diesem Gesichtspunkt und mit geschärftem Sense für absurde Komik z.B. die ersten Seiten der soeben fertiggestellten Erzählung ER, NICHT ICH (der Titel eine individualistische Korrektur des braun-klopstockschen „Sie, und nicht wir“ bzw. „Wir, und nicht sie“), man lese von Erlebnissen, die dank ihrer banalen Fehlverkantetheit wenigstens unsereins an Chaplin und den höheren Blödsinn des Slapsticks denken lassen und trotz ihrer Trostlosigkeit hellauf lachen. Obwohl ich mich mit solcher Prognose nicht festlegen möchte – weiß der Teufel, was in Hilbigs Küche z.Z. zu schmoren begonnen hat −, findet man, erst einmal darauf gekommen, bei Hilbig nicht nur ästhetische Bekenntnisse („Oft sind es Banalitäten, die als Auslöser emotionaler Prozesse fungieren…“), sondern auch in seiner literarischen Praxis immer wieder Konstellationen hergestellt, wie sie zu den Grundvoraussetzungen schwarz-humoristischer Präsentation zu gehören pflegen, z.B. die häufige (u.U. „entlarvende“) Verschränkung des total Banalen mit dem Erhabensten…
Adolf Endler, 28.5.1991, aus: Wolfgang Hilbig: zwischen den paradiesen, Reclam-Verlag Leipzig, 1992
Vorstellung Wolfgang Hilbigs
Wenn ich Gedichte und Prosa von Wolfgang Hilbig lese, fällt mir immer wieder ein Hölderlin-Satz ein: „Tritt auf dein Elend und du stehst höher.“ Und ich denke, ich weiß, er beweist einmal mehr: Die Außenseiter, die Ausgestoßenen, die Ausgegliederten sind am Ende allemal die Repräsentanten. Angestautes Schweigen entlädt sich eruptiv. Innerhalb weniger Jahre ist Hilbig zu einem der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller geworden. Jede seiner Prosaarbeiten konzentriert sich auf ein Zentrum, auf ein einschneidendes Erlebnis. Jedes seiner Prosastücke bildet einen Baustein zu einem großangelegten Werk.
Wie unglaubwürdig das System DDR war, bewies es im Umgang mit Schriftstellern, die sich nicht auf die lächerlichen Maßstäbe der Kleinbürger vereidigen ließen, die von einer bezirksgeleiteten Nationalliteratur träumten und danach handelten: Klein-in-Klein. Wie bezeichnend für die tatsächliche Verachtung der Arbeitswelt, die allzu oft als Strafraum genutzt wurde, daß einige der potentesten Schriftsteller dieses Staates wie Gert Neumann, der Betriebshandwerker, Wolfgang Hilbig, der Bohrwerksdreher und Heizer, überhaupt nicht zählten. Als hätte man es nun doch nicht so genau wissen wollen, wie es um die Arbeit und die Arbeitslandschaft links und rechts des Bitterfelder Wegs bestellt gewesen war. So erging es aus anderen Motiven auch Uwe Johnson, den sein Mecklenburg zu Werken inspiriert hat, die inzwischen in allen großen Kultursprachen ästimiert werden.
Zu Hilbig fällt mir das Sprichwort ein: „Geh nicht zum Schmiedel, geh zum Schmied!“ In der „Erbe-Aneignung“ hat er kühne Linien gezogen: Novalis, Kafka, Joyce, Beckett. Seit ich die furiose und grandiose Dichtung Alte Abdeckerei kenne, denke ich Tarkowski hinzu. Stalkerlandschaft in der Umgebung von Leipzig. Dieser Hilbig – das ist einer, der schwer trägt, der tief unten steht im Heizungskeller, von ganz unten kommt, der aber den Blick frei hat nach oben, nach vorn.
Seine Gelände, etwa die Tagebauwüste mitteldeutscher Braunkohlenlandschaft, werden von ihm in ihrer Dämonie erfahren als eine Hölle. Die Vergiftungen der Landschaft, des Körpers, der Seele hat er erlitten und ausgeforscht und setzt sie nun um in literarisch geformte Bilder. Literarisches Handwerkszeug – keine Frage für ihn, wie es scheint. Das Adjektiv „sprachmächtig“ trifft ins Zentrum. Seine Stärke sind Schilderungen, Szenen, die mit bohrender Eindringlichkeit und Plastizität gestaltet werden. Wie sagte Frank Schirrmacher:
Das Erbe der Avantgarde hat in den Nischen des Erzählens störrisch überdauert.
Ja, typischer Fall von Beharrungsvermögen. So etwas wird gern als störrisch apostrophiert. Zentrale Hilbig-Vokabel, über die schon jetzt Germanisten deutelnd gebückt sitzen. Meint er nicht einfach Entfremdung? Sicher, das auch!
Ich sehe in ihm einen, der lange unerkannt draußen vor der Tür stand und von dieser Außenseiter-Position, die schärferes Sehen ermöglicht, seine Stärke bezieht. Man lese seinen Brief an den einstigen Minister Höpcke. Der steht für eine ganze Generation, die auf Grund ihrer kritischen Texte Ausgesperrte oder Randständige blieben. Ich ist der erste wirkliche Roman über den Untergang der DDR durch Absurdität, das heißt durch den Verlust an Wirklichkeits-Gefühl, durch den Verlust jeglicher Realitätsbindung. So konnte die galoppierende Selbstzerstörung freudlose Urständ feiern. Die Dämonie der Kesselhäuser, verdreckt und verspeckt, ein Staat als Alte Abdeckerei, dessen Lebensadern zu verpesteten und verstunkenen Kloaken wurden – Hilbig hat das, was er erfahren hat, wie ein Seismograph registriert und gedeutet. Er schreibt in Gleichnissen, die nicht nur für ihn stehen, für sein persönliches Schicksal. Er denkt seine Welt groß, weil er über sie hinaus zu denken gelernt hat von den wirklichen Meistern. Er ist selbst einer.
Wulf Kirsten, aus: Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Verlag Das Wunderhorn, 2008
Tausend Buchhandlungen wurden ihm zu einer
– Gespräch mit Georg Klein. Georg Klein, 1953 in Augsburg geboren, ist Schriftsteller. Er lebt und arbeitet in Heinitzpolder/Ostfriesland. 2002 hielt er die Laudatio zur Verleihung des Büchnerpreises an Wolfgang Hilbig. –
Karen Lohse: Wie haben Sie Wolfgang Hilbig kennengelernt?
Georg Klein: Meine Urbegegnung mit Wolfgang Hilbig war ein Leseerlebnis. Dennoch kann ich mich daran szenisch-körperlich wie an den Zusammenstoß mit einem anderen Leib erinnern: Im Winter 1985 war ich ein nahezu unveröffentlichter, sehr unsicherer Schreiber, der insgeheim wohl nichts mehr fürchtete, als einem wirklich starken Gegenwartsautor ins Auge seiner Texte blicken zu müssen. Ich hatte mir aus der germanistischen Bibliothek der TU Berlin übers Wochenende ein paar Neuerscheinungen ausgeliehen, lag abends im Bett und hatte schon zwei Bücher nach kurzem Anlesen wieder weggelegt. Ich griff mir das nächste, und nach ein paar Seiten merkte ich, dass mich der Text völlig hingerissen hatte. Da war die ersehnte Empfindung höchster Gegenwärtigkeit. Die Sprache hat jede schützende Distanz unterwandert. Ich glaubte diesem Stil. Die Euphorie blieb allerdings nur kurz ungetrübt. Der Name des Autors sagte mir nichts. Was, wenn er zu meiner Altersgruppe gehörte? Der schrieb mich mit links an die Wand.
Zaudernd wendete ich das Buch und sah eines dieser Hilbig-Fotos. Es war mir so gleichgültig, wie der Großteil der biographischen Angaben. Ich suchte nur nach dem Geburtsjahr. Gott sei Dank: Da stand eine 4 und keine 5. Ich durfte also getrost bewundernd zu ihm aufsehen.
Inzwischen gebe ich nicht mehr viel auf das Konzept der Generation. Bei den wirklich guten Autoren vernebelt es das Wichtigste, wenn man sie zwanghaft im Dunstkreis ihrer Altersgenossen sieht. Dennoch ist die phänomenale Überlegenheit seiner Prosa für mich weiterhin ein gut gehütetes Tabu der Hilbig-Rezeption. Man stempelte ihn als Ost-Autor ab, um die schreibenden Altersgenossen im Westen nicht allzu gründlich mit ihm vergleichen zu müssen.
Lohse: Welches Buch hatten Sie damals von ihm gelesen?
Klein: Es war ein Band mit drei langen Erzählungen: Der Brief
Lohse: Sie sind ihm dann 1989 real begegnet. Hat sich in der Zwischenzeit in Ihrem Verhältnis zu ihm irgendwas geändert? Hat sich da eine Spannung aufgebaut, eine Erwartungshaltung?
Klein: Es hatten sich zwei Sachen verändert: Zum einen las ich mehr von ihm und ahnte, dass hinter dem Namen Hilbig ein Werk steht. Zum anderen war ich in meinem Schreiben weitergekommen. Ich traute mich erst leibhaftig an ihn heran, als ich das Gefühl hatte, mich auch als Autor nicht vor ihm genieren zu müssen.
Im Nachhinein halte ich das für einen rechten Unsinn, der ganz meiner inneren Hilbig-Vergötterung entsprang. Ich hatte die Größe, das grandiose Format meiner Leseerfahrung schlicht auf den mir unbekannten Menschen projiziert. übrigens las ich damals kein Feuilleton, hatte also auch keine Vorstellung von Hilbigs Geltung im Literaturbetrieb. Ich kannte bloß seine Texte und habe ihn aus dieser Perspektive, aus dieser intimen Ferne, idealisiert. Als ich dann zu meiner ersten Hilbig-Lesung aufbrach, war mir nicht klar, dass ich ihn nun als Menschen und zugleich bei seiner Betriebsarbeit erleben würde. Ich habe den Abend wie einen David-Lynch-Film in Erinnerung, einen Film, den man unter verschärften Rezeptionsbedingungen, festgeschnallt an seinen Kinositz und auf einer Rundum-Leinwand, erleben muss.
Lohse: Wo war das?
Klein: In einer Buchhandlung in Berlin-Steglitz, in einem schon damals ein wenig aus der Zeit gefallenen Geschäft. Man hatte die üblichen drei Reihen Klappstühle aufgestellt, auf denen sich schon eine Handvoll Leutchen niedergelassen hatten. Mein Blick schweifte durch den gedämpft beleuchteten Laden, und dann sah ich ihn auf einen Stuhl an der Wand hocken, eine Figur des Jammers, ein kleiner Mann mit einem arg dicken Bauch, der in einen viel zu engen kanariengelben Nickipulli gespannt war. Ein schweißnasses Gesicht, lange verschwitzte Haare. In den realexistierenden Augen des von mir verehrten Dichters glänzte nicht der poetische Furor, sondern der abendliche Fieberschub einer bösen Grippe.
Später erklärte Hilbig dem Publikum, dass er tatsächlich seit Tagen hohes Fieber habe und es wohl ein Fehler gewesen sei, aus Edenkoben anzureisen. Bevor die Lesung begann, bemerkte ich ein Rucken, Knirschen und Raunen aus der Reihe hinter mir. Der wuchtige Glatzkopf, der dort saß und der Ursprung der nervösen Geräusche war, stand offensichtlich unter einem unheimlichen Druck. Ich wunderte mich über seine hörbare Anspannung, über das zischelnde Flüstern ins Ohr seiner Begleiterin, begriff aber nicht, dass es sich bei ihm schlicht ebenfalls um einen Schreibenden handelte.
Es war eine Doppellesung. Zuerst trug ein westdeutscher Altersgenosse Gedichte vor, die ich als gut gemeint und brav gemacht in Erinnerung habe. Dann war Hilbig dran. Er trat an ein Stehpult und hob an in einem Idiom, das ich zuvor noch nie gehört hatte, in seiner speziellen Verschärfung dieser rund um Meuselwitz praktizierten Vokal- und Konsonantenfolter. Er wolle einen Prosatext und abschließend ein einziges Gedicht lesen. Dann richtete er seinen fieberverschleierten Blick in die Regale hinter dem Publikum, kniff die Augen zu Äuglein zusammen und nannte, jäh ins Hochdeutsche stürzend, den Titel der Erzählung: „Der Spleen der Toten“. Mir lief es eiskalt den Rücken runter. Er las schaurig gut. Ich habe ihn danach noch oft gehört, und immer lag die Qualität des Vortrags irgendwo zwischen okay und katastrophal. An diesem Fieberabend aber war er fantastisch. Ich war erneut, auf eine neue Weise, hingerissen. Wenn man jemanden für das, was er leiblich darbietet, lieben kann, dann habe ich ihn an diesem Abend geliebt.
Sofort nachdem die Lesung beendet war, sprang der hippelige Glatzkopf hinter mir auf und rannte wie unter Zwang ans Pult, seine Begleiterin im Schlepptau. Ich bin auch aufgestanden und nach vorn gegangen, nicht zuletzt weil mich die Szene interessierte. Der Mann drückte Hilbig einen eigenen Gedichtband in die Hand, duzte ihn, obwohl sie sich offensichtlich zum ersten Mal sprachen. Man sah ihm deutlich an, wie schwer er mit dem Eindruck der Lesung, mit seinen Neid zu kämpfen hatte. Es gelang ihm nicht ganz, er machte eine missgünstige Bemerkung, die Hilbig mit einer süffisanten Antwort konterte. Die Treffsicherheit dieses Konters verblüffte mich. Diese Fähigkeit, einen präzisen, fast tückisch raffinierten verbalen Schlag zu setzen, habe ich dann noch einmal während eines Empfangs auf dem Salon de Livre in Paris 2001, beobachtet, und war erneut überrascht. Es kam mir ein bisschen vor, als erwache der trickreiche Boxer, der er als junger Mann gewesen war, noch einmal in Worten zum Leben.
Lohse: Haben Sie ihn nach dieser ersten Lesung angesprochen?
Klein: Ja, wir haben uns bei zwei Gläsern Wein über seine Texte unterhalten. Es ging uns, trotz seines Fieber und trotz meiner Befangenheit, gut dabei. Mein Vorgänger, mein Kollege, hatte ja alles Ungute schon wie ein Sündenbock auf sich genommen.
Lohse: Danach sind Sie mit ihm im sporadischen Kontakt geblieben?
Klein: Wir schrieben uns hin und wieder. Er war ein unzuverlässiger Briefpartner, einer, der Briefe oft mit großer Verzögerung und nur mit einer chaotischen Karte beantwortete. Aber er hat regelmäßig in Berlin gelesen. Es war fast immer so, dass diese Lesungen schlecht besucht waren und dass es im Anschluss problemlos möglich war, mit ihm ins Gespräch zu kommen und auch mit ihm und den Veranstaltern wegzugehen.
Lohse: Eine merkwürdige Diskrepanz. Seine Lesungen waren auf der einen Seite so schlecht besucht, auf der anderen Seite wurde er mit Preisen und Stipendien geradezu überhäuft.
Klein: Ein betriebsüblicher Widerspruch: Autoren, denen die Kritik reichlich Geltung zuweist, haben keine Leserschaft, deren Zahl dieser Bedeutung quantitativ entsprechen würde. Ich denke, Wolfgang Hilbig hatte nie ein größeres Publikum. Die Bücher von ihm, die halbwegs häufig über den Ladentisch gingen, also die Romane Ich und Das Provisorium, profitierten von Missverständnissen. Sie wurden als aktuell, als Buch zu einem Thema propagiert und vermarktet. Das hat mit etwas Glück zu einigen Tausend Fehlkäufen geführt. Aber dauerhafte Leser wurden dadurch nicht gewonnen. Die Hilbig-Gemeinde ist momentan kleiner als damals.
Lohse: Können Sie sich erklären, wie der Arbeiter Wolfgang Hilbig zu seiner literarischen Sprache gefunden hat?
Klein: Ich denke, er muss schon ganz früh den Schutzraum des Lesens, die Verbunkerung im fremden, dann im eigenen Text gesucht und gefunden haben. Rätselhaft, wie er den Mut gefunden hat, schon als Junge selbst zu schreiben. Irgendjemand muss ihm glaubwürdig liebevoll zugehört haben. Das Meiste ist wohl angeborenes Genie: eine starke mimetische Begabung. Kunst kommt in der Regel von Kunst-Nachmachen. Dazu ein Schuss Aberwitz oder Tollkühnheit…
Lohse: … zu dem eine bestimmte Wahrnehmungsgabe gehört?
Klein: Wenn die Intensität der Wahrnehmung, die Deutlichkeit des Wahrgenommenen ein bestimmtes Maß übersteigt, ist das ein Fluch. Ich habe Hilbig oft genug mit einer Art Tunnelblick erlebt. Wahrscheinlich ging es immer eher darum, sich vor Eindrücken zu schützen als diese zu vertiefen. Ich glaube nicht, dass er je an einer getreuen Abbildung irgendwelcher Verhältnisse oder Zeitläufe interessiert war.
Lohse: Hat er unter der Maschinerie des Literaturbetriebs gelitten?
Klein: Die durchschnittlichen, gar nicht spektakulären Erwartungen des Betriebes waren für ihn Strapazen: Sich eine Fahrkarte zu kaufen, in irgendeine Stadt zu fahren und dort in einer Buchhandlung vor acht freundlichen, Literatur liebenden Frauen zu lesen, die geduldig ausharrten, obwohl sie doch lieber etwas Eingängigeres gehört hätten. Dann, nach vier Stunden, sind Pflicht und Kür vorbei. Aber Mitternacht ist für den Nachtarbeiter Hilbig früh am Abend. Schlafen kann er nicht, also geht er in die Bahnhofskneipe oder in irgendeinen Imbiss, isst einen Döner und trinkt ein Bier nach dem anderen mit Leuten, die um diese Zeit an solchen Orten auflaufen. So hat er es mir zumindest erzählt, und das Ganze als etwas Zehrendes beschrieben.
Als Schriftstellerdarsteller habe ich ihn eigentlich immer unter Stress erlebt. Auch die Manuskriptproduktion, das Einhalten von Abgabeterminen setzte ihn unter Druck. Der Verlag wollte natürlich regelmäßig etwas von ihm haben, am liebsten romanähnliche Texte. Seine Stärke lag aber auf der kurzen und mittleren Distanz. Diese Textgrößen entsprachen auch mehr der Arbeitsweise, die er sich angewöhnt hatte, dem Wiederaufnehmen uralter Anfänge, dem Vollenden von verjährten Fragmenten, dem scheinchaotischen System mit Schulheften und losen Blättern.
Lohse: Kann man sich dem Druck des Literaturbetriebes überhaupt entziehen?
Klein: Hilbig gehörte zu den Autoren, die vom Betrieb leben – wie die meisten guten Schriftsteller in Deutschland. Für diese finanzielle Absicherung, meist auf bescheidenem Niveau, werden bestimmte Gegenleistungen erwartet: Wenn man ein Aufenthaltsstipendium bekommen hat, muss man am fraglichen Ort auch präsent sein. Wenn ein Lesungstermin ansteht, sollte man pünktlich und in akzeptabler Verfassung antreten. Wenn die Bücher eines Autors wenig Geld einspielen, erwartet der vorschusszahlende Verlag, dass er eine Geltungsfigur abgibt und sein symbolisches Kapital auf den einschlägigen Bühnen mehrt.
Als Hilbig Stadtschreiber in Bergen-Enkheim war, durfte er sich auch einen Autor zu einer Lesung wünschen. Es hat mich sehr gefreut, dass er mich damals einladen ließ. Aber dann saßen wir spätnachts in seinem Stipendiatenhäuschen, auf Stühlen, deren Bezüge schon mancher Vorgänger abgewetzt hatte. Hilbig spielte mir Kassetten mit Songs vor, die ihm Freunde aufgenommen hatten. Ich denke, er wünschte sich an solchen Niemandsorten oft weg in jene Zeiten, in denen er noch nicht Adoptivkind des Literaturbetriebs war. Gleichzeitig wollte er natürlich nicht wirklich zurück an die Küchentische dieser voröffentlichen Existenz – zu sehr hatte er sich an die neue Versorgung und auch an die Aufmerksamkeit und die Hilfe derer, die es gut mit ihm meinten, gewöhnt. Also hielt er durch, so gut, wie es eben ging. Auch wenn das unter Umständen bedeutete, dass der Vortrag des eigenen Textes zur Tortur wurde. Ich habe ihn oft wie einen Leseautomaten erlebt – wie einen unglücklichen Automaten.
Lohse: Ist der Druck, den der Literaturbetrieb auf Hilbig ausgeübt hat, nicht auch der Motor für neue Texte gewesen?
Klein: Das ist schwer zu beantworten. Man kann spekulieren, was geschehen wäre, wenn er den Sprung in den westdeutschen Literaturbetrieb nicht geschafft hätte. Ich vermute, dass diese Integration, diese anhaltende Spiegelung, zumindest stabilisierend auf ihn und damit auch auf seine Produktion gewirkt hat.
Lohse: Wie ist er mit seiner Begabung, seinem Erfolg umgegangen?
Klein: Vor einigen Jahren bin ich nach einer Veranstaltung im Hamburger Literaturhaus noch mit ihm zusammen in eine Kneipe gegangen. Wir unterhielten uns über Lyrik und er lobte gleich eine ganze Reihe passabler deutscher Lyriker über alle Maßen. Eine Weile hörte ich mir das an und sagte schließlich:
Sicher sind das keine schlechten Leute, aber du kannst das, was die schreiben, doch nicht mit deinen besten Sachen gleichsetzen.
Er wurde ganz still, beugte den Kopf zu mir herüber und flüsterte:
Georg, komm hör auf damit! Ich weiß schon, was du meinst. Aber das macht mir richtig Angst!
Ich denke, insgeheim oder in bestimmten Schaffensmomenten war ihm die überragende Qualität seiner Texte schon bewusst. Aber die Größenerfahrung hatte eben auch etwas Schreckenerregendes, vielleicht sogar Grauenvolles, weil die Identität Sprengendes.
Lohse: Welche Rolle spielte der Alkohol in seinem Leben und Schreiben?
Klein: Ich erinnere mich an Phasen, wo er sich tapfer an seinem Mineralwasserglas festhielt. Aber ich habe auch zwei, drei qualvolle Abende und Nächte mit ihm erlebt, in denen sein freundliches Verhalten unter dem Einfluss von Alkohol dissoziierte und sich zu anderen, weniger angenehmen Verhaltensmustern neu zusammensetzte.
Als sein letzter Erzählband erschienen war, durfte ich eine Lesung von ihm moderieren. Wir trafen uns bereits am Nachmittag in seinem Hotelzimmer. Er kam von einer Goethe-Lesung aus dem Ausland, hatte mehrere Nächte nicht geschlafen und machte einen schlimm mitgenommenen Eindruck. Er bestand darauf, mit mir noch vor der Lesung etwas trinken zu gehen. Ich riet ihm zu Kaffee, er bestellte sich – obwohl schon angetrunken – Rotwein. Wir machten aus, eine seiner Erzählungen gemeinsam zu lesen. Für mich war es ein Akt der Verehrung. Aber als ich dann während der Veranstaltung dran war, suchte er grimassierend Blickkontakt mit dem Publikum. Auch während des anschließenden Gesprächs mühte er sich witzelnd um Schulterschluss mit den Anwesenden, gab ganz seltsam spitze Antworten. Als ich ihn Stunden später unter vier Augen fragte, warum er sich so verhalten hatte, sagte er, er könne sich schon nicht mehr an unseren Auftritt erinnern.
Lohse: War diese Lesung das letzte Mal, wo sie ihn gesehen haben?
Klein: Es war das letzte Mal, dass ich einige Stunden mit ihm verbracht habe. 2004 schickte ich ihm noch ein Exemplar meines Romans Die Sonne scheint uns, für das er sich mit einer Karte bedankte. Die letzten Spanne bis zu seinem Tod habe ich ihn nicht mehr gesehen und hatte auch sonst keinen Kontakt mehr zu ihm.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Frauen – ein heikles Kapitel im Leben des Dichters? Auf die Suche nach Wolfgang Hilbigs Verhältnis zu Frauen in Werk und Leben gehen: Katja Lange-Müller (Frauen und „Die Weiber“), Kerstin Hensel (Moderation), Nancy Hünger (Hat Hilbig eigentlich Liebesgedichte verfasst?), Margret Franzlik (Hilbig – persönlich). Veranstaltung vom 20. Juli 2021 im Literaturhaus Leipzig
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Katrin und Volker Hanisch: Gespräch über Wolfgang Hilbig
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, 3.8.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Interview + KLG + IMDb +
YouTube + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die WindeDie Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003



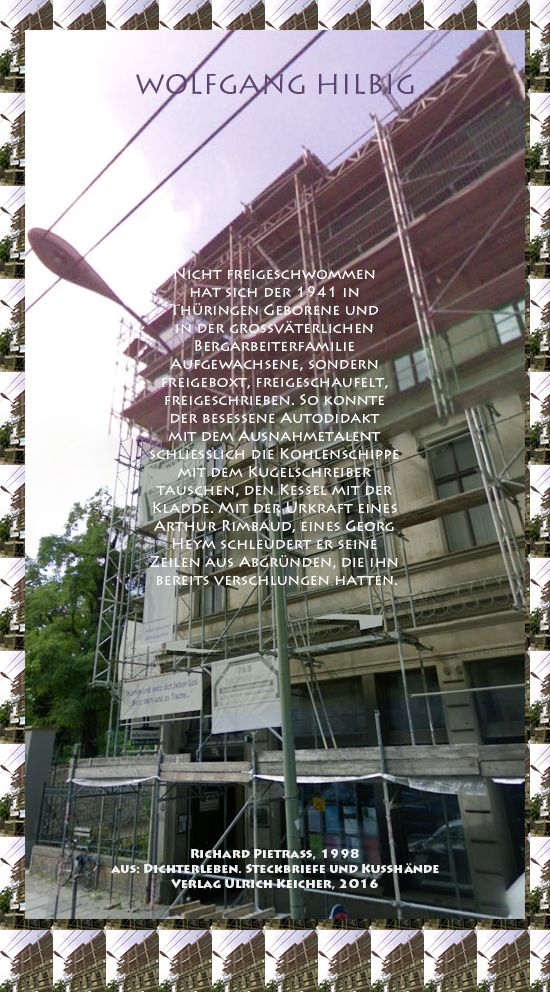












Schreibe einen Kommentar