Wulf Kirsten: Stimmenschotter
DER GRILLENFÄNGER
am feldrain saß der grillenfänger
und zwirbelte selbstvergessen seinen halm
unverrückt mit verzückter fängerhand.
alle hügelbänke endlos weit gefeldert,
mit acheln und stacheln bewehrte gefilde,
woge um woge im grannenhaar kornschwer gesetzt.
die quergelegten furchenhäupter
verschäumen den erhitzten duft wilder kamille,
nicht auszurotten der bauern ungebetnes weiß.
im queckenacker ruht der unkrautsiegel.
für eine kleine mittagsstunde ist der sommer
am wegrand übermüdet eingeschlafen.
grille, laß dich aus der erde mundloch locken,
im kurzen schatten des einmaligen tags
liegt der müßiggänger auf der lauer.
das schweigen zwischen der erde und den dingen
hat sich ermattet in den staub geworfen,
am feldrain saß der grillenfänger.
Poesie mit Narben der Geschichte
– Wulf Kirsten rechnet in seinem neuen Gedichtband Stimmenschotter mit Apparatschiks und Sprücheklopfern ab. –
Nach sechsjährigem Schweigen meldete Wulf Kirsten sich jetzt mit neuen Versen zu Wort. Sein letzter, 1987 im Leipziger Reclam Verlag erschienener Gedichtband die erde bei Meißen, der noch starke Bezüge zu Peter Huchel und Johannes Bobrowski spüren ließ, enthielt originelle und eigenständige Naturlyrik, die im deutschen Sprachraum ihresgleichen suchte.
Daß der Autor die politische Realität in der DDR weitgehend ignorierte und sich kaum am kurzlebigen Tagesgespräch beteiligte, verlieh seinem Werk bereits damals einen Zug von Dauerhaftigkeit und Beständigkeit. Die „weggedichtete Wirklichkeit“ erwies sich zu einer Zeit als Trost, da auch Kirsten nicht wußte, „für wen noch das schweigen aufreißen monat um monat mit lettern, wo längst alle auf gepackten koffern sitzen und danach trachten, landesabständig zu werden“.
Auch in der nun vorliegenden Sammlung zeigt der Autor sich weit entfernt von glatter Polemik. Konsequent hat er sein poetisches Konzept fortgesetzt. Noch immer ist seine Bilderwelt fixiert auf Landschaften, historische Ereignisse und große Persönlichkeiten aus Kunst und Philosophie. Aber die Horizonte haben sich geweitet – der aus dem „häuslerwinkel“ von Klipphausen stammende Sachse sieht jetzt über die Mauern seiner „betont bäuerlich-handwerklichen Welt“ (Eberhard Haufe) hinweg. Der „heimatliche muff und schluff“, in dem ihm so viele grandiose Motive begegneten, verlor mittlerweile an Priorität.
Kirsten überwand eine Enge, deren Metaphern teilweise ausgeschöpft waren. Jetzt läßt er den Leser eintauchen in „sommergesichte“ aus Altmecklenburg, in die Septemberstimmung am Ettersberg, in die herbe Schönheit des Thüringer Orlatals. Er streift mit Freunden durch die Orte Nietzsches zwischen Röcken und Weimar, fühlt sich ein in Luthers Ära, porträtiert Johann Christian Günther.
Doch die Flucht vor dem abgegriffenen Vokabular macht den Dichter nicht zu einem entrückten Ästheten. Kirstens Arbeiten tragen die Narben der Geschichte, sie sind zerfurcht von der Wucht des gesellschaftlichen Umbruchs. Man muß zumeist tief in diese Strophen hineinleuchten, um ihre Botschaft als Zeichen der Zeit zu verstehen.
Selten reflektiert Kirsten die Erstarrung der untergegangenen DDR mit so frappierender Deutlichkeit wie in den Gedichten „Muttersprache“ und „Zuspruch“. Hier bietet er sein ganzes gestalterisches Instrumentarium auf, um die Verlogenheit der sozialistischen Ideologie bloßzustellen.
Voller schmerzlicher Ironie entlarvt er die Apparatschiks, denen es gelang, mündige Menschen in „mechanische bürger ohne wandlungsbedarf“ zu verwandeln. Den Staatsfunktionären mit ihrem „administrativen Instinkt“ lastet er es an, das Weltbild der Masse „auf seh-schlitzformat gesundgeschrumpft“ zu haben. Die Abrechnung mit den „bestellten wohlbestallten claqueuren“ und den „sprücheklopfern“ gerät fast zum Ritual einer Anklage.
Es geht Kirsten jedoch auch um die Verbiegung der Sprache, um das verarmte Amtsdeutsch, das SED-Bonzen pflegten. Erinnerungen an Viktor Klemperers Analyse der LTI kommen auf, wenn er sarkastisch davon redet, daß „quadrierte parolen zur herzenssache von sekundären analphabeten“ erhoben wurden.
Gleich Hanns Cibulka und Heinz Czechowski ist Kirsten sensibel für die „konjunktur rückläufiger natur“. Ökologische Probleme besitzen einen zentralen Stellenwert in seiner Dichtung. Ihn bedrückt der wachsende „brandfleck im teppich der natur“. Daß die „erdoberfläche abgespellt aufgerissen, vertrichtert“, daß die Wüstungen sich ausdehnen, stimmt ihn schwermütig. Am Ende bleibt eine Ohnmacht, gegen die keine Beschwichtigungen helfen.
Sprachlosigkeit, wie sie den modernen deutschen Lyrikern von Reiner Kunze bis zu Günter Kunert zu schaffen macht, setzt auch Kirsten Grenzen. Seine poetische Substanz wirkt „zersungen, zermalmt“; die Chancen, sich nicht zu wiederholen, unbenutzte Ausdrücke für bereits bekannte Vorgänge zu entdecken, schwinden. Er sieht den „Stimmenschotter / im versiegenden flußbett“, er hat das Sagbare gesagt und dabei eine Leere in sich erzeugt, die mit dem Alter wächst.
Wittgensteins berühmtes Diktum rückt für ihn in greifbare Nähe: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ Bleibt zu wünschen, daß Kirsten der Melancholie trotzt und nicht in der Stille versinkt.
Ulf Heise, Neue Zeit, 19.10.1993
Halt auf freier Strecke
Der Titel weckt die Vorstellung einer großen Zahl undeutlicher Stimmen. Wer Kirstens frühere Arbeiten gelesen hat, mag hier eine Verlagerung der Gewichte vermuten. Für die Alltagssprache ist Schotter fast nur das Produkt industrieller Arbeit, die gewachsenes Material nach Normen destruiert. Es ist nicht anzunehmen, daß der Autor nicht wenigstens die Möglichkeit einer solchen Assoziation gesehen und somit in Kauf genommen hat, daß sich durch das Wort die Welt der großen Städte, der modernen Verkehrswege und der durch dies alles geprägten Kommunikationsweise in die Phantasie des Lesers drängt. Lesen wir dann das Gedicht, das den Titel geliefert hat, werden wir durch den Wortforscher Kirsten korrigiert; er erinnert uns daran, daß „Schotter“ zuerst das Geröll war, das Flüsse ständig produzieren, verändern und transportieren, bis es endlich als Lage nur noch an den ehemaligen Fluß erinnert; erst für diesen Zustand des Gerölls ist der Name gebräuchlich.
Das Gedicht trägt die Jahreszahl 1987. Es spricht aus einem Befinden heraus, das unverkennbar durch Mißvergnügen am Leben in der DDR geprägt wurde, aber diese Feststellung liefert keinen zureichenden Grund, es in das Fach unserer Verständnismuster abzulegen, in dem die Zeugnisse der Vergangenheit oder der Auseinandersetzung mit ihr untergebracht sind. Wenn es überhaupt möglich ist, die geschichtliche Dimension dessen poetisch zu erfassen, was in den letzten Jahren geschehen ist, finden wir in diesem Band eine Ahnung davon. Stimmenschotter ist im Bett eines versiegenden Flusses zu vernehmen, in einem „versiegenden Flußbett“, wie es Kirsten sagt. Endzeit und Untergang werden in diesem Band mit einem Engagement artikuliert, das von gestern sein mag, das jedenfalls zu den konstitutiven Momenten dieser Dichterpersönlichkeit, dieses Werks gehört und nach wie vor seine Produktivität erweist.
Im ersten Text dieses Doppel-Gedichts, der keine finite Verbform enthält, heißt es:
die umgeschuldeten mißerfolge
in den gebetsmühlen aufrecht
zersungen, zermalmt.
Aus solchen Textelementen wäre eine Neujahrsrede zur Jahrtausendwende zu montieren, wenn sich ein Redner fände, der dem Schönfärben so wenig geneigt wäre wie dieser Dichter. Es bedarf wohl des skeptischen Hintergrunds, um die Werte begreifen zu können, welche sein Werk tragen, Der „halt auf freier strecke“ mag vielleicht nicht als freundliche Metapher für den „aufenthalt auf erden“ gelesen werden; wer einigermaßen aufmerksam die Bilder durchgeht, die der den Malern geneigte Dichter hier reiht, findet eine herbe Schönheit, die nicht nur für die Unvergnügtheit ihres Urhebers spricht. Und dann gibt es „die schaukel“, ein Gedicht, das dem Leser mit einer Vollkommenheit begegnet, bei der man nicht zu unterscheiden vermag, ob sie die der Welt oder die des poetischen Bildes ist. Hier hat Kirsten ganz eigenständig und auf hoher Ebene eine Motivtradition weitergeschrieben, die ihn mit Clemens Brentano verbindet. Selbst der Reim ist nun möglich („gartengrasmücke“), obgleich er sehr vorsichtig und wie mit schlechtem Gewissen verwandt wird. Man könnte auch von Dezenz und Genauigkeit sprechen, von der Ausstellung des Bemühens, die poetische Notwendigkeit der in der Gegenwart so wenig geschätzten Form für diesen Text evident zu machen.
Wenn der Leser an Kirstens poetische Arbeiten denkt, erinnert er sich wohl zuerst daran, daß ihn die meisten von ihnen an die Erde verwiesen, an ihre landschaftlichen Individuationen. Dieser Dichter ist von Anfang an – um mit dem Philosophen zu sprechen, der nun auch in seiner Poesie bedacht wird – der Erde treu geblieben. Allerdings gehörten zu seinen Landschaften überall die Menschen; er war ihnen nahe, jedenfalls bezeugen dies seine Texte. Er sprach nicht nur von ihnen, gab nicht nur Bilder ihrer Weisen, mit dem Leben zurechtzukommen. Als das Besondere seiner Dichtungen lernten Kirstens Leser seine Sprache schätzen, die in Klang und Wortschatz der Redeweise nachgebildet schien, die er den einfachen Leuten seiner Region abgelauscht hatte und deren Ton in seinen Gedichten sorgsamer bewahrt wurde als die märkischen und preußischen Klänge in den Texten der oft genannten Vorbilder Huchel und Bobrowski. Daß der Schein mit beträchtlicher Kunst erarbeitet worden war, haben die Gedichte nie verschleiert. Vor einigen Jahren konnten wir Bemerkungen des Dichters über Stefan George lesen, aus denen ein deutliches Gefühl der Verwandtschaft sprach. Was Kirsten da Georges „Kunstgriff“ nannte, „der Lyrik eine neue, unverschlissene Sprache zu geben“, ist unübersehbar sein eigener „Kunstgriff“; ihm ging es weder um die Bewahrung und Pflege eines der untergehenden Dialekte, noch um eine „volkstümliche“ Dichtung. Oder es ging ihm doch darum, aber dann nur in dem Sinne, in dem sich romantische und neuromantische Erneuerer der Poesie als Vorbereiter einer Zukunft sahen, in welcher eine ganz andere Übereinstimmung zwischen dem Dichter und denen bestehen würde, die in Stimmenschotter mit deutlichem Anklang an die Sprache Georges als „die mitglieder der menge“ bezeichnet werden. Die Hoffnung auf eine solche Annäherung – die sich in Kirstens Gedichtbänden nie aufdringlich zeigte – scheint nun noch geringer zu sein. Wenn der in einem anderen Deutsch aufgewachsene Leser auch nach wie vor an seiner sprachlichen Kompetenz zweifeln muß, wird er doch nicht übersehen, daß sich die Sprache dieses Bandes weniger um die Verbindung zur regionalen Rede sorgt als die der früheren. Wahrscheinlich haben Bewohner der Landschaft bei Meißen nicht geringere Schwierigkeiten mit der Lektüre der Texte als andere deutsche Leser. (Es wäre aber doch günstiger gewesen, auch in diesen Band die Worterläuterungen aufzunehmen, die wir aus anderen Kirsten-Sammlungen kennen.)
Eine größer gewordene Freiheit gegenüber dem Wortmaterial findet nun in der Elastizität der Verse ihren Ausdruck. Auch der mit guten Wörterbüchern ausgestattete Leser wird gelegentlich vor Bedeutungsunschärfen kapitulieren, und in diesem Augenblick mag sich das Verständnis ihrer Leistungen einstellen. Die Wörter erscheinen nicht mehr wie kostbare Perlen, die auf einen syntaktischen Faden von geringerer Solidität gereiht wurden, wie es dem Leser doch jedenfalls bei einigen der früheren Gedichte vorkam, sie fügen sich aber keineswegs ohne Widerstand in die Gebote der höheren Ordnungen. In seinem ersten Band sprach Kirsten von „Wortfeldern“; die Prägung nahm das Bild der bestellten Bodenfläche auf. Jetzt entstehen zunehmend „Felder“ in einem gleichsam jüngeren Verständnis, Energien in mehrdimensionaler Wirkung. Die Wörter stützen und stören die syntaktischen Gefüge, die somit sehr viel offener sind für den Zugang des Lesers, für das, was er in den Aufnahmeprozeß bringt.
Es wäre interessant zu untersuchen, ob diese Veränderung mit den größer gewordenen Möglichkeiten des Dichters zu tun hat, bisher unzugängliche Landschaften zu sehen. Eine Reihe von Gedichten könnte eine derartige Vermutung stützen. Schaut man jedoch genauer hin, so wird man eigentlich nur in der Ansicht bestärkt, daß die wettinischen Lande mit ihren Bildern und Tönen wichtig geblieben sind, daß ihr Potential mit einer reicheren und weiteren poetischen Welt mitgewachsen ist. Auch hier könnte man anders formulieren: Der Band zeugt für die – einst ja nicht unumstrittene – Fruchtbarkeit des Weges, den Kirsten mit seinen ersten Gedichten einschlug. An Gedichten mit verwandter Thematik kann man die Wandlungen und die aus ihnen resultierenden Gewinne überzeugend demonstrieren, Solche Demonstrationen lassen aber zu leicht übersehen, daß die früheren Werke durch die Wandlungen des Ensembles, in dem sie nun stehen, in anderen Beleuchtungen erscheinen, neue Zugänge erhalten.
Der Band wird es nicht leicht haben; es bedarf wiederholter Lektüre dieser Gedichte, um ihre Schönheiten im rechten Licht sehen zu können. So ist er eigentlich unzeitgemäß, und das gilt auch für seine Gestaltung; vom Umschlag bis zum Einband und zum Satz erinnert alles an etwas, das immer seltener wird: die Alltagsform des schönen Buches.
Rüdiger Ziemann, neue deutsche literatur, Heft 493, Januar/Februar 1994
Wulf Kirsten • Stimmenschotter • Gedichte
„Entwurf einer Landschaft“ ist der Titel des kurzen Essays, den Wulf Kirsten seinem ersten Gedichtband satzanfang beigefügt hat: „Sein Thema finden heißt zu sich selbst finden.“, heißt es dort, Naturnähe wird zum „Raum des Menschlichen“, und von den „Leuten ohne Resonanznamen“ geht die Rede. Diese frühe Vergewisserung seiner Absichten und Möglichkeiten ist für Wulf Kirsten und seine Dichtung lange, in wesentlichen Motiven vielleicht bis heute, bestimmend geblieben, und die Gedichte des neuen Bandes Stimmenschotter sind die vorläufig letzten Erscheinungen auf diesem Weg; ein Weg, der Wandlungen unterworfen war, von der inständigen und hoffnungsvollen Landnahme bis zu den bitteren Bilanzen, die wir in den neuen Gedichten vor uns haben.
Kaum ein Dichter der Gegenwart hat seine Dichtung so konsequent auf „Grundworten“ aufgebaut, die, in Zusammenhänge gebracht, das Sinngefüge ergeben, wie Wulf Kirsten, denn: „Im Wort selbst liegt der Anfang der Poesie…“; eine Maxime, die gültig bleibt, wenn auch die Beziehungen andere geworden sind. Die Gedichte Wulf Kirstens laufen in die Tiefe der eigenen Biographie, sachlich und beschwörend, traumverbunden und gegenwartbesessen: Erinnerungen, die auch Erinnerung an eine verschüttete Zukunft sind; fortlebend und zugleich begraben, zitternd an den unruhigen Wurzeln, die ihre Motive behalten, in scheinbar unerschöpflichen Bildern zur Sprache gebracht: eine Spurensuche, die auch dort fündig wird, wo die Spuren kaum noch zu finden sind, von Raum und Zeit überwuchert und manchmal verschlossen, mit der zweifelnden Frage am dichterischen Grund:
… in der dunkelheit schwimmen dörfer,
die an faden lichtern glimmen.
… wo haben wir wirklich gelebt?
„… wo haben wir wirklich gelebt“, und was ist geworden? Die Arbeit vor der Natur bringt es vor unsere Augen und an den Tag „… wo die menschen / schweigen, reden die steine…“, heißt es in dem „LETZTE KLARHEIT“ benannten Gedicht – reden die Landschaften, die Wulf Kirsten gesehen, in sich aufgenommen und verwandelt hat. Es sind die verletzten Landschaften, die für die verletzten und schweigenden Menschen sprechen, im Augenblick, in der Erinnerung und jenen geschichtlichen Räumen, die nicht aufhören fortzuwirken und der stete Grund alles Gegenwärtigen sind. Der Augenblick kann so zum Ganzen werden: in Bildern der Wanderungen und Reisen, in den Portraits der Wahlverwandten, die Ähnliches erlebt und erlitten und – standgehalten haben, wie Johann Christian Günther:
… das ist die welt der krämer, in der sich alles, alles rechnen muß. halt aus!
Es sind die kleinen Leute, die die Sympathie des Dichters haben, und seine harsche Ironie, seine Wortspiele und Wortbedeutungen gelten den Verhältnissen, die die Natur und die Menschen gleichermaßen mißbrauchen, ihre Wege verstellen und einebnen, so daß am Ende auch die Worte an jene Grenze kommen, wo sie ohnmächtig sind: „… alle worte sind verloren mit den dingen, / die der große schlingschlang fraß.“; mit Folgen auch für die Menschen, die solches Treiben, als Fortschritt getarnt, in sich aufnehmen, fast ohne es zu bemerken, denn längst ist „… das weltbild / auf schschlitzformat gesundgeschrumpft…“ Eine Fülle von umgangssprachlichen Worten und Wendungen hat in diese neuen sarkastischen und auch satirischen Gedichte Wulf Kirstens Eingang gefunden, freilich jedes an seinem bedeutenden, Sinn und Zusammenhang stiftenden Platz. Die Gegenwelt scheint schmaler geworden zu sein, die Entfremdung größer, mit dem Widerspruch, der gewachsen ist: Und doch hebt das Mädchen mit der Schaukel noch immer… „den frühling / in den himmel.“, und der Himmel gibt die Schaukel der Erde zurück; und auch jenes Statisten wird gedacht, der ausgehalten und „ein leben lang / nichts als statist gewesen…“ ist, ein Vorgang, dem der Dichter mit Achtung begegnet und den er in der Sprache aufgehoben hat:
… gedenket seiner
ohne ranküne.
Jedoch scheint es immer schwerer zu werden, die Worte zu finden, wo sie zusammen mit den Dingen verblassen und sich manchmal ganz in sie zurückzuziehen scheinen: in einer stillstehenden Zeit, die ihr Wesen verloren hat und nur noch ihr Unwesen treibt in den zurückgebliebenen Resten; so daß mitunter das „reine Nichts“ von den Worten gebannt wird und wie eine leise Fanfare zu uns herüberklingt:
… auf einer staubsäule
fahrn
in das himmelreich!
Eine bittere Bilanz, auch nach jenen Jahren, die den steten Fortschritt auf ihre Fahnen geschrieben hatten. In den programmatischen Gedichten „MUTTERSPRACHE“ und „ZUSPRUCH“ wendet Wulf Kirsten sich dieser Zeit zu, zugleich dem eigenen Wachsen und Werden:
der fluß der glorreichen zeit rinnt ätzend durch die kehle,
ein mensch, wie stolz… ist das maß aller… voll bis
zum strich, der einmal geeicht war…
Erstmals in seinem Werk kann man hier von politischen Gedichten Wulf Kirstens sprechen, wachsend aus dem Detail und allen unvergessenen biographischen Elementen; so daß Sprache und Wirklichkeit zu jenem Zusammenhang geführt werden, in den sie gehören, in langzeiligen und prosanahen Gedichten, die das Panorama kleiner Zeitalter in einander jagenden Wortspielen ausbreiten, Indiz auch für die Absurdität einer Epoche, die gerade hinter uns liegt. „… den unbequemen wahrheiten das wort und den weg abgeschnitten…“ – die Worte benennen den Verlust, der lange Folgen haben wird. Hier hat Wulf Kirsten sich neue Themen erschlossen, verbunden und verrätselt mit den früheren, die dem Band Gestalt und Bilder geben und zu jenen zeitüberspannenden Gedanken vordringen, zu einer im Büchnerschen Sinne beinahe endgültigen Bilanz:
aufenthalt auf erden.
halt auf freier strecke.
„POETOLOGIE“ heißt das Gedicht, das diesen Band abschließt, ein leiser prosaischer Gesang, ein kleines fragmentarisches Werk des Gedenkens, wenn man an die Schicksale jener denkt, die genannt werden und auch an all die anderen, zahllosen Bekannten und Unbekannten.
Markisch, Perez Dawidowitsch, aus Wolhynien, hat sich
schuldig gemacht mit versen auf jiddisch, das hat gereicht für
den tod durch den strang, not tat des felsens ganze härte, hieß es
in jenen jahren…
Erneut, wie schon einmal in Deutschland nach dem letzten Krieg, wird die Frage gestellt und angenommen, was Worte noch können, sollen oder dürfen… wir erfahren es aus den erstaunlichen Gedichten dieses Buches, aus ihrem Widerspruch, ihrem Gedenken, ihrem Zuspruch, aus ihrer Arbeit gegen das Vergessen, damit wir vom Wort nicht abkommen und die Wortlosigkeit das letzte Wort nicht behält:
… vom berg der ewigkeit
wird abgetragen
alle tage.
Wolfgang Trampe, Ostragehege, Heft 1, 1994
Erdzeit, Jahreszeit, Menschenzeit
– Thüringer Landschaft in Wulf Kirstens Gedichten. –
Wulf Kirsten hat wiederholt betont, zuletzt in dem hier veröffentlichten Essay „Landschaft als literarischer Text“, er sei kein „Naturdichter“, sondern „Landschafter“. Als Landschaft gilt ihm nicht jenes atmosphärisch-anmutungshaft sich entfaltende Gegenüber der Natur, das Joachim Ritter in Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux am 26. April 1335 als Ursprung nach antiken Naturerlebens auszumachen glaubte, sondern der vom Menschen bearbeitete, geformte, ja womöglich zerstörte Lebensraum, in dem ursprüngliche Natur inzwischen nurmehr randständig, residual gegenwärtig ist. Daher unterliegt Landschaft in seinem Verständnis qualitativ sehr unterschiedlichen zeitlichen Veränderungen: die Natur den gleichförmigen erdgeschichtlichen und jahreszeitlichen Rhythmen, die ihr Profil und Farbe verleihen, die Kultur den ungleichmäßigen Tempi der vom Menschen gemachten Geschichte, in der sich Phasen gedehnten Stillstands mit solchen reißender Veränderungen abwechseln. Die restaurativ verlangsamte und die revolutionär beschleunigte Zeit gehören als äußerste Möglichkeiten eines gleichsam aus dem Takt geratenen Verhältnisses des Menschen zu seiner eigenen Geschichte eng zusammen. Deren Gewalt ergreift zuletzt zerstörerisch auch das, was in der Landschaft noch an Natur geblieben ist:
VEILCHENZEIT
1
zur veilchenzeit über die hügelriffe, erdzeichen
gelesen im muschelkalk, wo die wolle wächst
aus rauher wurzel, der weidenzeile unten beigemessen
und ihrem wasserlauf, dem fortgetragenen murmeln
der quellgeister, im frühlingstrunkenen flor
grünts blütenschäumend auf, das schüttre flurgehölz
erweckt von winterharten anemonen, auf jeder wiesenwelle,
tief in den grund geduckt, die veilchenblauen polster,
der feuchte schrund vom maulwurf um und um geackert
und gehöckert, vom lerchenhimmel ausgetropft
das fahle morgenlicht im atmenden widerschein
des landstrichs unter meinen füßen.
2
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa„Vergiftet sind meine Lieder.“
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHeinrich Heine
das flurbuch aufgeschlagen, unwirsch die biosphäre.
im waldstück, wo vormals anemonen, wo veilchenblauer
schimmer, liegt alles rings zerstochen, panzerstände
ausgehoben mit dem spaten, verstümmelt und verstummt
sind meine areale, von erdumwälzern der heckenwuchs
zerstückt und ausgebrannt, was voller dornen rankte
und aufgekrallt an asphaltierter straße letzter ordnung,
liegt abgeschlagen kreuz und quer auf weg und wiesen-
streifen, durch die plantage hinterm maschendraht
ziehn giftig gelbe schwaden als frühlingsboten
über land, den unrat der agrarfabriken breit aufs
ackerland gekippt, das trinkwasser mit jauche versetzt,
stallweise weggeschüttet das nitratgemelk und wohin?
gott schenke uns allen ein säurefestes und abgashartes
gewissen, die alten dörfer hinter den hügelriffen,
tief in sich versunken, wollten ihr zeitliches
noch nicht segnen lassen, ach, sieh nur, wie die siechen
dort hängen, schicksalsergeben am selterswassertropf.
Im Inhaltsverzeichnis des mit Stimmenschotter überschriebenen Bandes sind alle Gedichte mit Jahreszahlen versehen; „veilchenzeit“ entstand demnach 1988, noch vor dem Zusammenbruch der DDR. Auch diesem Gedicht geht es, ohne daß die Metapher fiele, um eine „Wende“, eine andere als die politische, doch eine nicht weniger radikale. Sie vollzog sich unter abweichenden Vorzeichen auch außerhalb der DDR, hat nicht aufgehört, unser Leben zu prägen, und vermag Kirstens Worten außer dem ästhetischen Interesse an ihrer gestalthaften Prägnanz die Aufmerksamkeit jedes denkenden Zeitgenossen zu sichern.
Das Gedicht spricht nicht nur von einer Wende, sondern beschreibt in seinem Vollzug selbst die Bewegung eines Umschlags. Erster und zweiter Teil sind durch ein mehr als halbseitiges Spatium getrennt, das der Leser überdies durch Weiterblättern überbrücken muß. Das Heines „Lyrischem Intermezzo“ entnommene Motto gilt, ungewöhnlich genug, nur dem zweiten Teil und scheidet das Gedicht scharf in sehr unterschiedliche Hälften. Deren Numerierung ist keineswegs semantisch unbestimmtes Ordnungsprinzip, sondern stellt der These des ersten Teiles in bestimmter Negation die Antithese des zweiten gegenüber, ohne daß auch nur andeutungsweise die aufhebende – auf einer höheren Stufe bewahrende – Synthese einer dialektischen Versöhnung in den Blick käme. Zahlreiche negativierende Wiederaufnahmen unterstreichen die antithetische Struktur des Gedichtes, dessen Titel vom Schluß her gelesen in unaufhebbarer Ambivalenz, zwischen erinnerndem Preisen und sarkastischer Wut, zu stehen kommt: Den „winterharten anemonen“ und „veilchenblauen polster[n]“ antworten die Verse „im waldstück, wo vormals anemonen, wo veilchenblauer / schimmer, liegt alles zerstochen, panzerstände“; dem „wasserlauf, dem fortgetragenen murmeln / der quellgeister“ respondieren „trinkwasser mit jauche versetzt“ und „nitratgemelk“; die „weidenzeile“ wird zur „asphaltierte[n] straße letzter ordnung“. Die possessivpronominale Wendung „unter meinen füßen“, mit der im Schlußvers des ersten Teiles die Nähe der Landschaft zum aufmerksam wahrnehmenden, empfindungsfähigen Betrachter hervorgehoben wird, findet im zweiten Teil in den Halbversen „verstümmelt und verstimmt / sind meine areale“ eine klagend-anklagende Entsprechung.
Es macht wesentlich die Qualität von Kirstens Gedicht aus, daß es den Bruch zwischen der behutsam gepflegten Landschaft des ersten und der militärisch wie agrarindustriell verwüsteten des zweiten Teiles variierend auf der Grundlage eines lyrischen Idioms entfaltet. Zu ihm zählen – und damit sind wesentliche Mittel von Kirstens Lyrik überhaupt benannt – unter anderem die unregelmäßigen, ungereimten Verse, die ebenso wie die zahlreichen Enjambements durch entschiedene Betonungen das widerständige Einzelwort zur Geltung bringen; die subjektlos eingesetzten Partizipien des Perfekts; ungewöhnliche nominale und adjektivische Komposita; alliterierende wie auch rhythmische Verklammerungen von Wortbausteinen; eine diskrete Metaphorik wie die der im ersten und viertletzten Vers eingesetzten „hügelriffe“, die, mit dem „muschelkalk“ des zweiten Verses verbunden, die schonend gepflegte oder aggressiv verwüstete Landschaft des Gedichts in weiteste erdgeschichtliche – die menschliche Geschichte übergreifende – Bezüge stellt. Auf der Grundlage des gemeinsamen lyrischen Idioms – und nicht erst im Wechsel des Sprachgestus in den letzten fünf Versen – treten die Unterschiede umso deutlicher hervor: etwa zwischen den weichen, geradezu sanften Alliterationen der Verse zwei bis vier („[…] wo die wolle wächst / aus rauher wurzel, der weidenzeile unten beigemessen / und ihrem wasserlauf“) und dem die gewaltsame Zerstörung der Landschaft unterstreichenden Konsonantismus des zweiten Teiles („zerstochen, panzerstände“, „von erdumwälzern der heckenwuchs / zerstückt“, „kreuz und quer“), zwischen einem Vokalismus des Entzückens („grünts blütenschäumend auf, das schüttre flurgehölz“) und einem Vokalismus des Entsetzens („ziehn giftig gelbe schwaden als frühlingsboten“) oder auch – jeweils zu Beginn der beiden Teile exponiert – einer Metaphorik behutsamer Entzifferung des Landschaftstextes („erdzeichen / gelesen im muschelkalk, wo die wolle wächst / aus rauher wurzel, der weidenzeile unten beigemessen“) und einer Metaphorik besitzergreifenden, zerstörenden Lesens der Landschaft („das flurbuch aufgeschlagen […] / […] verstümmelt und verstummt“). Daß die ehemals vertraute Landschaft unvertraut geworden ist, kommt im zweiten Teil nicht zuletzt im Gebrauch irritierender Fremdwörter zum Ausdruck: „biosphäre“, „ashaltierte[r] Straße“, „agrarfabriken“, „plantage“ und, aggressiv gesteigert, „nitratgemelk“. Eine Metapher auch, „hügelriffe“, verklammert die beiden Gedichtteile. Zu Beginn mißt die Meeresmetapher, unterstützt durch den geologischen Fachbegriff „muschelkalk“, erdgeschichtlich wie in der räumlichen Vertikale (wo – unten – einst „Riffe“ und „Muscheln“ waren, ist nun – oben – Hügel, und die Verlängerung der Blickachse reicht, unausdrücklich, bis an den „lerchenhimmel“ hinan) die Landschaft aus, während sie am Ende mit dem Halbvers „tief in sich versunken“ die Vorstellung des drohenden Untergangs freisetzt: Die äußerste Brennweite der Bildlichkeit ist nun der gebannten Nahsicht auf die „am selterswassertropf“ hängenden „siechen“, „die alten dörfer“, gewichen.
Genaue Orts- oder Flurnamen fehlen in „veilchenzeit“, doch dem Gedicht mangelt es keinesfalls an kulturräumlicher Bestimmtheit. Mag der Leser an das Panzerübungsgelände auf der nordwestlichen Saaleseite oberhalb von Jena, an Massentierhaltung auf den südlichen Höhen gegenüber Engerda bei Großkochberg oder, wie nach einer freundlich gewährten Auskunft, der in Weimar ansässige Dichter selber, an zerstörte Landschaft südlich und westlich des Ettersbergs denken – unzweideutig, wenngleich alles bloß Mimetische überschreitend, ruft das Gedicht Thüringer Landschaft herauf.
Ebenfalls aus dem Band Stimmenschotter stammt ein 1991/92 entstandenes Gedicht, das nicht nur im Titel eine genaue Ortsangabe macht:
FELDWEGS NACH ORLAMÜNDE
eine schlichtwollige landschaft
wirrsträubig gebauscht und verbuscht,
fehlsiedlungen in dorn und weiden,
welt vor dem ziegelschlag,
hungerfleckig verdistelt und verhedericht,
lichtüberfluß von ungefähr, namen über namen,
nicht zu vergessen den guten heinrich
des Jacob Grimm, der klappertopf
frißt das brot
noch von den backschaufeln herunter.
das himmelreich gleicht einem senfkorn,
man soll das wort gottes
nicht unter die ofenbank schieben,
wo nichts zu worfeln noch zu schwingen,
wo keiner den feldfrieden bricht.
der untere strümpfel weiß noch
von flurumzügen, wie der aberglaube
hoch zu roß um den flauer geritten.
saalüberwärts ins Orlatal geblickt,
ein biergarten schäumt
unter endlos zerdehnter traueresche.
im abendschein
durchs alte stadttor ziehn,
wenn aus den laubkronen unten
der pirol dir die kindheit zurückruft,
als wär die dreimal gewendete zeit
neunmal stehengeblieben
in der stadt auf dem riff
zwischen Pfisters gehöft
und kemenate, im rost verlummert
und schamstumm erstickt.
Orlamünde ist ein zwanzig Kilometer südlich von Jena auf dem westlichen Saaleufer gelegenes Städtchen, mit einer sanft ansteigenden Unterstadt und der historischen Oberstadt auf dem Rücken des über ihr schroff aufsteigenden Bergsporns aus Muschelkalk. Von der Oberstadt schaut man auf die meist gemächlich in langen Schleifen dahinfließende Saale und das jenseits, „saalüberwärts“, gegen Osten sich hinziehende Orlatal, dessen Wasserlauf sich in die Saale ergießt. Die zweite Strophe nimmt vielfach auf die historische Oberstadt Bezug: Die aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts stammende „kemenate“, mit bis zu drei Metern dicken Mauern, diente einst wohl vor allem als Wehrturm einer Grenzburg gegen die Slawen östlich der Saale. Sie ragt eindrucksvoll als, abgesehen von Mauerresten, einziges Zeugnis jener Zeit in die Gegenwart. „Pfisters gehöft“ war ein – inzwischen, nach Entstehung des Gedichtes, wegen Baufälligkeit abgerissenes – Anwesen. Und nicht nur das „alte stadttor“, sondern auch der Biergarten „unter endlos zerdehnter traueresche“ nimmt konkret auf die Oberstadt Orlamündes Bezug – von ihm aus hat der Besucher, wie sonst erst wieder dreißig Kilometer nördlich von den Goethe so lieben Dornburger Schlössern, einen weiten Blick ins Saaletal und die östlichen Gebiete. Die Erinnerung an das einst mächtige Geschlecht der Grafen von Orlamünde, das 1486 erlosch, wurde in der Romantik durch die Brüder Grimm aufgefrischt, die in den „Deutschen Sagen“ unter dem Titel „Die Gräfin von Orlamünde“ von der verwitweten Gräfin Agnes (historisch: Kunigunde, Witwe Ottos VII., 14. Jahrhundert) erzählen, die aus Liebesleidenschaft ihre beiden Kinder töten ließ bzw., nach einer anderen Variante, mit eigener Hand tötete. Vor den Grimms hatten schon Musäus und Theodor Körner die Sage aufgegriffen, auch E.T.A. Hoffmann nahm darauf Bezug. Einige Fassungen der zahlreichen Bearbeitungen sprechen von der Wiederkehr der Kindermörderin als Spukgestalt. Mag Kirsten dieses Hintergrundwissen noch allenfalls leise anklingen lassen, so wird ihm die Reminiszenz an Raabes Erzählung „Pfisters Mühle“ (1884) nicht ungelegen gekommen sein, spricht doch auch sie, ökologisch akzentuiert, von der zerstörerischen Macht der Zeit. Zur „großen“ Vergangenheit Orlamündes gehört schließlich auch der Aufenthalt Karlstadts, der hier seit 1523 seine wiedertäuferischen Lehren verbreitete und durch seine Anhänger Luther vertreiben ließ, der in der Absicht angereist war, mäßigend einzuwirken.
„feldwegs nach Orlamünde“ spricht, in genauer Einlösung des Titels, von einer Annäherung und vom schließlich erreichten Ziel. Wie in „veilchenzeit“ sind die beiden Strophen deutlich voneinander geschieden, zugleich aber engstens verbunden: Geht es in der ersten um eine „landschaft“, in der Siedlungsversuche der Wasserarmut wegen wiederholt aufgegeben werden mußten, so in der zweiten um die Kleinstadt, deren ländlich gebliebener Charakter eine Erinnerungstiefe eröffnet, in der sich individuell-lebens- und kollektiv-weltgeschichtliche Zeit, durch die zwei Silben „als war“ verbunden, ununterscheidbar mischen – in einer Bildlichkeit, die an die der ersten Strophe anknüpft („wirrsträubig gebauscht und verbuscht“ // „im rost verlummert / und schamstumm erstickt“), nun aber nicht nur Jahrhunderte zurückliegenden, fehlgeschlagenen Siedlungsversuchen, sondern der allerjüngsten Vergangenheit gilt: Was wäre denn, in einem individuellen Lebensrückblick Anfang der 1990er Jahre bis zu den frühesten Erinnerungen, unter „dreimal gewendete[r] zeit“ anderes zu verstehen als die Zäsuren 1933, 1945 und 1989, deren erste fast genau mit dem Geburtsjahr des Dichters, 1934, zusammenfällt, deren zweiter er nicht nur in zahlreichen Gedichten, sondern auch in einem Band autobiographischer Prosa gedacht hat und von deren dritter der Gedichtband Stimmenschotter, 1993, insgesamt zeugt?
Wie in „veilchenzeit“ – wenngleich weniger schroff – sind die beiden Strophen des Gedichtes geschieden. In der ersten, die nach dem Hinweis des Titels und von der zweiten her gelesen, eine langsame, im Gehen aufmerksam wahrnehmende Annäherung an Orlamünde von Westen aus evoziert, fehlt, grammatisch gesehen, der persönliche Bezug der ersten oder zweiten Person noch völlig. Die Partizipien des Perfekts und die Verben der dritten Person Singular beziehen sich überwiegend auf die Landschaft oder einzelne ihrer Elemente. Vom Menschen wird nur zurückhaltend in der Infinitivwendung „nicht zu vergessen“, dem Imperativ „man soll“ oder in der personifizierenden Rede vom „aberglaube“ gesprochen, der „hoch zu roß um den flauer“, d.h. die Flur „geritten“. Wenig gebräuchliche Worte wie „ziegelschlag“ (= Ziegelei) oder „klappertopf“, ein sogenanntes Unkraut wie der „gute]n] Heinrich“, das heißt der gemeine Gänsefuß, der zugleich als Heilpflanze dient, der Flurname „strümpfel“, ungewöhnliche Komposita („schlichtwollig[e]“, „wirrsträubig“, „hungerfleckig“) und Ableitungen („verdistelt“ und „verhedericht“, Luther: „Christus wolt nicht das hedderich [= wilder Senf]ausrotten lassen, das nicht auch der weitzen mit ausgerottet würde“) verleihen den Versen eine Widerständigkeit, in der die karge Landschaft in der Sprache selbst Gestalt annimmt. Der vergleichsweise sachliche, emotionsarm gehaltene Ton wird zweimal gebrochen, das erste Mal abrupt, im Übergang zu den geradezu entzückten Worten „lichtüberfluß von ungefähr, namen über namen“, in denen die eben noch heraufgerufene menschenabweisende Dürftigkeit der Landschaft im ganz anderen Licht eines beglückenden, zum Kosmischen hin offenen Reichtums erscheint, das zweite Mal, daran anschließend und also minder schroff, in den Versen „das himmelreich gleicht einem senfkorn, / man soll das wort gottes / nicht unter die ofenbank schieben“ – auch hier wird gerade in der scheinbaren Armut des in der Landschaft Gegebenen, dem Senfkorn, in dem das Perfektpartizip „verhedericht“ verdeckt aufgenommen wird, die dem nicht mehr religiös gebundenen, doch wahrnehmungsfähigen Menschen der Gegenwart mögliche Offenheit gegenüber der ihn umgreifenden nichtmenschlichen Welt zur Sprache gebracht. Aufmerksamkeit, so Malebranche und ihm folgend Benjamin im Blick auf Kafka, ist „das natürliche Gebet der Seele“.
„saalüberwärts ins Orlatal geblickt“: Das Partizip Perfekt zu Beginn der zweiten Strophe bleibt wie der bald darauf folgende Infinitiv „ziehn“ ohne pronominalen Bezug, doch der zwischen temporaler und konditionaler Bestimmung changierende Satz „wenn aus den laubkronen unten / der pirol dir die kindheit zurückruft“ ordnet ihm mit der Selbstanrede „dir“ nachträglich ein Ich zu, das nun umso emphatischer sprechen kann, als es nirgends grammatikalisch eindeutig kenntlich hervortritt. Von beglücktem, entzücktem Innehalten sprechen die ersten Verse der zweiten Strophe. Das erreichte Ziel stellt sich zunehmend nicht nur als das der Wanderung, sondern als das des eignen Lebens dar. Der „pirol“, der „aus den laubkronen unten“ ruft, verbindet den erfüllten gegenwärtigen Augenblick mit der Zeitentiefe des individuellen Lebens. Gerade die epiphanische Einholung der „kindheit“ freilich erweist sich als brüchig, und von der diesen Bruch markierenden Wendung „als wär“ an wird der Ton immer dunkler. Lebensgeschichtliche und weltgeschichtliche Zeit sind Zeiten wiederholter Wenden, über deren Abgründe der Ruf aus der Kindheit umso schmerzlicher zu vernehmen ist. In der Bildlichkeit der „auf dem riff“ von der Geschichte gleichsam zurückgelassenen Stadt ist nun von ganz anderen historischen Brüchen die Rede als denen, die der erste Teil mit dem Wort „fehlsiedlungen“ angesprochen hatte. „im rost verlummert“ (das heißt erschlafft) „und schamstumm erstickt“ spricht von abgebrochenem Leben und, mehr als nur von physischer, von moralischer Schwäche, von der Scham im Rückblick auf ein Leben, das doch das einzige eigene war – „es war, als sollte die Scham ihn überleben“, so die letzten Worte in Kafkas Prozeß.
„feldwegs nach Orlamünde“ enthält einen nicht markierten intertextuellen Verweis, der mit Johannes Bobrowski, die lebenszeitliche Tiefe profilierend, einen der wichtigsten literarischen Gewährsmänner Wulf Kirstens aufruft. „Kindheit“ ist das zweite Gedicht der „Sarmatischen Zeit“ überschrieben. Es beginnt mit den Versen: „Da hab ich / den Pirol geliebt – “. Die Schlußstrophe lautet:
Nacht, lang verzweigt im Schweigen –
Zeit, entgleitender, bittrer
von Vers zu Vers während:
Kindheit –
da hab ich den Pirol geliebt –
Auch in dem Roman Levins Mühle. 34 Sätze über meinen Großvater wird die Verbindung zwischen dem Gesang des scheuen, selten gewordenen Vogels und der individuellen Lebenszeit hergestellt:
Diese Marie melkt die Ziegen, und der Levin trinkt die halbe Milch gleich aus, und dann sind sie wieder weg, man hört sie manchmal irgendwo, aber da sind sie nie. Jetzt sitzen sie auf der Wiese, und es regnet. Es ist die Zeit, wo man den Pirol hört, besonders dort, wo die Rotbuchen zuende sind und die Weißbuchen anfangen, carpinus betulus. Er läutet einem die Augen leer mit seiner Glockenstimme, man hört und hört und sieht nichts mehr, und wenn man schon alt ist, wie Jan Marcin, lehnt man sich an einen Baum und bewegt die Lippen, aber man sagt kein Wort, höchstens: Meine Zeit.
Unter den zahlreichen Porträtgedichten Kirstens – „Gottfried Silbermann“, „Querner“, „Christian Wagner“, um nur einige zu nennen – stellt ein 1974 entstandenes Emil Nolde in die Thüringer Landschaft:
UMWEGE
mit sack und pack
zog der maler aus Jena ab,
nahm quartier
im „Grünen Baum zur Nachtigall“,
den frühling zu malen
oben am Napoleonstein.
über nacht aber fiel schnee
in dicken büscheln.
morgens die gleißenden flächen,
unbeschriebene seiten
unter der kalten sonne!
froststiche,
daß es dem märz die sinne verschlug.
eine baumzeile verzettelte bauschiges weiß.
der maler sah die rotglühende sonnenkugel
in den pappschnee rollen.
gefärbte blätter lagen wahllos umher,
zugeschneit. zuweilen kolorierte er
in den abendstunden, wenn der frost einbrach
und die natur ihre mitarbeit anbot,
naß-in-naß auf festem zeichenpapier,
daß der schnee die farben ausfranste
und gefrieren ließ
zu kristallenen sternen und strahlungen.
auf dem bauch liegend,
schrieb er mit eisstücken weiter,
bis er völlig erstarrt war
und ihn die angst packte
vor abgefrorenen händen.
das schmelzwasser spülte ihn
über den kalkrücken hinunter,
unterwegs von Cospeda nach Ruttebüll
über Celebes, Port Said.
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gab es in Jena einen rührigen Kunstverein, in dem sich der Philosoph Eberhard Grisebach und der Archäologe Botho Graef hervortaten. Graef hat unter anderem Liebermann, Munch und Nolde gefördert, in dem er nach Auskunft Kirchners, der 1917 und 1919 im Jenaer Kunstverein ausstellte, „den Nachfolger Munchs“ sah. In den ersten Jahren des am 21. Dezember 1903 gegründeten Kunstvereins kam auch Emil Nolde wiederholt nach Jena. Im zweiten Band seiner Autobiographie, Jahre der Kämpfe. 1902–1914, hat er des 1917, 58jährig verstorbenen Graef gedacht:
Botho Graef suchte früh meine Kunst und trat nahe zu ihr und sprach für sie auf Ausstellungen in Jena, Essen und Frankfurt, schön und fesselnd. Es war merkwürdig, daß er, in alter Kunst lehrend, zur neuesten neuzeitlichen Kunst hinfand, ja, er hatte den Glauben, daß derjenige, welcher die Kunst seiner Gegenwart nicht versteht, auch nicht die alte, historisch gewordene verstehen kann.
Im Abschnitt „Folkwang-Soest-Jena“ berichtet Nolde über einen späteren Besuch, 1908, der ihn zunächst in das Haus seines inzwischen „zum Professor, zum Geheimrat und zum Hofrat“ aufgestiegenen Freundes Hans Fehr und anschließend in eine noch heute unter demselben Namen existierende Gaststätte des am Rande des Schlachtfeldes von 1806 gelegenen Dörfchens Cospeda führte. Kirstens Gedicht liegen aquarellierte Bilder wie „Sonne über Schneematsch, Cospeda 1908“ und, vor allem, der folgende Abschnitt aus „Jahre der Kämpfe“ zugrunde:
In Cospeda im Grünen Baum zur Nachtigall fand ich eine Stätte zum Wohnen und zum Arbeiten. Studenten kamen und gingen. Hartleben und seine Dichterfreunde hatten hier ihren Schoppen getrunken. Auf dem Hochplateau hatte Napoleon seine Regimenter zur Schlacht gesammelt. Was aber ging uns dies alles an. Ich malte kleine Bilder. Sie wollten nicht gelingen. Dann griff ich zu den Wasserfarben und malte die rotglühende Sonnenkugel über Schneematsch niedergehend, ich malte den weißen fallenden Schnee, und die halb oder ganz fertigen Blätter lagen umher überschneit, so daß ich sie suchen mußte und erstaunt war, wie die Farben seltsam verträumt unter dem Schnee sich angesetzt hatten. Zuweilen auch malte ich in frierenden Abendstunden und sah es gern, wenn auf dem Papier die gefrorenen Farben in kristallenen Sternen und Strahlungen sich setzten. Ich liebte solche Mitarbeit der Natur; ja, die ganze Naturverbundenheit: Maler, Wirklichkeit und Bild.
Nordwestlich der Jenaer Innenstadt erhebt sich der Landgraf, ein steil abfallender, durch tief einschneidende Täler gegliederter Höhenrücken, der in ein Hochplateau übergeht, aus dem als höchster Punkt der „Windknollen“ hervorragt. Von ihm aus hatte Napoleon 1806 seine sich zur Schlacht sammelnden Truppen befehligt; 1808 war er Schauplatz eines am Rande des Erfurter Fürstenkongresses zur Erinnerung an die Niederwerfung Preußens aufwendig – mit einem schon bald wieder abgetragenen „Napoleonstempel“ – arrangierten „allerhöchsten“ Treffens. Ein auf dem Windknollen befindlicher Stein, der die Flurgrenze zwischen Jena und Cospeda bestimmte, wurde im 19. Jahrhundert „Napoleonstein“ genannt und später, als er verschwunden war, durch einen neuen ersetzt, der nun ausdrücklich an den wiederholten Aufenthalt des französischen Kaisers erinnerte. Bis 1990 diente das Gebiet um den Windknollen als russisches Panzerübungsgelände. Der damals verlorengegangene zweite Erinnerungsstein wurde 1991 in dem nun jedermann zugänglichen Hochplateau durch einen dritten ersetzt, auf dem unter anderem Entfernungsangaben zu den großen Schlachten Napoleon Bonapartes und zu den Orten seines Exils zu lesen sind. Nolde kann den auf der höchsten Erhebung aufgestellten zweiten Napoleonstein gar nicht übersehen, Kirsten hingegen kann ihn, da er zur Entstehungszeit des Gedichts nicht zugänglich bzw. schon verschwunden war, nur von Abbildungen oder vom Hörensagen gekannt haben. Beide, Nolde und Kirsten, nehmen ähnlich, doch unterschiedlich auf den weltgeschichtlichen Ort Bezug: jener mit unterkühlter Beiläufigkeit – „Was aber ging uns dies alles an. Ich malte […] Bilder“ –, dieser ebenfalls mit einer adversativen Wendung, die das historisch Bedeutsame zugunsten eines neuerlichen wunderbaren Wintereinfalls zurücktreten läßt – „den frühling zu suchen / oben am Napoleonstein. / über nacht aber fiel schnee“. Daß die Erwähnung des Napoleonsteins 1974 nebenbei auch einen politisch brisanten Bezug auf die russischen Truppen hatte, konnte nur von Ortskundigen erkannt werden. Der damals schon im nahen Weimar lebende Dichter wird ihn seinem Nolde-Porträt bewußt eingestaltet haben.
Die sich wenig über 350 Meter erhebenden Höhen bei Jena – der Windknollen erreicht 361,6 Meter – sind in der kalten Jahreszeit häufig schneebedeckt, während die 200 Meter tiefer gelegene Stadt schneefrei bleibt, was auch heute noch den in einer halben Stunde über den „Steiger“ zum Landgrafen und Windknollen aufgestiegenen Spaziergänger überraschen kann. Kirsten hebt, abweichend von Nolde, den plötzlichen, späten Wintereinbruch hervor und überschreibt seine Quelle mit einer fortgeführten Metaphorik des Schreibens und Zeichnens – „unbeschriebene seiten“, „froststiche“, „eine baumzeile verzettelte bauschiges weiß“, „pappschnee“, „gefärbte Blätter“ –, aus der die militärisch gewaltsam im doppelten Wortsinn beschriebene und gezeichnete Landschaft unberührt und zu behutsamerem Umgang mit ihr befreit hervorgeht. Denn dies macht die strukturbildende Pointe seines Gedichtes in radikalisierender Fortführung zu der durchaus sprachmächtigen autobiographischen Prosa Noldes aus: daß eben jene Natur, die, jahreszeitlich überraschend, die gewalttätige Beschriftung der Landschaft – wenngleich nur für eine kurze Frist, bis zum „schmelzwasser“ – tilgt, „ihre mitarbeit anbot“, als „schnee“, der „die farben ausfranste / und gefrieren ließ / zu kristallenen sternen und strahlungen“, als „eisstücke[n]“, mit denen der „maler“ weiter „schrieb“. Nolde bleibt ungenannt, wenngleich nicht verborgen. Mag sein Jenaer Aufenthalt nur wenigen zur Kenntnis gelangt sein, so sprechen die beiden Schlußverse mit der Südseereise und dem endlich an der deutschen Nordseeküste gefundenen Lebensmittelpunkt bekannte Daten seiner Biographie an, und im Schnee, der „die farben ausfranste / und gefrieren ließ“, ist, über die spätwinterliche Cospedaer Episode hinaus, die vom Maler bevorzugte Aquarelltechnik, eindringlich gefaßt. Daß Noldes Name nicht fällt, ist gleichwohl bedeutsam. Durch die Aussparung gibt das Gedicht zu verstehen, so könnte man dies deuten, daß es im Porträt dieses bestimmten Malers, stärker als ein namentlich gezeichnetes Porträt es täte, um eine allgemeinere menschliche Möglichkeit geht.
„umwege“ ist ein doppeldeutiger Titel. Vordergründig, unironisch, meint er die Lebensbahn Noldes, in der Jena mit Cospeda Episode blieb. Hintergründig, entschieden ironisch, zielt er auf einen singulären Einklang mit der unverfügbaren Natur, die dem aufnahmefähigen Menschen „unterwegs“ noch in der von äußerster Gewalt geprägten Landschaft begegnen kann. Wenn es am Ende heißt „das schmelzwasser spülte ihn / über den kalkrücken hinunter“, werden die der Zeit weltgeschichtlicher Gewalt gegenübergestellten Zeiten des einzelnen Menschen und der jahreszeitlichen Natur mit einem an die Riffe von „veilchenzeit“ und „feldwegs nach Orlamünde“ erinnernden Wort um die alle anderen Zeiten umgreifende Erdzeit ergänzt. In der Konsonanz dieser drei Zeiten, in der befristeten Sistierung des „Zeitenzerfalls“ (Hans Blumenberg), ist eine Weite erreicht, die der Schluß des Gedichtes in großartig beiläufiger Geste auf das ganze Leben und die ganze Welt ausgreifen läßt.
„veilchenzeit“ ist Frühlingszeit, „feldwegs nach Orlamünde“ ruft Sommer oder frühen Herbst herauf, „umwege“ den unerwartet zurückkehrenden Winter. Die jahreszeitlich unterschiedliche Beschriftung der in ihre erdgeschichtliche Herkunft gestellten Natur tritt deutlich hervor, in den „winterharten anemonen“, in der „hungerfleckig verdistelt[en] und verhedericht[en]“ Flur, in „bauschige[m] weiß“ und „schmelzwasser“. Zu den natürlichen Zeiten der Jahreszeiten und der Erdgeschichte – „hügelriffe“, „muschelkalk“, „kalkrücken“ – treten in Kirstens Landschaftsgedichten die menschlichen Zeiten des individuellen Lebenslaufes und der Weltgeschichte. Die Verbindung fällt je unterschiedlich aus. In „veilchenzeit“ erfährt ein zunächst klagendes, dann anklagendes Ich die Zerstörung der geliebten Landschaft durch militärische und agrarindustrielle Gewalt. „feldwegs nach Orlamünde“ beschreibt einen doppelten Umschlag: von der nachdenklichen Vergegenwärtigung eines dem Menschen einst bedeutsamen, nun weitgehend verlassenen Kulturraums zur beglückten Preisung der in ihm überwältigend erfahrbaren Schönheit und weiter zur Erinnerung an die Kindheit und die seitdem weltgeschichtlich „dreimal gewendete zeit“, die den Wert auch des in ihr gelebten individuellen Lebens – „im rost verlummert / und schamstumm erstickt“ radikal in Frage stellt. Allein in „umwege“ kommt es, bedingt, zu einem Einklang der Zeiten: Der jahreszeitlich späte Schnee macht aus den weltgeschichtlich ausgefüllten kurzfristig „unbeschriebene seiten“; die Stimmigkeit zwischen Erdzeit, Jahreszeit und individuell-lebensgeschichtlicher Zeit schließt die sogenannte große Geschichte nicht ein, bleibt an unverfügbare äußere Bedingungen gebunden und stellt sich überdies, verdeckt selbstbezüglich, als nurmehr künstlerisch bzw. in ästhetischer Kontemplation zu leisten dar.
Die drei besprochenen Gedichte sind nicht in der hier gewählten Reihenfolge entstanden. „umwege“, das hellste unter ihnen, ist das älteste (1974); „veilchenzeit“ wurde anderthalb Jahrzehnte später geschrieben (1988); noch einmal drei bis vier Jahre später entstand, scheinbar heller, tatsächlich – am Ende – noch stärker verdunkelt, „feldwärts nach Orlamünde“ (1991/92). Auch in späteren Texten hat Kirsten im Landschaftsgedicht das Konzept gegenläufiger Verschränkung natürlicher und menschlicher Zeiten weiterverfolgt, etwa in „kniestück“ (1995):
wie leuchtet die sonne, wie lacht die flur
am flußknie, wo sich das wasser
in die kurve legt, treibholz
und schmückendes beiwerk im wiesengewell.
[…]
jetzt gewerbegebiet, breitflächig ausufernd,
durch den Flachsgrund wälzt sich der landverbrauch,
überbautes gelände, wie leuchtet, wie lacht,
die zeit läßt nicht ab von der flur.
Oder in „muschelkalk“ (1997), hier nicht mit Bezug auf die Zeit nach der dritten, sondern auf die vor der zweiten der drei Wenden, von denen in „feldwegs nach Orlamünde“ die Rede ist:
das gebirge nimmt anlauf im vorland,
probeweise stehn die zwergichten berge
ohne sinn und verstand für symmetrie
wahllos verstreut im zerschrammten gelände,
abgründige schlupfwinkel, nirgends ein rechter,
aberzählig kavernen im muschelkalk,
geschaffen von hand ein unsichtbares reich
für troglodyten, von sprengkommandos
abgeriegelt die stählernen tore. –
die landschaft mit windmühlenrumpf
will ihre geheimnisse nicht preisgeben
goldgierigen grabräuberseelen, all
diesen nach trüffeln schnobernden scharen
wildernder schatzgräber, ohne zu wissen,
was und wo wirklich der wahnwitz
dem erdinnern abgetrotzt hat für nichts
und wieder nichts. – wuchs den toten
nicht längst der bart durch die steinernen tische?
das quartier samt allen grabkammern
und totengrüften mit dem meißel gebunkert
von sklaven, zerlumpt und zu tode geschunden,
erdwellen, wellblechgerippt, spielen
in aller unschuld mit lämmern,
von der mühle, die kein wind mehr beflügelt,
irrt das auge über eine terra incognita
pod polje, wenn Dostojewskij, wenn der,
wenn jener gewußt hätte, ach wie gut,
daß niemand weiß…
Was leisten Gedichte wie „veilchenzeit“, „feldwegs nach Orlamünde“ oder „umwege“? Sie übersetzen – weglassend, akzentuierend, Beziehungen herstellend – Landschaft in Sprache. Sie bewahren sie, ja sie machen sie dem Aufmerksamen in ihrer je bestimmten Sicht allererst zugänglich. Im Unterschied zu dem von Kirsten in frühen Gedichten vergegenwärtigten „unberühmte[n] Landstrich“, dem linkselbischen Gebiet seiner Kindheit zwischen Dresden und Meißen, ist der Thüringer Raum, zumal die Saale und das Gebiet um Jena, längst, von Schiller etwa („Der Spaziergang“) oder von Benn („Jena vor uns im lieblichen Tale / schrieb meine Mutter von einer Tour / […]“ [„Jena“]), in der imaginären Weltkarte der Literatur verzeichnet. Kirstens Leistung besteht weniger in der allen Lyrikern abverlangten punktuellen Verdichtung als in der kritischen Verschränkung natürlicher und menschlicher Zeiten. In der Abwendung sowohl von Schillers geschichtsphilosophischen Aufschwüngen als auch von Benns das Barock unchristlich erneuerndem Vergänglichkeitspathos, in der spekulationsresistenten, unsentimentalen Vergegenwärtigung asynchroner Zeiten erkennen wir in ihm den Dichter unserer Zeit: „Poesie ist in dem Grad, in dem sie Herkunft sagt.“ (Elke Erb).
Gerhard R. Kaiser, aus Gerhard R. Kaiser (Hrsg.): Landschaft als literarischer Text. Der Dichter Wulf Kirsten, Glaux Verlag Christine Jäger, 2004
Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies
– Im Gespräch mit dem Lyriker und Erzähler Wulf Kirsten. –
Arroganz und Selbstinszenierung sind Wulf Kirsten fremd. Der 1934 in Klipphausen bei Meißen geborene Autor wirkt bescheiden und zurückhaltend, obwohl er in die vorderste Reihe deutscher Verskünstler gehört. Seit dem Erscheinen der Gedichtsammlungen Stimmenschotter und Wettersturz eilt ihm der Ruf eines Sprachalchimisten und Worthypnotiseurs voraus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung feierte seine Strophen als „berauschend schön“. Als er 1968 mit einem Lyrikheft in der von Bernd Jentzsch begründeten Reihe Poesiealbum debütierte, war er bereits 34. Doch schon damals nannte ihn Reiner Kunze die „große Hoffnung der DDR-Literatur“. Ulf Heise befragte den in Weimar lebenden Schriftsteller über Jugenderinnerungen, Arbeitstechniken und Vorbilder.
Ulf Heise: Sie haben kürzlich Ihre Memoiren unter dem Titel Die Prinzessinnen im Krautgarten vorgelegt. Stimmt es Sie melancholisch, daß die archaische Dorfwelt, in die Sie hineingeboren wurden, nicht mehr existiert?
Wulf Kirsten: Natürlich, aber ich überlege auch, ob nicht seit Erschaffung der Welt ständig dieser Prozeß des Verschwindens abläuft. Ich glaube, es hat noch in keinem Jahrhundert Stillstand gegeben. Immer hat sich etwas verändert. Nur sehe ich in diesem Jahrhundert auch unnötigen Verfall und unnötige Wandlungen, die mit Überfluß zu tun haben, mit der Wegwerfgesellschaft.
Heise: Ihre Prosa kündet von sehr viel Gelassenheit…
Kirsten: Ich benötigte sehr viel Zeit, um diese Gelassenheit in mir selber herzustellen. Ich habe überhaupt lange gebraucht, um die erforderliche Distanz zu meiner Herkunftslandschaft zu gewinnen. Als ich früher versuchte, Erinnerungsprosa über meine Heimat zu schreiben, ist mir das nicht geglückt.
Heise: Gelassenheit ist bei Ihnen aber nicht identisch mit Harmonie…
Kirsten: Nein, meine Texte haben nichts Bukolisches. Daß es in ihnen Brüche gibt, resultiert daraus, daß ich immer nur Abbreviaturen, Fragmente liefere. Den Ehrgeiz, etwas fortlaufend zu erzählen, habe ich nicht. Ich bin kein Erzähler, sondern ein Aufzeichner, der sich der pars pro toto-Technik bedient.
Heise: Aus ihren Miniaturen erfährt man, daß sie elfjährig mit Meißen erstmals eine größere Stadt betraten. Erscheint Ihnen die lange Isolation in Ihrem Weiler aus heutiger Perspektive als nachteilig?
Kirsten: Ich empfand das damals nicht als Isolation. Ich hatte einfach so wenig Welt in mir, daß mich das nicht störte. Städte sind mir aufgrund der starken Prägung, die mir das Dorf verliehen hat, eher fremd geblieben. Obwohl ich mittlerweile urbanisiert bin, sehne ich mich noch immer nach dem idealen Dorf, das es natürlich nicht gibt. Es ist wie die Suche nach dem verlorenen Paradies.
Heise: Sie berichten von der Wißbegier, mit der Sie Besuchern, die auf den Hof Ihrer Eltern kamen, Neuigkeiten ablauschten. Sind die Episoden, die Sie bei solchen Gelegenheiten hörten, zu einem Ideendepot für Dichtungen geworden?
Kirsten: Ja, auch wenn mir erst relativ spät bewußt wurde, welchen Fundus ich da mit mir herumschleppte. Zunächst habe ich ignoriert oder sogar mißachtet, was aus der Mundart und der Umgangssprache in mir hängen geblieben ist. Als ich Mitte der 60er Jahre anfing, über meine Kindheitswelt Gedichte zu schreiben, erkannte ich den Wert dieses Materials, das sich kaum ausschöpfen läßt. Insofern fühle ich auch keine Angst, daß mir der Stoff ausgehen könnte. Vielmehr spüre ich die Besorgnis, daß meine Lebenszeit nicht ausreicht, um das aufs Papier zu bringen, was mich innerlich bedrängt.
Heise: Oft gewinnt man den Eindruck, daß Sie ein Fremdkörper in Ihrem heimatlichen Umfeld waren…
Kirsten: Seit einigen Jahren denke ich unablässig über meine Außenseiterrolle nach. Was mich ausgrenzte, war vor allem meine Linkshändigkeit. Die galt als großer Makel in einem bäuerlich-handwerklichen Haushalt. Außerdem habe ich zuviel gelesen, so daß man sich für mich schämte. Zusätzlich spielten religiöse Grundsätze ein Rolle, die mein Vater auf mich übertrug. Die Außenseiterrolle befähigte mich, schärfer hinzusehen. Man stand immer etwas neben den Dingen. Doch ich will das Ganze nicht zu sehr stilisieren, denn es gab auch Erlebnisse der Gemeinsamkeit mit der Dorfjugend. Ich war nie einer, der nur im Zimmer hockte.
Heise: Im Hühnerstall und unter dem Frühbeetfenster verschlangen Sie als Halbwüchsiger eifrig Karl-May-Romane…
Kirsten: Es ging dabei gar nicht so sehr um Karl May, sondern um die Tatsache, daß ich an unstillbarer Lesewut litt und in meiner Bedrängnis alles konsumierte, was mir unter die Finger kam. Woher diese Leidenschaft rührte, kann ich nicht sagen. Sie war einfach ursächlich da.
Heise: „Die Deutsche Bücherei wurde mir zur eigentlichen Universität“, heißt es in Ihrer Dankrede für den Peter-Huchel-Preis. Was haben Sie in Leipzigs berühmter Bibliothek während Ihrer Studienzeit hauptsächlich gelesen?
Kirsten: Zwei Drittel meiner Lektüre bestanden aus literarischen Zeitschriften des Zwanzigsten Jahrhunderts. Das war sozusagen mein Guckloch in den Westen. Diese Möglichkeit habe ich in jeder freien Stunde genutzt. Manches Seminar wurde darüber von mir versäumt. Einschränkungen bei der Ausleihe gab es damals kaum. Nur selten fand sich auf einem Leihschein der Stempel mit dem Satz „Nachweis für wissenschaftliche Verwendung erforderlich“. Man konnte sogar die Originale der Zeitschriften wie Der Sturm noch in die Hand nehmen. Das wäre heute aus konservatorischen Gründen gar nicht mehr möglich.
Heise: Christa Wolf erklärte bereits in den 80er Jahren, es wäre für ihre literarische Laufbahn besser gewesen, wenn sie nicht Germanistik studiert hätte. Glauben Sie, daß sich zu viel akademisches Wissen für einen Dichter als hinderlich erweist?
Kirsten: Es belastet schon, aber ich bin trotzdem dankbar dafür. Den Unterricht in Grammatik und Wortbildungslehre möchte ich nicht missen. Natürlich gab es in der Germanistik auch Dinge, die mich nicht sonderlich interessierten. Beispielsweise war ich kein Held, wenn es um Mittelhochdeutsch ging. Nun muß ich allerdings hinzufügen, daß ich meine Ausbildung nie nur der Schule oder der Universität überließ. Ich bin immer Selbsthelfer gewesen.
Heise: Noch bevor Sie 1960 an die Leipziger Universität kamen, schickten Sie Briefe an Hermann Hesse und er sandte Ihnen Bücher. Wie entwickelte sich Ihr Verhältnis zu diesem Autor?
Kirsten: Wie viele junge Leute früherer und folgender Generationen befand ich mich jahrelang in einem richtigen Hesse-Fieber. Das hing auch damit zusammen, daß ich mich damals in einer spätneoromantischen Phase befand. Ich las Bonsels und Haringer, und das faszinierte mich. Hesse bedeutete mir zu dieser Zeit als Lyriker einiges. Inzwischen ist er mir am nächsten in seiner Reiseprosa und in seinen frühen Erzählungen. Heute muß sich dieser Autor für mich in einem viel größeren Kanon behaupten als er mir in meiner Jugend zur Verfügung stand.
Heise: Auch Peter Huchel betrachteten Sie bereits zeitig als Stern erster Größe. Begegnen Sie diesem Dichter noch immer mit Enthusiasmus?
Kirsten: Meine Beziehungen zu Huchel haben sich nicht abgekühlt. Was mich ein bißchen bekümmert, ist die Tatsache, daß man heute in der Öffentlichkeit bei dem Namen Huchel zuerst an ein Politikum denkt, an den Streit um Sinn und Form, während seine Verdienste als Lyriker zu kurz kommen.
Heise: In einem Essay bezeichnen Sie Gedichte als „schöne Fiktion irdischer Vergeblichkeit“. Was ist so tröstlich an dieser Fiktion, daß Sie es immer wieder damit versuchen?
Kirsten: Hochtrabend gesagt: Die Möglichkeit zur Lebens- und Selbstgestaltung. Selbsterkenntnis zu gewinnen, ist ein hoch zu schätzender Aspekt. Zugleich versuche ich mich mit meinen Mitmenschen in eine Beziehung zu setzen, immer in der Hoffnung, daß sie das auch wahrnehmen. Egozentrisches Dichten liegt mir fern. Eine meiner geheimen Botschaften, wenn es so etwas überhaupt gibt, zielt darauf, die Leute mit ihren eigenen Augen sehen zu lehren.
Heise: Heute besitzt oft nur noch solche Lyrik Marktchancen, die vordergründig Realität durchschimmern läßt. Verfügen die Menschen heute nicht mehr über genügend Bildung, um Metaphern zu entschlüsseln?
Kirsten: Zweifellos muß man mittlerweile schon Hemmungen hegen, auf irgend etwas anzuspielen. Eines Tages werde ich es nicht mehr wagen können, ein Bibelzitat anzuführen. Wenn ich mich auf Schriftsteller wie Keller oder Platen beziehe, merke ich immer häufiger, daß man die Kenntnis dieser Autoren bei anderen nicht mehr voraussetzen kann. Das ist sehr schmerzlich. Trotzdem werde ich von meinem dichterischen Verfahren nicht abweichen. Ich brauche Metaphern, um die Sprache aufzuladen, sonst wird sie flach. Ein Gedicht muß mehrere Tiefenschichten aufweisen und ein Geheimnis bergen dürfen, das sich nicht sofort offenbart. Ich habe den Ehrgeiz zu zeigen, wie reich die deutsche Sprache ist, wobei ich gewiß kein poetus doctus bin, der den Leuten Kreuzworträtsel aufbürdet.
Heise: Von Theodor Storm weiß man, daß er mitunter monatelang nach einem passenden Wort für ein Gedicht suchte. Wie ist das bei Ihnen?
Kirsten: Natürlich rudert man oft nach einem, nach dem passenden Wort, und ich kann wütend werden, wenn ich weiß, daß dieses Wort existiert und mir fällt es nicht ein. Da gibt es aber keine Hilfsmittel. Man muß sich gedulden. Ich lege ja einen Entwurf nicht gleich aus der Hand. Daran wird in Fassungen oder Stufen eine Weile gearbeitet. Entscheidend ist nur die Fähigkeit, die Ansätze früh genug kritisch zu sehen.
Heise: Stehen Gedichte Ihnen eigentlich auf einen Schlag vor dem geistigen Auge?
Kirsten: Nein, sie kristallisieren in der Regel langsam aus. Normalerweise muß ein Gedicht, das sich im status nascendi befindet, so lange gedreht und gewendet werden, bis es am Ende selbst mitdichtet, bis die Sprache eigenmächtig wird. Erst im Laufe des Schreibens kommt dann doppelter Boden hinzu. Es gibt aber hin und wieder auch blitzartig auftauchende Gedichte, die man in einem Zug notiert, an denen wenig verändert werden muß. Schließlich finden sich stets auch Schwächlinge und Kümmerlinge unter den Gedichten, die man für immer verwirft. Alles in allem gelingt einem das ideale Gedicht nur in seltenen Fällen.
Heise: Arbeiten Sie nach einem strengen Regime wie Thomas Mann?
Kirsten: Nein, ich bin in dieser Beziehung totaler Anarchist. Ich wandle nicht als Poet durchs Leben. Ich werde mit so vielen banalen Dingen konfrontiert wie jeder andere Mensch. Es gibt Phasen, in denen ich völlig stumpf für das Gedicht bin. Dann wieder kann ich in relativ kurzer Zeit viel schreiben. Wichtig ist, daß man sich auch in den Zeiten der Unproduktivität eine Speicherfähigkeit bewahrt, daß man Material sammelt, sich Notizen macht, Tagebuch führt.
Heise: Sie sind ein Sprachmeister und Sprachschöpfer von hohen Graden. Welchen Stellenwert hat für Sie das Wort?
Kirsten: Ich stamme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater war Steinmetz, mein Großvater Tischler. In diesen Berufen ist Millimetergenauigkeit gefragt. Ich habe versucht, diese Präzision als Wortarbeiter umzusetzen. Mir kam es immer darauf an, Vokabeln aus dem passiven Wortschatz, den jeder in sich trägt, in den aktiven hinüberzuführen. Darin hat mich während meiner Leipziger Studienzeit auch Hans Mayer bestärkt, der oft vom authentischen Sprechen redete, wie er es im Umgang mit Robert Musil erfuhr.
Heise: Ihre Prosa ist trotz der „körnigen“ Diktion lyrisch beschaffen. Wäre es vermessen, sie den Prosagedichten zuzuordnen?
Kirsten: Keineswegs. Diese Bezeichnung trifft meine Intentionen recht genau, denn ich bin sehr darauf bedacht, daß die Texte zu Klangbildern verschmelzen und daß die Sprache einen Rhythmus hat. Außerdem fesselt mich die Grenzüberschreitung. Ich taste mich in Gedichten, so weit es irgend geht, an die Prosa heran und auch umgekehrt. Generell bin ich ein narrativer Lyriker, ich muß immer Stoff transportieren. Das bloß Musikalische reizt mich weniger.
Heise: Oft denkt man bei Ihrer Literatur an die Malerei von Kurt Querner. Gibt es da eine Seelenverwandtschaft?
Kirsten: Ich sehe in Querner einen meiner geistigen Väter. Es bestand eine enge Freundschaft zu ihm während seiner letzten zehn Lebensjahre. Ich habe ihn immer wieder in Börnchen bei Freital besucht und mir aus seinen Bildern Anregungen geholt.
Heise: In Ihrem Essay Textur bekennen Sie sich zu Stefan George, aber auch zu Bertolt Brecht. Nun klaffen zwischen diesen beiden Autoren nicht nur ästhetisch Abgründe, sondern auch ideologisch…
Kirsten: Ich hatte nie die Absicht, einem von beiden weltanschaulich nachfolgen zu wollen. Bei George ist mir einzig wichtig gewesen, daß er eine geniale neue Poesiesprache schuf und daß er die französische Moderne nach einem Besuch bei Mallarmé in einem Aktentäschlein nach Deutschland brachte. Brecht schenkte der deutschen Poesie gleichfalls etwas sehr Kühnes, das freie Sprechen, den Rhythmus gestischen Sprechens.
Heise: Manche Ihrer Gedichte laufen offensichtlich auf Pantheismus hinaus. Wohnt für Sie in der Natur etwas Göttliches?
Kirsten: Unbedingt. Dazu bekenne ich mich auch, ohne als Missionar aufzutreten, obwohl einer meiner ehemaligen Freunde behauptet, ich hätte einen „christlichen Tick“. Ich halte mich an Hermann Broch, der gesagt hat: „Der wahrhaft gläubige Mensch hat es nicht notwendig, über den Glauben zu reden. Nur wer um den Glauben ringt, muß sich mit ihm auseinandersetzen.“
Heise: 1995 begaben Sie sich zwecks Recherchen für einen Aufsatz auf die Suche nach Spuren Friedrich Nietzsches in Mitteldeutschland. Was bedeutet Ihnen dieser Philosoph?
Kirsten: Er bildet für mich keine weltanschauliche Basis, aber er ist ein scharfer Denker und nicht zuletzt ein großer Poet. Er steht für mich am Anfang der Moderne in der deutschen Dichtung. Natürlich sehe ich in ihm auch den brillanten Aphoristiker, der seiner Zeit weit voraus war.
Heise: In unserer Ära ist das Buch zur Massenware und zum Konsumgut herabgesunken. Fürchten Sie nicht, daß Ihre thematisch anspruchsvollen Werke in der Flut von Neuerscheinungen unterzugehen drohen?
Kirsten: Sie drohen nicht nur unterzugehen, sie gehen unter. Was mich hält, ist die Gewißheit, einen kleinen Kreis treuer Leser zu besitzen. Rückenstärkend wirken aber auch Erfahrungen, die man bei Lesungen sammelt. Insgesamt gewinnen einzelne Stimmen stark an Gewicht.
Heise: Zehn Jahre nach dem Untergang der DDR blüht in den Neuen Bundesländern die Ostalgie, nicht zuletzt auch unter Schriftstellern. Haben Sie Verständnis für dieser Art Ressentiments?
Kirsten: Um ehrlich zu sein verblüfft es mich, daß manche Autoren davon träumen, daß in Zukunft ein veredelter Sozialismus politische Praxis werden könnte. Das ist für mich die Utopie der Utopien. Marx als analytischer Kopf und Kritiker des Kapitalismus ist sicher nicht von der Hand zu weisen, aber auf seinen Lehren ein Gesellschaftssystem aufbauen zu wollen, halte ich für unmöglich, weil es dafür einen Menschenschlag braucht, denn es nie gegeben hat und nie geben wird.
Deutsche Bücher, Heft 2, 2001
deinesgleichen, meinesgleichen – geschichtsfähig gemacht
– Unsortierte Gedanken zu Wulf Kirstens Helden der kleinen Verhältnisse. –
Ich müsste mit den Auslassungen beginnen, die Lücken benennen, in langen Listen eine Aufzählung all dessen anführen, was ich in so kurzer Zeit, mit meinem kümmerlichen Rüstzeug, nicht zu Ende denken, nicht gründlich genug ausleuchten kann, denn beginnt man sich mit dem Werk Wulf Kirstens zu beschäftigen, das so gerne mit griffigen Kategorien bedacht wird, gerät man schnell in ein tiefdunkles Dickicht, verliert sich im verdschungelten Denken, das noch jede verknäuelte Einzelheit entwirren will, um Aufschluss über das Ganze zu gewinnen und allein die Skepsis gelten lässt, dass die Kategorien nicht taugen. So ziehe ich also einzelne Fäden aus dem Knäuel, ganz im Sinne Wulf Kirstens, greife mir, was habhaft ist: Schuhmacher Pritzel z.B., der mich ins Erinnern und somit zu einem Anfang drängt.
Als ich ein Kind war, hatte ich zwei Paar Schuhe für den Sommer, zwei für den Winter und eines für gut. Diese Schuhe mussten gepflegt und sorgsam behandelt werden, wehe man wurde beim Schlurfen erwischt, dann gab es Schellen, gab es den Vortrag, der sich beliebig auf alle Dinge im Haushalt anwenden und abwandeln ließ: eine langatmige Litanei über Werte. Doch selbst unter Einhaltung aller Gebote, meine Schuhe wollten schlicht keinen Anspruch auf Ewigkeit erheben, also tauschte ich regelmäßig das eine gegen das andere Paar und ging fast allmonatlich zum alten Schuster Bunge, um ihm meine löchrigen Schlumpen reumütig unter die Nase zu halten. Schon das Schaufenster, das kein Schaufenster, sondern ein bodennahes schmales Fensterchen mit Häkelgardine war, bot Wunderliches: Auf einem selbstgezimmerten zweistufigen Holzpodest standen auf der einen Stufe winzige Schuhe aus Porzellan, spitz zulaufend und üppig mit Blumen dekoriert, auf der anderen aber Ledergaloschen, schwer anmutende Schnürstiefel, ebenfalls in Miniatur, richtige Arbeitertreter, ich hatte solche Schuhe nie zuvor gesehen, weder klein noch groß. Betrat man nun seine winzige Werkstatt, schellte das Glöckchen und er kam aus dem angrenzenden Wohnzimmer herbeigeeilt, nahm die Schuhe in Augenschein, schüttelte lächelnd den Kopf, um mir zuletzt ein kleines Zettelchen mit meinem Namen auszuhändigen. Zum alten Bunge lief ich vor ca. 20 Jahren, laufe ich heute zu ihm, stehen keine Schuhe im Schaufenster, schellt kein Glöckchen mehr, die Tür ist seit Langem verschlossen. Er war der letzte Schuster im Ort, ein Abkömmling jener Flickschusterdynastien, die wahrscheinlich noch mit der Kiepe auf dem Rücken von Dorf zu Dorf ihr Handwerk priesen; er war – wie ich es nun verstehe – schon damals ein lebender Anachronismus, einer Vorzeit entstammend, da die Handwerksbude noch mit dem Lebensraum untrennbar verbunden und der Handwerksstand eine Sache der Tradition, der Familienehre war. Heute fährt man in die Supermärkte, die die kleine Stadt wie Epidemieherde an der Peripherie einkreisen, um Schuhe zur Reparatur zu bringen, den Einkauf zu erledigen, Post abzuschicken, bei wem auch immer, die Namen sind austauschbar wie die Dinge, das alte Verweissystem Schuhe=Bunge ist aufgehoben. Das eigentliche Zentrum jedoch; der kleine Marktplatz, gähnt schaurig mit den zahnlosen Mündern leerer Schaufenster im Zuge globalisierender Verniemandung. Ich hatte das unverschämte Glück, einen Zuspätkommer, einen letzten Widerständler einer längst untergegangenen Epoche gerade noch erleben zu können. Einer Epoche, die ihren Abgesang mindestens 100 Jahre zuvor einstudierte, als das Handwerk, das noch ein geschlossenes System von Seele, Auge und Hand darstellte, vom sogenannten grassierenden Fortschritt dem Untergang geweiht wurde. Wer erinnert sich der verschwundenen Berufe wie Bleicherin, Schäfer, Kutscher, Landarbeiter, Sackflicker, Gänserupfer, Alteisenhändler, Fellaufkäufer, Essig-, Seifen- und Leitermänner, an die Hausschlächter, und Schafscherer. Wer erinnert sich schon an die Statisten der Geschichte, die „fristgerecht abgetreten / von der bühne / im namen aller namenlosen“ („statist“), wer erinnert ihr fast lautloses Verschwinden, den Zusammenbruch einer mittelalterlichen Ordnung, die uns heute nur noch märchenhafter Stoff aus einer unterentwickelten Vorzeit scheint. Wer erinnernd die Namen zu bewahren sucht, denen kein Eintrag Rechnung trägt, „inständig die leute benenn(t), ihre ausdauer, ihre werktaggeduld“, misstraut nicht nur den notorischen Geschichtsfälschern, sondern auch dem Gedächtnis als Sache des Kollektivs, wer sich erinnert, ist dabei gewesen, „an einer so einschneidenden Stelle der Geschichte, an der die Ränder zweier Epochen aufeinanderkrachen wie Eisberge, von denen einer zerschellt“. („Die Prinzessinnen im Krautgarten“) Wulf Kirsten war dabei, als scheinbar ewige Ordnungen wie Kartenhäuser ineinanderfielen, hatte er „Geschichte vor Augen, die sich auf ganz konkrete ortsgebundene Momente und Bilder auffädelt: Schützengräben hinterm Eltenhaus, aus denen zum Glück nicht mehr geschossen wurde, Reste des deutschen Heeres auf der Flucht…, die Nacht der Nächte in den Runkelrübenkatakomben der nachbarlichen Lehmannsmühle, der Einmarsch der Befreier, Plünderungsfreiheit aus der Optik der Geängsteten, Russentage genannt, Entnazifizierung an zwei Tischen im Dorfgasthof, Bodenreform hinterm Haus,… und so fort bis hin zu Zwangskollektivierung im Frühjahr 1960, womit innerhalb weniger Jahre der Stand der Bauern abgeschafft wurde.“ („Landschaft im Gedicht“)
Was sich im Dorf seiner Kindheit zutrug, wurde ihm letztendlich zum Lebensstoff, den es abzuwälzen, zu erzählen gilt: „Nach mancherlei Versuchen, die an relativ rasch wechselnden Vorbildern Maß zu nehmen versucht hatten, gestand ich mir ein, nur das gestalten zu können, was ich kenne. Also galt es, sich ausschließlich auf sein eigenes Lebensmaterial zu verlassen.“ „Beschränkung auf eben das Stück Landschaft, in dem ich mich auskenne. In der Absicht, dies pars pro toto für Welt zu setzen.“
So wuchs aus einer frühen Einsicht eine literarische Haltung, will sagen, eine strenge Poetik, die der Indifferenz, der zuweilen abstrakten Vagheit und dem fiktionalen Charakter zeitgenössischer Dichtung, die konkrete, geschichtlich verankerte Erfahrung von Welt wortwörtlich entgegensetzt. Wulf Kirsten ist kein Geschichten-Erfinder, vielmehr scheint er ganz im Sinne Walter Benjamins einer jener sesshaften Erzähler, der, redlich sich nährend, im Lande geblieben ist und dessen Geschichte und Überlieferungen kennt:
Der Erzähler nimmt, was er erzählt, aus der Erfahrung; aus der eigenen oder berichteten. Und er macht es wiederum zur Erfahrung derer, die seiner Geschichte zuhören. (…) Die Erzählung, wie sie im Kreis des Handwerks – des bäuerlichen (…) – lange gedeiht, ist selbst eine gleichsam handwerkliche Form der Mitteilung. Sie legt es nicht darauf an, das pure „an sich“ der Sache zu überliefern wie eine Information oder ein Rapport. Sie senkt die Sache in das Leben des Berichtenden ein, um sie wieder aus ihm hervorzuholen. So haftet an der Erzählung die Spur des Erzählenden wie die Spur der Töpferhand an der Tonschale.
Der Erzähler ist, so Benjamin, ein Chronist und damit vom Historiker unterschieden:
Der Historiker ist gehalten, die Vorfälle, mit denen er es zu tun hat, auf die eine oder andere Art zu erklären; er kann sich unter keinen Umständen damit begnügen, sie als Musterstücke des Weltlaufs herzuzeigen. Genau das aber tut der Chronist, und besonders nachdrücklich.
Wulf Kirstens Musterstücke wie beispielsweise der Schnür-Mäusel, der Waldläufer Manoli, Ochsenkutscher Maroske oder Nachbar Oswin, allesamt Schicksalswesen, altmodisch gestiefelte Eigenbrödler stehen stellvertretend für so viele, die namenlos unter der Geschichtslast begraben nichts hinterließen, an die kein Ort auf der Welt erinnert. Kein Bild, kein Grab blieb nach. („Gottfried Silbermann“) Dabei werden diese kleinen Helden niemals ausgestellt oder vorgeführt, es wird ihrer gedacht, den Stimmlosen, ein Gedenken gestiftet, „wo grab um grab überwuchs / das schnellebige jahrhundert“.
Mögen viele dieser Musterstücke oft und ausdrücklich an die Bedingungen des Handwerks bzw. weltläufige Handfertigkeiten gekoppelt sein, das Joch körperlicher Arbeit, so wäre es doch zu kurz gegriffen, diese Texte rein als inventarisierende Handwerkskammer zu deuten. Im Vordergrund steht, wie mir scheint, das Wechselspiel verschiedener historischer und sozialer Wirkkräfte und deren Niederschlag in den Beschädigungen des Menschen.
Zu all den Außen-Faktoren, mit denen das Individuum konfrontiert wird und die es in sich austragen und verkraften muß, kommen die individuellen Prägungen in Raum und Zeit, die manuellen und geistigen Erfahrungen. All dies angesichts rasender Veränderungen, die mit Abbrüchen und Untergängen alter Lebensformen verbunden sind.
Das Handwerk und die naturgebundene Arbeit bestimmten das alltägliche Leben auf den Dörfern, bestimmten den Rhythmus der kleinen autarken Gemeinschaften und prägten zugleich Wulf Kirstens Biographie, der in solcherart agrarischer Gemeinschaft, mit seinesgleichen, aufwuchs, somit geraten die Handfertigkeiten automatisch als feste Größe, quasi Gradmesser der Veränderung im Zuge eines Globalisierung genannten Flächenfraßes in den poetischen Fokus des Dichters:
Zur Eigenart agrarischer Gefilde, in denen sich spätfeudale Besitzverhältnisse bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gehalten hatten, kamen in meinem Fall extrem altmodische Lebensformen als Erlebnishintergrund hinzu, wie sie sich andernorts längst überlebt hatten. Eingeschränkte Mobilität, kleingekammertes Raumgefühl stärkten territoriale Verbundenheit und intensivierten Kommunikationsmöglichkeiten mit all ihren Vorzügen und Schattenseiten. Die Aufnahme dieser kleinen Welt verführte regelrecht zu detaillierter Weltwahrnehmung. In dieser vorindustriellen Reliktlandschaft bildeten Dörfer, zumindest solange meine Kindheit währte, noch weitgehend in sich ruhende, annähernd autarke Lebensgemeinschaften. Während sie danach innerhalb weniger Jahrzehnte einem galoppierenden Prozeß der Auflösung bäuerlicher Funktionalität unterworfen waren, der zur Anonymisierung führte, zur individuellen Abkapselung, so daß ich heute die mir vertrauten Dörfer wie ausgestorben, wie scheintot, als reine Schlaforte vorfinde.
In Wulf Kirstens poetologischen Ausführungen gewinnt ein weiterer wichtiger Begriff – bisher scheinbar unbemerkt – Land: die Gemeinschaft (oder, wie es Göran Rosenberg nannte, der Wärmekreis):
Eine Form naiven Eingebundenseins in ein menschliches Miteinander – die einst vielleicht allgemeine Lebensbedingung war, heute aber nur noch in Träumen existiert. Mitmenschliche Loyalität, die innerhalb des „Wärmekreises“ ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, lässt sich „aus keiner externen sozialen Logik ableiten oder aus einer ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse“. (Zygmunt Bauman)
Im Zuge der sogenannten industriellen Revolution und durch die Einführung der Fabrikarbeit wurden die traditionellen Gemeinschaften aufgelöst und mithin jenes „natürliche Einverständnis“, der von der Natur bestimmte Rhythmus der Landwirtschaft und die von Tradition bestimmte Routine des Handwerkerlebens wurden durch eine neu entworfene; mit Hilfe von Zwangsmitteln und Überwachungsmaßnahmen durchgesetzte „Routine“ (Bauman) ersetzt.
Diese Transformation der bäuerlichen Gemeinschaft in die Vermassung der Fabrikarbeiter erodierte nicht allein den natürlichen Werkinstinkt, entkoppelte die Arbeit von den Begriffen Würde, Wert und Ehre unaufhaltsam, sondern ebenso ein besonderes zwischenmenschliches Gefüge, das autonom, von einer strengen, eigenen und nichtverhandelbaren Logik geprägt und damit unanfällig für Manipulationen und Veränderungen war. Da die Interaktionsstränge zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft so dicht verwoben waren,, dass feste Bindungen entstanden, und nur durch eben diese Bindungen und Abhängigkeiten konnte die Gemeinschaft aufrechterhalten werden. Um es mit Kirsten zu sagen:
Was im Dorf einem einzelnen widerfuhr im Guten wie im Bösen, war immer dem ganzen Dorf geschehen. („Die Prinzessinnen im Krautgarten“)
Nach zwei Jahrhunderten sind wir, wie es Zygmunt Baumann nennt, im Zeitalter der Bindungslosigkeit, die bedeutsamer Weise auch als posttraditional bezeichnet wird, angekommen und diese Bindungslosigkeit ist allumfassend.
Damit nicht genug, die entfremdete Arbeit schluckt nicht nur die kleinen autarken Gemeinschaften und vernichtet somit all das, was man unter den Begriff territorialer Heimat subsumiert, sondern sie verwüstet zugleich die Sprache, jene Besonderheiten sind nun außer Gebrauch, platt gemacht, so stirbt zugleich die zweite Heimat des Dichters, die vielleicht sogar seine erste ist, die Sprache, seine poetische Existenz. Denn „alle Worte sind verloren mit den Dingen / die der große Schlingschlang fraß“. So ist im Werk Kirstens nichts einzeln zu denken, nichts zu reduzieren auf bloße Kategorien wie: Handwerkskammer, Sprachkammer untergegangener sächsischer Mundart, Kuriositätenkabinett, Landschaftserkundung oder aber trotzig anachronistisches Standbild einer verlorenen mittelalterlichen Welt, alles unterliegt einem vielfältigen und wechselseitigen Bezugssystem, das eine ist ohne das andere nicht zu denken, jede Beschränkung auf eine bloße Inventur der Einzelphänomene muss angesichts dieser Vielschichtigkeit zwangsläufig zu kurz fassen:
Beginnt man dieses mit Geschichte durch und durch infiltrierte, inkrustierte Material literarisch zu bearbeiten, so daß persönliche Erlebnisse, Erfahrungen und verallgemeinerbare gesellschaftlich-historische Zusammenhänge in einem Konnex stehen, findet man kein Ende angesichts einer erdrückenden Überfülle beider Komponenten. Nahezu bohrend schmerzhaft werden Erinnerungen abgefragt, reaktiviert, Vergessenes, Halbvergessenes durch Gedächtnistraining zurückzugewinnen gesucht.
Die verlorene Heimat, die Georg Lukács als den Kern aller Kunst und damit aller Literatur benennt, ist in Kirstens Biographie Wirklichkeit und nicht allein Chiffre, aber wie sich nun diesem Verlust mit poetischen Waffen nähern, den großen begrifflichen Abstrakta der Entfremdung, ohne an dieser Sprache, die selbst Teil des Ganzen ist, zu laborieren, wie sich also poetisch nähern, wenn nicht über Einzelschicksale bzw. die eigene Biographie, das, was eben habhaft erzählbar ist, um Schritt für Schritt aus dem vermeintlichen Provinztheater, mit seinem kleingekammerten Raumgefühl, ein Welttheater abzuleiten, belebt von den Statisten der Geschichte, die, als solitäre Phänomene in dieser Dichtung bewahrt, die Gleichmacherei des Fortschritts oder Fortschrotts (wie Gerhard Falkner einmal trefflich polemisierte) stoisch überstanden.
Kirsten enthebt diese Einzelschicksale, die wie Kehrricht durcheinander gewirbelt wurden, aus der Anonymität der Masse, die den Menschen verschlingt und maximal als statistische Größe, als bloßes numerisches Faktum bestehen lässt. Auf dem Schrottplatz seiner kleinen Weltgeschichte sammelt und sichert er die biographischen Spuren jener Flattergeister unruhiger Jahre, die schattenhaft durch seine Erinnerung geistern, denn was und wer immer gewesen ist, hat etwas hinterlassen. Er fügt die ausgesonderten Teile durch unerbittliche Gedächtnisbefragung eins ums andere zusammen und setzt die verschütteten Biographien ins Gedicht. So wuchs über Jahrzehnte hinweg ein wunderliches Personal, das seine Gedichte und Prosatexte bevölkert. Es sind allesamt Widerständler, wie mein Schustermeister Bunge, die uns deshalb zeitentrückt und außergewöhnlich erscheinen obwohl sie doch gerade paradigmatisch für den Alltag einer Epoche einstehen, sie alle repräsentieren eine entschwundene Zeit, fanden jedoch ins kollektive Gedächtnis, das nur die heroischen, ja, monolithisch herausragenden Einzelkämpfer gelten lassen will, keinen Eingang.
Wulf Kirsten betreibt eine eigene, eine subjektive Geschichtsschreibung: durch den Rückgriff auf Vergangenheit, manische Gedächtnisbefragung und Sammelleidenschaft. Was schreibend dem Vergessen abgerungen, aus der Erinnerung geborgen wurde, liegt ver- und bewahrt in einer aufgerauten, widerständigen Sprache, die sich, durch handwerkliche Genauigkeit und akribische Wortarbeit, gegen Sentimentalität und oberflächliche Lesbarkeit verwahrt. Sich also wappnet gegen die Bocksgesänge auf die gute, alte Vergangenheit, die Suche nach dem verlorenen Paradies oder versunkene Idyllik, denn verklärende Nostalgie oder heimattümelnder Kitsch ist Kirstens Sache nicht. Wiewohl es aber ein mutiger Versuch ist, sich in einer Zeit, da der Traditionsstrom unterbrochen und nur die Ideologie vom Ende aller Ideologien herrscht, in der jedes kritische Notat dem schnöden Kulturpessimismus zugeschlagen wird, ohne den optimistischen Wunsch nach einer Verbesserung der Zustände darin zu deuten, gegen den Status quo zu stellen.
In dieser Zeit gewinnt der Chronist, der die Mitteilung von der reinen Information noch zu trennen wusste und wie Wulf Kirsten sein Lebenswerk der akribischen Gedächtnisbefragung, „dazu verdammt anzuschreiben gegen das schäbige vergessen, das so viele leben einschließt“ und sich somit zugleich dem Marginalen, Verworfenen, Vergänglichen widmete, angeht gegen das Verschwinden und letztlich meines und deinesgleichen geschichtsfähig macht, größtmögliche Bedeutung, damit der Stafettenstab nicht in eine geschichts- und gesichtslose Leere gereicht wird. Sollte ich also dennoch genötigt sein, dieses Werk einer statischen Kategorie unterzuordnen, einen Begriff zu finden, der meines Erachtens taugt, so ist es einzig der Humanismus, dem ich es beugen würde. Denn ruft „da nicht einer: Gerechtigkeit, wo bist du, wo bleibst du, vergeblich“ in einer Zeit, da selbst das Geschrei, neues Unheil im Anmarsch, ungehört verhallt?
Nancy Hünger, aus Wulf Kirsten – die Poesie der Landschaft. Gedichte, Gespräche, Lektüren herausgegeben von Jan Röhnert, Stiftung Lyrik Kabinett, 2016
Lieber Wulf
Wann wir uns erstmals begegneten, weiß ich nicht mehr, aber seither sind viele Jahre vergangen. Nun wohnst Du in meiner Erinnerung und bleibst in Deinen Büchern. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit trafen wir einander am Künstlerstammtisch, zu dem Gisela Kraft nicht müde wurde einzuladen. Es war eine freundliche Runde, nicht nur auf Dichter beschränkt, und neben Gisela warst Du es, der maßgeblich den Ton angab. Von Treffen zu Treffen stellten wir reihum einander in Kürze vor, was uns gerade beschäftigte. Die anteilnehmende Kritik und spontanen Kommentare schenkten neben Aufmerksamkeit auch Ermutigung. Dabei ging es nie laut zu, kein einfaches Drauflosschwadronieren, wohl bedacht die angemessenen Worte zu finden, das war Dir wichtig.
Für ein Künstlerbuch mit Lithografien gabst Du Ullrich Panndorf und mir Anfang der neunziger Jahre drei Balkangedichte. Eines davon, „Stimmenschotter“, wählten wir als Titel. Zeitgleich erschien im Ammann Verlag unter gleichem Namen ein umfangreicher Band mit Deinen Gedichten. Also haben wir einfach auf die ISBN verzichtet, denn von der aussagestarken Wortschöpfung wollten wir nicht lassen. Über die Jahre hast Du unsere Versuche im Bildermachen nicht ohne Wohlwollen und mit Interesse verfolgt. Anfang 1999 schenktest Du mir zur Ausstellung in Weimar Deine Textur-Reden und Aufsätze, die es in sich haben, und Anfang Oktober 2004 die erdlebenbilder – dem zwanzig Jahre Jüngeren zum 50. Geburtstag „gedichte aus 50 jahren 1954–2004“. Dort ist auch die Balkan-Trilogie von 1987/88 wieder zu finden und so vieles mehr. Freilich begegneten mir auch Die Prinzessin im Krautgarten, Kleewunsch und Die Schlacht bei Kesselsdorf. Besonders eindrücklich in der Erinnerung bleibt mir Der Berg über der Stadt zwischen Goethe und Buchenwald mit Fotos von Harald Wenzel-Orf und Deinen Texten. Ich wurde in Weimar geboren, es ist meine Stadt, das geht mir ans Herz.
Später fürs Dreierlei der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V. fragtest Du mich nach einer Grafik zu „durchsichtig“. Im Gedicht kommen Brod, Kafka und Goethe vor, aber auch Gretchen „… gerade sechzehn geworden…“ und ein im Hochsommerlicht „durchsichtig“ scheinendes Kleid. Ja wer schaut denn da „erotisiert“ und leicht verlegen? Vielleicht sogar Kafka, nicht als Käfer, sondern selbst zum „backfisch“ geworden. Schließlich ereilte mich auch ein Ruf des Elsbeer-Quartetts. Gern und mit Vergnügen habe ich geholfen, dem geplanten Büchlein Gestalt zu geben.
Neben meinem Arbeitsplatz im Steinbruch Ehringsdorf habe ich zwei Elsbeerbäume gepflanzt, sie sind gut angewachsen, und wenn ich sie sehe, denke ich auch an Dich…
Walter Sachs, aus Unterwegs mit Wulf Kirsten. Eine Freundesgabe, herausgegeben von Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, Elsinor Verlag, 2023
Fünfunddreißig Jahre Bewunderung
Am 16. Mai 1986 fuhr ich, auf Empfehlung von Martin Walser, mit meinen Kollegen Friedrich Werner und Thomas Schröer 360 Kilometer weit nach Ravensburg und zurück, um dort Wulf Kirsten kennenzulernen. Seine Lesung beeindruckte uns so sehr, daß wir beschlossen, den Dichter auch nach Weilheim einzuladen.
Ich war seit 1975 regelmäßig in die DDR gefahren, um Verwandte in Steinbach-Hallenberg in Süd-Thüringen zu besuchen, und freute mich jetzt auf Weimar. Nach meinem ersten Besuch schrieb Wulf Kirsten in sein Buch Die Schlacht bei Kesselsdorf:
für Fritz Denk mit der Verpflichtung zum Wiederkommen – herzlich Wulf Kirsten – Weimar, 9. September 1986
Ich kam in der Tat bis Ende 1992 14mal wieder. Vom 22. bis 27. Februar 1990 besuchten wir mit Schülerinnen und Schülern Weimar, wo wir u.a. eine Lesung von Wulf Kirsten erleben durften. Ein anderes Mal fuhr ich, begleitet von Prof. Eberhard Dünninger, Prof. Karl Stocker, Hans Heck, Thomas Schröer und Fritz Werner nach Weimar, Greiz und Reichenbach, wo wir an drei Gymnasien insgesamt 2.500 Deutschlektüren und Lehrbücher sowie Kopierer überreichten. Und in Weimar lernte ich dank Wulf Kirsten den Autor Wolfgang Haak, den Germanisten Dr. Eberhard Haufe und die Familie des Musikers Hermann Sprenger kennen. Das wichtigste Ereignis war seine wunderbare Lesung am 23. Oktober 1989 in Weilheim, „einer der Höhepunkte der Weilheimer Dichterlesungen“ (Weilheimer Tagblatt, 25.10.89), vorbereitet vom 27. Weilheimer Heft zur Literatur: Das Haus im Acker und andere Gedichte. Daran erinnerte er sich 31 Jahre später im folgenden Brief:
Weimar, 30. Oktober 2020
Lieber Friedrich,
leider habe ich zu meinen zahlreichen Lesereisen in Deutsch-Ost wie -West nicht Buch geführt. Was nicht alles werd ich nun mit 86 vergessen haben? Aber es gibt eine Handvoll Freunde, für die es da keine Unterschiede gab und gibt. Du stehst dabei entschieden ganz oben. Darüber wäre zu reden. Vielleicht separat?
Wie oft werd ich in Weilheim gewesen sein? Nicht nur im Gymnasium, wo man, wo ich vor 500 Gymnasiasten, Lehrern, Besuchern auftrat. Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, las ich daselbst zu einem historischen Zeitpunkt. Fiel da nicht grade die komplette DDR wie ein Kartenhaus in sich zusammen?
Alles was in Weilheim geschah, zeichnete sich aus durch Deine perfekte Organisation. Wie da auf die Minute genau der Einzug mit dem Direktor des Gymnasiums vorher geprobt wurde. All das eingebunden in Dein gesamtdeutsches Denken, Handeln in Richtung Ausgleichen, Angleichen. Was ja von so vielen Deutschen bis heute nicht geschafft wurde. Das Bundesverdienstkreuz müßtest Du haben. Als einer, der ein Beispiel gab. Mit seinen Schülern in Weimar war, was zumindest in einem meiner Gedichte1 dokumentiert wurde. Das Schwarzbierhaus in der Geleitstraße läßt grüßen.
Und mit wie vielen prominenten Schriftstellern „gastiertest“ Du im Schiller-Gymnasium? Mit so einigen lief ich dann anderntags durch die Stadt.2
Die von Dir so perfekt organisierten Veranstaltungen waren so beispielhaft, exzellent, daß sie sich nicht vergaßen. Wieso hat mich eine Exkursion mit Dir auf den Peißenberg nahe Weilheim so nachhaltig beeindruckt? Ich sehe uns noch immer stehen, weit ins Oberbayrische blicken. Natürlich auch Begegnungen bei uns in der Weimarer Wohnung. Du mit Gefolge, darunter mindestens zwei „Adjutanten“.
Nicht zu vergessen, was Du in dieser Umbruchzeit, teils chaotisch, aber unsererseits voller Zuversicht, Hoffnungen, an Lehrbüchern mitbrachtest. Bald werde ich wohl „letzter Mohikaner“ sein, der sich an all die von Dir als Zentralissimo inszenierten Aktivitäten (im Zustand des Glücks, das INEINSGEHEN zu erleben) erinnert. Daß sich die SED-Apparatschiks ihren Untergang selber beschert hatten, gesponsert von einer weitgehend friedlich-christlichen (ungelogen!) Revolution – war für unsereinen zwingend klar. Nur nicht, daß es zu meiner Lebenszeit geschah (meine Eltern lebten nicht mehr).
Ich grüße Dich, die Deinen, Deine Kollegen, die mit Dir gesamtdeutsch wirkend unterwegs waren und mit denen ich meine Erinnerungen gern teile…
Herzlich mit Zitterschlag,
Dein Wulf
Friedrich Denk, aus Unterwegs mit Wulf Kirsten. Eine Freundesgabe, herausgegeben von Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, Elsinor Verlag, 2023
BRAUNKOHLENSOMMER
für Wulf Kirsten
Nie stürzte der Himmel ein in diesen endlosen Sommern
in denen Sepiawolken & kandierte Aromen
von den südlichen Kokereien in die Stadt geweht wurden.
Und nie sah man schönere Leberflecke
als im Waldbad am Mühlholz, wo die Pleiße in öliger Bronze
die Ballhascher von den Sprungteufeln trennte.
Wenn die Rußfackeln über der Kimmung zuckten
und ein neunfarbiger Regenbogen den Himmel verkuppelte
preßte die Schwerlast des Glücks uns den Brustkorb zusammen.
Zögernd folgte man dann einem Schemen auf Augenhöhe
einem Glimmen aus spöttischem Mundwinkel folgte man
einem federnden Rücken mit verschnittenen Flügeln.
Thomas Böhme
Lesung Wulf Kirsten am 27.11.1991 im Deutschen Literaturarchiv Marbach
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Archiv + KLG + IMDb +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


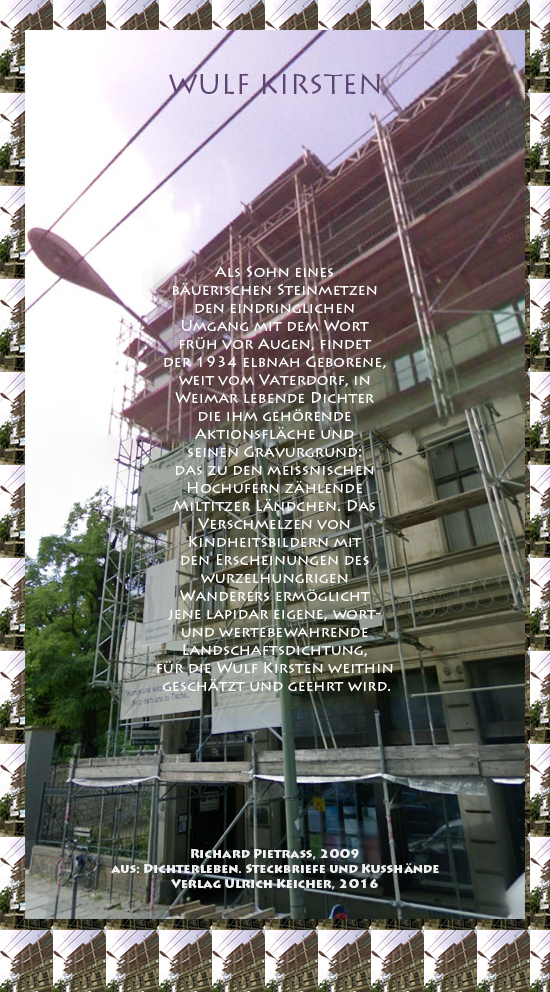












Schreibe einen Kommentar