Zbigniew Herbert: Das Land, nach dem ich mich sehne
TESTAMENT
Ich vermache den vier elementen
was ich zur kurzen verfügung hatte
dem feuer – meine gedanken
möge das feuer blühen
der erde die ich zu sehr geliebt
meinen körper taubes korn
und der luft worte und gesten
und die sehnsucht das heißt nutzlose dinge
was übrigbleibt
ein wassertropfen
mag zwischen himmel und erde
kreisen
mag es durchsichtiger regenfall sein
farnkraut des frosts flocke des schnees
mag es den himmel niemals erreichend
zum jammertal hier
zurückkehren als treuer tau
geduldig die harte scholle zu rühren
bald geb ich den elementen zurück
was ich zur kurzen verfügung hatte
ich kehre nicht wieder zur quelle der ruhe
Deutsch von Karl Dedecius
Sehsucht und Sehnsucht
Gibt es noch einen europäischen Dichter? Einen, der nicht nur die Sprache seines Landes mit seiner poetischen Energie auflädt, der auch außerhalb der lokalen Literaturgeschichte und in fremden Sprachen ein Maß an Verständigung stiftet, das über den normalen Begriff von Literatur hinausweist? Einen, der nicht durch bizarre formale Erfindungen die Grenzen überspringt, sondern kraft seiner poetischen Ideen? Je durchlässiger die Grenzen geworden sind, je leichter der Austausch vonstatten geht, je stärker sich die nationalen Eigenschaften angeglichen haben – desto schwieriger scheint es zu sein, das Ganze der europäischen Poesie und Poetik noch einmal auszudrücken.
Zbigniew Herbert gehört zu den seltenen Dichtern, denen dies gelungen ist. Beim Lesen der Werke dieses freundlichen Herrn aus Lemberg, zeitlebens unter heftigen polnischen Kopfschmerzen leidend, hat man stets das Gefühl, sich im Zentrum eines unerhört starken Magnetfeldes zu befinden. Mühelos angesaugt und geordnet wird eine unerschöpfliche Menge an Material, die einen weniger subtilen Geist leicht zum kauzigen Historiendichter hätte werden lassen. Bei Zbigniew Herbert dagegen entsteht Ordnung, eine kleine Insel inmitten des geschichtlichen Chaos, die plötzlich auftaucht: aus Wörtern gebildet, die jeder im Munde führen kann, aus Ideen und Erfindungen. Weit davon entfernt, an eine Remythisierung der Erfahrung zu glauben, stöbert dieser gelehrte Pole, der nichts von einem Akademiker hat, in dem europäischen Mythenschatz herum, um die alten Geschichten vergegenwärtigend neu zu bedenken. Seine nie versiegende Sehsucht und seine historisch entwickelte Sehnsucht haben verhindert, daß er zum Zyniker wurde, der dem Untergang kunstvoll die Stimme leiht. Nein, dieser letzte Europäer, der wie kein anderer die Verluste kennt und auf das empfindlichste zur Sprache bringt, ist trotz aller Erfahrung zu menschenfreundlich, um zum Verächter zu taugen.
Ich war wenig älter als zwanzig, als ich den ersten Band von Zbigniew Herbert kaufte, mit der wunderbaren Hommage an den nicht zähmbaren Kiesel: ich spür einen schweren Vorwurf gegenüber diesem vollkommenen Gegenstand, der uns alle überleben wird. Seither begleiten mich seine Texte wie eine Handvoll Kiesel, die ich, trotz des Vorwurfs, stets bei mir trage. Verläßliche, klare Gegenstände, in denen Wissen und Gefühl, Geschichte und Gegenwart, „Lebenszeit und Weltzeit“, Mut und Verzweiflung souverän vereint sind und eine Wärme erzeugen, die nur und ausschließlich von großer Poesie abgestrahlt wird. Und wenn ich sie lese, höre ich sofort die leise höfliche Stimme ihres Erfinders und sehe sein verschmitzt-besorgtes Gesicht und weiß, daß er in der Nähe ist. Seine unbestechliche Nähe tut gut!
Ich grüße Dich!
Michael Krüger, Vorwort, August 1986
Zu Zbigniew Herberts Leben und Werk
Zbigniew Herbert wurde im Jahre 1956 bekannt, zusammen mit einigen anderen Dichtern, die in der Euphorie der Tauwetter-Periode ihre Wahrheit vor der Öffentlichkeit bekunden wollten; mit seinen Altersgenossen hatte er jedoch wenig gemein. Während diese die Vergangenheit mit Hochmut und Verachtung abtaten, brachte Herbert ihr ostentativ Ovationen dar. Ihre trotzige Poetisierung des Häßlichen beantwortete er mit dem Festhalten an ästhetischen Konventionen. Ihrem ungestümen Individualismus setzte er die Distanz zur eigenen Person entgegen. Statt der vordergründigen Groteske gebrauchte er die mehrdeutige Ironie. Damit unterschied er sich von der vorherrschenden literarischen Mode deutlich. Er war älter: 1924 in Lemberg (Lwów) geboren, veröffentlichte er zwar 1950 drei Gedichte, blieb dann aber in der Stalin-Ära verschwiegen.
Alles deutet daraufhin, daß er sich für einen „Trauerarbeiter“, einen Erben der Katastrophe hielt. Im „Lebenslauf“ schreibt er, daß er nach der Befreiung, die er „abermals mit den Tränen der Scham“ angenommen hatte,
nicht sogleich mit dem Leben einverstanden war
(…)
Poesie sei nach seinem Verständnis eine Tochter des Gedächtnisses.
Verlorenheit an die Welt, aber auch unstillbare Neugier sind Herberts Lebenslauf abzulesen. Er war Sohn eines Bankdirektors und – wie es sich gehört – konspirativer Gymnasiast, Student, Soldat. Nach dem Krieg studierte er Handelswissenschaft, Polonistik, Kunst, Philosophie und Jura, von Krakau nach Danzig und von Thorn nach Warschau wandernd. In jenen Jahren hat er sicherlich sowohl sein vielseitiges Wissen als auch den offenen Blick für die Kultur erworben, was ihm später bei der Niederschrift seiner Essays Ein Barbar in einem Garten (1962) zugute kam. Erfolg und Mißerfolg lösten in seinem Leben einander ab: Mal arbeitete er als Verkäufer, dann wieder als Bankangestellter, in Büros oder in Redaktionen, später bereiste er mehrere Jahre das Ausland, als „Zigeuner“-Tourist oder als Stipendiat, bald auch als Preisträger, da er nach der Veröffentlichung der Gedichtbände Lichtsaite (1956), Hermes, Hund und Stern (1957) und Studium des Gegenstandes (1961) rasch anerkannt und berühmt wurde. Seine Gedichte fanden Übersetzer, er erhielt polnische und ausländische Preise, darunter den Lenau– (1965), den Herder– (1973) und den Petrarca-Preis (1979); nur eines Staatspreises wurde er nie für würdig befunden. Der Ruhm ließ ihn indessen ziemlich unbeeindruckt: Er blieb nach wie vor der Dichter auf Reisen, der charmante Unterhalter und der Kamerad, für jede Überraschung gut, verliebt in die Welt und recht gleichgültig den vergänglichen Dingen gegenüber. Herbert läßt sich besser verstehen, wenn man ihn in einer Reihe neben Różewicz, Borowski und Baczyński betrachtet, die, wie er, Zöglinge der Zeit zwischen den Weltkriegen und Gezeichnete des Krieges waren. Sie alle hatten die Kulturkrise nicht in der Bibliothek erlebt, sondern auf der Straße, im Konzentrationslager oder im Wald. Sie starben von der Hand ihres Nächsten und sie töteten diesen Nächsten, oder sie drückten sich vor dem Tod mit Schlauheit oder Heroismus. Sie waren sehr jung. Über die Welt, die Geschichte und die Menschen wußten sie das, was ihre Religions- und Lateinlehrer ihnen beigebracht hatten. Ihre christliche und humanistische Tradition mußten sie nun überwinden oder ihr eine neue Tiefe abgewinnen lernen; denn sie war durch Schule und Gesellschaft verflacht und nach einem nationalen, oftmals provinziellen und oberflächlichen Maßstab zurechtgestutzt. Wir erinnern uns an Różewicz’ Sarkasmus und Borowskis politische Bedingungslosigkeit. Die kulturelle Tradition konnte die Zeit der Menschenunwürdigkeit verhindern. Was blieb da anderes übrig als zynische Verzweiflung (die vielleicht eine Erneuerung zu bewirken hatte?) oder ideologischer Fanatismus (der den Menschen völlig umgestalten sollte…)?
Bei Herbert ist nichts dergleichen zu finden. Er hat die Krise der Werte auf entgegengesetzte Weise gelöst: Das kleine Wort „also“ kennzeichnet die Wahl, die er getroffen hat gegen seine Epoche und gegen die Komplexe der Geschlagenen:
wovon sprechen die fünf
in der nacht vor der vollstreckung
von den prophetischen Träumen
vom abenteuer im bordell
von fahrzeugteilen
von der seereise
(…)
von mädchen von früchten
vom leben
also darf man
in der lyrik namen von griechischen hirten verwenden
versucht sein die farbe des himmels am morgen zu bannen
von liebe schreiben
sogar
noch einmal
mit sterblichem ernst
der verratenen welt eine rose
schenken
(„Die fünf“)
Nach dieser Entscheidung trugen alle seine Arbeiten den inneren Zwiespalt zwischen dem „engel der schizophrenie“ und dem „engel der ironie“ („Die Verrückte“) aus. Letztlich blieben Herberts poetische Qualität und Eigenart unangetastet. Weder die Demütigungen im Krieg noch die darauf folgende Barbarei konnten den Überzeugungen und dem moralischen Pflichtbewußtsein des Dichters etwas anhaben. Dieses Pflichtbewußtsein ist allerdings „schizophren“, denn es steht im offenen Widerspruch zur Welt. Wenn Herbert beispielsweise „mit sterblichem ernst“ der Welt eine Rose schenkt, betont er vorweg, wie anachronistisch das sei; und doch ist er überzeugt, richtig zu handeln. Er fügt nur dem Bild, das er dem Leser vorzeigt, das Selbstbekenntnis zur eigenen Lächerlichkeit hinzu… Damit beweist er seine (zumindest intellektuelle) Überlegenheit denen gegenüber, die die „Rose“ voreilig auf den Kehrichthaufen der Geschichte geworfen haben. Mit Hilfe der Ironie gelingt es Herbert, die Diskrepanz zwischen Norm und Realität, Ideal und Erfahrung, Tradition und Gegenwart aufzuheben. Gegen wen oder was richtet sich aber sein subtiler Spott? Wohl nicht gegen die überkommenen Kulturwerte, denn diese will der Dichter ja bewahren. Nicht gegen die Realität, denn dieser Kampf wäre aussichtslos. Die Ironie muß sich vielmehr gegen den modernen Menschen selbst richten, in dem Recht und Realität aufeinanderprallen: das bedeutet zuerst gegen den Dichter selbst oder – genauer – gegen sein lyrisches Ich. Der Dichter zeigt, wie unfähig er ist, seinen eigenen Wertvorstellungen gerecht zu werden. Damit führt er uns vor, gleichsam wie ein verliebter Clown, wie groß seine unbeholfene Treue zu den Idealen ist.
Beispiele? Der Dichter befragt sein Gewissen, „die innere Stimme“. Die Stimme weiß aber keinen Rat, sie murmelt lediglich „glu-glu“. Ist es der sokratische Daimon, der dem modernen Menschen mit einem hilflosen Schluckauf antwortet? Es sieht so aus, doch während der Dichter sich an sein eigenes Gewissen wendet, beteuert er:
ich hatte so etwas noch nie
jetzt tue ich’s auch nicht
(„Die innere Stimme“).
Er wird das Moralgesetz also nicht verletzen, auch wenn ihm nicht klar ist, warum. Oder: Über die Stacheldrähte der Grenzen und die Kriegserinnerungen hinweg gelangt der Dichter endlich zur „Mona Lisa“. Und was sieht er da?
die fette und kaum hübsche Italienerin
strählt ihr haar auf die trockenen felsen
Nirgendwo allerdings wird behauptet, das Gemälde sei kein Meisterwerk. Im Gegenteil, es ist ein vollendetes Kunstwerk, Erzeugnis höchster intellektueller Spekulation („als wär sie aus linsen gebaut / auf dem fond der hohlen landschaft“) .
Woher also die Enttäuschung:
zwischen ihren schwarzen schultern
und dem ersten baum meines lebens
liegt ein schwert
ein geschmolzener abgrund
Er selbst ist es also, der das Bild nicht mehr begreifen kann, für den die klassische Schönheit nicht mehr erreichbar ist. Im Renaissance-Garten, vor dessen Harmonien steht der Barbar aus dem Norden, der lieben will, aber weiß, daß er zurückgewiesen worden ist…
In Herberts Dichtung werden alle bloßgestellt: die Dichter von der Poesie, die Gläubigen von der Religion, die Patrioten, vom Vaterland, die Ästheten von der Schönheit, alle schließlich von der Moral, denn Ironie bedeutet weniger ein Empfinden für die Unzulänglichkeit menschlicher Sehnsüchte und Bemühungen als vielmehr die Rache des „kleinen Mannes“, den seine Ideale im Stich gelassen haben.
Herbert wechselt ständig die Stilebenen: vom Pathos zur (gemäßigten) Umgangssprache, von der intimen Note zum Predigerton. In seinen eher kurzen Gedichten finden Elemente einer Ode, einer Elegie, eines Epigramms und eines Poems nebeneinander Platz. Den variierenden Aussagen entsprechen die stilistischen Kontraste. Abgerundete Perioden, die oft auf rhetorischen Aufzählungen basieren, stehen neben umgangssprachlichen Flüchtigkeiten, neben abgebrochenen und unvollständigen Sätzen. Bewußt eingesetzte Anachronismen, gewöhnlich in Verbindung mit einem prosaischen Stil verknüpft, vereiteln jede Illusion und führen zu einer eher kummervollen Schlußfolgerung. Alle diese Kunstgriffe (vor allem, wenn das Wissen über die Welt auseinanderfällt: Die Hauptfigur eines Gedichts, anfangs als naiv gezeigt, entpuppt sich gegen Ende als weise oder umgekehrt) belegen, wie Herbert mit dem lyrischen Ich manipuliert – es ist seine bevorzugte Technik und die formale Voraussetzung seiner allumfassenden Ironie. Der Dichter spaltet gewissermaßen die Stimme, die das Gedicht deklamiert, in ein Subjekt und das lyrische Ich. Das Subjekt erscheint in der Regel als der Klügere, der den Sinngehalten näher steht; demgegenüber wirkt das lyrische Ich wenn nicht dümmer, so doch mit Sicherheit schwach, ratlos und verblendet.
In Herberts Rollengedichten findet die Technik der Ironie ihre Vollendung (man erinnere sich, daß Herbert auch einige kurze Theaterstücke verfaßt hat). In Die Heimkehr des Prokonsuls wird ein römischer Beamter von Zweifeln geplagt, ob er seinem Heimweh nachgeben und nach Hause zurückkehren oder aus Angst vor dem Kaiser in Afrika bleiben soll. Seine Überlegungen verheißen kein glückliches Ende:
ich hoffe wirklich es wird sich einrichten lassen
sagt der Prokonsul, von dem wir sehr wohl annehmen können, daß, sollte er sich zur Heimkehr entschließen, er entweder ums Leben kommt oder zum Schurken wird. Die Ironie geht hier fast in Spott über.
Die Ironie steht ganz im Dienst der ethischen Werte. Gewiß. Hilft sie aber dem Dichter, in einer Welt zu leben, der „der Knoten fehlt“ und in der das Gefühl für Tragik schwindet, mit dem die Literatur diesen ebenso unmöglichen wie notwendigen Werten huldigt?
Klytämnestra öffnet das fenster, spiegelt sich in der scheibe, um ihren neuen hut aufzusetzen. Agamemnon steht im vorzimmer, steckt sich eine zigarette an, wartet auf seine frau. Zum tor kommt Ägisthos herein. Er weiß nicht, daß Agamemnon gestern nachts zurückkam. Sie begegnen sich auf der treppe. Klytämnestra schlägt vor, ins theater zu gehen. Sie werden ab nun sehr oft zusammen ausgehen. Elektra arbeitet in der genossenschaft. Orest studiert pharmazie. Bald wird er seine zerstreute kollegin mit dem blassen teint und den ewig verweinten augen heiraten.
(„Das Fehlen des Knotens“)
Der Ironiker zittert, denn er sieht auch sich selbst ironisch: Ist er nun unfähig zu urteilen und zu handeln? Ist die Ironie für ihn nur eine Rechtfertigung seiner Skepsis und Schwäche? Die Vorahnung einer Katastrophe, aus Herberts Lyrik verbannt, kehrt nun wieder… durch das Haupttor:
Riesige kühle weht von den Langobarden
(…)
aufgerichtet kommen sie aus dem norden schlaflos
beinahe blind die frauen wiegen die roten kinder über den feuern
riesige kühle weht von den Langobarden
ihr schatten durchbrennt das gras wenn sie ins tal sich stürzen
schreiend ihr zähes nothing nothing nothing
(„Die Langobarden“)
Vor der Stadt stehen die Barbaren. In der Stadt:
aus dem tempel der freiheit
wurde ein flohmarkt
(„Herr Cogito von der aufrechten Haltung“).
Was kann dem Nichts entgegengestellt werden, das die Polis von innen zersetzt, an ihren unbewachten Toren schreit? Dem Herrn Cogito geht das nicht aus dem Sinn.
Herr Cogito ist unter Herberts Gestalten die heldenhafteste und gebrechlichste zugleich. Er versteckt sich nicht mehr hinter der ehrwürdigen Maske der literarischen Tradition. Es ist einer von uns, von uns Passanten des Jahrhundertendes. Sein linkes Bein ist
dem leben allzu verbunden
um sich zu gefährden
das rechte
edel steif
aller gefahr zum hohn
(„Von den zwei Beinen des Herrn Cogito“)
Seine Gedanken drehen sich im Kreis, selten nur „erreichen sie noch / den reißenden fluß der fremden gedanken“. Seine Muse ist wie eine Köchin, sein Alltag spießbürgerlich, sein Geschmack trivial. Selbst seine Träume sind blaß… Sein Abgrund ist nicht nach der Art von Pascal: Herr Cogito mißt sich nicht an der Unendlichkeit. Er möchte nicht lange leben: ihm reicht die Lebensspanne eines Elefanten (die der des Menschen, wie man weiß, gleicht). Er ist nicht neidisch auf die Götter, denn was könnte er bei ihnen schon beneiden? Er macht sich keine Illusionen über die Wirksamkeit seines Handelns, es drängt ihn vielmehr danach, Zeugnis zu geben. Er spielt ein seltsames Spiel „à la Kropotkin“: In der Beschreibung der Flucht des russischen Anarchisten aus dem Gefängnis beansprucht er für sich die Rolle eines „Vermittlers der Freiheit“, beispielsweise des Pferdes, das die Kutsche mit dem Flüchtling davonträgt. Cogito ist kein Prometheus. Denn was bleibt einem Halbgott mehr übrig als „ein Dankschreiben vom Tyrannen des Kaukasus, dem es dank der Erfindung des Prometheus gelungen ist, die aufrührerische Stadt niederzubrennen“? Er ist auch kein Philosoph: Herbert erzählt, daß Gott sich Spinoza nicht als intellectus archetypus geoffenbart habe, sondern als ein Freund der einfachen Menschen, und daß er dem Weisen rät, sich um seine ermatteten Augen und sein verfallenes Haus zu kümmern. Herrn Cogito reizt auch nicht die Kunst „der atemlosen Alchemiker der Halluzinationen“, die aus der Frustration „verblühender Dichter“ geboren wurde, jener Dichter, die der Jugend ohne Erfolg schmeicheln.
Herr Cogito wendet sich stets gegen die Doktrin, gegen das System und gegen die Masse. Deshalb wählt er in der Dichtung die semantische Transparenz:
Sie ist eine Eigenschaft des Zeichens, die darauf beruht, daß sich die Aufmerksamkeit, während man sich seiner bedient, auf dessen Gegenstand richtet, wobei das Zeichen selbst unbeachtet bleibt. Das Wort ist ein Fenster, das sich zur Wirklichkeit hin öffnet.
In Wirklichkeit gibt es jedoch kein völlig transparentes Zeichen. Wenn es direkt auf ein Ding zu deuten scheint, dann nur deshalb, weil es in einer universell geltenden Konvention verankert ist. Deshalb erneuert Herbert oft die abgenutzten Wendungen, spielt mit Synonymen und simplen Kontrasten (und hört nicht auf zu betonen, daß er spielt; der poeta doctus ist zugleich ein poeta ludens). Die abgedroschenen Stilfiguren setzt er in Anführungszeichen; er jongliert mit Animismen (wenn er beispielsweise versichert, daß ein innerer Abgrund „heranreifen / und ernst wird“, sobald man ihn entsprechend nährt), er nimmt den Vergleich wörtlich, läßt mit Augenzwinkern funktionale Stilmittel gegeneinanderprallen. Er neigt zur Paraphrase, zur Metonymie, zur Litotes… Das sind allerdings schwache Mittel, die den Leser weder in Erstaunen noch in Entzücken versetzen wollen. Statt dessen weben sie sehr gleichmäßig am Stoff eines Gedichts und bewirken, daß der Verstand sich nie langweilt oder vor einem unüberwindlichen Hindernis stockt. Herbert mag – und darin ist er seinem Herrn Cogito ähnlich – weder Halluzinationen noch Sophistik. Sein Gedicht entfaltet sich wie eine Reflexion, die direkt zur Sache kommt, aber stets von einer unerwarteten Seite.
Das ist in der modernen Lyrik selten. Suchte man nach Vorbildern fiir Herbert, so wäre vor allem Czesław Miłosz zu nennen, der bereits 1947 den polnischen Dichtern empfohlen hatte, die Reflexion wieder in ihr Recht einzusetzen, auch mit verschiedenen Idiomen unbefangener umzugehen. Gewiß könnte auch Herbert sein unfrohes Bekenntnis unterschreiben:
Uns war das Gekreisch von Zwergen und von Dämonen erlaubt,
Aber die reinen und würdigen Worte waren verboten
Bei so hoher Strafe, daß jemand, der eins davon auszusprechen wagte,
Sich selber bereits für verloren hielt.
(„Aufgabe“)
Zu diesen „reinen und würdigen“ Worten gelangt Herbert auf Umwegen: Mal gibt er sich einfältig, mal wiederum weise. Denn nur einfältige Menschen (dank ihrer Naivität) und Weise (wegen der Ironie) sind heute in der Lage, sich der Erfahrungen der Menschheit zu bedienen, der das allgegenwärtige und unbeschreibliche „Herrn Cogitos Ungeheuer“ überall auflauert…, jenes Nichts, das man so schwer zum Duell herausfordern kann, da dessen Existenz nur durch seine Opfer bestätigt wird:
antreten möchte Herr Cogito
zum ungleichen kampf
der sollte so rasch wie möglich
stattfinden
ehe der niedergang eintritt
durch apathie
der gewöhnliche tod ohne glorie
die erwürgung durch das amorphe
(„Herrn Cogitos Ungeheuer“)
Ist die Vergangenheit Herberts einzige Stütze? Wohl eher die Allgemeinverbindlichkeit einer natürlichen Ordnung, die von der Gegenwart erschüttert worden ist. Die Familie des Herrn Cogito ist das Urbild einer Familie. Obgleich verlassen, erkennt er in Gott seinen Vater, in der Erde seine Mutter, durch seine Schwester entdeckt er den Unterschied, das principium individuationis, und durch seine Lebensgefährtin die Unmöglichkeit einer vollkommenen Verständigung, was von allen Arten der Entfremdung die offensichtlichste ist. Ryszard Przybylski schreibt:
Die Erziehung des Herrn Cogito in einer archetypischen Familie hat zur Folge, daß er zusammen mit Gott an der Bestimmung der Wahrheit und des Guten teilhat, sich von der Mitte des Lebens entfernt und ewig unersättlich bleibt, weil er die verlorenen Chancen erkennt.
Herrn Cogitos Weltanschauung (sofern ein Mensch überhaupt eine Weltanschauung haben kann – würde Herbert hinzufügen) wurzelt nicht nur im Christentum. Zur Leiblichkeit verdammt, ja sogar stolz auf die Gewöhnlichkeit seines Menschseins, scheut der Dichter doch, über den Himmel der reinen Poesie, die unbegreifliche Wahrheit, das ideal Gute zu sprechen. Dagegen kann er sich nicht befreien von den Erinnerungen an Landschaften, an das Porträt einer Unbekannten, an einen Abend beim Wein – kurz, an die mediterrane Utopie von dolce vita, wo das Leben in natürlichen Bahnen verläuft, wo Raum ist für alles, selbst für Irrtum und Leid. Einzig das zwiegesichtige nihilistische „Ungeheuer“ der Dekadenz und Barbarei erhält dort keinen Zutritt.
Wie läßt sich nun Herberts Werk zusammenfassen? Vielleicht auf die Weise, wie es unlängst Stanisław Barańczak getan hat. In Herberts Dichtung, so der Professor aus Harvard, herrsche „eine Opposition von ,Erbe‘ und ,Ent-Erbung‘“. Das „Erbe“, das ist die Vergangenheit, der Mythos und die mediterrane bzw. westliche Kultur, in der er aufgewachsen ist. Die „Ent-Erbung“, das ist die Gegenwart, die „empirische“ Erfahrung des Alltags und schließlich das heimatliche „Schatzhaus allen Unglücks“, bewacht von einem „dichten Stacheldrahtgebüsch“. Das bedeutet aber keinesfalls, daß Herbert ein nostalgischer Anhänger des Erbes ist und der Welt der Ent-Erbung, in der er leben muß, den Rücken kehrt. Treue ist für ihn eine sehr wichtige Tugend. Also ist er ständig bemüht, sich mit den beiden gegensätzlichen Polen auseinanderzusetzen. Wert und Bestand des Erbes werden an der gegenwärtigen Erfahrung gemessen; andererseits macht es das Erbe möglich, die heutige Welt frei, distanziert und mit einer unverbohrt kritischen Grundhaltung zu betrachten.
(Wichtigste Waffe in dieser Auseinandersetzung ist natürlich die Ironie. Und was läßt diese überhaupt noch gelten? Eben nur das, was in der Kunst wie im Leben aufrichtig, würdig und menschlich ist. Herbert ist ein sarkastischer Gegner von Systemen, Utopien und Moden, er baut auf das, was individuell, konkret und von Dauer ist. Man könnte nun meinen, daß diesem nostalgischen Ästhetizismus moralische Forderungen folgen. Doch Herberts Ethik verzichtet auf ein Gesetzbuch und spekuliert weder auf Erfolg noch auf Lohn. Sie begegnet vielmehr mit Mißtrauen denen, die andere beherrschen und sie zwingen wollen, Gutes zu tun.
Man sollte nicht vergessen, daß Herbert nichts ferner liegt als Sermon und Pathos. Er genießt vielmehr die Freiheit, den Scherz, das Glück des Augenblicks, ist jeder Art des Dogmatismus, auch der des ästhetischen, abhold; wenn er jedoch in arkadischen Gefilden lustwandelt, vergißt er dabei nicht, wie oft diese schon mit Blut befleckt waren. Er leistet Widerstand gegen das Unrecht, hütet sich aber davor, in einen belehrenden Moralismus zu verfallen. Herberts Talent zeigt seine skeptischen und heiteren (aber auch – in unerwarteten Augenblicken – leidenschaftlichen und mitfühlenden) Seiten bereits in dem Band Ein Barbar in einem Garten, der 1962 erschienen und später ergänzt worden ist.
Die Essays dieser Sammlung sind weder herkömmliche Reiseerinnerungen noch Skizzen über die antike, italienische und französische Kunst. Aufs neue begibt sich der junge Barbar aus dem Norden ans Mittelmeer, um sich in Arkadien ästhetisch formen zu lassen. War er wirklich so jung? Im Jahre 1962 war Herbert bald 40 Jahre alt. Und hinter ihm lagen Erfahrungen, die man beileibe nicht arkadisch nennen kann. Er schlüpft also in die Rolle des naiven Enthusiasten, um seine Eindrücke einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Er vertraut nicht dem zur Verfügung stehenden historischen und ästhetischen Wissen (das er ja selbst zur Genüge besitzt), sondern er ist bestrebt, die Akropolis, Chartres und Orvieto neu zu sehen. „Neu“ bedeutet in diesem Fall: sogar den „Barbaren“ hinc et nunc anzusprechen. Beherzt macht er sich zu den ehrwürdigen Bauwerken und Statuen auf, um das wiederzuentdecken, was einfach und elementar ist, von der Gewohnheit und Gelehrsamkeit aber verwischt worden ist. Seine einfühlsame Neugier führt ihn auch zu den Stätten und Zivilisationen, mit denen die Geschichte wenig liebevoll umgegangen ist: nach Ades, Sizilien, zu den Etruskern und Albigensern. Die lange Tradition literarischer Reisen in den Süden erweitert Herbert um einige Dutzend Kapitel, in denen sich präzise Skepsis mit ästhetischem Scharfblick aufs trefflichste verbinden.
Da jede Reise einmal zu Ende geht und Arkadien (oder der Traum von Arkadien) seinen Preis verlangt, überwiegt in Herberts letzten Gedichten die Angst. Die glücklichen Monate des Lebens sind nur noch Erinnerung. Wenn er gelegentlich im (Pariser) Babylon erscheint, „schweigen am telephon die sirenen verstockt“. Zurück im „steinernen schoß des vaterlands“, wartet er auf den „unvermuteten schlag / der tödlichen frage“. Er irrt in der Stadt des Todes umher und verpaßt den Transport. Er hört, wie Adam unter der Folter schreit, und ist voller Angst, er könne mit dem Echo des aufbegehrenden Schreis allein bleiben. Er schreibt „Berichte aus einer belagerten Stadt“. Ein Bote der Vernichtung tritt „in einer maske aus blut schmutz klage“ auf:
er gab unverständliche schreie von sich zeigte mit der hand gen Osten
das war schlimmer als tod denn weder mitleid noch furcht
und jeder verlangt doch im letzten moment nach entsühnung
Distanz und Humor stellen das Gleichgewicht wieder her. Und sollte es jetzt schon an der Zeit sein, über Tugend zu sprechen, dann hält es Cogito für besser, dies so zu tun:
diese weinerliche alte jungfrau
im unmodernen hütchen der Heilsarmee
ermahnt sie
sie holt aus der rumpelkammer
Sokrates’ konterfei
das kupferne kreuz
die alten worte
und drumherum das brausende herrliche leben
rosig wie ein schlachthof am morgen
(…)
mein Gott
wäre sie etwas jünger
und hübscher
(…)
vielleicht würden dann
die richtigen männer sie liebgewinnen
die generäle die sekretäre die staatsanwälte
(…)
aber sie riecht
nach naphthalin
verschnürt ihren mund
wiederholt ihr großes Nein
unerträglich in ihrem starrsinn
lächerlich wie eine vogelscheuche
wie anarchistenträume
wie heiligenlebensläufe
(„Herr Cogito über die Tugend“)
Aus dem Polnischen von Hildburg Heider und Ryszard Zan
Jan Błoński, Nachwort
Editorische Notiz
Die von Michael Krüger aus dem Gesamtwerk getroffene und thematisch gegliederte Auswahl gibt Auskunft über die vielschichtige, reale und ideale „Heimat“ des Dichters. Die Anordnung der Themen gibt die Verschränkung von Individual- und Universalgeschichte, wie sie dem Dichter eigen ist, wieder. Der erste Teil betrifft die Kindheit, der zweite ist dem Schreiben gewidmet. Der dritte versammelt Texte zur alten und neueren Mythologie. Die zwei Prosastücke des vierten Teils gelten der europäischen Kultur: ihrer Wiege und Vorgeschichte. Der fünfte Teil enthält historische (im weitesten Sinne) Gedichte. Die Texte des sechsten Teils enthalten Gedanken zum Mittelalter und zur Renaissance. Der siebte Teil versammelt die kurzen Stücke der poetischen, meist ironischen Prosa. Der achte Teil ist eine Auswahl aus dem „Herr Cogito“-Zyklus. Die holländischen Skizzen des neunten Teils gelten der Zeit nach der Renaissance, der bürgerlichen Epoche. Im zehnten Teil betreffen die Gedichte die (zeitlich und geographisch) nähere Heimat des Autors; im Teil A sind es die früheren Gedichte, im Teil B die 1983 publizierten.
Die beiden Texte im Nachtrag sind kurze Statements zum Weltbild und zur Poetik des Dichters.
Bei der Groß- und Kleinschreibung der Gedichte versuchen die bisher in deutscher Sprache erschienenen Bücher Herberts unterschiedliche Lösungen. In der vorliegenden Ausgabe wird an der Kleinschreibung und Interpunktion Herberts konsequent fest gehalten – nicht zuletzt, um die von ihm – selten nur als Mittel der Hervorhebung eines Worts oder Begriffs benutzte Großschreibung in seinem Sinne nachvollziehen zu können.
Skizzen zu Zbigniew Herbert
Vielleicht war es ihm ein Trost – wenn es denn in der Krankheit überhaupt Trost von außen gibt –, daß seine Bücher zuletzt im Buchhandel erhältlich waren und begierig gekauft wurden und daß die Zahl der Arbeiten über sein Werk explosionsartig wuchs. Damals befand sich Herbert als führender Dichter auf dem Gipfel seines Ruhms. Als niemand dem Schwerkranken noch Neues zugetraut hätte, erschien der Band Gewitter Epilog. Die Gedichte darin beeindruckten durch ihre Schönheit, aber auch als ein Zeichen von Schaffenskraft trotz qualvollen Leidens.
Doch heute, daran zurückdenkend, will ich nicht über Zbigniews Gedichte schreiben, sondern über seinen Humor, seine Lebensart, die sich auch in seinen Briefen spiegelte. Denn obgleich er ernst und unnachgiebig war und es, wie in „Klapper“, „ja – ja / nein – nein“ hieß, versuchte er doch stets einen leichten Ton anzuschlagen. Er besaß einen feinen Witz mit tausend Facetten, vom leichten bis hin zum bissigen Scherz, wenn ihm etwas mißfiel; er konnte locker, ironisch oder sarkastisch sein. Daran erinnerte ich mich, als ich die Briefe und Karten durchsah, die er uns während unserer langjährigen Freundschaft schrieb. Es ist ein dickes Bündel, und obwohl wir erst seit Ende der fünfziger Jahre enger befreundet waren, stammt der erste von 1953.
Zbigniew war damals jung und von ungewöhnlicher Grazie, die er nie verlor, über die sich im Alter aber ein Anflug von Bitterkeit legte. Diese Grazie sicherte ihm die Aufmerksamkeit und Sympathien sowohl der Frauen als auch der Männer, Zbigniew „ließ sich mögen“, neben allen übrigen Vorzügen des Geistes und des Herzens besaß er die Zuneigung seiner Umgebung, die mit dem Alter gemeinhin nachläßt.
Sein Verhältnis zu Volkspolen ist bekannt, also war es nicht verwunderlich, daß er möglichst oft ins Ausland reiste, ins geliebte Italien, nach Griechenland, England oder – für Monate oder gar Jahre – nach Paris, Berlin, Kalifornien. („Ich alter umherirrender Emigrant denke innig an Euch.“) Aus Paris schrieb er:
Ich wohne auf der Île Saint-Louis und träume, selbst wenn ich wach bin. Ansonsten ist alles bestens. Wenn es noch besser wäre, wäre es nicht auszuhalten.
Einen großen Teil seines Lebens verbrachte er im Ausland. Oft war er nicht bei uns, doch er kam immer wieder und achtete darauf, sich mit seiner Dichtung nicht zu weit von dem zu entfernen, was ihm nahe war. Viele seiner Postkarten wurden im Ausland geschrieben, aber etliche auch in Polen, in der Gegend von Suwalki, an der Ostsee. („Meine Lieben, herzliche Grüße vom nordöstlichsten Rand unseres niedergedrückten Vaterlands“, „Ich dachte mir, besser zwischen Bäumen herumlaufen als zwischen Mauern“, „Ich tue meine Bürgerpflicht und schwimme und rudere, wir fahren ein bißchen herum“.) Manchmal schrieb er uns aus Warschau, vor allem gegen Ende unseres vierjährigen USA-Aufenthalts, da er und seine Frau Kasia 1969 und 70 ebenfalls in Amerika waren. Von 1971 bis zu unserer Rückkehr wohnten sie in unserer Wohnung in der Marszałkowska. („Liebe Julia, lieber Artur, ich schreibe diesen Brief an Arturs Schreibtisch, leicht aufgestützt, aber nicht arrogant, sondern mit gewisser Andacht.“) Er ahnte, daß wir erwogen, für immer in den Staaten zu bleiben (wer hätte das mit einer sicheren Arbeit und fern der heimatlichen Kalamitäten nicht getan, besonders nach dem schändlichen Jahr 1968), und schrieb uns im Frühjahr 73:
Ich bin heimgekehrt, weil ich im Westen zwar ein Einkommen und meine Ruhe habe, aber nicht schreiben kann (genauer gesagt, das wenige, das ich schreiben kann, hat für mich keinen Sinn). (…) Die Bestie wird verrecken, ich weiß nur nicht, ob wir sie begraben.
Das schrieb er zu Beginn der Gierek-Zeit, als er nach Anzeichen einer Wende zum Besseren Ausschau hielt. Er nannte (ohne sich, wie auch in den anderen Briefen, um Kommas zu kümmern) die Reisefreiheit:
Viele haben das Land verlassen, auch Kijki parl fronsä mit Pompidou in Paris. Sogar Kisiel ist weg. In der Baracke bleiben nur die Lahmen und Sprachlosen. Zu Kasias Geburtstag habe ich Dozent Błoński, Professor Wolicki, Professor Frybes eingeladen ich war so neidisch auf die Titel, daß ich viel trank und aggressiv wie ein Palästinenser war. Aber gestern waren die Jastruns da, und alle waren sittsam.
Im Juni 72 spottet er:
Nixon war da, aber nur kurz, so daß wir uns nicht treffen konnten.
In dieser Zeit fährt er häufig nach Obory.
Eingedenk der Lehren des hl. Franziskus und des hl. Artur hänge ich Speck auf, streue Körner. Auf Anweisung Anna Trzeciakowskas gehe ich sogar in den Stall und mache ihrem Pferd Wickel – ich habe schreckliche Angst, daß es mich zerstampft.
Ein andermal:
Ich bin in Obory und arbeite an Karpfen nach jüdischer Art und weißrussischen Piroggen.
Er berichtet uns nach Iowa auch von seinen Reisen in Polen, vielleicht Lesereisen:
Heute breche ich nach Krakau und Breslau auf. Das Leben eines Regionalaktivisten ist schrecklich. Aber zu den Feiertagen müßte ich es wohl schaffen, einen Napfkuchen oder sogar Wiener Törtchen zu backen. Ich habe eine Mundharmonika gekauft, Kasia eine Flöte. Das ist vielleicht kindisch, aber Spielen ohne es zu können macht Spaß (…). Ich war im PEN Paweł hat Arturs Dankesbrief sehr schön verlesen. Freunde. ihr fehlt mir. Wenn ihr heimkommt, läute ich die Glocken und Kasia streut Blumen. Andrzej trägt den Weihrauch und wie ich Joanna kenne, wird sie bestimmt singen.
Im Gedicht „Artur“ aus „Gewitter Epilog“ heißt es:
… also singe ich nicht mehr das lied über Felek Stankiewicz / und nicht mehr das regimentslied vom roten mohn.
Das Lied über Stankiewicz sangen Zbigniew und Artur „auf allgemeinen Wunsch der Öffentlichkeit“ bei freundschaftlichen, nicht selten feuchtfröhlichen Zusammenkünften gerne im Duett. „Vorn Nichtsingen ist meine Stimme schon ganz eingerostet“, schreibt er in einem Brief, geschmückt mit der eigenhändigen Zeichnung eines Amors, der Blumen auf einen See voller Schwäne streut. An anderer Stelle:
Stankiewicz war ein feiner Kerl. Wenn du kommst, werden wir ihn besingen.
Dazu scherzhafte Randglossen: „Mir ist’s egaal wie man mich bestraaft“, „Sieh uns vom Himmel zu, Kościuszko / wie wir im Blut der Feinde waten werden“. Und am Ende die Signatur:
Die ewig treue Emilia Plater ihre Schleppe schleppend im Galopp.
Eine Rarität ist ein an eine Reklame erinnerndes kartoniertes Blatt, das sorgsam mit phantasievoll über die Seite verstreuten Worten beschrieben ist und folgendermaßen beginnt:
Die berühmte Tanzschule Zbigniew Herberts (Schüler von Meister Sobiszewski) öffnet demnächst ihre Pforten.
Ein anderer Brief von 1979 beginnt:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen mein Name bekannt ist, deshalb möchte ich anmerken, daß ich mehrmals in den Zeitschriften Faust, Tanne und Zorn vertreten war und bei einer Reihe von Wettbewerben auf Kreis- und sogar Wojewodschaftsebene reüssierte. Ich leiste viel ehrenamtliche Arbeit und züchte Kaninchen, die dem Verband der Fleischfreunde angehören. … Ach, meine Lieben, ganz ohne Scherz und Ironie / vergebens ist all unser Se h n e n.
Ab und an zeigt er Ungeduld: Er plant mit Czajkowski eine Griechenland-Reise, „… aber das ist noch Zukunftsmusik, zu schön, um wahr zu sein. Als Bürger der Volksrepublik Polen kann man nicht wie ein normaler Mensch planen. O Leben, du Dornbusch. Doch wenn auch der Sturm uns umtost wir wollen den Mut nicht verlieren / bis die kreuzritterlich-sowjetischen Wirren zu Staub und Asche sich pulverisieren.“
Aus Berlin schreibt er:
Schon rollt feierlich der Stern von Bethlehem über den gleichfalls feierlichen, aber fremden und kapitalistischen Himmel, so daß Euch die Karte wohl erst nach dem Karpfen, schlimmstenfalls nach dem Mohnreis erreicht.
Und ein Jahr später:
Mir ist, als wäre ich gerade vom Osteressen aufgestanden, dabei ist schon wieder Heiligabend. Das ist das Leben eines alten Mannes zwischen Plappern und Schmatzen. Nun ja, auch gut – wie mein Freund zu sagen pflegt.
Im August wiederum, kurz vor unserer Rückkehr aus den Staaten:
Wenn Ihr bald kommt, gibt es Blini mit saurer Sahne, wenn es Winter wird, Bigos, doch auch im Frühjahr ließe sich etwas zubereiten, das in der Form national und im Inhalt sozialistisch ist.
Und er schreibt, als wolle er sagen:
Liebe Julia, mein Gott, wie ich mich über Arturs Rückkehr freue. Ich lasse alles fallen…
Dann wieder gibt es in diesen Briefen Passagen wie aus einem Prosagedicht. Auf einer Ansichtskarte mit einer italienischen Landschaft schreibt er:
Auf diesen Hügeln lagen wir unter schwerem Beschuß der himmlischen Heerscharen. Vor Jahresende werden wir angreifen. Im Februar so Gott will überschreiten wir die Weichsel die Warthe und schlagen unser Lager auf dem heimatlichen Gut auf.
Oder, auf einer Ansichtskarte von Florenz:
Gott allein weiß (obwohl ich mir da nicht so sicher bin, er ist ja kein Psychiater) was ich in diesen Bergen noch verloren habe alt und müde wie ich bin – als suchte ich eine Offenbarung, ein Wunder, eine grundlegende Wandlung, absolutes Wissen. Kurzatmig, asthmageplagt, kurzsichtig, schlaflos. Aber wie Artur sagt – fein ist’s…
Ich lese Zbigniews Briefe, um Trost zu finden nach dem Verlust des Freundes, um Kraft zu schöpfen aus der imponierenden inneren Ruhe, die diesen Menschen kennzeichnete, der mit sich selbst kämpfte, sich jedoch ganz dem Studium, dem Staunen und dem dichterischen Schaffen hingab. Trotz manchen Scheiterns. („Lieber Artur, auch ich komme mit der Arbeit nicht voran, weil das Feld überschwemmt ist. Aber du wirst sehen, es kommen auch wieder bessere Tage.“) Warum zitiere ich aus diesen Briefen? Vielleicht interessiert es die Leser seiner Gedichte, daß ihr Autor ein empfindsamer, mitfühlender Mensch mit einem enormen Sinn für Humor war und mit einem Blick für das einfache Leben und die anrührende Zerbrechlichkeit der kleinen Dinge des Alltags. Ein schwieriger, in exaltierten Momenten unerträglicher Mensch („Liebe Julia, lieber Artur, entschuldigt bitte vielmals mein unmögliches Benehmen. Ich küsse die Hand und werfe mich Euch zu Füßen Zbigniew“ – auf einer Karte, die eine weibliche Rokoko-Figur und den Schriftzug „La Folie“ zeigt), den man trotz allem gern hat. Dem man alles verzeiht, in dem Gefühl, es mit einem außergewöhnlichen Menschen zu tun zu haben.
Wenn wir Henryk Elzenbergs Brief vom Dezember 1956 lesen, in dem er Zbigniew Herbert wünscht, daß ihm dereinst die Anerkennung zuteil werde, die seiner „literarischen Leistung gebührt und die trotz der jüngsten Erfolge noch in weiter Ferne liegt“, wird klar, daß der Professor die Bedeutung seines ehemaligen Studenten für die polnische Lyrik schon früh erkannte. Dabei hatte er nicht allzu heftig widersprochen, als Herbert ihm 1951 schrieb:
Ich fürchte sehr, daß das Häuflein meiner Getreuen ein Hilfsprogramm organisiert, um mir Mut zu machen und meine Einsamkeit zu zerstreuen.
Heute ist Herbert anerkannt wie kaum einer, aus dem Häuflein der Getreuen ist eine über die Landesgrenzen hinausreichende Schar geworden und überall in Polen werden Schulen nach ihm benannt. Allerdings ist zu befürchten, daß ahnungslose, nur von seinem Namen verführte Leser ihre Lektüre auf ein paar „klassische“ Werke beschränken.
Herberts erster Brief an Elzenberg stammt von 1951 und enthält die Bitte, eine Prüfung zu verschieben. Herbert hatte damals bereits ein Jurastudium abgeschlossen und studierte Philosophie in Thorn; wo Elzenberg lehrte. Vermutlich entschied er sich für dieses Fach nicht zuletzt wegen dieses Professors, der wegen seiner Aufrichtigkeit und seines Nonkonformismus allgemein geschätzt wurde. Auch nachdem Herbert das Studium abgebrochen hatte und nach Warschau gezogen war, blieben beide in engem brieflichem Kontakt. Herbert betrachtete Elzenberg weiterhin als seinen Lehrer und unterschrieb seine Briefe nach wie vor mit „Ihr Schüler“. So zeigte er seine Dankbarkeit und Bewunderung für einen Menschen und Denker, der sein Vertrauter in allen geistigen Fragen war. In diesen Briefen begegnet man, neben vielen anderen, Pascal und Lukrez, Ovid und Gandhi, Buddha, Shaftesbury, Renan oder Rousseau. Elzenbergs Briefe sind nie professoral, der Gedankenaustausch ist ganz ungezwungen, obgleich Herberts Respekt vor seinem Briefpartner unverkennbar ist.
Man muß bewundern, mit welcher Intuition Herbert einen geistigen Außenseiter zum Lehrer wählte. Wir kennen Elzenberg heute dank seiner Aufzeichnungen „Kummer mit dem Sein“, und eben dieser Kummer mit dem Sein verband die beiden.
Kann man die Beziehung zwischen Briefpartnern als Freundschaft bezeichnen? Das hätte Herbert sicher nie gewagt. Und doch wird ihr Dialog immer lebendiger, wird aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis ein gleichberechtigter Austausch: Der Philosoph erkennt immer deutlicher das Profil des Dichters, und der Dichter legt die Demut des Schülers ab und sagt, was er von der Philosophie erwartet:
Ich mag keine Philosophie, die erklärt, ich mag eine Philosophie, die einen aus dem Gleichgewicht bringt. Das bekenne ich, damit Sie sich keine Illusionen machen, Herr Professor: Aus mir wird nichts.
Einen späteren Brief aber unterschreibt er:
Ein Adept der Philosophie, der diese wegen der Musen verraten hat.
Das Philosophiestudium gab Herbert zwar auf, nicht aber die leidenschaftliche Suche nach Erkenntnis, die auch seine Lyrik prägt. Diese Leidenschaft ist stark genug, um seinem Talent Konstanz und Leserinteresse zu gewährleisten. Daß er in einem Essay schreibt, Hamlet habe „die Qualen des vollen Bewußtseins durchlitten“, zeigt, auch ihm ist diese Erfahrung nicht fremd. Die Hoffnung, die Philosophie könne endgültige Antworten geben, erwies sich als Illusion, doch das Bedürfnis, zum Kern und zum Sinn des Daseins vorzudringen, blieb – wenn auch oft vom Gefühl des Scheiterns begleitet.
Rationalismus und der Glaube an eine Ordnung sind Kennzeichen stabiler Epochen. Heute dominiert eine irrationale, dämonische Sicht auf die Welt.
Mit dieser „Welt“ liegt er ständig im Streit. Er versucht sogar, den in seinen Gedichten so deutlichen moralischen Imperativ abzuschwächen:
Ich sehe, daß ich meine Jugend unnatürlich verlängere, daß es höchste Zeit ist für Banalität, Ruhe, Leben und Verdummung.
Aus dieser ironischen Feststellung spricht nicht, wie man vermuten könnte, Resignation, sondern der für so viele seiner Äußerungen typische Protest: „man muß sich aufreiben, darf sich nicht schonen, nicht kleinmütig sein“, schreibt er, nun sehr ernst, in einem anderen Brief.
So offen wie in dieser Korrespondenz, in der er sogar von seinen Stimmungen spricht, ist er wohl nirgends sonst:
Eine traurige und banale Herbstkarte, weil mich diverse Nihilismen plagen.
Wie reagiert der Lehrer auf diese Gedanken und Bekenntnisse? Als Herbert mit Sartre die Welt absurd nennt und den Glauben an eine Ordnung als unbegründeten Optimismus abtut, tadelt Elzenberg ihn sanft:
Ich stelle fest, daß Sie die Sünde des Existentialismus in einer ihrer sträflichsten Formen begehen. Aber lyrisch und rein menschlich gesehen sind Sie immer interessant (…).
Vielleicht offenbart dieser Satz das Wesen dieses Briefwechsels, in dem der Lehrer und Philosoph das Recht der Dichtung anerkennt. Die von Herbert mitgeschickten Gedichte zeigten Elzenberg, daß er es mit einer außergewöhnlichen Begabung zu tun hatte. Er hielt sich nicht zu dichterischen Ratschlägen berufen, und wenn er doch welche erteilte, waren sie nicht immer überzeugend; so kritisierte er in „An Marc Aurel“ das so schöne „der sterne silberlarum“. Die Situation wird schwierig, als nun der große Philosoph Gedichte schickt. Herbert nennt sie zeitlos und klassisch und ist so wohlwollend, wie man es gegenüber dem traditionellen dichterischen Repertoire nur sein kann. Mehr Eleganz in Verbindung mit einem sachlichen Urteil ist kaum denkbar.
Muß man daran erinnern, daß diese Korrespondenz in der finstersten Phase der polnischen Nachkriegszeit stattfand, in einer Zeit der Willkür und Unterdrückung? Die offizielle Kultur war ihrer Selbständigkeit beraubt, sie konnte sich nicht frei entwickeln. Herbert versuchte nicht, sich mit dieser Wirklichkeit zu arrangieren, er lebte in Armut und arbeitete in den – gemessen an seiner Berufung – absurdesten Einrichtungen (etwa im „Torfprojekt“). Ein bißchen verdiente er mit Rezensionen für katholische Zeitschriften, die unter Pseudonymen oder nur mit seinen Initialen gezeichnet erschienen. Der Professor kannte die Lage seines Schülers und bemühte sich, ihm eine angemessene Tätigkeit zu verschaffen. Er wollte Herbert auch finanziell unter die Arme greifen, wogegen dieser sich jedoch wehrte. Auch Elzenberg zahlte einen hohen Preis für seine Unbeugsamkeit und für das Festhalten an den von ihm vertretenen und gelehrten Werten. 1950 mußte er die Universität Thorn verlassen; den Lehrstuhl erhielt erst 1956 wieder. Als ihn die Krankheit niederwarf, schrieb er an Herbert:
(…) ich würde Sie sehr, sehr gerne noch einmal sehen (…).
Zum hundertsten Geburtstag widmete Herbert Elzenberg ein Gedicht, in dem er den Professor zum ersten Mal mit Vornamen anredet. Man kann also doch von Freundschaft sprechen.
Herberts Schaffen wurde von Anfang an als außergewöhnlich anerkannt. Seine Gedichte wurden in weltanschaulichen Debatten ganz oder auszugsweise zitiert; man hat aus ihnen moralische Maßstäbe abgeleitet und sie nicht selten für politische Zwecke instrumentalisiert. Herrn Cogitos Ruf „bleib treu und geh“ erwies sich als so dehnbar, daß ihn auch Leute übernahmen, von denen sich Herr Cogito mit seinem inzwischen geradezu sprichwörtlichen „Geschmack“ gewiß angewidert abgewandt hätte.
Was sagt die Popularität dieser Lyrik über ihren künstlerischen Rang? Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß sie auch zu einer Falle werden kann – dann nämlich, wenn die Gedichte nur oberflächlich gelesen und banalisiert werden, bis sich ihre edle Substanz allmählich verbraucht. Ein allzu oft zitierter Vers wird zur Parole, zu einem Schlagwort, das mit Herbert nichts mehr zu tun hat. Herbert wurde Mode, zumal in den neunziger Jahren, obgleich die oft schwierigen und anspielungsreichen Gedichte aus dieser Zeit kaum zu Modeobjekten taugen, sondern dem Intellekt und der Imagination einiges abverlangen.
Herberts Lyrik ist geschichtsgesättigt, kaum ein anderer zeitgenössischer Dichter hat sich so intensiv mit der Antike, mit ihrer Kunst, Philosophie und Mythologie auseinandergesetzt. In seiner Lyrik erweckt er die Antike wieder zum Leben; er verknüpft sie ganz selbstverständlich mit der jüngsten Geschichte, die er am eigenen Leibe erfahren hat, und verleiht ihr einen neuen, nicht immer direkt zu entschlüsselnden Sinn. Aus seinen Gedichten könnte man Anthologien zu 1939, zur Heimatarmee, zum Untergrund, zum Ungarn-Aufstand oder zum Kriegsrecht zusammenstellen – ich erinnere nur an „Knöpfe“, „Wölfe“, „Die Fünf“, „Fortynbras’ Klage“ oder „Herrn Cogitos Vermächtnis“.
Wenn er von zeitgeschichtlichen Fakten spricht, bleibt Herbert oft „schwammig“; so nennt er den zweiten Weltkrieg nie beim Namen. Im Gedicht „Photographie“ schreibt er:
vor dem zweiten perserkrieg machte mein vater das bild.
Natürlich gewinnt das Gedicht dadurch, es ist nicht mehr so eindeutig. bleibt aber verständlich; der sentimentale Ton wird mit einer scherzhaften Note angereichert. In „Bericht aus einer belagerten Stadt“ spricht er von der „Zweiten Apokalypse“ und in „Regen“ heißt es über seinen Bruder: „ein granatsplitter / traf ihn bei Verdun / vielleicht bei Tannenberg / (die einzelheiten hatte er vergessen)“, obwohl es sich um eine Begebenheit aus dem zweiten Weltkrieg handelt. Eine derartige Verschleierung korrespondiert auf frappierende Weise mit Herberts Art zu sprechen. Er hatte seinen eigenen Gesprächsstil entwickelt, der direkte Aussagen vermied und Bekenntnisse ausschloß. Sein Charme, sein Witz und seine Lockerheit waren unwiderstehlich. Zbigniew konnte jeden sofort für sich einnehmen, sofern ihm der Betreffende gefiel; wenn er etwas übelnahm, konnte er rücksichtslos, ja unbarmherzig sein, weil er mit seinem unvergleichlichen Scharfsinn immer den wunden Punkt traf, falls er wollte. Letztlich aber verzieh man ihm alles, zumal er hinterher immer größte Reue zeigte, anrief, schrieb oder sich mit Blumen entschuldigte. Herberts Lyrik ist voller Menschen, viele Gedichte sind seinen Nächsten gewidmet, der Mutter, dem Vater. Darunter gibt es eine Person, die er selbst, auf eigene Gefahr, ins Leben rief: Herrn Cogito. Herbert erschuf ihn als eigenständige Figur, die aber nach und nach mit dem Autor verschmolz. Ein Gedicht, in dem Herr Cogito und Herbert mit einer Stimme sprechen, ist wohl „Herrn Cogitos Vermächtnis“. Herbert war keineswegs der erste, der sich eine literarische Figur als porte-parole erschuf – man denke an Paul Valérys Monsieur Teste und Henri Michaux’ tragikomischen Plume. Er knüpft also an eine literarische Tradition an, doch kommt die Erfindung des Herrn Cogito der Erschaffung eines neuen Menschen mit eigenem Schicksal und eigenem Charakter gleich.
Ich schweife wohl nicht ab, wenn ich in diesem Zusammenhang Herberts große Belesenheit in der modernen Lyrik erwähne. Am Beginn seines Schaffens wurde er mit Francis Ponge verglichen, weil er wie dieser die autonom existierende Welt der Dinge in seine Dichtung einführte. Doch das ist nur eine Etappe. Herbert kommuniziert ebenso mit Eliot und mit deutschen Dichtern, ein weiterer unbestrittener Lehrmeister ist Kavafis. Von Beeinflussung kann aber, zumal im Spätwerk, kaum die Rede sein. Herbert verkehrt mit diesen Dichtern von gleich zu gleich, nach den Prinzipien der Zeitgenossenschaft und Brüderlichkeit.
Wenn es Dichter gibt, die sich von Vernunft und Verstand leiten lassen, und solche, die eher ihrer Intuition folgen, dann gehört Herbert sicherlich zu ersteren. Zur Kultur gehört für ihn eine angeborene Empfindsamkeit, sie ist unverzichtbarer Teil unserer Existenz, sie blüht und trägt poetische Früchte. Herberts Kultur ist eine von Ethik geprägte Kultur, eine Ethik, die mit Ironie und Selbstironie gewürzt ist.
Herberts Lyrik vermittelt, direkt oder indirekt, die Auffassung, daß Leiden nicht zu vermeiden sind und man seinem Schicksal nicht entgeht. Er spricht vom tugendhaften Leben und seiner Vergeblichkeit:
Geh wohin die anderen gingen bis an die dunkle grenze
suche das Goldene Vlies des nichts deine letzte belohnung
Er strebte nach Harmonie, glaubte aber nicht, daß sie erreichbar sei. Davon handelt „Brevier“, eines seiner letzten Gedichte. Ich denke, er wußte, wie gefährlich es für die Dichtung ist, moralische Aussagen mit künstlerischer Eindeutigkeit zu verbinden. Doch eben das hielt er für notwendig. Heute werden seine Gedichte von der jungen Generation radikal in Frage gestellt, so wie alle Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens und der Treue zu den eigenen Überzeugungen ins Wanken geraten. Diese Treue, ein unterschwelliges Leitmotiv von Herberts Schaffen, kann der Grund sein, daß wir uns von ihm abwenden, so wie wir uns von Institutionen und Personen abwenden, die uns zu besseren Menschen machen wollen. Vielen allerdings bietet gerade Herberts Werk Orientierung. Dieser Gegensatz zeugt vielleicht vom Rang dieser Dichtung, einer weitläufigen, menschlichen und bezaubernd schönen Dichtung, deren reiner Ton Bewunderung weckt.
Julia Hartwig, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 2008
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann
Jan Wagner: Im Königreich der Dinge. Insbesondere über Zbigniew Herbert. Dritter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Zbigniew Herbert
I
Wir trafen uns in einem Supermarkt kurz
vor der Kasse, zeitgleich stipendienverpflichtet
und Hüter eines vornehmen Hauses höherer Künste.
Er im wehenden Sommermantel mit dem Duft
von Paris, oder wo immer er herkam, in jenem Winter.
Ein Ruheloser zwischen den Welten,
der nie so recht wußte, an welchem Ort er gerade
unbequem ist, und ob die Kreuzigung Jesu
nun schon vollstreckt war oder eben bevorstand.
Vor sich den Einkaufswagen gleich einem Esel,
ehe er hinstürzt. Beladen mit allem, was ihm
in den Sinn kam, fünffach und viermal zuviel.
(Später kann ich im Kaufrausch der Hände
die Angst des Verhungernden sehn,
der dem Ghetto entkam, es aber nicht überlebte.)
II
Abends, sobald die Siedlung im Grab lag und vom Tag
noch das Glas blieb für den fälligen Whisky,
besprachen wir die Lage, wie es ist,
wenn die Fliege im Netz hängt. Für ihn
an der Weichsel, und für mich an der Weser,
die ich frisch gegen die EIbe eingetauscht hatte
aus Gründen, mit denen er unterwegs war,
die Landkarte westwärts. Doch alles war Polen,
und alles ein faulender Giebel im Auswurf
scheißender Tauben. Denn er war uns im Kopf,
der Osten, dieser Krieg der Sprache gegen die Sprache,
dieses schreckliche Volksstück der Vorvormoderne.
Also wohin, Genosse Deserteur? Zurück in die eigenen
Schriften? In die schließliche Hinfälligkeit
fragmentarischer Vorstellungswelten? In den Vollzug?
III
Nichts, kein Wort über Bücher, oder nur flüchtig,
nachts nebenher, kurz vor einem nächsten
gnadenlosen Morgen. Der Mord als Ekstase
der Liebe und reine Form des Begehrens,
das hat ihn länger beschäftigt,
und in seinen Augen tanzte der Kobold,
der das Böse verlangt und das Gute erschafft.
Dieses feine, ironische Leuchten im Blick,
dieser Aufstand des Lachens gegen die Trauer,
die ihm tief ins Gesicht geschnitten war,
ich vermisse sie, diese Nähe von Anbeginn.
Zu spüren im Schweigen, sobald die Worte
keinen Anlaß mehr finden und jeden sonst
zurücksinken lassen in die Verlorenheit,
in die Stille ringsum, vor der Welt.
IV
Ich habe es immer befürchtet, der Tod ist stärker
als die Sprache, und das letzte Gedicht,
es schreibt keiner. Wir sehen uns noch einmal
in Warschau. Seine Stimme am Telefon
schon wie aus dem Jenseits gesprochen,
mit einem Lachen, das abbricht, ehe es endet.
Wo bist du, Genosse Deserteur? Aber da war ich
schon ins Zimmer gekommen und teilte mit ihm
den schweren Geruch seiner Krankheit.
Am Boden zerknülltes Papier, begonnene
und verworfene Sätze. Um rauchen zu können,
schiebt er den Schlauch zum Beatmungsgerät
vom Mund auf die Wange, als wäre er der Grund
allen Unglücks. Die Augen so leer wie die Platte
des Schreibtischs, ertrunken in Trauer. Von Polen
sprechen wir nicht, Deutschland verschweigen wir.
Vor dem Fenster ein verwahrloster Frühling,
die Schwalben im Tiefflug, die Kastanie gebrochen.
Kurt Drawert
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber +
Archiv + KLG + IMDb
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Krüger – Lebenselixier Literatur im Gespräch mit Norbert Bischofberger, SRF 22.9.2013.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLfG + IMDb + PIA +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 1/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 2/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 3/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 4/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 5/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 6/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 7/8.
Zbigniew Herbert – Dokumentarfilm Obywatel Poeta, Teil 8/8.


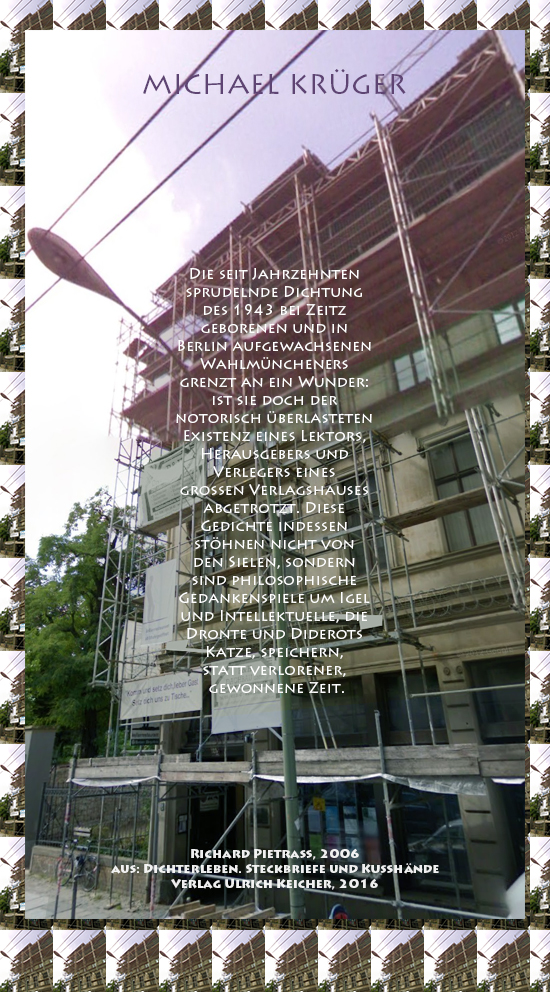












Schreibe einen Kommentar