VORGARTEN
in memoriam Johannes Hübner
Gäbe es dies −
keine Nacht, keinen Mond, der uns
in die Abwesenheit tauchte
und uns bis in die Kindheit entfernte;
keinen Tag, keine Sonne, die uns
aufginge wie Sterblichkeit −,
wären Tag und Nacht unsichtbares Theater
auf einem unsichtbaren Stern;
eine Stille, die jeder folgende Augenblick −
fände er noch statt −
mit gleicher Stille durchbräche.
Richard Anders
![]()
Nachwort zur RETROSPEKTIVE 1979
Wir haben die Gedichtbücher, Zeitschriften und Anthologien des Jahres 1979 gelesen und sieben Gedichte ausgewählt (darunter drei Gedichte von Lyrikern der DDR), die wir dem Jahrbuch voranstellen als Beispiele. Wir sind von diesen Gedichten überzeugt und glauben, daß Machart, Thematik, Syntax und Atem jedes einzelnen Gedichts poetische Sprache in diesen Jahren repräsentieren kann. Unser Gedanke war, der Retrospektive einen Katalog fragwürdiger, beliebiger, mittelmäßiger und schlechter Gedichte gegenüberzustellen, aber wir haben die Absicht fallengelassen. Es schien uns unmöglich, Sprache bloßzustellen, ohne die Autoren bloßzustellen und zu verletzen. Der Leser des Jahrbuchs wird deshalb aufgefordert, fragwürdige Gedichte selbst zu suchen, in diesem Buch und in vielen Büchern.
Nachwort zur AUSWAHL 1980
Die Auswahl 1980 enthält Gedichte, die wir den verlangt oder unverlangt eingesandten Manuskripten entnommen haben. In mehreren Durchgängen haben wir Hunderte von Gedichten aussortiert, danach Dutzende und schließlich immer wieder einzelne, bis wir glaubten, die besten Gedichte zurückbehalten zu haben. Wir haben das ohne Rücksicht auf bekannte oder unbekannte Namen, auf Bekanntschaften oder Freundschaften, auf Hoffnungen, Wünsche oder Forderungen einzelner vorgenommen. Dabei stellten wir fest, daß auch die sorgfältigste Auswahl nicht umhin kann, Konfektions-Gedichte beizubehalten. So haben wir Gedichte aufgenommen, die typisch für Zeiterfahrung und Generation und bezeichnend für das Sprachklima dieser Jahre sind. Gedichte dieser Art bilden die breite Grundlage jeder Anthologie, die keine klassische Blütenlese ist. Der Titel des Jahrbuches DAS ZAHNLOS GESCHLAGENE WORT – eine Gedichtzeile von Erich Arendt – wurde gewählt, weil die seit Jahren öffentliche These vom neuen Interesse für Lyrik wenigstens fragwürdig ist. Sie erweist sich als manipuliert durch den literarischen Markt. Nichts deutet darauf hin, daß Gedichte häufiger verkauft, gekauft und gelesen werden. Nach Durchsicht der Manuskripte sieht es für uns so aus, als komme die deutschsprachige Lyrik dieser Jahre immer mehr aggressiv oder zahnlos larmoyant aus defensivem Lebensgefühl. Seit kurzer Zeit allerdings zeigt sich, daß der Leser (welcher?) von Poesie etwas zu erwarten scheint. Vermutlich ein schlechtes Zeichen, denn es ist eine belegbare Tatsache, daß Poesie (als Lebenshilfe und Seismograph) immer dann in Anspruch genommen wird, wenn FINSTERE ZEITEN zu erwarten sind.
Nachwort zur FRAGE NACH DEM VERBLEIB DES POLITISCHEN GEDICHTS
Keine NUR DIE SOLIDARITÄT / DES PROLETARIATS / ZERSCHLÄGT / DEN FASCHISMUS-Gedichte mehr, keine Agitprop-Gedichte zur Mobilisierung der Massen und des einzelnen. Mit dem Niedergang der organisierten Linken sind die Parolen aus der Lyrik verschwunden und damit, scheint es, ist die Konjunktur der ,Politischen Lyrik‘ vorbei. Das Feuilleton hat die Neue Subjektivität, die Neue Innerlichkeit und die Neue Weinerlichkeit entdeckt; das Gedicht, wird behauptet, sei „privat“ geworden. Mit Etiketten dieser Art wird jedoch nur die alte Trennung von Politischem und Privatem in der Poesie behauptet, vor allem aber ein Begriff weitergeschleppt, der zur Rechtfertigung farbloser Tendenzverse ebenso herhalten mußte wie zur Erledigung politisch eindeutiger Autoren. Die FRAGE NACH DEM VERBLEIB DES POLITISCHEN GEDICHTS erscheint uns so problematisch wie der Begriff selbst.
Das dritte Kapitel des Jahrbuchs enthält Gedichte, die, vielleicht direkter als die im zweiten, persönliche Erfahrung mit dem Riß DURCH UNSERE WELT / AUS DEM SONST TÄGLICH SCHEISSE FÄLLT zur Sprache bringen. Die komplexe Formel VON MIR – ZU EUCH – FÜR UNS allerdings bleibt fast ohne Entsprechung. Statt BLEIB ERSCHÜTTERBAR UND WIDERSTEH Resignation, Wut, Angst, Alptraum, Verzweiflung oder die große Gardinenpredigt. Keine Rede mehr von Utopie.
Je genauer ein Autor seine Misere schreibt, desto deutlicher zeichnet sich die große Misere ab. Wo er die „objektive Wahrheit“ zurückläßt und von Erfahrung spricht, vom beschädigten Leben und vom großen Nackenschlag, macht er Welt und Epoche sichtbar. Die Fenster nach draußen freilich sind klein.
Nachwort zu NEUE AUTOREN
Im Kapitel NEUE AUTOREN werden Lyriker vorgestellt, die Gedichtbände noch nicht veröffentlicht haben oder aber unter Ausschluß der Öffentlichkeit in kleinen Verlagen. Es handelt sich nicht um JUNGE AUTOREN. Der jüngste ist Jahrgang 1949.
Unserer Überzeugung nach unterscheiden sich die hier vorgestellten Lyriker von der poetischen Konfektion durch thematische und sprachliche Eigenart. Wir glauben, daß sie eine Stimme haben oder haben werden.
Brief
Ein wichtiges Unterfangen, so ein Jahrbuch, dessen Gedichte mir sehr unterschiedlich scheinen. Es bezeugt ein weitgehendes Fehlen von Ansprüchen und Maßstäben. Und dies vor allem, entschuldigen Sie die anmaßenden Worte, bei den bundesdeutschen Autoren. Oft habe ich das Gefühl, daß DDR-Autoren (u.a. Adolf Endler, Karl Mickel, Günter Kunert, Erich Arendt, Rainer Kirsch, Kurt Bartsch, Heiner Müller) und ehemals in der DDR wohnende Dichter (u.a. Peter Huchel, Sarah Kirsch, Bernd Jentzsch, Jürgen Fuchs, Thomas Brasch, Helga Novak, Christa Reinig) das Niveau bestimmen. Gewichtige Ausnahmen, dies sei ausdrücklich betont, eingeschlossen, neben den Verstorbenen Ernst Meister und Günter Bruno Fuchs vor allem Christoph Meckel, Rose Ausländer und Hans-Magnus-Enzensberger, dem mit seinem Titanic-Untergang ein Aufstieg zu einer überzeugenden Form gelang. Nun würde ich ein Jahrbuch wie das vom claassen Verlag sicher nicht immer wieder mal zur Hand nehmen, wenn sich nicht in der Vielzahl durchschnittlicher, leidenschaftslos oder unkonzentriert geschriebener Gedichte immer Überraschungen fänden. Auch bei Autoren, die ich kaum kenne oder noch gar nicht kannte. Andernorts überzeugte mich Oskar Pastior (der allerdings aus Rumänien stammt), wie auch das konsequente Arbeiten von Brinkmann, Heissenbüttel, Jandl immer wieder anregte und anregt.
Vielleicht sollten Sie sich für das nächste Jahrbuch zu einer Gliederung entschließen, bei der die Texte einzelner Autoren hintereinander gedruckt werden. Dies ist übersichtlicher, denn man kann sowieso nicht erwarten, daß ein Leser zirka zweihundert Arbeiten verschiedener Leute nacheinander genießt. Bei einer thematischen Anthologie müßten ansonsten strengere Maßstäbe bei der Auswahl vorhanden sein. Die weitverbreitete Sucht, unbedingt etwas bis dahin Unveröffentlichtes vorzustellen, scheint die Autoren auch zu flüchtigem Arbeiten zu animieren. Mir fehlt einfach bei vielen Texten, und jetzt beziehe ich mich nicht nur auf die in Ihrem Jahrbuch gelesenen, ein Ernst, der das Schreiben von Gedichten zwingend erfordert. Liegt das an fehlender Arbeitsdisziplin beim Schreiben (jawohl, Disziplin, auch wenn dieses Wort Aversionen auslöst) oder an fehlender Intensität beim Erleben? Vieles wirkt beliebig, wie aus einem Überdruß heraus geschrieben. (Ich denke da z.B. an jene Texte, die das Lyrik-Jahrbuch 1 eröffneten.) Die Lyrik-Debatten bei Ihnen in den letzten Jahren konnte ich zum Teil verfolgen (z.B. in Akzente), wobei ich – bei interessanten Details – auch hier den Eindruck gewann, daß zum Großteil über Selbstverständlichkeiten gestritten wird und man bei der Diskussion über soziologische Komponenten der Nach68erLyrik, über Wirkung oder Nichtwirkung, sich eigentlich sehr oft vom Gedicht entfernt. Schon der Begriff „Neue Subjektivität“ (dessen Idiotie nur von „Neuer Innerlichkeit“ überboten wird, wo gibt es ein halbwegs gelungenes nicht-subjektives Gedicht?) bezeugt Hilflosigkeit.
Begrüßenswert, daß die Gedichte von DDR-Autoren nicht nach politischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Diese Unvoreingenommenheit sollte beibehalten werden. Sie schrieben, daß die DDR unterrepräsentiert sei. Ich weiß um die Schwierigkeiten für einen Außenstehenden, Texte zu bekommen, Schwierigkeiten, die mitunter bei der postalischen Beförderung beginnen. Doch vielleicht sollten Sie wenigstens bei den hiesigen Autoren das Erstveröffentlichungsprinzip durchbrechen und langfristig Texte aus hier erschienenen Büchern, Anthologien, Zeitschriften auswählen, um dann termingemäß Nachdruckgenehmigungen zu erhalten. So gut wie noch nichts bei Ihnen wurde von den bedeutenden Lyrikern Georg Mauerer und Uwe Greßmann gedruckt. Weitgehend unbekannt dürften auch Kito Lorene, Walter Werner, Hanns Cibulka, Jürgen Rennert sein. Äußerst wichtig auch die 1966 gestorbene Dichterin Inge Müller, von der hier einmal ein Poesiealbum erschien. Richard Leising und B.K. Tragelehn brauche ich wohl nicht zu erwähnen? Von Bettina Wegner, Frank-Wolf Matthies, Wolfgang Hilbig erschienen ja im letzten Jahr in der Bundesrepublik Gedichte, hier fielen mir in letzter Zeit bei dem Gedruckten Gabriele Eckart, Uwe Kolbe und Steffen Mensching auf (drei sehr unterschiedliche Temperamente, Haltungen, deren Texte noch nicht die Eigenständigkeit der vorher genannten drei Dichter besitzen). Und unbedingt erwähnen will ich Bert Papenfuß. Und wenn ich jetzt noch einmal zum Buchregal ginge, käme ich sicher mit dem einen oder anderen Namen zurück.
Auf ein neues Jahrzehnt, das nicht bei „1984“ enden möge,
Ihr Lutz Rathenow
Brief
… Was nun das Jahrbuch betrifft, so war es zunächst einmal angenehm für mich, obwohl ein Taschenbuchfreund, endlich wieder ein gebundenes Buch in Händen zu halten (mit dem man notfalls auch Köpfe einwerfen kann). Die inhaltliche Gliederung – in dem Bestreben, ein „großes Poem“ herzustellen hat der datentreuen (etwa der nach Jahrgängen, die ja sehr einem Gang über den Friedhof ähnelt: ein Grabstein neben dem andern) alles an Intuition voraus. Was mich enttäuscht hat, war, auf so viele schlechte (vordergründige, belanglose, von völliger handwerklicher Unkenntnis geprägte etc.) Gedichte zu stoßen. Zuviel Raum der „Laber-Lyrik“ (wie ich sie nenne, ohne mich in einigen früheren Fällen selbst ausnehmen zu können). Ihre Entschuldigung im Nachwort zieht nicht. Ein Schreibender wird dadurch nicht gefördert, daß man ihm seine stümperhaften Versuche abnimmt und druckt, sondern indem man ihn, en detail kritisierend, zu größeren Leistungen anspornt. In die Nähe dessen gehört auch dieser Unsinn vom „Zeittypus“ (ein Argument, das man sowohl in Conradys Jahrbuch für Lyrik als auch bei Ihnen findet). Gedichte werden nicht von der Zeit geschrieben, sondern von Menschen, die in der von ihnen selbst geschaffenen Zeitidee leben. Da kommen nun einige Herausgeber, finden ein Gedicht nicht gut, aber „zeittypisch“, und möchten es dem Leser „nicht vorenthalten“. Folge: die einen Erzeugnisse werden gedruckt, die anderen, die der Vorstellung vom „Zeittypischen“ entgleiten, nicht. So wird von den Verwaltern, nicht von den Autoren, das „zeittypische Gedicht“ protegiert.
Bei 70% der aufgenommenen Arbeiten, heißt es im Nachwort, waren sich die Herausgeber hinsichtlich deren Qualität einig, und Sie ziehen daraus den Schluß, es müsse eine „undogmatische Poetologie“ möglich sein. Ich meine: die weiteren 30% sprechen dagegen, denn quantitativ, nach Demokratie-Prinzip aufwiegen läßt sich das nicht. Über diese Fälle hätte ich gern mehr erfahren.
Als sehr wertvoll empfand ich die Beteiligung älterer, unpopulärer Lyriker. Um deren Vermächtnis sollte man sich – noch zu ihren Lebzeiten – in der Tat mehr kümmern.
Sie können Kritik vertragen?
Herzlich:
Jürgen Wellbrock
Brief des ersten Mitherausgebers Harald Hartung
(Wird von den folgenden Mitherausgebern fortgesetzt.)
Lieber Christoph B., lieber Christoph M.,
ich will mich in diesem Brief auf eine einzige Frage beschränken. Freilich auf eine so große, allgemeine, entscheidende, daß ich dazu nur ganz persönliche und pauschale Anmerkungen machen kann. Es ist die Frage nach der Form, besser der Formlosigkeit so vieler neuerer Gedichte. Werden gegenwärtig überhaupt noch Verse geschrieben oder ist das nicht alles abgeteilte Prosa, Flattersatz, der nach Gedicht aussieht und sich Autorität und Aura des Gedichts borgt? Ich bin nicht der erste, der so fragt, aber ich habe den Eindruck, daß alle Fragen in diese Richtung kein Gehör fanden. Der freie Vers, von den älteren Dichtern gern als der schwierigste bezeichnet, dominiert in den poetischen Hervorbringungen, als wäre er das Schwierige, das ganz einfach zu machen ist. Wer auf Formfragen beharrt, ist Formalist und damit basta – das ist die Devise aller Inhaltisten, die sich deshalb, weil sie gegen den Formalismus sind, schon für fortschrittlich und gesellschaftlich wirksam halten. Und wenn in Lyrik-Kritiken einmal schüchtern nach der Funktion von Zeilenbrechungen gefragt und gar ihre Willkürlichkeit moniert wird, scheint es fast, als würde solche Willkür dem Autor als eine Art Kraft zugutegehalten. Der Verdacht des Formalismus und der Konvention gilt ja als das Schlimmste, das den Autor treffen kann. Und deshalb frage ich mich, wie lang es braucht, bis die unreflektierte Verwendung des Parlando-Stils (was ein sehr anspruchsvoller Ausdruck für die oft sehr anspruchslose Sache ist) als konventionell und formalistisch gilt. Im Moment scheint noch was (fast) alle tun, unverdächtig und unbezweifelbar. Wer bei Flattersatz nach dem Vershaften fragt, wird als Spezialist in die Zunft der Metriker abgedrängt, einer, wie man zugeben muß, sehr zerstrittenen Zunft. Oder ist der Frager bloß ein Reaktionär, der Hexameter, Distichon und Sonett wiederbeleben möchte und mit ihnen die Inhalte einer längst vergangenen Kultur?
Um Wiederbelebung geht es dem Frager nicht. Nicht so jedenfalls, als brauchte man in die bereitliegenden alten Schläuche nur einen schon vorhandenen neuen Wein zu füllen. Ich bemerke, wie ich in den Gestus der Rechtfertigung gerate. Dann nämlich kann ich gleich mit einer weiteren Verdächtigung kommen und sie mir vorhalten. Formen – mit Vorliebe wird in diesem Zusammenhang von „strengen“ Formen gesprochen, als wolle ihr Befürworter seinen Versen mit dem Rohrstock den Takt schlagen – Formen also, sind das nicht Selbst-Disziplinierungen von Schwäche, dazu oder deshalb auch politisch verdächtig? Dann gibt es – in Sachen Form – noch die „Rettungsring-Theorie“, und ich muß zugeben, daß ich ihr einmal selbst angehangen habe. Zum Beispiel läßt sich die Frage, warum in Diktaturen so viele Sonette geschrieben werden, mit Hilfe dieser Theorie wunderbar auflösen: Geist gegen Ungeist, heißt es, oder gar Form als Widerstand. Wenn aber die andere These ebenso plausibel gemacht werden kann, wonach den autoritäten Gesellschaftsstrukturen ebensolche Formstrukturen entsprechen, dann gerät wieder alles ins Wanken. Und endlich ist der umgekehrte Schluß von der Existenz des Sonetts auf die Befindlichkeit der Gesellschaft so wahnwitzig spekulativ, daß keine ernsthafte Literatursoziologie da mithalten möchte.
Und nun kommt einer daher und ruft nach der FORM. Nein, er ruft nicht, er schreibt einen Brief, er gibt zu bedenken, er rät auch dazu. Überzeugen kann und will er nicht, wie fruchtbar oder unfruchtbar das auch wäre. Er muß also von sich sprechen, von seinem Bedürfnis nach Form, von seiner Lust an der Form. Er gibt also zu, daß er im Strandbad Platen und Weinheber las; und als er dann schrieb, bewegte er sich in zugemessenen Rhythmen, die ihn freilich reizten. Aber nachdem er eine Weile geschrieben hatte, kam er wie viele zu der Ansicht, die überlieferten Formen von Vers und Strophe seien tot und nicht wieder zum Leben zu erwecken. Er erkannte den Leerlauf der Form; er bemerkte, daß die Formen ihm etwas vorsagten, was er nicht sagen wollte; er hatte noch nicht begriffen, daß Formen etwas provozieren können, was einem sonst nie eingefallen wäre. Aber nach allen Versuchen in freien Versen entdeckte er doch wieder das Bedürfnis, zwischen Sprache und Realität das Raster Form zu haben: nicht um die Wirklichkeit zu foltern, sondern aus dem Glauben, daß erst durch ein gewisses Nadelöhr Wirkliches auf dem Papier wieder zutage tritt.
Daß dies kein Privat- oder Köhlerglauben ist, ließe sich an vielen Beispielen zeigen. Der Lyriker erfährt den Widerstand der Realität als Widerstand der Form. Ihre Wahl wird durch das fertige Produkt nachträglich legitimiert oder in Frage gestellt. Um so unbegreiflicher, wie wenig das Machen, das Sichabarbeiten an der Form gegenwärtig bedacht wird. Form wird zumeist angesehen als bloße Ausbreitung von Inhalt. Auch beim Bleigießen entstehen Formen; sie mögen merkwürdig und bizarr sein, und ihre Interpretation nährt den Aberglauben. Jemand meinte, man müsse nur skrupellos genug sein, etwas Gesehenes und Beobachtetes als Gedicht hinzuschreiben. Nun war er nicht der erste, der so dachte, aber bei ihm kam etwas heraus; die vielen, die ihm folgten, nahmen das als Rezept, was nur eine vorübergehend brauchbare Arbeitshypothese war. Hantierte früher eine ganze Generation geschäftig und geheimnistuerisch im Labor der Träume und machte das Machen zur Machenschaft, so trat eine spätere an den Tresen und verwechselte Bierbestellung mit Lyrik. Das sind Verallgemeinerungen, wie man sie in einem Brief schreibt; ich lasse sie hier stehen auf die Gefahr, mißverstanden zu werden. Ich will aber doch ganz deutlich sagen, daß der neue Realismus in der Lyrik, der das Gedicht wieder ins Gespräch brachte, was nicht sein geringstes Verdienst war, inzwischen abgesunken ist in eine triviale Tagebuchnotizenproduktion, die das Druckbild von Gedichten nur mehr imitiert. In vielen dieser Gedichte wird die Phantasie mehr beredet als verwirklicht. Warum verwenden so wenig Lyriker Phantasie auf die Erfindung neuer Formen oder auf die Verfremdung und Erneuerung tradierter Formmuster? Bei den älteren Autoren kann ich die Scheu vor der überlieferten Metrik noch verstehen. Sie möchten nicht wieder in den Jambentrott geraten oder sich von Trochäen einschläfern lassen; der freie Vers war ihnen das Resultat von Befreiung. Aber die Jüngeren – können sie als Befreite beginnen? Wer kennt denn Kaysers Kleine deutsche Versschule wirklich? Oft glaubt sich Unkenntnis gegen die Verführung zur Form, zur „bloßen“ Form gesichert. Wenn Virtuosentum eine Gefahr ist – wo sind die Virtuosen, die uns das deutlich machen?
Da lob ich mir jene, die sich – nicht immer ganz freiwillig, sondern in Ermanglung avantgardistischer Verführungen – durchs sogenannte kulturelle Erbe hindurcharbeiten mußten: nicht eben ins Schlaraffenland, sondern in die sichere Beherrschung des métiers. In Jena und in Weimar schreibt man wieder Hexameter, das ist zwar Parodie klassischer Formen, aber ebenso gegenwärtige Wirklichkeit – wenigstens für die heute vierzigjährigen Autoren, die in der DDR leben oder lebten. Wer hat den Blankvers aufgerauht, den Reim schlagkräftig und zwingend gemacht, das Sonett dialektisch behandelt und, wo solche Dialektik wieder zu glatt lief, die hirnwitzige wieder auf die Füße gestellt? Das tat nicht bloß Karl Mickel, das besorgten, jeder auf seine besondere Weise, Sarah Kirsch und Bernd Jentzsch, Rainer Kirsch und Heinz Czechowski. Und in der Gestalt von Andreas Reimann gibt es gar einen Formvirtuosen à la Weinheber oder Platen, gewiß problematisch, aber nicht uninteressant. Interessant auch die Bedeutung des Prosa-Gedichts, auch und gerade in der DDR. Denn gewiß ist Poesie nicht an den Vers gebunden. Aber gegenüber einer Lyrik, die den Vers bloß vorgibt statt ihn zu verwirklichen, ist das Prosa-Gedicht die ehrliche Form. Es gibt Belege dafür, wie aus Gedichten in freien Versen poetische Texte in Prosaform wurden, die ihren Wahrheitsgehalt ganz rein ausprägten.
Und die West-Deutschen? Sagen wir nicht, wir hätten bloß Rühmkorf, den plebejischen Virtuosen, der in Parodie und Kontrafaktur alte Möglichkeiten aufhebt und bewahrt. Wir haben, Anwesende einmal nicht ausgenommen, einen Christoph Meckel, der ungeniert Sonette schrieb, als man die tradierten Formen totsagte. Wir hatten Dieter Leisegang, den zu Lebzeiten ganz wenige Leser wahrnahmen. Wir haben, beispielsweise, einen anderen Außenseiter: Ludwig Greve, der mit antiken Formen experimentiert.
Es gibt keinen freien Vers. Hier kann man anknüpfen, weitergehen und soll sich nicht in einen kulturkonservativen Winkel abdrängen lassen.
Euer
Harald Hartung
*
Vereinzelt ungehalten, meist aber wohlwollend war die Reaktion der Feuilletons auf das erste Jahrbuch der Lyrik. Es sah jedoch so aus, als hätten ZWEI ZENTNER MILDE VERSE die Kritiker derart ermattet, daß es nur noch zu Unverbindlichkeiten reichte. Eine Debatte über die beiden Jahrbücher des Jahres 79 kam nicht zustande, weil niemand eine klare und also angreifbare Position bezog, weil der programmatische Satz der amerikanischen Underground-Lyrik IM GEDICHT HAT ALLES PLATZ von Kritikern und Autoren seinerzeit vielfach pauschal, unkritisch, fast gläubig übernommen wurde. Seither ist Form in der deutschsprachigen Poesie ein seltener Begriff.
Den ursprünglichen Plan, das zweite Jahrbuch mit einem Kapitel Theorie/Polemik/Diskussion zu beschließen, in dem Grundsätze und Gegensätze formuliert und poetologische Attacken vorgetragen würden, mußte fallengelassen werden. Anstelle einer Debatte also einige Beiträge und drei Zuschriften von Lyrikern.
Abschließende Notizen
I
Was war aus den Reaktionen der Leser, Lyriker und Rezensenten, was aus den kritischen Anregungen zu erfahren?
Erstens: Ein Autor wird nicht ermutigt oder gefördert dadurch, daß ein wenig überzeugendes Gedicht von ihm in das Jahrbuch aufgenommen wird. Weiter helfen nur solidarische Kritik und „ein paar neue alte Maßstäbe“;
Zweitens: Zweihundert Gedichte sind zuviel;
Drittens: Nicht nur von lesenden Kritikern und kritischen Lesern, sondern vor allem auch von den Autoren selbst wurde Unbehagen über die „Qualität“ vieler Gedichte geäußert: „Laber-Lyrik“; „leidenschaftslos und unkonzentriert“; Banalitäten; in Zeilen gebrochene Prosa.
WAS IST DAS, EIN GUTES GEDICHT?
*
Das zweite Jahrbuch bezieht durch Auswahl und Zusammenstellung eine Position, die „Retrospektive 79“ zeigt einen Maßstab, den Maßstab der Herausgeber. Darüber läßt sich streiten.
Die Kriterien unserer Auswahl sind, so hoffen wir, den Gedichten selbst ablesbar. Eine Poetologie, sofern sie überhaupt möglich ist, können wir nicht liefern. Wichtig schien uns, eine Bestandsaufnahme der deutschsprachigen Gegenwartslyrik eines Jahres vorzulegen mit den (uns erreichbaren) besten Gedichten.
Insgesamt haben wir etwa 5 Prozent der eingesandten Gedichte berücksichtigt.
Christoph Buchwald
II
Die Möglichkeiten einer Anthologie sind begrenzt. Die Möglichkeit von Kompromiß und Mißlingen ist unbegrenzt. Gewöhnlich werden Gedichte nach Themen, Jahrgängen oder Autoren geordnet und in entsprechenden Kapiteln beigesetzt. Das Buch erscheint programmgemäß, das heißt: es wird mehr oder weniger erfolgreich in der Öffentlichkeit beigesetzt. An diesen Tatsachen läßt sich wenig ändern. Das Prinzip Anthologie ist Ordnung und Übersicht. Das Prinzip Jahrbuch engt das Prinzip Anthologie ein. Festgelegte Typografie und Aufmachung des Buches engen weiter ein. Die literarische Optik der Herausgeber engt die Gedichtauswahl ein, und die Qualität der eingesandten Gedichte engt die Qualität des Jahrbuches ein. Luft, Luft, Clavigo!
*
Das Problematische einer Anthologie soll nicht einmal mehr verschleppt, sondern demonstriert werden. Der Leser soll an der Problematik teilnehmen. Ermüdet von Lyrik und nicht zufrieden mit ihr wollen wir zeigen, womit es der Leser und der Autor zu tun hat und auf welche Weise wir selber damit zu tun haben.
*
Zur genauen Beurteilung der Gedichtauswahl müßten alle aussortierten Gedichte als Anhang veröffentlicht werden. 7000 Gedichte in fünf Bänden.
*
Möglichkeiten einer Anthologie: Auswahl von Gedichten aus einem größeren Zeitraum. Zubereitung einer Anthologie als Hausbuch, Schöngeister-Bibel und belletristisches Ruhekissen. Beschränkung auf wenige Autoren, auf die Tendenz einer Saison oder auf eine Möglichkeit poetischer Sprache. Anthologien, die nur gereimte Gedichte enthalten, und Anthologien; die auf gereimte Gedichte grundsätzlich verzichten. Beschränkung auf eine Generation, ein deutschsprachiges Land, auf ein Thema schlechthin. Beschränkung auf kurze oder lange Gedichte, auf Kurzzeiler oder Langzeiler. Anthologie als Geschenkartikel eines Verlags oder Ruderclubs, als Werbeartikel einer Firma und als Poesiealbum für Bildungsbürger. Als ästhetisches Manifest oder ideologisches Weißbuch, als Propaganda und Podium einer literarischen Schule. Als Landeskunde und Reiseführer im weiteren Rahmen der Touristik. Soziologisch relevante Anthologien, etwa Lyrik von Seeleuten, Witwen, Bankangestellten oder Germanisten. Etc. Etc. Und das alles mit Versen. Wir möchten mit dieser Anthologie Vorschläge machen, die zukünftige Herausgeber angreifen oder aufgreifen können.
*
Ein junger Lyriker schreibt: „Ich sehe nicht ein, warum meine Gedichte nicht gedruckt werden sollten. Wenn ich lese, was heute als Lyrik veröffentlicht wird, dann kann ich meine Gedichte nicht schlechter finden. Ich halte sie eher für besser.“ Die andern, sagte einer, sind nicht größer als ich, sie sind eher kleiner. Da kam ein Riese und steckte ihn in die Tasche.
*
„Auf die Frage, welches die Kriterien der Größe in der Literatur sind, antworte ich: kosmische Weite der Vision und Großzügigkeit.“ Diesen Satz von Czeslaw Milosz zum Jahrbuch in Beziehung zu setzen, ist eine Unverschämtheit, denn er beschämt das Jahrbuch, er beschämt verschiedene Verse in ihr, und er beschämt ganz offensichtlich die Chancen eines deutschsprachigen Jahrbuchs zu Beginn der achtziger Jahre.
Es ist aber ein Vergnügen, diesen Satz zum poetischen Weltbürger Erich Arendt in Beziehung zu setzen.
Christoph Meckel
Die Lyrik-Jahrbücher
Die dreieinhalb Jahrzehnte seit 1945 waren unterschiedliche Zeiten für Lyrik: Jahre des lyrischen Wohlstands, der lyrischen Umbrüche, der lyrischen Austrocknung, der lyrischen Wiederbelebung. Das Interesse der Massen wie zu Majakowskis und Jewtuschenkos Zeit in Sowjetrußland, wie für die Verse Pablo Nerudas oder Ernesto Cardenals in Südamerika, fand die Lyrik hierzulande nie. Sie konnte keine Revolution verheißen, nicht die alte Erde seligpreisen, keine Kommunion mit allem Lebendigen feiern. Keine Erzählungen, keine allgemein verständlichen Gesänge, keine Poster für ein Paradies. Stets arbeiteten unsere Lyriker mehr artistisch, monologisch, intellektuell; zu fest am Schreibtisch, zu fern vom Gras, mit zuwenig Geschichte oder zuviel Absicht.
Nach 1945 traten den abendländisch beschwörenden Versen älterer Autoren Verse der jüngeren entgegen, die mit Erinnerung und Umbruch die Vorstellung einer kritischen „Inventur“ verbanden (Günter Eich). Politisch aufklärerische Gedichte verdrängten in den 50er Jahren Ausläufer des naturmagischen Gedichts. Unter die alphabetisierenden und konkretistischen Gedichte der 60er Jahre mischten sich zuerst popleichte Satzreihen. Später duckten agitatorische Verse das sensible lyrische Ich. Denunzierende Demonstrationsverse und ideologisierende Meinungslyrik besetzten das literarische Feld. Erst in den 70er Jahren fragten Autoren und Kritiker, was denn Verse ausrichten, wenn sie nur Nachrichten, soziologische Reiz- und politische Streitworte reproduzieren.
Zwei lyrisch aufsteigende und abfallende Kurven lassen sich seit 1945 erkennen. Die erste erreichte ihre Scheitelhöhe in den späten 50er, ihre Talsohle in den späten 60er Jahren. Die zweite lyrische Kurve steigt seit den frühen 70er Jahren auf. Sie dürfte an verlegerischem und publikumswirksamem Interesse gerade ihren Höhepunkt überschritten haben.
Wie vor einigen Jahren auf Ideogramme reagiert die literarische Kritik jetzt auf private Gefühle, auf leichte Prosa, die mit der linken Hand in Versware umgebrochen wird, härter. Der Athenäum– und der Claassen-Verlag hoffen freilich, daß den Autoren der lyrische Gusto nicht erlahmt, Lesern, Kritikern und Käufern das lyrische Interesse nicht erlischt.1 Beide Verlage haben ihr zweites Lyrik-Jahrbuch ediert, Athenäum mit rund 80 bekannten und weniger bekannten Autoren, Claassen mit rund 70 Autoren und ebenfalls über 100 Gedichttexten. Wie Conrady und Pinkerneil, die Herausgeber des Athenäum–Jahrbuchs anmerken, handelt es sich – und zwar in beiden Fällen – mehr um ein Lyrik-Forum als um eine Anthologie mit repräsentativem Anspruch. Zwar haben namhafte Autoren, denen an ihrer Präsenz auf dem lyrischen Markt gelegen ist, mitgemacht – unter ihnen Wolfgang Bächler, Walter Helmut Fritz, Ernst Jandl, Karl Krolow, Rainer Malkowski, Johannes Poethen. Andere wie Rose Ausländer, Jürgen Becker, Hans Magnus Enzensberger, Hilde Domin, Uwe Dick, Günter Grass, Peter Härtling, Ursula Krechel, Heinz Piontek – vor allem aber die ehemaligen DDR-Autoren Thomas Brasch, Wolf Biermann, Bernd Jentzsch, Sarah Kirsch, Reiner Kunze haben auf ihre Teilnahme am lyrischen Jahrmarkt verzichtet.
Die ersten Jahrbücher enthielten zu viele Texte, die sich durch willkürlichen Umbruch von Prosasätzen als Verse ausgaben. Ihre sprachlichen und bildnerischen Mängel waren nicht zu übersehen, die rhythmischen nicht zu überhören. Zuviele „durchschnittliche leidenschaftslose oder unkonzentrierte“ Verse blieben stehen, kritisiert der in der DDR lebende Lyriker Lutz Rathenow. Man besetzte private Gefühle mit gesellschaftlichen Reizworten. Neue Subjektivität oder lyrische Konfektion, das blieb die Frage.
Der sensible Harald Hartung ist wegen des Überhangs an Formlosigkeit in zahlreichen Gedichten als erneuter Herausgeber des Claassen-Jahrbuchs ausgeschieden.
Christoph Buchwald und Christoph Meckel, die Herausgeber des zweiten Claassen-Jahrbuchs, veröffentlichen im Anhang Briefe dieser kritischen Debatte und nehmen selbst Stellung. „Wer auf Formfragen beharrt“, polemisiert Hartung gegen das Vorzeigen von Gesinnung und Nachrichtenkritik, „ist Formalist und damit basta – das ist die Devise aller Inhaltisten, die sich deshalb, weil sie gegen den Formalismus sind, schon für fortschrittlich und gesellschaftlich wirksam halten.“ Der wirkliche Lyriker, gibt Hartung zu bedenken, „erfährt den Widerstand der Realität (immer noch) als Widerstand der Form“.
Den Herausgebern Buchwald und Meckel lagen 7.000 zugesandte Gedichttexte zur Auswahl vor. Daß sie unter die 120 publizierten Gedichte einen so fahrigen und modischen Text wie den des Versicherungsangestellten Jochen Hoffbauer (geb. 1923) aufnahmen, verrät bedenkliche Unsicherheit.
AUS DEM LEBEN EINES TAUGENICHTS
Mit der Laute und einem
Plastikbeutel über die
Autobahn getrampt.
Im Regen bei Hildesheim
zwischen km 9,7 und 9,8
zuletzt gesehen. Mitgenommen
von einem US-Straßenkreuzer,
Kennzeichen unbekannt.
,Mich brennt’s an meinen Reiseschuh’n…‘
soll er gesungen haben
zur Laute,
am Straßenrand laufend,
trotz des Regens,
von Polizeistreifen verfolgt.
Eine Müllerschürze habe er
über den Jeans getragen,
die wehte bei Innsbruck
wie eine
weiße Fahne
der Ergebung
über den
verschneiten
Alpen.
SEITDEM FEHLT JEDE SPUR.
Man setze die willkürlich gebrochenen Zeilen aus der Verssprache in die Prosa zurück; man nehme ihnen den ritualisierten Anspruch, dann liegen Laute und Plastikbeutel, Eichendorff-Zitat und Fahnenmetapher, Sentimentalität und Spurenpathos gebeutelt im lyrischen Straßengraben. Das ist eine bloß zitierende, metaphorisch aufgeputzte, gesinnungsmodische, unrhythmische Sprache.
Man muß fragen, ob der bundesdeutsche Lyrik-Acker, der in beiden Jahrbüchern nur wenig über die Elbe nach Osten und über die Alpen nach Süden erweitert ist, überhaupt zwei Ernten jährlich erlaubt. Eines der wenigen Gedichte aus der DDR stammt von Wolfgang Hilbig. Sein im Jahrbuch der Lyrik 2 (1980) publiziertes Gedicht „Abwesenheit“ wurde bereits 1969 geschrieben. Der Ostberliner Autor klagt den Konformismuszwang des Staates an. Wer sich als Bürger oder gar Autor nicht konform verhält, wird nicht nur nicht vermißt, sondern aus der Öffentlichkeit der Gesellschaft ausgeschlossen. Das leidenschaftliche Gedicht hat nach der Zwangsausbürgerung so vieler Autoren und Künstler noch größere Repräsentanz gewonnen.
ABWESENHEIT
wie lange noch wird unsere abwesenheit geduldet
keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind
wie wir uns selbst verkrochen sind
in unsere schwärze
nein wir werden nicht vermißt
wir haben stark zerbrochene hände steife nacken –
das ist der stolz der zerstörten und tote dinge
schaun auf uns zu tod gelangweilte dinge – es ist
eine zerstörung wie sie nie gewesen ist
und wir werden nicht vermißt unsere worte sind
gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee
wo bäume stehn prangend weiß im reif – ja und
reif zum zerbrechen
alles das letzte ist uns zerstört unsere hände
zuletzt zerbrochen unsere worte zerbrochen: komm doch
geh weg bleib hier – eine restlos zerbrochne sprache
einander vermengt und völlig egal in allem
und der wir nachlaufen und unserer abwesenheit
nachlaufen so wie uns am abend
verjagte hunde nachlaufen mit kranken
unbegreiflichen augen.
„Abwesenheit“ ist das bitterste Gedicht der beiden Lyrik-Jahrbücher:
… zuletzt zerbrochen unsere Worte.
Zerbrochen sind Grundbeziehungen, Vertrauen, lebensnotwendige Nähe. Weil dieser Klagepsalm erst 1979 in der Bundesrepublik erstpubliziert wurde, nahmen es die Claassen-Herausgeber in ihre „Retrospektive 1979“ auf.
Wie isoliert ein Autor hierzulande an seinen Sätzen arbeitet, wie seine Sätze erst eine Form Freiheit schaffen, notiert der in West-Berlin lebende Oskar Pastior:
Am Rande, denkst du, denkst du Sätze, die dich denken. Du denkst, die denken dich. In deinen Sätzen bist du an ihrem Rand. Du bist eine Anrandung von
Sätzen, die dich an den Rand stoßen, Gegensätzen, und auch an denen wandelst du entlang. Sätze, die dich gegensätzlich denken, wandeln dich an und denken Gegensätze, die du nicht denkst…
… seltsam, du bist nur in Sätzen in Sicherheit, die dich wiegt, und nur in Sätzen in Freiheit, aber in welcher.
Der in Siebenbürgen geborene Autor, der bereits das 50. Lebensjahr überschritten hat, wird von beiden Jahrbüchern als eine der stärksten lyrischen Begabungen und Existenzen entdeckt. Ein lyrischer Spracharbeiter wie Paul Celan, doch nicht surreal ausschreitend, sondern eher konkretistisch, nicht metaphysisch, sondern eher beschreibend und spielerisch Ausschau haltend.
Wie steht es mit der studentischen Gesinnungsnot zwischen Widerstand und Wohlstand? Ironisch, sogar satirisch adressiert der 1938 in Berlin geborene, in Heidelberg lebende Michael Buselmeier einige studentische Müßiggänger:
AN EINIGE BESUCHER DES AKADEMISCHEN LESESAALS
Ihr Gott- und Wahrheitssucher mit abgerissenem Studium,
geheime Poeten, Härtefälle, ich mittendrin!
Hier über der Mensa war, bis sie dichtgemacht wurde,
eure Heimat und Wärmestube, eure Universität…
Brüder ihr nützt keinem etwas, niemand braucht uns,
immer grauer werdend, keine Angst, niemand tut uns was!
Ihr hinkt ja, bekleckert, eure Aktentaschen sind schwer,
so täuscht ihr euren Wirtinnen Fleiß in den Wissenschaften vor,
heimkehrend gegen Abend in eure Dachkammern
kriegt ihr die Tür nicht gleich auf, sie klemmt.
Leere Flaschen unterm Eisenbett, Schuhschachtel
voller Briefe, zittrig, so aus der Welt gerutscht,
Wickelkinder, wo seid ihr jetzt, was geht
in euren Köpfen vor, was träumt ihr.
Eine ungewöhnliche lyrische Adresse, jenseits bequemer Kumpanei. Wie die Prosa der letzten Jahre arbeitet der gleiche Michael Buselmeier den Vater-Sohn-Konflikt in Versen auf. Der Text steht 18strophig im Athenäum–Jahrbuch.
DAS BILD MEINES VATERS
Der Mensch, der mein Vater war, ist tot.
Niemals hat er mich besucht, ich durfte
sein Haus nicht betreten…
Haßte ihn, der mich nicht schlug,
nicht schützte vor den Fäusten
der Arbeiterjungen, vorm Griff
ins Hosenbein…
Haßte ihn, der nicht zahlte, hungerte
mit meiner Mutter, wurde
seltsam und schrill.
Haßte ihn, der sich mir immer entzog, haßte
alle Väter, KEINE VERSÖHNUNG,
das danke ich dir…
Samstagabend starb er im Rokoko
Sessel, während die Sportschau
im Fernsehen lief…
Erinnerungsarbeit, Bewußtseinsarbeit, Trauerarbeit – keine Versöhnung. Noch nie haben in der deutschen Literatur so viele 40jährige ihre Väter angeklagt. Wie können diese Söhne – im Streit mit Vätern und Vaterbild selber Väter werden?
Prononciert politische Demonstrationsgedichte wie die Auschwitz-Anekdote von Yaak Karsunke, in der ein deutscher Germanist als Mithäftling einen polnischen Juden erschlägt, bilden in beiden Jahrbüchern die Ausnahme. Die meisten Gedichte setzen persönliche Betroffenheit in Sprache, beschreiben die eigene Befindlichkeit, tägliche Zustände. Auffallend leise, behutsame, ja zarte Gedichte fallen auf. Die in Hamburg lebende Hildegard Wohlgemuth beginnt ein Gedicht:
Sei leise
sagst du
das kranke wasser
schläft sich gesund
und seine träume
schlagen ans ufer
mond und fledermäuse
halten abstand
sagst du
und der streifen niemandsland
ist ihr geschenk
an uns…
Eine Rückkehr zum Naturgedicht oder zu einer Naivität, die nicht durch sprachlich und politisch kritisches Bewußtsein hindurchgegangen ist, erscheint hierzulande nicht möglich. Das „Sommer II“-Gedicht des 1944 in Bremen geborenen, in der Schweiz lebenden Wolfram Malte Fues bildet eine Ausnahme.
SOMMER II
Ich bin mir zu schwer.
Ich möchte ein Grashalm werden
oder
ein trockener Zweig
in der Wegrinne
In den Schwerefeldern des Mittags
wiegt, was ihm gehört, nicht mehr
als ein Wunsch im späten Erinnern.
Es ist schwer
wie ein Baumblatt zu sein
oder
wie das Vertrauen des Vogelflugs
in die Parabel der Schatten.
Ich bin mir zu schwer.
Ich möchte ein Samenkorn werden
auf Deiner Hand
und in Deinem Atem
über das Land gehen.
Diese Verse schwimmen in Kitschgefühlen. Die Athenäum-Herausgeber setzen darunter das Waldgedicht des gleichaltrigen Dieter Liewerscheidt.
IM WALDE
Leise renn ich in den Wald
nach dem roten Sonnenball
der naiven Malerei.
Alles stimmt, und lautlos knallt
unter frischem Überschall
mein Gehör entzwei.
In fast Heinescher Manier werden naive Sehnsucht und naives Gefühl denunziert. Der Knall des Überschallflugzeugs bricht ins Ohr, zerreißt die Stille, stört die aus ästhetischer Erinnerung und Anschauung gesuchte reale Idylle.
Buchwald und Meckel, die Herausgeber des Claassen-Jahrbuchs, belegen, wie das direkt politische Gedicht verrinnt, wie anstelle des Horizonts „Utopie“ die Stimmung „Resignation“ tritt: konkrete Hoffnung ist nicht in Sicht.
Die westdeutsche Entdeckung des Jahres ist der große alte DDR-Lyriker und Übersetzer (vor allem aus dem Südamerikanischen) Erich Arendt (geb. 1903 in Neuruppin, 1933–1950 im Exil). Ihm ist das Claassen-Jahrbuch gewidmet. Seinen Gedichten attestiert Christoph Meckel im Nachwort „kosmische Weite der Vision und Großzügigkeit“. Ein solches Kriterium beschämt, so Meckel, nicht nur „verschiedene Verse“ des Jahrbuchs, sondern „ganz offensichtlich die Chancen eines deutschsprachigen Jahrbuchs zu Beginn der achtziger Jahre“. In diesem Satz steckt bereits die Resignation des Herausgebers.
Paul Konrad Kurz, aus Paul Konrad Kurz: Zwischen Widerstand und Wohlstand. Zur Literatur der frühen 80er Jahre, Verlag Josef Knecht, 1986
Christoph Buchwald: Selbstgespräch, spät nachts. Über Gedichte, Lyrikjahrbuch, Grappa
Das Jahrbuch der Lyrik im 25. Jahr
Jahrbuch der Lyrik-Register aller Bände, Autoren und Gedichte 1979–2009
Fakten und Vermutungen zum Jahrbuch der Lyrik
Fakten und Vermutungen zu Christoph Buchwald + Instagram + Facebook + Kalliope
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
Zum 60. Geburtstag von Christoph Meckel:
Thomas Rietzschel: Das Schneetier
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.6.1995
Zum 80. Geburtstag von Christoph Meckel:
Hartmut Buchholz: Die Magie der Entstehung eines Gedichts
Badische Zeitung, 12.6.2015
Michael Braun: Meister der Melancholie
Der Tagesspiegel, 12.6.2015
Michael Braun: Schutzengel der Poesie
Park, Heft 68, 12.6.2015
Wulf Segebrecht: Christoph Meckels bildkünstlerisches und literarisches Werk
literaturkritik.de, Juli 2015
Zum 90. Geburtstag von Christoph Meckel:
Johanna Dombois: Nachgeholtes Zwiegespräch nach beider Tod
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.5.2025
Fakten und Vermutungen zu Christoph Meckel + Instagram + KLG + Interview + Archiv 1 & 2 + Internet Archive + IZA + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images +Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Christoph Meckel: FAZ ✝︎ FR ✝︎ MDR ✝︎ RBB ✝︎ Sinn und Form ✝︎ SZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Christoph Meckel berichtet über sich und seine Arbeit, gibt Einblick in seine „Kopfwerkstatt“ und erklärt seine Poetologie.



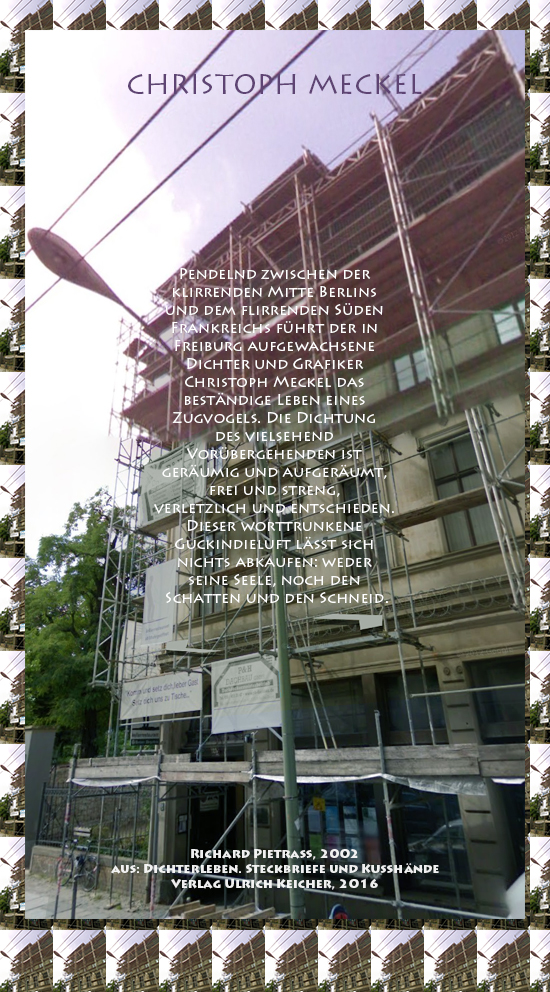












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
In der literarisch-publizistischen Klimaschleuse zwischen dem Haus des Schriftstellers und der Öffentlichkeit, in Presse, Medien und Kulturpolitik, entwickeln sich zunehmend Normen der Äußerung, die fragwürdig sind und der Poesie in den Rücken fallen. Das ist die inflationäre Masse der Statements, der Selbstdarstellungen, Preisreden, Anthologien, der Interviews und Diskussionsbeiträge, der Beiträge überhaupt. Es ist die Überflutung durch Publikation, die Beteiligung an Wettbewerben, Colloquien, Quizsendungen und Jurien, der Meinungsumfragen und Umfragen zu Problemen, von denen ein Schriftsteller keine Ahnung hat. Schließlich die Vorstellung durch den Autor selbst, die der Gewohnheit von Akademien entspricht. Ich frage mich, was in diesem Lärm beliebig, möglich, notwendig und unerläßlich ist. Ist es unerläßlich, daß ein Schriftsteller an professionellen, institutionellen und kulturellen Gewohnheiten auskunftgebend teilnimmt, sich gezwungenermaßen in ihnen wiederholt? Im Betrieb der Verlautbarungen, der von wechselnden Gesichtspunkten veranlaßten, aus häufig fernliegenden Anlässen unternommenen Beanspruchungen von Literatur ist es mir immer unmöglich gewesen, Antwort und Auskunft zu geben für jeden Bedarf. Es ist mir nicht möglich, etwa zum vierzigsten Mal, etwas zu mir und meiner Sache zu sagen, ohne zu fragen, wohin das alles führt. Und ich stelle fest, daß der Lärm die Sprache entwerten, die Gedichte ersticken, den Schriftsteller lähmen kann.
Ein Schriftsteller hierzulande kann Lesungen machen, die gewöhnlich mit Diskussionen verbunden sind. Er hat jede Chance, seine Sache zu vertreten, ausgenommen vielleicht in einem Bordell. Ich habe, durch Überlegung und Auswahl begrenzt, seit zwanzig Jahren gelesen und diskutiert, in Gymnasien, Schulen und Hochschulen aller Art, in Universitäten und Seminaren, in Instituten, Vereinen und Betrieben, in Gefängnissen, Jugendclubs und privaten Zirkeln, in Bereichen von Kunst, Literatur und Politik, Gesellschaftskritik, Pädagogik und Soziologie, im Inland, im Ausland, bezahlt und nicht bezahlt, für Wohltätigkeiten, Spenden und Hilfsaktionen (wie jeder Kollege aus Solidarität). Der wiederholte Ritus von Befragung und Diskussion, das Stereotype der Veranstaltungen, Beanspruchungen und Auskünfte, Spekulationen und Problemumkreisungen – vor allem im Rahmen der üblichen Bildungsprogramme – hatte weitgehend nichts mit der Sache zu tun, mit der Sprache selbst, ihren Formen und Substanzen, Voraussetzungen, Wirkungen und Folgen. Ich hielt das alles für unerläßlich – lebendige Fortsetzung von Literatur. Ich machte – und mache – mir diese Chance zu eigen, ihre Wirkung zu steigern durch Auftritt der Person, durch Stimme, Gespräch, Kontroverse und Argument. Das alles hat erkennbare Folgen gehabt und ist für mich selbst nur in Grenzen von Wert gewesen. Ein Schriftsteller kann zum Beantwortungsspezialisten, zum Entertainer, Verkünder, Alleinunterhalter, zum Trostapostel und Bildungslieferanten und schließlich zur Karikatur seiner selber werden. Drei Schatten neben sich selbst und der eigenen Sache, nimmt er die Zweifel und Hoffnungen anderer wahr, bezahlt sie mit Erschöpfung und Zeitverlust und kommt an den Punkt, da ihm alles fragwürdig wird. Ich nehme überall, jederzeit und auch hier das Recht für mich in Anspruch, nichts zu mir und meiner Sache zu sagen, sondern auf die Sache selbst zu verweisen. Dies ist keine Gesellschaft von Tabakspezialisten oder Bankfachleuten, die gelegentlich etwas von Sprache erfahren wollen. Hier sind Spezialisten versammelt, und ich darf annehmen, daß fast jeder etwas von mir gelesen hat. Wer will, hat die Möglichkeit, in Büchern zu lesen, und ich bitte Sie, diese Sätze nicht falsch zu verstehen. Mir liegt jeder Hochmut in der Sache fern. Wichtiger als Auskunft erscheint mir die Frage wohin der erwähnte Lärm der Verlautbarungen führt und ob er der Sache nützt oder schadet.
Ich habe, seit ich erstmals publizierte, und das ist fünfundzwanzig Jahre her, als nicht professioneller Mensch gelebt und geschrieben, und werde nicht aufhören, das in Zukunft zu tun. Berufliches Funktionieren ist mir suspekt. Routine, Cleverness und Manier in der Sprache erscheinen mir beklemmend und lächerlich. Wie viele Schriftsteller meiner Generation sind erfolgreich und namhaft vor die Hunde gegangen durch athletisch gesteigerte Produktivität. Wie viele haben ihr Wesen durch Ehrgeiz verfälscht, durch marktgerechte Ware ruiniert, von halbwahren Forderungen entfremden lassen, in Wiederholung verbilligt oder erschöpft. Wie viele sind immer wieder zu oft zu sehn, ohne Nennenswertes mitzuteilen. Wie viele produzieren in der Befürchtung, an Position oder Einkommen zu verlieren. Ich sehe den Menschen, der Sprache macht, als einen, der nichts dergleichen zu verlieren hat. Zur Produktion – ich spreche von mir selbst – gehört vor allen Dingen das Nichtproduzieren, zur Sprache die Sprachlosigkeit und das Nichterscheinen. Der Schlaf, der Traum, das unsichtbare Leben, die Antwortlosigkeit und das offene Vergnügen, die Ablehnung alles dessen, was – auch nur im Ansatz – Verwertung, Verfügbarkeit oder Lieferung wäre, Verlautbarung an beliebige Adressen, die Mitarbeit am Warencharakter der Kunst. Es gehört dazu die notwendige Abwesenheit, auch auf die Gefahr hin, daß der Mensch verschwindet, Resonanz verliert und in der Versenkung verstummt. Die Sprache, die Strophe, braucht Ruhe um zu wachsen, bis sie gemacht und beendet werden kann. Sprache braucht – im Reißwolfklima der Zeit – in wachsendem Umfang Stille und Nutzfreiheit, den natürlichen Atem und eine Entschiedenheit, die persönlich bestimmt und privates Risiko ist. Sie braucht einen Umkreis, der unantastbar bleibt, von Erklärungsgetrampel nicht betreten wird, von Lautverstärker und Informationswert frei, vom Erstickungsverfahren durch Zweck und Gebrauchsfähigkeit. Ein Buch, ein Gedicht, kann für mich kein Gegenstand sein, der während des Schreibens zur Publikation bestimmt ist. Schreiben heißt nicht, ein Buch nach dem anderen schreiben, dann weiter schreiben und über das Schreiben schreiben, über Geschriebenes Auskunft geben nach Plan und Bedarf. Der Vers ist ein komplexes Lebewesen, dem sich nichts entnehmen oder hinzufügen läßt. Es besitzt das Recht, den Verfasser im Stich zulassen, es wird ein Leben lang ohne Netz balanciert. Die Anmaßung, mit der die Presse voraussetzt, ein Mensch könne Auskunft geben – jederzeit -, ihr scheinbares Recht im Namen der Öffentlichkeit, die dubiosen Praktiken im Vermarkten und Werben, die Manipulationen von Büchern und Namen, sind allem, was Sprache sein kann, entgegengesetzt.
Es ist denkbar und immer wieder der Fall, daß ein Mensch, der schreibt, sich allem verweigert, was ihn umgibt als Gesellschaft und Literatur. Es ist ein romantischer Purismus denkbar, der jede Stellungnahme für falsch erklärt. Das ist eine Frage persönlicher Glaubwürdigkeit, betrifft Konzeption und Statur des einzelnen Menschen und kann über jeden Zweifel erhaben sein. Undenkbar ist diese Verweigerung für mich. Sie könnte für meine Sache nur fragwürdig sein. Sie ist aber denkbar als Forderung für das Gedicht. Ich halte es für möglich, und also für machbar, das Gedicht im notwendigen Raum aus Ruhe zu lassen, und trotzdem mit Öffentlichkeit zu tun zu haben. Die Sprache und ich, wir müssen mitten hindurch. Reservat, Umgehung und Schonzeit besitzen wir nicht. Es ist ein Dilemma, mit dem sich ein Mensch, der schreibt – professionell oder nicht -, zu konfrontieren hat, in wachsendem Maß zu konfrontieren hat, sofern er nicht zum verbalen Hampelmann wird. Ein Zuviel an Sagen, Meinen und Behaupten, an Wortlaut und Diskussion zurückzuweisen, die für ihn notwendigen Formen selbst zu bestimmen und nicht bestimmen zu lassen durch Öffentlichkeit.
Eine alte Tatsache ist entscheidend, die Person und Arbeit des Schriftstellers relativiert, und die mich jederzeit veranlassen wird, über Lyrik und Kunst hinauszugehn. Es ist die Geschichte und ihre Gegenwart. Sprache war immer mehr als ein Ding der Kunst und niemals nur in der Literatur zu Haus. Es ist kein Zufall, daß die Verbrennung von Wahrheit zuerst die Bücher und die Schriften betraf, und was verdächtigt, verfolgt und vernichtet wird, zuallererst immer Menschen der Sprache sind – jeder Art von Sprache, Kritik und Literatur, der entsprechenden Wissenschaften und Philosophien. Ich kann das sagen, weil ich Zeichner bin, im Vergleich zweier Möglichkeiten lebe und weiß, daß Bildende Kunst weit weniger öffentlich ist, was Vermittlung und Wirkung von Erkenntnis betrifft. Sprache enthält Bazillen und Energien, die direkter zu wirken scheinen als Bild und Skulptur, der Macht verdächtiger sind als Musik und Film. Das ist keine Überbewertung von Literatur, es ist die Gewißheit einer zusätzlichen Chance. Auf die Wahrnehmung dieser Chance kann ich nicht verzichten, ohne mich selbst und die Sprache zu kompromittieren. Diese Möglichkeit durch beliebige Mittel zu schmälern, ihre subversiven Kräfte zu uniformieren, wäre in jeder Hinsicht mein Untergang.
Die Literatur ist kein Zuhause für mich, in dem sich mit fester Einrichtung leben ließe. Das von mir Gemachte gibt mir keinen Rückhalt, und ich erwarte keinen Rückhalt von ihm. Doch tut es mir manchmal gut, daran zu denken, den einen und anderen Satz geschrieben zu haben. Das ist ein Anfang, von dem ich ausgehen kann. Ich lebe und atme in dem, was noch nicht gemacht ist, in Sprachen, Rhythmen, Erkenntnissen, die bevorstehn, und nicht nur mir und meiner Sache bevorstehn. Mein Zuhause ist ohne Dach und Versicherung dort, wo das einzelne Wort als Grundstein gehandhabt wird, ich weiß nicht wofür, es gibt aber ein WOFÜR, ich kenne es wie die Luft und erkenne es wieder: in jedem Satz, der mich entbehrlich macht.
Christoph Meckel 1980, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.