RÜCKFAHRT VON LANA, TIROL
Natürlich bin ich „mitgenommen“.
Die Lyriktage in Lana „haben mich mitgenommen“.
„Ganz schön mitgenommen“, könnte man auch sagen.
(Mehrere Auftritte, gespannte, lohnende Aufmerksamkeit beim Zuhören.)
(Das Wort „mitgenommen“ hält mich erst einmal fest
aaaaahier
mit seinem charmanten und pur umgangssprachlichen Reiz.
Wie es da alle möglichen Beschwerden in die Vorstellung hakt
und gleichzeitig oder vorher schon und zwar beides
oder mehr als 2 – zugleich verschwinden läßt –
in den Gering-Wert einer gewissen Erschöpfung.
Neuerdings stutze ich immer wieder vor gewöhnlichen Wörtern, da sie mir, Hokuspokus, ihre ungewöhnlichen Konditionen auftun. Offenbar eine Alterserscheinung.
Vielleicht ist mir dieses Wort hier eingefallen, weil ich mich,
wegen meiner kleinen vormittäglichen Müdigkeit
nicht frei imstande fühle, auszusagen,
was mich überrascht, erstaunt, ja entzückt hat! Nämlich:
Ich habe die Alpen bisher nicht erkannt,
bei allen früheren Begegnungen nicht!
Sie sind erhaben!
Ach!! Was hat mich solange zurückgehalten!!
Welch ein großer Wechsel ist eingetreten!
Vielleicht gleichfalls dem eigenen Alter verdankt?
Die Alpen sind erhaben!
Nein: Nicht etwa mächtig: Erhaben!
Und ein wenig dabei, als schwebten sie.
Hier war Jenbach.
Als wir auf sie zu fuhren, von München, geschah:
Sie standen, nie gesehn!: in einem zarten Blau, sie selbst,
nicht im Himmelblau, sie brauchten keinen Himmel dabei.
Das hob sie in meinem Ansehn so,
daß ich alles vergaß, was ich gegen sie hatte,
und allem, was ich dann sah von ihnen,
wunderbar gewogen blieb.
So kann es gehn. Aber vordem nämlich dachte ich,
wie kann man da leben, ständig die Felswand vor Augen!
Wie eingesperrt!
Und dann war natürlich auch die Vorausverehrung,
man fuhr ja in eine Vorausverehrung. Ungünstig.
Und deren soziale Struktur, man müßte ja kaltherzig sein:
![]()
Die neue Sammlung von Texten
umfasst zum einen die Jahre 2013 und 2014, andererseits „geholte“ Texte von 1968 bis 2012 sowie Reiseaufzeichnungen: Durchgehendes Bildmotiv die Zweibeiner-Mädchen, Mantelrand unterm Hintern. Noch 12 Minuten Fahrt. Bln-Adlershof, nun schon „unsere Menschen draußen im Lande“ (Funktionärsfloskel). Unendlicher Schrebergarten, Menschen-Kaninchen-Idyll; auch, Mehring, ach, Bismarck, Altglienecke, wer war je Christ, Nä, so doch nicht … so funktioniert es nicht… Grünbergallee… es geht nur mit einem kleinen Ruck im Gehirn; dann ist man einen Augenblick mehr-geht-nicht-zufrieden. Die lassen die Leute hier eine Stunde fahren ohne ein einziges Pißklo.
Beiträge zu diesem Buch:
Dirk Uwe Hansen: Fortfahrender und fortgeführter Zusammenhang
signaturen-magazin.de
ncb.: Nimm Notiz!
Neue Zürcher Zeitung, 19. 5. 2015
Das Lyrische Quartett im Lyrik Kabinett München vom 17.7.2018
Elke Erb: Aber habe wohl nicht geweint
– Laudatio auf Elke Erb anläßlich der Verleihung des Anke Bennholdt-Thomsen Preises der Deutschen Schillerstiftung von 1859 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar, am 8. Mai 2015. –
Wenn eine Zwölfjährige sich Anfang 1950 mit festem Willen, gehörigem Ehrgeiz und, wie ich zu spüren meine, wohl auch einer guten Portion Verdrossenheit vornimmt, innerhalb eines Nachmittags die drei Strophen eines Paradebeispiels von Lyrik mit dezidiert gesellschaftspolitischer Wirkungsabsicht, deren sang- und klangloser Untergang in Deutschland aus mir völlig unerklärlichen Gründen neuerdings gerne wieder betrauert wird, auswendig zu lernen, und zwar ein für allemal, dann erscheint dies nicht darum bemerkenswert, weil der Verfasser der zu memorierenden Verse ein Schriftsteller war, der als Gymnasiast in Münchner Kreisen damit bekannt wurde, daß er eine junge Frau erschoß, und auch nicht, weil er, ein Meister des wohlig dahinplätschernden Herrscherlobs, in nicht allzu ferner Zukunft das Amt des Kulturministers bekleiden sollte, von Berufspolitikern bereits zu Lebzeiten als Klassiker eingestuft, von Kollegen als wandelnde Leiche betrachtet.
Nein, meine gespannte Aufmerksamkeit wird allein darum geweckt, weil es sich bei der Zwölfjährigen um ein Mädchen mit dem Namen Elke Erb handelt.
Jahrzehnte nach dem Ereignis, und zwar ausgerechnet zu Nikolaus 2013 – mit angeklebtem weißen Bart geht der Geist Johannes R. Bechers um und legt den braven Kindern ein paar seiner Gedichte in die Schuhe –, ausgerechnet am 6. Dezember 2013, in der Datierung noch näher präzisiert auf: „nachts“, notiert Elke Erb Sätze, die sich im weiteren Arbeitsverlauf zu einem Gedicht in ihrem Band Sonnenklar entwickeln werden:
ABER ICH HABE WOHL NICHT GEWEINT
Ferne Erinnerung – so,
als hätte ich damals geweint –
ich legte mich auf eine Brettpritsche,
die, in unserem Wohnraum im Heim,
stand an der Wand
und lernte die Hymne entschlossen,
warf mich hart auf die Pritsche
und graue arme Decke (,Pferdedecke‘)
hatte nichts gegen das, hatte vor,
jetzt, nach der Schule, energisch
die Hymne zu lernen beschlossen, alle drei
Strophen auf einmal, ein- für allemal
auswendig – energisch, als wären wir,
Pritsche, die an der Wand stand, 3:
die Hymne, die Liege und leb,
zusammengenommen,
nahm mich zusammen, das Wort
kannte ich nicht, meine ich
3 an der Wand und die 3 Strophen
Hymne
an der Seite des Raums
das Weinen, die Bretter, die Strophen
warf ich mich auf den Bauch,
vor mir das Blatt aus dem Heft
mit der Hymne, wir waren noch neu
dort Halle Franckesche Stiftungen
im Kinderheim, hatte nichts gegen es
Franckesche Stiftungen, 1950. – Nein,
da war kein Weinen dabei
nur die Strophen, Bretter hart
an den Rippen und Ellenbogen.
Die Realität betäubt,
geben mir
über die Zeit hin Bretter und Leib
zu verstehn.
Über die Spanne von mehreren Jahrzehnten hinweg geben Bretter und Leib etwas zu verstehen: Offenkundig geraten wir hier in eine als existentiell empfundene Situation. Wie auch sonst hätte sich das Weinen in die Erinnerung eingeschlichen und dort so hartnäckig gehalten, daß es, dreiundsechzig Jahre nach dem nachmittäglichen Hymnenlernen einer Klärung bedarf.
II
Es entspricht der Arbeitsweise von Elke Erb, kontinuierlich Notizen anzulegen, Wahrnehmungsnotizen, Lektürenotizen, Reflexionsnotizen. Das so von früh an fortgeschriebene Tagebuch, wie sie es heute nennt (früher war die Rede vom Notizbuch), wird – so meine Vorstellung – ebenso kontinuierlich daraufhin geprüft, ob sich an einzelnen Einträgen etwas entzündet, ob ein Eintrag als Auslöser eines Gedichts in Frage kommen könnte. Indem Elke Erb in den zurückliegenden Jahren offenbar häufiger auch weit zurückliegende Tagebucheinträge in die Prüfung mit einbezieht, entstehen – zunehmend in den Bänden seit den aus 5-Minuten-Notaten gewonnenen Gedichten in Sonanz-Gedichte auf der Grundlage von Notizen, die bei früheren Sichtungsvorgängen keine Funken geschlagen haben.
Gerade der Band Sonnenklar führt nun vor, daß dieses Arbeitsprinzip weit mehr zur Folge hat als das Entstehen neuer Gedichte aus bereits vorhandenem Material. Die Verhältnisse schillern – zwischen den aus weit zurückliegenden Notizen gehobenen Gedichten, den sich unmittelbar aus dem Abschreibvorgang neuer Notizen entwickelnden Gedichten und jenen unter der Rubrik „Nimm Notiz!“ gefaßten Wahrnehmungs- und Reflexionsprotokollen, die Elke Erb bevorzugt in öffentlichen Verkehrsmitteln anfertigt, also in einer Sphäre, die merkwürdig zwischen sozialer Interaktion und selbstverordneter Abschottung oszilliert. Diese Mitschriften aber könnten, wie einem beim Lesen irgendwann aufgeht, in Zukunft selbst wieder als Auslöser für Gedichte herangezogen werden: Schwindelerregende Transparenz, in der ein Geheiminsversprechen steckt.
Das Versprechen zum Beispiel, anhand einer zukünftigen Notiz einem Sachverhalt aus der Kindheit nachzugehen. Vor dem Hintergrund dieser zeitlichen Staffelung, dieser Staffelung von Schriftzeugen entstehen Gedichte, die etwas anderes sind als ,Kindheitserinnerungen in Versen‘.
Mir scheint, Elke Erb hat damit eine unmittelbar einleuchtende Vorstellung von Kunstautonomie entwickelt: Eine Autonomie, die weder Kunstreinlichkeitsobsessionen verfällt, noch sich in der – auf Fernsehdramaniveau heruntergewirtschafteten – Opposition von gesellschaftlichen Verhältnissen und ,subjektivem‘ Erleben erschöpft. Das Moment der Autonomie läßt sich vielleicht so fassen: Kunst hat nicht die Pflicht, irgendwem zu irgendwas zu dienen. Kunst lädt ein.
Elke Erb führt es uns vor, indem sie Ossip Mandelstams Kindergedicht von der in die Milch gefallenen Fliege Wort für Wort übersetzt und so nicht nur etwas über Mandelstams Position in der frühen Sowjetunion und sein dichterisches Selbstverständnis in Erfahrung bringt – sie beleuchtet darüber hinaus auch unsere heutigen, gewissermaßen postsozialistischen Lektüregepflogenheiten im Umgang mit Mandelstam. Indem Elke Erb liest, was Gilles Deleuze über Kafka schreibt, erfaßt sie die letzten Tage im Leben des rumänischen Diktators Ceauşescus.
Und was geschieht, wenn Elke Erb sich daran erinnert, wie sie, aus Scherbach in der Eifel nach Halle verpflanzt, mit dem Text der neuen Nationalhymne kämpft? Kindheit und Jugend geraten, als Reflexions-, als Hallraum, in ihrem Werk von früh an in den Blick, erweisen sich immer wieder als produktiv. Das Gedicht „Aber habe wohl nicht geweint“ stellt in dieser Reihe noch einmal einen besonderen Fall dar: Nimmt sich hier doch Elke Erb, die es wie kaum jemand versteht, Lektüre fruchtbar zu machen, selbst als lesendes Mädchen in den Blick.
III
Die äußeren Umstände jenes Nachmittags sind rasch skizziert. Sie ergeben, nicht von ungefähr, ein Bild dringlich vorangetriebener, geballter, gedrängter, hektischer, um nicht zu sagen: grotesk kopfloser Aktivität, die einen fast obszönen Gegensatz bildet zum weit ausgreifenden zeitlichen Rahmen des Gedichts „Aber habe wohl nicht geweint“, ja, zum grundsätzlichen Textverständnis von Elke Erb: Die Dimensionen, in denen sie schreibend denkt, gehen weit über meinen Horizont hinaus – schwer zu fassende Beobachtung, daß sie mittlerweile Gedichte aus ihren Notizbucheinträgen von 1965 hebt, dem Jahr meiner Geburt.
Keine vier Wochen braucht es, von Bechers erstem Entwurf am 12. Oktober 1949, über die Vertonung durch Hanns Eisler, das Vorspiel im Club der Kulturschaffenden, ein weiteres Vorspiel zu Hause bei Wilhelm Pieck, den Ministerratsbeschluß und den Abdruck im Neuen Deutschland am 6. November, bis die Hymne amtlich ist. Unmittelbar darauf wird sie den Schülern wie mit der Betondruckpumpe in die Köpfe gedrückt – zum Jahresende, so die Erfolgsmeldung, kennt die Jugend tatsächlich schon keine Text- und Melodieunsicherheit mehr.
Unglaubliches Geschehen. Ich merke, selbst mir – der ich nie irgendeine Hymne irgendeines Staatsdichters habe auswendig lernen müssen – teilt sich der akute Erregungszustand des Gedichts von Elke Erb nahezu unmittelbar mit. Einen Monat zuvor hat noch keine einzige Silbe existiert, und mit einemmal gelten Bechers Verse für sämtliche Einwohner der DDR, mehr noch, nach Bechers gesamtdeutscher Vorstellung soll die Hymne genauso für den Westen gelten. Für alle Zeit. Es habe „ein sehr würdiger und sehr menschlicher Ton gefunden werden“ müssen, gibt Hanns Eisler über seine Komposition zu Protokoll. Sehr würdig also und sehr menschlich – dies aber zackzack.
Die in „Aber habe wohl nicht geweint“ in den Blick genommene Zwölfjährige hinkt hinterher. In eben jenem November 1949 ist sie mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern nach Halle an der Saale gekommen. Höchste Zeit, sich jetzt, – vermutlich Anfang – 1950, die dreimal neun gleich siebenundzwanzig Verse der neuen Hymne in den Kopf zu zwingen, deren Reime so wenig Greifbares bieten, so wenig Behaltbares bereithalten, daß sich leicht ausmalen läßt, welchen Grad an Verbissenheit es zum Auswendiglernen braucht. Diese Reime leiden unüberhörbar an Charakterschwäche:
scheint – vereint – beweint – Feind
Leben – Streben
empor – zuvor
vertrauend – bauen
scheinen – einen
Hand – Vaterland – zugewandt
Frieden – beschieden
gelingen – zwingen
sowie, natürlich, das wirklich miese Eingangsreimpaar:
dienen – Ruinen.
Der Körper schreibt mit, so wie der Körper mit auswendig gelernt hat – nur um sich Jahrzehnte später noch einmal aus der Situation der Zwölfjährigen heraus zu melden, etwas zu verstehen zu geben. Ob Elke Erb die Hymne heute noch auswendig kennt? Ob ihr Vorhaben damals überhaupt gelungen ist? Diese Fragen sind nicht Gegenstand des Gedichts, so wenig wie die Hymne selbst. Da, wie ich vermute, heute kaum jemand mehr alle drei Strophen auswendig kennt, sei hier die zweite wenigstens beispielhaft angeführt:
Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,
Reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderlich uns einen,
Schlagen wir des Volkes Feind!
Laßt das Licht des Friedens scheinen,
Daß nie eine Mutter mehr
Ihren Sohn beweint,
Ihren Sohn beweint.
Dies ist kein leichter, kein leicht zu lernender Text, sofern man ihn nicht nur lernt, sondern – und davon ist bei Elke Erb auszugehen – auch liest. Von Zeile zu Zeile, ja, von Wort zu Wort häufen sich Widersprüche und Unzulänglichkeiten auf. Nimmt man tatsächlich einmal Vers und Vers zusammen, wird hier in der zweiten Hymnenstrophe nichts weniger als ein Schlachtfest angekündigt: Wir schaffen Frieden, indem wir Volkes Feind – vier Jahre zuvor noch: Volksfeinde – erschlagen. Weil jedoch auch keine Mutter mehr ihren Sohn beweinen soll, wäre es im Grunde nur folgerichtig, die Mütter der Feinde des Volkes gleich mit zu erschlagen.
Wo aber bleiben in Bechers Welt die Täter, die Väter, die Töchter? Und in welcher Lage befindet sich die Tochter eines marxistischen Literaturwissenschaftlers, wenn sie, als letzte Schülerin in der DDR, Anfang 1950 den neuen Hymnentext noch nicht fehlerfrei mitsingen kann?
Ich möchte nicht in der Haut der zwölfjährigen Elke Erb gesteckt haben. Sie selbst vielleicht auch nicht. Aber dann steckt sie mit einem Mal doch wieder in ihrer eigenen Haut, der Haut der Schülerin, die sich in einer äußerst starken Bewegung Anfang 1950 auf eine Brettpritsche wirft, kein hymnisches „Empor“, ein mutwilliges ,Hinunter‘ vielmehr, dem Niveau der Hymnenverse gemäß – zum Auswendiglernen auf Augenhöhe.
Sie drischt sich den Text in den Kopf, auf daß sie ihn nie wieder vergißt. Noch kaut sie daran, kaut darauf herum, meint man, wie der Esel die Distel kaut. Keine Spur von Gleichmut, sondern Ingrimm, ein Anflug von Unerbittlichkeit sich selbst gegenüber – und noch die Erkenntnis vom Dezember 2013 hat etwas von einem Tapferkeitsbeweis: „Aber habe wohl nicht geweint.“
IV
Den Trotz erkennt man beim Lesen sofort, im großen „Aber“, im kursivierten „habe“. Erst beim Wieder- und Wiederlesen jedoch kommt man dahinter, daß dieses Gedicht von einem im Geheimen waltenden, grimmigen Witz angetrieben wird. Der Austausch eines einzigen Lautes, nämlich die Umwandlung des beim Absingen der Becherhymne am Ende der zweiten Strophe zu wiederholenden „beweint“ in ein gleichermaßen zweifaches „geweint“ führt, als Auftakt, vielleicht sogar als Auslöser, in das Gedicht von Elke Erb hinein:
Aber habe wohl nicht geweint
Ferne Erinnerung – so,
als hätte ich damals geweint –
Mit einer minimalen Lautjustierung, vom ,b‘ zum ,g‘, wird der Bezug von abstrakten Müttern auf die Akteurin selbst gelenkt, springt der Blick vom Trampeltopos ,weinende Mutter‘ zur auswendig lernenden Schülerin, die einen Umgang mit Bechers Text zu finden sucht – sie darf sich von dessen semantischem Störfeuer nicht aus der Ruhe bringen lassen. Daß sie sich in dieser Situation weinend erinnert, verzweifelt eher denn hoffnungsfroh, konterkariert wiederum die Schlußzeilen der anderen zwei Hymnenstrophen – und wirkt damit selbst wie ein semantisches Störfeuer, das weit in die Vergangenheit zurück gesendet wird:
Daß die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint,
Über Deutschland scheint.
Bei Johannes R. Becher läuft mit „vereint – scheint – Feind – beweint – vereint – scheint“ eine Reimfolge über alle drei Strophen hinweg, bei Elke Erb entwickelt sich aus dem „geweint“ an Gleichklängen entlang ein Weg über die Stationen „eine – Heim – drei – einmal – ein – drei – meine – drei – drei – Seite – Weinen – Kinderheim – Nein – kein – Weinen – dabei – Zeit“, wie eine Zusammenfassung der ,ganzen Geschichte‘, eine klangliche Eselsbrücke und ein Selbstvergewisserungsstrang zugleich, bis zum entscheidenden „Leib“,
Offenbar wird mit dem Einsetzen des schriftlichen Korrekturvorgangs einer Erinnerung im Notizbuch von Elke Erb in der Nacht des 6. Dezember 2013 auf höchst eigenartige Weise motivisches und klangliches Material jener im Gedicht nicht näher beleuchteten Hymne herangezogen. Die, wie es scheint, bis heute zumindest latent präsenten Allerweltsverse, die es seinerzeit zu memorieren galt, treiben die gedankliche Klärung an: Der fehlerfrei zu lernende Text den Text um eine fehlerhafte Erinnerung.
Da wundert mich dann auch die Beobachtung nicht, daß, über die ,ei‘-Reihe hinaus, ein zweites Klangschema der Nationalhymne bei Elke Erb wieder aufscheint:
Und der Zukunft zugewandt,
Deutschland, einig Vaterland.
Deutschland, unserm Vaterland.
Reicht den Völkern eure Hand
„Einig“ und „unserm“ – das zentrale Moment, der neuralgische Punkt, weshalb in späteren Jahren konsequent auf das Absingen verzichtet wurde. Von der Brettpritsche, auf der die Schülerin die nachmals stumme Nationalhymne der DDR auswendig lernt heißt es, sie
stand an der Wand
und:
die an der Wand stand
und:
3 und die Wand
womit wir Elke Erb im Erinnerungsbild also keineswegs der Zukunft zugewandt zu sehen bekommen, sondern eben einer Wand im Kinderheim der Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale.
Parodie wäre einfach, Parodie wäre fad – der Bechersche Hymnentext selbst kommt ja bereits derart unspezifisch daher, daß er sich als humorlose Parodie auf zahllose Gedichte des neunzehnten Jahrhunderts lesen ließe, ja, er scheint in einer nahtlosen Folge von parodierten Hoffnungs- und Euphorieaufforderungen zu stehen, die mit „Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand, Rußland ist ein schönes Land“ noch lange nicht endet.
Nein. Das Gedicht von Elke Erb reagiert auf die Widersprüchlichkeiten dreier Strophen von Johannes R. Becher, indem es sich in Widerspruch begibt. Ein direkter, in das Wort- und Klangmaterial greifender Widerspruch – dessen Gestus sich jedoch genauso jedem mitteilt, der „Auferstanden aus Ruinen“ nie gehört haben sollte.
Auf eine andere Weise deutlich wird das Abklopfen von Textverhältnissen als Lebensprinzip, wie Elke Erb es vertritt (und das ich als unausgesprochenes Sonntagsredenverbot auffasse), in einem Text mit der Überschrift „Aus ,IMPFSCHEIN BIS KÜNDIGUNG‘ Loch-Ordner, VEB Pirol Lößnitz“, den sie – wie anfangs erwähnt – aus ihrem Notizbuch des Jahres 1965 hebt, am 15. März 2013, also, und ich kann darin keinen Zufall sehen, einige Monate, bevor die Fehlerinnerung an das nachmittägliche Hymnenlernen einer Klärung unterzogen wird. Hier heißt es:
Die Dinge in den erregenden Verhältnissen,
das sind die Worte.
Ich habe den Verhältnissen gekündigt,
sie waren falsch,
nur deshalb waren sie erregend.
V
Ich will nun gar nicht behaupten, Elke Erb habe „Aber habe wohl nicht geweint“ mit Bedacht am Becherschen Hymnentext entlang ausgerichtet. – Sicherlich nicht, und das macht die Parallelsetzung ja gerade so ungeheuer interessant. Dennoch halte ich es für grundfalsch, angesichts solcher Hallräume, solcher Textbewegungen davon zu sprechen, die Autorin gehe beim Schreiben „traumwandlerisch“ vor, arbeite mit „traumwandlerischer Sicherheit“, wie es leider immer wieder heißt, wenn von ihren Gedichten die Rede ist. Als sei Bewußtsein ein Makel, Reflexionsvermögen eine Frauenkrankheit, die es zu überspielen gilt.
Keine Spur von Somnambulismus, wenn ein existentiell nahes „geweint“ im Gedicht den „Feind“ aus einem fernen Fremdtext mitklingen läßt. Der Körper schreibt mit, wer wollte das bezweifeln – so augenfällig wie hier allerdings hat mir das noch kein Text vorgeführt.
Der Reim bestimmt das Bewußtsein.
Ein Hymnenkommentar ohne Hymne, ein Becherkommentar ohne Becher, von mir aus auch ein Kommentar zur durchtriebenen Naivität beifallsüchtiger dichtender Männer – aber eben, und diese Staffelung ist entscheidend, nicht vom Erleben der Schülerin, nicht vom Erinnern der Erwachsenen, nicht von der Schreibpraxis Elke Erbs ablösbar. Ein Lehrstück über die Tücken der Mnemotechnik: Ich erinnere mich fälschlich, ich hätte geweint, während mir der Auslöser dieser Erinnerung als Klangstruktur noch nach Jahrzehnten in den Knochen steckt.
Wie aber, frage ich mich am Ende, hat das Weinen seinen Platz im Erinnerungsbild gefunden? Gehört es überhaupt in diese Szene „in unserem Wohnraum im Heim“, „dort Halle Franckesche Stiftungen“?
Ich glaube, die Antwort hat Elke Erb längst selbst gegeben, in einem zwischen 1969 und 1972 entstandenen Text mit dem Titel „Gezönk“, der 1976 in ihrem Buch Einer schreit: Nicht! veröffentlicht wurde. Sein erster Satz lautet: „Während man meine beiden Schwestern fast so oft, wie man zu ihnen hinsah, in ein Gezänk verwickelt fand, war ich, die zwei Jahre Ältere, ,still‘ und ,vernünftig‘.“
Und sein letzter Satz: „Heute höre ich das Gezänk aus der Kindheit – unverkennbar! – als ein fortwährendes Weinen.
Marcel Beyer, aus Marcel Beyer: Sie nannte es Sprache, Brueterich Press, 2016
NERVÖSES AUSHARREN
für Elke Erb
Unverfestigtes Etwas, über was grübeln?
Scheinklarheit wie Scheinblüte
Geldscheine umgerubelt und Pidgin
gestottert, gewartet, daß etwas geschieht.
Das war das Geschehen, rauschte vorüber
in eine flatterhaft dünne Ferne.
Hand geöffnet und nur eine Türklinke
war zu fassen, Messing, rot verfärbtes Laub
regennaß der Tag, die Anmut von Stunden
die nicht vergingen. Endlosschleife der Erwartung
(das war das Geschehen nicht); wir versuchten
es rückgängig zu machen, ohne zu handeln.
Ursula Krechel
DRESDEN, 19. SEPTEMBER 2013
für Elke Erb
Daß Sie so alt noch rauchen macht mich Ihnen
Im Nachhinein noch etwas mehr gewogen.
Nach Ihrem Vortrag wartenden Granits
Der Treppe, Schwelle werden will und auch
Des Lobs des Bauern, der den Sellerie
Gebären ließ aus seiner schwarzen Erde.
Ich bitt Sie mir noch zwanzig Jahre beizuwohnen
Im guten Abstand Ihres Pankower Domizils
Die Zeit, die alles hinnimmt soll an Ihnen
Auch weiter nur verebben wie am Fels
Der Sie nicht sind, bei Gott, jedoch soll nichts erschüttern
Die Insel deren Zauberin in Ihnen
Sich figuriert und zuverlässig weiter sendet.
Berührung soll auch weiter nur am Rand
Sich Ihnen auferlegen. Daß der fixe Punkt
Den Sie für weiten Raum in sich erhalten
Noch zuverlässig länger jedem strahlt
Der seiner so wie ich bedürftig ist.
Mir ward in Ihnen immer ausgeschenkt
Wes mir die Spur ging daß es in mich denkt.
Mich selbst zurück vom Spiegel wieder wendend
Kann ich den Stimmen, die mich öd befallen
Ganz einfach Ihren Sound befehlen.
Dann hab ich sie im Griff
Und es ist Ruhe im Schiff
Sie haben darin recht: man muß sich selber
Manchmal Befehl erteilen, dann gehts weiter
Ich hätte gern noch über Schnelligkeit.
Jetzt länger ausgeführt. Jedoch mir scheint
Daß dieser kurze Gruß bewenden sollte
Sie mögen lange noch gesund und munter
Wie heute hier in Dresden weiter flechten
An Ihrer Lyrik, die wie Körbe aufkommt
Die sich dem einen fülln, dem andern nicht.
Vielleicht kann man, was in die Dauer geht
An kleinen Dingen nur vertäun. Das zeigt sich spät.
Andreas Paul
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Urs Engeler: Fünf Bemerkungen zu E. E.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ + Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP + rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 + Hayer +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ + AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb + Archiv + Internet Archive + IZA + PIA + weiteres 1, 2 & 3 + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Dirk Skiba Autorenporträts + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 + IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: Bundespräsident ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Die Zeit ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ faustkultur ✝︎ FAZ ✝︎ junge Welt ✝︎ literaturkritik ✝︎ LiteraturLand ✝︎ mdr ✝︎ MZ ✝︎ nd ✝︎ signaturen ✝︎ Sinn und Form ✝︎ SZ ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ tagtigall ✝︎ taz ✝︎ Volksbühne
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Zur Erinnerung an Elke Erb und Helga Paris. Lesung mit Steffen Popp, Brigitte Struzyk, Joachim Hildebrandt und Peter Wawerzinek am 6.7.2024 im Salon von Ekke Maaß, Berlin. Martin Schmidt: Improvisationen am Klavier
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.



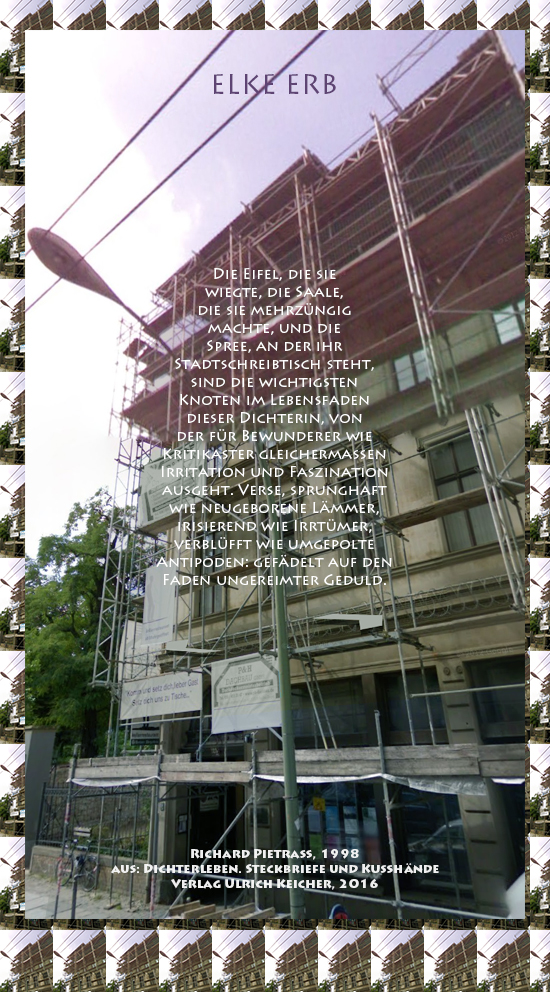












0 Kommentare