Fernando Pessoa: Poesie
DON SEBASTIAN, KÖNIG VON PORTUGAL
Ein Tor, ja, ein Tor, weil ich Größe erstrebte,
wie sie die Himmlischen nicht verleihn.
Weil ich den Traum zu heftig erlebte,
verblich, wo die Möven schrein,
mein altes, nicht mein lebendiges Sein.
Erbt meine Torheit von mir
mit allem, was in ihr gärt!
Was wäre mehr als das satte Tier
der Mensch ohne Torheit wert,
lebendiger Leichnam, der sich vermehrt!
Fernando Pessoa,
Portugals größter Lyriker seit Camões, ist bei Lebzeiten ebenso ruhmlos und arm geblieben wie der Schöpfer der Lusiaden. Seine Biographie ist farbloser als die seines großen Vorgängers: geboren am 13.6.1888 in Lissabon als Sohn eines Staatsangestellten, der sich nebenberuflich als Opernkritiker betätigte, verlor er früh den Vater und verbrachte neun Jugendjahre mit der wiederverheirateten Mutter in Durban (Südafrika), wo er die Bildung eines englischen Kolonialgymnasiums in sich aufnahm. Nach seiner Rückkehr nach Portugal (1905) hat er Lissabon kaum mehr verlassen und sich bewußt – seiner Dichtung zuliebe – auf eine bescheidene, aber freie Tätigkeit als Auslandskorrespondent für verschiedene Handelshäuser beschränkt. Als er am 30.11.1935 an Leberkolik – als Folge übermäßigen Branntweinkonsums – verstarb, war nur ein einziges Buch von ihm veröffentlicht, das übrige Werk nur einem kleinen Kreis Eingeweihter bekannt. Die einzige irdische Hinterlassenschaft des Dichters bildete eine Truhe mit Bergen gesichteter und ungesichteter Manuskripte. In den 25 Jahren seit Pessoas Tod ist aus dieser Truhe eine achtbändige, in ihrem Prosateil noch immer nicht abgeschlossene Gesamtausgabe zu Tage gefördert worden, die den Ruhm des portugiesischen Dichters in ganz Europa auszubreiten beginnt.
Pessoa hat lange geschwankt, ob er englischer oder portugiesischer Dichter werden sollte. Bedeutsamer als die Tatsache, daß er englische Gedichte geschrieben hat, bevor er für die portugiesische Sprache optierte, ist seine Begegnung mit der englischen Geisteswelt überhaupt. Sie hat ihn vor dem Provinzialismus bewahrt, dieser ewigen Gefahr für die Intellektuellen kleiner Länder. „Mit Camões allein kann man keine Bildung aufbauen“ (E.R. Curtius). Von England empfing Pessoa eine solide Kenntnis der englischen und antiken Klassiker. Der französischen Sprache verdankt er mannigfache Anregungen: er kannte Baudelaire und die Symbolisten, Marinettis Futuristisches Manifest und, von den großen deutschen Autoren, Goethe, Heine und Nietzsche in Übersetzungen.
Seine Stellung innerhalb der Lyrik hat Pessoa in einer nachgelassenen Aufzeichnung definiert:
Der erste Grad der lyrischen Dichtung ist derjenige, in dem der Dichter sich auf sein Gefühl konzentriert und dieses Gefühl zum Ausdruck bringt. Ist er jedoch ein Wesen mit wandelbaren und mannigfaltigen Gefühlen, so wird er gleichsam eine Vielzahl von Persönlichkeiten ausdrücken, die nur durch Temperament und Stil zusammengehalten wird. Einen Schritt weiter und wir haben einen Dichter vor uns, der ein Wesen mit mannigfaltigen und fiktiven Gefühlen, eher phantasie- als gefühlvoll ist und jeden seelischen Zustand mehr mit der Intelligenz als mit dem Empfindungsvermögen erlebt. Dieser Dichter wird sich wie eine Vielzahl von Persönlichkeiten aussprechen, die nicht mehr durch Temperament und Stil geeint wird, sondern allein durch den Stil; denn das Temperament ist durch die Phantasie ersetzt worden und das Gefühl durch die Intelligenz. Noch einen Schritt weiter auf dem Wege zur Entpersönlichung oder, besser gesagt, Phantasie, und wir haben den Dichter vor uns, der sich in jeden seiner verschiedenen geistigen Zustände so hineinlebt, daß er seine Persönlichkeit vollkommen aufgibt, derart daß er, indem er jeden seelischen Zustand analytisch erlebt, aus ihm gleichsam den Ausdruck einer anderen Person gewinnt; dabei wird sogar der Stil mannigfaltig. Ein letzter Schritt und wir finden den Dichter, der verschiedene Dichter zugleich ist, einen dramatischen Dichter, der Lyrik schreibt. Jede Gruppe unmerklich verwandter Seelenzustände wird dabei zur Persönlichkeit mit eigenem Stil, deren Gefühle sich von den typischen Gefühlserlebnissen des Dichters selbst unterscheiden, ja ihnen durchaus entgegengesetzt sein können. Und so kommt die lyrische Dichtung… zur dramatischen Dichtung, ohne dramatische Form anzunehmen.
Die drei Lyriker, die Pessoa geschaffen hat: Alberto Caeiro, Alvaro de Campos und Ricardo Reis, sollten wir als solche Dramengestalten ohne Drama betrachten. Pessoa hat jeden von ihnen mit eigener Biographie und eigenen, gegensätzlichen Kunstabsichten ausgestattet und dabei Fiktion und Spontaneität so kunstvoll vermischt, daß sein Werk die Kritik zu den merkwürdigsten Spekulationen über die Bedeutung dieser „Heteronyme“ angestiftet hat. Wie untrennbar Inspiration, Fiktion und Freude am Schabernack miteinander verschmolzen sind, zeigt die berühmte Stelle aus einem Brief des Dichters an den Kritiker Casais-Monteiro:
Gegen 1912… kam ich auf den Gedanken, einige Gedichte heidnischer Art zu schreiben. Ich skizzierte etwas in freien Versen und gab dann die Sache auf. Gleichwohl war mir im nebelhaften Halbschatten ein ungefähres Bild der Person erschienen, die diese Verse geschrieben hatte. Ohne mein Wissen war Ricardo Reis geboren. Anderthalb oder zwei Jahre später kam ich eines Tages auf den Gedanken, dem Sá-Carneiro (einem Lyriker, der zugleich Pessoas bester Freund war) einen Streich zu spielen und einen bukolischen Dichter komplizierter Art zu erfinden und ihm mit einem Anstrich von Wahrscheinlichkeit vorzustellen… Ich verbrachte einige Tage damit, diesen Dichter auszuarbeiten, aber es wurde nichts daraus. An dem Tage, an dem ich es endlich aufgegeben hatte, stellte ich mich an eine hohe Kommode, nahm ein Stück Papier und begann zu schreiben, im Stehen, wie ich sooft wie möglich schreibe. Ich schrieb über 30 Gedichte in einem Zuge, in einer Art von Ekstase… Es war der triumphale Tag meines Lebens; einen anderen dieser Art werde ich nicht erleben. Ich begann mit einem Titel: „Der Hüter der Herden“. Und dann erschien jemand in mir, dem ich sogleich den Namen Alberto Caeiro gab. Entschuldigen Sie das Absurde des Satzes: mir war mein Meister erschienen.
Die Dichtung der Heteronyme liefert gleichsam die Kontrapunkte zu Pessoas eigner Dichtung. Ist Pessoa ipse vor allem der Dichter des Denkleids – „was in mir fühlt, muß immer denken“ –, so erscheint Meister Caeiros abstrakte Bukolik als eine fortwährende Flucht vor dem Denkenmüssen. Indem Caeiro die Dinge bei ihren Namen ruft, nimmt er das alte Recht des Dichters für sich in Anspruch, durch den Akt der Namengebung an der Weltschöpfung teilzuhaben, und weist eben darum alle Spekulationen über die Welt als mit diesem Auftrag unvereinbar ab. Caeiro ist der Statiker unter den Heteronymen; sein dynamischer Gegenspieler wird sein „Schüler“ Alvaro de Campos, ein in Glasgow ausgebildeter Schiffsingenieur, der – wie bezeichnend – „untätig in Lissabon lebt“. Seine Devise: „Sich verstellen heißt sich erkennen“ („fingir é conhecer-se“) kennzeichnet Pessoas Heteronyme als Hilfsmittel auf dem Wege zur Selbstfindung. Er ist der „Hysteriker“ unter Pessoas Geschöpfen; seine Gefühlswelt reicht von der zerspringenden Euphorie der frühen großen Oden mit ihrer Verherrlichung der modernen Technik und Zivilisation bis zu jener in ihrer Nonchalance so abgründigen Verzweiflung an Welt und Ich in den späten Gedichten, in denen gewisse Gefühlskomplexe der Existenzphilosophie vorausgenommen werden. Alvaro de Campos ist der Modernist unter Pessoas Heteronymen; seine frühen, an der Hymnik Walt Whitmans geschulten Oden erschienen 1915 in der kurzlebigen Zeitschrift Orpheu. Die beiden einzigen Nummern des Orpheu bezeichnen den Durchbruch des Modernismus in Portugal und erregten ein solches Ärgernis, daß die Lissaboner Presse den jungen Dichtern das städtische Irrenhaus als angemessensten Wohnsitz empfahl. Gewiß hat Alvaro de Campos’ euphorischer Taumel – in der „Meeres-Ode“, in der „Triumph-Ode“ – nichts mit Walt Whitmans gesunder, urkräftiger Begeisterung gemeinsam; er verrät überall – durch seine masochistischen Züge, durch seinen pathologischen Einschlag – die Gebrochenheit des zarten Dichters, ein Dekadenz-Bewußtsein, dem Nietzsches Wille zur Macht zum Umschlag in Megalomanie verhilft. Dennoch ist die „Meeres-Ode“ vielleicht das großartigste Werk Pessoas, ein genau komponierter Hymnus auf Seefahrt und Meer, wie er nur aus der atlantischen Seele eines Portugiesen hervorgehen konnte. In der „Meeres-Ode“ erscheint auch ein Motiv, das in der gesamten Dichtung Pessoas wiederkehrt: die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies der Kindheit als Kontrapunkt zum Denkleid des Erwachsenen.
Aus Fernando-Alvaro-Pessoa-Campos spricht der Zeitgeist unverhüllter als aus Alberto-Fernando-Pessoa-Caeiro oder Ricardo-Fernando-Pessoa-Reis, Und doch hat die klassizistische Odendichtung des Ricardo Reis Pessoas Leben gleichmäßiger begleitet als die Dichtung der übrigen Heteronyme. Der Formkünstler Reis wird beim deutschen Leser Anklänge an Klopstock, Hölderlin und George wachrufen. Wie sie bemüht sich auch Reis um eine Neuformung der antiken Dichtung aus modernem Geist. Die portugiesische Sprache eignet sich freilich nicht zur Unterwerfung unter antike Metren; der Klassizismus der Oden wird, abgesehen von der Thematik, eher in einer puristischen Wortwahl sichtbar, die heftig von Campos’ ungezügelten Wortfeuerwerken absticht. Die Nähe der antiken Spruchdichtung und die Anrufung der alten Götter darf nicht täuschen: Reis ist kein bloßer Nachahmer des Alten. Auch bei seinen Oden befinden wir uns in Nach-Nietzsche-Bereichen: die christliche Heilserwartung ist verschwunden und an ihre Stelle von neuem das alte, eherne Schicksal getreten, dem auch die Götter nicht gebieten. Pessoas theosophische Gedankengänge spielen dabei eine nicht geringe Rolle: sein Glaube an ein Stufenreich der Geister, dessen unterste Chargen auf Erden eine Probezeit abdienen und hernach aufsteigen in die höheren Gefilde der Hierarchie, die nur den Eingeweihten der Theosophie schon auf Erden ahnbar werden. Wenn Reis die humanistische Dichtung mit neuem Leben erfüllt, so ist auch dies nur ein weiterer Kontrapunkt zu der hitzigen Modernität seines Rivalen Campos.
Es gehört zu den Paradoxien dieses „Dramas in Dichtern“, daß Pessoa ipse sich ausdrücklich als Christen bezeichnet, wenn auch als „gnostischen, und deshalb allen organisierten Kirchen gegenüber ablehnenden Christen“. Sein Leben lang hat Pessoa die „Geheimtraditionen des Christentums“ durchforscht, theosophische Schriften aus dem Englischen übersetzt und den möglichen Wegen zum Okkulten nachzugehen versucht. Aber er war doch eher Künstler als religiöser Mensch, und so sind die Themen des Okkultismus zwar thematisch in den sogenannten „esoterischen Gedichten“ künstlerische Aussage geworden, aber es wäre gewiß verfehlt, ihnen zentrale Bedeutung beimessen zu wollen.
Auch Pessoas Nationalismus, niedergelegt in seinem einzigen bei Lebzeiten veröffentlichten Buch, der Botschaft, knüpft an eine – diesmal innerportugiesische – Geheimtradition an. Der junge, im Kampf gegen die Mauren gefallene König Sebastian, mit dessen Tod der politische Niedergang Portugals sich vollendete, soll nach dem Volksglauben einst wiederkommen und sein Land zu neuer Größe führen. Pessoa bemächtigt sich dieses Mythus und vergeistigt ihn: im letzten der fünf Weltalter, die die Erde nach der Prophezeiung des Daniel erleben soll, erhofft der Dichter für sein Land eine geistige Mission universalen Charakters:
Hellas und Rom und Christenheit,
Europa – sie sanken ins Grab,
Gingen den Weg aller Zeit.
Wer hält sich dem Dienst an der Wahrheit bereit,
Für die Don Sebastian sein Leben gab?
In einem frühen Gedicht von Alvaro de Campos stehen die Zeilen:
Ich gehöre der Gattung von Portugiesen an, die nach der Entdeckung Indiens arbeitslos geworden sind.
Dieser Resignation zum Trotz hat Pessoa das Schicksal seiner alten Rasse bewußt bejaht: das Abenteurertum seines Volkes ist bei ihm nach innen geschlagen. Die große Ausfahrt ins Unbekannte, wo alle Horizonte offen sind, der Mensch ganz auf sich gestellt und dem Scheitern anheimgegeben ist, wurde bei diesem Dichter zum geistigen Ereignis. Auf sich gestellt, in der Enge eines geistigen Abenteuern abholden Milieus, hat er die Fahrt gewagt; seine Kunst erkaufte er mit dem bewußten Verzicht auf alle irdische Behaustheit, auf Ruhm, auf Liebe und berufliche Ehren. So ist er auf seine stille Weise ein Märtyrer der Dichtung in unserem Jahrhundert geworden, ein Märtyrer, dem erst die Nachwelt Kränze geflochten hat, in Portugal sogar die eines neuen Nationaldichters, was Pessoa, hätte er es erlebt, gewiß mit sanfter Ironie quittiert hätte.
Georg Rudolf Lind, Nachwort, September 1961
Die vorliegende Auswahl
umfaßt Pessoas größtes Gedicht, die „Meeresode“; dazu exemplarische Stücke aus dem Werk des Portugiesen, in dem vier dichterische Modifikationen zu unterscheiden sind. Er hat diese einzigartige Vierteilung selbst besiegelt, indem er sich, als Autor, außer seinem eigenen die Namen Alvaro de Campos, Alberto Caeiro und Ricardo Reis gab: sie alle sind hier mit charakteristischen Proben vertreten.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1962
Fernando Pessoa – Der sich selbst Unbekannte
Dichter haben keine Biographie. Ihr Werk ist ihre Biographie. Pessoa, der an der Wirklichkeit dieser Welt stets zweifelte, würde es wohl ohne zu zögern gutheißen, wenn ich mich direkt seinen Gedichten zuwendete und die Umstände und Zwischenfälle seines Erdenlebens außer acht ließe. Nichts in seinem Leben ist außergewöhnlich – nichts, außer seine Gedichte. Ich glaube nicht, daß sein „Fall“ – man kommt nicht darum herum, dieses widerwärtige Wort zu gebrauchen – sie erklärt; ich glaube jedoch, daß im Licht seiner Gedichte sein „Fall“ aufhört, einer zu sein. Sein Geheimnis ist übrigens in seinem Namen beschlossen: Pessoa bedeutet im Portugiesischen Person und kommt von persona, der Maske der römischen Schauspieler. Maske, Scheinperson, niemand: Pessoa. Seine Geschichte könnte man reduzieren auf das Hin und Her zwischen der Irrealität seines täglichen Lebens und der Realität seiner Fiktionen. Diese Fiktionen sind die Dichter Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis und vor allem Fernando Pessoa selbst. Es ist daher nicht unnütz, an die wichtigsten Fakten seines Lebens zu erinnern, doch sollte man sich stets vor Augen halten, daß es sich um die Spuren eines Schattens handelt. Der wahre Pessoa ist ein anderer.
Er wird 1888 in Lissabon geboren. Im Kindesalter wird er durch den Tod seines Vaters Halbwaise. Seine Mutter heiratet wieder; 1896 übersiedelt sie mit ihren Kindern nach Durban, Südafrika, wohin ihr zweiter Mann als Konsul Portugals geschickt worden war. Englische Erziehung. Der angelsächsische Einfluß auf Denken und Werk des zweisprachigen Dichters bleibt beständig. 1905, als er die Universität von Kapstadt besuchen will, muß er nach Portugal zurückkehren. 1907 verläßt er die Philosophische Fakultät der Universität von Lissabon und gründet eine Druckerei. Ein Mißerfolg. Dieses Wort wird in seinem Leben öfter vorkommen. Er arbeitet hinfort als „Auslandskorrespondent“, das heißt als ambulanter Verfasser von Geschäftsbriefen in Englisch und Französisch, eine bescheidene Tätigkeit, mit der er fast sein ganzes Leben lang sein Brot verdienen wird. Einmal öffnen sich ihm, wenn auch mit Zurückhaltung, die Tore einer Universitätslaufbahn; mit dem Stolz der Schüchternen lehnt er das Angebot ab. Ich sagte Zurückhaltung und Stolz, vielleicht hätte ich sagen sollen Unlust und Realitätssinn: 1932 bewirbt er sich um den Posten eines Archivars in einer Bibliothek und wird abgewiesen. Doch es gibt keine Rebellion in seinem Leben: gerade nur eine an Verachtung grenzende Bescheidenheit.
Seit seiner Rückkehr aus Afrika verläßt er Lissabon nicht mehr. Zuerst wohnt er in einem alten Haus zusammen mit einer altjüngferlichen Tante und einer verrückten Großmutter; danach bei einer anderen Tante; eine Zeitlang auch bei seiner Mutter, die erneut Witwe geworden ist; und die restlichen Jahre wohnt er mal hier, mal dort. Mit seinen Freunden trifft er sich auf der Straße und im Café. Einsamer Trinker in Tavernen und Wirtshäusern der Altstadt. Weitere Details? 1916 plant er, sich als Astrologe niederzulassen. Der Okkultismus hat seine Gefahren, und einmal sieht sich Pessoa in eine Sache verwickelt, die die Polizei gegen den englischen Magier und „Sataniker“ Aleister Crowley angezettelt hatte, der auf der Durchreise in Lissabon nach Adepten für seinen erotisch-mystischen Orden suchte. 1920 verliebt er sich, zumindest glaubt er das, in ein Ladenmädchen; das Verhältnis dauert nicht lange: „Mein Schicksal“, schreibt er in einem Abschiedsbrief, „gehorcht einem anderen Gesetz, dessen Existenz Sie nicht einmal ahnen…“ Von anderen Liebschaften weiß man nicht. Es gibt eine Unterströmung schmerzlicher Homosexualität in der „Ode Marítima“ (Meeres-Ode) und in der „Saudaçao a Walt Whitman“ (Gruß an Walt Whitman), große Gedichte, eine Ankündigung derer, die fünfzehn Jahre später García Lorca als „Poeta en Nueva York“ (Dichter in New York) schreiben sollte. Doch Álvaro de Campos, professioneller Provokateur, ist nicht der ganze Pessoa. Es gibt andere Dichter in Pessoa. Da er „züchtig“ ist, sind alle seine Leidenschaften imaginär; besser gesagt, sein großes Laster ist die Imagination. Deshalb rührt er sich nicht vom Stuhl. Und es gibt noch einen Pessoa, der weder dem Alltagsleben noch der Literatur gehört: der Jünger, der Initiierte. über diesen Pessoa kann und soll nichts gesagt werden. Offenbarung, Täuschung, Selbsttäuschung? Alles zusammen, vielleicht. Pessoa, wie der Meister in einem seiner hermetischen Sonette, weiß und schweigt.
Anglomane, kurzsichtig, höflich, scheu, schwarzgekleidet, zurückhaltend und schlicht, ein Kosmopolit, der den Nationalismus predigt, feierlicher Erforscher nichtiger Dinge, ein Humorist, der nie lächelt und uns das Blut in den Adern gefrieren läßt, Erfinder anderer Dichter und Zerstörer seiner selbst, Verfasser von Paradoxen, die so klar sind wie Wasser und wie dieses atemberaubend: sich verstellen heißt, sich erkennen, ein geheimnisvoller Mensch, der das Geheimnis nicht kultiviert, geheimnisvoll wie der Mond am Mittagshimmel, das schweigsame Phantasma des portugiesischen Mittags: wer ist Pessoa? Pierre Hourcade, der ihn gegen Ende seines Lebens kennenlernte, schreibt:
Nie wagte ich es, wenn ich mich von ihm verabschiedete, mich noch einmal umzudrehen; ich hatte Angst zu sehen, wie er sich verflüchtigt, in Luft auflöst.
Habe ich etwas vergessen? Er starb 1935 in Lissabon an einer Leberkolik. Er hinterließ drei Bändchen mit Gedichten in englischer Sprache, einen schmalen Band mit portugiesischen Gedichten und eine Truhe voller Manuskripte. Noch sind nicht alle seine Werke veröffentlicht.
Sein öffentliches Leben, irgendwie muß man es ja nennen, verläuft im Halbdunkel. Literatur der Randzone, eines schlecht beleuchteten Gebiets, in dem sich – Verschwörer oder Mondsüchtige? – die undeutlichen Gestalten Álvaro de Campos, Ricardo Reis und Fernando Pessoa bewegen. Augenblicksweise geraten sie ins Scheinwerferlicht des Skandals und der Polemik. Danach wieder Dunkel. Die Fast-Anonymität und die Fast-Berühmtheit. Jeder kennt den Namen Fernando Pessoa, doch wenige wissen, wer er ist und was er macht. Ansehen eines Schriftstellers in Portugal, Spanien und Hispanoamerika bedeutet in der Praxis:
Ihr Name kommt mir so bekannt vor, sind Sie nicht Journalist oder Filmregisseur?
Ich vermute, daß Pessoa eine solche Verwechslung gar nicht unangenehm war. Er kultivierte sie eher noch. Zeiten hektischer literarischer Tätigkeit, gefolgt von Perioden der Unlust. Wird er von der Arbeitswut auch nur selten und anfallsweise gepackt – Handstreiche, um die paar Leute der offiziellen Literatur in Schrecken zu versetzen –, ist er in seiner einsamen Arbeit doch beharrlich. Wie alle großen Faulenzer verbringt er sein Leben damit, Verzeichnisse von Werken aufzustellen, die er nie schreiben wird; und wie es bei Willensschwachen ebenfalls vorkommt, wenn sie nur leidenschaftlich und einfallsreich sind, schreibt er, um nicht zu platzen, um nicht verrückt zu werden, fast verstohlen, am Rande seiner großen Pläne jeden Tag ein Gedicht, einen Artikel, eine Betrachtung. Zerstreuung und Anspannung. Alles trägt denselben Stempel: diese Texte wurden aus zwingender Notwendigkeit geschrieben. Und ebendas, die Notwendigkeit, unterscheidet einen echten Schriftsteller von einem, der nur Talent hat.
Seine ersten Gedichte schreibt er zwischen 1905 und 1908 in Englisch. In jener Zeit las er Milton, Shelley, Keats, Poe. Später entdeckt er Baudelaire und verkehrt mit mehreren „portugiesischen Subpoeten“. Nur allmählich kehrt er zu seiner Muttersprache zurück, obgleich er nie aufhören wird, in Englisch zu schreiben. Bis 1912 wiegt der Einfluß der symbolistischen Dichtung und des „Saudosismo“ (Erinnerungskult) vor. In diesem Jahr veröffentlicht er seine ersten Arbeiten in der Zeitschrift A Águia (Der Adler), dem Organ der „portugiesischen Renaissance“. Seine Mitarbeit bestand in einer Artikelserie über die portugiesische Poesie. Es ist für Pessoa typisch, daß er sein Schriftstellerdasein als Literaturkritiker beginnt. Nicht minder bezeichnend ist der Titel eines seiner Texte: „Na Floresta do Alheamento“ (Im Wald der Entfremdung). Das Thema der Entfremdung und der Suche nach sich selbst, im verzauberten Wald oder in der abstrakten Stadt, ist mehr als ein Thema: es ist der Stoff seines Werkes. In diesen Jahren ist er auf der Suche nach sich selbst; bald wird er sich erfinden.
Im Jahre 1913 lernt er zwei junge Männer kennen, die in dem kurzen futuristischen Abenteuer seine treuesten Gefährten sein werden: den Maler Almada Negreira und den Dichter Mario de Sá-Carneiro. Weitere Freundschaften: Armando Côrtes-Rodrigues, Luis de Montaevor, José Pacheco. Noch gefangen vom Zauber der „dekadenten“ Poesie, versuchen diese jungen Leute vergebens, die symbolistische Richtung zu erneuern. Pessoa erfindet den „Paulismo“. Und plötzlich, durch Sá-Carneiro, der in Paris lebt und mit dem er eine fieberhafte Korrespondenz führt, die Entdeckung des großen modernen Aufstands: Marinetti. Die Fruchtbarkeit des Futurismus ist unbestreitbar, obgleich sein Glanz später durch die wiederholte Abdankung seines Gründers verblaßt ist. Die Bewegung fand sofort Widerhall, wahrscheinlich weil sie weniger eine Revolution, denn eine Meuterei war. Sie war der erste Funke, der Funke, der das Pulverfaß zur Explosion brachte. Der Brand breitete sich schnell aus, von einem Ende Europas zum anderen, von Moskau bis Lissabon. Drei große Dichter: Apollinaire, Majakowski und Pessoa. Das darauffolgende Jahr, 1914, sollte für den Portugiesen das Jahr der Entdeckung werden, oder genauer, das der Geburt: es erscheinen Alberte Caeiro und dessen Schüler, der Futurist Álvaro de Campos und der Klassizist Ricardo Reis.
Auf die Freisetzung der Heteronyme, ein inneres Ereignis, folgt die öffentliche Tat: Orfeu: die Explosion. Im April 1915 erscheint die erste Nummer der Zeitschrift; im Juli die zweite und letzte, Wenig? Eher zuviel. Die Gruppe war nicht homogen. Schon der Name „Orpheus“ zeigt deutlich den symbolistischen Einschlag. Selbst bei Sá-Carneiro, trotz dessen Ungestüm, stellen die portugiesischen Kritiker fest, daß der „Decadentismo“ fortdauert. Bei Pessoa ist die Spaltung eindeutig: Álvaro de Campos ist ein ganzer Futurist, während Fernando Pessoa immer noch ein „paulistischer“ Dichter ist. Die Öffentlichkeit nahm die Zeitschrift mit Entrüstung auf. Die Texte von Sá-Carneiro und Campos bewirkten, daß die Journalisten, wie üblich, tobten. Auf die Beschimpfungen folgte der Spott; auf den Spott Schweigen. Der Kreis schloß sich. Ist etwas geblieben? In der ersten Nummer war die „Ode triunfal“ (Triumph-Ode) erschienen; in der zweiten die „Ode marítima“. Die erste Ode ist ein Gedicht, das ungeachtet seiner Ticks und seiner Künsteleien bereits den direkten Ton von „Tabacaria“ (Tabakladen) hat, die Erkenntnis der Gewichtlosigkeit des Menschen gegenüber dem Schwergewicht des gesellschaftlichen Lebens. Das zweite Gedicht ist mehr als nur das Feuerwerk der futuristischen Poesie: ein großer Geist deliriert mit lauter Stimme, und sein Schrei ist nie animalisch noch übermenschlich. Der Dichter ist kein „kleiner Gott“, sondern ein gefallener Mensch. Die beiden Gedichte gemahnen eher an Whitman denn an Marinetti, an einen grüblerischen und negativen Whitman. Doch das ist noch nicht alles. Der Widerspruch ist System, bildet die Kohärenz seines Lebens: zur gleichen Zeit schreibt er „O Guardador de Rebanhos“ (Der Hirte), ein postumes Buch von Alberto Caeiro, die latinisierenden Gedichte von Reis und Epithalamium und Antinous, „zwei meiner englischen Gedichte, sehr indezent und deshalb in England nicht zu veröffentlichen“.
Das Abenteuer Orfeu wird jäh unterbrochen. Angesichts der Angriffe der Journalisten, und wohl auch erschrocken über die Maßlosigkeit Álvaro de Campos’, machen einige nicht mehr mit. Sá-Carneiro, immer unstet, kehrt nach Paris zurück. Ein Jahr darauf begeht er Selbstmord. 1917 ein neuer Versuch: die einzige Nummer von Portugal Futurista, herausgegeben von Almada Negreira, in der das Ultimatum von Álvaro de Campos erscheint. Es fällt heute schwer, diesen Schwall von Invektiven zu lesen, obgleich einige ihre heilsame Virulenz bewahrt haben:
D’Annunzio, Don Juan auf Patmos; Shaw, kalte Geschwulst des Ibsenismus; Kipling, Schrotthandel-Imperialist…
Die Episode Orfeu endet mit der Auflösung der Gruppe und dem Tod eines ihrer Anführer. Man wird fünfzehn Jahre warten müssen, bis eine neue Generation kommt. Nichts ist daran ungewöhnlich. Das Erstaunliche ist das Auftreten der Gruppe, die ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft voraus ist. Was wurde in diesen Jahren in Spanien und in Hispanoamerika geschrieben?
Die folgende Periode ist relativ glanzlos. Pessoa veröffentlicht zwei Bändchen mit englischen Gedichten, 35 Sonnets und Antinous (beide 1918), die von der Londoner Times und vom Glasgow Herald sehr höflich und mit wenig Begeisterung besprochen werden. 1922 erscheint der erste Beitrag Pessoas für Contemporânea, eine neue literarische Zeitschrift: „O Banqueiro Anarquista“ (Der anarchistische Bankier). In diesen Jahren auch hat er seine politischen Anwandlungen: Lobeshymnen auf den Nationalismus und das autoritäre Regime. Die Wirklichkeit öffnet ihm die Augen und nötigt ihn zum Widerruf: bei zwei Anlässen widersetzt er sich der Staatsgewalt, der Kirche und der Gesellschaftsmoral. Das erste Mal, um Antonio Botto zu verteidigen, den Autor von Canções, in denen die uranische Liebe besungen wird. Das zweite Mal opponiert er gegen den „Kampfbund der Studenten“, der unter dem Vorwand, mit der sogenannten „Sodom-Literatur“ Schluß zu machen, das freie Denken verfolgte. Cäsar ist immer Moralist. Álvaro de Campos verteilt ein Flugblatt: „Aviso por causa da moral“ (Ein Wort in Sachen Moral); Pessoa veröffentlicht eine Erklärung; und der Angegriffene, Raúl Leal, verfaßt das Flugblatt: „Uma lição de moral aos estudantes de Lisboa e o descaramento da Igreja Católica“ (Eine Morallektion für die Studenten von Lissabon und die Dreistigkeit der katholischen Kirche). Der Schwerpunkt hat sich von der freien Kunst auf die Freiheit der Kunst verlagert. Unsere Gesellschaft ist so beschaffen, daß der schöpferische Mensch zur Heterodoxie und zur Opposition verurteilt ist. Der klarsichtige Künstler weicht dieser moralischen Gefahr nicht aus.
Im Jahre 1924 eine neue Zeitschrift: Atena. Sie bringt es nur auf fünf Nummern. Nie war ein zweiter Aufguß gut. In Wirklichkeit ist Atena eine Brücke zwischen Orfeu und den jungen Leuten von Presença (1927). Jede Generation wählt sich scheint’s ihre eigene Tradition. Die neue Gruppe entdeckt Pessoa: endlich hat er Gesprächspartner gefunden. Zu spät, wie immer. Kurz darauf, ein Jahr vor seinem Tode, ereignet sich der groteske Zwischenfall: ein Dichter-Wettbewerb, ausgeschrieben vom Ministerium für Nationale Propaganda. Das Thema war natürlich ein Lied zum Ruhme der Nation und des Reiches. Pessoa schickt „Mensagem“ (Botschaft), Gedichte, die eine „okkultistische“ und symbolische Interpretation der portugiesischen Geschichte sind. Das Buch muß die beamteten Juroren des Wettbewerbs in große Verlegenheit gebracht haben. Sie verliehen ihm den Preis „zweiter Klasse“. Es war sein letzter literarischer Versuch.
Alles beginnt am 8. März 1914. Doch es ist besser, hier einen Auszug aus einem Brief Pessoas an einen der jungen Männer von Presença, Adolfo Casais Monteiro, zu zitieren:
Gegen 1912 kam ich auf den Gedanken, einige Gedichte heidnischer Art zu schreiben. Ich entwarf ein paar Sachen in freien Versen (nicht im Stil von Álvaro de Campos) und gab dann den Versuch auf. Doch im Halbdunkel sah ich verschwommen das Bild der Person, die diese Verse schrieb (ohne mein Wissen war Ricardo Reis geboren). Anderthalb oder zwei Jahre später kam ich auf den Einfall, Sá Carneiro einen Streich zu spielen, einen etwas verzwickten bukolischen Dichter zu erfinden und ihn so zu präsentieren, ich weiß nicht mehr wie, als wäre er ein wirkliches Wesen. Ich verbrachte damit mehrere Tage, doch es wollte mir nicht gelingen. Eines Tages, als ich es schon aufgegeben hatte – es war der 8. März 1914 – stellte ich mich vor eine hohe Kommode, nahm einen Stapel Papier und begann im Stehen zu schreiben, wie ich das nach Möglichkeit immer tue. Und ich schrieb über dreißig Gedichte hintereinander, in einer Art von Ekstase, die ich nicht näher beschreiben kann. Es war der triumphale Tag meines Lebens, nie werde ich so einen noch einmal erleben. Ich begann mit einem Titel, „O Guardador de Rebanhos“. Und dann erschien jemand in mir, dem ich sofort den Namen Alberto Caeiro gab. Entschuldigen Sie das Absurde des Satzes: in mir war mein Meister erschienen. Das war mein unmittelbares Gefühl. Und es war so stark, daß ich, kaum waren die dreißig Gedichte geschrieben, auf einem neuen Blatt Papier, ebenfalls in einem Zuge „Chuva obliqua“ (Schräger Regen) von Fernando Pessoa schrieb. Unmittelbar und bis zum Ende (…) Es war die Rückkehr von Fernando Pessoa-Alberto Caeiro zu Fernando Pessoa schlechthin. Oder besser: es war die Reaktion Fernando Pessoas auf seine Nichtexistenz als Alberto Caeiro (…) Als Caeiro erschienen war, versuchte ich sogleich, unbewußt und instinktiv, Schüler für ihn zu entdecken. Ich entriß den latent existierenden Ricardo Reis seinem falschen Heldentum, fand für ihn einen Namen und glich ihn sich selber an, denn in diesem Augenblick sah ich ihn schon. Und plötzlich, entgegengesetzter Herkunft zu Reis, tauchte gebieterisch noch eine Person auf. In einem Zug, ohne Unterbrechung noch Verbesserung, entstand die „Ode triunfal“ von Álvaro de Campos. Die Ode mit diesem Namen und der Mensch mit seinem Namen.
Ich weiß nicht, was diesem Bekenntnis hinzuzufügen wäre.
Die Psychologie bietet uns verschiedene Erklärungen. Pessoa selbst, der sich für seinen Fall interessierte, findet zwei oder drei. Eine krude pathologische:
Wahrscheinlich bin ich ein neurasthenischer Hysteriker (…) und das erklärt recht oder schlecht den organischen Ursprung der Heteronyme.
Ich würde nicht sagen, „recht oder schlecht“, sondern kaum. Die Fragwürdigkeit dieser Hypothesen besteht nicht darin, daß sie falsch wären: sie sind unvollständig. Ein Neurotiker ist ein Besessener; ist derjenige, der seine psychischen Störungen meistert, ein Kranker? Der Neurotiker erleidet seine Obsessionen; der schöpferische Mensch wird ihrer Herr und wandelt sie um. Pessoa erzählt, daß er seit seiner Kindheit mit imaginären Personen lebte. („Ich weiß natürlich nicht, ob sie es sind, die nicht existieren, oder ob ich es bin, der nicht existiert: in diesen Dingen dürfen wir nicht dogmatisch sein.“) Die Heteronyme sind umgeben von einer wabernden Menge von Halbwesen: der Barón de Teive; Jean Seul, französischer satirischer Journalist; Bernardo Soares, Gespenst des gespenstischen Vicente Guedes; Pacheco, eine blasse Kopie Campos’… Nicht alle sind Schriftsteller: es gibt einen Mr. Cross, unermüdlicher Teilnehmer an den Wettbewerben in Silben- und Kreuzworträtseln der englischen Zeitschriften (ein unfehlbares Mittel, wie Pessoa glaubte, um reich zu werden), Alexander Search und andere. All das – wie seine Einsamkeit, sein heimlicher Alkoholismus und vieles andere – wirft ein Licht auf seinen Charakter, aber erklärt uns nicht seine Gedichte, worauf allein es uns ankommt.
Gleiches ist zu sagen von der „okkultistischen“ Hypothese, zu der Pessoa, der viel zu kritisch ist, zwar nicht offen greift, doch auf die er immerhin anspielt. Bekanntlich verraten die Geister, die den Medien die Feder führen, auch wenn es die Geister von Euripides oder Victor Hugo sind, eine erstaunliche literarische Ungewandtheit. Manche Leute vermuten, daß es sich um eine „Mystifikation“ handelt. Der Irrtum ist ein doppelt grober: weder ist Pessoa ein Lügner, noch ist sein Werk Schwindel. Der moderne Geist hat etwas schrecklich Vulgäres: Im wirklichen Leben dulden die Leute jede Art von schändlichen Wirklichkeiten, aber die Existenz der Fabel können sie nicht ertragen. Und eben das ist Pessoas Werk: eine Fabel, eine Fiktion. Wenn man vergißt, daß Caeiro, Reis und Campos dichterische Schöpfungen sind, vergißt man zuviel. Wie jede Schöpfung, wurden diese Dichter im Spiel geboren. Kunst ist Spiel – und anderes. Doch ohne Spiel gibt es keine Kunst.
Die Authentizität der Heteronyme hängt von ihrer poetischen Kohärenz, von ihrer Wahrscheinlichkeit ab. Sie waren notwendige Schöpfungen, andernfalls hätte Pessoa sein Leben nicht darauf verwandt, sie zu leben und zu erschaffen; was heute zählt, ist nicht, daß sie für ihren Autor notwendig gewesen sind, sondern ob sie das auch für uns sind. Pessoa, ihr erster Leser, zweifelte nicht an ihrer Wirklichkeit. Reis und Campos sagten Dinge, die er vielleicht nie gesagt haben würde. Indem sie ihm widersprachen, gaben sie ihm Ausdruck; indem sie ihm Ausdruck gaben, zwangen sie ihn, sich zu erfinden. Wir schreiben, um zu sein, was wir sind, oder um das zu sein, was wir nicht sind. In dem einen wie in dem anderen Fall suchen wir uns selbst. Und wenn wir das Glück haben, uns zu finden – ein Zeichen von Schöpfung –, werden wir entdecken, daß wir ein Unbekannter sind. Immer der andere, immer er, untrennbar mit uns verbunden und uns ein Fremder, mit deinem Gesicht und mit dem meinen, du immer bei mir und immer allein.
Die Heteronyme sind keine literarischen Masken:
Das, was Fernando Pessoa schreibt, gehört zwei Arten von Werken an, die wir orthonym und heteronym nennen könnten. Man kann nicht sagen, daß sie anonyme oder pseudonyme Werke sind, da sie es wirklich nicht sind. Das pseudonyme Werk ist das des Autors in Person, nur daß er es mit einem anderen Namen zeichnet; das heteronyme ist das des Autors, der seiner Person entäußert ist (…).
Gérard de Nerval ist das Pseudonym von Gérard Labrunie: dieselbe Person und dasselbe Werk; Caeiro ist ein Heteronym von Pessoa: es ist unmöglich, sie zu verwechseln. Auch der Fall Antonio Machado ist ein anderer. Abel Martín und Juan de Mairena sind nicht ganz und gar der Dichter Antonio Machado. Sie sind Masken, doch durchsichtige Masken: ein Text von Machado unterscheidet sich nicht von einem Text von Mairena. Zudem ist Machado von seinen Fiktionen nicht besessen, es sind keine Geschöpfe, die ihn heimsuchen, ihm widersprechen oder ihn negieren. Dagegen sind Caeiro, Reis und Campos die Helden eines Romans, den Pessoa nie geschrieben hat. „Ich bin ein dramatischer Dichter“, bekannte er in einem Brief an J.G. Simôes. Trotzdem ist die Beziehung zwischen Pessoa und seinen Heteronymen nicht gleich der des Dramatikers oder Romanciers zu seinen Personen. Er ist kein Erfinder von Dichter-Persönlichkeiten, sondern ein Schöpfer von Dichter-Werken, Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wie A. Casais Monteiro sagt: „Er erfand die Biographien für die Werke und nicht die Werke für die Biographien.“ Diese Werke und die im Hinblick auf sie, für oder gegen sie geschriebenen Gedichte Pessoas sind sein dichterisches Werk. Er selbst wird zu einem der Werke seines Werks. Und er hat nicht einmal das Vorrecht, der Kritiker dieser Clique zu sein: Reis und Campos behandeln ihn ziemlich herablassend; der Barón de Teide grüßt ihn nicht immer; Vicente Guedes, der Archivar, sieht ihm so ähnlich, daß er sich selbst ein wenig bemitleidet, wenn er ihn in einem Wirtshaus des Viertels trifft. Er ist der behexte Zauberer, von seinen Phantasmagorien so völlig besessen, daß er sich von ihnen beobachtet, gar verachtet oder bemitleidet fühlt. Unsere Werke beurteilen uns…
Alberto Caeiro ist mein Lehrmeister. Diese Aussage ist der Prüfstein eines ganzen Werkes. Und man könnte hinzufügen, daß das Werk Caeiros die einzige positive Aussage ist, die Pessoa gemacht hat. Caeiro ist die Sonne, und um sie kreisen Reis, Campos und Pessoa selbst. In ihnen allen gibt es Partikel der Negation oder der Irrealität: Reis glaubt an die Form, Campos an die Sinneswahrnehmung, Pessoa an die Symbole. Caeiro glaubt an nichts: er existiert. Die Sonne ist das von sich erfüllte Leben; die Sonne sieht nicht, denn alle ihre Strahlen sind Blicke, die sich in Wärme und Licht verwandelt haben; die Sonne hat kein Bewußtsein ihrer selbst, denn bei ihr sind Denken und Sein ein und dasselbe. Caeiro ist all das, was Pessoa nicht ist, und zudem all das, was kein moderner Dichter sein kann: der mit der Natur versöhnte Mensch. Der Mensch vor dem Christentum, gewiß, aber auch noch vor der Arbeit und vor der Geschichte. Vor dem Bewußtsein. Caeiro negiert durch die bloße Tatsache seiner Existenz nicht nur die symbolistische Ästhetik Pessoas, sondern alle Ästhetiken, alle Werte, alle Ideen. Bleibt nichts? Alles bleibt, aber frei von den Phantasmen und Spinnweben der Kultur. Die Welt existiert, weil meine Sinne mir das sagen; und indem sie mir das sagen, sagen sie mir, daß auch ich existiere. Ja, ich werde sterben, und auch die Welt wird sterben, doch sterben heißt leben. Die Aussage Caeiros annulliert den Tod; indem er das Bewußtsein negiert, negiert er das Nichts. Er behauptet nicht, daß alles ist, denn das hieße, eine Idee zu vertreten; er sagt, daß alles existiert. Und mehr noch: er sagt, daß nur ist, was existiert. Alles übrige sind Täuschungen. Campos setzt dann das Tüpfelchen auf das i: „Mein Lehrmeister Caeiro war kein Heide; er war das Heidentum.“ Ich würde sagen: ein Bild des Heidentums.
Caeiro hat kaum Schulen besucht. Als er erfuhr, daß man ihn einen „materialistischen Dichter“ nannte, wollte er wissen, was das für eine Lehre sei. Als er Campos’ Erklärung hörte, war er zuhöchst verwundert:
Das ist eine Idee von Geistlichen ohne Religion! Sie sagen, sagen Sie, der Raum sei unendlich? In welchem Raum haben sie das gesehen?
Vor seinem verblüfften Schüler behauptete Caeiro, der Raum sei endlich: „Was keine Grenzen hat, existiert nicht…“ Der andere entgegnete: „Und die Zahlen? Nach der 34 kommt die 35 und dann die 36 und so fort…“ Caeiro sah ihn mitleidig an: „Aber das sind doch nur Zahlen!“ und fuhr mit umwerfender Kindlichkeit fort: „Gibt es eine Zahl 34 etwa in der Wirklichkeit?“ Eine andere Anekdote: man fragte ihn: „Sind Sie mit sich selbst zufrieden?“ Und er antwortete: „Nein, ich bin zufrieden.“ Caeiro ist kein Philosoph, er ist ein Weiser. Die Denker haben Ideen: für den Weisen sind Leben und Denken nichts voneinander Geschiedenes. Deshalb ist es unmöglich, die Ideen Sokrates’ oder Laotses darzulegen. Sie hinterließen keine Lehren, sondern eine Handvoll Anekdoten, Rätsel und Gedichte. Chuang Tzu, redlicher als Platon, will uns keine Philosophie vermitteln, sondern ein paar kurze Geschichten erzählen: die Philosophie ist von der Erzählung untrennbar, sie ist Erzählung. Die Lehre des Philosophen reizt zur Widerlegung; das Leben des Weisen ist unwiderlegbar. Kein Weiser hat je verkündet, daß die Wahrheit erlernbar sei; alle, oder fast alle, haben gesagt, daß das einzige, wofür sich zu leben lohnt, die Erfahrung der Wahrheit ist. Caeiros’ schwacher Punkt sind nicht seine Idee (diese Schwäche ist eher seine Stärke), sondern die Irrealität der Erfahrung, die er zu verkörpern behauptet.
Adam in einem Landhaus der portugiesischen Provinz, ohne Frau, ohne Kinder und ohne Schöpfer: ohne Bewußtsein, ohne Arbeit und ohne Religion. Eine Sinnlichkeit unter Sinnlichkeiten, ein Existieren unter Existenzen. Hier und jetzt ist Stein Stein und Caeiro Caeiro. Danach wird jeder etwas anderes sein. Oder das gleiche. Gleiches oder Verschiedenes: alles ist gleich, da alles verschieden ist. Benennen heißt sein. Das Wort, mit dem er den Stein benennt, ist nicht der Stein, aber es ist geradeso wirklich wie der Stein. Caeiro will die Wesen nicht benennen, und deshalb sagt er uns nie, ob der Stein ein Achat oder ein Kiesel ist, ob der Baum eine Pinie oder eine Steineiche ist. Auch will er keine Beziehungen zwischen den Dingen herstellen; das Wort wie kommt in seinem Vokabular nicht vor. Jedes Ding ist in seine eigene Wirklichkeit vertieft. Wenn Caeiro spricht, so deshalb, weil der Mensch ein Lebewesen ist, das sprechen kann, so wie der Vogel ein Lebewesen ist, das fliegen kann. Der Mensch spricht wie der Fluß fließt oder der Regen fällt. Der unschuldige Dichter braucht die Dinge nicht zu benennen; seine Worte sind Bäume, Wolken, Spinnen, Eidechsen. Nicht die Spinnen, die ich sehe, sondern die, die ich sage. Caeiro wundert sich angesichts der Idee, daß die Wirklichkeit nicht greifbar sei: hier liegt sie vor uns, man braucht sie nur zu berühren. Man braucht nur zu sprechen.
Es wäre ein Leichtes, Caeiro zu beweisen, daß die Wirklichkeit nie mit Händen zu greifen ist und daß wir sie erobern müssen (auch auf die Gefahr hin, daß sie sich in dem Augenblick, da wir sie erhaschen, verflüchtigt oder zu etwas anderem wird: Idee, Utensil). Der unschuldige Dichter ist ein Mythos, aber ein Mythos, der die Poesie begründet. Der wirkliche Dichter weiß, daß die Worte und die Dinge nicht das gleiche sind, und deshalb, um zwischen dem Menschen und der Welt wieder eine, sei es auch ungesicherte, Einheit herzustellen, benennt er die Dinge mit Bildern, Rhythmen, Symbolen und Vergleichen. Die Worte sind nicht die Dinge: sie sind die Brücken, die wir zwischen ihnen und uns schlagen. Der Dichter ist das Bewußtsein der Worte, das heißt, das Heimweh nach der wirklichen Wirklichkeit der Dinge. Doch auch die Worte waren Dinge, bevor sie Namen von Dingen wurden. Sie waren es im Mythos vom unschuldigen Dichter, das heißt, vor der Geburt der Sprache. Die opaken Worte des wirklichen Dichters evozieren das Sprechen vor der Geburt der Sprache, die geahnte paradiesische Übereinstimmung. Unschuldiges Sprechen: ein Schweigen, in dem nichts gesagt wird, weil alles gesagt ist, alles sich selbst sagt. Die Sprache des Dichters nährt sich von diesem Schweigen, das unschuldiges Sprechen ist. Pessoa, ein wirklicher Dichter und ein skeptischer Mensch, mußte einen unschuldigen Dichter erfinden, um seine eigene Poesie zu rechtfertigen. Reis, Campos und Pessoa sagen sterbliche und geschichtliche Worte, Worte des Untergangs und der Auflösung: sie sind die Vorahnung der Einheit oder das Heimweh nach ihr. Wir hören sie vor dem Hintergrund des Schweigens dieser Einheit. Es ist kein Zufall, daß Caeiro jung stirbt, noch bevor seine Schüler ihr Werk beginnen. Er ist ihre Grundlage, das Schweigen, das sie nährt.
Caeiro, der von den Heteronymen der Natürlichste und Schlichteste ist, ist der am wenigsten Wirkliche. Er ist es durch ein Übermaß an Wirklichkeit. Der Mensch, zumal der moderne Mensch, ist nicht ganz wirklich. Er ist kein kompaktes Seiendes wie die Natur oder die Dinge; das Bewußtsein seiner selbst ist seine substanzlose Wirklichkeit. Caeiro ist eine absolute Bejahung des Existierens, und deshalb scheinen uns seine Worte Wahrheiten einer anderen Zeit, jener Zeit, in der alles ein und dasselbe war. Sinnlich wahrnehmbare und unberührbare Gegenwart: sobald wir sie benennen, verflüchtigt sie sich! Die Maske der Unschuld, die Caeiro uns zeigt, ist nicht die Weisheit: weise sein heißt, sich mit dem Wissen abfinden, daß wir nicht unschuldig sind. Pessoa, der das wußte, war der Weisheit näher.
Das andere Extrem ist Álvaro de Campos. Caeiro lebt in der zeitlosen Gegenwart der Kinder und der Tiere; der Futurist Campos im Augenblick. Für den ersteren ist sein Dorf die Mitte der Welt; der andere, Kosmopolit, hat keine Mitte; er lebt verbannt in diesem Nirgendwo, das überall ist. Trotzdem ähneln sie sich: beide kultivieren den freien Vers; beide tun dem Portugiesischen Gewalt an; beide verschmähen nicht die Prosaismen. Sie glauben nur an das, was sie berühren können, sie sind Pessimisten, sie lieben die konkrete Wirklichkeit, nicht jedoch ihresgleichen, sie verachten die Ideen und leben außerhalb der Geschichte, der eine in der Fülle des Seins, der andere im äußersten Mangel an Sein. Caeiro, der unschuldige Dichter, ist das, was Pessoa nicht sein konnte; Campos, der vagabundierende Dandy, was er hätte sein können, aber nicht war. Sie sind Pessoas unmögliche Lebensmöglichkeiten.
Campos’ erstes Gedicht ist von trügerischer Originalität. Die „Ode triunfal“ ist dem Anschein nach ein brillantes Echo Whitmans und der Futuristen. Doch sobald man dieses Gedicht mit jenen vergleicht, die in denselben Jahren in Frankreich, Rußland und anderen Ländern geschrieben wurden, wird man den Unterschied gewahr. Whitman glaubte tatsächlich und fest an den Menschen und an die Maschinen; besser gesagt, er glaubte, daß der natürliche Mensch mit den Maschinen nicht unvereinbar sei. Sein Pantheismus umfaßte auch die Industrie. Die meisten seiner Nachkommen hegen solche Illusionen nicht. Einige sehen in den Maschinen ein wunderbares Spielzeug. Ich denke an Valéry Larbaud und seinen Barnabooth, der mit Álvaro de Campos mehr als eine Ähnlichkeit besitzt. Die Einstellung Larbauds zur Maschine ist epikureisch; die der Futuristen visionär. Sie betrachten sie als Mittel zur Vernichtung des falschen Humanismus, allerdings auch des natürlichen Menschen. Sie wollen die Maschine nicht vermenschlichen, sondern eine ihr ähnliche neue Gattung Mensch schaffen. Ausgenommen vielleicht Majakowski, doch selbst er… Die „Ode triunfal“ ist weder epikureisch noch romantisch noch triumphal: sie ist ein Gesang des Zorns und der Niederlage. Und darauf beruht ihre Originalität.
Eine Fabrik ist „eine tropische Landschaft“, bevölkert mit riesigen lasziven wilden Tieren. Eine endlose Hurerei von Rädern, Kolben und Rollen. In dem Maße wie der mechanische Rhythmus schärfer wird, verwandelt sich das Paradies aus Eisen und Elektrizität in eine Folterkammer. Die Maschinen sind Geschlechtsorgane der Zerstörung: Campos möchte von diesen rasenden Propellern zerfetzt werden. Diese seltsame Vision ist nicht so phantastisch, wie es scheint, und nicht nur eine Obsession von Campos. Die Maschinen sind Nachbildung, Vereinfachung und Vervielfachung der Lebensprozesse. Sie bezaubern uns und erfüllen uns mit Entsetzen, weil sie uns zugleich das Gefühl von Intelligenz und Unbewußtsein geben: alles, was sie machen, machen sie gut, doch sie wissen nicht, was sie machen. Ist nicht dies ein Bild des modernen Menschen? Doch die Maschinen sind nur eine Seite der heutigen Zivilisation. Die andere ist die gesellschaftliche Promiskuität. Die „Ode triunfal“ endet mit einem Aufschrei; in ein Bündel, eine Kiste, ein Paket, ein Rad verwandelt, verliert Álvaro de Campos den Gebrauch des Wortes: er zischt, er kreischt, er klappert, er hämmert, er knattert, er birst. Das Wort Caeiros evoziert die Einheit des Menschen, des Steins und des Insekts; das Campos’ das zusammenhanglose Geräusch der Geschichte. Pantheismus und Panmaschinismus, zwei Möglichkeiten, das Bewußtsein zu vernichten.
„Tabacaria“ ist das Gedicht des wiedererlangten Bewußtseins. Caeiro fragt sich, was bin ich?; Campos: wer bin ich? Von seinem Zimmer aus betrachtet er die Straße: Autos, Passanten, Hunde, alles wirklich und alles hohl, alles ganz nah und dabei so fern. Gegenüber, selbstsicher wie ein Gott, änigmatisch lächelnd wie ein Gott, sich die Hände reibend wie Gott Vater nach seiner entsetzlichen Schöpfung, taucht der Besitzer des Tabakladens auf und verschwindet wieder. Da kommt in seine Kramladen-Tempel-Höhle Esteva, der Unbekümmerte, Esteva ohne Metaphysik, der spricht und ißt, der Gefühle hat und politische Meinungen und der die gebotenen Feiertage einhält. Von seinem Fenster, seinem Bewußtsein, aus betrachtet sich Campos die beiden Marionetten und, sie sehend, sieht er sich selbst. Wo ist die Wirklichkeit: in mir oder Esteva? Der Inhaber des Tabakladens lächelt und antwortet nicht. Als futuristischer Dichter behauptet Campos zuerst, daß die einzige Wirklichkeit die Sinnesempfindung ist, ein paar Jahre später fragt er sich, ob er selbst irgendeine Wirklichkeit besitzt.
Indem er das Bewußtsein seiner selbst annulliert, negiert Caeiro die Geschichte; jetzt ist es die Geschichte, die Campos negiert. Ein marginales Leben: seine Geschwister, wenn er welche hat, sind die Prostituierten, die Herumtreiber, der Dandy, der Bettler, das Gesindel der Unter- wie der Oberschicht. Seine Rebellion hat nichts zu tun mit den Ideen: der Erlösung oder der Gerechtigkeit: Nein: alles andere, nur keine Gründe haben! Alles, nur nicht die Menschheit wichtig nehmen! Alles, nur keine Menschenfreundlichkeit! Campos rebelliert auch gegen die Idee der Rebellion. Sie ist keine Tugend, kein Bewußtseinszustand – sie ist das Bewußtsein eines Gefühls:
Ricardo Reis ist Heide aus Überzeugung; Antonio Mora aus Intelligenz; ich bin es aus Rebellion, das heißt, vom Temperament her.
Seine Sympathie für die Elenden ist gefärbt von Verachtung, doch diese Verachtung fühlt er vor allem für sich selbst:
Ich habe Sympathie für alle diese Leute,
Vor allem, wenn sie keine Sympathie verdienen.
Ja, auch ich bin Vagabund und aufdringlicher Bettler (…)
Ein Vagabund und Bettler sein heißt nicht, ein Vagabund und Bettler sein:
Es heißt, außerhalb der gesellschaftlichen Rangordnung stehen (…)
Heißt, kein Staatsanwalt, kein fester Angestellter, keine Prostituierte sein,
Kein Anwärter auf Armenrecht, kein ausgebeuteter Arbeiter,
Kein Kranker mit unheilbarem Leiden,
Keiner, der nach Gerechtigkeit dürstet, auch kein Hauptmann der Kavallerie,
Heißt, kurz und gut, nicht diese Gesellschaftsmenschen der Romanciers sein,
Die sich mit Buchstaben vollstopfen, weil sie Grund haben, Tränen zu weinen,
Und sich gegen die Gesellschaft auflehnen, weil sie den überschüssigen Verstand haben, das zu tun (…)
Ihre Streunerei und Bettelei sind durch keinen äußeren Umstand bedingt; sie sind Unheilbare ohne Erlösung. Ein solcher Herumtreiber sein heißt, seelisch einsam sein. Und weiter unten, mit dieser Brutalität, die Pessoas Ärgernis erregte: Ich kann nicht einmal Zuflucht nehmen zu Meinungen über soziale Verhältnisse (…) Ich bin bei Verstand. Nichts da von Ästhetik mit Herz: ich bin bei Verstand. Scheiße! Ich bin bei Verstand.
Das Bewußtsein der Verbannung ist seit anderthalb Jahrhunderten ein permanentes Merkmal der modernen Poesie. Gérard de Nerval gibt vor, Prinz von Aquitanien zu sein; Álvaro de Campos wählt die Maske des Vagabunden. Der Wandel ist aufschlußreich. Troubadour oder Bettler, was verbirgt diese Maske? Nichts vielleicht. Der Dichter ist das Bewußtsein seiner geschichtlichen Irrealität. Nur, wenn dieses Bewußtsein sich von der Geschichte zurückzieht, versinkt die Gesellschaft in ihrer eigenen Opakheit, sie wird Esteva oder der Besitzer des Tabakladens. Manch einer wird sagen, daß Campos’ Einstellung nicht „positiv“ ist. Auf solche Kritik entgegnete A. Casais-Monteiro:
Das Werk Pessoas ist tatsächlich ein negatives Werk. Es dient nicht als Vorbild, es lehrt weder zu regieren noch regiert zu werden. Es dient ganz im Gegenteil dazu, den Geist zum Ungehorsam zu erziehen.
Campos ist nicht, wie Caeiro, darauf aus, alles zu sein, sondern alle zu sein und überall zu sein. Die Dispersion in die Pluralität bezahlt er mit dem Verlust der Identität. Ricardo Reis wählt die andere in der Poesie seines Lehrmeisters latente Möglichkeit. Reis ist ein Eremit, wie Campos ein Vagabund ist. Seine Eremitage ist eine Philosophie und eine Form. Die Philosophie ist eine Mischung aus Stoizismus und Epikureismus. Die Form ist das Epigramm, die Ode und die Elegie der klassizistischen Dichter. Nur daß der Klassizismus eine Nostalgie ist, das heißt, eine Romantik, die nicht um sich weiß oder die sich maskiert. Während Campos seine langen Monologe schreibt, die der Introspektion immer näher sind als der Hymne, bosselt sein Freund Reis kleine Oden über die Freude, die Flucht der Zeit, die Rosen Lydias, die trügerische Freiheit des Menschen, die Eitelkeit der Götter. In einer Jesuitenschule erzogen, Arzt von Beruf, Monarchist, seit 1919 in Brasilien in der Verbannung lebend, Heide und Skeptiker aus Überzeugung, Latinist durch Erziehung, lebt Reis außerhalb der Zeit. Er scheint, aber ist es nicht, ein Mann der Vergangenheit: er hat gewählt, in einer zeitlosen Weisheit zu leben. Cioran wies kürzlich darauf hin, daß unser Jahrhundert, das so viele Dinge erfunden hat, nicht geschaffen hat, was wir am nötigsten brauchen. So ist es denn nicht verwunderlich, daß einige in der östlichen Tradition danach suchen: im Taoismus, im Zen-Buddhismus: in Wirklichkeit erfüllen diese Lehren die gleiche Funktion wie die Moral-Philosophien am Ausgang der Antike. Reis’ Stoizismus ist eine Möglichkeit, nicht in der Welt zu sein – und dabei in ihr zu bleiben. Seine politischen Anschauungen haben einen ähnlichen Stellenwert: sie sind kein Programm, sondern eine Negation der Umstände seiner Zeit. Er haßt Christus nicht, doch er liebt ihn auch nicht; er verabscheut das Christentum, obgleich er, schließlich ein Ästhet, im Hinblick auf Jesus zugibt, daß „seine schwermütige, schmerzliche Art uns etwas gegeben hat, das uns fehlte“. Reis’ wahrer Gott ist das Schicksal, und alle, Menschen und Mythen, sind seiner Herrschaft unterworfen.
Reis’ Form ist bewundernswert und eintönig, wie alles, was von kunstreicher Vollkommenheit ist. In diesen kleinen Gedichten bemerkt man, von der Vertrautheit mit den lateinischen und griechischen Originalen abgesehen, eine kluge, durch Destillation gewonnene Mixtur aus der lusitanischen Klassik und der ins Englische übersetzten Anthologia Graeca. Die Korrektheit seiner Sprache beunruhigte Pessoa:
Caeiro schreibt ein schlechtes Portugiesisch; Campos schreibt es hinlänglich gut, obgleich ihm Fehler unterlaufen und er zum Beispiel sagt „eu próprio“ statt „eu mesmo“; Reis schreibt es besser als ich, doch mit einem Purismus, den ich für übertrieben halte.
Die somnambule Übertreibung Campos’ schlägt ins Gegenteil um und wird zur übertriebenen Genauigkeit von Reis. Weder die Form noch die Philosophie rechtfertigen Reis: sie rechtfertigen ein Phantasma. Die Wahrheit ist, daß auch Reis nicht existiert, und er weiß das. Klarsichtig, mit einer Klarsicht, die tiefer dringt als die erbitterte von Campos, betrachtet er sich:
Ich weiß nicht, wessen sie ist, meine Vergangenheit,
Die ich erinnere,
Ein anderer war ich, auch erkenn ich mich nicht,
Wenn meine Seele
Jene fremde er fühlt, die ich fühlend erinnere.
Von Tag zu Tag verlassen wir uns,
Nichts Gewisses, das uns mit uns verbindet,
Wir sind, wer wir sind, und was
Wir waren, ist etwas von innen Geschautes.
Das Labyrinth, in dem Reis sich verirrt, ist das seiner selbst. Der innere Blick des Dichters, etwas ganz anderes als Introspektion, rückt ihn in die Nähe Pessoas. Obgleich beide feste Versmaße und Formen benutzen, verbindet der Traditionalismus sie nicht, da sie verschiedenen Traditionen angehören. Was sie verbindet, ist das Gefühl der Zeit – nicht als etwas, das vor unseren Augen abläuft, sondern als etwas, wozu wir werden. Dem Augenblick verhaftet, affirmieren Caeiro und Campos freiweg das Sein oder den Mangel an Sein. Reis und Campos verirren sich auf den Gebirgspfaden ihres Denkens, in einer Wegbiegung finden sie sich und, indem sie eins werden mit sich selbst, umarmen sie einen Schatten. Das Gedicht ist nicht der Ausdruck des Seins, sondern das Gedenken dieses Augenblicks der Einswerdung. Ein leeres Monument: Pessoa baut dem Unbekannten einen Tempel; Reis, der karger ist, schreibt ein Epigramm, das auch ein Epitaph ist:
Mag das Verhängnis, außer ihn zu erblicken,
Mir alles versagen: Stoiker ohne Härte,
Des Schicksals eingemeißelten Spruch
Genießen, Letter um Letter.
Álvaro de Campos zitierte einen Ausspruch von Ricardo Reis: Ich hasse die Lüge, weil sie eine Ungenauigkeit ist. Diese Worte könnte man auch auf Pessoa beziehen, vorausgesetzt, daß man Lüge nicht mit Imagination oder Genauigkeit mit Strenge verwechselt. Die Poesie von Reis ist präzis und einfach wie eine Linearzeichnung; die von Pessoa exakt und komplex wie die Musik. Komplex und mannigfaltig, geht sie in verschiedene Richtungen: die Prosa, die Poesie in Portugiesisch und die Poesie in Englisch (die französischen Gedichte kann man als irrelevant außer acht lassen). Die Prosaschriften, obgleich noch nicht vollständig veröffentlicht, lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: die mit seinem Namen gezeichneten und die seiner Pseudonyme, insbesondere des Barón de Teive, verarmter Aristokrat, und Bernardo Soares’, „Handlungsgehilfe“. An verschiedenen Stellen betont Pessoa, daß sie keine Heteronyme sind:
Beide schreiben in einem Stil, der, ob gut oder schlecht, der meine ist…
Es ist nicht unbedingt notwendig, sich mit den englischen Gedichten zu befassen; sie sind von literarischem und psychologischem Interesse, doch fügen sie der englischen Poesie, wie mir scheint, nicht viel hinzu. Das dichterische Werk in Portugiesisch, von 1902 bis 1935, umfaßt Mensagem, die lyrische Dichtung und die dramatischen Gedichte. Diese letzteren sind meines Erachtens von marginaler Bedeutung. Auch wenn man sie beiseite läßt, bleibt ein umfangreiches dichterisches Werk.
Ein erster Unterschied: die Heteronyme schreiben in einer einzigen Richtung und in einer einzigen zeitlichen Strömung. Pessoa gabelt sich wie ein Delta, und jeder seiner Arme bietet uns das Bild, die Bilder, eines Augenblicks. Die lyrische Dichtung verzweigt sich in Mensagem, den Cancioneiro (Liederbuch) (mit den noch nicht veröffentlichten und verstreuten Gedichten) und in die hermetischen Gedichte. Wie immer, entspricht die Klassifizierung nicht der Wirklichkeit. Cancioneiro ist ein symbolistisches Buch, durchsetzt von Hermetismen, obgleich der Dichter nicht direkt zu den Bildern der okkulten Tradition greift. Mensagem ist vor allem ein Buch der Heraldik – und die Heraldik ist ein Zweig der Alchimie. Letztlich sind die hermetischen Gedichte in Form und Geist symbolistische; man braucht kein „Initiierter“ zu sein, um zu ihnen Zugang zu finden, noch setzt ihr dichterisches Verständnis besondere Kenntnisse voraus. Diese Gedichte, wie sein übriges Werk, verlangen vielmehr ein tiefes und differenziertes Verständnis. Zu wissen, daß Rimbaud sich für die Kabbala interessierte und daß er Poesie mit Alchimie gleichsetzte, ist nützlich und bringt uns sein Werk näher; doch um wirklich in es einzudringen, brauchen wir etwas mehr und etwas weniger. Pessoa definierte dieses Etwas wie folgt: Zuneigung, Intuition, Intelligenz, Verständnis und, das Heikelste: Gnade. Mag sein, daß diese Aufzählung übertrieben erscheint. Doch ich sehe nicht, wie man ohne diese fünf Voraussetzungen Baudelaire, Coleridge oder Yeats wirklich lesen kann. Allerdings bietet die Poesie Pessoas weniger Schwierigkeiten als die Hölderlins, Nervals, Mallarmés… Bei allen Dichtern der modernen Tradition ist die Poesie ein System von Symbolen und Analogien, entsprechend dem der hermetischen Wissenschaften. Ihm entsprechend, nicht mit ihm identisch: das Gedicht ist eine Konstellation von Zeichen, die ihr eigenes Licht haben.
Pessoa faßte Mensagem als ein Ritual auf; oder auch: als ein esoterisches Buch. Wenn man die äußere Perfektion in Betracht zieht, ist dieses sein vollkommenstes Werk. Aber es ist ein fabriziertes Buch, womit ich nicht sagen will, daß es unaufrichtig sei, sondern daß es aus den Spekulationen und nicht aus den Intuitionen des Dichters entstanden ist. Auf den ersten Blick ist es eine Hymne zum Ruhme Portugals und die Prophezeiung eines neuen Reiches (des Fünften), das nicht materiell sein wird, sondern geistig; seine Herrschaft wird sich über den geschichtlichen Raum und die geschichtliche Zeit hinaus erstrecken (ein mexikanischer Leser wird sofort an die „kosmische Rasse“ von Vasconcelos gemahnt). Das Buch ist eine Galerie historischer und legendärer Personen, die ihrer überlieferten Wirklichkeit entrückt und in Allegorien einer anderen Tradition und einer anderen Wirklichkeit verwandelt werden. Vielleicht ohne sich seines Tuns voll bewußt zu sein, verflüchtigt Pessoa die Geschichte Portugals und stellt statt dessen eine andere, rein geistige dar, die deren Negation ist. Der esoterische Charakter von Mensagem verbietet uns, es als ein rein patriotisches Gedicht zu lesen, wie einige offizielle Kritiker das gern möchten. Man muß hinzufügen, daß sein Symbolismus es nicht einlöst. Damit die Symbole tatsächlich symbolkräftig werden, müssen sie aufhören zu symbolisieren, müssen sinnlich wahrnehmbar werden, lebendige Geschöpfe und keine musealen Embleme. Wie in jedem Werk, in dem mehr der Wille, denn die Inspiration im Spiel ist, gibt es in Mensagem wenige Gedichte, die diesen „Stand der Gnade“ erreichen, der die Poesie vor der schönen Literatur auszeichnet. Doch diese wenigen leben in demselben magischen Raum der besten Gedichte des Cancioneiro und einiger seiner hermetischen Sonette. Es ist unmöglich zu beschreiben, worin dieser Raum besteht; für mich ist es der der Poesie schlechthin, ein wirkliches, greifbares Gebiet, das von einem anderen Licht erhellt wird. Es macht nichts, daß es wenige Gedichte sind. Benn sagte:
Keiner auch der großen Lyriker unserer Zeit hat mehr als sechs bis acht vollendete Gedichte hinterlassen (…) also um diese sechs Gedichte die dreißig bis fünfzig Jahre Askese, Leiden und Kampf.
Der Cancioneiro: eine Weh aus wenigen lebendigen Wesen und vielen Schattengebilden. Es fehlt die Frau, die zentrale Sonne. Ohne Frau löst das Universum des sinnlich Wahrnehmbaren sich auf, es gibt weder festes Land noch Wasser noch Verkörperung des nicht Greifbaren. Es fehlen die schrecklichen Lüste. Es fehlt die Leidenschaft, diese Liebe, die Verlangen ist nach einem einzigen Sein, welches es auch sei. Da ist ein vages Gefühl der Brüderlichkeit mit der Natur: Bäume, Wolken, Steine, alles flüchtig, alles in einem zeitlichen Vakuum schwebend. Irrealität der Dinge, Abbild unserer Irrealität. Da ist Negation, Überdruß und Trostlosigkeit. In dem Livro de Desassossêgo (Buch der Unrast), von dem nur Bruchstücke bekannt sind, beschreibt Pessoa seine geistige Landschaft:
Ich gehöre einer Generation an, die ohne Glauben an das Christentum geboren wurde, und die auch keinen Glauben mehr in all die anderen Anschauungen setzte; wir waren von der sozialen Gleichheit, von der Schönheit oder vom Fortschritt nicht begeistert; wir suchten nicht in Orienten und Okzidenten nach anderen religiösen Formen (jede Kultur hat eine innige Beziehung zu der Religion, die sie vertritt; indem wir die unsrige verloren, verloren wir alles); einige von uns widmeten sich der Eroberung des Alltags; wir, aus besserem Hause, verzichteten auf die res publica, wollten nichts und verlangten nichts; andere wieder frönten dem Kult der Konfusion und des Lärms: sie meinten zu leben, wenn sie sich selbst hörten, sie meinten zu lieben, wenn sie auf die Äußerlichkeiten der Liebe stießen; und wir, die übrigen, Rasse der Endzeit, der geistigen Grenze der Toten Zeit, leben in Negation, Unzufriedenheit und Trostlosigkeit.
Dieses Porträt ist nicht das Pessoas, aber es ist der Hintergrund, von dem seine Gestalt sich abhebt und mit dem sie manchmal verschwimmt. Geistige Grenze der Toten Zeit: der Dichter ist ein leerer Mensch, der in seiner Hilflosigkeit eine Welt schafft, um seine wahre Identität zu entdecken. Pessoas ganzes Werk ist eine Suche nach der verlorenen Identität.
In einem seiner Gedichte, die am häufigsten zitiert werden, sagt er:
Der Dichter ist ein Simulant, der so perfekt täuscht, daß er selbst noch simuliert, der Schmerz, den er wirklich fühlt, sei simuliert.
Indem er die Wahrheit sagt, lügt er; indem er lügt, sagt er die Wahrheit. Wir haben es nicht mit einer Ästhetik zu tun, sondern mit einem Glaubensbekenntnis. Die Poesie ist die Enthüllung der Irrealität des Dichters:
Zwischen dem Mondschein und dem Laub,
Zwischen der Ruhe und dem Wald,
Zwischen dem Nacktsein und dem Nachtwind
Zieht ein Geheimnis vorüber,
Folgt dem Vorüberziehn meiner Seele.
Was da vorüberzieht: ist es Pessoa oder ein anderer? Die Frage stellt sich ihm im Laufe der Jahre und mit weiteren Gedichten immer wieder. Er weiß nicht einmal, ob das, was er schreibt, seins ist. Besser gesagt, er weiß, daß es das nicht ist, obgleich es das ist:
Warum lasse ich mich hinters Licht führen und meine, daß meins ist, was meins ist?
Die Suche nach dem Ich – verloren und gefunden und wieder verloren – endet im Ekel:
Brechreiz, Lust zu nichts: leben, um nicht zu sterben.
Nur aus dieser Perspektive kann man die volle Bedeutung der Heteronyme verstehen. Sie sind eine literarische Erfindung und eine psychologische Notwendigkeit, doch sie sind noch mehr. In gewissem Sinne sind sie das, was Pessoa hätte sein können oder hatte sein wollen; in anderem, tieferem Sinne das, was er nicht sein wollte: eine Persönlichkeit. Zum einen machen sie reinen Tisch mit dem Idealismus und den intellektuellen Überzeugungen ihres Erfinders; zum anderen zeigen sie, daß die unschuldige Weisheit, der Marktplatz und die philosophische Eremitage Selbstbetrug sind. Der Augenblick ist so unbewohnbar wie die Zukunft; und der Stoizismus ist ein Mittel, das tötet. Und trotzdem führt die Vernichtung des Ich, denn ebendas sind die Heteronyme, zu einer geheimen Fruchtbarkeit. Die wahre Einöde ist das Ich, und nicht nur, weil es uns in uns selbst einsperrt und uns so dazu verurteilt, mit einem Phantasma zu leben, sondern auch weil es alles, was es anrührt, zum Welken bringt. Die Erfahrung Pessoas, vielleicht ohne daß er selbst das gewollt hat, steht in der Tradition der großen Dichter der Moderne seit Nerval und den deutschen Romantikern. Das Ich ist ein Hindernis, ist das Hindernis. Deshalb ist jedes rein ästhetische Urteil über sein Werk unzulänglich. Wenn man auch zugeben muß, daß nicht alles, was er geschrieben hat, von der gleichen Qualität ist, so ist doch alles, oder fast alles, geprägt von den Spuren seiner Suche. Sein Werk ist ein Schritt auf das Unbekannte zu. Es ist eine Passion.
Pessoas Welt ist weder diese Welt noch die andere. Das Wort Abwesenheit könnte sie definieren, falls man unter Abwesenheit einen fließenden Zustand versteht, in dem Anwesenheit sich auflöst und Abwesenheit Ankündigung ist – wovon? –, Augenblick ist, in dem das Gegenwärtige nicht mehr ist und andeutungsweise jenes sich zeigt, das vielleicht sein wird. Die städtische Wüste bedeckt sich mit Zeichen: die Steine sagen etwas, der Wind, das erleuchtete Fenster und der einsame Baum an der Ecke sagen etwas, alles sagt etwas, nicht das, was ich sage, sondern etwas anderes, immer etwas anderes, eben das, was sich nie sagen läßt. Abwesenheit ist nicht nur Mangel, sondern auch Vorahnung einer Anwesenheit, die sich nie ganz zeigt. Hermetische Gedichte und Gesänge decken sich: in der Abwesenheit, in der Irrealität, die wir sind, ist etwas gegenwärtig. Staunend unter Leuten und Dingen, geht der Dichter durch eine Straße der Altstadt. Er betritt einen Park, und die Blätter regen sich. Sie sind im Begriff, etwas zu sagen… Nein, sie haben nichts gesagt. Irrealität der Welt im letzten Licht des Tages. Alles ist reglos, in Erwartung. Der Dichter weiß jetzt, daß er keine Identität hat. Wie diese Häuser, fast golden, fast wirklich, wie diese in der Abendstunde schwebenden Bäume, ist auch er sich selbst entrückt. Und der andere, der Doppelgänger, der wahre Pessoa erscheint nicht. Er wird nie erscheinen: es gibt keinen anderen. Was erscheint, sich einschleicht, ist das andere, das, was keinen Namen hat, was man nicht benennen kann und was unsere armen Worte erbetteln. Ist es die Poesie? Nein: die Poesie ist das, was übrig bleibt und uns tröstet, das Bewußtsein der Abwesenheit. Und von neuem, kaum vernehmlich, ein Raunen von etwas: Pessoa oder das nahe Bevorstehen des Unbekannten.
Octavio Paz, 1961, aus Octavio Paz: Essays 2, Suhrkamp Verlag, 1984
Sieger im Scheitern
– Fernando Pessoa und Robert Walser, zwei entfernte Verwandte. –
„Ich bin gescheitert wie die ganze Natur“, so bekennt Fernando Pessoas Hilfsbuchhalter Bernardo Soares im Buch der Unruhe. Es scheint, als sei erst unsere Zeit für solches Scheitern empfänglich, so wie auch Robert Walser, dieser Virtuose in der Kunst des schönen Scheiterns, erst heute in seiner umfassenden Bedeutung erkannt zu werden beginnt. Zumindest ein Grund für die späte Entdeckung Fernando Pessoas und Robert Walsers dürfte darin liegen, daß sie beide Dichter jenseits der Systeme waren; sie lassen sich weder in ideologische noch in literarisch-stilistische Schemata pressen; wie sie politisch weder von rechts noch von links zu vereinnahmen sind, standen sie auch den herrschenden Stilrichtungen ihrer Zeit fremd oder indifferent gegenüber, oder aber sie verformten und sprengten sie bewußt.
So gibt es sicherlich Jugendstil-Elemente bei Robert Walser und futuristische Anklänge bei Fernando Pessoa, genauer bei dem von ihm geschaffenen Alvaro de Campos; aber weder ist Walser ein Jugendstil-Autor noch Pessoa Futurist, Jugendstil oder Futurismus sind bei beiden nur Masken unter anderen Masken. Und so wie Robert Walser in seiner aufreizenden Ausdrucksvielfalt auch eine obenhin ganz aufs Reizende ausgerichtete, eine idyllisch-neuromantische und eine fast erbauliche Seite hat (die ihn, der das Genre des Schulaufsatzes ja favorisierte, geradezu zum Fibel-Autor zu prädestinieren scheint), gibt es auch bei Pessoa eine rückwärtsgewandte Seite: er mußte seinen antikisierenden, archaischen und „heidnischen“ Bedürfnissen ebenso wie seinen klassizistischen Neigungen gleich zwei Heteronyme schaffen, Alberto Caeiro und Ricardo Reis.
Doch Caeiro und Reis sind nicht Pessoa. Nur alle zusammen – und es existieren außer den bekannten und schon genannten vier Heteronymen ja noch zahlreiche andere, etwa Vicente Guesde, der Archivar, der Barón de Teide, Jean Seul, der französische satirische Journalist, Antonio Mora, der Philosoph des Neopaganismus, nicht zu vergessen Charles Robert Anon und Alexander Search, die englisch schreibenden Heteronyme aus seiner Jugend – sind Pessoa. Pessoa, das bedeutet im Portugiesischen sowohl Person wie auch Maske (das Wort leitet sich vom lateinischen persona ab). Tatsächlich lassen sich bei keinem anderen Autoren der Moderne Person und Maske so wenig voneinander unterscheiden wie im Falle Fernando Pessoa. So daß Octavio Paz, der meinte, die Heteronyme seien „keine literarischen Masken“, letztlich ebenso recht hat wie derjenige, der behaupten würde, selbst Pessoa ipse sei noch eine Maske.
„Er ist der verdeckteste aller Dichter“, hat Elias Canetti von Robert Walser gesagt und Walsers Besonderheit darin erblickt, daß dieser seine Motive nie ausspreche. Bei Pessoa ist diese Motiv-Verweigerung mindestens so ausgeprägt wie bei Walser. Beide halten ausgesprochen wenig von „der Wahrheit“ oder von Wahrheiten. „Sei dir stets bewußt: sich ausdrücken bedeutet für dich nichts anderes als lügen“, notiert Pessoas Hilfsbuchhalter Soares einmal im Buch der Unruhe. Und ein andermal: „Die Lüge ist… die ideale Sprache der Seele.“ In seinem Prosastück „Lüge auf die Bühne“ von 1907, das gegen den damals die Bühne beherrschenden Naturalismus gerichtet war und mit dem unnachahmlichen Satz endet: „Ich bin für ein Lügentheater, Gott helfe mir!“, hatte auch Robert Walser eine Kunst propagiert, die „goldene, ideale Lügen in großer, unnatürlich-schöner Form ausspinnt“. Nur wenn die Illusion von vorneherein einkalkuliert ist, sagt Soares = Pessoa, gibt es keine Desillusionierung. Doch nur die Kunst beherrsche diese Kunst der Illusion:
Die Liebe, der Schlaf, die Drogen und die Gifte sind Elementarformen der Kunst, oder, besser gesagt, sie bringen die gleiche Wirkung hervor wie sie. Aber auf Liebe, Schlaf und Drogen folgt allemal die Desillusionierung. Der Liebe wird man satt, oder sie enttäuscht. Aus dem Schlaf erwacht man, und während man geschlafen hat, hat man nicht gelebt. Die Drogen bezahlt man mit dem Ruin derselben Physis, zu deren Stimulierung sie gedient haben. Aber in der Kunst gibt es keine Desillusionierung, denn die Illusion war von Anfang an einkalkuliert. Aus der Kunst gibt es kein Erwachen, denn in ihr schlafen wir nicht, wenn wir auch träumen mögen. In der Kunst gibt es keinen Tribut, keine Strafe, die wir bezahlen müßten, weil wir sie genossen haben.
Sind nicht sogar Pessoas Heteronyme Verkörperungen solch „goldener, idealer Lügen“ im Sinne Walsers? Nichts vermag freilich darüber hinwegzutäuschen, daß dieses Spiel mit Masken, dieser Zwang zur Kunst-Lüge, dieser Zwang, zu fingieren, bei Pessoa wie bei Walser aus einer fundamentalen Mangel-Erfahrung, einer beispiellosen Ich-Schwäche resultieren; beide können Selbstbewußtsein nur fingieren, nur auf Papier simulieren. Ein schwaches Selbst schafft sich, um von seiner Schwäche abzulenken, eben andere Selbste. Diese Heteronyme bleiben aber Ausdruck mangelnder Autonomie, sie bleiben Signen des Scheiterns.
„Der Dichter ist ein Simulant, der so perfekt täuscht, daß er selbst noch simuliert, der Schmerz, den er wirklich fühlt, sei simuliert“, schreibt Soares = Pessoa. Die Robert-Walser-Nähe dieses Satzes ist evident. In einem seiner späten Gedichte wobei der Ausdruck spät sowohl bei Pessoa wie bei Robert Walser insofern irreführend ist, als beider „Spätwerk“ von Mittvierzigern stammt! – hat Pessoa ipse unter dem Titel „Autopsychographie“ den Zwang zur Simulation als bloßes Spiel zu tarnen gewußt:
Der Dichter macht uns etwas vor:
So weit treibt er sein Spiel,
Daß Kummer, den er wirklich fühlt,
Gespielter Kummer wird.
Und der dann liest, was jener schrieb:
Statt jener Doppelpein
Empfindet er ein Drittes nun:
Den Schmerz, den er nicht fühlt.
Und so, dem Geist zum Zeitvertreib,
Rollt sie auf ihrem Gleis:
Die kleine Spielzeug-Eisenbahn,
Gemeinhin „Herz“ genannt.
Übertragung: Paul Celan
So ins Spielzeughaft-Putzige und ins Nachlässig-Heitere hat auch Robert Walser immer wieder sein Scheitern an der Realität zu sublimieren gewußt. Und ziemlich sicher wären ihm jene Sätze vertraut vorgekommen, mit denen sich Soares = Pessoa gleichsam als eine Wörterpuppe, ein „Buchwesen“ beschreibt:
Ich bin großteils die gleiche Prosa, die ich schreibe. Ich entfalte mich in Perioden und Abschnitten, ich werde zur Zeichensetzung, und ich kleide mich bei der entfesselten Verteilung der Bilder (Metaphern) wie die Kinder als König aus Zeitungspapier ein, oder ich schmücke mich in der Weise, wie ich aus einer Aufreihung von Wörtern Rhythmen forme, wie die Verrückten mit trockenen Blumen, die in meinen Träumen lebendig bleiben. Und bei alledem bin ich so still wie eine mit Sägemehl gefüllte Puppe, die zum Bewußtsein ihrer selbst kommt und ab und zu mit dem Kopf nickt, damit die Schelle oben auf der Zipfelmütze (einem integrierenden Teil des Kopfes) etwas ertönen läßt, klingendes Leben des Gestorbenen, winziger Hinweis ans Schicksal… Ich bin zu einem Buchwesen geworden, zu einem gelesenen Leben.
Woher nun aber dieser Zwang, aus einem lebendigen ein „Buchwesen“ zu werden? Woher dieser Zwang, sich – übermütig, hochmütig oder mutlos? – abzusondern und vollkommen zu vereinsamen? Beide, der Schweizer wie der Portugiese, fielen ja nicht nur aus dem jeweiligen Literaturbetrieb ihrer Zeit und ihrer Länder, sondern auch aus jeglicher sozialen und sogar familiären Bindung heraus, beide hatten bald nur noch mit sich selbst Umgang (als ihn Carl Seelig bei einem der Spaziergänge in der Nähe von Herisau fragte, mit wem er in Bern Umgang gehabt hätte, antwortete Robert Walser: „mit mir selbst“). Man wird tief in die Kindheit dieser beiden Schriftsteller zurücksuchen, wird die lautlosen Katastrophen der Kindheit aufspüren müssen, wenn man die Wurzeln ihrer späteren Vereinsamung freilegen möchte.
Robert Walser verlor früh die Mutter, Pessoa noch früher seinen Vater – aber im übertragenen Sinne verlor auch er die Mutter, nämlich an deren zweiten Mann, seines Zeichens Generalkonsul Portugals in Südafrika, dem die Mutter schon bald nach dem Tod ihres ersten Mannes mit ihren Kindern nach dorthin folgte. Dieser Stiefvater war verantwortlich, daß Pessoa mit der Mutter auch die Muttersprache einzubüßen drohte, denn er wurde in Durban von irischen Nonnen englisch erzogen. Psychologisch aufschlußreich scheint in diesem Zusammenhang eine Eintragung im Buch der Unruhe, in der Pessoa seinen Soares zum vollständigen Waisen werden läßt:
Ich entsinne mich nicht an meine Mutter. Sie starb, als ich ein Jahr alt war… (sie) Mein Vater lebte in der Ferne; er hat sich umgebracht, als ich drei Jahre alt war, und ich habe ihn nie gekannt.
Robert Walsers Zögling Jakob von Gunten trägt in sein Tagebuch ein:
Ich war eigentlich nie Kind, und deshalb, glaube ich zuversichtlich, wird an mir immer etwas Kindheitliches haften bleiben. Ich bin nur so gewachsen, älter geworden, aber das Wesen blieb… Ich entwickle mich nicht.
Im Tagebuch des Hilfsbuchhalters Soares korrespondiert eine Eintragung auffallend mit jener des Jakob von Gunten = Robert Walser, sie verwandelt für einen kurzen Moment lang das sonst eher philosophische und auf Abstand bedachte Buch der Unruhe in ein journal intime:
Gott erschuf mich als Kind und hat mich immer ein Kind bleiben lassen. Warum aber hat er zugelassen, daß mich das Leben geschlagen hat, mir meine Spielzeuge wegnahm und mich in den Pausen allein ließ, in denen ich mit schwachen Händen die vom häufigen Weinen schmutzig gewordene blaue Spielschürze zerknitterte?
Die frühen Verluste haben bei beiden Autoren, Pessoa wie Robert Walser, eine bis zur Manie reichende Berührungsangst hinterlassen, die von beiden in eine Verklärung der Unberührtheit, in einen Kult des Berührungsverzichts umfunktioniert wurde.
Sehen und Hören sind die einzig edlen Dinge, die das Leben enthält. Die übrigen Sinne sind plebejisch und rein körperlich; der einzige Adel besteht darin, nie zu berühren, sich nicht zu nähern – das ist adlige Gesinnung.
So aristokratisch wie Pessoas Hilfsbuchhalter Soares hat das der frühere Commis und Kanzleischreiber Robert Walser nicht ausgedrückt, aber gehandelt hat er zeitlebens nach dieser Maxime; der ihm selbst liebste unter den von ihm geschaffenen Unberührbaren, der Zögling Jakob von Gunten – der übrigens auffälligerweise das adlige „von“ in seinem Namen führt –, verkündet ebenso emphatisch wie der gescheiterte Buchhändlerlehrling und Poet Simon Tanner aus dem Roman Geschwister Tanner (der sich „immer noch vor der Tür des Lebens“ stehen sieht) das aristokratische Abstands-Programm (auch wenn es bei Simon Tanner dann aufs kleinbürgerliche Anständigbleiben statt auf Adel hinausläuft):
Ich bin nichts als ein Horchender und Wartender, als solcher allerdings vollendet, denn ich habe es gelernt, zu träumen, während ich warte; das geht Hand in Hand, und tut wohl, und man bleibt dabei anständig.
Ähnliches hat Robert Walser 1914 auch in einem Prosafragment, das er auf die Rückseite seiner Skizze „Der Mann“ notierte, bekannt:
Ich bin ein achtsamer Mensch. Ich bestehe fast ganz nur aus Aufmerksamkeit. Ich muß notgedrungenermaßen auf alles achtgeben, es zwingt mich, es reißt mich hin, ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht hinwegsehen, ich kann nichts überspringen. Das ist vielleicht ein Übel. Ja, sehr wahrscheinlich ist es ein Übel. Aber dieses eigentümliche Übel beherrscht und regiert mich, und ich bin sein Diener, muß ihm gehorchen. Andere Menschen schlafen, ich, ich wache immer, als sei ich immer auf einer Art Wache.
Pessoa, der einmal von der „Ekstase des Schauens“ spricht und als Alberto Caeiro dichtet:
Wenn ihr nach meinem Tod meine Biographie schreiben wollt,
so ist nichts leichter als das.
Sie hat nur zwei Daten – Geburt und Todestag.
Alle Tage dazwischen gehören mir.
Ich bin leicht auf eine Formel zu bringen.
Ich war besessen vom Schauen
Pessoa = Soares sieht sich geradezu als Spion des Lebens:
Ich habe unter ihnen als Spion gelebt, und niemand, nicht einmal ich selbst, hat den Verdacht gehegt, daß ich einer wäre. Alle haben mich für einen Verwandten gehalten: niemand ahnte, daß man mich bei der Geburt vertauscht hatte…
Aus der aus Verlustangst erzeugten Berührungsangst ist bei Pessoa wie bei Walser Beobachtungszwang geworden, Voyeurismus, eine Art literarischer Spionagetätigkeit. Beide Dichter, zeitlebens mit Schlaflosigkeit geschlagen, sind „Augen-Liebhaber“, wie Herr Soares das nennt, sie treiben Tag und Nacht durch die Straßen der Städte oder hocken in mehr oder weniger armseligen Wirtschaften und betreiben das, was Robert Walser bei einer Begegnung mit Alfred Fankhauser im Bern der zwanziger Jahre drastisch „Augevögle“ genannt hat. Für beide existiert die Frau nur als Projektion, als Traum, als schöne Lüge. „Wir lieben niemals irgend jemanden. Wir lieben ganz allein die Vorstellung, die wir uns von jemand machen“, schreibt Soares = Pessoa. Oder auch: „Der Onanist ist der vollkommen logische Ausdruck des Liebenden. Er ist der einzige, der sich nichts vormacht und sich nicht betrügt.“ Robert Walsers Jakob von Gunten verkündet die Konsequenz: „Liebe entbehren, ja, das heißt lieben!“ Soares = Pessoa ergänzt: „Wer Liebe gibt, verliert Liebe“, und findet schließlich für sich folgende Abstands-Formel: „Vom Leben abdanken, um nicht von sich selbst abzudanken.“
Doch was ist das noch für ein Selbst, das zu zerbrechlich für jede Berührung ist und sich sagen muß: „Ich beneide alle Leute darum, nicht ich zu sein“ (Soares = Pessoa), oder: „Niemand wünsche ich, er wäre ich“ (Robert Walser)? Es ist ein vielfältig zersplittertes, an seine Beobachtungs-Partikelchen ausgeliefertes Selbst, das sich ständig neu zu definieren gezwungen ist und doch nie die Gewißheit einer Identität zu fühlen vermag. „Ständig fühle ich, daß ich ein anderer war, daß ich als anderer dachte“, schreibt Soares = Pessoa, Oder:
Um erschaffen zu können, habe ich mich zerstört; so sehr habe ich mich in mir selbst veräußerlicht, daß ich in mir nicht anders als äußerlich existiere. Ich bin die lebendige Bühne, auf der verschiedene Schauspieler auftreten, die verschiedene Stücke aufführen.
Jede Wahrnehmung ruft ein anderes Ich, eine andere Ausprägung der Sensibilität auf diese Ich-Bühne:
Das kleinste Vorkommnis – eine Veränderung des Lichts, der eingerollte Fall eines trockenen Blattes, das Blumenblatt, das sich welk ablöst, die Stimme auf der anderen Seite der Mauer oder die Schritte dessen, der diese Stimme erhebt, im Verein mit den Schritten desjenigen, der sie vernimmt, das halb geöffnete Portal des alten Gutshofs, der Innenhof, der sich unter dem Bogen der im Mondlicht zusammengescharten Häuser auftut –, all diese Dinge, die mir nicht gehören, fesseln doch mein empfindliches Nachdenken mit Banden des Widerhalls und der Sehnsucht. In jeder einzelnen dieser Wahrnehmungen bin ich ein anderer, erneuere mich schmerzlich in jedem unbestimmten Eindruck.
Die Flüchtigkeit der Erscheinungen, ihre peinigende permanente Metamorphose, bringt Soares = Pessoa auf die knappste aller denkbaren Verlust-Formeln: „Sehen heißt: schon gesehen haben.“ Und es ist immer ein anderes Ich, das sieht – und das gesehen hat.
„Je est un autre“: Rimbaud war es, der vor Pessoa und Robert Walser deren Grunderfahrung in einem Satz festgehalten hat, einem Satz, der recht eigentlich als das Motto der Moderne gelten könnte. Keiner der Autoren, die wir heute noch für diese Moderne reklamieren, so divergierend sie auch untereinander (gewesen) sein mögen, der sich nicht mit dieser Erfahrung des „Ich-Zerfalls“ (Gottfried Benn) auseinandergesetzt hätte, von Hofmannsthal mit seinem „Lord-Chandos-Brief“ und seinem „Gespräch über Gedichte“ („Wie der wesenlose Regenbogen spannt sich unsere Seele über den unaufhaltsamen Sturz des Daseins; wir besitzen unser Selbst nicht: von außen weht es uns an, es flieht uns für lange und kehrt uns in einem Hauch zurück… Und etwas begegnet sich in uns mit anderen. Wir sind nicht mehr als ein Taubenschlag“) bis zu Ernst Bloch, dessen „Spuren“ programmatisch von den beiden Sätzen eröffnet werden: „Ich bin. Aber ich habe mich nicht.“ Von Ezra Pound, der mit so vielen fremden Stimmen sprach, der „die Seelen aller Großen durch uns ziehen“ fühlte und bekannte: „Die Suche nach dem Wesen begann ich mit einem Buch, ,Personae‘ genannt, in dem ich gleichsam mit jedem Gedicht eine fertige Maske des Selbst abtat“, bis zu seinem Freund T.S. Eliot, in dessen epochemachendem Poem The waste land immer noch zwei andere Personen anwesend sind, wenn das eine Ich spricht, aber nicht im Sinne eines romantischen Doppelgängertums, sondern dem einer unbegreiflichen Polypersonalität („Who is the third who walks always beside you?“).
Ob Marinetti, der Futurist (dessen Werk Pessoa zum Teil kannte), mit der Flucht nach vorn dazu aufrief, „das Ich in der Literatur zu zerstören“, oder sein Landsmann Pirandello sechs Bühnenfiguren „auf die Suche nach ihrem Autor“ schickte, ob Juan Ramón Jiménez ein Gedicht „Ich und Ich“ oder Jorge Luis Borges ein ganzes Buch Borges und ich überschrieb („Ich bin nicht ich. / Ich bin jener, / der an meiner Seite geht, ohne daß ich ihn erblicke, / den ich oft besuche / und den ich oft vergesse, / jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche…“, dichtete Jiménez, und Borges schrieb: „Ich lebe, lebe so vor mich hin, damit Borges seine Literatur ausspinnen kann… Ich muß in Borges bleiben, nicht in mir, sofern ich überhaupt jemand bin, aber ich erkenne mich in seinen Büchern weniger wieder als in vielen anderen… Ich weiß nicht einmal, wer von uns beiden diese Seite schreibt“), ob André Breton seine „Nadja“ mit der Frage „Wer bin ich?“ oder Max Frisch seinen „Stiller“ mit der Beteuerung „Ich bin nicht Stiller“ begann, ob Julien Green, der sich schreibend stets als Medium einer unbekannten Macht empfand, darauf insistierte, man könne „sehr wohl zwei Personen sein“, oder Karen Blixen, die unter drei Namen publizierte, ihre Sängerin Pellegrina eine „Vielfache“ sein ließ, ob Valéry Larbaud als „Mr. Barnabooth“ auftrat oder Witold Gombrowicz an den Beginn seines Tagebuchs trotzig die vierfache Beteuerung „Ich / Ich / Ich / Ich“ stellte (und damit doch nur bewies, wie unsicher er sich dieses Ichs war): stets waren und sind Ich-Verlust und Ich-Zerfall vom Verlangen nach Entpersönlichung kaum voneinander zu unterscheiden.
T.S. Eliot meinte: „Poesie ist nicht der Ausdruck von Persönlichkeit, sondern eine Flucht vor der Persönlichkeit. Aber es wissen natürlich nur die, die Persönlichkeit haben, was es heißt, dieser entrinnen zu wollen.“ Sogar noch in den gerne das Kollektiv-Glück verkündenden Autoren vom Schlage Majakowskijs (der einen Gedichtband 100 Millionen betitelte) oder Brechts (der in seiner „Maßnahme“ den einzelnen, „der nur zwei Augen hat“, der Partei mit ihren „tausend Augen“ unterstellte) hat diese Dialektik von Polypersonalität und Wunsch nach Entpersönlichung ebenso ihre Spuren hinterlassen wie etwa in den Drogen-Texten Huxleys, Ernst Jüngers und Henri Michaux’ oder in der „écriture automatique“ der Surrealisten, denen allen die Überzeugung zugrunde liegt, daß in dem Augenblick, in dem das Ich zum Schweigen gebracht ist, der andere in uns – das andere Ich zu sprechen beginne. Und natürlich gehören hierher auch die expressionistischen Regressions-Träume eines Gottfried Benn:
O daß wir unsere Ururahnen wären.
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.
Leben und Tod, Befruchten und Gebären
glitte aus unseren stummen Säften vor.
Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel,
vom Wind Geformtes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel
wäre zu weit und litte schon zu sehr.
Gar nicht regressiv, sondern als willkommene Chance, im Allgemeinen aufgehen zu können, empfindet Robert Walser das, was für die anderen nur Ich-Armut, schmerzlicher oder schmerzlich erträumter Ich-Verlust ist. In seinem 1919 gedruckten Prosastück „Freundschaftsbrief“, in welchem dem „engen Selbst“ das Leben „wie ein Riese“ gegenübersteht, heißt es:
Wie bin ich im Meer der Erregtheit arm. Doch bin ich froh, denn ich denke, daß nur der Arme fähig sei, vom engen Selbst geringschätzig wegzugehen, um sich an etwas Besseres zu verlieren, an das Schwebende, das uns selig macht, an die Bewegung, die nicht stockt, an ein Hohes, das immer wächst, an das schwingende Allgemeine, an das nie erlöschende Gemeinsame, das uns trägt, bis es uns in Frieden begraben mag.
Für Robert Walser wie für Fernando Pessoa ist das gefährdete Ich am besten in den „unteren Regionen“ aufgehoben, „klein sein und bleiben“ ist beider Maxime: „Klein sein und bleiben. Und höbe und trüge mich eine Hand, ein Umstand, eine Welle bis hinauf, wo Macht und Einfluß gebieten, ich würde die Verhältnisse, die mich bevorzugten, zerschlagen, und mich selber würde ich hinabwerfen ins niedrige, nichtssagende Dunkel. Ich kann nur in den untern Regionen atmen.“ So formuliert es Jakob von Gunten in seinem Tagebuch. Und den Hilfsbuchhalter Soares läßt Pessoa in sein Tagebuch eintragen: „Wenn ich die Welt in der Hand hätte, würde ich sie, dessen bin ich sicher, gegen eine Fahrkarte zur Rua dos Douradores eintauschen“ (das ist jene kleine, freudlose Straße in Lissabons Baixa, wo Soares nach dem Willen Pessoas sein Kontor und sein Zimmer hat).
„In Wahrheit ist Chef Vasques mehr wert als die Könige des Traums; in Wahrheit ist das Büro in der Rua dos Douradores mehr wert als die großen Alleen unmöglicher Parks“, sagt dieser Soares = Pessoa.
Und wenn das Büro in der Rua dos Douradores für mich das Leben verkörpert, so verkörpert mein zweites Stockwerk, in dem ich in der gleichen Rua dos Douradores wohne, für mich die Kunst. Jawohl, die Kunst, die in derselben Straße wohnt wie das Leben, jedoch an einem anderen Ort, die Kunst, die das Leben erleichtert, ohne daß es deshalb leichter würde zu leben, die so eintönig ist wie das Leben selber, nur an einem anderen Ort. Jawohl, diese Rua dos Douradores umfaßt für mich den gesamten Sinn der Dinge, die Lösung aller Rätsel außer der Tatsache, daß es Rätsel gibt, die keine Lösung finden können.
Eine der charakteristischsten Tagebuch-Eintragungen dieses Soares lautet:
Ein Freund, Teilhaber einer Firma, sagte neulich zu mir, weil er annahm, ich verdiente zu wenig: „Sie werden ausgebeutet…“ Das rief mir in Erinnerung, daß ich ausgebeutet werde, da wir aber im Leben ausgebeutet werden müssen, frage ich mich, ob es nicht weniger schlimm ist, von Herrn Vasques aus dem Stoffgeschäft ausgebeutet zu werden als von der Eitelkeit, der Ruhmsucht, der Verachtung, dem Neid oder dem Unmöglichen. Es gibt sogar Leute, die Gott selbst ausbeutet, und das sind die Propheten und Heiligen in der Leere der Welt. Und ich ziehe mich – wie in das Heim, das die anderen ihr eigen nennen – in das fremde Haus, in das weitläufige Büro in der Rua dos Douradores zurück. Ich mache es mir an meinem Schreibtisch bequem wie an einem Bollwerk gegen das Leben. Ich spüre Zärtlichkeit, bis zu Tränen reichende Zärtlichkeit für meine Geschäftsbücher, in die ich Eintragungen vornehme, für das alte Tintenfaß, dessen ich mich bediene, für den gebeugten Rücken Sergios, der etwas weiter von mir entfernt Warenbegleitpapiere ausfertigt. Ich liebe das alles, vielleicht, weil ich sonst nichts zum Lieben besitze – oder vielleicht auch deshalb, weil nichts die Liebe einer Seele wert ist und, wenn wir es schon für ein Gefühl halten, es ebenso lohnend ist, dieses Gefühl meinem kleinen Tintenfaß entgegenzubringen wie der großen Gleichgültigkeit der Gestirne.
In der „Liebe zum Belanglosen“, von der so viele Tagebuch-Blätter des Herrn Soares zeugen, treffen sich Pessoa und Robert Walser ebenso wie in ihrer Skepsis gegenüber allen allzu großen Gedankengebäuden. Das Unbehagen an der Dominanz des Gedanklichen, das sich bei einem Autor unserer Tage, bei Botho Strauß, in seinem Poem „Diese Erinnerung an einen, der nur einen Tag zu Gast war“, so äußert: „Nicht wissen möcht ich, sondern / erklingen“, und das auch in der Generation Pessoas und Walsers immer wieder thematisiert wurde, etwa bei Gottfried Benn (der sich als „armen Hirnhund, schwer mit Gott behangen“ sieht und klagt: „Ich bin der Stirn so satt“) oder bei W.H. Auden
Hätt ich doch ein Dummkopf sein dürfen, einer, der lebte,
Bevor noch das Unheil seine Werber aussandte hierher;
Jünger als Würmer, Würmer haben schon zuviel zu leiden.
Ja, Gestein wär’ das Beste: Könnte ich nur
Diese Wälder, von den Feldern das Grün, diese lebhafte Welt
Unfruchtbar sehen wie den Mond
dieses Unbehagen liefert die Grundmelodie im Werk Walsers und Pessoas, zumal in jenem Pessoas = Caeiros. Caeiro empfindet sich als „Mystiker des Nichtwissenwollens“; er verkündet: „Gesegnet sei ich für alles, was ich nicht weiß“, und: „Wesentlich ist nur, sehen zu können, / sehen zu können, ohne dabei zu denken.“
Robert Walser treibt die Entpersönlichung am weitesten, er erhebt den Identitätsverlust geradezu zur sittlichen Norm: „Sich selbst nicht spüren, nicht fühlen, nicht wissen, / wer und was man ist und wessen man bedarf, / ist Sittlichkeit“, heißt es in einem seiner späten Gedichte. Und hölderlinhaft verklärt Walser die Sphäre des Blödeseins (der er dann achtzehn Jahre lang leibhaftig anheimfallen sollte, als er in den psychiatrischen Kliniken Waldau und Herisau Säcke klebte, Tische wischte, vorwiegend Trivialliteratur las und sich das Schreiben verbot), wenn er im März 1926 an Max Rychner schreibt:
Ich fand die Frage Kerrs, ob zur Gedichtfabrikation ein Grad von Verblödung erwünscht sei, bemerkenswert… Im Begriff Blödsein liegt eben etwas Strahlendschönes und -gutes, etwas unsäglich Feinwertiges, etwas, das gerade die Intelligentesten sehnsüchtig gesucht haben…
Schon Walsers Jakob von Gunten, man erinnere sich, hatte ja zuletzt das Institut Benjamenta verlassen, um mit seinem Erzieher vor der Erziehung zu fliehen und in die Wüste – die eine Metapher für Gedankenwüste, für Kulturflucht war – zu gehen: „Der Kultur entrücken, Jakob. Weißt du, das ist famos“, erklärte dieser Erzieher. Und die letzten Sätze dieses Anti-Erziehungsromans stimmten dann ein fast metaphysisch begründetes Lob der Gedankenlosigkeit an:
Ich fühle, daß das Leben Wallungen verlangt, nicht Überlegungen… Weg jetzt mit dem Gedankenleben… Jetzt will ich an gar nichts mehr denken. Auch an Gott nicht? Nein! Gott wird mit mir sein. Was brauche ich da an ihn zu denken? Gott geht mit den Gedankenlosen. Nun denn adieu, Institut Benjamenta.
Auch Pessoas Alberto Caeiro ist in Walsers wunderbarer Wüste der Gedankenlosigkeit gelandet, nicht als Alberto Caeiro, sondern als ein „Menschentier“, das nicht länger hinter den Sinn der Dinge kommen will, sondern sich in der reinen Tautologie aufgehoben weiß: „Die Dinge selbst sind der einzig verborgene Sinn der Dinge.“ Caeiro verlangt von der Welt nicht mehr, „sie solle anders sein als die Welt“, und er kann von sich sagen: „Ich bin nicht ich: ich bin glücklich.“ Pessoas Hilfsbuchhalter Soares freilich ahnt solches Glück nur für winzige Augenblicke: „Ich bin heute so klarsichtig, als ob ich nicht existierte“, notiert er einmal. Im übrigen ist er vorwiegend damit beschäftigt, über die vertrackte sokratische Dialektik von Wissen und Nichtwissen zu reflektieren. „Wissen heißt töten, im Glück wie in allem übrigen“, meint er einmal, „nicht wissen jedoch heißt nicht existieren.“ Soares weiß, daß auch noch die wunderbare Wüste der Gedankenlosigkeit nichts anderes als ein Gedanke ist und es keine rationale Rettung vom Denken geben kann. Nur eine irrationale oder eine ironische. Statt „erkenne dich selbst!“ postuliert er deshalb:
Verkenne dich selbst… sich bewußt verkennen ist tätige Anwendung der Ironie.
Ironiker sind sie sicher beide, Pessoa wie Walser, und zwar in jenem Sinne, in dem Martin Walser in seiner „Einübung ins Nichts“ überschriebenen Frankfurter Vorlesung über Robert Walsers Jakob von Gunten Ironie als eine „Existenzbestimmung“, ein Nichtanders-können-als-sich-selbst-in-Frage-Stellen im Gegensatz zur bloßen „Benehmensironie“ etwa eines Thomas Mann definiert hat. Es bleibt diesem Schweizer und diesem Portugiesen gar nichts anderes übrig, als die Wirklichkeit des Lebens als eine Form der Illusion und die Illusion wiederum als eine Form der Wirklichkeit aufzufassen.
Beider ausgeprägter Hang zum Oxymoron – also dem äußersten Widerspruch in sich selbst – läßt sich von daher ebenso erklären wie beider dezidierte Abneigung gegen die Sphäre des Politischen, die ja immer Eindeutigkeit vorspiegelt und eine widerspruchsfreie Welt in Aussicht stellt. Pessoa = Soares erklärt jeden, der sich der Politik verschrieben hat, ob Reaktionär oder Revolutionär, zum Ignoranten:
Jeder Revolutionär, jeder Reformer ist ein auf Abwege Geratener. Kämpfen bedeutet, außerstande zu sein, sich selbst zu bekämpfen. Reformieren heißt, selbst nicht besserungsfähig zu sein.
Und:
Alle Ideale und alle ehrgeizigen Pläne sind ein Wahnwitz männlicher Gevatterinnen. Es gibt kein Imperium, das es wert wäre, daß um seinetwillen eine Kinderpuppe entzweiginge. Es gibt kein Ideal, das das Opfer einer blechernen Eisenbahn verdiente.
Auch beider Abneigung gegen Reisen – Fernreisen – leitet sich von dieser Erkenntnis des Illusionscharakters der Wirklichkeit ab. „Geht die Natur etwa ins Ausland?“, ließ der große Spaziergänger Robert Walser seinen Simon Tanner einmal fragen. Und programmatisch beginnt Walsers Prosastück „Spazieren“ von 1912:
Es ging einer spazieren. Er hätte in die Eisenbahn steigen und in die Ferne reisen können, doch er wollte nur in die Nähe wandern.
Der Hilfsbuchhalter Soares, der wie sein Erfinder Pessoa ein Leben lang in Lissabons Baixa spazierenging und kaum je auch nur die Stadtgrenzen hinter sich ließ, verkündet lapidar:
Existieren ist reisen genug.
Und:
Nur äußerste Schwäche der Einbildungskraft rechtfertigt, daß man den Ort wechseln muß, um zu fühlen. Jede Straße, sogar diese Straße von Entenpfuhl trägt dich ans Ende der Welt. Doch das Ende der Welt ist, sobald man die Welt vollständig umkreist hat, der gleiche Entenpfuhl, von dem man ausgegangen ist… Das Leben ist das, was wir aus ihm machen. Die Reisen sind die Reisenden. Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern das, was wir sind.
Aus dem Käfig des Ich gibt es keine reale, sondern nur eine erträumte Befreiung. Aber auch das Geschöpf des Traums, Alvaro de Campos, muß noch klagen:
Ich bin der Mensch, der immer reisen will,
und immer bleibt, immer bleibt, immer bleibt,
bis zum Tod bleibt, selbst wenn er abreist, bleibt und bleibt und bleibt…
Es bleibt nur die kontemplative Alternative:
Jedes Ding ist, je nachdem wie man es betrachtet, ein Wunder oder ein Hindernis, ein Alles oder ein Nichts, ein Weg oder eine Sorge. Es auf immer verschiedene Weise betrachten heißt, es erneuern und durch sich selbst vervielfältigen. Deshalb hat der kontemplative Geist, der nie aus seinem Dorf herausgekommen ist, gleichwohl das ganze Universum zu seiner Verfügung. In einer Zelle oder in einer Wüste liegt das Unendliche beschlossen. Auf einem Stein schläft man kosmisch. (Soares = Pessoa)
Es liegt auf der Hand, daß diesen souveränen Standpunkt einzunehmen nur für Augenblicke gelingen kann. Soares = Pessoa beklagt, daß „die selbstauferlegte Absonderung von den Zwecken und Bewegungen des Lebens, der von mir selbst gewollte Bruch im Umgang mit den Dingen“ ihn genau dorthin geführt hätten, wovor er zu flüchten versuchte:
Ich wollte das Leben nicht spüren, wollte die Dinge nicht anrühren, weil ich aus der Erfahrung meines Temperaments im Umgang mit der Welt wußte, daß die Wahrnehmung des Lebens für mich immer schmerzhaft sein würde. Doch indem ich diese Berührung scheute, isolierte ich mich und, indem ich mich isolierte, steigerte ich meine ohnehin übertriebene Sensibilität noch mehr… Und indem ich meine Sensibilität durch die Isolierung anstachelte, bewirkte ich, daß selbst Kleinigkeiten, die sogar mir zuvor nichts ausgemacht haben würden, mich wie Katastrophen treffen. Ich habe mich in der Fluchtmethode geirrt. Ich bin auf einem unbequemen Umweg genau an denselben Ort geflüchtet, an dem ich mich bereits befunden hatte… Ich habe die Willenskraft abgetötet, indem ich sie analysierte. Wer gibt mir den kindhaften Zustand vor der Analyse zurück, auch wenn das vor aller Willenskraft wäre!
Der sich – wie Robert Walser – als „Prediger des Verzichts“ verstand, muß erkennen, daß er – im Gegensatz zu Walser, der seit seiner gewaltsamen Überführung von der Heilanstalt Waldau in die psychiatrische Klinik von Herisau auch noch auf das letzte Mittel, sein Ich zu behaupten, auf das Schreiben verzichtet hatte – den alles entscheidenden letzten Verzicht noch nicht geleistet hat:
Ich habe noch nicht gelernt, von meiner Neigung zu Vers und Prosa abzudanken.
Der Tod ersparte ihm das. Einundzwanzig Jahre vor dem um zehn Jahre älteren Robert Walser stirbt Fernando Pessoa 1935 an Leberzirrhose. Giuseppe Ungaretti, im selben Jahr wie Pessoa geboren, auch er ein Dichter der Masken, der das Ich als „monströses Triebwerk“ begriff, hatte gedichtet: „La morte si sconta vivendo“ (in Ingeborg Bachmanns Übersetzung: „Den Tod büßt man lebend ab“); nach diesem Motto hatten beide gelebt, der Schweizer wie der Portugiese, beide verzichteten auf alles, was man üblicherweise Leben nennt, auf irdische Behaustheit, Anerkennung, Liebe, Erfolg (Pessoa brachte im Gegensatz zu Walser zu Lebzeiten gerade ein einziges Buch, Mensagem, heraus), beide sind Märtyrer der Dichtung.
Spätestens an dieser Stelle ist ein Wort fällig über das, was Pessoa bei allen frappierenden Parallelen zu Walser von diesem unterscheidet. Es ist dies vor allem einmal seine portugiesische Herkunft. Es ist ja verblüffend, wie viele von den wenigen, die bisher über Fernando Pessoa geschrieben und nachgedacht haben, den Portugiesen Pessoa schlicht ignorieren.
Portugal, dieses kleine Land am Rande Europas, das in seiner Geschichte nie sehr fest mit der eigenen Erde verwachsen war, sondern den Blick immer hinaus aufs Meer, ins Ungewisse gerichtet und sich von dorther alles erhofft hat, erlebte nach den wenigen Jahren, in denen es dort in der unermeßlichen Ferne auch tatsächlich etwas entdeckte und danach die Heimat mit fremden Schätzen überhäufte, eine beispiellose Erschütterung seiner nationalen Identität, von der es sich nie mehr erholt hat. Seit Dom Sebastian, der blutjunge König, der am 8. August 1578 mit seinem riesigen Heer in der Schlacht bei Alkazar gegen die Mauren unterlag und dabei verschollen ging – wie lange wartete man am Tejo auf seine Wiederkehr, manche meinen, noch heute erwarte jeder Portugiese heimlich die Wiederkehr Dom Sebastians! –, lebt man in Portugal im Bewußtsein der Niederlage. Einmal wollte man zuviel, wollte ein portugiesisches Weltreich, seither will man nichts mehr, seither gilt der Traum mehr als jede Tat. Seither ist man in Portugal von der Traumhaftigkeit des Tatsächlichen überzeugt. „An die Stelle des Weltreichs trat die Illusion“ (Reinhold Schneider). Doch das Bewußtsein der Niederlage, das Wissen um die Vergeblichkeit allen Tuns wird zum Stolz gesteigert, zum Stolz auf die alles durchtränkende Traurigkeit, für den man in diesem Volk einen eigenen, ganz unübersetzbaren Namen gefunden hat: saudade, jenes Wort, das so oft in der Unterhaltung mit Portugiesen fällt und noch weit mehr meint als Stolz auf die Schwermut und Lust am Leiden. „Ich trage das Bewußtsein der Niederlage wie ein Siegespanier mit mir herum“, liest man in Pessoas Buch der Unruhe. Wahrlich ein portugiesischer Satz!
Da man in Portugal jedoch stets im stolzen Bewußtsein der saudade lebt, stößt man mit der Realität immer wieder empfindlich zusammen. Daher dann die große Müdigkeit im portugiesischen Volk, die große Passivität, der große Überdruß, daher mehr Klage als Anklage, daher das tragische Lebensgefühl als Grundzug eines ganzen Volkes, daher die Ehrfurcht vor dem Leiden, das in Portugal womöglich noch mehr verehrt wird als selbst in Rußland (Reinhold Schneider hat von einer geheimen Verwandtschaft zwischen der portugiesischen und der russischen Sprache gesprochen), daher die Liebe zur Poesie, zum poetischen Ausdruck (in diesem Land, das ja noch immer Analphabetismus kennt, werden vergleichsweise mehr Gedichte geschrieben als in jedem anderen Land). Daher aber auch der Hang zum Okkultismus, zur Astrologie, die Bereitschaft, auf Botschaften aus anderen Welten zu lauschen. Über Pessoas okkultistische, astrologische, theosophische Neigungen ließe sich ein dickes Buch verfassen; kein Wunder, daß der englische Magier Aleister Crowley, den er brieflich auf einen Fehler in einem seiner Horoskope aufmerksam gemacht hatte, sich sofort auf den Weg nach Lissabon machte, um Pessoa persönlich kennenzulernen. Und was das Labyrinthische angeht, so genügt ein einziger Blick auf die nur in Portugal anzutreffende manuelinische Architektur mit ihren unentwirrbaren steinernen Tauen und Verschlingungen, um zu begreifen, daß das Labyrinth das eigentliche Wappenzeichen des Portugiesen ist; ebenso wie jeder, der die Städte Porto und Lissabon kennt, die beide etwas Ruinenhaftes haben und dieses auch noch zu kultivieren scheinen, die Affinität des Portugiesen (und des portugiesischen Künstlers zumal) zum Abbrechen einer angefangenen Arbeit, zum Fragmentarischen, zum undeutlich Gesprochenen verstehen wird.
In Pessoa verkörpern sich alle die angedeuteten portugiesischen Eigenschaften eher im Übermaß als versteckt. Und nicht nur daß das Meer (das Robert Walser vermutlich nie erblickt hat) auch außer in seinem gewaltigen 40-Seiten Poem „Meeresode“ eine zentrale Rolle in Pessoas Poesie spielt, er hat in seinem einzigen zu Lebzeiten publizierten Gedichtband Mensagem auch fast nationalistische Töne angeschlagen und viele der Portalfiguren der portugiesischen Geschichte in einem mythischen Licht imaginiert. Darunter nicht von ungefähr auch Dom Sebastian, den jenseits des Meeres Verschollenen, mit dem sich Pessoa hier heftig identifiziert. In seinem als Schlüsselgedicht zu verstehenden Dom-Sebastian-Gedicht läßt er diesen bekennen, daß er den Traum – den er zugleich auch „Torheit“ nennt. – zwar „zu heftig erlebte“, daß aber dieser Traum, der ihn getötet habe, ihn zugleich lebendig erhalte über alle Zeiten hinweg. Das Gedicht endet mit einer Botschaf t- „Mensagem“ = Botschaft – an das portugiesische Volk:
Erbt meine Torheit von mir
mit allem, was in ihr gärt!
Was wäre mehr als das satte Tier
der Mensch ohne Torheit wert,
lebendiger Leichnam, der sich vermehrt!
(Das „minha loucura“ des portugiesischen Originals ließe sich statt mit „Torheit“ legitim auch mit Wahnsinn übersetzen: „Erbt meinen Wahnsinn!“)
Doch ebenso wie ihn der Traum = die Torheit umtreibt, hält ihn auch die große Müdigkeit seines Volkes gefangen: Pessoa ist der Dichter der äußersten Passivität, des äußersten Überdrusses. Wenn Robert Walser von Trägheit spricht, wird bei ihm gleich eine „beschwingte Trägheit“ daraus (ein sehr bezeichnendes Walsersches Oxymoron!), und die Müdigkeit, die seinen „Knirps“ auszeichnet, ist von dieser Art:
Dann und wann trug seine wie aus einer Art von Eingeschlafenheit quillende Geschicklichkeit den Stempel berechneter Naivität oder gekünstelter Ungekünsteltheit!
Pessoas Passivität und Müdigkeit jedoch sind von vergleichsweise tragischer, eben von portugiesischer Art; er, der seinen Alvaro de Campos einmal zu jenen Portugiesen rechnet, „die seit der Entdeckung Indiens arbeitslos sind“, hat mit einer verzweifelten niederdrückenden Müdigkeit zu kämpfen, mit einem alles vergiftenden Überdruß. Es ist ein aussichtsloser Kampf. Am 18.9.1933, zwei Jahre vor seinem Tod, notiert Pessoa = Soares in sein Tagebuch:
Der Überdruß ist nicht die Langeweile des Nichts-zu-tun-Habens, sondern die ärgere Krankheit, zu fühlen, daß es sich nicht lohnt, irgend etwas zu tun. Und da dem so ist, muß man, je mehr zu tun ist, desto mehr Überdruß empfinden.
Aus demselben Jahr stammt eine Eintragung im Buch der Unruhe, in der Pessoas Polypersonalität gleichsam noch um eine Figur erweitert wird:
Ich bin an jenen Punkt gelangt, an dem der Überdruß zur Person wird, zur verkörperten Fiktion meines Zusammenlebens mit mir selbst.
Im Gedicht Sommerfrische von Alvaro de Campos, in dem es zunächst heißt: „Ich kam hierher zur Erholung, / doch ich vergaß, mich zu Hause zu lassen“, durchtränkt der Überdruß am Ich – oder vielmehr der personifizierte Überdruß – jeden Tag und macht jeden zur Qual; das Gedicht endet mit der drastischen Zeile (die auch einen Blick auf den Alkoholiker Pessoa freigibt):
Weiß- oder Rotwein, es ist das gleiche: es ist zum Kotzen.
Schließlich steigert sich der Überdruß bei Pessoa zum Ekel, Ekel über den nicht mehr zurückzunehmenden Akt der Schöpfung:
Zuweilen überkommt mich ein so schrecklicher Lebensüberdruß, daß es nicht einmal die Vorstellung einer Handlung gibt, mit der ich ihn meistern könnte. Um ihm abzuhelfen, erscheint mir der Selbstmord als zu unsicher, der Tod, selbst wenn er Unbewußtsein herbeiführen würde, als viel zu wenig. Es ist ein Überdruß, der nicht darauf abzielt, das Existieren zu beenden, was durchaus möglich oder nicht möglich sein kann – sondern auf das Schrecklichere und weitaus tiefer Reichende erpicht ist, niemals existiert zu haben, was ganz und gar unmöglich ist.
Oder doch möglich, nämlich jenem mythischen Denken, das Pessoa dazu veranlaßte, in einem seiner Gedichte Ulysses als den eigentlichen Gründer Lissabons erscheinen zu lassen. Ulysses war und ist wirklich, weil er nie existierte, suggeriert dieses Gedicht. So wirklich wie Bernardo Soares, Ricardo Reis, Alberto Caeiro oder Álvaro de Campos, die auch nie leibhaftig existierten, so wirklich wie jeder künstlerisch gefaßte Traum, so wirklich wie alle große Poesie, zu der Fernando Pessoas Werk so sicher wie das Robert Walsers zu zählen ist. Beide sind nicht nur Märtyrer der Dichtung, sondern auch Sieger im Scheitern. Wie solche aus Niederlagen gewonnenen Siege aussehen, dafür soll zuletzt eines der späten Gedichte von Pessoa ipse zeugen:
Ich bin ein Flüchtling.
Mein Leben begann,
da schloß man mich ein,
ich aber entrann.
Peter Hamm, Erstdruck in: Algebra der Geheimnisse, ein Fernando-Pessoa-Lesebuch, Ammann Verlag, 1986
Zwiesprachen: Monika Rinck über Fernando Pessoa am 15.5.2019 im Lyrik Kabinett, München
Hans-Jürgen Heise: Rangierbahnhof fremden Lebens
Harald Hartung: Eine Ästhetik der Abdankung. Fernando Pessoa deutsch, Merkur, Heft 493, März 1990
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstler Fernando Pessoa
Astrid Nettling. Ich bin eine Gestalt aus einem noch zu schreibenden Roman
Allen Ginsberg liest Fernando Pessoa – Gruß an Walt Whitman – 22. Juni 1981
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Archiv + KLG + IMDb +
Interviews + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Hans Magnus Enzensberger – Trailer zu Ich bin keiner von uns – Filme, Porträts, Interviews.
Hans Magnus Enzensberger – Der diskrete Charme des Hans Magnus Enzensberger. Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999.
Hans Magnus Enzensberger liest auf dem IX. International Poetry Festival von Medellín 1999.
Fakten und Vermutungen zum Autor + KLfG + Stadtbild +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Keystone-SDA
Fernando Pessoa – Dokumentation.


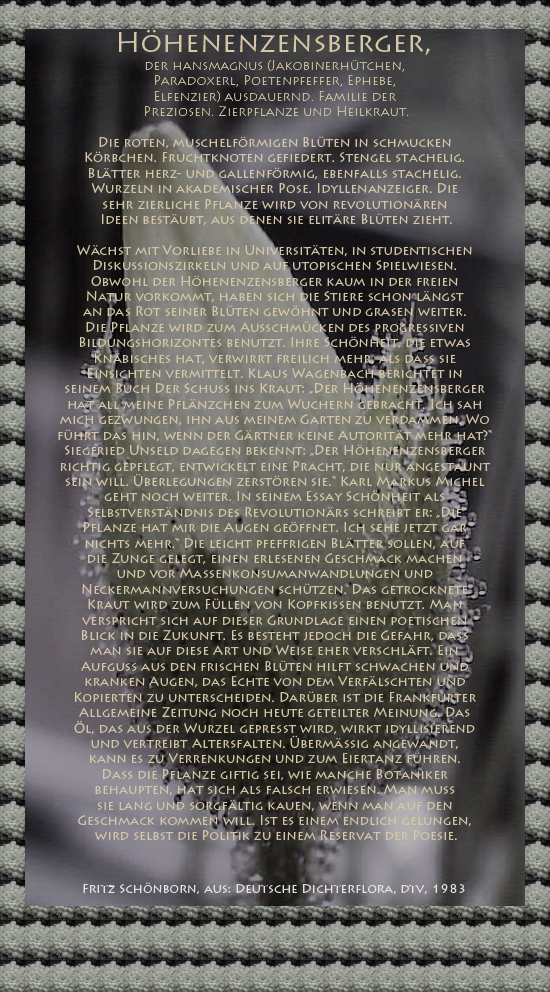
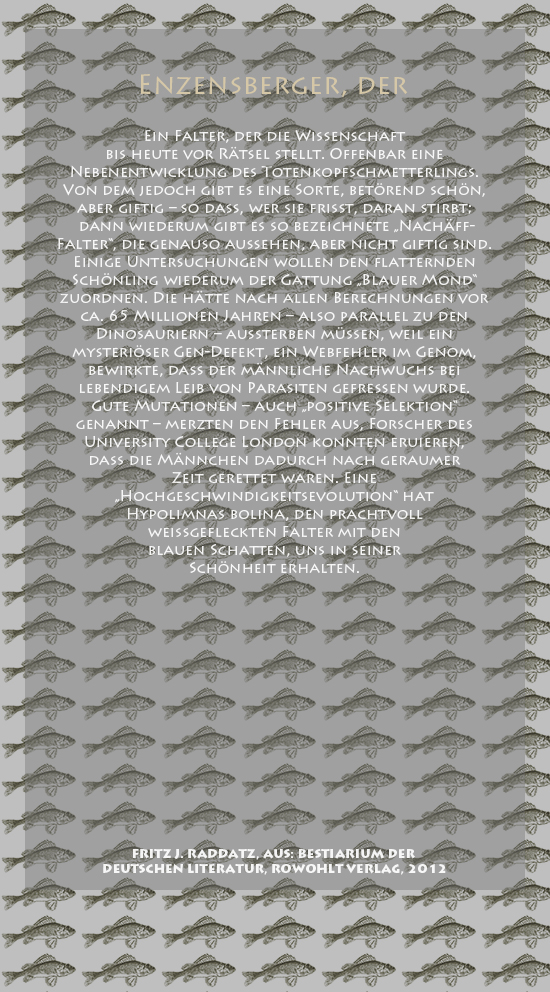












Schreibe einen Kommentar