Günter Kunert: Gedichte
LAIKA
In einer Kugel aus Metall,
Dem besten, das wir besitzen,
Fliegt Tag für Tag ein toter Hund
Um unsre Erde
Als Warnung,
Daß so einmal kreisen könnte
Jahr für Jahr um die Sonne,
Beladen mit einer toten Menschheit,
Der Planet Erde,
Der beste, den wir besitzen.
Nachwort
1
In der Kindheit – schreibt Ernst Bloch – scheine uns allen etwas, worin noch niemand war: Heimat. Günter Kunert hat eine Heimat zeit seines Lebens schmerzlich vermißt. Nie aber war er weiter von ihr entfernt als gerade in seiner Kindheit. Der Mangel an Gemeinschaft und Geborgenheit, an sicherer Zuflucht und sorglosem Vertrauen in seine Umwelt, den er in seinen jungen Jahren erfuhr, ist zu einem beherrschenden Motiv seines Werkes geworden. Mit den Zeilen: „der auserlesene Findling / Kind ohne Kindheit / Fremder in eigener Heimat und / verhöhnt“ porträtiert er Edgar Allen Poe, doch durch die zarten Striche dieser Skizze schimmert unzweifelhaft ein Selbstbildnis.
Kunert wurde 1929 in Berlin geboren, als Sohn einer jüdischen Mutter und eines – wie es bald schon heißen sollte „arischen“ Vaters. In dem autobiographischen Prosastück „Ohne Bilanz“ vermittelt er in lapidaren Sätzen einen Eindruck von seiner „verstörten Kindheit“, die er „genauso verlassen kann wie die Schnecke ihr Haus“. Der Vater, ein im Grunde unpolitischer Mensch, war durch seine Ehe zum Hitler-Gegner geworden: „Obwohl aufgefordert, sich scheiden zu lassen, um des Durchschnittslebens eines Durchschnittsbürgers teilhaftig zu werden, hielt mein Vater dickköpfig an Frau und Feindschaft fest. “ Trotz der schnell zunehmenden Bedrohung schloß sich der Vater immer enger an die jüdische Familie seiner Frau an. Kontakte zu nicht-jüdischen Nachbarn bröckelten wegen der „offiziellen Ächtung“ ab. Doch dieses „Familienleben schwand mit dem Beginn der Deportationen und vergrößerte das Vakuum subjektiven Lebensraumes. Obwohl im Heimatland fühlte man sich in der Fremde“.
Der Sohn Günter Kunert wuchs isoliert und in einer Atmosphäre der Angst auf. Obwohl er sich nichts hatte zuschulden kommen lassen und sich keines Vergehens bewußt war, begegnete ihm die Gesellschaft feindlich. Sie gestattete ihm niemals, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln, sondern erklärte ihn zum Aussätzigen, dem nirgends Schutz gewährt werden durfte. Für ihn gab es nicht einmal eine Appellationsinstanz, bei der er um Gnade hätte nachsuchen können. Er wurde so als Kind und Jugendlicher gewaltsam in die jahrhundertealte, verhängnisvolle Außenseiterrolle der Juden gepreßt und in seiner psychischen Konstitution geprägt.
In welch auswegloser Situation sich Kunert damals befand, begreift man besser, wenn man sich vor Augen hält, daß seiner Familie auch der radikale Rückzug ins Privatleben verwehrt war.
Die vereinsamte Wohnung […] besaß eher den Charakter einer Falle: zu Hause war man am verwundbarsten: Sobald das Telefon klingelte und ein verabredetes Stichwort eine neue Judenaktion ankündigte, verließ man sie vorsichtshalber […], selber die Nacht bei Bekannten zu verbringen, unsicher ob man heimkehren könne, und doch des einen gewiß: daß man bei den Hilfsbereiten über einen längeren Zeitraum nicht verweilen konnte.
Natürlich wäre es eine unerlaubte Vereinfachung, wollte man behaupten, Kunert sei schon allein wegen dieser Erfahrungen zu einem politisch hellhörigen, buchstäblich geistesgegenwärtigen Schriftsteller geworden. Daß sie aber Spuren in seinem literarischen Werk hinterlassen haben, läßt sich kaum bezweifeln. Die Perspektive, aus der er seine Themen in den Blick nimmt, ist zwar immer persönlich, nie aber privat. Er versteht sein lyrisches Ich als eine „Legierung individueller und gesellschaftlicher Komponenten“. Seine Texte sind präzis formulierte, subjektive Reflexe auf konkret Erlebtes, Erfahrenes und Erlittenes. Eines seiner ältesten Gedichte, „Für mehr als mich“, hat seinen programmatischen Charakter bis heute nicht verloren:
Ich bin ein Sucher
Eines Weges
Der breiter ist
Als ich.
Nicht zu schmal.
Kein Ein-Mann-Weg.
Aber auch keine
Staubige, tausendmal
überlaufene Bahn.
Ich bin ein Sucher
Eines Weges.
Sucher eines Weges
Für mehr
Als mich.
Nach dem als Befreiung erlebten Ende des Krieges fühlte er sich – wie viele Intellektuelle in seiner Situation – von marxistischen Ideen angezogen. Er war überzeugt, „die Werkstätten mörderischen deutschen Bewußtseins würden anfangen, Vernunft zu erzeugen, sobald sie sozialisiert seien“, und trat 1949, im Gründungsjahr der DDR, in die SED ein. Ein bequemer, linientreuer Genosse ist Kunert allerdings nie gewesen: bereits 1950 verließ er den „Ersten Schriftstellerlehrgang des deutschen Schriftstellerverbandes“, nachdem es zwischen ihm und einigen Parteidichtern zu massiven Kontroversen gekommen war. Konflikte wie diese sollten bald schon alltäglich werden: von oberlehrerhaften Bedenken gegen seine Bücher über polemische Attacken gegen seine Person bis hin zur kaum bemäntelten Zensur reichten die Maßnahmen, mit denen die offiziöse Literaturkritik und die Kulturbürokratie der DDR den unangepaßten, aber gleichwohl erfolgreichen Schriftsteller Kunert zu disziplinieren suchten.
In Johannes R. Becher und Bertolt Brecht hatte er zunächst noch einflußreiche Fürsprecher, die seine ersten, behutsam nach dem eigenen literarischen Weg tastenden Schritte begleiteten. Doch schon sein 1962 fertiggestellter Gedichtband Der ungebetene Gast durfte lange Zeit nicht gedruckt werden. Die nachfolgenden Bücher konnten nur unter anwachsenden Schwierigkeiten in der DDR erscheinen. Wieder mußte sich Kunert als Außenseiter, als heftig befehdeter Ruhestörer empfinden, dem ein angemessener Platz in der Gemeinschaft verweigert wurde. Wieder trat der Staat ihm – dem Einzelnen – unverhohlen feindlich entgegen. Wieder war er ein „Fremder in eigener Heimat“.
Kunert hat sich dieser erzwungenen Heimatlosigkeit schreibend nach Kräften widersetzt. Er protestierte gegen die Versuche der Gesellschaft, ihren Kritiker mundtot zu machen, indem sie ihn zum verfemten Einzelgänger erklärte. Zugleich aber machte er die Literatur zu seiner Heimat. Im Prozeß des Schreibens – so betont er – erbaut er in seiner Imagination zwar keine „heile“ Traumwelt, wohl aber gelingt es ihm, sich mit sonst nie erreichter Intensität vor Augen zu stellen, was ihm vorenthalten wird. Er beschreibt, worunter er leidet, und rettet so für sich – und also auch für seine Leser – eine Ahnung vom Befinden jenseits der Leiden. Der Schriftsteller besitzt laut Kunert
das Talent, sich, seine Psyche, sein Bewußtsein, auch sein Unbewußtes, seine Persönlichkeit zu verwandeln: in einen knappen Text von wenigen Zeilen. Aus diesem Text kann er weder vertrieben noch ausgebürgert werden, er ist seine eigentliche Heimat.
Als Kunert im Oktober 1976 die Petition der DDR-Schriftsteller zugunsten Wolf Biermanns unterschrieb, gestaltete sich seine Situation noch schwieriger. Im Januar 1977 wurde ihm – wie kurz zuvor schon Jurek Becker, Sarah Kirsch und Gerhard Wolf, die ebenfalls zu den Unterzeichnern gehörten – seine SED-Mitgliedschaft aberkannt. Knapp drei Jahre später, in denen er öffentlichen Diffamierungen und geheimdienstlichen Nachstellungen ausgesetzt war, reiste er in die Bundesrepublik aus und ließ sich bei Itzehoe nieder, wo er bis heute lebt.
2
Kunerts literarische Entwicklung ist eng mit seiner Biographie verknüpft. Man kann sein Werk, wie es Dieter E. Zimmer formulierte, als die „Geschichte einer zunehmenden Verfinsterung“ lesen, die von der Hoffnung auf eine menschenwürdigere Zukunft über allmählich sich ausbreitende Zweifel bis hin zu einer globalen Katastrophen-Erwartung, ja Katastrophen-Gewißheit führt. Seine frühesten Gedichte teilen den aufbruchstrunkenen Optimismus, der den damals noch jungen sozialistischen deutschen Staat beherrschte. Allerdings machen sich auch schon in den frühesten Arbeiten skeptische Untertöne bemerkbar. Sie schrecken zurück vor steilem Pathos und allzu naiven Erwartungen: so schickt Kunert seinem Gedicht „Über einige Davongekommene“, das mit der in der Nachkriegszeit üblichen „Nie wieder“-Deklamation endet, den sarkastischen Nachsatz „Jedenfalls nicht gleich“ hinterher. Oder er schreibt, statt über das Gelingen, lediglich über den „Traum von der Erneuerung“ und setzt jede der sieben Strophen in den Konjunktiv: „Eines Tages müßte die Menschheit; / Ihr Krankenbett verlassend, / Geheilt umhergehen.“
Wenige Jahre später finden sich in dieser Lyrik kaum noch Ausblicke ins vermeintlich näherrückende Arkadien. An ihrer Stelle mehren sich Warnungen vor einem möglichen Inferno. Warnungen, die heute geläufig erscheinen, seinerzeit aber Befremden, wenn nicht Bestürzung hervorriefen: das Thema des Gedichtes „Laika“ beispielsweise klingt für den Leser in der Mitte der achtziger Jahre nur zu vertrautes entstand aber ein Vierteljahrhundert zuvor.
Hatte sich Kunert am Anfang seiner literarischen Karriere dem Glauben hingegeben, genau zu wissen, in welche Richtung und zu welchem Ergebnis die Weltgeschichte sich entwickelt, heißt es zu Beginn der sechziger Jahre: „Wir streben dem Ziel zu, / Uns wandelnd und wandelnd das Ziel, / Ewig unerreichbar und darum / Ewiger Ansporn, es zu erreichen.“ Es klingen immer häufiger Motive an, die ihre Nähe zum französischen Existentialismus – der zur gleichen Zeit auch in der Bundesrepublik große Popularität genoß – nur schwer verleugnen können. Für dogmatische Literaturkritiker in der DDR Grund genug, Kunert bald schon ideologische Unzuverlässigkeit vorzuwerfen, ihn als „existentialistischen Abweichler“ zu denunzieren.
Die Poetologie der Mahn- und Warn-Gedichte wurde Kunert allerdings in den folgenden Jahren immer fragwürdiger:
Auf unzeitgemäß verfertigtem Papier
schreibe ich
eine kleine fossile Wahrheit
in der Schrift
welche vor den täglichen Weltuntergängen
verständlich war.
Die Aufforderung, unermüdlich einem „ewig unerreichbaren“ historischen Ziel zuzustreben, nimmt in Kunerts Gedichten nach und nach eine immer düstere Färbung an. Der Preis, den der Einzelne für ein solch ehrenwertes, aber vergebliches Unterfangen zu entrichten hat, rückt in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Hatte er unter dem Titel „Ikarus 64“ zwar schon bekannt: „Fliegen ist schwer“, so richtete er damals an seine Leser trotzdem noch die Aufforderung:
Dennoch breite die Arme aus und nimm
einen Anlauf für das Unmögliche.
Nimm einen langen Anlauf damit du
hinfliegst
zu deinem Himmel
daran alle Sterne verlöschen.
[…]
Denn Tag wird.
Ein Horizont zeigt sich immer.
Nimm einen Anlauf.
Mitte der siebziger Jahre dagegen beschreibt er als die „ikarischen Züge“ der Vögel nicht mehr deren Aufstreben zum Himmel, sondern nur noch deren Verletzungen nach dem Absturz, ihr „,zerfetztes Gefieder“, ihre „gebrochenen Schwingen“:
ein blutiges und panisches
Geflatter
nach Maßgabe der Ornithologen
unterwegs nach Utopia
wo keiner lebend hingelangt
wo nur Sehnsucht
überwintert
Der ehemals so siegessicher imaginierte Gang der Geschichte wird zum sinnlos mörderischen Wettlauf („Das Fortschreiten von etwas Unaufhaltbarem / wird zum unaufhaltbaren Fortschritt“), der das Individuum zum Statisten im Welttheater („Theatrum mundi“) degradiert:
Nur du und ich
beschmutzt von Furcht und Mitleid
aller Dramen
erfahren nichts als daß
wir Komparsen sind
jenseits der Worte
die uns keiner gab.
Schließlich nimmt Kunert gegen Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre – ungefähr zeitgleich mit seiner Übersiedlung in den Westen – „endgültig Abschied von der Utopie, vom Prinzip Hoffnung“. Beides bleibt zwar in seiner Lyrik weiterhin präsent, aber erkennbar nur ex negativo, als das Verlorene, Aufgegebene, dem die „Absage“ gilt:
Als Sehnsuchtsziel gewitzt erdacht,
als Ort der wahren Menschlichkeit.
Doch greift sie aus in Raum und Zeit,
verliert sie ihre fade Pracht,
wird ein realer Wüstenstrich,
ein Jammertal wie längst bekannt:
Ein Stirb- und Werdniewiederland.
Behalte deine Welt für dich.
Freilich vollzieht sich dieser Abschied keineswegs schmerzlos, sondern hinterläßt eine nie vernarbende Wunde. Kunert versinkt nicht in gemütvoller Altersresignation: Er macht noch in der Schilderung der Niederlage etwas vom Zorn des Aufbruchs, von der Rebellion gegen das Unvermeidliche spürbar. Sein lyrischer Nekrolog auf die Hoffnungen von einst lautet:
Wer lange in einer Legende gelebt
die mit der Zeit doch zerfällt,
dem bleibt, wonach er niemals gestrebt:
Nur Asche von seiner Welt.
Trotz allem betrachtet er seinen Werdegang nicht allein als eine fortschreitende Desillusionierung, sondern auch als Reifungsprozeß, als das Zeugnis einer persönlichen Emanzipation:
Die Gedichte markieren Stationen, Wegstrecken, die immer weiter von der Ausgangsposition fort und immer näher zum eigenen Selbst führten. Das scheint mir ein ganz normaler Gang zu sein: von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung. Und diese Entwicklung ist beispielhaft nur insofern, als sie vorführt, daß man sich dem Muster entziehen kann, in welchem man als dekorativer Schnörkel vorgesehen war.
In der Tat macht seine Sprache im Laufe der mittlerweile vier Jahrzehnte währenden poetischen Produktion einen verblüffenden Wandel durch. Einen Wandel, den man als mühevoll erstrittenen Durchbruch zur Unabhängigkeit, zu weitreichender literarischer Autonomie betrachten kann. Kunert überbrückt die schier unüberbrückbare Distanz zwischen zwei in sich geschlossenen, ja teilweise konträren lyrischen Wehen: er bewältigt – kurz gesagt – den Weg von Brecht zu Benn, von einer diskursiv und didaktisch argumentierenden, pointiert formulierenden Gedankenlyrik zu einer das ureigenste, aber gleichwohl überindividuelle Lebensgefühl beschwörenden Dichtung, die durch Bilder, Stimmungen und Klänge Unsagbares zu sagen versucht. Ein Weg, auf dem er sich nicht nur von ideologischer Bevormundung, sondern auch von dem gebieterischen Vorbild Bertolt Brechts befreite, dem Ziehvater und Zuchtmeister seiner jungen Jahre.
Stellt man eines der frühen Gedichte, wie „Einige bleiben“, neben „Denkmal“, das gegen Ende der sechziger Jahre entstand, und neben „Tiefseemuschel“ aus der Mitte der achtziger Jahre, so fallen die tiefgreifenden Differenzen zwischen den jeweiligen poetischen Sprechweisen sofort ins Auge. „Einige bleiben“ gibt seinen parabolischen, gleichnishaften Charakter unschwer zu erkennen: Der Autor hat – zumindest in den ersten drei Strophen – eine Erkenntnis, einen Gedankengang versinnbildlicht, und dem Leser fällt die Aufgabe zu, diese literarische Einkleidung zu entschlüsseln, hinter dem metaphorisch Formulierten das ursprünglich Gemeinte aufzudecken. Kunert versucht also, mit seinen Versen etwas zu erklären, er versucht Zusammenhänge verständlich zu machen, die er offenbar genau kennt. Er nimmt die Haltung eines Wissenden ein, spricht zudem seine Leser gelegentlich mit einem auffordernden, Anweisungen erteilenden „Du“ oder „Ihr“ unmittelbar an, wodurch er sie noch deutlicher in die Rolle der Schüler verweist. Mit anderen Worten: Er macht seine Lyrik zum Vehikel der Aufklärung.
„Denkmal“ weist zwar noch schwach gleichnishafte Züge auf, doch wird nun in der letzten Strophe sorgfältig offengelegt, was immer verschlüsselt geblieben sein sollte. Der Autor benutzt die gewählten Bilder jetzt allein als Beispiel, seine Überlegungen anschaulich zu machen. Vor allem aber bezieht Kunert in den entscheidenden Versen, in denen von dem „Menschen“ und den „Geschlechtern“ die Rede ist, sich selbst in die Reflexionen des Gedichtes mit ein. Er hat die Haltung des Lehrenden weitgehend aufgegeben und beschreibt einen Vorgang, dem er ebenso wie der Leser ausgeliefert ist.
„Tiefseemuschel“ schließlich ist in einem unüberhörbar kontemplativen Tonfall geschrieben. Zwar erscheint auch hier die Anrede „du“, doch wird nicht mehr an den Leser appelliert. Kunert nimmt vielmehr mit diesem „du“ ein Selbstgespräch auf, er lauscht gleichsam in sich hinein, um sich seiner selbst und seiner veränderten Weitsicht – zu vergewissern. Anders als in dem Gedicht „Einige bleiben“, das Antworten gab auf Fragen, die überhaupt nicht gestellt wurden, tauchen jetzt Fragen auf, die nicht nur ohne Antwort bleiben, sondern schlicht unbeantwortbar sind. In seiner Hilflosigkeit, seinen Ahnungen und Ängsten angesichts dieser Geheimnisse unterscheidet der Autor sich keineswegs von seinem Leser. Im Gegenteil: er macht sich selbst zur exemplarischen Figur, in der man sich wiedererkennen darf und soll: „ich bin, aber das bloß, insoweit das Spezifikum unspezifisch erscheint: Günter Kunert als Günter Jedermann“. Zudem wird der Text von einer passiven Grundhaltung beherrscht: während der Leser in den frühen Gedichten zum Handeln, zur Veränderung der Welt oder seiner selbst aufgerufen wurde, beschränkt sich Kunert nunmehr darauf, zu „mustern“ und zu „hören“. Kurz: das lyrische Ich ist vom Subjekt zum Objekt geworden, es betreibt nichts mehr, sondern wird getrieben.
Solche Gedichte sind eine Einladung zur Meditation. Darin liegt ihre Aufgabe, die zugleich ihre unersetzbare Stärke ausmacht. Um es mit einem Wort Paul Celans zu sagen: „La poésie ne s’impose plus, elle s’expose.“ („Die Dichtung setzt sich nicht mehr durch, sie setzt sich aus“) – und daß mittlerweile Gemeinsamkeiten zwischen Celan und Kunert zu entdecken sind, belegt noch einmal, welche immensen Veränderungen sich in dessen Lyrik seit ihren Anfängen vollzogen hatte. In unserer technokratischen, von anonymen Wirtschafts- und Verwaltungsapparaten geprägten Gegenwart wird das Gedicht, wie Kunert es nun versteht, zum mikroskopisch kleinen, aber doch allumfassenden Gegenentwurf einer anderen, humaneren Welt.
Seine Sache ist die Verstörung […] wenn [es das] Einverständnis mit der Welt erschüttert, dann hat es eine Leistung vollbracht, die für ein derart winziges Gebilde aus wenigen Zeilen gigantisch ist.
In einer Zeit, in der jeder und alles der instrumentellen Vernunft unterworfen ist und allein nach der Funktionalität der Dinge wie der Personen gefragt wird, definiert Kunert die Lyrik als eines der letzten Reservate unangetasteter Individualität. Das „Bewußtsein“ seiner Gedichte entzieht sich jetzt konsequent dem Nützlichkeitsdenken: er versucht den Leser nicht mehr zu überzeugen, sondern zum Zeugen unserer Lebenssituation zu machen. Es geht ihm darum, den Menschen als Ganzes, als in sich widerspruchsvolle Einheit in den Blick zu bringen, samt seiner selbstproduzierten und dennoch zutiefst selbstverletzenden Beziehungen zur Gesellschaft. Kunerts Lyrik bietet den Zeitgenossen die Gelegenheit zu etwas selten Gewordenem: zur Selbstbegegnung.
Es ereignet sich […] solchermaßen im Gedicht auch Heimkehr nach langem Umherirren […]. Im Ich des Gedichts erscheint […] das unverkrüppelte, vollkommene, wenn auch ewig unvollkommene Individuum – ein Windhauch aus Utopia. Sich als Individuum zu erfüllen, so weit wie möglich der eigenen Deformationen einsichtig werden und sie zu korrigieren suchen: ein faktisches wie phantastisches Ziel, eines wenigstens, das die Lyrik dem zielbangen Leser zeigen und mit dem er sich identifizieren kann.
Diese Poesie wird folglich nicht zu einem Fluchtort außerhalb der Realität, in einer weltabgewandten, lebensfremden Traumsphäre. Vielmehr läßt sie, gerade weil sie sich zweckorientiertem Denken entzieht, jene Verluste erkennen, die unsere industrielle Zivilisation dem Einzelnen zufügt. Das Gedicht übernimmt für ihn – wie Theodor W. Adorno, an dessen ästhetische und kulturkritische Theorien sich Kunert seit dem Ende der siebziger Jahre anlehnt, es formuliert hat die Rolle einer „geschichtsphilosophischen Sonnenuhr“, die durch ihren Schattenwurf anzeigt, welche Stunde uns geschlagen hat: und es ist, daran läßt Kunert längst keinen Zweifel mehr, schon fünf Minuten nach zwölf.
Denn unsere Abhängigkeit von den Systemen hindert uns, die Systeme aufzugeben. Obwohl wir wissen, was sie uns zufügen, wie sie uns zurichten und abtöten, sind wir ihnen dennoch verfallen. Wir versinken auf Nimmerwiedersehen in der Abhängigkeit von Regelmechanismen, die wir selber geschaffen haben.
Eine allgemeine Emanzipation, wie er sie persönlich durchlebte, hält er nicht mehr für möglich. Mag sein, daß sich hier ein haarfeiner Riß durch Günter Kunerts sonst konzise Argumentation zieht.
3
Inmitten dieser umfassenden Wandlungen des Lyrikers Günter Kunert steht quer durch die Jahrzehnte unberührt ein Motiv von schillernder, verstörender Macht. Es erscheint mit solcher Kraft und Ausstrahlung, daß man von einer Besessenheit sprechen muß: Kunert spielt es durch in ungezählten Nuancen, lädt es mit den unterschiedlichsten Bedeutungen auf, entfernt sich von ihm, indem er es schwach und immer schwächer anklingen läßt, um dann doch stets wieder zu ihm zurückzukehren. Vermutlich ist dieses Motiv aufs engste mit Kunerts poetischer Produktivkraft verbunden, vielleicht treibt es sie an, wie eine Unruh die Uhr.
Die unaufhaltsame Versteinerung des Lebens und, darauf folgend, die Verlebendigung der Steine – diese Topoi sind zum unverkennbaren Merkmal Kunertscher Lyrik und Prosa geworden. Bereits in den drei hier eingehender untersuchten Gedichten kann man jene eigentümliche Verknüpfung nachweisen: da gibt es „Stubenecken“ und „dunkle Winkel“, die sich „erinnern“; ein Mensch verwandelt sich in ein „Denkmal“ mit einem „Kopf aus Marmor und einem Herz aus Kalkstein“; und die „Tiefseemuschel“ wird als „Hülle“ des Lebens angesprochen. Liest man Kunerts Texte – gleich welcher Entstehungszeit – in Hinblick auf dieses Motiv, erkennt man, welche atemberaubende Phantasie dieser Autor im Wenden und Wandeln, Variieren und Transponieren des immer gleichen Grundschemas entwickelt.
In seinem „Versuch über meine Prosa“ hat er eine Erklärung für diese sonderbare thematische Vorliebe angeboten:
Unsere sogenannten „zwischenmenschlichen“ Beziehungen sind seit dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts durch zwei Aspekte bestimmt: Anonymität und Verdinglichung […]. Dieser Anonymität und Verdinglichung adäquat ist die sprunghaft gewachsene Bedeutung der Dinge, der Gegenstände selber, die nun zu einem Teil an die Stelle einstmals menschlicher Beziehungen getreten sind, […] die Dinge, gleich welcher Größenordnung, [sind] nichts anderes […] als geronnene soziale und gesellschaftliche Beziehungen, was besagt, daß sie, die Gegenstände, befragt man sie nur ernsthaft genug, über diese Beziehungen Auskunft geben […]. Der Gegenstand […] verwandelt sich, nimmt anthropomorphe Züge an […]. Indes die Menschen zu Dingen […] werden, aber trotzdem menschliche Aktivität behalten und ausüben.
Gewiß: diese Eigen-Interpretation – hinter der die Grundgedanken der marxistischen Entfremdungstheorie leicht auszumachen sind – läßt die meisten Kurzgeschichten Kunerts und manche seiner Gedichte transparenter erscheinen: wenn es etwa in einem der frühen „Berliner Lieder“ heißt, „Unsre Städte hier sind unser Manifest. / Lest die Zeilen und die Sätze unsrer Straßen“. Oder – um ein spätes Beispiel zu nennen – wenn „Kohlenplatzarbeiter“ sich dem von ihnen geschürften Erz lyrisch anverwandeln:
Irgendwann hat das Karbon
sie überwältigt und gibt
sie nie mehr frei.
Kunerts Selbst-Deutung sind aber auch Grenzen gesteckt: man täte ihr Gewalt an, wollte man sie auf jene zahlreichen Gedichte anwenden, in denen von Versteinerungen die Rede ist, die auf natürlichem Wege entstanden sind. Denn Entfremdung, wie sie von Marx definiert wurde, entsteht durch menschliche Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen, die denen der Natur diametral entgegengesetzt sind. So läßt sich Kunerts „Spiegelblick“, der „Auf dem Schädeldach: Erosion: / Kahler Fels: porös“ entdeckt, als Metapher der Verdinglichung des Menschen lesen. Die folgende, abschließende Strophe aber kaum noch:
Fossilien, ehe sie das Museum verschlingt,
waren einst lebenslüsterne Tiere,
jung als ihre Welt jung gewesen
oder es ihnen so schien.
Zudem gilt die Entfremdung allgemein als zerstörerische Kraft, bei Marx ist sie die wesentliche Ursache für alle wichtigen menschlichen und gesellschaftlichen Leiden der Neuzeit. Kunert dagegen benutzt das Bild der Versteinerung gelegentlich in unmißverständlich positivem Zusammenhang:
Selber Fels sein.
Stillstehen mit der gewesenen Zeit:
[…]
Platz nehmen im Parco di Monstri
unter schweigenden Ungeheuern
aus behauenem Gestein.
Einer der ihren werden
halb in der feuchten Erde geborgen
[…]
Dableiben. Hierbleiben.
Kristallinisch
solcher Landschaft sich innig verbinden:
wenigstens vorübergehend
unsterblich sein.
Kunerts Lieblingsmotiv entfaltet so eine beunruhigende Ambivalenz. Das Versteinern des Menschen erscheint als anziehender oder auch abstoßender, immer aber als faszinierender Vorgang, der dem Autor keine Ruhe läßt. Die positiven Variationen auf dieses stets gleiche Thema wurden von Literaturwissenschaflern mit einem anderen typischen Kunert-Sujet in Verbindung gebracht: vor allem in seiner Prosa, aber auch in der Lyrik beschäftigt er sich wiederholt mit verschiedenen Formen erstarrter Erinnerung – mit alten Fotos, fixierten Tagträumen oder phantasierten Tableaus. Diese Bilder geben sich – wie die Versteinerungen – als verfestigte Zeugnisse des vergangenen Lebens zu erkennen: eines zumeist angenehmen Lebens, zu dem sich der Autor zurücksehnt, das er aber zugleich auch als symbolischen Entwurf einer menschlicheren Zukunft empfindet. Mithin kann man diese Ideal-Vorstellungen – im Sinne von Blochs Philosophie der Hoffnung – als Vor-Schein der besseren Welt in der Literatur betrachten.
Diese Interpretation entschärft Kunerts Obsession allerdings, denn sie gilt unbestreitbar den Stein-Menschen und nicht jeder beliebigen Art der Erstarrung. So ist es bezeichnenderweise nicht irgendein metallischer Roboter oder der aus Leichenteilen zusammengesetzte Frankenstein, der Kunert als Kind „bis zu tiefen Verängstigungen bewegt hat“, sondern Gustav Meyrinks „mystisch nacherzählte Legende vom Golem“, einem aus Lehm geformten Monstrum. Er schreibt über die „Medusa“, deren Anblick ihr Gegenüber zu Stein werden läßt, und über „Pygmalion 1978“, der – im Gegensatz zu seinem klassischen Vorbild – ein lebendes Modell in eine Marmorstatue verwandelt, über die Salzsäule von Sodom und die mit Gips ausgegossenen Hohlformen von Pompeji, über Menschen, die zu ihrem eigene Denkmal gefrieren, und über den Wunsch, sich den Steinfiguren von Bomarzo anzugleichen, über Fossilien und Kalk-Skelette, über Knüppeldämme aus Knochen und den Schatten, den ein verglühter Bewohner Hiroshimas auf einer Betonwand hinterließ.
Vor allem die letzten Zitate lassen ahnen, was sich hinter Kunerts markanter Leidenschaft verbirgt: der Tod. Die Steine werden zur Metapher für die Endstation des Lebens für den endgültigen Stillstand. Nicht die Gebeine, sonder nurmehr die Sedimente bewahren die letzten Zeugnisse unserer Existenz. So verstanden ist die Versteinerung des Menschen tatsächlich mit schicksalhafter Gewißheit vorgezeichnet – und alles Grauen und innere Zerrissensein, das angesichts dieses unentrinnbaren Weges aus dem Gedichte spricht, erscheint nur zu verständlich. Zugleich birgt der Tod aber auch die zeitlose Ruhe der Steine. Mit dem Sterben ende nicht nur jede Aktivität, sondern auch jeder Mangel, der die Aktivität erst hervortrieb. Es ist auch eine Ankunft nach lebenslangem Suchen. „Dableiben. Hierbleiben“ heißt es in dem dunkel lockenden Poem „Verlangen nach Bomarzo“. Erst als Versteinerung ist das Leben unwiderruflich bei sich angekommen, ist es mit sich eins geworden. Rasende Todesangst und inbrünstige Todessehnsucht sind in Kunerts Lyrik zwei Seiten der gleichen Medaille, zwischen diesen Polen oszillieren seine Gedichte. Der Tod lastet als Alpdruck auf jedem Wort, er gibt sich aber auch als letztes Ziel zu erkennen, auf das alles zuläuft. Er wird zur Utopie mit negativem Vorzeichen, zur schwarzgefärbten Wunschwelt, denn auch er bietet – definitive – Einkehr, und also das, was Günter Kunert niemals hatte: eine, wenn auch steinerne, Heimat.
Uwe Wittstock, Nachwort
Die Literatur hat die Funktion einer Prothese
– Gespräch mit Günter Kunert über Kostproben kommender Katastrophen und die Notwendigkeit von Enttäuschungen sowie den zwielichtigen Charakter der Poesie. –
Uwe Wittstock: Ihre frühen Gedichte appellierten unübersehbar an die Vernunft der Leser, versuchten sie zu belehren und zu erziehen. Sind Sie mit dieser aufklärerischen Literatur-Konzeption gescheitert?
Günter Kunert: Ja, absolut. Aber genau genommen war das gar nicht ,meine‘ Konzeption. Es war das Ergebnis verschiedener Lesefrüchte. Ich habe schon sehr früh in meiner Jugend die emanzipatorisch intentionierten deutschen Autoren gelesen, von Heine bis Tucholsky. Deshalb war mir, als ich anfing zu schreiben, dieser Gestus sehr nahe. Ich wollte den Leuten mit Witz die Wahrheit sagen und sie sozusagen zum Besseren bekehren. Das ist aber, wie ich später einsah, leider nicht möglich.
Wittstock: Die Gedichte, die sie heute schreiben, folgen einer ganz anderen Konzeption. Um es auf eine Formel zu bringen: Die Texte können dem Leser Gelegenheit zur Selbstbesinnung bieten. Trauen Sie dieser Form der Lyrik eine größere Wirksamkeit zu?
Kunert: Ich rede ungern von der Wirkung oder der Wirksamkeit der Literatur. Das klingt immer so nach Knopfdruckmechanismus. Nach dem Motto: Hier liest einer etwas und daraufhin öffnet sich sein Bewußtsein, er ist plötzlich aufgeklärt, oder er fühlt etwas Bestimmtes, was ihm zuvor verschlossen blieb. An all das glaube ich nicht. Ich vermute vielmehr, Lyrik kann einem – und dies habe ich an mir selbst erlebt – einen Zugang zur eigenen Person vermitteln. Allerdings nicht zur Totalität der eigenen Person. Wie ein kleiner Spalt öffnet sich da für den Leser ein Türchen, durch das er in eine zuvor unbekannte Kammer im eigenen Inneren eintreten kann. Man blickt durch das Gedicht wie durch ein Schlüsselloch in sich hinein und entdeckt – mit etwas Glück – etwas Ungeahntes, Neues. Das kann die Literatur. Allerdings muß dies nichts Bleibendes sein. Wir Menschen sind sehr unstete Gestalten. Wahrscheinlich können wir auch wesentliche Eindrücke gewöhnlich nur flüchtig festhalten.
Wittstock: Setzen Sie sich mit dieser Literatur-Konzeption nicht dem Verdacht aus, lediglich von unserer gar zu unbehaglichen Gegenwart ablenken zu wollen?
Kunert: Ich meine nein. Das muß nicht sein. Der Leser von Lyrik kann sich ja durch das Gedicht als ein gesellschaftlich bedingtes Geschöpf erkennen. Natürlich hängt dies von dem Gedicht ab, das er liest. Gesetzt den Fall er liest ein Liebesgedicht: So wird er sich durch diesen Text – wenn er sich ernsthaft mit ihm auseinandersetzt – vielleicht ein wenig klarer über seine eigene Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Liebe, über die eigene Kälte oder Leidenschaft. Wenn das Gedicht dagegen politische Bezüge in den Mittelpunkt stellt, besteht die Chance, daß sich der Leser – wenn er sich wirklich auf sie einläßt – deutlicher als ein geschichts- und gesellschaftsbedingtes Wesen erkennt. Dazu muß man nicht erst Brecht mit erhobenen Zeigefinger lesen. Das gelingt ebensogut, vielleicht sogar besser einem anderen grandiosen Dichter der mir gerade einfällt: Cesar Vallejo. Er war Anfang der siebziger Jahre eine Kultfigur der deutschen Linken. Heute hat man ihn wieder nahezu vergessen. Aber er ist ein ganz starker, großartig symbolstarker Dichter, dessen Symbole immer auf die Gesellschaft zielen.
Wittstock: In Ihren Essays beschreiben Sie die Situation, in der wir leben, als äußerst bedrohlich. Müßte die Literatur in einer solchen Situation nicht auch mit ihren bescheidenen Mitteln nach einer Rettung suchen? Wären dann Einladungen zur lyrischen Meditation nicht doch so etwas wie Flucht vor der Realität?
Kunert: Das sind zwei Fragen, die zwei Antworten nötig machen. Einerseits glaube ich nicht, daß Literatur in einer bedrohlichen Situation überhaupt etwas ausrichten kann. Auch nicht mit aufklärerischen Mitteln. Könnte sie dies, wäre Literatur heute überflüssig. Denn wir sehen heute vor uns zweitausend Jahre europäischer Literatur, die ja nicht nur Blümchen- oder Mondgedichte hervorbrachte, sondern ungezählte und hervorragende Werke, die auf nahende Katastrophen hinwiesen, vor Krieg und Unvernunft warnten und dennoch nichts bewirkt, nichts verhindert haben. Unser Jahrhundert ist da ein gutes Beispiel: Die Expressionisten haben den Ersten Weltkrieg und die radikalen sozialen Umwälzungen, die er mit sich brachte, vorausgeahnt und auf ihre Weise formuliert. Geändert hat das nichts. Und vor 1933 hat die linke Literatur, die damals eine große Leserschaft hatte, sich die Kehle heiser geschrien, um vor dem Nationalsozialismus zu warnen. Dies alles hat nicht geholfen. Das beweist uns, daß auch eine Literatur, die aufklärerisch, polemisch und warnend über die Bedrohtheit unserer Welt spricht, nicht in der Lage ist, die Gefahren zu reduzieren.
Warum nicht? Weil Literatur eine höchst ambivalente, zwielichtige Geschichte ist. Es ist ja nicht so, daß aufklärerische Literatur einfach nur aufklärt. Im Gegenteil: Ich bin der Überzeugung, daß die Literatur – und das ist fatal – eine Ersatzfunktion übernimmt. Sie liefert dem Leser auch ein Alibi für seine politische Untätigkeit, für seine Passivität und Ignoranz. Ein gutes Beispiel sind hier Brechts Stücke: Die Zuschauer gehen ins Theater, schauen sich – meinetwegen – die Tage der Commune an, sind begeistert, klatschen, gehen dann nach Hause, legen sich ins Bett, haben ihre Revolution erlebt, und das wars. Das ist ein Wesensmerkmal der Literatur. Sie zeugt oft von den besten Absichten des Autors, erreicht aber zugleich das Gegenteil: Sie wirkt wie ein Sedativ. Literatur hat, meine ich, einen Protheseneffekt. Sie ist Ersatz für nicht gelebtes Leben. Man kann sich eine Menge mögliche, vielleicht sogar notwendige Aktivität ersparen, wenn man viel liest. Darum hat Literatur nie etwas verhindern können. Die Wirklichkeit war immer übermächtig.
Um zur zweiten Frage zu kommen: Bedeutende Literatur hat niemals die Flucht nach Innen forciert. Nehmen wir als Beispiel eine stark psychologisierende Literatur, wie Marcel Proust sie schrieb. Seine Romane verführen nicht zum Rückzug aus der Welt. Im Gegenteil: Sie analysieren das Seelenleben der Romanfiguren mit solcher unglaublichen Scharfsicht, daß sie auch den persönlichen Innenraum des Lesers ein bißchen heller machen. Durch sie kann er die eigenen Schwächen, die eigenen pathologischen Züge kennenlernen. Doch sollte man sich auch diesen Prozeß nicht zu einfach vorstellen. Er vollzieht sich sicher meist ganz unbemerkt, unterhalb unserer Wahrnehmung. Wenn Literatur wirkt, dann wirkt sie doch wohl eher auf die weltabgewandte Seite unserer Seele, auf unser verschlossenes Bewußtsein, auf das Unbewußte.
Wittstock: Wenn Literatur tatsächlich wie ein Sedativ wirkt, dann müßten Sie den Schriftsteller wohl oder übel als Drogen-Dealer bezeichnen. Oder um bei dem anderen Bild zu bleiben, das Sie benutzten: Warum handeln Sie mit Prothesen?
Kunert: Gewiß, ich müßte mich als Drogenhändler betrachten, wenn ich auf Wirkung hin schriebe. Das tue ich aber nicht. Ich schreibe meine Gedichte nicht für andere, nicht fürs Publikum. Ich schreibe sie ja für mich, sie sind für mich ein Moment der Selbstverständigung. Ich benutze das Schreiben als ein Instrument zur Selbst-Auslotung. Natürlich möchte ich, daß diese Gedichte auch für den Leser zu einem Mittel der Selbstverständigung werden können. Aber das kommt erst an zweiter Stelle. Allerdings wäre es für mich tatsächlich Drogenhandel, wenn ich markerschütternde, pathetisch Fäuste schüttelnde Gedichte machte, die man emphatisch und begeistert lesen kann, die aber dann von der Zeitgeschichte unfehlbar in irgendeinem Keller abgeheftet und vergessen werden.
Wittstock: In Ihren Aufsätzen zeichnen Sie die Gegenwart und vor allem die Zukunft schwarz in schwarz. Zugleich geht es uns aber besser als je zuvor. Wie geht das zusammen?
Kunert: Wen meinen Sie mit „uns“? Ich glaube, man muß da eine kleine, aber notwendige Einschränkung machen. Es geht uns hier in Westeuropa – oder auch den Menschen in Nordamerika besser als allen unseren Ahnen und Vorfahren. Aber wir machen es uns bequem auf Kosten des anderen, größten Teils der Menschheit. Auch dies ist wiederum ein Anlaß, schwarz zu sehen. Denn dieser Zustand kann nicht von Dauer sein. Es gibt keine überwältigende Majorität, die sich auf Dauer das Brot vom Munde wegnehmen läßt. Insofern ist unser augenblickliches Wohlleben nur eine Lüge. Ich glaube auch, daß wir das bis zu einem gewissen Grade spüren. Die Literatur zumindest spürt es und wahrscheinlich mit ihr viele andere Leute. Alles was wir heute haben, ist nur geliehen, und irgendwann müssen wir es zurückgeben. Wir haben auf eine etwas undurchsichtige Weise einen großen Kredit aufgenommen, den wir irgendwann zurückzahlen müssen. Das wird ein schmerzlicher Tag.
Wittstock: Solche Kassandra-Rufe sind zu Ihrem Markenzeichen geworden. Besteht nicht die Gefahr, daß die Leser Ihre Bücher inzwischen mit einem – vielleicht gar angenehmen – Gruseln lesen, daß sie sie gleichsam als Horror-Literatur konsumieren, so wie andere Leute Horror-Videos?
Kunert: Das weiß ich nicht, und das läßt sich wahrscheinlich auch kaum nachprüfen. Aber selbst wenn: Es wäre für mich kein Grund, meine Weltsicht zu ändern. Ich kann nicht nachrechnen, ob da drei, fünf oder auch fünfzig Leute meine Gedichte falsch lesen, um daraufhin den Entschluß zu fassen: Von jetzt an schreibe ich nur noch ganz optimistische Verse. Vor Mißbrauch oder falschen Interpretationen ist kein Autor sicher. Das muß man hinnehmen.
Wittstock: Ein Aperçu sagt: Wer in seiner Jugend nicht an die Revolution glaubt, hat kein Herz. Wer im Alter immer noch an sie glaubt, hat keinen Verstand. Sind Sie in diesem Sinne ein Mann mit Herz und Verstand?
Kunert: Ich müßte mich selber loben, wenn ich dem ohne weiteres zustimmte. Ich bin sicher jemand mit einem mehr oder minder reduzierten Herzen und einem mehr oder minder reduzierten Verstand. Sonst wäre diese Welt ohnehin nicht zu ertragen. Mit einer unbeschädigten Seele wäre das alles nicht ansehbar. Und mit einem umfassenden Verstand könnte man gleich aus dem Fenster springen. Bis zu einem gewissen Grad muß man emotional und rational beschränkt sein, um leben und auch schreiben zu können.
Wittstock: Meine Frage hat freilich einen Haken. Ihr Werdegang scheint doch kein Einzelfall zu sein. Vielmehr entspricht er offenbar einem Stereotyp unseres Jahrhunderts, sonst wäre er wohl kaum zum Aperçu geronnen. Ihr Lebensweg vollzieht also ein altes Muster nach. Liegt in dieser Erkenntnis nicht ein heimliche Hoffnung?
Kunert: Warum das?
Wittstock: Vielleicht ist dies ja nur ein Stereotyp der Selbsttäuschung: Der individuelle Blick in die Zukunft ist immer skeptisch. Jedermann denkt, mit ihm – mit seinem Tod – kommt die Geschichte an ihr Ende. Aber schließlich geht’s auch ohne ihn weiter.
Kunert: Daß sich da ein altes Muster vollzieht, will ich gar nicht abstreiten. Nur breitet sich der Stoff, auf dem das Muster erscheint, inzwischen immer weiter aus. Wenn in alten Zeiten vom Weltuntergang die Rede war, dann war letztlich doch nur Sachsen gemeint, oder Münster, oder Florenz, oder meinetwegen Santorin. Unbewußt haben diese Untergangs-Visionäre vergangener Zeiten fest an das Überleben der Menschheit geglaubt, denn andernorts blieb ja alles bestehen. Unsere Skepsis heute – und ich spreche von „unserer“, weil der Zweifel am Fortbestand der Menschheit allmählich immer weitere Kreise zu ziehen beginnt – hat einen qualitativ und quantitativ anderen Charakter. Es ist eben nicht mehr nur das Rote Meer oder der Ausbruch des Vesuvs, es ist nicht nur der Dreißigjährige Krieg oder der Zweite Weltkrieg der uns bedroht, sondern es ist eine globale Durchgiftung und Zerstörung im Gange von der Stratosphäre bis tief in den Boden. Sie ist für uns in diesem Ausmaß nur noch nicht sichtbar geworden. Die abgestorbenen Bäume werden abgehackt. Und die Lehrpfade über das Waldsterben, die man gelegentlich stehen läßt, sind doch nur harmlose Kostproben der ganzen Katastrophe. Solange wir das nicht begreifen, können wir uns weiterhin einreden, alles bliebe beim alten. Doch es ist inzwischen ein grundsätzlich anderer Zustand erreicht, wie es ihn noch niemals gegeben hat.
Einerseits lernen wir Menschen ja nie etwas aus unseren Irrtümern oder Fehlern und aus Katastrophen schon gar nicht. Wir siedeln immer wieder auf dem Vulkan. Ich habe neulich einen Satz gelesen, der vielleicht vertrackt klingt, aber genau sagt, worum es geht:
Der kognitive Horizont des Menschen ist genetisch beschränkt.
Das heißt nichts anderes, als daß wir gar nicht in der Lage sind, abzusehen, was wir anrichten, mit dem was wir tun. Wobei das Problem nicht darin besteht, eine Gefahr zu erkennen, denn Gefahren liegen ja meist auf der Hand. Zum Beispiel die Nordsee-Verschmutzung: Jeder weiß und kann sehen, was wir dem Meer und den Fischen dort antun. Aber das hindert die Anrainer-Staaten keineswegs daran, ihren Dreck weiter in die Nordsee zu kippen. Sie schließen einfach die Augen vor den Folgen ihres Tuns.
Die Menschen sind offenkundig nicht in der Lage, projektiv zu denken – oder zumindest nicht fähig, nach den Erkenntnissen ihres projektiven Denkens zu handeln. Das Auto wurde jetzt hundert Jahre alt. Vor hundert Jahren war es lediglich ein Bestandteil der Witzblätter. Man machte sich lustig über dieses ulkige Gefährt, die Fahrer trugen Ledermäntel, merkwürdige Hauben und eine große Brille. Man nannte es Töfftöff und fand es kurios. Niemand hätte damals geahnt, daß das Auto einmal zu den großen Zerstörern unseres Planeten zählen wird. Genauso wissen wir heute nicht, wozu sich das entwickelt, was zur Zeit erfunden oder benutzt wird. In Günther Anders Buch Die Antiquiertheit des Menschen steht ein Satz, den ich für sehr richtig halte, auch wenn er etwas biblisch gefaßt ist:
Vielleicht bekämpfen wir den Teufel in einem Zimmer, in dem er schon gar nicht mehr ist.
Vielleicht sind all unsere gegenwärtigen Sorgen mit der Kernkraft, der Zerstörung der Ozonschicht, der Vergiftung der Flüsse, vielleicht sind diese Probleme, die wir bereits nicht mehr zu lösen imstande sind, nur das Vorspiel zu viel größeren, die wir noch gar nicht kennen. Die chemische Industrie bringt jährlich zigtausend neue chemische Verbindungen auf den Markt. Es ist nicht bekannt, was mit ihnen in hundert Jahren sein wird. Wenn ich heute lese, daß bereits jeder achte Amerikaner unfruchtbar ist, dann liegt die Vermutung nahe, daß dies an der hohen chemischen Verschmutzung seiner Umwelt liegt.
Diese Nachricht wirft übrigens ebenfalls ein beunruhigendes Licht auf unsere Zukunft: Ich halte eine militärische Vernichtung unseres Planeten für unwahrscheinlich. Ich bin vielmehr der Überzeugung, daß wir uns auf eine ganz unauffällige Art von diesem Planeten verabschieden werden. Wir verlieren offensichtlich mit der Zeit unsere Reproduktionsfähigkeit. Noch erleben wir ja diese wahnsinnige Bevölkerungsexplosion: Zur Zeit gibt es schon fünf Milliarden Menschen, in dreißig Jahren sollen es sieben oder acht Milliarden sein. Dann wird wohl der Ratteneffekt, oder um es freundlicher zu sagen, der Feldmauseffekt eintreten. Den kann man bei uns auf dem Land sehr gut beobachten: Wenn die Feldmäuse in einem Jahr überhand nehmen, gibt es im nächsten Jahr keine einzige mehr. Uns wird es nicht anders gehen.
Wittstock: Der Gattung der Feldmäuse scheint dieser Effekt allerdings nur wenig auszumachen?
Kunert: Es gibt immer noch Feldmäuse, sicher. Aber auf einem bestimmten Feld sind sie zunächst einmal ausgestorben. Später wandern sie von anderen Feldern, auf denen die Population nicht überhand genommen hatte, wieder zu. Den Menschen steht aber nur ein Feld zur Verfügung. Von wo sollten wieder welche zuwandern, wenn sie auf diesem aussterben? Aber es gibt ja nicht nur zu viele Menschen, sie produzieren auch zu viele Bedürfnisse. Jeder von ihnen will ja auch ernährt werden. Das zwingt dazu, den Boden immer stärker auszubeuten. Oder auf technischem Wege künstliche Nahrung zu produzieren. Aber auch dies ist nicht grenzenlos möglich. Ich glaube, wir sind seit dem Neandertaler auf einen Weg geraten, den wir nicht mehr verlassen können, der durch immer größeren Einfallsreichtum noch ein wenig verlängert werden kann, der aber doch recht bald zu einem Ende führen wird.
Wittstock: In Ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen beschreiben Sie den Verlust Ihrer politischen Hoffnungen als den Preis für den Weg von der Fremd- zur Selbstbestimmung. Zugleich unterstellen Sie aber Ihren Mitmenschen, daß sie weiterhin in Fremdbestimmung verharren, daß sie nicht zur Selbstbestimmung vordringen werden. Halten Sie sich folglich für einen besonderen Menschen?
Kunert: Vielleicht hängt es mit der kreativen Tätigkeit zusammen. Diese Vermutung ist nicht neu. In den sechziger Jahren, glaube ich, wurde sie als die einzige nicht entfremdete Arbeit bezeichnet – auch so eine Formulierung, die längst keiner mehr benutzt. Es spricht keiner mehr von Entfremdung, eigenartigerweise, obwohl sie doch weiterbesteht. Selbstbestimmung kann wohl nur im kreativen Bereich durchgesetzt werden. Alles andere ist doch zumindest durch das Kollektiv kanalisiert, gelenkt und auch deformiert.
Wittstock: Sind Künstler für Sie also besondere Menschen?
Kunert: Nein, nicht besondere Menschen, daß wäre unsinnig. Ich halte sie für Menschen, die sich in einer günstigeren Ausgangsposition befinden. Denn sie sind in der Lage, ihre Desillusionierungen fruchtbar zu machen. Das ist etwas, was der Einzelne in der Gesellschaft sonst nicht kann. Er hat bestenfalls die Möglichkeit, auf seine Enttäuschungen zu reagieren: Das heißt auf gut Deutsch, er kann entweder zum Zyniker oder zum Terroristen werden. Aber damit hat er sich dem sozialen Druck noch lange nicht entzogen. Er reagiert auf diesen Druck nur anders als geplant. Mit Selbstbestimmung hat das wenig zu tun.
Wittstock: Viele von denen, die heute fest mit dem kommenden Weltuntergang rechnen, glaubten früher ebenso fest an eine alles verändernde Weltrevolution. Andere dagegen, die nie solch hochgesteckte Hoffnungen haben, schauen heute zuversichtlicher in die Zukunft. Ist die Apokalypse für manche nicht geradezu ein Revolutions-Ersatz?
Kunert: Man macht es sich sicherlich zu einfach, wenn man unterstellt, da würde nur ein Glaube gegen den anderen ausgetauscht. Wer einmal gründlich enttäuscht wurde, ist eben hellhöriger als seine Mitmenschen. Wer aus dem Traum, eine humane Zukunft zu errichten, unsanft aufgeschreckt wurde, ist danach eben wacher als die anderen. Er sieht die Dinge kritischer und schärfer. Natürlich zeigen jene Leute, die nie von Hoffnungen geplagt und gejagt wurden, die also nie desillusioniert werden, auch späterhin nur mäßige Erregung, wenn sie die Welt betrachten. Ich glaube schon, daß man durch eine große Enttäuschung gehen muß, um einen klaren Blick zu bekommen. Dies ist genauso im Verhältnis der Menschen untereinander. Wenn man nie von einem Menschen enttäuscht wurde, wird man stets ein ziemlich naives Verhältnis zu ihnen behalten. Wer aber erst einmal von einem Freund im Stich gelassen wurde, wird daraufhin viel vorsichtiger sein, wird das Verhalten seiner Mitmenschen von nun an genauer beobachten. Insofern ist die Enttäuschung, wie die Psychologen sagen, eine Notwendigkeit des Erwachsenwerdens.
Wittstock: Kann es nicht doch sein, daß die unerfüllte Liebe zur endgültigen Revolution lediglich umschlägt in die Liebe zum Ende schlechthin?
Kunert: Nein, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Geschichte hat uns in diesem Punkt eine deutliche Lehre erteilt: Gerade die vielen Menschen, die in ihrer Jugend Hitler-Anhänger waren, haben sich nach dem Krieg sehr rasch den Ideen der neuen Machthaber verschrieben. Das heißt, sie wurden in ihrer Glaubensbereitschaft angesprochen. Es wurde ihr Wille zur Veränderung, ihre Begeisterung und Einsatzfreude für eine scheinbar unfehlbare Ideologie gefordert. Die Erwartung einer möglichen Apokalypse ist etwas ganz anders. Die verlangt keine Begeisterung, keine Liebe, denn dies ist ja keine erfreuliche Veranstaltung. Es ist eher die schmerzliche Erkenntnis eines Vorgangs, dem man sich selbst nicht entziehen kann. Es ist wie der Blick aus einem Eisenbahnzug, von dem der Lokomotivführer abgesprungen ist und der immer schneller bergab rollt, und man selbst kommt einfach nicht aus seinem Abteil heraus. Es ist zu erwarten, daß dies nicht gut ausgeht. Es ist nicht hundertprozentig sicher, und man kann auch nicht den exakten Zeitpunkt der Katastrophe prophezeien. Aber daß sie eintritt, ist sehr wahrscheinlich. Natürlich kann plötzlich ein deus ex machina kommen, also ein Hubschrauber, der einen neuen Lokomotivführer auf dem dahinrasenden Zug absetzt, der dann die Bremse zieht. Das ist möglich, aber weitaus unwahrscheinlicher. Wenn wir uns freiwillige Beschränkungen auferlegten, hätten wir wohl größere Überlebenschancen. Aber das ist eben das Unwahrscheinlichere. Solange alles Sinnen und Trachten weiterhin nur darauf abzielt, unsere Industrie-Zivilisation weiter wachsen und sich ausbreiten zu lassen, besteht keine Hoffnung.
Wittstock: Was treibt diese Entwicklung voran? Gibt es so etwas, wie einen kollektiven Todestrieb?
Kunert: Nein, das glaube ich nicht. Es ist meines Erachtens eher eine immer stärkere und wachsende Adaption des Menschen an die Maschine. Der Mensch wird durch die Industrialisierung immer stärker funktionalisiert, er funktionalisiert sich selbst immer mehr und betrachtet sich auch nur noch als ein funktionales Teil in einer übergreifenden Organisation. Wenn jemand zum Arzt geht, tut er dies, als wolle er ein Auto in die Werkstatt bringen. Er erwartet unbedingte Heilung, also eine folgenlose Reparatur und kann dann nicht begreifen, warum der Arzt ihm sagt, daß er mit seinen Leiden leben muß. Dies ist ja auch nicht einzusehen, wenn man sich selbst wie eine Maschine betrachtet. Da wartet man darauf, durch ein passendes Ersatzteil wiederhergestellt zu werden.
In der weiteren wie auch in unserer individuellen Umwelt spielt Naturwissenschaft, Mechanik und Technologie eine immer größere Rolle. Aber durch das Übermaß an Maschinen in unserer Umwelt werden wir selbst zur Maschine: Wenn wir mit einem Auto fahren, müssen wir anhalten, sobald ein rotes Licht erscheint. Wir reagieren wie Automaten. Wir werden zum Bestandteil unserer Maschinen. Und durch diese wachsende Funktionalisierung wird der Mensch immer stromlinienförmiger: Er verliert immer mehr von dem, was ihn zum Menschen macht und was sich eigentlich jener Funktionalisierung entgegenstemmen müßte. Diese sich selbst immer stärker beschleunigende Entwicklung ist auch eines der wesentlichen Momente, die keine Hoffnung mehr zulassen. Es wird keine Masse mehr geben, die plötzlich aufsteht und das erlösende „Nein“ spricht.
Wittstock: Die Literatur ist alles andere als funktional. Muß man sie mithin nicht als ein hervorragendes Mittel betrachten, um jene Funktionalisierung des Menschen zu unterlaufen? Ist die Poesie der Sand im Getriebe der modernen Welt?
Kunert: Nein, ich bin da der Meinung von Theodor Lessing:
Die Kultur ist der Deckmantel der Untaten.
Kunst kommt heute vielleicht nur noch aus einem eher schäbigen Grund eine besondere Bedeutung zu. Sie bewahrt jenen Rest des Menschen, der noch nicht völlig abgetan ist, sie erhält eine Erinnerung an jene menschlichen Eigenschaften, die uns heute abdressiert werden. Daran ergötzt sich der Leser, daran klammert er sich und davon läßt er sich trösten. Er bleibt also geduldig acht Stunden am Tag in seine Alltags-Maschine eingesperrt, arbeitet vor dem Computer oder am Steuerrad oder sonstwo, und dann liefert ihm die Literatur ein Feierabendgeläut, das dafür sorgt, daß er am nächsten Morgen wieder zur Arbeit antreten kann.
Wittstock: Ihre Argumente erinnern stark an die alten Thesen von der „Bewußtseinsindustrie“: Die Kultur sei nur dafür da, das Volk zu unterhalten und von seinen wirklichen Interessen abzulenken. Macht diese Theorie nicht den Fehler, Kunst und Showgeschäft in einen Topf zu werfen?
Kunert: Die Unterscheidung zwischen E- und U-Kultur, zwischen sogenannter „ernster“ und „Unterhaltungs-Kultur“ ist grauenvoll, ist eine Fiktion. Sie stimmt nicht, auch wenn alle von ihr reden. Natürlich ist es grobschlächtig, sich von Dallas- oder Denver-Sendungen für ein, zwei Stunden aus dem unerträglich langweiligen Alltag entführen zu lassen. Aber die große, bedeutende Literatur wird – wenn auch auf eine vertracktere, psychologisch vielschichtigere Weise – ähnlich rezipiert. Zum einen kann ich aus ihr den Gewinn ziehen, daß sie mir die Augen für mich selbst öffnet, daß ich durch sie einen Teil meines Inneren besser zu erkennen lerne. Zum anderen aber liefert sie mir auch ein komplexes Ersatzleben, bietet sie mir die Möglichkeit, aus mir heraus- und in dieses Kunstwerk einzutreten. Auch dies hilft mir die Eintönigkeit meines alltägliches Lebens leichter zu ertragen. Nehmen wir wieder ein historisches Beispiel: Wir dürfen nicht vergessen, wieviele deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg mit der kleinen Feldpostbücherei im Tornister in die Schlachten zogen. Sie haben in den Gefechtspausen Goethe, Rilke oder Lessing gelesen. Da sollte man doch denken, das ginge nicht zusammen: zuerst große Literatur lesen und hinterher ein paar Leute abknallen. Aber es geht zusammen, denn der Mensch hat ein sehr uneinheitliches Bewußtsein, und seine verschiedenen Schichten sind – wie bei Computer-Chips – nicht immer miteinander verbunden. So kann es geschehen, daß eine Schicht sich mit Kunst und Literatur beschäftigt, daß ihr dies Genuß bereitet und sie sich der Illusion hingibt, der Mensch würde auf diese Weise bereichert. Andererseits funktioniert der gleiche Mensch aber weiterhin wie ein kleiner Elektromotor, der irgendein Fenster hoch- und runterkurbelt.
Wittstock: Hatte Kunst immer diese Täuschungsfunktion? Oder hat sich das erst heute durch den Verlust an Zukunft und Utopie ergeben?
Kunert: Wahrscheinlich hat sie immer die Funktion gehabt, vorzutäuschen, Illusionen aufzubauen. Und zwar je bedeutender die Kunstwerke waren, desto wirkungsvoller – jetzt benutze ich mal dieses Wort – desto wirkungsvoller ist es ihnen gelungen, eine Scheinwelt zu errichten, der man sich beimengen, an die man sich hingeben, mit der man eins werden kann. Das ist – bei einem wirklich grandiosen Werk – eine regelrechte Kommunion: Ein Stück von einem selbst geht in dieses Werk ein und aus dem Werk strömt ein Stück in einem über – eben jene Illusion, daß man mehr sei als ein Regenbogen oder eine Ameise. Kunst hat immer und zu allen Zeiten als ein Instrument zur persönlichen Transzendenz gedient, also dazu das eigene Bewußtsein zu transzendieren. Davon abgesehen, haben die Kunstkonsumenten aber immer buisiness as usual betrieben, wie alle anderen Menschen auch. Unsere Klagen über die Wirkungslosigkeit der Kultur resultieren einfach aus einem Mißverständnis. Wir stellen immer die Forderung, die Literatur solle unsere Umwelt verändern. Das kann sie gar nicht. Sie kann nichts anderes, als uns lebensfähig machen, indem sie unser Bedürfnis nach Transzendenz befriedigt. Darüber hinaus macht uns die Literatur natürlich noch sprachfähig in besonderer Weise. Hier gibt es auch tatsächlich einen Unterschied zwischen E- und U-Literatur. Die Bücher, die wir lesen, prägen unsere verbale Ausdrucksfähigkeit. Jemand, der nur Konsalik liest, kann sich auch nur auf Konsalikschem Niveau mit anderen verständigen. Jemand der Kafka liest oder Walter Benjamin hat andere Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. In dieser Vertiefung der Sprachfähigkeit, die zugleich unsere Chancen erhöht, einander zu verstehen und miteinander zu einem Konsens zu finden, liegt vielleicht eine der Hauptaufgaben der Literatur.
Wittstock: Sie betonen, daß Sie nur für sich selbst schreiben. Dann bleibt allerdings die Frage offen:
Warum veröffentlichen Sie?
Kunert: Einerseits veröffentlicht ein Schriftsteller, weil er von etwas leben muß. Das ist ein ganz konkreter Grund. Er wird nicht von irgendwelchen Institutionen finanziert, also muß er seine Arbeiten verkaufen. Zum anderen wirkt die Veröffentlichung auf eine subtile Weise auf die Texte ein. Ein Manuskript ist etwas anderes als ein Buch. Ein Gedichtband nimmt für den Autor eine andere Bedeutung an als ein Konvolut mit handschriftlichen oder getippten Blättern. Das Buch hat sich vom Autor abgetrennt, es ist – um es mit einem großen Wort zu sagen – zu einem Kind geworden, das er in die Welt geschickt hat. Es hat sich abgenabelt, hat sich von seinem „Vater“ abgeschlossen. Unveröffentlichtes ist nie abgeschlossen. Eigenartigerweise. Ungedruckte Texte wird man nicht los. Man arbeitet weiter an ihnen, bewußt oder unbewußt. Sie machen einen unzufrieden. Das, was publiziert ist, ist vorbei und geschehen. Man sieht es nie wieder an, solange man nicht muß. Es ist abgeschlossen, es ist eine Entwicklungsstufe, die man hinter sich gebracht hat. Dann kann man aufatmen und etwas neues anfangen.
Dieser Effekt ist für mich, neben dem Honorar – aber viel Geld kann man mit Gedichten ja leider nicht verdienen –, der wichtigste. Natürlich ist es auch schön, daß die Leute dann die Gedichte lesen und diesen Prozeß von Selbstempfinden, Selbsterkenntnis oder Selbstsicht, der die Gedichte entstehen ließ, nachvollziehen können. Gewiß, das ist alles sehr schön. Ich bin ja auch ein Leser. Ich lese gern und viel. Aber das ist nicht das Primäre. Das Primäre ist für mich, daß ich an einem Tisch sitze und mich irgend etwas nicht los läßt. Eine Ahnung, ein unformulierter Gedanke. Mit manchen Dingen quäle ich mich sehr, weil da etwas ist, was ich nicht greifen kann oder noch nicht greifen kann. Das liegt da wie ein Klotz. Ich schreibe dann immer wieder, entweder an einem Gedicht, oder an verschiedenen Gedichten zu diesem Thema: zehn Gedichte, fünfzehn Gedichte. Ich komme dann damit nicht weiter. Der Klotz erdrückt mich. Ich bin dann ganz unglücklich. Bin schlecht gelaunt. Aufatmen kann ich erst, wenn ich den Stoff für dieses Gedicht wirklich mit dem Gedicht in den Griff bekommen habe. Dann ergibt sich eine gewisse eigentümliche, aber keineswegs dauerhafte Befriedigung. Mehr kann man wohl kaum verlangen.
Aus Uwe Wittstock: Von der Stalinallee zum Prenzlauer Berg. Wege der DDR-Literatur 1949–1989, Piper Verlag, 1989
Dagmar Hinze: Der Bruch mit der Utopie. Die Lyrik der 80er und 90er Jahre von Günter Kunert
Armin Zeissler: Notizen über Günter Kunert, Sinn und Form Heft 3, 1970
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Cornelia Geissler: Die Welt ertragen
Berliner Zeitung, 6.3.2009
Fred Viebahn: Ein unbequemer Dichter wird heute 80
ExilPEN, 6.3.2009
Reinhard Klimmt: Günter Kunert
ExilPEN, 6.4.2009
Hannes Hansen: Ein heiterer Melancholiker
Kieler Nachrichten, 5.3.2009
Renatus Deckert: „Ich bin immer noch naiv. Gott sei Dank!“
Der Tagesspiegel, 6.3.2009
Hubert Witt: Schreiben als Paradoxie
Ostragehege, Heft 53, 2009
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Peter Mohr: Die Worte verführten mich
lokalkompass.de, 3.3.2014
Schreiben als Selbstvergewisserung – Dichter Günter Kunert wird 85
Tiroler Tageszeitung, 4.3.2014
Wolf Scheller: Die Poesie des Melancholikers
Jüdische Allgemeine, 6.3.2014
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Reinhard Tschapke: Der fröhlichste deutsche Pessimist
Nordwest Zeitung, 2.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Ideale sind schlafen gegangen“
Thüringer Allgemeine, 4.3.2019
Günter Kunert im Interview: „Die Westler waren doch alle nur naiv“
Göttinger Tageblatt, 5.3.2019
Katrin Hillgruber: Ironie in der Zone
Der Tagesspiegel, 5.3.2019
Benedikt Stubendorff: Günter Kunert – 90 Jahre und kein bisschen leise
NDR.de, 6.3.2019
Matthias Hoenig: „So schlecht ist das gar nicht“
Die Welt, 6.3.2019
Tilman Krause: „Ich bin ein entheimateter Mensch“
Die Welt, 6.3.2019
Günter Kunert – Schreiben als Gymnastik
mdr.de, 6.3.2019
Peter Mohr: Heimat in der Kunst
titel-kulturmagazin.net, 6.3.2019
Knud Cordsen: Der „kreuzfidele Pessimist“ Günter Kunert wird 90
br.de, 6.3.2019
Studio LCB mit Günter Kunert am 1.4.1993
Lesung: Günter Kunert
Moderation: Hajo Steinert
Gesprächspartner: Ulrich Horstmann, Walther Petri
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zum Autor + DAS&D + Archiv +
Internet Archive + Kalliope + KLG + IMDb + Bibliographie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Günter Kunert: NDR 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Welt ✝ AA ✝ Zeit ✝ FR ✝
NZZ ✝ Tagesspiegel ✝ SZ 1 + 2 ✝ MDR ✝ nd 1 + 2 ✝
Günter Kunert bei www.erlesen.tv.


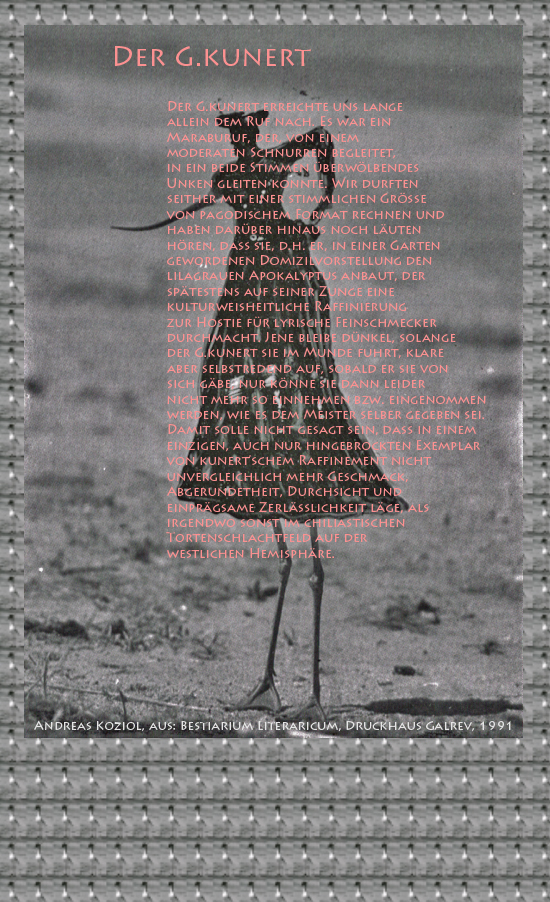
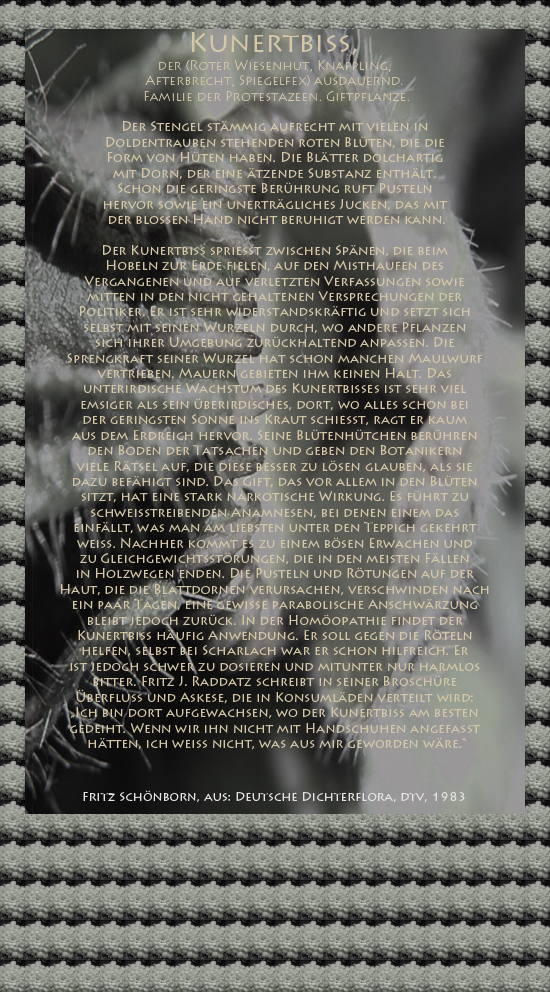
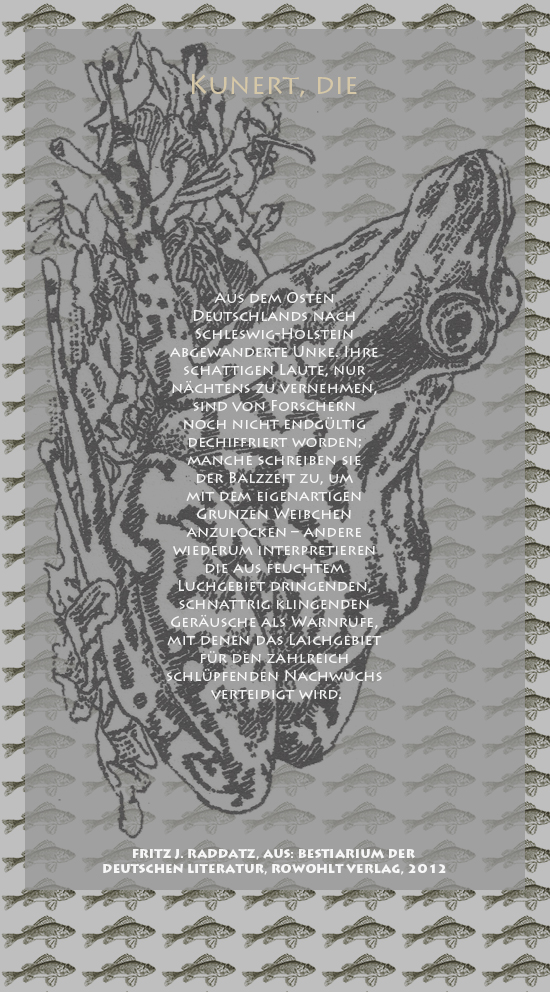
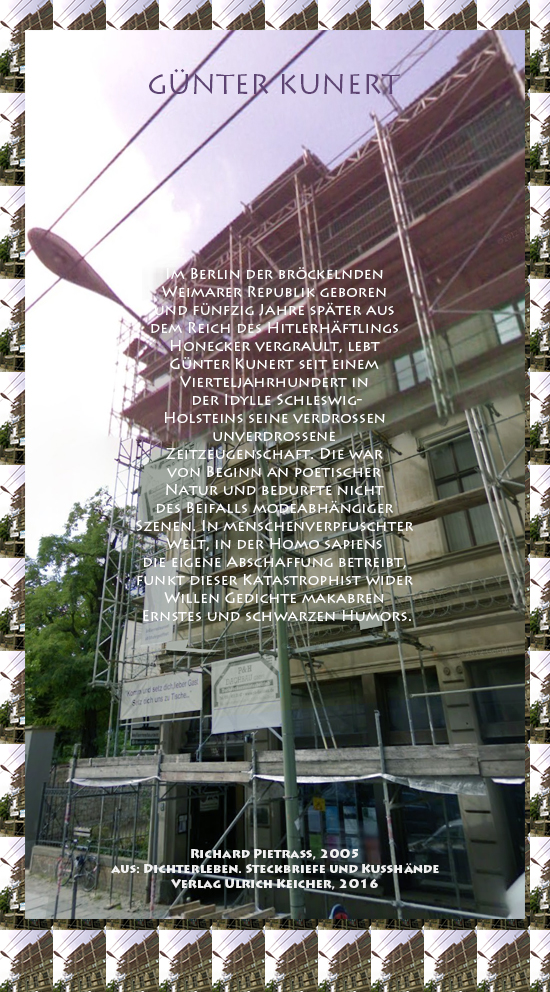












Schreibe einen Kommentar