Heinz Czechowski: Auf eine im Feuer versunkene Stadt
ENGEL
Die Dichter,
Steht geschrieben,
Hören den letzten
Paukenton, den Mozart
Nicht mehr aufschreiben konnte,
Den Flügelschlag
Der Engel über Paris und
Vor allem sich selbst.
Manche
Haben kein Geld,
Aber die Zeit,
Als man das komisch fand,
Ist vorbei.
Ich saß in Kleinzschachwitz,
Wir sahn an der Tanne im Zimmer vorbei
Auf den Schornstein des Holzschnitzers Dyrlich,
Aus dem sorglos der Rauch stieg.
Da sagte ich: Dyrlich
Verbrennt die mißlungenen Engel,
Doch der Dichter entgegnete: Selbst die
Macht er noch zu Geld.
Die Engel des Dichters
Sind harmlos-vergängliche Wesen.
Sie schweben wie Staub durch das Zimmer
Und entgleiten den Händen wie Geld.
Manche jedoch
Ähneln den Frauen und Mädchen,
Die sich zu des Dichters Geburtstag
im Garten verstreun. Andere wieder
Sind wirkliche Engel, aber
Auch nicht aus Holz.
Diese
Sammeln das Geld wieder ein,
Um nahrhafte Dinge zu kaufen,
Damit der Dichter
Den letzten Paukenton
Mozarts vernimmt oder
Das nächtlich knirschende Eis auf der Elbe
Und
Die Schritte der Engel
Im Schnee seines Gartens.
Die Stadt als Text
Das Gruppenbuch Bekanntschaft mit uns selbst. Gedichte junger Menschen (1961) zieht einen generativen Trennstrich in der Entwicklung der Lyrik, die sich nach 1945 auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik vollzogen hat. Gerhard Wolf hatte die „Zeichen der Zeit“ sehr früh erkannt, wenn er in seinem kurzen Begleittext prophezeite, daß sich in dieser Art lyrischer Selbstverständigung „auch die ersten Konturen einer künftigen Dichtung abzeichnen“. Der Bandtitel kann im nachhinein als Ankündigung des poetischen Programms einer neuen Lyrikergeneration gelesen werden, das auf Individualstil und Subjektivität setzte. Sowenig die damals kreierten sechs Namen einen Kreis bildeten, sowenig die Gedichte im einzelnen noch heute das Programm stützen mögen, als Ansatz eines neuen Stilwillens und Denkmusters hat dieser schmale Band nolens volens Geschichte gemacht, wer auch immer dies nicht wahrhaben wollte. René Schwachhofer hob in seiner Rezension einen der Beiträger heraus:
Der Tenor, wie wir ihn noch jüngst aus anderen Sammlungen und Anthologien vernahmen, ist einer klareren, konkreteren Diktion gewichen, in der unsere Wirklichkeit in ihrer gesamten Weite und Vielschichtigkeit sichtbar wird. – Dies gilt in besonderem Maße für den 1935 geborenen Heinz Czechowski. In Czechowskis Gedichten sind alle Gedanken der in dem Buche vertretenen Autoren gleichsam sublimiert: Man findet die bohrende Frage wie das leidenschaftliche Bekenntnis, die dringliche Mahnung wie den hymnischen Aufruf. Fülle und Reichtum des Lebens in der sozialistischen Gesellschaft bedürfen keiner überlauten Pathetisierung mehr…
Schwachhofer spürte aus den neuartigen Gedichten der Fünfundzwanzigjährigen, die ihr Mitspracherecht anmeldeten, das Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Gesellschaft. Ihr neues Weltgefühl dünkte ihm „romantisch“. Der romantische Grundton, sollte er je wirklich bestimmendes Merkmal gewesen sein, hat sich nicht gehalten. Andere Kritiker fügten in den Folgejahren gern das Epitheton „barock“ hinzu, vor allem, nachdem Volker Braun auf den Plan der Literatur getreten war. Aber auch dies geht an der Sache selbst vorbei. Georg Maurer sprach von der sächsischen Dichterschule. Aus dem Bonmot wurde dank seiner Griffigkeit ein Etikett, das erfolgreich zur Legendenbildung beiträgt. Unbestreitbar und unabweisbar jedoch ist, daß der Dresden-Topos eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt hat, weil er bei der Geschichtsbewältigung und Selbstfindung jener Generation von starker Beweiskraft ist. Wie zu sehen, finden sich auch in einer jüngeren Generation Lyriker, für die Dresden als Landschaft Gegenstand ihrer Dichtung geworden ist. Thomas Rosenlöcher und Michael Wüstefeld bezeugen dies auf unterschiedliche Weise. Man könnte zugespitzt sagen, ohne jenem Lokalkultus frönen zu wollen, wie er in sehr viel populäreren Erlebensbereichen gang und gäbe ist, Dresden als eine Lebenslandschaft, als eine Landschaft, die – von der Geschichte herausgehoben – für ein Weltgefühl steht, das für existentielle Probleme besonders sensibilisiert worden ist. Provinz als Thema kann durchaus literarischen Provinzialismus nach sich ziehen. Verständlich, daß gleichsetzende Vorstellungen und Ängste noch heute umgehen. Fast erübrigt es sich, zu betonen, daß eine Haltung, die Distanz einschließt, diese Gefahr sehr wohl abzuwenden vermag. Der aus Dresden stammende Fotograf Christian Borchert, zu dessen Band Semperoper Dresden. Bilder einer Baulandschaft (1985) Heinz Czechowski den Text „Mit Dresden leben“ schrieb, bekannte:
Es wäre furchtbar, wenn alles Verbrüderung wäre; Distanzlosigkeit würde Flachheit bedeuten. Distanz heißt nicht Fremdheit, sondern Würde.
Eine bündigere Definition ist schwerlich möglich, gilt sie doch nicht nur für den Fotografen, sondern für jeden Künstler, für jeden „Übersetzer“ von Wirklichkeit gleichermaßen. Und auch, was Johannes R. Becher immer wieder als „prägnanten Punkt“ zu umschreiben versucht hat, dürfte mit dieser Art von Distanzgefühl zu tun haben, ohne das keiner der in diesen Band aufgenommenen Texte geschrieben worden ist.
In der erwähnten Sammlung Bekanntschaft mit uns selbst finden sich bezeichnenderweise zwei Gedichte zum Thema, denen gewissermaßen Signalfunktion zukommt. Das erstere stammt von Karl Mickel und trägt den Titel „Dresdner Häuser (Weißer Hirsch und Seevorstadt)“. Es handelt sich dabei um eine Vorstufe des 1965 wesentlich erweiterten und veränderten Gedichts „Dresdner Häuser“. Das zweite Gedicht trägt die Überschrift „An der Elbe“. Sein Autor Heinz Czechowski hat dieses Sonett späterhin auf den Eingangsvers reduziert, weil ihm das Ganze in seiner linearen Schreib- und Denkweise zu stark auf Illusion und Idyll aus war. Die gegenläufigen Arbeitsmethoden markieren bei beiden einen Entwicklungsgang, an dem sich eine differenziertere Weltsicht ablesen läßt. Die zurückgelegte Strecke läßt sich leichter abmessen, wenn der Blick auf die Anfänge nicht verstellt ist. Gerade diese eine Gedichtzeile des Sonett-Rudiments ist so etwas wie ein Leitmotiv geworden. Karl Mickel verwendet sie als freies Zitat in dem Gedicht „Die Elbe“ (1973), so wie ein Komponist ein bekanntes Motiv anspielt, als gäbe sich in dieser Zeile Dresdner Landschaft ursächlich zu erkennen. Volker Braun wiederum setzt in dem Gedicht „Dresden als Landschaft“ ebenjene Zeile als Wiedererkennungszeichen und nennt, diesen Bezug verstärkend, an anderer Stelle dieses Textes nicht ohne Ironie jene vier etwa gleichaltrigen aus Dresden gebürtigen Lyriker, die sich mehr oder weniger intensiv und häufig zu dieser Stadt bekannt haben, allerdings aus gehöriger Entfernung: „Mickel Czechowski Braun und Tragelehn / Exilieren nach Preußen“.
In diesen Stadt-Kontext sind die Dresden-Gedichte Heinz Czechowskis zu stellen, die im Laufe von drei Dezennien entstanden und um ein zentrales Erlebnis kreisen, das für ihn mehr und mehr zu einem Trauma geworden ist. Gemeint ist der Untergang des alten Dresden in jener Februarnacht des Jahres 1945, als die Stadt in Schutt und Asche sank. In dem Prosastück „Landschaft der Kindheit: Wilder Mann“ ist nachzulesen, wie er als Zehnjähriger das Inferno aus vorstädtischer Nähe beobachtet hat. „Ich bin verschont geblieben, aber / Ich bin gebrandmarkt“ heißt es in einem seiner Gedichte. Dieser Satz liest sich wie das Motto zu dieser Auswahl.
Für Heinz Czechowski ist die Stadt, die er als Dreiundzwanzigjähriger verließ, längst zu einer Erinnerungslandschaft geworden. Auch spätere Besuche und Stadtgänge, wie sie aus den Gedichten abzulesen sind, zehren immer von den prägenden Kindheitseindrücken der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Innerhalb des Werkes ist die Dresden-Thematik, und durchaus nicht nur in den Gedichten, breit gefächert, aber mit ihr ist es bei weitem nicht erschöpft. Betrachtet man allein die zahlreichen Landschaftsgedichte als eine spezielle Form der „Weltbefragung“, so sind die auf das zeitweilige Domizil Halle sowie den See- und Saalkreis geschriebenen Texte als zweite poetische „Landnahme“ zu sehen. Gemessen an der fast ausschließlich auf Berlin bezogenen Großstadtdichtung, wie sie kurz vor 1880 aufkam und dreißig Jahre später, am Vorabend des ersten Weltkrieges, mit den dämonischen Visionen Georg Heyms ihren Höhepunkt erreichte, hat Dresden-Dichtung keine Tradition, auf die zu bauen gewesen wäre, so glanzvoll die Stadt auch sonst in ihre kulturelle Vergangenheit eingebettet sein mag. Dresden ist eine ausgesprochene Malerstadt. Von jenem kleinen Kreis avantgardistischer Schriftsteller, der sich um 1917/18 für kurze Zeit in der Stadt an der Elbe zusammenfand, sind kaum nachhaltige Wirkungen ausgegangen. Jedenfalls ist das geistige Klima der Stadt nicht spürbar davon betroffen worden. Der revolutionäre Aufbruch und jugendliche Elan, wie er sich in der spätexpressionistischen Zeitschrift Menschen und einigen anderen geistesverwandten kurzlebigen Blättern manifestierte, wurde rasch von den restaurativen Strömungen erstickt. Zu den lokalspezifischen Eigenheiten der ehemaligen sächsischen Residenz gehört eine Tendenz zum Gemüthaft-Behäbigen, das in seiner abgründigen Haltbarkeit und Gründlichkeit wie für die Ewigkeit bestimmt scheint. Auch Dieter Hoffmann, ein vornehmlich impressiv arbeitender Lyriker, der das sächsisch-augusteische Umfeld seiner Vaterstadt mit wahrer Besessenheit liebevoll-ironisch memoriert hat, verließ Dresden sehr früh, zu einem Zeitpunkt, als Czechowski eben zu schreiben begann. So stark dann auch dessen Entwicklungsgang von der Stadt als einer auratischen Erlebnislandschaft mitbestimmt worden ist, war er zu keiner Zeit auch nur annähernd in ihren Dimensionen zu denken. Nicht Dresden als Lebensform; sondern die Stadt als Text. Die Frage dabei war nur, wie dieser paradigmatische Text zu lesen, also auch aufzuzeichnen und zu überliefern ist.
Zur Distanz als Position des besseren Überblicks und Blickfeldes könnte der Stadtrand, an dem Czechowski recht ländlich-naturnah aufgewachsen ist, verstärkend eingewirkt haben. So seltsam es klingen mag, seine Stadtgedichte sind von auffallend reduzierter Urbanität. In seiner Stadtlandschaft dominieren die naturwüchsigen Randbezirke mit rustikalen dörflichen Relikten. Längst von der vordringenden Stadt eingekreiste und eingemeindete Dörfer haben ihre bäuerliche Herkunft noch immer nicht ganz abgeschüttelt. Die ursprüngliche Siedlungsstruktur ist in einigen Winkeln, an denen der großstädtische Verkehr vorüberbrandet, noch erkennbar geblieben, so in Alt-Trachau oder in dem abseits liegenden Selleriedorf Alt-Kaditz. Mitunter wechselt der architektonisch ausgestellte soziale Habitus, der einer Gegend ihr unverwechselbares Gepräge gibt und für eine stimmige Atmosphäre sorgt, von einem Straßenzug zum andern. Wie Stein gewordene Lebensgeschichten reihen sich die Villen der Weinbergstraße, in ihrer Umgrünung strahlen sie noch heute saturierte Bürgerlichkeit aus. Einige Nummern bescheidener geben sich die schäbig gewordenen Gründerzeitfassaden des Kleinbürgertums. Monotone Mietshausfluchten verweisen auf die proletarische Provenienz. Dazwischen Gartenkolonien oder ein Wohngeviert im Bauhausstil, ein rundum bewohntes Denkmal. Am schlimmsten mitgenommen vom Rost der Geschichte und vom Frust der Gleichgültigkeit sind die Ladenstraßen der ausgestorbenen kleinen Händler und selbständigen Handwerker. Erkundungsgänge am Stadtrand oder Exkursionen ins sächsische Hinterland, wie ich sie mit Heinz Czechowski von Zeit zu Zeit unternommen habe, trugen immer den Charakter einer Expedition ins verlorene Paradies. Selbst „Die Fahne des Marmeladefabrikanten“ vermag dann zur Aura beizusteuern, die die Erinnerungsarbeit der Kindheit beimißt. Nördlich der Vorstadt Wilder Mann erstreckt sich ein abgesprengter Teil der Dresdner Heide, die Dürre Heide, als Flur vor der Haustür. Darin der Heidefriedhof mit den Massengräbern:
Den Toten ein Kreuz, oben
Hinter den Wäldern über der Stadt,
Den Namenlosen.
Dahinter und zuseiten die Gartenstadt Hellerau, Klotzsche, das Rödertal, der Heller, den der Impressionist Otto Altenkirch entdeckt hat, die Lößnitz mit ihren Weinbergen und Gärtnereien, mit dem Sanatorium des Naturapostels Eduard Bilz, der auf Wasser setzte, und der noch immer unter Dampf stehenden Sekundärbahn, die „auf die Ewigkeit pfeift“, um nach Moritzburg zu entweichen, dessen Jagdschloß zu den Insignien sächsischen Barocks gehört, wie dessen Hellhaus dem Verfall und mithelfenden Vandalen zu treuen Händen übereignet wurde. Das Weichbild der Stadt beschirmen verwaldete und verwilderte Parkanlagen, die bis zur Reblauskatastrophe Weinberge waren. Eines dieser alten Weingüter in ländlicher Stille besaß für wenige Jahre der unstete Dramatiker Carl Sternheim. Ein anderes Landhaus gleicher Herkunft gehörte dem Ornithologen Ludwig Thienemann. Hinter den Mauern dieses Grundstücks scheint seit seinem Tode das Pendel der Geschichte angehalten worden zu sein.
All diese Orte der Erinnerung und andere mehr werden von Heinz Czechowski in seinen Gedichten beschwörend aufgerufen. Sie sind ihm Teil seiner selbst. Der elegische Grundton hat mit der Trauerarbeit zu tun, die er unentwegt leistet. Er scheut sich nicht, von „Wehmut und Schönheit“ zu sprechen, wenn er so seine Kindheit Revue passieren läßt. In den Fassaden der steinernen Altersschönheiten, die der Vernichtung entgingen, liest er wie in einem aufgeschlagenen Geschichtsbuch. Seine Art des Erkundens läßt an die Leistung des Kunsthistorikers Fritz Löffler denken, der dem untergegangenen Dresden als dessen integerste Instanz und gutes Gewissen ein glanzvolles Buch-Denkmal gesetzt hat. Czechowski geht wie ein Archäologe zu Werke, wenn er seine Stadt sichtet und als geistigen Besitz birgt. Die Fülle erinnerter Namen und Realien, die den Gedichten das Lokalkolorit geben, bilden das sichere Fundament seiner Poesie. Sie sind für ihn Größen und Werte von absoluter Gewißheit. Aber dieser Hintergrund, den der Leser nicht unbedingt vor Augen haben muß, bildet immer nur den Schreibanlaß. Die protokollarischen Notate und Stichworte zur Biographie werden auf den Prüfstand des Gewissens zitiert. Er reflektiert über die wahrgenommenen Fakten. Auf diese Weise mischt er die sinnlich-konkrete Dingwelt in ihrer Unmittelbarkeit mit Wissen und Bewußtsein, mit Erfahrung und Betroffenheit. Durch die Öffnung des Blickwinkels weitet sich das Landschaftsgedicht immer zum Weltanschauungsgedicht. Die Stadt als Text ist eben nicht bloß ein additives Notieren von mehr oder weniger zufälligen Eindrücken, sondern es geht um die gesellschaftlichen Zusammenhänge, um die Komplexität des Lebens. Erlebnis, Fühlen, Denken und Ahnung gehen in seiner Poesie zusammen und gelten ihm gleichberechtigt in ihrer Wertigkeit. Jeder Aspekt birgt in sich Möglichkeiten, Qualitäten. Sie helfen ihm alle gleichermaßen, sich eine Vorstellung von der Welt zu verschaffen. Erinnerte Geschichte und erlebte Gegenwart verschränken sich und bilden „Materie der Poesie“. Er will sich und dem Leser nichts vormachen. So umschreibt er auch selten metaphorisch. Viellieber setzt er auf das direkte Bild, auf ein hartes Benennen der Dinge, die sich nach seiner Auffassung nicht im Raum stoßen, wie bei Schiller, sondern im Individuum. Erst das Gedicht in seiner Gesamtheit wird zu einem Gleichnis für menschliche Spannweite zwischen Leben und Tod. In dieses Bezugsfeld ist auch sein Verhältnis zur Stadt und zu ihrem Schicksal, von dem er nicht loskommt, einzuordnen, daraus ergibt sich der Modellcharakter. Und weil Dresden weltweit als Symbol für die Verletzbarkeit und Zerstörbarkeit aller Humanitas steht, kann es auch zu einem Welt-Modell von starker Beweiskraft werden. So ist es gar nicht verwunderlich, daß Geschichtsträchtigkeit zu den Charakteristika seiner Lyrik zählt. Und dies trifft nicht nur für die Dresden-Gedichte zu. Er selbst äußerte in einem Interview, Geschichte als einen Raum aufzufassen. Dieser Raum hat wiederum mit Dresden als Landschaft zu tun. Die räumliche Vorstellung verweist aber auch darauf, daß Geschichte als etwas ganz Konkretes gesehen wird: als eigene Lebens- und Zeiterfahrung. Was nicht heißt, historische Zusammenhänge, die außerhalb des persönlichen Erfahrungsbereiches liegen, würden geleugnet. So wie er sich eine von Geschichte „unbelastete“ Landschaft nicht vorstellen kann, ist auch seine bohrende Suche nach dem Sinn des Lebens gleichzeitig ein Gang über das Feld der Geschichte. Und wenn er dabei den Blick in die Zukunft richtet, sieht er die zunehmende Bedrohung menschlicher Existenz, die kaltblütig-gewissenlos aufs Spiel gesetzt wird. Deshalb vor allem baut er in seinen Gedichten so prononciert auf eigene Erfahrungen, auf den untrüglichen Augenschein. Seine Zeitbilder stehen gegen Allgemeinplätze, die zur Phrase verkommen sind. Er schreibt gegen die Vergeßlichkeit an. Er mißtraut jenen Geschichtsbüchern, in denen Retuschen an der Wirklichkeit vorgenommen worden sind. Eingedenk der Opfer ist er es sich und ihnen schuldig, weder etwas zu vertuschen noch zu glorifizieren. Ungeschminkt und unverstellt setzt er deshalb die am eigenen Leibe erfahrene Geschichte in ihrer Alltäglichkeit ins Bild, nur so kann er von größtmöglicher Glaubwürdigkeit sein.
Als Heinz Czechowski eben die Welt wahrzunehmen begann, hatte der zweite Weltkrieg begonnen. Das Dritte Reich stellte sich ihm als „gewöhnlicher Faschismus“ dar. Bewußt wurde ihm dies erst, als er über seine Kindheit nachzudenken begann. Für den militanten Alltag finden sich in seinen Gedichten zahlreiche Beispiele. Das Kriegsgeschehen blieb zunächst noch weit entfernt, allenfalls wurde es aus zweiter Hand vermittelt, so daß trotz aller Einbrüche die Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit vorherrschten. Als dann jedoch Vokabeln wie Fliegeralarm und Luftschutzkeller in die Kindheitswelt als Realität eindrangen, ging dieses Gefühl verloren. Einige Male wurde er nach Böhmen mitgenommen, was ihn zwar der täglichen Bedrohung entrückte, ihn jedoch am regelmäßigen Schulbesuch hinderte. Mehrere Zwangspausen führten dazu, daß der Schüler nach Kriegsende im Grunde noch einmal von vorn beginnen mußte. Aber all diese Einbrüche stehen in keinem Vergleich zu jener Bombennacht im Februar 1945, die jählings alles auslöschte, was bis dahin noch entfernt an Geborgenheit erinnert haben mag. Der Blick vom Hausdach auf die in einem Feuermeer untergehende Stadt überstieg jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Diese Katastrophe nahm das Ende der Kindheit vorweg. Das alte Dresden blieb fortan nur noch eine Erinnerungslandschaft aus einzelnen, sporadisch gespeicherten Bildern, die sich in der Wirklichkeit nicht mehr zusammenfügen ließen. Das Fritz Löffler gewidmete Gedicht „Ruinen“ steht als surreal überhöhtes Bild für die gespenstische Trümmerkulisse, die ihn über viele Jahre begleitet und an seinem Lebenstext entscheidend mitgeschrieben hat. Die Gedichte dieser Auswahl bezeugen, wie stark und anhaltend jenes Grunderlebnis nachwirkt und daß es in den achtziger Jahren spürbar an Intensität gewonnen hat. Von jenem Inferno her wird Geschichte als etwas Erlittenes empfunden. Die Geschichte und Geschicke der Stadt, mit denen er sich als Nachfahr, als Erbe, identifiziert, ein verkohlter Korpus, so wie ihn der Zeichner Wilhelm Rudolph festhielt.
Heinz Czechowski sieht sich als Objekt der Geschichte. Er spricht für die Opfer, „die ohne Stimme sind“. Sein Text, den er sich auf die Stadt macht, arbeitet gegen Vergeßlichkeit und Verdrängung. Die chronologisch geordneten Texte spiegeln den Erkenntnisprozeß, den er dabei zurückgelegt hat. Während in dem ersten Gedichtband Nachmittag eines Liebespaares (1963) harmonisierende Tendenzen überwiegen, die aus der Rückschau leicht als naiv zu apostrophieren sind, ist in dem Band Wasserfahrt (1968) Nachdenklichkeit zur Grundhaltung geworden. Ernüchterung, Desillusionierung sind an die Stelle der zuversichtlichen Begeisterung getreten. Die Sprache ist selbstbewußt und selbständig geworden, sie greift nun kühner und härter aus. Der ursprünglich noch tradierten Mustern verpflichtete Tonfall ist von einem lakonischen Sprechgestus abgelöst worden. Dies schafft größeren Spielraum und mehr Bewegungsfreiheit beim Zugriff auf die spröden, prosaischen Fakten des Alltags. Ein Vergleich der bei den sich thematisch entsprechenden Gedichte „Der Nachmittag eines deutschen Liebespaares“ und „Sonntagnachmittag im März“ macht den sprachlichen und gedanklichen Umschlag, der innerhalb weniger Jahre stattgefunden hat, sinnfällig. Mit einer solch offenen Struktur, die formal sehr viele Möglichkeiten einschließt zwischen Erzählgedicht und elliptisch verknapptem Gleichnis, ließ sich ein tragfähiges Programm entwickeln. Ein Programm der kontinuierlich intensivierten und radikalisierten Selbstbefragung, die gleichermaßen zur kritischen Weltbefragung gerät. Czechowskis Gedichte zeigen paradigmatisch, wie das Individuum die gesellschaftlichen Widersprüche, mit denen es tagtäglich konfrontiert wird, in sich austrägt. Auch die Dresden-Gedichte sind in diesen fortwährenden Diskurs mit der vergangenen, gegenwärtigen und vorgeahnten Wirklichkeit eingebunden, eben weil sie nicht auf der Stufe linearer Reproduktion von Kindheitserinnerungen, von Naturgefühl oder ephemerer Befindlichkeit verharren. Je illusionsloser der Blick auf die Dinge, auf die Zeit und ihre Zustände, desto entschiedener der Wille, nichts zu glätten, nichts zu beschönigen, nichts auszusparen oder gar zu unterschlagen. Erst in der sarkastisch zugespitzten Formulierung wird das Problem auf den Punkt gebracht. Die Offenheit und Vielseitigkeit der eingesetzten Mittel bei der literarischen Bewältigung der Erlebnisse, die Schwachhofer sehr früh bemerkt hatte, ist für Czechowskis Lyrik signifikant geblieben. Das ausgeprägte Problembewußtsein und die radikale Ehrlichkeit gehören zu den Voraussetzungen, daß aus den Notaten existentieller Betroffenheit gesteigerte Szenen des Alltags entstehen. Nichts ist verstellt oder arrangiert um des Effekts willen. Die nachdrückliche Verteidigung der Subjektivität, wie sie auch die letzten Bandtitel unterstreichen, hat durchaus mit dem gesellschaftlichen Entwurf zu tun, dem sich Czechowski verpflichtet weiß. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Die alte Frage: Wer bin ich? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? wird von ihm aufs neue und auf unverwechselbare Weise gestellt. Seine „Dresdner Kindheit um 1945“ hat er vorerst in Gedichten ausgeführt. Die Prosagedichte dieser Sammlung sowie die erzählten Texte „Die Elbe bei Pieschen“ und „Landschaft der Kindheit: Wilder Mann“ aus dem Band Herr Neithardt geht durch die Stadt (1983) verweisen auf noch auszuschöpfende Möglichkeiten seines Themas.
Wulf Kirsten, Nachwort
„Ich hatte das Glück und das Unglück,
in einer Stadt geboren zu werden, die einmal zu den schönsten Deutschlands, ja Europas gehörte: Dresden. Diese Stadt wurde 1945 dem Erdboden gleichgemacht.“ (Heinz Czchowski, 1988)
In jener Februarnacht 1945, als die Bomben auf Dresden fielen, endete für Czechowski die Kindheit.
„Ich / Bin verschont geblieben, aber / Ich bin gebrandmarkt“ – ein Satz wie ein Motto für die Gedichte und die Prosa, die vom Ende der fünfziger Jahre bis heute entstanden und Dresden als gesellschaftliche und biographische Landschaft zum Gegenstand haben. Sie spiegeln, wie Czechowskis Liebeserklärung an die Stadt immer stärker gebrochen werden, die Verklärung der idyllischen Landschaft aufgehoben wird. Erinnerte Geschichte und erlebte Gegenwart verschränken sich und bilden die Materie der Poesie. „ Heinz Czechowski sieht sich als Objekt der Geschichte. Er spricht für die Opfer, die ohne Stimme sind. Sein Text, den er sich auf die Stadt macht, arbeitet gegen Vergeßlichkeit und Verdrängung“, schreibt Wulf Kirsten in seinem Nachwort „ Die Stadt als Text“.
Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1990
h
Wäre es wünschenswert, daß der Rezensent seinem jeweiligen Gegenstand so unbefangen wie nur möglich gegenübertritt, dann wäre ich gänzlich ungeeignet, mich zu diesem Buch mit Prosa und Gedichten über Dresden zu äußern. Kann man von jemandem verläßliche Auskünfte erwarten, dem Verse wie die folgenden aus dem Gedicht „Glück“ das Herz höher schlagen lassen?
Die Bauernhöfe Alt-Reicks,
Die Kühe,
Im Landgraben weidend.
Der Fensterplatz neben der Mutter
Im rumpelnden Kasten der Linie 9,
Klein-Zschachwitz entgegen.
Wenn es auch nicht „Pieschen, Cotta, Löbtau oder im Hechtviertel“ war, wo ich aufwuchs, sondern Stetzsch, Leutewitz und Leubnitz-Neuostra, so kenne ich doch das bescheidene kleinbürgerlich-proletarische Milieu der Vorstadt, das Ackerbürgerliche der sich ins Ländliche entgrenzenden Stadt, kurzum die „Peripheriegefühle“.
Eine Landschaft breitet sich aus als Erinnerungslandschaft, und zumal in der unwillkürlichen Erinnerung à la Proust schieben sich Gegenwart und Vergangenheit übereinander. Czechowski entsinnt sich der Erfahrung des Kindes, das den mütterlichen Verboten zum Trotz die Grenzen des ihm zugewiesenen Spiel-Raumes erstmals überschreitet:
In diesem Augenblick prägt es nur in sich ein, was jetzt gegenwärtig ist und sich später einmal als unwiederholbar und unwiederbringlich erweisen wird. Kein Vergleich mit anderen Flüssen, die andere Städte durchfließen, kann sich jetzt zwischen das Es des Kindes und die Dinge stellen, die es erblickt. („Die Elbe bei Pieschen“)
Wiederbegegnung mit der Kindheit, Wiederentdeckung ihrer Ur-Bilder: Sind die Entdeckungen der Literatur nicht in weitaus größerem Maße Wiederentdeckungen? Damit sind natürlich nicht in erster Linie die Realien der Außenwelt gemeint, die wir schon kannten und von denen wir nun wieder hören, die be-greifbaren Dinge, die begehbaren Landschaften, die historischen Ereignisse, sondern vor allem Stimmungen und Ahnungen, das schon einmal – zumindest im Keim – Gedachte und Gefühlte.
Wie entkommt man der Rührung? Mit Tränen in den Augen sieht man die Welt verschwommen, und der Blick für die Qualität eines Textes kann erst recht nicht aufgebracht werden. Als Möglichkeit der Selbstdisziplinierung bietet es sich an, anhand der Texte, die aus einem Zeitraum von dreißig Jahren (1958 bis 1988) stammen, einige Notizen zur Entwicklung des Lyrikers aufzuschreiben. Traditionell in den Mitteln, bildsprachlich oft noch konventionell, beschwören die frühen Gedichte Harmonie. Ihnen fehlt häufig das spezifische, eben auf Dresden und keine andere Stadt zutreffende Detail. Da ist beispielsweise vom „Tal romantischer Versunkenheit“ die Rede und von Eichen, „die wie deutsche alte Meister standen“ („Der Nachmittag eines deutschen Liebespaares“). Der Versuch, den Schrecken der Bombenangriffe im Februar 194 5 zu benennen, bekommt durch die Behauptung „wie nie“ etwas Hilfloses:
Da krampften sich die Nägel wie nie
In die härtesten Steine.
Da wurden Menschen wie nie
Von klassisch behauenen Steinen
Erschlagen.
Aber es ist billig, solche Unfertigkeiten eines jungen Autors lang und breit zu zitieren. Czechowski weiß darum selbst am besten, sonst hätte er diesen Band nicht mit einem Vers eröffnet, der als einziger von dem Sonett „An der Elbe“, wie es sich in dem 1973 erschienenen Gedichtband Nachmittag eines Liebespaares findet, übriggeblieben ist. Aufschlußreicher als die Unsicherheiten eines Beginnenden sind die falschen Sicherheiten, wie sie einer Ideologie entstammen, die mehr für eine Scheinwelt optieren mußte als für die wirkliche.
Manchmal,
Ich gebe es zu,
Steht es nicht gut um mich:
Die Stadt sehe ich im Feuer, aber
Die Zukunft kommt mir entgegen, sicher berechnet,
Doch die Zeit, der ich entronnen bin,
Weint.
Daß die Rechnung nicht aufgeht, diese Ahnung findet sich im Gedicht „Wasserfahrt“. Die Reflexion über technologischen Fortschritt mündet in die Verse:
Aber wenn da etwas verlorenging
Vom Liebesgeflüster, von
Der Fahrt auf dem Fluß, vom Grün
Und der Wölbung des Berges, was
Blieb?
Das war, scheint mir, nicht die bange Frage nur, sondern schon der Beginn des Einspruchs. In der Folge wurden die Kulissen, die den Blick auf die Wirklichkeit verstellten, von Czechowski beiseite geschoben. Ehrlichkeit und Genauigkeit verlangte er von sich; beide Kategorien hängen, ohne deckungsgleich zu sein, eng zusammen; die erste akzentuiert das Moralische, die zweite basiert auf der Einsicht, daß der entschiedene Ausdruck von Subjektivität gar nicht möglich ist ohne differenziertes Ausloten und Ausforschen ihrer Umwelt. Freilich mußte der sich von vorgefertigten Betrachtungsmustern lösende, der enttäuschte Blick den Verfall der Verheißungen wahrnehmen. Damit aber gewinnt zugleich eine nur scheinbar vergangene End-Zeit an exemplarischer Bedeutung, mit stärkerer Intensität als zuvor wird der Topos und das Trauma „einer im Feuer versunkenen Stadt“ beschworen.
Daß Czechowski sich als „Opfer der Geschichte“ empfindet, wie er im Gespräch mit Christel und Walfried Hartinger sagte, geht auf das Erlebnis des Kindes zurück, das den Feuersturm, in dem Dresden unterging, wüten sah. Zugleich erhielt dieses Gefühl ständig Nahrung aus einer von Hochrüstung und Umweltzerstörung versehrten Welt, wobei der „real existierende Sozialismus“ – Tschernobyl war das Menetekel – sich als schlimmere Variante der Industriegesellschaft erwies. Solche Vermutungen, wenn nicht Einsichten waren den Texten Czechowskis schon seit längerem zu entnehmen.
Nun haben diese Gedichte nicht nur eine gesellschaftskritische Dimension, reflektieren also nicht nur die von uns selbst verschuldeten Zerstörungen. Nicht minder verdanken sie ihr Entstehen wohl dem Impuls, die zwanghafte Erfahrung von Vergänglichkeit zu verarbeiten. Wir sind Melancholiker, insofern es uns zweifelhaft erscheint, ob gegenwärtige Glücksversprechen in der Zukunft Beglaubigung finden, ob Hoffnung auf Glück nicht Selbsttäuschung ist. Was wir verloren haben, wissen wir, was wir bekommen, nicht… Frühe Eindrücke sind oft die stärksten, sie werden als Erinnerungsmale unwiederholbarer Erlebnisse empfunden, die wiederum ein rätselhaftes Moment unserer Identität auszumachen scheinen. Lebens-Räume umschreiben auch Claus Weidensdorfers farbige Zeichnungen, Stadt-Leben wird in ihnen als kollektiver Mythos ver(sinn)bildlicht.
Dresden erscheint in den Prosatexten und Gedichten Czechowskis als eine „Lebenslandschaft, als eine Landschaft, die – von der Geschichte herausgehoben – für ein Lebensgefühl steht, das für existentielle Probleme besonders sensibilisiert worden ist“. So formuliert es Wulf Kirsten, der, selbst ein entschlossener Landgänger, zusammen mit Czechowski den sozialkulturellen Raum Dresden auf zahlreichen Erkundungsgängen ausschritt. Sein Nachwort „Die Stadt als Text“ gibt viel ausführlicher und kenntnisreicher über Sachsen im Herzen der Dichtung Czechowskis Auskunft, als das hier geschehen könnte. Czechowski ist natürlich kein „Dresdner Dichter“, auch wenn er sich wie kein anderer Schriftsteller der Gegenwart immer erneut dieser Stadt zugewandt hat, so wie Günter Kunert wieder und wieder – vergleichbar sind beide in ihrer Mentalität wie in der Intensität ihres archäologisch-literarischen Bemühens – das vergangene und vergehende Berlin vergegenwärtigt.
Literatur ist als Artiges nicht der Rede wert, nur als Eigenartiges. Czechowski hat einen Gedichttypus ausgeprägt, der es ihm erlaubt, seine eigen-artigen Welt- und Stadt- und Lebensbilder so unaufdringlich wie eindringlich zur Sprache zu bringen. Die Einzelheiten des Lebens verbinden sich darin mit den Elementen des Daseins, die Fakten mit den Tragödien, der elegische Ton mit der lakonischen Feststellung, die Anschauung mit der Abstraktion, das „Erzählgedicht“ mit dem „elliptischen verknappten Gleichnis“ (Kirsten).
Ich schreibe keine Lehrgedichte,
Das überlaß ich andern, die das auch nicht können.
Das Leben lehrt nicht und der Tod lehrt nicht,
Denn beide sind sich selbst genug und leben
Im besten Einvernehmen miteinander.
(„Liberty“)
Dies freilich wäre auch eine Lehre, wenn man sie denn aus einem Gedicht, das immer mehr als eine Lehre eine Lebensregung ist, herauslösen dürfte. Denn: „Jedes neue Gedicht / Widerlegt das vergangene…“ (Vom Gedicht isoliert, sind auch diese Zeilen eine falsche Wahrheit.)
In dem Prosastück „Landschaft der Kindheit: Wilder Mann“ berichtet Czechowski auch über den Aufbau des Dresdner Zentrums. „Nur um die Ruine der Frauenkirche herrscht noch Kahlschlag.“ Heute sieht es dort ganz anders aus, und der Wiederaufbau der Frauenkirche scheint beschlossene Sache. Gerade wegen der heftigen Veränderungen in unserer Gegenwart dürfen wir nicht versäumen, das Bild, die Bilder der Vergangenheit zu bewahren. Die Literatur gibt solcher Erinnerung und Besinnung Raum.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 454, Oktober 1990
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Eckart Krumbholz: Flußlandschaften
Sonntag, 20.5.1990
Jens Jessen: Die Einsamkeit des Schriftstellers im Festzelt
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.9.1990
Thomas Rietzschel: Die Stadt im Feuer
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.1.1991
Ian Hilton: Heinz Czechowski: the darkened face of nature
Arthur Williams u. a. (Hrsg.): German literature at a time of change 1989–1990, Herbert & Cie Lang Verlag, 1991
Renatus Deckert: Auf eine im Feuer versunkene Stadt. Heinz Czechowski und die Debatte über den Luftkrieg
Merkur, Heft 659, 1.3.2004
GEMISCHTE GEFÜHLE
für Heinz Czechowski
Musik schwappt über. Ein Gefühl,
wie wenn eine Frau an mich denkt. Unbegreifliche
Sätze über die Liebe, sie stammen
von mir. Langsam heraustreten
aus der Starre, die Dinge beim Wort
nehmen, die täglich wechselnden Farben
des Himmels in diesem rumänischen Herbst.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaHimmel,
zwei Schnäpse für einen guten Anfang.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaDu sagst,
man kann ein Gedicht auf vielerlei Arten
beginnen. Jetzt könnte ich
mir eine von dir ausborgen: ins Gedicht
mit der Landschaft. Über die entgleitende Ebene
könnte ich sprechen, über den kleinen, südlich anmutenden
Hafen oder über den erodierten Phallus
des römischen Herrschers am Meer.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaAber bleibt auch
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaadiesmal
alles beim Alten? Sprechblasen und stumme
quälende Unrast.
aaaaaaaaaaaaaaaOder ich könnte
von der Liebe reden und Hölderlin
zitieren, aber was hab ich schon
davon, nichts als den hungrigen Atem und vielleicht
ein beschleunigtes Leben, „eine offene Wunde“, verletzlich
und taub. Und Metaphern
vor allem, Metaphern.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaWas sag ich da
im Halbrausch? Auseinanderredende Stimmen:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaOliven und meistens
gemischte Gefühle, flüchtige Grüße
aus Warschau, Vernunft, Rotwein und Büchner, Affekte,
Kleist und salziger Käse, von Schafen und Sternen.
Reisen, Bekanntschaften, Risse, Erinnerungslücken.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIch betrachte
die Welt wie durch ein Fenster, wie durch
das halbleere Schnapsglas diffuser
Glaubensbekenntnisse:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZweisprachig fast, mit gespaltnem
Bewußtsein, ratlos,
aber gefaßt, wir sprachen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBrüche
und tranken, meistens gemischte
Gefühle, und wiederkehrende Zweifel
an den Formulierungen unserer Zweifel, und das bißchen
nicht zu unterdrückende Bedürfnis nach Präzision, in der
sich, heiter
wie nie, die Gegensätze verflüchtigen, in der Musik
die überschwappt.
aaaaaaaaaaaaaaaaJa, gewiß, ich geb’s
zu, für Augenblicke wich
die Beklemmung, beim Atemholen
vor offenem Fenster, bei Nacht.
Unten die vertraut zerbröckelnde Stadt,
die singend zerplatzenden Hügel
am Bosporus, die kühl zerfallenden Schwäne
auf den Seen der Märkischen Schweiz,
der brennende Feigenbaum vor meinem Fenster
zu Hause, wenn ich nicht irre, auf der Straße
der Freiheit.
aaaaaaaaaaaEs ist nicht viel, wenn
ich’s zähle, aber auch der Tod läßt sich
ein Leben lang bescheißen.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLeben also: wurzellos, man
weiß es, aber verbunden, mit allem,
was uns geschieht, auch
mit seinen Grenzen, auf Messers
Schneide.
aaaaaaaaWie Rauch
über den Stoppelfeldern, du bist
im Bild, der entgleitenden Ebene
schwanken wir
hin und her
und werden nicht irre
an einigen Dingen. Das läßt uns noch
Hoffnung, ein bißchen Hoffnung, zusammengespannt
aus Erlebnis und Leere, aus, noch
einmal, auseinanderredenden Stimmen, gemischten
Gefühlen, aus allem,
was uns berührt und was wir berühren, was uns verändert
und was wir verändern, aus allem,
was, wie dies Gedicht, so schnell
vorübergeht, ohne noch richtig
begonnen zu haben.
Werner Söllner
DRESDENER ELEGIE
für Heinz Czechowski
Spaziergang die Wiesen entlang der Elbe
Heuduft der schwere Geruch des Stroms
Sanft gehen / Wie Tiere die Hügel / Neben dem Fluss
Immer noch das Geräusch der Stadt
Bei der Arbeit nahe jetzt fern
Kühler Abend nach heißem Tag
1956
B.K. Tragelehn
Zum 70. Geburtstag des Herausgebers:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Herausgebers:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß(Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Herausgebers
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Herausgebers:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Archiv + KLG + IMDb +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jens Bisky: Vom Nichts begleitet
Süddeutsche Zeitung, 7.2.2005
Beatrix Langner: Schreiben im eigenen Schatten
Neue Zürcher Zeitung, 7.2.2005
Hans-Dieter Schütt: Rückwende
Neues Deutschland, 7.2.2005
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + KLG + Archiv +
Kalliope
Porträtgalerie: Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Heinz Czechowski: Die Welt ✝ poetenladen ✝
titelmagazin ✝ Der Spiegel ✝ Deutschlandfunk ✝ Freitag ✝
Berliner Zeitung ✝ Der Tagesspiegel ✝ Süddeutsche Zeitung


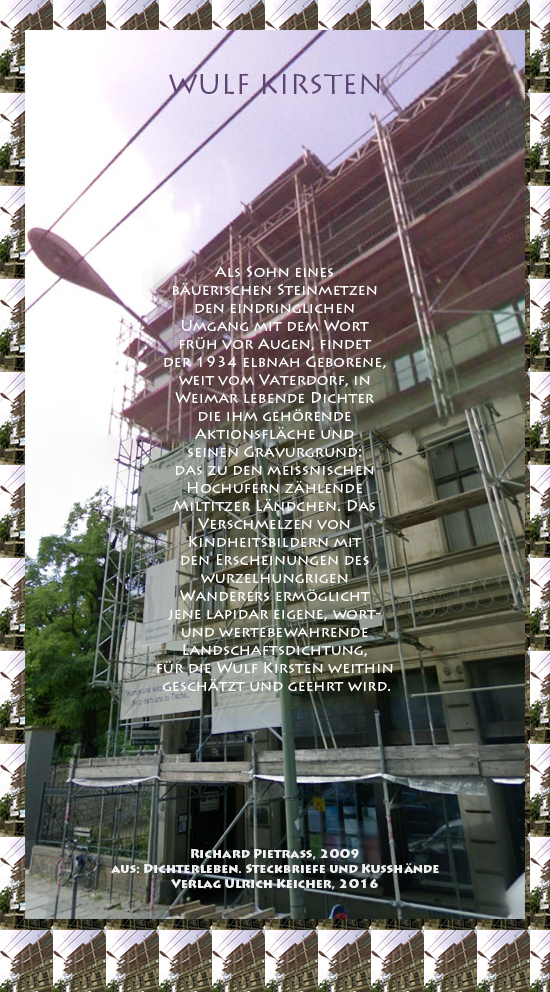














Sehr anregend, danke.