Ingeborg Bachmann: Die Gedichte
DAS SPIEL IST AUS
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß
und fahren den Himmel herunter?
Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß
und wir gehen unter.
Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier
viele Länder und Schienen.
Gib acht, vor den schwarzen Linien hier
fliegst du hoch mit den Minen.
Mein lieber Bruder, dann will ich an den Pfahl
gebunden sein und schreien.
Doch du reitest schon aus dem Totental
und wir fliehen zu zweien.
Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt,
es rinnt uns der Sand aus den Haaren,
dein und mein Alter und das Alter der Welt
mißt man nicht mit den Jahren.
Laß dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand
und der Feder im Strauch nicht betrügen,
iß und trink auch nicht im Schlaraffenland,
es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen.
Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee
das Wort noch weiß, hat gewonnen.
Ich muß dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee
im Garten zerronnen.
Von vielen, vielen Steinen sind unsre Füße so wund.
Einer heilt. Mit dem wollen wir springen,
bis der Kinderkönig, mit dem Schlüssel zu seinem Reich im Mund,
uns holt, und wir werden singen:
Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt!
Jeder, der fällt, hat Flügel
Roter Fingerhut ist’s, der den Armen das Leichentuch säumt,
und dein Herzblatt sinkt auf mein Siegel.
Wir müssen schlafen gehen, Liebster, das Spiel ist aus.
Auf Zehenspitzen. Die weißen Hemden bauschen.
Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus.
wenn wir den Atem tauschen.
Nachwort
Als Ingeborg Bachmann am 17. Oktober 1973 in einem römischen Krankenhaus starb, traf die Nachricht vom Tod der erst 47jährigen Schriftstellerin weder ihre Freunde noch die Öffentlichkeit gänzlich unerwartet: Ingeborg Bachmann hatte drei Wochen zuvor, am 26. September, in ihrer Wohnung lebensgefährliche Verbrennungen erlitten, und über den hoffnungslosen Kampf der Ärzte um das Leben der Bewußtlosen war von der Boulevardpresse täglich berichtet worden. Das laute öffentliche Interesse am Sterben dieser auf „Diskretion, Noblesse, Scheu und empfindsamen Abstand angewiesenen Dichterin“ wurde von ihren Freunden als „unsäglich unangemessen“ empfunden; es war aber auch Ausdruck des großen öffentlichen Ansehens, das die österreichische Erzählerin, Hörspielautorin, Essayistin und Lyrikerin schon zu ihren Lebzeiten gefunden hatte.
Niemals in den knapp fünfundzwanzig Jahren ihres Schaffens hatte es Zweifel daran gegeben, daß sie zu den beeindruckendsten österreichischen Schriftstellern der Nachkriegszeit, ja zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichtern gehört. Namhafte Literaturpreise bestätigen dies auch rein äußerlich. Die ersten, den Preis der Gruppe 47 (1953) und den Literaturpreis der Freien Hansestadt Bremen (1956), hatte sie für zwei schmale Gedichtbände erhalten, die, ergänzt durch wenige in den Jahren davor und danach geschriebene Gedichte, ihr lyrisches Gesamtwerk ausmachen. Ingeborg Bachmann hatte es als abgeschlossen betrachtet; sie war bereits 1967 als Lyrikerin verstummt. Wenige Wochen vor ihrem Tod befragt, warum sie aufgehört habe, Gedichte zu schreiben, antwortete sie: „Das, was ich an Gedichten geschrieben habe, das ist es, und damit ist es zu Ende.“
Debütiert als Lyrikerin, wie als Schriftstellerin überhaupt, hatte sie mit vier Gedichten in Heft 1 1948/49 der von Hermann Hakel herausgegebenen Wiener Zeitschrift Lynkeus. Dichtung, Kunst, Kritik. Schon diese Gedichte, („Abends frag ich meine Mutter“; „Wir gehen, die Herzen im Staub“; „Es könnte viel bedeuten“; „Entfremdung“) der Philosophie-Studentin Ingeborg Bachmann belegen, was die Poetik-Dozentin Dr. Ingeborg Bachmann reichlich zehn Jahr später in ihren Frankfurter Vorlesungen zu Problemen zeitgenössischer Dichtung formulierte: daß Dichten nicht „außerhalb der geschichtlichen Situation“ stattfindet, daß der Ausgangspunkt eines Dichters „von den Zeitgegebenheiten bestimmt“ ist. Wollte man historische Determiniertheit freilich an eingebrachten Details aktueller gesellschaftlicher Wirklichkeit ablesen, so wäre sie nur für einige ihrer späteren Gedichte nachweisbar. Versucht man diese Determiniertheit jedoch als ein von der persönlichen Erfahrung geprägtes Zeitverständnis und Zeitgefühl zu erfassen, so ist eine individuelle und zugleich an die „Zeitgegebenheiten“ der spätbürgerlichen Gesellschaft gebundene Ausgangsposition im Gesamtwerk Ingeborg Bachmanns erkennbar.
Ihre frühen Gedichte sind getragen von Endzeitgefühlen, Todesgewißheit und Todesfurcht, von Erfahrungen der Ohnmacht, der Entfremdung und Vereinsamung des Menschen: „Ich bin das Immerzu-ans-Sterben-Denken“ – „Ich bin der großen Weltangst Kind“. Themen, die sich als Reflex auf die persönlichkeitsfeindlichen Auswirkungen des Kapitalismus und des Krieges bei vielen spätbürgerlichen Dichtern besonders in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg finden.
Selbst Erfahrenes auszusprechen, bekannte sie 1959 in ihrer Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden:
Der Schriftsteller ist… mit seinem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet, auf den Menschen, dem er seine Erfahrung vom Menschen zukommen lassen möchte (oder seine Erfahrung der Dinge, der Welt und seiner Zeit, ja von all dem auch!), aber insbesondere vom Menschen, der er selber oder die anderen sein können und wo er selber und die anderen am meisten Mensch sind. Alle Fühler ausgestreckt, tastet er nach der Gestalt der Welt, nach den Zügen des Menschen in dieser Zeit. Wie wird gefühlt und was gedacht und wie gehandelt? Welche sind die Leidenschaften, die Verkümmerungen, die Hoffnungen…?
Wo Ingeborg Bachmann ihre Erfahrung der Weit artikulierte, waren es zumeist differenziert wahrgenommene und erlittene Verkümmerungen. Worin sie die das Mensch-Sein am stärksten gefährdende Verkümmerung gesehen hat, sprach sie in einem der frühen Gedichte direkt aus:
Es könnte viel bedeuten: wir vergehen,
wir kommen ungefragt und müssen weichen.
Doch daß wir sprechen und uns nicht verstehen
und keinen Augenblick des andern Hand erreichen,
zerschlägt so viel: wir werden nicht bestehen.
An dieser Grunderfahrung leidend, versuchte sie, erfüllt von Sehnsucht nach unmittelbarer zwischenmenschlicher Kommunikation, in ihrem Leben wie in ihren Dichtungen den persönlichkeitszerstörenden Tendenzen des Nicht- Verstehens und des Nicht-verstanden-Werdens nachzuspüren und entgegenzuwirken. Toni Kienlechner, lange Zeit befreundet mit Ingeborg Bachmann, sagt von ihr: „Worauf man bei ihr rechnen durfte und zugleich rechnen mußte, waren zwei scheinbar widersprüchliche Gewißheiten: eine Verständigungsbereitschaft aus Einfühlung und eine Unnachsichtigkeit aus geistiger Genauigkeit.“
Einfühlungsvermögen und Genauigkeit im Denken befähigten sie, ihren dichterischen Auftrag nicht nur im Registrieren und rückhaltlosen Darstellen eigenen Erlebens zu sehen, sie nicht nur als leidende Repräsentantin ihrer Zeit zu verstehen, sondern „eine neue sittliche Möglichkeit zu begreifen und zu entwerfen“. Ein solches „Richtungnehmen“ war in ihren Augen „Gewähr für die Authentizität einer dichterischen Erscheinung“, Gewähr für das Entstehen großer und neuer Leistungen in der Literatur. Das Ziel der angestrebten sittlichen Veränderungen bleibt vage im Gesamtwerk Ingeborg Bachmanns, deutlich aber wird, daß es gesellschaftlich-sozial nicht gemeint ist.
Ihr erstes Gedicht („Abends frag ich meine Mutter“) vermittelt auf verhaltene Weise eine rührende Gewißheit freundlichen Verstandenwerdens und läßt erkennen, welches Ausmaß an Verständnis und Geborgenheit im Zwischenmenschlichen ersehnt wird. Zugleich offenbart dieser ideale Anspruch die innere Gefährdung, der die Autorin solcher Zeilen in ihrer Umwelt ausgesetzt sein mußte. 1971 formulierte Ingeborg Bachmann denn auch in einem Rundfunkinterview ihre Auffassung vom Anteil „der anderen“ – auch des anderen in uns selbst – an der inneren Zerstörung eines Menschen: Daß man auch ohne Krieg „mitten im Frieden ermordet“ wird; „dafür sorgen eben die anderen, über das, was ich den Mörder nenne.“ Vor diesem Schon-ganz-vernichtet-Sein aber steht ein tapferer Gegenentwurf, der Versuch, durch wahre, der eigenen Erfahrung gemäße Darstellung auch „die anderen zur Wahrheit zu ermutigen“, sie zu einem Leben „ohne Täuschung“ zu befähigen; dies alles auch mit den Mitteln des Gedichts. Dabei habe ein Gedicht in ihrer Zeit nichts mehr zu verherrlichen, auch Ruhm, Glaube und Beweis wären nicht Sache des Lyrikers heute. Vielmehr lege, „wer Gedichte schreibt, Formeln in ein Gedächtnis…, wunderbare alte Worte für einen Stein und ein Blatt, verbunden oder gesprengt durch neue Worte, neue Zeichen für Wirklichkeit“; und „wer die Formeln prägt“, entrückt in sie „mit seinem Atem, den er als unverlangten Beweis für die Wahrheit dieser Formeln gibt“. So ist es denn auch der „Atem“, ist es die innere Haltung, worin sich das Unverwechselbare ihrer Gedichte, aber auch ihr sich allmählich wandelndes Welt- und Selbstverständnis am deutlichsten zeigt.
Die frühen Gedichte, mit ihrer Frage „Was soll nur werden?“, ihrem Bekenntnis „Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg sehen“, sind voller Melancholie und Resignation. Ebenso die wenigen Gedichte, die sie während ihrer Wiener Zeit veröffentlichte, in der sie ab Herbst 1951 nach beendetem Germanistik-, Philosophie- und Psychologie-Studium als Rundfunkredakteurin arbeitete. Daß diese Gedichte ihrem selbstgestellten Anspruch an einen „wirklichen Dichter“, Richtung zu nehmen, nicht genügen, mag der Grund gewesen sein, weshalb sie sie später verwarf. 1952 dann erschien Ingeborg Bachmanns erster Gedichtzyklus „Ausfahrt“ in dem von Hans Weigl herausgegebenen Wiener Jahrbuch Stimmen der Gegenwart. Mit diesem Gedichtzyklus reiste sie – einer Einladung folgend – im Mai 1952 nach Niendorf in die BRD zu einer Tagung der Gruppe 47. Sie erinnerte sich später, dort „vor Aufregung am Ersticken“, ein paar Gedichte gelesen zu haben, die „ein freundlicher Schriftsteller… nochmals laut und deutlich“ vortrug. Dieser erste scheue Auftritt vor einem sachkundigen Publikum begründete Ingeborg Bammanns rasch anwachsenden Dichter-Ruhm. Schon für den nächsten Tag wurde eine Lesung derselben Gedichte im Rundfunk vereinbart, der weitere Funklesungen folgten; den Preis der Gruppe 47 erhielt sie bereits einige Monate vor Erscheinen ihres ersten Gedichtbandes Die gestundete Zeit im Jahre 1953. Die Literaturkritik reagierte spontan und einig darin, daß eine große Dichterin zu sprechen begonnen hatte.
Auch in den Gedichten der Gestundeten Zeit spricht ein Ich, das den Mut hat, erlittenen Schmerz zu bekennen, das die schmerzlichen Tatbestände der Wirklichkeit nicht verdrängt, sondern sich zwingt, sie bewußt bis zum Äußersten zu erleben. Vom Thematischen her gibt es im ersten Teil dieses Lyrikbandes nur geringfügige Erweiterungen gegenüber den vor 1952 entstandenen Gedichten. Das gestaltete Erleben einer Endzeit, einer befristeten, „gestundeten“ Zeit dominiert; Landschaften und Situationen tragen Merkmale eines kaum noch zu verbergenden Verfalls:
Fliegt noch die Locke taglang im Wind
um des Landgotts gebräunte Stirn,
unter dem Hemd preßt die Faust
schon die klaffende Wunde.
Neu aber sind Grundton und Haltung. Zwar ist das Ich auch dieser Gedichte sich des Lebens zum Tode bewußt:
Wie Orpheus spiel ich
auf den Saiten des Lebens den Tod
Doch bezieht es gerade von daher auch eine Art Zuversicht:
Aber wie Orpheus weiß ich
auf der Seite des Todes das Leben…
In ihrer Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden formulierte sie, welche Haltung ihr angesichts einer ausweglosen Situation menschenwürdig erschien: „Ich glaube, daß dem Menschen eine Art des Stolzes erlaubt ist – der Stolz dessen, der in der Dunkelhaft der WeIt nicht aufgibt und nicht aufhört, nach dem Rechten zu sehen.“
Dieser Stolz ist in den Gedichten der Gestundeten Zeit als Grundhaltung spürbar; vom stolzen „Trotzdem“, vom Ineinander nüchterner Sachlichkeit und bebender Sensibilität beziehen sie ihre Wirkung. Diese rückhaltlosen Bekenntnisse von Angst, Verlorenheit, erlebter Sinnlosigkeit und Ohnmacht des einzelnen zeugen vom Sich-Wehren gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen du Müde-Werden und gegen die Verführung durch Phrase und Klischee, welche sich wie ein Netz über die Wirklichkeit werfen lassen, durch dessen Maschen die Wahrheit entgleitet.
„Zu schreiben gewillt, was im Anfang war“, lehnte sie es als Schriftstellerin ab, sich der „vorgefundenen Sprache, also der Phrase“, zu bedienen. Selbst die Eigenart des Menschen, im Alltagsleben bereits vorgeprägte Formulierungen zu verwenden, hatte für sie nur negative Aspekte. Das gedankliche Typisieren, auf dem sie beruhen, erschwere es, unvoreingenommen, aus sich selbst heraus Wirklichkeit zu sehen, zu analysieren und zu einem eigenen Urteil zu finden:
Berauscht vom Papier am Fließband,
erkenn ich die Zweige nicht wieder,
noch das Moos, in dunkleren Tinten gegoren,
noch das Wort, in die Rinden geschnitten,
wahr und vermessen.
Daß das wahre Wort nur aus der genauen Beobachtung und Prüfung der Wirklichkeit erwachsen kann und der Weg dahin über das Schulen der Sinne genommen werden muß, war für die einstige Philosophie-Studentin gewiß. Sie hatte sich gründlich mit dem Positivismus auseinandergesetzt, eine Dissertation über Martin Heidegger geschrieben und anerkannte „die Erfahrung“ als „die einzige Lehrmeisterin“. „Wie gering sie auch sein mag – vielleicht wird sie nicht schlechter beraten als ein Wissen, das durch so viele Hände geht, gebraucht und mißbraucht oft, das sich oft verbraucht und leer läuft, von keiner Erfahrung erfrischt.“ So bedeutete für sie Sehen, „Schauen“, nicht nur genaues optisches Wahrnehmen, sondern tiefes, vom optischen Eindruck ausgehendes Erleben und Erfassen der ganzen Sinnschwere eines Geschehens oder Zustands. Das bezeugt ihr Essay „Was ich in Rom sah und hörte“ aus dem Jahr 1955. Kunst solle zuwege bringen, „daß uns, in diesem Sinne, die Augen aufgehen“, schlußfolgerte sie 1959. Mit welchem Widerstand sie bei diesem Versuch zu rechnen hatte, wußte sie: „Wir schlafen ja, sind Schläfer aus Furcht, uns und unsere Welt wahrnehmen zu müssen.“ Dennoch hoffte sie mit einer Poesie „scharf von Erkenntnis“ und „bitter von Sehnsucht“ „an den Schlaf der Menschen rühren“, die Bereitschaft zum In-Frage-Stellen des Gewohnten (und aus Gewöhnung für wahr, gut und unverrückbar Gehaltenen) wecken zu können, denn der „geheime Schmerz“ erst sei es, der uns „für die Erfahrung empfindlich“ mache „und insbesondere für die Wahrheit“.
Daß „nach dem Rechten zu sehen“ für sie einschloß, auch die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung ihrer Umwelt aufmerksam zu verfolgen, deutet sich in einigen Gedichten des zweiten und dritten Teils dieses ersten Lyrikbandes an:
Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt,
sucht sein enthaupteter Engel ein Grab für den Haß
und reicht dir die Schüssel des Herzens.
Neben die leidvolle Erfahrung des Vergangenen tritt das Erkennen und Erleiden neuer Gefahr:
Sieben Jahre später,
in einem Totenhaus,
trinken die Henker von gestern
den goldenen Becher aus.
Die Augen täten dir sinken.
Nachdem jahrelang pathetisch und phrasenhaft über die Wirklichkeit geschrieben worden war, wurde das leise, doch unerbittlich genaue Benennen realer Sachverhalte in diesen Gedichten als neuer Akzent in der deutschsprachigen bürgerlichen Lyrik begrüßt. Gesellschaftliche Wirkungen freilich blieben aus, es regte sich „nichts…, nur dieser fatale Applaus“, wie Ingeborg Bachmann einmal resignierend feststellte. Auf die Gedichte der Gestundeten Zeit gemünzt, in denen die Schrecknisse der Vergangenheit ebensowenig ausgespart werden wie die der Gegenwart, sprach die bürgerliche Literaturkritik rühmend vom „Wohllaut des Schrecklichen“. Diese Gedichte sind, was sie in ihren Frankfurter Vorlesungen über die Lyrik Günter Eichs sagte, „erkenntnishaltig, als müßten sie in einer Zeit äußerster Sprachnot aus äußerster Kontaktlosigkeit etwas leisten, um die Not abzutragen“. Auch die eigene Not. Denn sie war, wie Hilde Spiel in einem Nachruf schreibt, „ein Bündel aus Spannungen, hatte diesen guten scharfen Verstand,… hatte diese bebende Empfindsamkeit, litt auch mit den Erniedrigten und Beleidigten… und war zugleich eine Frau, die den Männern gefallen wollte, gern an Luxus roch wie an einem Rauschkraut, das ihr die Todesfurcht nahm“.
Auf den „Stufen der Schwermut“ tiefer und tiefer fallend, „mit dem scharfen Gehör für den Fall“, vermittelte sie in ihrem ersten Lyrikband dennoch „Formeln“ für eine Haltung des Widerstandes, des stolzen Bewahrens. In ihrem zweiten, 1956 erschienenen Gedichtband Anrufung des Großen Bären ist in einigen Gedichten außerdem eine fast zuversichtlich wirkende, bejahende Haltung spürbar, zu der Ingeborg Bachmann in den Jahren 1952/53 vorübergehend fand oder die sie sich doch zumindest abverlangte. Zu diesem optimistischeren Wirklichkeitsverständnis mögen drei in diese Zeit fallende Begegnungen beigetragen haben.
Im Mai 1952 war sie auf einer Tagung der Gruppe 47 zum erstenmal Hans Werner Henze begegnet. Aus diesem ersten Kennenlernen erwuchs eine intensive, etwa bis 1966 währende Zusammenarbeit mit dem Komponisten. Ingeborg Bachmann war eine „Musikkundige von hohem Wissen und Geschmack“, hatte sehr früh schon Kompositionsversuche gemacht, den Plan, Musik zu studieren, jedoch wieder aufgegeben. Sie akzeptierte Musik stets als der Sprache, überlegenes Ausdrucksmittel menschlichen Fühlens. So geriet die Zusammenarbeit für beide Künstler fruchtbringend: Henze schrieb die Musik zu Ingeborg Bachmanns Hörspiel Zikaden und vertonte einige ihrer Gedichte; Ingeborg Bachmann schrieb eine Textfassung für die Ballettpantomime Der Idiot und die Libretti zu Henzes Opern Der Prinz von Homburg und Der junge Lord. Formale Prinzipien der Musik, insbesondere das der Variation, übernahm sie in viele Gedichte.
Die zweite in diese Zeit fallende wichtige Begegnung war die mit einer Landschaft: Im September 1952 reiste sie mit ihrer Schwester Isolde zum erstenmal nach Italien, in das Land, in welchem sie dann vom Spätsommer 1953 an – wenn auch mit Unterbrechungen – gelebt hat. In diesem „lichtüberströmten Land“ erwachte sie zum Schauen, dort fiel ihr Leben zu – so heißt es in einem Gedicht auf dieses ihr „erstgeborenes Land“. Jetzt stand sie nicht mehr nur unter dem selbst auferlegten Zwang des Sehen-Wollens, jetzt schien sie sich eine Zeitlang des Sehen-Könnens bewußt und sicher zu sein. Hinzu kam der Glaube an die die Zeit überdauernde Kraft des Wortes. Hieß es in der „Gestundeten Zeit“:
… Unsere Gottheit,
die Geschichte, hat uns ein Grab bestellt,
aus dem es keine Auferstehung gibt,
so verband sich mit diesem Wissen jetzt die Hoffnung:
Doch das Lied überm Staub danach
wird uns übersteigen.
Daß den Tod nur Lieder aus wahren, „kristallinischen Worten“ überdauern werden, die der „eigenen Bewußtseinslage und dieser veränderten Welt“ entsprechen; dessen war sie sich ebenso bewußt wie der Schwierigkeit, solche Worte zu finden. So zeugen denn auch die Gedichte der Anrufung einerseits vom Vertrauen in das Wort als Repräsentant des Seins, vom Glauben an seine erlösende Kraft – „Mein Wort, errette mich!“ wie sie andererseits auch den Zweifel artikulieren, den genauen, einzig möglichen Ausdruck für ein Gefühl, eine Sache finden zu können:
Hätt ich das Wort,
(verfehlt ich’s nicht).
Bei aller eingestandenen Schwierigkeit aber hatte sie Sprachlosigkeit und Stummheit, in welche viele spätbürgerliche Schriftsteller ganz oder doch zeitweilig flüchteten, stets als Niemandsland, als verschenkte Chance empfunden. Das Verstummen war für sie eine Versuchung, gegen die sie sich wehrte, indem sie die Grenzen des Sagbaren zu erweitern suchte – in diesen Jahren mit mehr Hoffnung, auch die eigene Todesfurcht mindern zu können:
Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten,
doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand.
Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten,
dem unbekannten Ausgang zugewandt.
Italien wurde für sie auch in anderer Hinsicht zu einer wichtigen Lebensstation. Rückblickend auf ihre Kindheit, schrieb die am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geborene und in Kärnten auch aufgewachsene Dichterin einmal, sie glaube, die Enge ihres heimatlichen Tales und das Bewußtsein der Grenze hätten ihr das Fernweh eingetragen. Sie habe ihre Gedanken früh schon auf Reisen geschickt „in fremde Städte und Länder und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem Himmel den Erdkreis schließt“. Immer seien es „Meer, Sand und Schiffe“ gewesen, von denen sie träumte. Nach ihrem Studium in Wien bereiste sie viele Städte und Länder, trug aber ein Leben lang nicht nur dieses Fernweh, sondern auch eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Heimat im Herzen. Rom als „historisch nicht abgeschlossene Stadt“ hat sie in diesem Sinne für einige Jahre Ruhe finden lassen: „Das Kommen und Gehen und Wiederkommen – die Utopie in Permanenz, das geistige Heimatgefühl“, das sie hier empfand, trat „an die Stelle des Gefühls von physischer Heimatlosigkeit“, von dem sie meinte, daß es in der Welt zunimmt.
Die dritte in diese Zeit fallende Begegnung war vermutlich eine Wiederbegegnung, die mit dem Werk eines, wie sie selbst, in Klagenfurt geborenen Schriftstellers, mit Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Aus der intensiven Beschäftigung mit diesem Roman entstanden 1953 ein Radio-Essay und eine Beitragsfolge für die Zeitschrift Akzente. In beiden verdeutlichte sie die zum Scheitern verurteilte Erinnerung einer gesellschaftsfernen Utopie, eines Lebens jenseits aller gesellschaftlichen Konventionen. Ihre Gedichte, wenn auch von Aufbruch, Ausfahrt und immer neuer „Landnahme“ kündend, zeigen weniger als die in den Jahren danach entstandenen Hörspiele und Erzählungen, daß sie gerade vom Musilschen Gedanken der Kündbarkeit aller gesellschaftlichen Konventionen her zu einer Vorstellung davon gelangt ist, wie menschliches Denken und Erleben aktiviert werden kann.
Auch für sie war gewiß, daß der rigorose Austritt aus der Gesellschaft einer Selbstzerstörung gleichkäme, und sie hat dementsprechend ihre literarischen Gestalten den endgültigen Austritt aus der Gesellschaft mit dem Leben bezahlen lassen. Aber „innerhalb der Grenzen“ den Blick zu richten „auf das Vollkommene, das Unmögliche, das Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe“, darin sah sie eine Chance, denn, so meinte sie: „Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten.“
Diese Orientierung am letztlich Unerreichbaren, das immer wieder neue Erzeugen eines Spannungsverhältnisses zwischen dem real Gegebenen und dem nur denkbaren Möglichen erschien ihr wohl geeignet, jene Unabhängigkeit individuellen Erlebens und Denkens zu erlangen, mit der allein der Entmündigung des einzelnen zu begegnen wäre, der satten und selbstgerechten Bequemlichkeit der schablonenhaft Denkenden ebenso wie dem dumpfen Trott der Entmündigten oder der an ihrer Machtlosigkeit Verzweifelnden. Der Glaube an die Möglichkeit differenzierten und vorurteilsfreien Betrachtens der Wirklichkeit und die Hoffnung, zumindest vorübergehend vom gewohnten, auf Konvention beruhenden Erleben abweichen zu können, haben in ihr vermutlich in diesen Jahren die Zuversicht bestärkt, als Schriftstellerin etwas unternehmen zu können gegen die zunehmende geistige und emotionale Erstarrung, die zunehmende Unfreiheit der Menschen in ihrer Umwelt. Um dies erreichen zu können, wollte sie verständlich sein für den Leser, von dem sie meinte, daß man von ihm „eine hohe Meinung haben muß und darf“; sie wehrte sich dagegen, ihre Gedichte zu „verrätseln“. Dennoch wird ihre Bildwelt mitunter als schwer zugänglich empfunden. Von der Naturlyrik im herkömmlichen Sinne distanzierte sie sich 1964 in einem Interview nachdrücklich. Dargestellte Landschaften in ihren Gedichten erweisen sich stets auch als geistige Räume; die Worte bauen vorstellbare Landschaften auf, benennen zugleich aber auch spezifisch Menschliches und ermöglichen gerade dadurch sinnenhaftes Erleben geistiger Erkenntnisse.
Die unmittelbare Verbindung von Sinnlichkeit und Abstraktion, in den Gedichten der Anrufung vollkommener als zuvor erreicht, wurde von der Literaturkritik emphatisch gerühmt, zumal sie zum Bild einer exemplarischen sensiblen Intellektuellen paßte, zu welchem die Öffentlichkeit Ingeborg Bachmann längst stilisiert hatte. Sie selbst empfand wohl nicht erst 1971, nach dem Erscheinen ihres Romans Malina, die Verschränkung zweier so ungeheuer gegensätzlicher Eigenschaften, „die nicht ohne einander sein können und die gegeneinander sein müssen“, als „Hochspannung“, durch welche eine von beiden „untergehen“ muß. Befähigt, auch ihre eigenen Empfindungen zu analysieren und zum Objekt ihrer Gestaltung zu machen, erlebte sie sich schon in diesen Gedichten mehr als Gezeichnete denn als Ausgezeichnete:
Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann:
sollt ich die kurze schauerliche Zeit
nur mit Gedanken Umgang haben und allein
nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun?
Muß einer denken? Wird er nicht vermißt?
In den Jahren nach dem Erscheinen ihres zweiten Gedichtbandes hat Ingeborg Bachmann nur noch achtzehn Gedichte geschrieben. Sie wurden verstreut in Zeitschriften oder über Rundfunk publiziert, zum Teil erst im Nachlaß aufgefunden. Geschrieben hat sie die meisten dieser Gedichte vermutlich 1957, im Jahr ihrer Veröffentlichung. Die Jahre danach ließen sie als Lyrikerin allmählich und von ihr bewußt erlebt verstummen. Schon 1961, als sie nach vierjährigem Schweigen mit einem Gedicht für Nelly Sachs („Ihr Worte“) wieder als Lyrikerin an die Öffentlichkeit trat, war es, ihrer eigenen Aussage zufolge, fraglich, ob weitere Gedichte folgen würden.
Das Gedicht, mit dem sie sich 1965 doch wieder als Lyrikerin äußerte, ist Anna Achmatowa gewidmet und 1964 nach der Begegnung mit der sowjetischen Lyrikerin in Rom entstanden. Auf ihre letzten Gedichte aus den Jahren 1964 bis 1967 trifft zu, was sie in bezug auf ihr Nelly Sachs gewidmetes Gedicht sagte: Es sind „Gelegenheitsgedichte“ im Goetheschen Sinne, geschrieben nach Begegnungen mit befreundeten Künstlern und als heimatlich empfundenen Landschaften.
Ingeborg Bachmann hatte in ihren Frankfurter Vorlesungen das Verstummen eines Dichters als Folge der „Not des Schriftstellers mit sich und der Wirklichkeit“ interpretiert. Ihre letzten Gedichte belegen diese These. Getragen teils von tiefer Hoffnungslosigkeit, teils von verzweifelter Sehnsucht nach Heimat, ähneln sie im Grundton ihren frühen Gedichten:
Nichts mehr gefällt mir.
Aber die Verzweiflung ist hier weitreichender; der Glaube an die Kraft des Wortes, eine Zeitlang Lebenshilfe, schlägt in Sprachverzweiflung um. „Mein Teil, es soll verloren gehen“ – dies klingt wie der Widerruf ihres dichterischen Schaffens. Auch ihr vermutlich letztes, 1967 geschriebenes und Hans Werner Henze gewidmetes Gedicht „Enigma“ hat diesen hoffnungslosen Grundton: „Nichts mehr wird kommen“, zitiert sie in der ersten Zeile die Peter-Altenberg-Lieder von Alban Berg. Und selbst die aus Gustav Mahlers dritter Sinfonie entlehnte Zeile „Du sollst ja nicht weinen“ klingt in diesem Kontext vernichtend, während sie bei Mahler, der sie in den Text aus Des Knaben Wunderhorn eingefügt hatte, durchaus tröstend gemeint war.
Ingeborg Bachmann aber scheint Trost nur noch von einem visionären Land erhofft zu haben, das sie „Böhmen“ nannte und von dem sie wenige Monate vor ihrem Tod erläuternd sagte, daß sie damit ja nicht nur Böhmen meine, „sondern unser aller Land, nach dem wir suchen“. Im Gedicht „Böhmen liegt am Meer“ beschrieb sie es als Land, in dem die Symbiose von Ordnung und Freiheit gelingt, welche sie in ihrem Werk oft entworfen und ebensooft in Frage gestellt hat. Wunschdenken und Wirklichkeitserleben scheinen in diesen Jahren immer stärker zu divergieren.
Gehen, schrittweis ist es wiedergekommen,
Sehen, angeblickt, habe ich wieder erlernt,
heißt es in einem der letzten Gedichte. Beide Zeilen wurden in einer im Nachlaß aufgefundenen Textvariante von Ingeborg Bachmann gestrichen, die eigene Streichung aber am Rande des Textes wieder, mit zwei Fragezeichen versehen – Zeichen immer weniger gelingenden Widerstandes gegen die Verzweiflung? Ihr unvollendet gebliebener Romanzyklus Todesarten, an dem sie seit 1963 arbeitete, verdeutlicht, daß ihre Sensibilität für Bedrohungen menschlicher Individualität zunahm. Wo sie unmittelbare Kommunikation ersehnte zwischen Dichtung und Gesellschaft, zwischen den Menschen, sah sie überdeutlich nur noch Tod, Angst, Mord. Dies registrierend, aber nicht ändern, nicht einmal sich selbst dagegen wehren könnend, beschränkte sie sich darauf, „diese Tatsachen“ darzulegen.
Kein „Richtungnehmen“ mehr, aber auch keine Selbstaufgabe. Schreibend wollte sie bis zuletzt „Realität“ erreichen, Realität, die überdauert:
Wart meinen Tod ab und dann hör mich wieder.
Vera Hauschild, Nachwort
Die vorliegende Ausgabe
umfaßt das lyrische Werk Ingeborg Bachmanns aus den Jahren 1948 bis 1967. Neben den zu Lebzeiten in Buchform erschienenen Gedichtsammlungen Die Gestundete Zeit und Anrufung des Großen Bären enthält sie auch die wichtigsten der verstreut in Zeitschriften, Zeitungen und Rundfunk-Veranstaltungen publizierten sowie einige der im Nachlaß aufgefundenen Gedichte. Allen Texten liegt die 1978 im Piper-Verlag München erschienene Werkausgabe in vier Bänden zugrunde. Die in dieser Ausgabe von den Herausgebern hinzugefügten Überschriften sind im Inhaltsverzeichnis mit * gekennzeichnet.
Von ähnlicher Wegsuche im Dunkel
– Zu Gedichten von Ingeborg Bachmann und Paul Celan bei Insel und Aufbau. –
Johannes Bobrowski starb 1965 achtundvierzigjährig in Berlin, Paul Celan suchte in Paris 1970 fünfzigjährig den Tod in der Seine, Ingeborg Bachmann erlag 1973 siebenundvierzigjährig schweren Verbrennungen in Rom – drei Dichter, von denen heute sicher ist, daß sie Bleibendes schufen, die früh und fast gleichaltrig starben. War ihr Werk abgeschlossen? Wer wollte das sicher entscheiden! Aber im Rückblick kommt das Nachdenken an kein Ende.
Es fügt sich glücklich, daß Ingeborg Bachmann und Paul Celan jetzt gleichzeitig in zwei Verlagen unserer Republik mit ihrem lyrischen Werk präsentiert werden. Als Band 1037 der Insel-Bücherei erschienen die Gedichte der Österreicherin, auf 154 Seiten das ganze Werk, die beiden Gedichtbände, die ihren Ruhm begründeten, Die gestundete Zeit (1953) und Anrufung des Großen Bären (1956), dazu einige frühe Verse und jene nur achtzehn Gedichte, die bis 1967 noch folgten (danach verstummte die Lyrikerin und schrieb nur noch Prosa). Ein schmales Werk, das im Rückblick nichts verloren hat von seiner anfänglichen Faszination, nur daß es – aller Modernität und Kühnheit ungeachtet – sich heute doch in große Traditionslinien einfügt; Rilke, Hofmannsthal, Trakl, Else Lasker-Schüler wären zu nennen. Zu diesen Gedichten hat Vera Hauschild ein eindringliches Nachwort geschrieben.
Ingeborg Bachmanns Gedichte reden von den ältesten Themen der Lyrik, von Liebe und Tod, vom Sichfinden in der Welt, von Macht und Ohnmacht des Dichterworts. Was sie signalisieren, sind die Leiden, Isolierungen, Entfremdungen eines wachen und sensiblen Geistes in der sich verfinsternden, verkrustenden Bürgerwelt von heute, rückhaltloses Bekennen von Angst und Verlorenheit, aber auch ein stilles, stolzes Dennoch inmitten allen Dunkels. Das ist, wie die Dichterin formulierte, Poesie „scharf von Erkenntnis“ und „bitter von Sehnsucht“, aber groß in ihrer weiträumigen, landschaftsbetonten Bildsprache, im tönenden Wohllaut ihrer Verse, deren vorwiegend herkömmliche Metren und Rhythmen, deren klarer, ruhiger Satzbau in subtiler Spannung zu ihrem Weltbild stehen. Sinnlichkeit und Abstraktion haben sich im deutschen Gedicht selten so vollkommen zusammengefunden.
(…)
Eberhard Haufe, Thüringer Tageblatt, 9.10.1980
Geschmacksurteile
− Über Ingeborg Bachmanns Gedichte. −
Nein, diese moderat oder gemäßigt genannte Moderne, der ihre Lyrik von Anfang an und immer wieder zugerechnet wurde, und für die sie schließlich gefeiert worden ist, hat nichts mit der Konsequenz und den daraus für das Gedicht folgenden Konsequenzen zu tun, die mir gefällt oder je hat gefallen können.
Für mich haben Ingeborg Bachmanns Gedichte sich nie wirklich aus der Masse der deutschsprachigen Nachkriegslyrik herausgehoben, in der ja so unangenehm und lauthals das „Schweigen“ und die „Schatten“ (ubiquitär), die „Fracht“ (welche bloß, nach 1945?) oder – bruchlos genug – „die schöne Stille der Gewächse“ (Karl Krolow) beschworen wird. Ja, sie hatten allerhand zu vergessen, damals – „Herber Trank aus dem Eichenfaß / schwemmt durch den Hahn ins blinkende Glas“ (Heinz Piontek). Vergessen wir nicht, daß auch der frühe Paul Celan, vor Sprachgitter, bis auf wenige Fügungen nur schwer erträglich ist. 50er Jahre Gedichte: ein angestrengtes Waten in Vierfruchtmarmelade, möchte ich sagen, in der Vierfruchtmarmelade der Bilder, versteht sich.
Zwei Gedichtbände – knallberühmt, keine schlechte Ausbeute. Ich sage das ohne Ironie, wie käme ich dazu. Für Ingeborg Bachmanns Karriere als Dichterin, bei tatsächlich durchschnittlicher Produktion, gibt es Anhaltspunkte. Es war Anfang der 50er die Planstelle für die Poetessa (nur eine bitte!) im deutschsprachigen Raum neu zu besetzen. Die aus Depression, Versagen, Selbstbezichtigung und ehrlicher Trauer geborenen Erinnerungen an Else Lasker-Schüler des Gottfried Benn von 1952, zeigten der jungen Autorengeneration, wie dem Publikum, die Leerstelle deutlich an – die kriegsgeprägte, auf autoritäre Strukturen konditionierte Gruppe 47 reagierte bekanntlich umgehend. Reagierte bekanntlich auch auf die junge, gutaussehende, nicht NS-kontaminierte, akademisch gebildete, akademische Dichterin (dies nahm man, wie es scheint, in Kauf), der man sich, zuletzt Marcel Reich-Ranicki, etwa so entsann: „An unsere Gespräche kann ich mich sonderbarerweise nicht erinnern, wohl aber an ihr Aussehen.“ Tragisch, naja, O. K.; das eben sind – Geschmacksurteile.
Hier sei gesagt, daß es sich bei ihren 2000 erschienenen Unveröffentlichten Gedichten, entgegen der von unterschiedlicher Seite geäußerten Einwände, selbstverständlich um Gedichte handelt! Um durchschnittliche Gedichte. Im Zusammenhang mit der steigenden Bedeutung Christine Lavants habe ich von der „artifiziellen Schneewittchenhaftigkeit“ bachmannscher Verse gesprochen, der ihrerseits, weit mehr vermutlich, als bisher bekannt, die Klagenfurterin Dank geschuldet hat. Man nehme nur, bei der Natur-Bildwelt Bachmanns (z.B. „Die blaue Stunde“), die lunar-lunatischen Metaphern in Augenschein, vergleiche sie mit denen der Lavanttalerin, die in weitaus bedrohlicheren, existentielleren, schärferen, letztlich: schöneren Chiffren imstande war zu schreiben.
Es trifft sich ganz einfach mit dem Mainstream-Kitsch, der (ja nicht allein sexuell) verdrucksten Adenauerjahre, wenn wir („Das Spiel ist aus“ – sogar der Opener der Anrufung) zu lesen bekommen:
Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt,
es rinnt uns der Sand aus den Haaren,
dein und mein Alter und das Alter der Welt
mißt man nicht mit den Jahren.
Die „klebrige Spinnenhand“ der darauf folgenden Strophe spare ich, dann geht es so weiter:
Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee
das Wort noch weiß, hat gewonnen.
Ich muß dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee
Im Garten zerronnen.
Nun geht das ja, endgereimt oder in freien Rhythmen, so bei ihr in einer Tour! Eine Kulissenschieberei, ein unelegantes Gewuchte von Bildern. Zu der ein ungebrochenes, ein Urvertrauen in die Metapher, und besonders in die Genitivmetapher kommt (diese „Nachgeburt der Schrecken“, diese „tragische(n) Spinnen der Gegenwart“, ja tragisch), die dermaßen gefällt, daß gern bis zu drei davon aufeinander folgen dürfen, meine Schrecken zu perpetuieren. Dazu kommt dieses klassizistische Herumfummeln mit Hölderlin; schwächste Beherrschung von Montageverfahren („Reklame“). Ich belasse es dabei, mir tut das weh.
Ingeborg Bachmann konnte und konnte keine übers Mittelmaß hinausreichenden Gedichte schreiben, ich stehe mit diesem Urteil nicht allein. Eine kleine, gehypte Dichterin; was sie erkannt haben könnte. Und eben eine große Schriftstellerin: gut, daß sie die Prosa für sich entdeckt hat, und jeder weiß, daß sie dort Bedeutendes geleistet hat. Ich wende diesen klasse Bachmann-Satz auf ihre Lyrik an – er steht in Malina: „Ich könnte mich nicht durch ein Buch ,hindurcharbeiten‘, das würde ja schon an Beschäftigung grenzen.“
Lest ihre Prosa; mit wem sie wann schlief, daß sie nach drei Bissen wieder rauchte, sodann ihre Kippe im Spiegelei ausdrückte – vergeßt das, lest ihre Schriften.
Thomas Kling, aus: Thomas Kling: Botenstoffe, DuMont Buchverlag, 2001
Wie ich Ingeborg Bachmann in New York hören,
aber nicht sehen konnte
Ich finde es schwierig, mich an meine erste Lektüre Ingeborg Bachmanns zu erinnern, ohne dabei an die wechselnden Jahrzehnte zu denken, in welchen man sie so oder so und nicht anders las. Ein nahezu achtzigjähriger Leser hält anderes fest als der Vierzig- oder Zwanzigjährige (wenn der nicht gleich ins Kino geht), und da ich der ersten Gruppe angehöre (mit Ausnahme meines chronischen Kinofiebers), liegt es mir nahe zu behaupten, daß Ingeborg Bachmann mit dem Anfang ihrer Arbeiten in eine besondere Situation der Literatur deutscher Sprache geriet. Es war noch die große Zeit der Lyrik, elf, zwölf Jahre nach dem Krieg und der Diktatur, ehe die Epiker ihre ersten Romane publizierten – Die Anrufung des Großen Bären erschien im Jahre 1956 und schon ein Jahr später Die Blechtrommel. Ingeborg Bachmann war ein lyrisches Glückskind, denn es war so, als hätten alle, Idylliker und Engagierte, Linke und Rechte, alternde Traditionalisten und jüngere Existenzialisten, ihre Gedichte erwartet, die alle Hoffnungen erfüllten und alle Skepsis verstummen ließen. „Am Abend Stimmenauflauf an den Zäunen / Andacht und Rosen werden laut zerpflückt“, in althergebrachten Vierzeilern, noch mit Spuren von Reimen, aber auch schon modische Nachrichten aus der City, „sie küßt in den Bars mit dem Strohhalm / die Gläser tief auf den Mund“, reimlos und in freien Versen, ja sogar die ersten Polemiken gegen die industrielle Reklame „was sollen wir tun / heiter und mit Musik“, und dann wieder Apulisches, Algarven, Schiffe, Wolken und Sonne (zur gleichen Zeit, als die deutschen Reisenden des Wirtschaftswunders an die blauen Strände drängten). Noch immer, wenn ich heute lese, erkenne ich ihre Lektüre, Trakl, Rilke und mehr als einen Hauch von Benn – zugleich aber ihre wunderbare poetische Energie, die sich wie tanzend über die Quellen ins originale Gedicht hinwegsetzt.
Cut, to New York, ungefähr 1970, der große Saal des Goethe-Hauses, Fifth Avenue und 72. Straße, gegenüber dem Metropolitan Museum, mit den breiten antiken Stufen, das Publikum in Erwartung der Poetessa, die heute lesen soll, College kids, ältere Damen, die Presse, österreichische und deutsche Emigranten, längst native New Yorkers, drängen über die Stühle in die Ecken. Es war nicht einfach, sie zu sehen; die Hörer und Hörerinnen bildeten eine dunkle Masse, ich stand hinten und glaube mich jetzt daran zu erinnern, daß sie ein merkwürdiges Pagenkleid trug (schwarze Seide?), als sie durch den Mittelgang zum Lesepult ging. Ich weiß nicht einmal, was sie dann las; ich hoffe, einige Prosa aus dem Dreißigsten Jahr und nicht aus dem älteren Hörspiel Der gute Gott von Manhattan. Dieser Text von der großen Liebe und einem kleinen Rückfall, von 1958, war noch fast exotisch in seiner expressionistischen Sprache, Symphonie einer Großstadt, der Großstadt:
Die Schornsteine röhrten und standen da wie Kolonnen eines wiedererstandenen Ninive und Babylon, und die stumpfen und spitzen Schädel der Gigantenhäuser rührten an den grauen Tropenhimmel, der von Feuchtigkeit troff und wie ein unförmiger ekliger Schwamm die Dächer näßte.
Nur die beiden Liebenden passen da nicht herein, denn es sind literarische Zuckerpuppen aus der Provinz, die Liebe agieren, eben der Pubertät entronnen, aber nicht ganz, weil sie sprachlich auch in einer minderen Brecht-Szene stehen könnten, „weil jeder sehen kann, daß ich bald ganz verloren sein werde, und fühlen kann, daß ich ohne Stolz bin und vergehe nach Erniedrigung; daß ich mich jetzt hinrichten ließe von dir oder wegwerfen wie ein Zeug nach jedem Spiel, das du ersinnst“. Ich weiß nicht, ob die Autorin damals diese Worte Jennifers las, aber ich weiß ganz genau, und ohne die soft lens der Erinnerung, daß sie die Hörerschaft in ihrer Gewalt hatte, auf die sanfteste und bescheidenste Tour.
Klaus Amanns Essay über Ingeborg Bachmann und die literarische Öffentlichkeit (Drava Verlag, Klagenfurt/Celovec 1997) ist eine der wenigen Arbeiten, die mir den Zusammenhang von Leben und Werk kritisch zu erklären suchen. Das Merkwürdige dabei ist, daß dieser Essay das Biographische in unserer Lektüre und aus der Anziehungskraft der Texte möglichst ausschalten will, um das Poetische selbst zu betonen oder gar zu retten, und doch gegen seine Absicht die vielen Affären, Skandalgeschichten und abgeblitzten Liebhaber ins Spiel bringt, von denen die Leute immer tuschelten, und nicht immer hinter der vorgehaltenen Hand. Ich kenne Klaus Amann nicht gerade als Formalisten oder Strukturalisten, der den literarischen Text, oder sein inneres Gerüst, aus den leidigen Lebenskontexten schneiden möchte, und kann mich doch des Eindrucks nicht erwehren, daß er sich uns Formalisten nähert, wenn er wütend gegen die Bachmann-Reminiszenzen Sigrid Weigels, Hermann Hakels oder das Ägyptenbuch polemisiert, das ein einstiger corteggiatore lange nach den Ereignissen, wenn es welche waren, publizierte. Die Schwierigkeit liegt eben darin, daß Amann rechtens sagt, Ingeborg Bachmann habe in der späteren Hälfte ihres Lebens „der ihr zugeteilten Rolle als Dichterin und Literaturdiva nicht mehr entsprechen wollen“, und so die Möglichkeit zuläßt, daß sie die ihr von den Patriarchen zugedachte Rolle in der ersten Hälfte ihres Lebens suchte und mit Lust inkarnierte. Die Frage bleibt offen, ob man die späteren Entscheidungen in ihren frühen Lebensgang projizieren darf. Alle Menschen, auch österreichische Autorinnen, haben ihr Recht auf Wandlung und Revision ihrer Existenzgründe (einschließlich ihrer Irrtümer), und so gerne ich glaube, daß es auch der jungen Bachmann um den „geistigen Prozeß des Ich“ ging, so wenig vermag ich zu glauben, daß sich dieser Prozeß ohne den Versuch abspielte, das Personale, ein Ich aus Fleisch und Blut, auf der literarischen Szene, die maskulin genug gewesen sein mag, strategisch in Szene zu setzen.
Die Ansprüche, die Ingeborg Bachmann als Person ihrer Epoche und als Schriftstellerin an sich stellte, waren hoch und unbedingt. Ungeachtet ihres Wortes, wir sollten uns unserer Grenzen bewußt bleiben, war sie süchtig nach Grenzüberschreitungen in einem rigorosen Sinn, wie ihr Verbündeter Kleist. Sie spricht ja, in einer Frankfurter Vorlesung, von sich selber als einem Schriftsteller (maskulin), „erkenntnissüchtiger, deutungssüchtiger, und sinnsüchtiger als andere Menschen“; und in ihrer Poetik hat die Vorsilbe Un- eine fundamentale Funktion – das Vollkommene als das Unmögliche und Unerreichbare, den Blick nicht im Horizontalen befangen, sondern auf das „Aufreißen einer Vertikale“ gerichtet. Sie glaubt an eine explosive, vielleicht sogar apriori Energie, welche die Schreibende, die sich nicht mit niederen Potentialitäten und dem Erreichbaren zufriedengeben darf, mit ihren Stößen in eine transzendentale Dimension treibt, aber sie ist sich nicht eben klar über den Charakter dieser Energie und nennt sie „den moralischen Antrieb“ vor jeder Moral, und fügt nichts mehr hinzu.
Hermann Broch sagte einmal, die wahren Romantiker in unserer Epoche der Relativität seien die vom Absoluten Besessenen oder, so bin ich versucht hinzuzusetzen, die nach dem Absoluten Süchtigen. Daß sich ihr Anspruch gegen alle Verwirklichung in jener Sphäre des Horizontalen stellt, in welcher die Literatur des Jahrhunderts vor sich geht, das ist ihre Tragödie und ihre unvergleichbare Würde – sie entbindet aber den kritischen Leser nicht der Frage, wie und auf welche Art Ansprüche und Verwirklichungen auseinanderklaffen oder wie die Verwirklichung, die immer noch Sprache bleibt, hinter dem Anspruch einherschleift. Das Ganze spitzt sich auf die Frage nach Intensität zu, und ganz besonders in einer Zeit, in der (Ingeborg Bachmann zitiert die berühmtesten Österreicher) „das Vertrauensverhältnis zwischen Ich und Sprache und Ding“ längst erschüttert ist.
Ingeborg Bachmann manövriert sich als Autorin mehr als einmal in eine gefährliche Situation. Sie will Intensität und den Durchbruch ins Vertikale (der sonst Metaphysikern und Mystikerinnen vorbehalten bleibt), hat aber wenig Neigung, sprachliche Mittel wie jene schon historische Avantgarde umzuwälzen, welcher offenbar, wenn man ihr glauben will, der Entschluß zur moralischen oder besser: vormoralischen Stoßkraft fehlte (ich bin da eher einer Meinung mit Julia Kristeva, die schreibende Frauen nachdrücklich auf die revolutionären Leistungen der Avantgarde hinweist). Vertikalität und Intensität sind kein bequemes Engagement, denn sie verlangen nach Verwirklichung in anderen Textarten; die Vertikalität will die metaphysische Spekulation der Philosophen oder die Gebete der Mystikerinnen, die Intensität, das plötzlich Explosive oder Hochgespannte, wie wir es aus den glücklichsten Momenten der Poesie oder den Ausbrüchen des Dramas kennen. Das Epische ist etwas anderes; die Praxis der Prosa (weder vertikal noch intensiv) will analytisch sagen, wie etwas ist, nicht wie es sein sollte; und selbst den bedeutendsten schreibenden Frauen unserer Epoche, Margret Atwood, Doris Lessing oder Dacia Maraini, ist eine gelassene Pragmatik nicht fremd, die in die aufgefächerten Dinge der Welt und ihre Menschen hinblickt und in ihren waagrechten Verwicklungen, Reibungen und Paarungen jene „Signatur der Zeit“ hervortreten läßt, die Klaus Amann, mit Recht, als grundsätzliches Zeichen der künstlerischen Meisterschaft betrachtet (immer vorausgesetzt, daß wir wissen, wie diese Zeit ist, um sie dann in ihrer Signatur wiederzuerkennen), auch und gerade im Werk Ingeborg Bachmanns. Ob sie dort überall zu finden ist und nicht nur blaß oder wie dahinschwindend? Deshalb meine Abneigung gegen den Roman Malina und sein geschwätziges Wiener Arkadien (Seelenmarter in der Eden-Bar und im Sacher) und, im Gegensatz, meine stete Sympathie für Elisabeth Langgässers längst vergessenen Roman Märkische Argonautenfahrt, Zeitsignatur und Starkstrom-Sprache in einem. Ich hänge deshalb an Ingeborg Bachmanns Gedichten, besonders an den langen, die schon prosaisch sind (wie der „Großen Landschaft bei Wien“), und an ihrer Geschichte „Das dreißigste Jahr“, in der ihr Narzißmus die Welt, in der wir leben, noch nicht ganz entbehren darf. Sie hat sich den dringlichen Fragen der Gattungen, hie Lyrik, hie Prosa, in ein Zwischenreich entzogen, in dem sie sich von allem Klassifikationsdruck wie durch eine magische Volte befreit, nicht mehr ganz Lyrik, noch nicht ganz Prosa, eine Undine, noch halb in den Fluten, aber noch nicht ganz auf unserer Erde. Aus diesem Zwischenreich kommen ihre besten Stücke, die alle Fragen nach der Zeitsignatur und der Intensität ihrer Sprache außer Kraft setzen.
Peter Demetz, aus Reinhard Baumgart und Thomas Tebbe (Hrsg.): Einsam sind alle Brücken, Piper Verlag, 2001
Ekkehart Rudolph im Gespräch mit Ingeborg Bachmann im Jahr 1971.
AUF EIN FOTO VON INGEBORG BACHMANN
Eine Art Tunika über
schwarzem Rock in den
psychodelischen Farben der
70ger brutal ornamental ganz
unpassend dazu das ans Gespräch
verschenkte Lächeln und die
Zuckerdose in der Hand mit
weißblauer Städteansicht (Fachwerk)
der Schlagobers unsichtbar
aber gewärtig
im Haar verfangen
die römische Sonne
von Carinzia
Dagmar Leupold
Bachmann Loops von Tim van Jul
Stimmen zu Ingeborg Bachmann
Hermann Burger: Abend mit Ingeborg Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Peter K. Wehrli: Unverbunden in Zürich
DU, Heft 9, 1994
Uwe Johnson: Good Morning, Mrs. Bachmann
DU, Heft 9, 1994
Inge Feltrinelli, Fleur Jaeggy, Toni Kienlechner, Christine Koschel, Inge von Weidenbaum: Römische Begegnungen
DU, Heft 9, 1994
Hans Magnus Enzensberger: Überlebenskünstlerin Ingeborg Bachmann
Heinz Bachmann: „Die Ärzte wollten dringend wissen, ob es irgendwelche Medikamente gab“
Die Welt, 5.9.2023
Ingeborg Bachmann erhält den Georg-Büchner-Preis 1964. Dankesrede und kurzer Fernsehbericht über sie inklusive Interview. Außerdem Rezitation des Gedichts „Die große Fracht“.
Zum 10. Todestag der Autorin:
Christa Wolf: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
DU
Zum 30. Todestag der Autorin:
Rolf Löchel: Es schmerzte sie alles, das Leben, die Menschen, die Zeit
literaturkritik.de, Oktober 2003
Zum 40. Todestag der Autorin:
Jan Kuhlbrodt: Zum 40 Todestag von Ingeborg Bachmann
signaturen.de
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Susanne Petersen: „Keine neue Welt ohne neue Sprache“
Sonntagsblatt
Diemut Roether: Ein Ungeheuer mit Namen Ingeborg
die taz, 23.6.2001
Otto Friedrich: Zum 75. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
Die Furche, 20.6.2001
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Evelyne von Beime: „Doch das Lied überm Staub danach / wird uns übersteigen“
literaturkritik.de, Juni 2006
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Ria Endres: „Es kommen härtere Tage“
faustkultur.de, 15.6.2016
Hans Höller: Ingeborg Bachmann: Phänomenales Gedächtnis ganz aus Flimmerhaar
Der Standart, 25.6.2016
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Hans Höller: Die Utopie der Sprache
junge Welt, 26.6.2021
Zum 50. Todestag der Autorin:
Hannes Hintermeier: Horror vor der Sprache der Bundesdeutschen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2022
Edwin Baumgartner: Bachmann für Verehrer
Wiener Zeitung, 24.11.2022
Ingeborg Bachmann: Eine poetische Existenz auf der Rasierklinge
Kleine Zeitung, 16.10.2023
Hans Höller: Kriminalgeschichte der Autorschaft
junge Welt, 17.10.2023
Claudia Schülke: Elementare Grenzgängerin
Sonntagsblatt, 11.10.2023
Paul Jandl: Vor fünfzig Jahren starb Ingeborg Bachmann an schweren Brandverletzungen. Dann gab es Gerüchte über einen Mord, und es entstand ein Mysterium
Neue Zürcher Zeitung, 17.10.2023
Teresa Präauer: Nur kurz hineinlesen – und nächtelang hängen bleiben
Die Welt, 17.10.2023
Andrea Heinz: Erinnerung an eine Unvergessene: Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann
Der Standart, 17.10.2023
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Forum + IMDb + ÖM + KLG +
Archiv 1, 2, 3 & 4 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Interview
Porträtgalerie: Keystone-SDA + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口


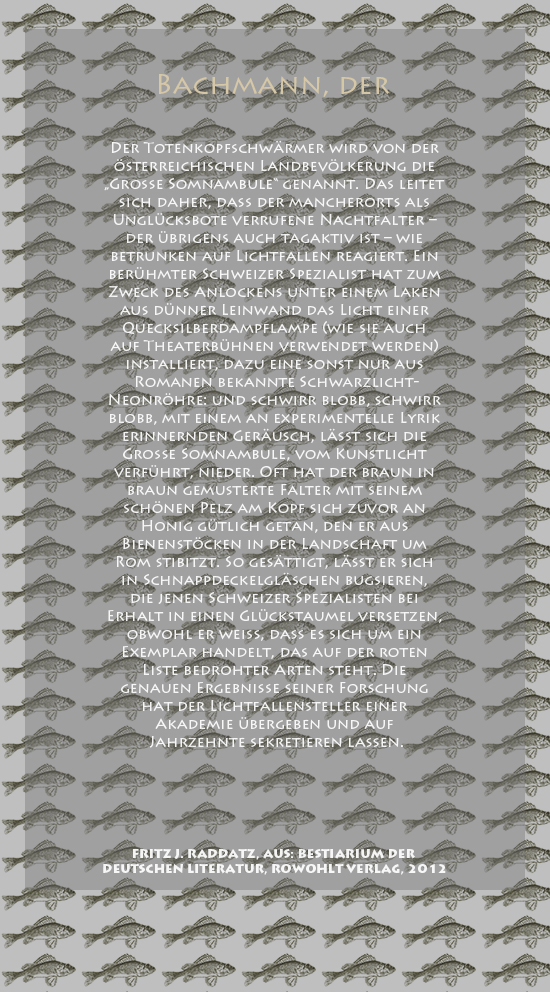












Schreibe einen Kommentar