Mahmud Darwisch: Belagerungszustand
Das Leben.
Das Leben in seiner Gänze,
Das Leben in seiner Unvollständigkeit
Empfängt benachbarte Sterne,
Die zeitlos sind…
Und wandernde Wolken,
Die ortlos sind.
Und das Leben hier
Stellt sich die Frage:
Wie kann man ihnen das Leben wiedergeben?
Belagerungszustand
ist eines der wichtigsten Bücher des palästinensischen Lyrikers Mahmud Darwisch. Die Gedichte, geschrieben unter dem Eindruck der israelischen Invasion, beginnen mit konfrontierenden Versen und enden mit einem Besingen des ersehnten Friedens zwischen Palästinensern und Israel.
In einer knappen, dokumentarischen Sprache reflektiert Darwisch das tägliche Leben unter der Belagerung, die Suche nach verlorener Menschlichkeit, und er hinterfragt den Mythos des „Märtyrers“.
Der Band umfasst Liebesgedichte ebenso wie politische Lyrik und imaginiert – wie ein Psychogramm – den Alltag unter der Besatzung, die kleinen Wunden und großen Sehnsüchte, quälende Ängste und robuste Hoffnungen.
Verlag Hans Schiler, Klappentext, 2006
Die Trümmer des künftigen Troja
HALAT HISAR nannte Mahmoud Darwish seinen 2002 in arabischer Sprache veröffentlichten Gedichtband, der 2005 zweisprachig unter Belagerungszustand im Hans Schiler Verlag, Berlin erschien.
Es ist eines seiner wichtigsten Bücher und erschien zur Zeit der zweiten Intifada, des zweiten Aufstandes der Palästinenser gegen die israelische Besatzung. Sie begann im September 2000 und zog Palästina und Israel in blutige Gemetzel, von denen sich viele der hineingerissenen Menschen bis heute noch nicht erholt haben.
Es war die Zeit
der Selbstmordattentate durch Palästinenser, vorwiegend in der Gegend um Hadera,
des Lynchens israelischer Soldaten in der Westbank, die sich verfahren hatten,
der Exekutionen führender Palästinenser durch die israelische Armee,
des Panzerrollens im Gazastreifen und der Westbank und
der Diskussion um den Mauerbau, um das Westjordanland endgültig abzuriegeln.
Es war die Zeit,
in der der Hass die Luft verseuchte und die Menschen auf beiden Seiten in tiefe Angst und Trauer stürzte,
in der auch zahlreiche jüdische Israelis auswanderten.
Belagerungszustand beginnt mit konfrontierenden Versen unter dem Eindruck der israelischen Invasion und endet mit einem Gesang über den ersehnten Frieden.
Mahmoud reflektiert hier das alltägliche palästinensische Leben unter der Belagerung, er sucht Menschlichkeit bei den Israelis und hinterfragt den Märtyrermythos der palästinensischen Selbstmordattentäter.
Der Gedichtband umfasst sowohl politische Lyrik wie auch Liebesgedichte:
Hier, an den Hängen der Hügel, im Angesicht der sinkenden Sonne
und des Schlundes der Zeit
nah den schattenberaubten Gärten
tun wir, was Gefangene tun,
tun wir, was Menschen tun ohne Arbeit:
wir nähren die Hoffnung.
Kein homerisches Echo hier von irgend etwas.
Die Mythen pochen an unsere Türen, wenn wir sie brauchen
kein homerisches Echo von irgend etwas…
Hier ist ein General, der gräbt nach einem schlafenden Staat
unter den Trümmern eines künftigen Troja
Soldaten messen den Abstand zwischen dem Sein
und dem Nichts
mit dem Zielrohr eines Panzers
Wir messen den Abstand zwischen unseren Körpern
und der Granate mit dem sechsten Sinn
ICH ODER ER
so beginnt der Krieg.
Doch er endet mit einer beschämenden Begegnung
ICH UND ER.
Die Seele steige ab,
um auf ihren seidenen Füßen zu gehen
an meiner Seite, Hand in Hand, wie zwei alte Freunde,
die sich das alte Brot
und den Kelch des alten Weines teilen,
auf dass wir diesen Weg gemeinsam gehen
bevor unsere Tage sich in zwei Richtungen scheiden:
Ich gehe ins Jenseits, sie aber hockt,
die Arme um ihre Beine geschlungen,
auf einem hohen Felsen
Die Belagerung macht mich von einem Sänger
zu einer sechsten Geigensaite
Mahmud Darwisch, die poetische Stimme des palästinensischen Volkes, war einer der herausragenden zeitgenössischen Dichter in der arabischen Welt. Zu den internationalen Auszeichnungen, die er für seine Arbeiten erhielt, zählen u.a. der Lenin-Friedenspreis (1983), der Lannan Cultural Freedom Award (2001), der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück (2003 zusammen mit dem jüdisch-israelischen Schriftsteller und Psychologen Dan Bar-On) sowie der Goldene Kranz (2007).
Mahmud Darwisch wurde 1941 in Barwa in der Nähe von Akko (damaliges Britisch-Palästina) geboren. Er starb am 09. August 2008 nach seiner dritten Herzoperation in Houston, USA.
Als Siebenjähriger musste Darwisch mit seiner Familie während des israelischen Unabhängigkeitskrieges unter israelischem Gewehrfeuer in den Libanon flüchten. Heimlich kehrte er nach Gründung des Staates Israel in sein Geburtsland zurück. Als Jugendlicher wurde er mehrfach inhaftiert und unter Hausarrest gestellt. 1971 ging Mahmoud Darwish ins Exil ( Moskau, Kairo, Beirut, Tunis, Paris, Amman) und lebte schließlich seit 1996 wieder teilweise in Ramallah (Westjordanland), wo er 2008 bestattet wurde. So blieb ihm zumindest der Blick auf den Gazakrieg Dezember 2008 – Januar 2009 erspart.
Marion Sens „ms“, amazon.de, 24.5.2009
Vexierbilder
− Mahmud Darwish zwischen hebräischem und arabischem Literaturkanon. −
Am 9. August 2008 starb mit Mahmud Darwish einer der bedeutendsten Dichter der modernen arabischen Literatur. Sein Tod wurde angesichts seiner lebenslang gespielten Rolle als „Sprecher seiner Gesellschaft“, des palästinensischen Kollektivs, und gleichzeitig als die meistgehörte poetische Stimme der arabischen Welt, im gesamten arabischen Sprachraum als schmerzlicher Verlust wahrgenommen, der in zahllosen Gedenkreden, Nachrufen und weltweiten Poesierezitationen betrauert wurde. Während aber seiner literarischen Bedeutung für die arabische Literatur und überhaupt die Weltliteratur ebenso wie seiner politisch-ideologischen Rolle volle Aufmerksamkeit zuteil wurde, kam Darwishs besondere hermeneutische Leistung nur am Rande zur Sprache. Es blieb unausgesprochen, daß der Dichter, der von seiner arabischen Kulturgemeinschaft früh als die „Stimme Palästinas“ reklamiert worden war, und der sich bis in die Neunzigerjahre hinein wichtigen politischen Aufgaben nicht hatte entziehen können, die „andere“ Kulturgemeinschaft, in deren Mitte er aufgewachsen war, die israelische, nie aus dem Blick verlor und sie vor allem in seinen Gedichten ebenso wie die arabische immer wieder „ansprach“. Das geschieht zumeist nicht direkt, sondern hermeneutisch vermittelt über Intertexte aus dem jüdischen Literaturkanon, zunächst und vor allem die Hebräische Bibel, später die Dichtung von Paul Celan, zuletzt auch die Philosophie Walter Benjamins. Diese von Darwish verfolgte Ansprache zweier Leserschaften, der arabischen und der jüdisch-hebräischen, ist nicht auf den ersten Blick einsichtig; sie ist für alle diejenigen Kritiker schwer zu erkennen, die mit der Hebräischen Bibel und der hebräischen und exiljüdischen Literatur nicht vertraut sind; für die meisten Israelis wiederum bleibt sie hinter dem arabischen Sprachgewand der Gedichte verborgen. Obwohl diese Gedichte auch ohne ihre hebräischen oder jüdischen Intertexte als Meisterwerke erkennbar sind, bezeugt doch Darwishs Festhalten an seinem zweiten, israelischen bzw. jüdischen Auditorium, eine einzigartige intellektuelle Offenheit, die sich diametral von dem antagonistischen Umgang mit dem jeweils anderen in der tagespolitischen Auseinandersetzung abhebt. Die Herausforderung, die Texte des Dichters als Vexierbilder, d.h. mit zwei verschiedenen Stoßrichtungen zu lesen, verspricht nicht nur, bisher unzureichend wahrgenommene politisch-ethische Dimensionen seines Werks offenzulegen. Sie zwingt zugleich dazu, von uns als „eigene“ reklamierte vertraute Texte, die in seine Dichtung eingegangen sind, neu zu lesen, sie als „Palimpseste“ zu erkennen, die durch seine Einschreibung eine neue Sinnschicht amalgamiert haben, oder – musikalisch gesprochen – polyphon geworden sind.
Ich, Wir und Du
„Durch viele Formen geschritten – durch Ich und Wir und Du“ –. Wenn dieser Vers auch nicht von Mahmud Darwish stammt, sondern von Gottfried Benn, so trifft er doch mit der Problematisierung des dichterischen Selbst geradezu den Nerv der Dichtung von Mahmud Darwish, der im folgenden – nicht als exotisch-arabischer, sondern als ein in unserer Tradition selbst präsenter Dichter – vorgestellt werden soll. Jetzt, nach seinem vorzeitigen Tod am 9. August 2008, wo zahlreiche Internet-Seiten nicht nur Nachrufe, sondern auch Originalaufnahmen seiner Rezitationen und Texte besonders beliebter Gedichte von neuem zugänglich machen, fällt auf, wie eindringlich die beiden Ichs des Dichters, sein Rollen-Ich als Sprecher seines Kollektivs und noch mehr sein prophetisches Dichter-Ich als Partner, Befreier, Hoffnungsanker dieses Kollektivs, im Gedächtnis der Nachlebenden geblieben sind. In der Tat gründet sich Darwishs noch in Haifa begonnene Dichterkarriere auf ein Gedicht, „Ashiq min Filastin“, „Ein Liebender aus Palästina“, das – 1966 von dem 25jährigen Poeten geschrieben – als Zeugnis eines lebenslangen Bundes des Autors mit seiner Nationalgemeinschaft verstanden wurde ein Bundestext, mit dem er sich nicht nur das Recht auf ein Verbleiben im Staat Israel verwirkte, sondern der ihn auch noch später, als er sich als persönliches, politik-fernes Ich zu äußern begann, in andauernde Rechtfertigungsnot zwang.
Dieser Zwiespalt zwischen politischer und künstlerischer Rolle gilt noch nicht für seine Beiruter Zeit – Darwish mußte 1970, 29jährig – durch zunehmende Repressalien gezwungen – Israel verlassen. Auf Umwegen kam er nach Beirut, wo es nun, nach dem Erwachen des palästinensischen Widerstands, galt, dem sich in der Öffentlichkeit manifestierenden „Wir“ der Revolutionäre eine artikulierte Stimme zu verleihen. Auch dies vollzog sich nicht konfliktlos, denn dieses „Wir“ – verkörpert in einer ganzen Generation von jungen Palästinensern, Söhnen entrechteter, in ärmlichen Lagern vergessener Familien ohne Anspruch auf persönliche Würde, die jetzt als Aktivisten einer Befreiungsbewegung hervortraten – dieses Wir war heftig umstritten. Die Ideale der Kämpfer mußten vor dem Zugriff nationalistischer Propaganda bewahrt werden, ihr Blut durfte nicht in Tinte und Druckerschwärze verschwimmen. Denn Beirut war damals, so berichtet Darwish später,
eine wahre Posterherstellungsfabrik. Gewiss die erste Stadt der Welt, die die Produktion von Postern auf das Niveau von Tageszeitungen erhob (…): Gesichter an den Wänden, Märtyrer, die frisch aus dem Leben und den Druckpressen herauskamen, der Tod, als Reproduktion seiner selbst. Ein Märtyrer ersetzt das Gesicht des anderen, nimmt seinen Platz an der Wand ein, bis ihn wieder ein anderer ersetzt oder der Regen ihn abwäscht
Für den Dichter also ein Seiltanz zwischen dem Anspruch auf sprachliche Veränderung der Welt, auf Gestaltung eines neuen Bewusstseins, und einem bereits im Gange befindlichen Mißbrauch der Sprache und ihrer Symbolik in der Massenpropaganda. Ein Gedicht aus dieser „Wir-Dichtung,“ das allerdings nicht den Beiruter Aktivisten, sondern den erst Jahre später auftretenden Intifada-Kämpfern in der Westbank gilt, ist heute im Internet besonders präsent, obwohl Darwish selbst es aus seinen Sammlungen verbannt hatte, weil es – im Zorn geschrieben – eine Fülle von Tabubrüchen begeht. Kein anderes Gedicht hat je so viele hebräische Übersetzungen und Kommentare provoziert bis hin zur Erwähnung in der Knesset wie „Abiruna fi kalamin abir“, „Ihr, die ihr vorüberzieht unter vergänglichen Worten“, das eine provokant-verzerrende Evokation des im Zionismus als Nationalmythos reklamierten Exodus bereits im Titel trägt („vorüberziehen“ statt „ausziehen“), das vor allem aber hebräische Sprachregelungen durch ihre arabische Übersetzung verfremdet und so israelische Sensibilitäten empfindlich verletzt. Das Gedicht ist ein Vexierbild: auf arabisch gelesen sehr zornig, aber eigentlich harmlos – durch die Linse des Hebräischen mit seiner biblischen Symbolik betrachtet aber eine ungeheuerliche Bloßstellung.
Nicht nur hat Darwish dieses Gedicht später zurückgezogen, er hat sich überhaupt von der Ich- und Wir-Rede im Dienste kollektiver Identitäts-Bewahrung gelöst.
Der Wandel seiner Dichtung hin zur Rede über sein persönliches Ich vollzieht sich in seiner Pariser Zeit (1982–1996), wo das Du des „anderen“, auch des jüdischen anderen, zum integralen Teil des dichterischen Ich wird. In der letzten Dekade seines Wirkens – wieder im Nahen Osten – geht er noch einen Schritt weiter und macht sein fragmentiertes Ich, Wir und Du selbst zum Thema, zum Diskurs seiner Dichtung.
Was hat das alles aber mit dem angekündigten Thema der in einander verschränkten Literatur-Canones zu tun? Die behauptete Beziehung wird klar, wenn wir Darwishs Ich-, Wir- und Du-Rede mit einzelnen biblischen Büchern verbinden, sie als Einträge in jüdische Referenztexte verstehen. Als Gespräch mit den Trägern der biblischen Tradition gelesen sind Darwishs Texte polyphon, oder anders ausgedrückt: sie oszillieren, werden zum Vexierbild, das eine arabische, aber auch eine „hebräische“ Lektüre erlaubt, „li-l-haqiqa wajhan“ – „die Realität hat zwei Gesichter“, wie Darwish es in einem späten Gedicht selbst genannt hat.
Der Dichter und seine Welt
Darwish Mahmud, geboren 1942 in dem galiläischen Dorf Birwa, das 1948 dem Erdboden gleich gemacht wurde, aufgewachsen als Sohn einer illegal aus dem Libanon zurückgekehrten Familie, trat früh als Dichter hervor. Dichtertum ist in der arabischen Welt – bis heute – nicht so sehr Schriftstellerei, als künstlerische Darstellung, performance; es beweist sich weniger in der Publikation von Gedichten im Druck, als im öffentlichen Vortrag. Doch auch diese Publikationsform ist nicht zensurfrei. Darwish eroberte mit seinen Vorträgen rasch eine arabische Hörerschaft, fiel aber gleichzeitig den israelischen Behörden auf und mußte öfters Hausarreste und Inhaftierungen in Kauf nehmen. Dabei waren seine Gedichte eher elegisch als aggressiv, der Nationalismus der Nasser-Ära stand ihm fern – zwei ganz andere Prägungen trieben ihn um. Zunächst die fremde, neue Kultur: Noch in viel späteren Interviews erwähnt er mit Bewunderung eine junge Hebräischlehrerein, die ihn in einzelne Bücher der Hebräischen Bibel einführte, Texte, die als Legitimationstexte für den neuen Staat Pflichtlektüre waren – offenbar aber ohne dabei ihre Faszination einzubüßen. Darwish hat sich im Hebräischen immer zuhause gefühlt, er hat sich über diese Sprache nicht nur die Weltliteratur erschlossen, sondern sich auch in die Literatur aus der Zeit vor und nach der Staatsgründung intensiv eingelesen. – Auf der anderen Seite das lastende Schweigen seiner eigenen Gesellschaft, die für ihre Katastrophe von 1948, den Verlust der Mehrheit ihrer Bevölkerung, keine Erinnerungsräume besaß, weder Denkmäler oder Museen noch liturgische Feiern – nur die Dichtung. Nur diese Dichtung, lokale Volksdichtung und die auf 1400jähriger Tradition beruhende Kunstdichtung, konnte die Gravitationskraft entwickeln, die erforderlich war, um die Entwurzelten an das ihnen nicht mehr gehörende Land zurückzubinden. Bis zu seinem Exil 1970 führte Darwish die prekäre Existenz eines arabischen Dichters und israelisch-arabischen Intellektuellen in einer Person.
Das frühe Langgedicht „Ashiq min Filastin“, mit dem Darwish 25jährig über Nacht zu dem Dichter Palästinas wurde, kreist um eine Grenzerfahrung: der Dichter wird sich beim Anblick seiner Heimat – offenbar vom Berg Karmel auf die Küstenebene hinunterschauend – unvermittelt seiner geradezu erotischen Liebesbeziehung zu Palästina bewußt. Er hat diese Erfahrung auch in Prosa, in dem später (1973) veröffentlichten Tagebuch der alltäglichen Traurigkeit (1978) festgehalten:
Unvermittelt erinnerst du dich, daß Palästina dein Land ist. Der verlorene Name führt dich in verlorene Zeiten, und am Strand des Mittelmeers liegt das Land wie eine schlafende Frau, die plötzlich erwacht, als du sie bei ihrem schönen Namen rufst. Sie haben dir verboten, die alten Lieder zu singen, die Gedichte deiner Jugend zu rezitieren, die Geschichten der Rebellen und Dichter zu erzählen, die dieses alte Palästina besungen haben. Der alte Name kehrt zurück aus der Leere, du öffnest ihre Karte so, als öffnetest du die Knöpfe des Kleides deiner ersten Liebe zum ersten Mal.
Poesie und Lieder – die Geschichte der Araber Palästinas – die hier unterdrückt werden, müssen totgeschwiegen werden, weil das Land nun mit einer anderen Sprache, einem anderen Gedächtnis und einer anderen Geschichte verbunden ist, weil ihm ein Text eingeschrieben ist, der als primordialer, von der Weltgemeinschaft universal anerkannter Text alle später gekommenen Texte außer Kraft setzt. Darwish ist sich bewußt, daß Dichtung eine Antwort sein muß auf die bereits existente Schrift, die in das Land eingeschrieben ist, um die schicksalhaft vorbestimmte Präsenz der anderen zu legitimieren: die Hebräische Bibel:
Man muß sich klar darüber sein, daß Palästina bereits geschrieben worden ist. Der Andere hat dies auf seine Weise getan, auf dem Wege der Erzählung einer Geburt, die niemand auch nur im Traum bestreiten wird. Einer Erzählung der Schöpfungsgeschichte, die zu einer Art Quelle des Wissens der Menschheit geworden ist: der Bibel. Was konnten wir anderes tun, als unsererseits eine mythische Erzählung schreiben? Das Problem der palästinensischen Poesie ist, daß sie ihren Weg begonnen hat, ohne sich auf feste Anhaltspunkte stützen zu können, ohne Historiker, ohne Geographen, ohne Anthropologen. Das machte es unumgänglich, durch einen Mythos hindurchzugehen, um beim Bekannten anzukommen.
Mit anderen Worten: Die master narrative der schicksalhaft verhängten palästinensischen „Abwesenheit“ war „um-zuschreiben“.
Der Dichter und sein Palästina: Eine Genesis-Geschichte
Die palästinensische Öffentlichkeit verknüpft diese von Darwish geleistete „Um-schreibung“ mit dem Anspruch auf die Person des Dichters als ihres Sprechers. In der Tat kann das Gedicht „Ashiq min Filastin“ („Ein Liebender aus Palästina“) als eine Art Bündnis-Dokument zwischen Dichter und Gesellschaft gelesen werden. Es beginnt mit den Versen „Deine Augen sind Dornen in meinem Herzen“ („Uyunuki shawkatun fi l-qalbi“) – und evoziert so Erfahrungen, die tief in die arabische literarische Tradition zurückreichen. Der Blick der Geliebten, der die persona des Dichters so schmerzlich trifft, ist nämlich jener Blick, der dem nahöstlichen Hörer aus dem ghazal, dem Liebesgedicht, seit jeher vertraut ist, sei es durch das udhritische Liebesgedicht von der hoffnungslosen Liebe, das noch Heinrich Heine beeindruckte, sei es das mystische Liebesgedicht von der Liebe des Sufi zu seinem Gott. Der Blick des geliebten Anderen, der den Liebenden verletzt, fordert ihm absolute Hingabe ab. („Deine Augen verletzen mich… ich aber bete sie an.“) Der Adressat des ghazal, ursprünglich die unnahbare geliebte Frau, später der unerreichbare göttliche Geliebte, wird in der postkolonialen Ära neu besetzt durch ein ebenfalls unerreichbares Anderes: das Bild der verlorenen oder besetzten Heimat. Im Fall Palästinas muß der Dichter, um diese Geliebte überhaupt anrufen zu können, sie zuerst in die Realität zurückholen, ihr ihren Namen zurückgeben. Denn 1966 war der Name „Palästina“ noch ein politisches Tabu, nachdem er mit der Gründung des Staates Israel abgeschafft und mit der Annexion der Westbank durch Jordanien dort ebenfalls verpönt war. Es gab nichts mehr, das Palästina hieß.
Es ist keine Übertreibung zu behaupten, daß das Gedicht „Ein Liebender aus Palästina“ Palästina aus Worten neu erschafft. Dazu greift Darwish auf ein alt bewährtes poetisches Modell für die Bewältigung von Verlustschmerz zurück: die Standardform der altarabischen qasida, ein Langgedicht mit der Aufeinanderfolge von drei Sektionen, die jeweils in einem eigenen Tenor gehalten sind. Die qasida beginnt mit einem elegischen Eingangsteil, dem nasib, das oft den Verlust einer Geliebten, fast immer aber die Auslöschung der einstigen Wohnstätten, atlal, beklagt und mit diesem Raumverlust einer nirgends sonst so überwältigend erfahrenen Melancholie Ausdruck gibt. Die altarabische „Klage über die verwüsteten Wohnstätten“ blieb bis in die Moderne der Schlüsseltopos der nahöstlichen Dichtung und hat noch Garcia Lorca den Vorwurf zu einem seiner Trauergedichte geliefert. Auf die Elegie folgt die heroischepische Beschreibung einer Reise, rahil, auf der der Dichter sein Selbstvertrauen zurückgewinnt. Er kehrt sich vom Ort der Verlusterinnerung ab und begibt sich, gestärkt durch den am ehesten Ausdauer und Beständigkeit verbürgenden Begleiter, sein Reitkamel, auf den Heimweg zu seinem Stamm. Das Gedicht kulminiert in einem pathetisch-appellatorischen Schlußteil, oft einer Preisung oder einem Selbstpreis, die die heroischen Tugenden der tribalen Gesellschaft feiern. Darwish wird diese komplexe Gedankenfigur in seinem späten Gedicht, „Yakhtaruni l-iqa“, „Der Rhythmus erwählt mich“, aus dem Jahr 2004 buchstäblich aushebeln und die 1400 Jahre alte elegische Feststellung der Unkenntlichkeit der ausgelöschten Wohnstätten, des Raumes, in die moderne kritische Feststellung der Unerkennbarkeit des Betrachters, des dichterischen Ich, übersetzen: „Du bist nicht Du, und die Wohnstätten sind nicht die Wohnstätten“. Vor allem aber wird er dem Reisemotiv seinen altarabischen Tenor heroischer Selbstbehauptung nehmen und ihm durch die Umdeutung in einen „Exodus ohne Ende“ eine neue tragische Dimension verleihen. Aber das geschieht erst 2004, in einem der späten Gedichte.
Doch schon Darwishs 40 Jahre älteres Gedicht von 1966 ist revolutionär: Die kurze im ghazal-Stil gehaltene Anrufung der Geliebten stiftet eine für die qasida nicht denkbare intime emotionale Bindung:
Deine Augen sind Dornen im Herzen
Sie verwunden mich, doch ich bete sie an
Und bewahre sie vor dem Wind.
Ich berge sie vor Nacht und Schmerzen,
So daß ihre Wunde Leuchten entzündet
Und ihr Morgen mein Heute mir kostbarer macht als meine Seele.
Auch hat die Orientierungslosigkeit des vor den Ruinen stehenden altarabischen Dichters jetzt kollektive Dimension: die Auslöschung der Wohnstätten hat ein Verstummen nicht nur des Dichters, sondern seiner Welt zu Folge.
Deine Worte waren ein Lied.
Ich versuchte es zu singen,
Doch das Elend umzingelte die Frühlingslippen,
Deine Worte – wie Schwalben – flogen auf von meinem Haus
Der Sehnsucht nach und wanderten aus von der Tür unseres Heims
Und der herbstlichen Schwelle
In Darwishs folgendem Reiselied, dem zweiten Teil der qasida, das schließlich zu jener bereits aus dem Prosa-Text bekannten Vision der wiedererkannten Heimat führt, geht der Sprecher nicht mehr physisch, sondern mit seinem Blick auf die Reise, verfolgt die Geliebte zu verschiedenen Szenarien des Elends: zum Hafen, dem Ort unfreiwilliger Auswanderung, zu Dorfruinen, zu Lagerräumen ärmlicher Bauernhäuser, zu billigen Nachtclubs und Flüchtlingslagern:
Ich sah dich gestern im Hafen…
Eine Reisende, ohne Anverwandte, ohne Wegzehr…
Ich sah dich auf dornüberwucherten Bergen,
eine Hirtin ohne Schafe,
verfolgt durch die Ruinen…
Die lange Folge von Visionen der Heimat in Bedürftigkeit und Demütigung nimmt eine plötzliche Wendung, als ihm die Geliebte in einer deutlich erotischen Ausstrahlung erscheint, als schlafende Schönheit – eine palästinensische Aphrodite:
Ich sah dich, ganz bedeckt von Meeressalz und Sand,
Deine Schönheit war von Erde, von Kindern und Jasmin.
Diese Endvision weckt den Sprecher aus seiner Melancholie und läßt ihn einen Eid absoluter Hingabe an die Heimat schwören. Der genau im Zentrum des Gedichts stehende Schwur verspricht in einer komplexen Metapher die Vollendung der poetischen Schöpfung der Geliebten, dargestellt als Produktion einer Textilie, eines Schleiers für sie, der aus Teilen seines Körpers gefertigt ist und so eine Art Selbst-Opfer darstellt:
So schwöre ich:
Ich werde dir einen Schleier weben aus meinen Wimpern für deine Augen
Und einen Namen, der – gewäßert mit meinem Herzen-
Die Bäume grüne Zweige treiben läßt.
Ich werde einen Namen auf den Schleier schreiben,
Teurer als Märtyrerblut und Küsse:
Palästinensisch ist sie und wird sie bleiben.
Der Sprecher tritt damit in die Rolle des biblischen Namensgebers, Adam, ein, des Ersten Menschen, der den Auftrag erhielt, die neu geschaffenen Wesen zu benennen. Wie Adam gibt auch er einen Teil seines Körpers hin, um die Erschaffung seiner Gefährtin vollkommen zu machen. Die Eva des Gedichts ist eine mythische Figur, Palästina – von nun an die Partnerin des Dichters, die ihm ihren Namen, ihre Realität, verdankt. Eine dichterische Schöpfung, die sich nicht nur biblisch, sondern auch koranisch legitimiert, indem sie im Schlußvers der Strophe „Palästinensisch ist sie und wird sie bleiben“ unüberhörbar den koranischen Schöpfungsimperativ „kun fa-yakun“ („Sei – und es ist“, Sure 3, Vers 117) evoziert, und mit dieser biblisch-koranischen Intertextualität den Anspruch auf ein palästinensisches Transkript der Genesis-Geschichte untermauert.
Nun, da die Geliebte Existenz und Namen erhalten hat, wird dieser Name zum Losungswort im Kampf des Dichters um persönliche und kollektive WÜrde. Der von der Qasidenform her als Schluß zu erwartende Selbstpreis kulminiert in einer furchtlosen Selbstbehauptung des Dichters, der voll auf die Macht des Wortes und die Waffe des Gedichts vertraut. Schwert und Schreibfeder sind – 1966 – noch vereint.
Exodus als Auszug in die Freiheit
Vier Jahre später verläßt Darwish Haifa und schließt sich der arabischen intellektuellen Elite in Beirut an, wo sich auch der inzwischen aufgeflammte palästinensische Widerstand konzentriert. Die nun in der Öffentlichkeit und den Medien omnipräsente Figur des fida’i wurde zu der neuen Heldenfigur, auf die sich alle Hoffnung richtete. Der fida’i, wörtlich: „der opferbereite Kämpfer“, bzw. der gefallene Kämpfer (shahid, Märtyrer), gewinnt bei Darwish eine gegenüber früherer Heldendichtung neue Dimension: er erscheint nicht nur als heroischer Kämpfer, sondern gleichsam als Erlöser aus der Gefangenschaft, der durch den symbolischen Akt des Selbstopfers sein Volk in die Freiheit führt, ohne selbst daran teilzuhaben – wie der biblische Mose, der die Israeliten im Exodus zurück ins Gelobte Land führt, selbst aber stirbt, ohne das Land zu betreten.
Dabei bleibt der fida’i natürlich arabisch, er besetzt eine alte poetologische Rolle neu: Darwish überträgt ihm die vorher vom Dichter selbst beanspruchte Rolle des wahren, leidenschaftlichen Liebenden der ghazal-Dichtung, des `ashiq, und macht ihm zum einzig legitimen Partner der Heimat, mehr noch, zu ihrem Bräutigam, ’aris, der durch das Erleiden eines gewaltsamen Todes eine mythische Märtyrer-Hochzeit, ’urs al-shahid, mit ihr vollzieht.
Auf den ersten Blick eine Mythenstiftung in nationalem arabischen Interesse – und doch auch ein Nachvollzug des großen biblischen Vorbilds, des Exodus. Denn mit seinem Selbstopfer kann der Märtyrer für einen Moment die Geschichte wenden, den Ausgang des Exodus gewissermaßen vorwegnehmen: Im Tod „kehrt er zurück“ in die Heimat: „Deine Brautnacht verbrachtest du auf den roten Dächern Haifas“, heißt es in einem Märtyrer-Gedicht von 1977. Der Tod des Kämpfers ist dabei nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die von der Dichtung geschaffene Märtyrergemeinschaft, ein Schritt auf dem Weg ins Gelobte Land. Und noch mehr: wie der Exodus schon innerbiblisch das Gebot zu seiner eigenen Kommemoration, zum Gedächtnis, zikkaron, enthält, das im jüdischen Pessach-Ritus auch alljährlich re-inszeniert wird, so wird auch in der palästinensischen Rezeption der Tod des Kämpfers in einem von der Dichtung geprägten Ritual, einer imaginierten Hochzeit des Helden mit dem Land, zelebriert – hier wie dort ein Ritual, das kollektive Erinnerung neu belebt. Die Erkenntnis der Zentralität der jüdischen Erinnerung, zikkaron, für die Kohärenz der Gesellschaft und ihre Übersetzung in arabische Erinnerung, mit dem verwandten dhakira bezeichnet, provoziert einen neuen, arabischen Erinnerungs-Diskurs. In dieser Diskurs-Stiftung liegt eine der vielleicht bedeutendsten intellektuellen Leistungen Darwishs, dessen Dichtung – wenn man den Gedanken einmal weiter verfolgen will- auf palästinensischer Seite für all das einsteht, was Holocaust-Gedenkfeiern und Holocaust-Museen auf jüdischer Seite leisten.
Die von Darwish gestaltete palästinensische Mnemotechnik, die die tödliche Wunde des Kämpfers, nicht etwa seinen individuellen Namen, zum Erinnerungszeichen erhebt, wirft Fragen auf: Läßt sich Erinnerung an Verlorenes nicht viel sicherer als durch die ans Masochistische grenzende ständige Reaktivierung des Leidens durch Konkretes bannen: durch zeitliche und örtliche Fixierung des Verlusts, durch Benennung des Verlorenen und eventuell seine bleibende, vielleicht sogar monumentale Einprägung in eine zu beschreibende Oberfläche? Das eben ist die Praxis der anderen Gesellschaft im Land, deren Erinnerung, gepflegt in einer nie unterbrochenen, durch Schrift geprägten Tradition, ihnen durch die Geschichte die Verbindung zu ihrem mythischen Ursprungsland aufrechtzuerhalten half. Es ist diese auf eine feierliche Nennung von individuellen Toten und konkreten Verlustereignissen zu ihrer Einordnung in die Leidensgeschichte des Volkes rekurrierende Formensprache der Erinnerung, die auch moderne Zeremonien nationaler Trauer in Israel beherrscht. Eine solche Pflege der Erinnerung liegt der majoritär ländlichen, von Schriftkultur lange Zeit wenig berührten arabischen Bevölkerung Palästinas gänzlich fern. Der sunnitische Islam hat keine der jüdischen vergleichbare liturgische Formensprache für die Bewahrung von Leidenserinnerung entwickelt; für die Bewahrung kollektiver Erinnerung in Zeiten ihrer Bedrohung hatte man die Formensprache außerhalb der offiziellen Religion zu suchen. Man fand sie in der mündlichen Tradition heroischen Kämpfertums und in den seit jeher geübten sozialen Ritualen der dörflichen Gesellschaft, die dem Zusammenhalt der Sippen gültigen Ausdruck verliehen: in den Hochzeitsriten. In Darwishs dichterischer Übersetzung verbinden sich beide zu einem neuen Mythos: der Vereinigung des Kämpfers mit dem Land, der – vergleichbar einem die Genealogie fortführenden Bräutigam – mit dem Akt der freiwilligen Aufopferung des eigenen Lebens eine gesellschaftserhaltende heroische Erinnerung Über den Einschnitt der nationalen Katastrophe hinweg stiftet. Der Schrift- und Namen-orientierten jüdischen Erinnerung wird damit ein rituell kodiertes Zeichen entgegengesetzt: die blutende Wunde, die über das betroffene Individuum hinaus auf den kollektiven Körper der durch den Unrechtszustand „verwundeten“ palästinensischen Gesellschaft verweist. Das Verdikt masochistischer Selbstzerstörung geht hier fehl, denn die bereits in der islamischen Mystik getroffene Deutung von Märtyrertum als einer Form der Selbstermächtigung verleiht dem Opfergang des Kämpfers die triumphale Aura eines Weges hinaus in die Freiheit, eines für den Moment erreichten Exodus.
Ein weit verbreitetes Gedicht – auf einen im Exil zu Tode gekommenen Kämpfer von 1972 – mit dem Titel „’A’id ila Yafa“, „Zurückgekehrt nach Jaffa“, stellt den Tod des Kämpfers als eine Hochzeit mit der Konnotation eines religiösen Erlösungswerks dar: Beides, der zentrale Ritus palästinensischer Erinnerungskultur und die Urszene kollektiver jüdischer Erinnerungsstiftung, Exodus, werden zusammen re-inszeniert. Mit seinem „Fortziehen“ khuruj – das arabische Wort dient auch zur Bezeichnung des biblischen Buches Exodus – tritt der Kämpfer in die Fußstapfen Moses:
Er zieht jetzt fort von uns
Und wird einnehmen Jaffa
Und wird sie erkennen Stein für Stein
Hier gleicht ihm niemand
Nur die Lieder tun es ihm nach.
Sie preisen seine grüne Wiederkehr.
Die messianische Konnotation wird weiter deutlich, wenn dem Helden die Kraft zur Umkehrung der Realität zugesprochen wird:
Jetzt bietet er dar das Bild seiner wahren Gestalt,
Da der Lebensbaum sprießt aus dem Galgen hervor.
Jetzt bietet er dar sein wahres Geschick,
Da die Brände sich breiten auf dem Weiß der Lilie.
Jetzt zieht er fort von uns
Und wird einnehmen Jaffa.
Doch der „palästinensische Exodus“ ist – wie Darwish nicht verhehlen kann – gefährdet. Denn der Held hat – nicht anders als Mose – mit einem Volk zu tun, daß der Rigorosität seines Anspruchs nicht standhält, ein Volk, das Idolatrie betreibt, indem es „der wahren Gestalt“ und „dem wahren Geschick“ des Kämpfers ein Idol, einen verlogenen Umgang mit der kollektiven Erinnerung entgegensetzt. Die Gegenstrophe zu dem Gedichtanfang kontrastiert das eingangs evozierte „wahre Bild“ mit dem „falschen Bild“, dem Idol:
Wir sind so fern von ihm,
Da Jaffa nichts ist als vereinzelte Koffer,
Am Flugplatz vergessen,
Wir sind so fern von ihm
Da unsere Bilder nichts sind als Erinnerungsfotos
In den Taschen von Frauen,
Und wir auf den Seiten der Zeitungen
Darbieten täglich unsere Geschicke,
Nur zu gewinnen die Locke des Windes und Küsse aus Feuer.
Wir sind so fern von ihm,
Wir treiben ihn an, in den Tod sich zu stürzen
Und schreiben geschliffene Worte des Nachrufs auf ihn
Und moderne Gedichte.
Und gehn abzuwerfen die Traurigkeit draußen im Straßencafe.
Wir sind so fern von ihm,
Auf seinem Begräbnis umarmen wir selbst seinen Mörder
Und stehlen uns von seiner Wunde die Binde, zu putzen
Die Orden für Ausdauer und langes Warten.
Blut und Tinte fließen in einem verhängnisvollen Zirkel zusammen: der Dichter selbst schreibt – für den Druck vorgesehene – „moderne Gedichte“ über das Blut des Märtyrers, dessen Tod so zu einem Teil des politisch-journalistischen Tagesgeschäfts wird. Die Gefährdung des Ideals durch Surrogate, Idole – auch das ist eine biblische Erfahrung. Die Gedichte der folgenden zehn Jahre, bis 1982, sind ein Seiltanz zwischen der Treue zum selbst mit-geschaffenen Mythos und den tagespolitischen Zwängen.
Exodus ohne Gelobtes Land
Das Bild des Exodus als emblematische Repräsentation des palästinensischen Aufbruchs blieb auch gültig, als mit dem Scheitern der revolutionären Bewegung und der Vertreibung der Palästinenser aus Beirut 1982 in das abgelegene Tunis die Figur des Kämpfers von der Bühne abtrat, als sich der „Auszug in die Freiheit“ als ein „nie endender Weg“, ein „permanent gewordener Exodus“ abzeichnete, bei dem jegliche „Landnahme“ aus dem Horizont geschwunden war.
Damit kehrt sich der vorher triumphal eingesetzte Subtext in sein Gegenteil: Unter dem resignativen Aspekt der nie endenden Wanderschaft, wird der Exodus zum Bild für die unvollendete Nationwerdung der Palästinenser. In dem Gedicht von 1986 „Wir lieben das Leben“ geht Darwish so weit, das Leben selbst, das einfache Überleben, zum Gelobten Land, oder islamisch gewendet, zur Kaaba zu erklären. Darwish nutzt hier eine jedem arabischen Hörer geläufige Referenz auf die dem Gläubigen obliegende Wallfahrt zur Kaaba, er zitiert im Refrain die koranische Formel zur Einschränkung des Wallfahrtsgebots (Sure 3:97), nämlich auf „diejenigen, die fähig sind, hinzugelangen“ (Gott hat den Menschen die Pilgerfahrt zum Gotteshaus auferlegt, denjenigen, die fähig sind, hinzugelangen). Darwishs Refrain lautet:
Ja, wir lieben das Leben, wenn wir nur fähig sind hinzugelangen.
Das Gedicht verfolgt die Wanderschaft der Palästinenser unter Umkehrung der aus der Bibel bekannten lebenspendenden göttlichen Gunstbeweise, Manna und Wachteln, an ihre Stelle treten drastische Erfahrungen vergeblicher Bemühung um Selbsterhaltung:
Wir säen, wo immer wir lagern, schnell wachsende Pflanzen
Und ernten, wo immer wir ernten, nur Tote, Gefallne.
Wir geben der Flöte ein das Lied immer fernerer Fernen
und malen in den Sand des Wegs unsere zitternde Sehnsucht.
Ja, wir lieben das Leben, wenn wir nur fähig sind hinzugelangen.
Noch drastischer wird der triumphale Exodus subvertiert in dem aus derselben Zeit stammenden Gedicht: „Die Erde engt uns ein“, das endet:
Wohin gehn wir nach Überschreitung der letzten Grenze?
Wohin fliegen die Vögel nach Erreichung des letzten Himmels?
Wo schlafen die Pflanzen nach dem Schwinden des letzten Lufthauchs?
Wir werden unsere Namen schreiben mit rot gefärbtem Rauch.
Abschneiden werden wir die Hand dem Lied – soll unser Fleisch es zuende bringen.
Hier werden wir sterben, hier im letzten Durchgang.
Hier oder hier wird pflanzen seinen Ölbaum unser Blut.
Die Wanderung, die zu keiner Landnahme führt, die sogar Exterritorialität mit dem völligen Verschwinden des Raumes auf die Spitze treibt, mag als ein palästinensisches Zerrbild des – den anderen bereits geglückten – Exodus in das verheißene Land erscheinen. Es ist dennoch mit seiner biblischen Schlußmetapher, dem Friedenszeichen des Ölbaums, ein unüberhörbarer Appell an diese anderen, die palästinensische Unglücksgeschichte als dunkle Seite der eigenen Erfolgsgeschichte in ihrer Tragik wahrzunehmen.
Darwish im Gespräch mit Aragon und Celan
Darwish hat aber nicht nur Geschichte, sondern auch die Geschichte seiner eigenen Schöpfungsakte reflektiert – auch den im Pariser Exil vollzogenen unübersehbaren Bruch in dieser Geschichte. Er tut das, indem er seine Subtexte, seine literarischen Referenzen, ans Licht holt: Zur Erklärung seiner Hinwendung zu einem neuen biblischen Buch, dem lyrischerotischen Hohen Lied, legt er zunächst sein wechselhaftes Verhältnis zum „arabischen Hohen Lied“, dem Mythos von Majnun Layla, offen.
Die Geschichte von dem sich in unstillbarer Sehnsucht nach seiner Geliebten Layla verzehrenden Dichter Qays, wegen seiner Obsession auch Majnun Layla, d.h. „der von Layla Besessene“ genannt, ist omnipräsent in den nahöstlichen Literaturen – es hat vor allem die bedeutendste arabische Poesie-Gattung der Vormoderne, das ghazal-Liebesgedicht entscheidend geprägt. Majnuns Sehnsucht nach dem Wiedervereintwerden mit seinem Ideal ist im modernen ghazal ins Politische gewendet worden, das Liebesgedicht ist seit den fünfziger Jahren nicht nur in der arabischen, sondern auch in der weiteren islamisch geprägten Welt eine Hommage des Dichters an seine mythisierte verlorene Heimat.
1999 hat Darwish seinen eigenen Anteil an dieser poetologischen Entwicklung einer rigorosen Revision unterzogen. Im Rückblick auf seine „poetische Jugend“ nennt er seine frühere Identität als ’Ashiq min Filastin, als „Liebender aus Palästina“, eine temporäre poetische Rolle, die er in einer noch unausgereiften Phase gespielt habe, in einer gleichsam ekstatischen Situation, aus der heraus er erst durch eine Schock-Erfahrung wieder zur Nüchternheit gefunden habe. Das „autobiographische Gedicht“, „Eine Maske von Majnun Layla“, zeigt ihn zunächst in der Rolle des altarabischen Dichters Qays, dem von Layla Besessenen, Majnun Layla, läßt ihn dann aber – offenbar von Celans Dichtung angestoßenentscheidende Rollenwechsel durchmachen:
Eine Maske von Majnun Layla
Ich fand eine Maske, und es gefiel mir,
Ein anderer zu werden. Ich war
Jünger als Dreißig, überzeugt, die Grenzen
Der Existenz bestünden aus Worten. Ich war
Krank nach Layla wie jeder junge Mann,
In dessen Blut ein Körnchen Salz ist. Selbst wo sie
Nicht wirklich da war, lag das Bild
Ihrer Seele in allen Dingen. Sie bringt mich
Der Umlaufbahn der Sterne nah. Sie entfremdet mich
Meinem Leben auf der Erde…
Der Fluß heilte mich, als ich mich
In ihn warf, um mich zu töten,
Und einer, der vorüberkam, mich rettete.
Ich fragte: Weshalb hast du mir die Atemluft zurückgegeben
Und meinen Tod gedehnt? Er sagte: Damit du dich
Besser kennenlernst… wer bist du?
Ich sagte: ich bin Laylas Qays, und wer bist du?
Ich bin ihr Ehemann.
Wir gingen zusammen durch die Gassen Granadas
Und entsannen uns unserer Tage am Golf.
(Übersetzt von Stefan Weidner)
Seine Obsession für das Ideal, sein Weltverlust, hätte den Dichter zur Selbstauslöschung treiben können, wie Paul Celan, den großen jüdischen Exildichter, der 1970 in der Seine Selbstmord beging. Es ist die Person Celans, in die Darwish hier für einen Moment biographisch eintritt, um aus demselben Fluß existentiell verändert ins Leben zurückzukehren: nicht mehr jedoch als der arabische Majnun, sondern in der Rolle einer westlichen literarischen Verkörperung. Es ist die Rolle von Louis Aragons altem abgeklärten Dichter Medjnoun, der nach dem Fall von Andalusien meditierend durch die Gassen Granadas steift, den Ort arabischen Exils par excellence. Aragons Medjnoun ersehnt Layla, die bei ihm Eisa heißt, nicht mehr als Wiederherstellung einer verlorenen Wirklichkeit, sondern erwartet sie als geschichtliche Utopie einer universalen idealen Zukunft. Indem Darwishs persona Majnun in diese abgeklärte Rolle eintritt, kann er seinen früheren Rivalen als Gefährten, ja als Teil seines Ich erkennen und mit ihm gemeinsam Formen des Exils ins Gedächtnis rufen, nicht nur den Prototyp arabischen Exils, den Verlust Andalusiens, dessen Enddatum 1492, der Fall Granadas, zugleich jüdische Exilierung in Erinnerung ruft. Beide zusammen gedenken auch des Exils des Pioniers der Modernen Dichtung überhaupt, Badr Shakir al-Sayyab, dessen berühmtes, den persischen Golf beschwörendes Gedicht „Unshudat al-matar“ („Die Regenhymne“) hier evoziert wird.
Der einstige Majnun Layla gibt damit seine nostalgische Haltung auf und stellt sich in die Reihe moderner, westlicher und arabischer Exildichter, Paul Celan, Louis Aragon und Badr Shakir al-Sayyab, bei denen Exil nicht territoriale Exklusion, sondern existentielle Entfremdung ist, eine conditio humana, die so weit gehen kann, daß die Figur des Dichters selbst infrage gestellt wird. Wohl kein zweiter Vers Darwishs formuliert – in der Sicht von Stefan Milich – „so radikal wie der letzte von ,Qays’ gesprochene die völlige Aufgabe der modernen Subjekthaltung, der essentialistisch und monolitisch verstandenen Identität, und setzt an seine Stelle ein Selbstbewußtsein, das nicht mehr Dichter, sondern nur noch Dichtung sein will“.
Ich bin Laylas Qays,
Fremd meinem Namen und meiner Zeit (…)
Ich bin der erste Verlierer, ich bin der letzte Träumer, der Sklave der Ferne.
Ich bin ein Geschöpf, das nicht gewesen. Ich bin ein Gedanke
Für ein Gedicht
Von Layla zu Shulamith: ein jüdisch-arabisches Hohes Lied
Die Liebesklage um die palästinensische Layla, die poetische Wiedererschaffung der Figur „Palästina“, liegt nun, 1999, über dreißig Jahre zurück. Mit dem Zurückweichen der mythischen Layla tritt die Erinnerung der ersten wirklichen Geliebten wieder klarer hervor. Mahmud Darwish nennt die israelische junge Frau, mit der er noch in Haifa ein Liebesverhältnis hatte, „Rita“, manchmal auch „Shulamit“. Sie ist die zentrale Figur mehrerer vor 1970 entstandener Gedichte, die die Liebe des israelisch-arabischen Paares als „unmöglich zu leben“ beschreiben. Sie taucht wieder auf in seinem Kriegsmemoir Ein Gedächtnis für das Vergessen, wo er in der apokalyptischen Situation der Bombardierung Beiruts 1982 in seinen Tagträumen Telefongespräche mit ihr führt. Die ausführlichste Version der Liebesgeschichte mit Rita ist das Langgedicht „Ritas langer Winter“ von 1992 – bei näherem Hinsehen nichts anderes als eine Art Übersetzung des biblischen Hohen Liedes in die Realität des palästinensisch-israelischen Liebespaares, dem wie das biblische Paar die Erfüllung verwehrt wird, nicht von altorientalischen Wächtern der Stadt, sondern von einer mächtigen modernen Ideologie. Spannung besteht nicht wie im Hohen Lied zwischen weiblichem Begehren und patriarchalischen Zwängen, sondern zwischen der Liebe des Paares und politischen Widrigkeiten. Die Sprache ist ähnlich reich wie der Vorbildtext an eindrucksvollen Körpermetaphern aus dem Bereich von Fauna und Flora. Ritas Brüste sind Vögel, sie selbst ist eine Gazelle. Der Liebende ist wie die Geliebte Teil der lokalen Natur: er fühlt die Nadeln der Zypresse unter seiner Haut, beiden ist es, als schwärmten Bienen in ihren Adern, sie verbreitet den Duft von Jasmin; sie streut Anemonen über ihn, so daß er unter den Schwertern ihrer Brüder hindurchgehen kann, sie überlistet die Wächter der Stadt. Wie im Hohen Lied erlebt auch im Gedicht der Liebende, daß die Geliebte auf der Schwelle zur Erfüllung entschwindet. Aber die aus dem Hohen Lied bekannten Wächter bedrängen nicht sie, sondern ihn, indem sie ihm seinen Raum verstellen und ihn von der Geliebten trennen. – Doch kann sich der Dichter aus der realen in eine textuelle Welt flüchten. Er selbst weiß, daß er kanonische Texte „umschreibt“, hebräische wie arabische: Er hat „Teil am Buch Genesis, […] Teil am Buch Hiob, […] Teil an den Anemonen der Wadis in den Gedichten der früharabischen Liebenden, Teil an der Weisheit der Liebenden, die verlangt, daß der Liebende das Antlitz der Geliebten liebe, auch wenn er von ihr getötet wird“. – Ein Epilog enthüllt das Auseinanderbrechen der Beziehung – ihre Pistole liegt auf der Niederschrift seines Gedichts – und seinen erzwungenen Gang ins Exil.
Es bedurfte aber noch der – in dem Maskengedicht dokumentierten – Begegnung mit Paul Celan, um Rita aus der nostalgischen Erinnerung in das dichterische Ich selbst hineinzuholen. Erst in dem sieben Jahre späteren – um einen Celan-Vers herum geschriebenen – Gedicht von 1999 „Eine Wolke aus Sodom“ wird Rita zu dem, was sie für die weitere Dichtung Darwishs bleiben wird. In seinen eigenen Worten: „eine intensivpräsente Abwesenheit“.
EINE WOLKE AUS SODOM
Nach deiner Nacht, der letzten Winternacht
Verließen die Wachen die Straße am Meer.
Kein Schatten folgt mir, seit deine Nacht
In der Sonne meines Lieds vertrocknete. Wer sagt mir jetzt:
Verabschiede dich vom Gestern und träume
Mit der ganzen Freiheit deines Unbewußten.
Meine Freiheit sitzt nun auf meinen Knien
Wie eine zahme Katze (…).
Was macht meine Freiheit nach deiner Nacht, der letzten Winternacht?
„Eine Wolke zog von Sodom nach Babel“,
Vor hundert Jahren, doch ihr Dichter Paul
Celan brachte sich um, heute, in der Seine. Du wirst mich
Kein zweites Mal zum Fluß mitnehmen. Kein Wächter
Wird mich fragen, wie ich heute heiße. (…)
Wer bin ich? Wer bin ich, nach deiner Nacht, der letzten Winternacht?
(Übersetzt von Stefan Weidner)
Obwohl das Szenario des Hohen Liedes aus „Ritas langer Winter“ von der weiblichen Figur verlassen scheint, ist Rita präsent, sie ist – mit Elias Khoury gesprochen – in das nun in ein Du-Ich gespaltene dichterische Selbst eingegangen. Die Trennung der Liebenden kann nicht mehr wie vorher einfach durch den Rückzug des Dichters ins Unbewußte, in seine dichterische Kreativität, aufgehoben werden. Mit dem Eintritt des Dichters in das endgültige Exil und dem Eintritt des Fremden, das vorher in der „fremden Geliebten“ verkörpert war, in seine eigene Identität, muß er sich jetzt selbst jene Fragen stellen, die früher von den Wächtern und Soldaten an ihn gerichtet wurden. „Wer bin ich nach deiner Nacht, der letzten Winternacht ?“
Die im Gedichttitel „Eine Wolke aus Sodom“ ausgesprochene Evokation des infernalen Sodom aus dem frühen Rita-Gedicht „Eine schöne Frau aus Sodom“ von 1970 führt zurück zu der Situation, wo Darwish im Begriff war, sein Inferno Sodom in Richtung Exil, Babylon, zu verlassen. Doch sind Sodom und Babylon – wie Stephan Milich zuerst erkannt hat – inzwischen mit der Erfahrung des Exildichters par excellence, Paul Celan, besetzt, dessen Vers aus dem Gedicht „Mohn und Gedächtnis“ aus dem Jahr 1952 („Von Aug’ zu Aug’ zieht die Wolke / wie Sodom nach Babel“)? Darwish neu formuliert. Jüdische Exilerfahrung wird als arabische reklamiert. – Um dies zu legitimieren, greift Darwish zu einem Kunstgriff, er überspringt in seiner Reflektion der Stationen seiner dichterischen Kreativität – historisch gesprochen – die lange Phase seiner mythenschaffenden Dichtung im Beiruter Exil, als er nur „temporär exiliert“ war und noch auf eine Rückkehr hoffte. Er datiert sein – erst später erreichtes – Exilbewußtsein als existentielle Kondition gewissermaßen zeitlich zurück, um die Wahrnehmung seiner Existenz in einem „Land aus Worten“ mit derjenigen Paul Celans synchronisieren zu können, der sich 1970, dem Jahr, in dem Darwish ins Exil ging, das Leben nahm. Darwish geht – so könnte man die kühne Referenz deuten – den Exilweg Celans auf weite Strecken mit, doch führt ihn dieser Weg an entscheidender Stelle zum Bruch nicht mit der Welt, sondern mit seiner arabisch dominierten Textwelt. Sein Gedicht „Wer bin ich ohne Exil?“ aus der gleichen Sammlung Sarir al-ghariba, „Das Bett der Fremden“, 1999, macht den Gedanken der Celanschen Erbfolge fast explizit:
Ein Fremder am Ufer des Flußes, wie der Fluß… Das Wasser
Bindet mich an deinen Namen. Nichts bringt mich aus meiner Ferne zurück
Zu meiner Palme. Kein Frieden, kein Krieg. Nichts…
(Übersetzt von Stefan Weidner)
Darwish wird mit der europäischen Exildichtung, etwa Aragons, aber besonders mit dem Werk Celans, ein zweites Leben zuteil. Der palästinensische Dichter Darwish wird zum „Nachdichter“ des jüdischen – wie Celan hat er eine nicht mehr territoriale, eine Exil-Heimat in der Sprache, „ein Land aus Worten“, baladun min kalam, erschaffen.
Zum Schluß
Mahmud Darwish ist – über viele Stationen, von denen wir einige passieren konnten – von einem mythenschaffenden politischen Dichter, dem Schöpfer einer Genesis-Geschichte und eines Exodus-Dramas für seine Heimat Palästina, zum Entdecker eines weiträumigen ästhetischen Altneulands geworden: zum Wiederentdecker der Bibel als des großen regionalen Subtextes, der ein tieferes, nämlich allegorisches Verständnis von Geschichte ermöglicht. Die Bibel erweist sich für ihn als ein Archiv von Präfigurationen, von „Typen“ zeitgenössischer Ereignisse und Erfahrungen. Oder umgekehrt: als Brennglas, durch das hindurch die Gegenwart erst in ihrer doppelten Sinndimension erfahren werden kann: lil-haqiqa wajhan: „die Realität hat zwei Gesichter“. So wird die jüdische Erfahrung des Exodus von den Palästinensern in ihrem Befreiungskampf zuerst nachgelebt, dann nach dem Verlust ihrer Ziele nachgelitten – aber erst der biblische Referenztext, der die ontologische Notwendigkeit des Exodus für die Volkswerdung attestiert, macht die volle Tragweite des palästinensischen – letztendlich arretierten – Exodus voll erkennbar und in ihrer Tragik, als Vexierbild des geglückten Exodus der anderen, diesen anderen kommunizierbar. Und erst das Hohe Lied eröffnet die Reflektion über das poetische Ich in seiner untrennbaren Verbindung zum Du des anderen als einer „intensiv-präsenten Abwesenheit“. Lange ersehnte und nostalgisch erinnerte Territorialität hat bei Darwish einer Celanschen „Landkarte der Abwesenheit“ Platz gemacht: Celans Texte werden durch Darwishs Einschreibung von jüdischen Exilgedichten zu jüdisch-palästinensichen Palimpsesten. So auch Celans Gedicht aus dem Jahr 1954:
Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!
Feiner: ein Faden, an dem er herabwill, der Stern:
um unten zu schwimmen,
unten, wo er sich schimmern sieht,
in der Dünung wandernder Wortes
Darwish antwortet Celan in seinem Gedicht „Am letzten Abend auf dieser Erde“, aus dem Jahr 1992, in dem er arabisches und jüdisches Exil gleichermaßen in einem Land aus Worten aufhebt:
Am Ende werden wir uns fragen, war Andalusien
Hier oder dort? Auf der Erde […] oder im Gedicht?
Angelika Neuwirth, Akzente. Zeitschrift für Literatur, Heft 5, Oktober 2009
Ich bin nicht bereit, mein Leben einer Fahne zu weihen1
Helit Yeshurun: Mir schien zunächst, daß unsere Begegnung in einem Augenblick der Ungewißheit stattfinden würde: Ihr Verschwinden nach Jordanien, die Schwierigkeit, Ihre Telefonnummer ausfindig zu machen, um ein Gespräch mit Ihnen zu vereinbaren. Aber von nahem betrachtet, trifft das Wort „ungewiß“ gar nicht mehr zu. Wie würden Sie den gegenwärtigen Augenblick definieren? Nach dreizehn Jahren in Paris findet man Sie auf einmal in Jordanien wieder. Sind Sie von einem Exil ins andere gegangen?
Darwisch: Ich bin von einem Ort an einen anderen gegangen. Die historischen Ereignisse in der Region haben mir das Signal zum Fortgehen gegeben. Ich bin nicht hierhergekommen, um an den Ereignissen teilzunehmen, aber so weit entfernt von der neuen Dynamik hatte ich ein schlechtes Gewissen.
Ich kann nicht sagen, daß ich von einem Exil ins andere gehe, denn ich befinde mich auf eine zwiespältige Art im Exil. Heute ist das Exil psychischer Art, ein inneres Exil. Aber ich fühle mich in der arabischen Welt mehr zu Hause als in Paris.
Yeshurun: Haben Sie gezögert, zurückzukommen?
Darwisch: Das Zögern liegt in meiner Art, die Ereignisse zu interpretieren. Ich komme nicht zurück, ich komme. Niemand kann an den Ort, den er sich vorgestellt hat, oder zu dem Menschen, der er gewesen ist, zurückkehren. Barwa [der Geburtsort Mahmoud Darwischs, A.d.Ü.] existiert nicht mehr. Und das Recht auf Rückkehr ist uns nicht wirklich in Aussicht gestellt worden. Ich komme, aber ich komme nicht zurück. Ich komme, aber ich komme nicht an. Und das ist nicht nur eine poetische Ausdrucksweise. Es ist die Realität. Ich habe einen Teil meiner Heimat besucht. In Gaza habe ich mich sehr fremd gefühlt. Denn das Land ist schön, wenn man es in seiner Gesamtheit sieht; es ist die gesamte Geographie, die die Schönheit unseres Landes ausmacht. Ich bin ohne Illusionen gekommen. Ich war auf die Enttäuschung vorbereitet, und ich habe sie vorgefunden. Aber zu dem Menschen, der einmal war, und zu dem Ort, der einmal war, zurückzukommen, ist unmöglich.
Yeshurun: Vermischt sich bei Ihnen die Nostalgie der Kindheit mit der Sehnsucht nach der heimatlichen Erde? In der Einführung zu Ihrer ersten Gedichtsammlung haben Sie geschrieben, die Sprache Ihrer Kindheit sei Ihnen gestohlen worden. Und in Ihrem Buch Eine Erinnerung für das Vergessen sagen Sie: „Ich bin ein Dichter auf der Suche nach einem Kind, das in ihm war und das er irgendwo zurückgelassen und vergessen hat. Der Dichter altert und verbietet dem vergessenen Kind, heranzuwachsen.“
Darwisch: Die verschiedenen Ebenen meiner Geschichte sind untrennbar miteinander verbunden. In meiner Situation gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Geschichte meiner Kindheit und jener der heimatlichen Erde. Der Einschnitt in meinem persönlichen Leben ist der gleiche wie der, der mein Heimatland betrifft. Die Kindheit ist mir zur selben Zeit weggenommen worden wie mein Haus. Die Ereignisse sind in ihrem tragischen Aspekt parallel, bilden eine Einheit. 1948, als der große Einschnitt stattfand, bin ich aus dem Bett der Kindheit gesprungen und habe den Weg des Exils begonnen. Ich war sechs Jahre alt. Meine ganze Welt ist untergegangen, und meine Kindheit ist stehengeblieben; sie ist nicht mit mir weggegangen. Die Frage ist: Kann man die gestohlene Kindheit wiederfinden, indem man die gestohlene Erde wiederfindet? Es ist eine poetische Suche, die ihren Rhythmus an das Gedicht selbst weitergibt. Das Kind Mahmoud Darwisch wiederzufinden, ist nur im Gedicht möglich, nicht im Leben.
Yeshurun: Wenn Sie nur Prosa geschrieben hätten, hätten Sie dann dem Kind, das in Ihnen ist, ebenso verbieten können, heranzuwachsen?
Darwisch: Das Kind, das in mir ist, ist eine der Bedingungen für meine Poesie. Wenn ich ohne das ungestüme Kind, das in mir lebt, herangewachsen wäre, hätte ich nicht Dichter werden können. Wie soll man das Gleichgewicht finden zwischen Weisheit und Kindheit? Die Poesie ist eine Kindheit, die zur Weisheit gelangt ist, eine Synthese zwischen den Sinnen und dem Bewußtsein. Wenn ich einen Roman geschrieben hätte, hätte ich mich nicht im gleichen Maße von der Anziehungskraft der Kindheit freimachen können.
Yeshurun: In einem Gespräch in der Zeitschrift Masharif sagen Sie, daß, nachdem Sie Ihre Familie verlassen hatten, um in Haifa zu leben, es Ihnen bewußt geworden ist, daß Sie das Lieblingskind der Familie gewesen sind, nicht weil Sie das beste, sondern weil Sie das abwesende Kind waren.
Darwisch: Ja, ich habe noch in jungen Jahren mein Zuhause verlassen. Ich hatte das Gefühl, nicht geliebt und beschützt zu werden. Ich bin nicht der Älteste, und meine Mutter schlug mich immerzu ohne Grund. Sie lud mir die Verantwortung für alles auf, was bei uns zu Hause oder in unserer Umgebung negativ war. Erst als ich 1956 im Gefängnis saß – infolge der Streiks während der israelischen Aggression gegen Ägypten und der Besetzung des Gazastreifens –, erst als meine Mutter mich dort besuchte, mich in die Arme schloß und mir Kaffee und Früchte brachte, erst in diesem Augenblick habe ich verstanden, daß sie mich liebte und daß ich mich in ihr getäuscht hatte. Ich habe eine tiefe Freude empfunden, wie ein Licht in meinem Innern. Das Gefängnis war kein zu hoher Preis dafür, schließlich das Gefühl ihrer Liebe zu spüren.
Ich habe dort das Gedicht „Ich sehne mich nach dem Brot meiner Mutter“ geschrieben, und die Leute haben dieses Bekenntnisgedicht, dieses Gedicht, mit dem ich mein Schuldgefühl gegenüber derjenigen Person abbüßen wollte, die ich verdächtigt hatte, mich zu hassen, als ein Lied der nationalistischen Sehnsucht interpretiert.
Ich war nicht darauf gefaßt, daß es Millionen Menschen – nachdem es von Marcel Khalifa vertont worden war – in dem Glauben singen würden, die Mutter, von der dieses Gedicht handelt, sei das Heimatland.
Yeshurun: Und Ihr Vater?
Darwisch: Mein Vater hat nie mit mir geschimpft, mich nie geschlagen. Er war ein sensibler Mann. Er orientierte sein Leben an den Jahreszeiten und bildete einen Teil der Erde. Er hat sich nie in unsere Erziehung eingemischt. Es war meine Mutter, die das Haus führte; eine starke, scharfzüngige Frau. Vielleicht verdanke ich ihr meinen Sinn für Humor. Sie war zu meinem Vater autoritär; ich mochte ihren Despotismus nicht. Mein Vater lächelte und war friedlich; sie dagegen zettelte immerzu Streit an.
Yeshurun: In demselben Gespräch in Masharif erzählen Sie, daß Ihre Mutter niemals zu Hochzeiten ging, immer nur zu Beerdigungen.
Darwisch: Ja, das ist der Widerspruch in ihrer Persönlichkeit. Sie hatte eine grausame, zynische Haltung hinsichtlich dessen, was bei uns zu Hause, bei den Nachbarn oder im Land vor sich ging. Aber gleichzeitig fand sie in den Beerdigungen ein Ventil für ihre innere Traurigkeit. Sie war eine sehr traurige Frau. Ihr Leben war anfangs recht glücklich gewesen; später ist dann alles sehr schwierig für sie geworden. Meine Mutter stammte nicht aus Barwa. Ihr Vater war der Muchtar, der Bürgermeister des Nachbardorfs. Nach dem sie Flüchtling geworden war, fand sie bei den Beerdigungen die Gelegenheit zum Weinen; als ob sie zuvor ihre Tränen versteckt hätte. Auf einem Begräbnis zu weinen, ist keine Schande, es ist kein Zeichen von Schwäche.
Yeshurun: Haben Sie selbst auch ein wenig davon in sich?
Darwisch: Ich bin eine Mischung aus der Zaghaftigkeit meines Vaters und der Stärke meiner Mutter. Ich pendle zwischen zwei Polen, dem Schwachen und dem Starken, hin und her. Ich bin schwach und stark zugleich, in meiner Arbeit wie in meinem Leben. Meine Poesie ist vielleicht aus dem traurigen und stummen Sprechen meiner Mutter geboren.
Yeshurun: In Ihrer Poesie finde ich vor allem Stärke. Läßt sie auch Platz für Schwäche?
Darwisch: Ja. Ich schütze die Kraft der Schwäche gegen die Kraft der Stärke. Aber nicht, was die Sprache betrifft; hier bedarf es maximaler Stärke.
Yeshurun: Sie haben über einen Mann geschrieben, der des Nachts erschien, sang und wieder verschwand. Wer war dieser Mann?
Darwisch: Erinnern Sie sich an das Wort Mistanenim? Ich glaube, daß die Geschichte der „Eingesickerten“ noch nicht geschrieben ist; ein palästinensischer Schriftsteller sollte dies einmal tun. Als der Staat Israel in seiner Anfangsphase einen Zensus durchführte, waren wir Flüchtlinge im Libanon. Wir sind zwei Jahre später ins Land zurückgekommen, indem wir „eingesickert“ sind. Wir kamen in das Dorf Deir al-Assad.
Jedesmal, wenn die Polizei erschien, verbargen wir uns. Wenn der Schulrat in die Schule kam, versteckten mich die Lehrer, weil ich eigentlich gar nicht da sein durfte. Sie können sich vorstellen, wie stark so etwas ein siebenjähriges Kind beeinflussen kann, welche Gegensätze das zwischen der Kindheit und der Macht schaffen kann. Aus dieser Zeit in Deir al-Assad erinnere ich mich an einen Mann, der eine schöne Stimme hatte und der nachts zu unseren Nachbarn am Dorfrand kam, Rababa spielte und seine Geschichte vorsang: wie er sein Haus verlassen, die Grenze überschritten hatte und wie er zurückgekommen war. Er erzählte von Nächten und vom Mond – er brachte eine herzzerreißende Sehnsucht zum Ausdruck. Mein Unterbewußtsein hat seine Musik in sich aufgenommen. Als ich ihm zuhörte, spürte ich, daß Worte die Wirklichkeit in sich tragen können. Ich lernte, daß die Kunst aus den einfachen Dingen kommt. Ich wollte es diesem Mann gleichtun.
Yeshurun: Das läßt an Scheherazade denken, die die ganze Nacht lang ihre Geschichte erzählt, um ihr Leben zu retten.
Darwisch: Das stimmt. Ich erinnere mich, wie, als wir noch in unserem Heimatdorf waren, jede Nacht Gäste zu meinem Großvater kamen, Tee und Kaffee tranken und sich diesem Kult hingaben: Jemand las aus einem Buch vor und sang. So will es die Tradition der arabischen Kultur. Es schützt vor der Gegenwart und rettet vor dem Leid; zusammen mit dem Tag kommen die Polizisten zurück. Wenn man vom Leid erzählt, fühlt man, daß man in sich die Kraft zur Schöpfung trägt. Gott hat die Welt erschaffen, der Mensch kann Dichtung erschaffen.
Dieser Mann erinnerte an einen Ritter. Nach ihm wurde im gesamten Land gefahndet. Er lebte in den Bergen. Er kam, sang und verschwand bei Tagesanbruch wieder ins Gebirge. Eines Tages ist er für immer verschwunden, aber seine Stimme ist in mir geblieben. In dem „Gedicht von der Erde“ aus dem Jahr 1976 habe ich von ihm gesprochen:
Der Sänger singt
Vom Feuer und den fremden.
Und der Abend war der Abend.
Sie haben seine Brust durchwühlt
Und haben nichts dort gefunden als sein Herz.
Haben sein Herz durchwühlt
Und nichts dort gefunden als sein Volk.
Haben seine Stimme durchwühlt
Und nichts dort gefunden als seine Traurigkeit.
Haben seine Traurigkeit durchwühlt
Und nichts dort gefunden als sein Gefängnis.
Haben sein Gefängnis durchwühlt
Und nichts dort gefunden als sich selbst in Ketten.
Yeshurun: Gibt es überhaupt ein einziges Gedicht von Ihnen, bei dem nicht das Exil im Hintergrund steht? Bildet nicht die Situation des Exils eine Konkretisierung der Stellung des Dichters in der Welt, jedes Dichters, ob er sich in der Heimat befindet oder im Exil?
Darwisch: Man kann von all meinen Werken sagen, daß sie die Poesie eines Exilierten sind. Ich bin als Exilierter geboren. Das Exil ist ein sehr weitgefaßtes und sehr relatives Konzept. Es gibt das soziale Exil, das familiäre Exil, das Exil in der Liebe, das innere Exil. Jede Poesie ist der Ausdruck eines Exils oder einer Andersartigkeit. Wenn sie einem wirklichen Erleben entspricht, handelt es sich um ein konzentriertes, komprimiertes Exil. Ich habe das Exil in jedem Wort gefunden, das ich in meinem Wörterbuch nachschlage. Aber ich beklage mich nicht darüber. Schließlich ist das Exil zu meinem Schreiben sehr großzügig gewesen. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, unter verschiedenen Kulturen und Völkern umherzureisen.
Yeshurun: Das Exil hat Ihre Poesie bereichert. Es hat Ihnen gegeben, wonach Sie sich so sehnten, bevor Sie das Land verließen.
Darwisch: Das stimmt. Aber gestatten Sie mir, das ein wenig anders auszudrücken. Zuvor glaubte ich, die Poesie nehme am Kampf teil; heute glaube ich nicht mehr, daß sie eine unmittelbare Funktion hat. Der Einfluß der Poesie macht sich sehr langsam geltend, in einem Prozeß, in dem die Zeit eine große Rolle spielt.
Der Abstand hat mir erlaubt, meinen Ton zu mildern; er hat mir gestattet, mich selbst, die Besatzung, die Landschaft, das Gefängnis zu beobachten und der Beobachtung ein Stück vom Heiligen hinzuzufügen. Die Poesie hat sich in einen Kult der Schönheit, einen von jeder Verpflichtung freien Kult verwandelt. An einen anderen Ort zu gehen, ist eine Befreiung. Je weniger man gekannt wird, desto besser kennt man sich selbst; es ist auch eine Frage der Reife. Ich habe mehr gelesen und die europäische Poesie kennengelernt. Ich habe gelernt, zu vergeben. Denn letzten Endes leben wir alle im Exil. Ich und der Besatzer, wir leiden beide unter einem Exil. Er ist in mir exiliert, und ich bin das Opfer seines Exils. Auf diesem Planeten sind wir alle Nachbarn, sind wir alle exiliert, dasselbe menschliche Schicksal erwartet uns, und was uns vereint, ist die Notwendigkeit, die Geschichte dieses Exils zu erzählen.
Yeshurun: Liegt darin nicht eine Idealisierung der Distanz? Muß man für das Exil nicht einen Preis bezahlen?
Darwisch: Für das Exil zahlt man mit der Nostalgie und mit dem Gefühl, ein Außenstehender zu sein. Aber man wird dafür durch die Schöpfung einer neuen Welt parallel zur Wirklichkeit entschädigt. Und es ist die Distanz, die mir das erlaubt. Die geographische Entfernung schafft auch den zeitlichen Rahmen des Gedichts, das nun nicht mehr gezwungen ist, unmittelbar zu reagieren.
Yeshurun: In Ihrer Dichtung der letzten Jahre orientieren Sie sich an der Metaphysik. In dem Gedicht „Der Wiedehopf“ zum Beispiel wird die Liebe zu Gott zur Metapher für die Liebe zur heimatlichen Erde: „Und der Nichtort ist der Ort.“
Darwisch: Jeder Mensch wird zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort geboren. Es ist folglich normal, daß der Mensch sich auf sinnliche Weise ausdrückt. Ich gehöre zu den Dichtern, die der Meinung sind, daß die Poesie die Sinne durchlaufen muß. Ich glaube nicht an eine abstrakte Poesie. Selbst die Abstraktion durchläuft zunächst die Sinne. Je weiter wir heranwachsen, desto mehr nähern wir uns dem Himmel. Der Gesichtskreis erweitert sich. Indem die Poesie von der Wurzel ausgeht, entwickelt sie sich wie ein Baum dem Himmel entgegen. Die Poesie ist eine Reise zur Metaphysik. Der arabischen Poesie fehlt es an Metaphysik. Sie ist zu sehr mit der Realität befaßt. Man muß sie dazu bringen, den Alltagstrott zu verlassen. Der Wiedehopf stellt in meiner Poesie eine besondere Erfahrung dar. Ich wollte Ausdrucksmittel ohne Grenzen verwenden. Ich wollte mich in ganz neue Formen stürzen. Dieses Gedicht greift auf die Metaphysik zurück, aber es ist nicht metaphysisch. Es führt einen Dialog mit der Komödie Die Vögel von Aristophanes und mit den Wanderungen der Vögel in der persischen Poesie. Aber was suchte Aristophanes? Das Schlaraffenland. Was suchte Jalal al-Din al-Rumi? Gott. Was suche ich selbst? Ich habe dieselbe Reise gemacht, auf denselben Wegen; ich habe mich auf die griechische und die persische Kultur gestützt. Ich habe die Poesie gesucht – kein Heimatland. Und für die Dichter ist Gott letzten Endes die Poesie; er ist der große Schöpfer. Der Poet ist der Schatten Gottes.
Yeshurun: Wird das Abwesende durch die Kraft der Poesie gegenwärtig? Wird der Nichtort zum Ort?
Darwisch: Ja. Aufgrund der Kraft der Poesie. Sie kennt keine Grenzen. Es gibt kein letztes Gedicht; der Horizont ist offen. Der Weg zur Poesie ist die Poesie. Es gibt keine letzte Station, nicht einmal Gott. Auf dem Weg zu Gott findet man Gott. Die Poesie ist ein tastender Versuch, die Poesie zu finden. Wenn wir wüßten, aus welchem Gedicht die Poesie besteht, würden wir es schreiben, und die Sache wäre zu Ende.
Yeshurun: Die Beziehung zwischen der „Erde“ und der „Poesie“ steht im Hintergrund all Ihrer Gedichte. Worin besteht diese Beziehung?
Darwisch: Die Erde ist meine erste Mutter. Aus ihr bin ich gekommen, und zu ihr werde ich zurückkehren. Die Erde birgt in sich den Kreislauf der menschlichen Existenz; sie ist unser konkreter Himmel. Ein umgekehrter Himmel, könnte man sagen. Wir erheben uns, dann steigen wir wieder hinab und legen uns schlafen. Es ist vielleicht dieser Weg über die Erde, auf dem wir Gott begegnen. Da die Erde mir weggenommen wurde und ich auf ihr im Exil war, hat sie sich in den Ursprung und das Ziel meines Geistes und meiner Träume verwandelt – in das Symbol des Heimatlandes. Sie verkörpert alle Sehnsucht und alle Träume von Rückkehr. Aber man darf sie nicht ausschließlich als einen fest umschriebenen Ort betrachten. Sie ist auch die Erde der Welt schlechthin, und auch das bildet Teil der Grundlage meiner Arbeit. Die Erde ist eine Synthese: sie steht am Ursprung der Poesie, und ebenso ist sie deren Gegenstand und Sprache. Manchmal sind Erde und Sprache nicht voneinander zu trennen. Die Erde ist die physische Existenz der Poesie.
Yeshurun: Ich möchte mit Ihnen über Ihren Gedichtzyklus „Elf Sterne über dem Auszug aus Andalusien“ sprechen. Für was steht Andalusien in der arabischen Poesie? Was bedeutet es für Sie?
Darwisch: In der arabischen Tradition stellt Andalusien die kollektive Klage über das verlorene Paradies dar. Es übt eine starke Anziehungskraft gegenüber der Vergangenheit aus. Andalusien erinnert an die vorislamische Poesie der Jahiliya, in der man über den Ort, das Haus, das es nicht mehr gibt, weint. Das ist die Tradition: Der Gesang muß mit den Klagen über die Steine und das verschwundene Lager beginnen. Es ist der Gesang der Nomaden, die von einem Ort zum anderen ziehen. Der Dichter ist auf der Wanderung und findet Steine: Laila ist hier vorbeigekommen, Lubna ist hier vorbeigekommen. Die Geliebte ist nicht mehr da. Dann geht man zur Beschreibung des Pferdes oder Kamels über und von da zu den metaphysischen Fragen. Andalusien hat den Platz des verlorenen Ortes eingenommen, und später hat Palästina sich dann in Andalusien verwandelt. Die populäre Poesie der fünfziger und sechziger Jahre hat diesen Vergleich gezogen: Wir haben Palästina verloren, so wie wir Andalusien verloren haben. Aber das ist nicht die Art, wie ich die Dinge sehe. Ich habe immer gesagt, daß Andalusien wiedergefunden werden kann. Ich habe jene Elf Sterne in Erinnerung an die fünf Jahrhunderte geschrieben, die seit der – wie Sie wissen, auf einem Irrtum beruhenden – Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika verstrichen sind. Meine Gedichte sind der Appell eines arabischen Dichters, der sich inmitten jener enormen historischen Entwicklung befindet. Ich bin nicht der Auffassung, daß Andalusien mir gehört oder daß Palästina ein verlorenes Andalusien ist. Ich habe versucht, einen Dialog mit den Exilierten der Erde herzustellen, und ich habe kein Recht auf Andalusien reklamiert. Aber ich habe das Leid und die Tränen des Arabers verstanden, der siebenhundert Jahre lang an einem Ort gelebt hat und dann von dort verjagt worden ist; er hat keinen anderen Ort, keinen anderen Sammelpunkt. Meine Vision war nicht die eines Kolonialisten. Ich habe die Verschiedenartigkeit der Menschen gesucht, wo immer sie sich befinden. Andalusien kann hier oder anderswo, kann überall sein. Für mich repräsentiert Andalusien die Begegnung aller Fremden beim Aufbau einer menschlichen Kultur. Es gab dort nicht nur die Koexistenz zwischen Juden und Moslems; sie hatten auch ein gemeinsames Schicksal. Sie sind zur gleichen Zeit von dort weggegangen. Die spanische Regierung hat sich kürzlich, Jahrhunderte später, bei den Israelis entschuldigt; gegenüber den Arabern hat sie das nicht getan. Diese Reue basiert auf einem Kräfteverhältnis, nicht auf einer menschlichen Beziehung. Für mich ist Andalusien die Verwirklichung des Traums der Poesie. Ein goldenes Zeitalter des Humanismus und der Kultur.
Yeshurun: Glauben Sie nicht, daß Sie diesen Weg haben gehen können, weil Sie in einer Situation des Exils waren? Jetzt, wo sich die Liebe zum Heimatland in alltäglichen Problemen konkretisieren wird, werden Sie den umgekehrten Weg zur Realität gehen müssen. Beunruhigt Sie das?
Darwisch: Das Verhältnis, von dem Sie sprechen, ist nicht poetischer, sondern politischer Art. Für die Poesie ist die jetzige Situation vorzuziehen. Wir werden eine wundersame Lösung für alle Probleme haben: Wir werden einen Staat haben. So denken wir auf der politischen Ebene. Aber vom literarischen Gesichtspunkt aus ist das ein Irrtum. Wenn die Palästinenser einen Staat haben werden, wird die literarische Herausforderung noch größer sein. Der Staat wird den Schriftstellern ermöglichen, unter „normalen“ Bedingungen zu schreiben. Aber erst diese normalen Bedingungen werden zeigen, ob diese Literatur überhaupt der Mühe wert ist. Viele palästinensische Schriftsteller berufen sich darauf, daß wir keinen Staat haben. Aber ein Staat ist kein literarisches Thema. Dasselbe gilt für ein Heimatland. Wenn man ein Heimatland hat und dann mit patriotischer Begeisterung davon spricht, ist das lächerlich. Aus diesem Grund wird ein großer Teil der palästinensischen Literatur in die Krise geraten. Die Träume werden sich realisieren und dann? Ich werde nicht unter dieser Krise zu leiden haben. Ich habe sie bereits durchgemacht. Ich habe mir mein eigenes Heimatland aufgebaut. Ich habe mir sogar einen Staat geschaffen, nämlich in Form meiner Sprache. Wenn die Poesie keine menschliche Weite hat – wenn sie nicht ans Menschliche rührt –, ist der Text tot. Was nicht bedeutet, daß wir nur über allgemeine Themen schreiben müssen. Die Literatur kommt aus dem Alltäglichen, aber definiert sich das Alltägliche durch die Grenzen der Erde, in der wir unsere Wurzeln haben? Was ist ein Heimatland? Ein Ort, der den Menschen Bewegungsfreiheit gibt; aber nicht, damit sie eine Fahne daraus machen. In dem Gedicht „Waffenstillstand mit den Mongolen“ schreibe ich: „Wenn wir siegen, werden wir unsere schwarzen Banner auf Wäscheleinen hängen, danach machen wir Strümpfe daraus.“ Ich bin nicht bereit, mein Leben einer Fahne zu weihen.
Yeshurun: In Ihrer Dichtung der letzten zehn Jahre spüre ich immer stärker eine Annäherung an die jüdische Konzeption, die während der Jahrhunderte des Exils gereift ist: Sie stellt den Text der Realität, den abstrakten Ort dem physischen Ort gegenüber. In Ihrem Buch Eine Erinnerung für das Vergessen schreiben Sie: „Wir haben vom Libanon nichts als eine Sprache gesehen, die uns dem Überlebenstrieb auslieferte.“ Und in einer anderen Passage: „Palästina war kein Heimatland mehr, sondern eine sinnlose Parole.“ Ich weiß, daß der Vergleich zwischen dem jüdischen Schicksal und dem Schicksal der Palästinenser Sie empört, weil er an eine Art „Wettstreit“ denken läßt, wer von beiden in stärkerem Maße Opfer ist.
Darwisch: Zunächst einmal entrüstet mich dieser Vergleich durchaus nicht, wenn es um tiefe literarische Fragen geht. In diesem Bereich gibt es keinen Nationalismus. Ich denke, daß der Knoten, bei dem es darum geht, ob man den Vergleich akzeptiert oder zurückweist, sich mit dem Frieden auflösen wird. Der Jude wird sich der arabischen Komponente, die er in sich trägt, nicht mehr schämen, und der Araber wird sich nicht schämen, zu bekennen, daß auch er jüdische Bestandteile in sich hat. Besonders, wo es sich doch um dieselbe Erde handelt, Eretz Israel im Hebräischen, Palästina im Arabischen. Ich bin das Produkt sämtlicher Kulturen, die durch dieses Land gezogen sind, der griechischen, der römischen, der persischen, der jüdischen, der ottomanischen. Deren Präsenz besteht bis in meine Sprache hinein. Jede starke Kultur hat etwas dort zurückgelassen. Ich bin der Sohn all dieser Kulturen, aber ich habe nur eine einzige Mutter. Heißt das etwa, daß meine Mutter eine Prostituierte ist? Meine Mutter ist jene Erde, die alle Welt bei sich empfangen hat, die Zeugin und Opfer gewesen ist. Ich bin auch Sohn der jüdischen Kultur, die es in Palästina gegeben hat. Aus diesem Grund fürchte ich diesen Vergleich nicht. Aber das politische Spannungsverhältnis – wenn Israel existiert, müssen die Palästinenser verschwinden, und wenn die Palästinenser da sind, kann es Israel nicht geben – hat dazu geführt, daß wir es abgelehnt haben, uns als aus gleichen Bedingungen geboren zu betrachten, und daß wir zu Rivalen hinsichtlich der Frage geworden sind, wer von uns mehr Opfer ist als der andere. Ich habe schon Zionisten den Verstand verlieren sehen, wenn man sie an Völkermorde erinnert hat, die an anderen Völkern verübt wurden. Wie zum Beispiel Elie Wiesel, der geschrieben hat, er frage sich, wie man behaupten kann, was in Bosnien vor sich gehe, sei ein Völkermord. Als ob die Juden auf diesen Begriff ein Monopol hätten. Jedesmal, wenn ich zu einer Veranstaltung oder Fernsehsendung eingeladen werde, will man immer im Namen der Parität auch noch einen israelischen Schriftsteller einladen. In Italien hat man mir vorgeschlagen, ein gemeinsames Buch mit Nathan Zach zu veröffentlichen. Ich habe dazu gesagt: „Wenn Sie glauben, daß Nathan Zach ein guter Dichter ist, und ich denke, daß er das ist, und wenn Sie glauben, daß ich ein guter Dichter bin, und darin bin ich mir nicht so sicher wie Sie, dann veröffentlichen Sie ein Buch von ihm und ein Buch von mir.“ Warum muß ich über meine gute oder schlechte Beziehung zu den Israelis definiert werden? Bei diesen Beziehungen handelt es sich um Politik. Sie verwandeln unsere literarische Arbeit in Politik. Dem widersetze ich mich. Gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen meiner Wanderschaft und der des Juden? Ich denke ja. Unter dem Aspekt des menschlichen Schicksals gibt es viele Überschneidungen. Das ist sowohl gut als auch schlecht. Ich habe die Befürchtung, daß das ein neues Ghetto schaffen wird, daß wir keine Freude daran haben werden.
Yeshurun: Ist ein Staat immer ein Ghetto?
Darwisch: Man muß den Staat, jene wundersame Lösung, schnell vergessen und sich so verhalten, als sei er eine vollkommen normale Sache. Sie haben von Anfang an Ihren Staat zu etwas Heiligem gemacht und haben sich in diesem Ghetto eingeschlossen. Jetzt versuchen Sie, dem Ghetto zu entkommen. Man muß zwischen den beiden Standpunkten, dem politischen und dem intellektuellen, unterscheiden. Sie haben unser Exil verursacht, wir aber nicht das Ihrige.
Yeshurun: Das war eine historische Notwendigkeit.
Darwisch: Ich möchte Sie an einen wesentlichen Punkt erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob die heutigen Generationen der Juden in Europa das Gefühl haben, sich im Exil zu befinden. Ist der Begriff des „Heimatlandes“ während sämtlicher Generationen bei Ihnen lebendig gewesen? Aber jeder Palästinenser erinnert sich daran, daß er ein Heimatland hatte und daß er von dort ins Exil getrieben wurde. Die Juden in ihrer Gesamtheit erinnern sich nicht daran, denn es sind zweitausend Jahre seitdem vergangen. Bei den Palästinensern ist das Heimatland keine intellektuelle Erinnerung, kein intellektueller Begriff. Jeder Palästinenser ist Zeuge des Einschnitts, der stattgefunden hat.
Yeshurun: Aber die Juden haben lange Zeit im Exil gelebt. Worauf wollen Sie hinaus?
Darwisch: Darauf, daß der Palästinenser aus dem Konkreten kommt. Daß Ihr Exil allen Exilen aller Völker ähnelt.
Yeshurun: In Ihrem Artikel „Die Identität der Abwesenheit“ sprechen Sie sich gegen den Versuch aus, die Palästinenser mit den Juden zu vergleichen. Sie lehnen es ab, unsere Völker als geschichtliche Doppelgänger zu betrachten.
Darwisch: Ich sprach von der Situation in den besetzten Gebieten. Man muß einen Unterschied zwischen Besatzer und Besetztem machen.
Yeshurun: In Ihrem Buch Eine Erinnerung für das Vergessen schreiben Sie: „Wir müssen wissen, was wir wollen: unser Land oder unser Bild von uns selbst fern unseres Landes oder aber auch das Bild unserer Sehnsucht nach unserem Land im Innern des Landes.“ Sehnsucht nach der Sache selbst oder nach ihrer Widerspiegelung?
Darwisch: Hinter den großen Worten wie Vaterland, Revolution, Patriotismus verbergen sich zerbrechliche Dinge. Das Heimatland ist ein weitgefaßter Begriff, aber wenn man dann selbst dorthin geht, sucht man nach einem bestimmten Baum, einem bestimmten Stein, einem Fenster. Diese Dinge bringen das Herz zum Glühen, nicht eine Fahne oder eine Nationalhymne. Ich sehne mich nach den kleinen Einzelheiten. Ihre Frage nach der Sache selbst und ihrer Widerspiegelung warnt mein Herz vor einer Enttäuschung. Aber gestehen Sie mir wenigstens das Recht zu, zurückzukehren, damit ich mir diese Frage überhaupt stellen kann?!
Yeshurun: Sie haben Angst, den Traum zu verlieren?
Darwisch: Das ist in meiner Poesie ein lebendiger Mythos. Ich habe immer Angst, den Traum zu zerstören. In meiner letzten Gedichtsammlung sage ich, daß ich nur einen einzigen Traum habe: einen Traum zu finden. Ein Traum, das ist ein Stück Himmel in jedem von uns. Wir können nicht vollkommen pragmatisch, vollkommen realistisch sein; wir brauchen ein wenig Himmel, um das Gleichgewicht zwischen dem Realen und dem Traum zu finden. Der Traum ist das Gebiet der Poesie.
Yeshurun: In demselben Buch sagen Sie: „Mein Leben ist die Beschämung meiner Poesie, und meine Poesie ist die Beschämung meines Lebens.“
Darwisch: Was soll das heißen? Das soll ich gesagt haben? Das ist ein Irrtum in der Übersetzung. Ich habe das Wort Fadiha gebraucht. Im Arabischen ist Fadiha nicht nur die Beschämung, sondern auch der Skandal. Fadiha ist das Gegenteil eines Geheimnisses, einer Sache, die sich im Verborgenen abspielt. Fadiha, das ist eine Enthüllung. Fadahtu sirri: Ich habe mein Geheimnis offenbart. Die Poesie kann die in meinem Innern befindliche Wahrheit nicht verbergen. Die Poesie ist die skandalöse Enthüllung meines Geheimnisses.
Yeshurun: Über Beirut haben Sie geschrieben: „Ist es eine Stadt oder eine Maske? Exil oder Lied?“ Haben Sie hier Beirut in eine Metapher der Poesie verwandelt?
Darwisch: Für eine sehr kurze Zeit. In Wirklichkeit haben wir den Libanon nicht gekannt. Wir lebten in einem Ghetto, das wir uns in Beirut aufgebaut hatten. Jeder von uns fragte sich, was Beirut eigentlich war. Selbst die Libanesen kannten Beirut nicht. Beirut ähnelt Manhattan, ist eine Stadt der Vermischungen. In Beirut sahen wir nur uns selbst. Dort ist jede Straße eine Stadt für sich, vor allem im Krieg. Ich habe mich dieser Metapher bedient, um die inneren Widersprüche dieser Erscheinung hervortreten zu lassen. Beirut war ein Phänomen. Ich bin mit meinem Schreiben während dieser Zeit nicht sehr zufrieden. Der Krieg begann 1975, und ich war zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren dort. Ich habe das „Gedicht über Beirut“ geschrieben. Den Libanesen hat es nicht gefallen. Sie haben gesagt: Das ist nicht deine Stadt. Sie haben gesagt, ich sei ein Fremder. Ich fühlte mich als Durchreisender. Alle, die einen sechsten Sinn besaßen, wußten, daß das palästinensische „Gebilde“ in Beirut nicht von Dauer sein würde. Zwischen den Libanesen auf der einen und den Palästinensern und Syrern auf der anderen Seite begannen sich nationalistische Spannungen breitzumachen. Unsere Anwesenheit war den Libanesen lästig. Sie konnten die Bürde der Palästinafrage nicht allein tragen, und ich kann sie verstehen. Das ist ein Kapitel meines Lebens. Beirut war kein Lied. Es war eine Maske.
Yeshurun: Wie ordnen Sie sich innerhalb der Geschichte der arabischen Poesie ein?
Darwisch: Ich bin das Produkt eines alten, reichen Dialogs. Aber meine Art, mich auszudrücken, ist sehr persönlich. Jeder Dichter hat etwas beizusteuern. Es gibt keine Schöpfung aus dem Nichts. Es gibt keinen Beginn, der mit einer leeren Seite anfängt. Ich ziehe eine Summe, ich synthetisiere. In meiner Poesie findet sich eine Art Schlußfolgerung der Geschichte der arabischen Poesie – der klassischen und der modernen. Die Schriftsteller nach mir werden mich in ihre Schlußfolgerungen einschließen. Indem ich meine Bewunderung für Mutanabbi, der im zehnten Jahrhundert lebte, zum Ausdruck bringe, sage ich, daß er die Geschichte der arabischen Poesie vor ihm, zu seiner Zeit und danach in sich vereinigt. Er ist moderner als wir. Denn seine Poesie widersteht sogar noch dem Rhythmus unserer Zeit. Wenn wir etwas über unsere Zeit sagen wollen, gehen wir zu ihm zurück. Er ist der größte arabische Dichter. Ein Beispiel? „Unruhig, als säße ich rittlings auf dem Wind“, oder über seine Poesie: „Unter ihrem Aufblitzen verblaßt meine Tinte.“ Mutanabbi hat das Gewicht der Poesie dem Gewicht der Macht entgegengestellt, er hat die Macht der Poesie geschaffen.
Yeshurun: Ihre Poesie respektiert die Tradition der „Kasida“, der klassischen arabischen Ode. Sie führen jedoch die Alltagssprache und regional bedingte Ausdrücke ins klassische Arabisch ein. Sie verwenden zum Beispiel das Wort „Shubbak“, das man für gewöhnlich in der gesprochenen Sprache verwendet, öfter als das klassische literarische Wort „Nafidah“ [Beide Begriffe sind Synonyme für „Fenster“, A.d.Ü.].
Darwisch: Der arabische Modernismus kann sich nicht außerhalb der Geschichte der Kasida entwickeln. Ich bin gegen die Tendenz, die sich vornimmt, genau das zu zerstören, was die Kasida zu dem gemacht hat, was sie ist. Ich bin stolz, an jener musikalischen Schatzkammer teilzuhaben, die die arabische Poesie nun einmal ist. Ich kenne nicht alle Sprachen der Welt, aber keine andere Sprache besitzt wie das Arabische sechzehn verschiedene dichterische Metren. Das arabische Metrum beruht auf der Anzahl der metrischen Einheiten der Musik. Eine lange Silbe und eine kurze Silbe. Manchmal hat man drei lange Silben, gefolgt von einer kurzen und zwei langen Silben. Jede prosodische Einheit enthält mindestens eine lange Silbe. In einem kleinen Abschnitt kann ich einen Rhythmus in zwei verschiedene Metren aufspalten. Wenn ich sie mit einem weiteren verbinde, erhalte ich ein drittes Metrum, und das ist dann so, als hätte ich einen neuen Rhythmus geschaffen, und so geht es immer weiter. Man bezieht sich immer, ob am Ende oder am Anfang eines dichterischen Metrums, auf sämtliche anderen Metren. Kurz, es fehlt uns nicht an musikalischem Reichtum. Wir finden unsere Lösungen im Innern der arabischen Metrik, und nicht in ihrer Zerstörung, oder indem wir uns auf die Prosa verlegen.
Bei der neuen Welle in der arabischen Poesie handelt es sich um Prosa. Um eine poetische Prosa. Ich bin nicht dagegen, aber in meinen Augen ist das ein neues Genre; ich bezeichne das nicht als Poesie.
Ich bin der Ansicht, daß die Musik etwas Fundamentales ist und nicht nur eine Verzierung. Der Unterschied zwischen Poesie und Prosa muß erhalten bleiben, und zwar nicht nur in der Theorie. Was das betrifft, bin ich ein wenig reaktionär. Aber grundsätzlich geht es darum, das arabische Auge und Ohr vergessen zu lassen, daß es sich hier um eine Fortsetzung der klassischen Tradition handelt. Dabei hilft die Komposition der Metapher, weil sich dadurch eine neue Sicht ergibt. Man kann die Alltagssprache oder sogar fremde Wörter mit einbeziehen. So gebrauche ich zum Beispiel nicht das Wort al-Qithara, sondern ich sage „Gitarre“. Ich sage nicht Kaman, sondern Kamanja (Geige). Das bringt Abwechslung und nimmt dem Text die Schwere. Aber es ist nicht das, was die Poesie ausmacht. Die neue Herangehensweise befreit das Gedicht von der Unmittelbarkeit des Alltäglichen, sie stellt eine Synthese zwischen dem Sinnlichen und dem Abstrakten her und bewahrt dem Gedicht sowohl die Wolke als auch den Schatten.
Ich schreibe nicht in Reimen. Der Reim ist in meinen Augen eine Frau, die ihrem Mann aufgezwungen wird. Aber manchmal kann man, indem man einen einzigen Reim über eine gesamte Passage des Gedichts beibehält, das Gefühl einer Wiederkehr der abgelaufenen Zeit erzeugen. Ich sage immer, daß man die arabische Kasida beherrschen muß, um sich wirklich gegen sie auflehnen zu können. Die Revolte muß aus dem Innern kommen. Ich hüte die uns überlieferte Tradition. Mein Text ist den Einflüssen jener Zeit gegenüber offen.
Yeshurun: Betrachten Sie sich als Nachfolger von Ibrahim Tukan und Abu Salma, die nach der großen arabischen Revolte, die wir „die Ereignisse von 1936“ nennen, politische „Kasidas“ geschrieben haben?
Darwisch: Als ich jung war, empfand ich ebenso wie alle anderen die Notwendigkeit, die Kontinuität der palästinensischen Tradition zu demonstrieren. Ich sah mich genötigt, mich zum Erben dieser Familie zu erklären. Aber wenn Sie die Texte in bezug auf die Struktur, die Herangehensweise und die Vision des Gedichts aufmerksam lesen, werden Sie zwischen diesen Dichtern und mir, abgesehen von der Tatsache, daß wir Palästinenser sind, nichts Gemeinsames finden. Sie schrieben klassische Gedichte, und ich behauptete aus politischen Gründen, ich würde ihrem Weg folgen.
Yeshurun: Auf welche Weise beeinflußt die Barriere zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Arabisch den Charakter der gegenwärtigen arabischen Poesie? In welchem Verhältnis steht diese Erscheinung zu dem für die Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts typischen Versuch, eine spontane Poesie zu schaffen?
Darwisch: Ich setze mich mit dieser Frage immer in einer anderen Form auseinander: Wie kann man so schreiben, daß die Menschen es verstehen, daß das Volk es lesen kann? Denn selbst wenn man eine komplexe und moderne Poesie schreibt, bringt man auf die eine oder andere Art den Geist des Volkes zum Ausdruck. In der gesamten Geschichte der arabischen Literatur hat es immer eine literarische Sprache und eine Volkssprache gegeben. Selbst während der Jahiliya, als sich die arabische Kasida auf ihrem Höhepunkt befand – einem Höhepunkt, der bis heute unerreicht blieb –, ist es niemandem gelungen, auch nur im geringsten diese Barriere zu überwinden. Dabei kann ich mir nicht vorstellen, daß jemals Leute in dieser Sprache gesprochen haben. Es hat immer eine Sprache für die Literatur und eine andere für das Leben gegeben. Viele Dichter haben versucht, diese Beschränkung zu lockern und den Formalismus der geschriebenen Sprache zu mildern, indem sie sie mit der gesprochenen Sprache vermischten. Ich denke, daß sämtliche Versuche, die Distanz zwischen den beiden Sprachen zu reduzieren oder sie dazu zu bringen, sich auf halber Strecke zu treffen, fehlgeschlagen sind. So etwas ist vielleicht schön und nützlich für den Roman, aber bei der Poesie handelt es sich um eine aristokratische Arbeit, nicht um volkstümliche Werke. Sie bedient sich einer sorgfältig bearbeiteten Sprache. Wenn es in einem Gedicht mehrere Stimmen gibt, kann man auch einige Passagen in gesprochener Sprache darin aufnehmen; im übrigen wissen wir, daß sämtliche volkstümlichen Ausdrücke einen literarischen Ursprung haben. Man kann den Ton leichter machen, indem man auf Wörter verzichtet, die schon tot sind. Jede Entwicklung hat dazu geführt, daß Hunderte und Tausende von Wörtern aufgegeben wurden. Wir schreiben vielleicht im gleichen Rhythmus, aber nicht mit den gleichen Worten wie die Dichter der Jahiliya. Bestimmte vergessene Wörter verdienen es, zum Leben erweckt zu werden. Sie führen den Text an einen präzisen Ort, der Sehnsucht hervorruft und einen neuen Raum eröffnet. Das ist ein raffiniertes Spiel. Man kann Worte töten, aber ebenso kann man andere wiederbeleben. Letzten Endes hängt alles von der Struktur des Gedichts ab.
Yeshurun: Fühlen Sie sich nicht eingeschränkt, wenn sich der Rhythmus der gewöhnlichen Sprache nicht im Gedicht wiederfindet?
Darwisch: Nein. Der Unterschied liegt in der Grammatik und der Syntax, aber jedes Wort der gesprochenen Sprache hat einen Vetter in der literarischen. Ich möchte in einem modernen Gedicht keine überflüssigen populären Wörter sehen, auch wenn es sich dabei um eine der Grundlagen des Modernismus handelt. Ich selbst habe dieses Problem nicht. Die Frage, die sich heute stellt, ist die, wer die Poesie versteht, die man schreibt; und die einzige Antwort auf diese Frage ist, daß der arabische Leser sich entwickeln muß.
Yeshurun: Worin liegen die Vor- und Nachteile, die sich aus der Existenz zweier paralleler Sprachen in der Literatur und im Leben ergeben?
Darwisch: Ich sehe keinen Gewinn. Ich sehe immer nur den Verlust. Jeder Dichter träumt von einer Poesie, die so unentbehrlich ist wie das Brot. Das ist ein schöner Traum. Man muß davon träumen. Der Verlust besteht darin, daß, wenn ich für meine Mutter schreibe, sie mich nicht verstehen wird, weil sie nicht lesen kann. Das ist ein menschlicher und kultureller Verlust.
In Ägypten und im Libanon gibt es eine Poesie, die in gesprochener Sprache geschrieben ist. Aus diesem Grund sage ich, auch wenn das mit Sicherheit zu kurz gegriffen ist, daß das Problem durch al-Abnudi in Ägypten und durch Dichter wie Talal Haydar im Libanon, die in der Volkssprache schreiben, gelöst worden ist. Im Irak gibt es wunderbare Dichter der gesprochenen Sprache. Tatsächlich hat es dort immer zwei Arten von Poesie gegeben. Manchmal manifestiert sich die Modernität in diesen Gedichten besser als in der literarischen Poesie. Diese Dichter haben die gesprochene Sprache in eine neue literarische Sprache verwandelt. Das ist wirkliche Poesie. Sie haben, ausgehend von der Sprache des Lebens, eine Literatur geschaffen.
Yeshurun: Glauben Sie, daß einmal der Tag kommen wird, an dem die beiden Sprachen, die literarische und die gesprochene, im Schreiben verschmelzen werden? Können Sie sich vorstellen, eines Tages in einem arabischen Dialekt zu schreiben?
Darwisch: Nein. Und wissen Sie warum? Weil ich die arabischen Dialekte nicht gut kenne. Ich spreche eine gemischte Sprache. Meine Sprache ist nicht rein. Um eine Sprache rein zu sprechen, muß man an einem bestimmten Ort leben. Meine gesprochene Sprache ist eine Mischung aus Palästinensisch, Ägyptisch und Libanesisch.
Yeshurun: In dem Gedicht „Die Lehren der Houriya“ sagt Ihre Mutter:
Und das Exil schuf uns zwei Sprachen:
Den Dialekt, damit die Tauben
Ihn hören und die Erinnerung bewahren;
Die Literatur, damit ich den Schatten
Ihren Schatten erkläre.
Darwisch: Kennen Sie die Bedeutung des Namens Houriya? Es ist eine Meerjungfrau; halb Frau, halb Fisch. Die Volkssprache ist den Ursprüngen, der Landschaft näher; einfacher, menschlicher. Sie trägt eine Liebesbotschaft zwischen den Bäumen und den Tauben mit sich. Sie hütet die volkstümliche Erinnerung. Seitdem ich schreibe, bin ich zur ausgearbeiteten literarischen Sprache verurteilt worden, deren Rolle es ist, die Komplexität des Schattens zu erklären. Deine Beziehung, Mutter, ist wahrhaftiger; deine Sprache ist wahrhaftiger. Ich strebe nach den metaphysischen, höheren Dingen. In dem Absatz, den Sie zitieren, charakterisiere ich ja den Unterschied zwischen der Volkssprache und der literarischen Sprache.
Yeshurun: Meinen Sie, daß es in der Volkssprache keine Schatten gibt?
Darwisch: Dort ist das Weiße weiß und das Schwarze schwarz. Aber ich muß Schatten und Nuancierungen schaffen, um mich zu retten. Ich sitze im Schatten; ich bin nicht sehr klar. Ich befinde mich im Schatten der Sprache und im Schatten der Dinge; im Schatten der Realität und der Legende, aber nicht in der Sache selbst. Ich bin nicht ich, ich bin im Schatten meiner selbst.
Yeshurun: Und wie zeigt sich dieser „Schatten meiner selbst“ in der Poesie?
Darwisch: Man schreibt ein Gedicht und hat manchmal den Eindruck, daß ein anderer es geschrieben hat. Zwischen dem Text und uns besteht eine unbestimmte Spannung. Man sucht sich selbst und findet den Schatten eines anderen, manchmal das Bild eines anderen. Ich bin nicht ein einziges „Ich“, und jeder Schatten wirft selbst noch weitere Schatten.
Yeshurun: Hatten Sie, seitdem Sie im Exil waren, den Eindruck, Sie müßten für Ihr Schreiben neue sprachliche Werkzeuge entwickeln?
Darwisch: Diese Notwendigkeit neuer Mittel hat nichts mit meinem Leben in der Fremde zu tun; es ist eine beständige Notwendigkeit. Als ich nach Europa gegangen bin, hatte ich die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Das war der Wendepunkt. In Beirut habe ich die Bewegung der modernen arabischen Poesie kennengelernt, die ich in Palästina nicht kannte; in Beirut lebte ich im Zentrum der Debatte über die moderne arabische Lyrik.
Yeshurun: Worüber wurde diese Debatte geführt?
Darwisch: Über die Form und – was noch wichtiger ist – über die Beziehung zwischen Poesie und Realität, über die Frage, was wir mit dem Konzept der „revolutionären Poesie“ aussagen wollten. Ist die genannte Beziehung revolutionär als Beziehung zum Sujet, zur Gesellschaft, zur Realität, oder soll sich die Revolution nur in der Sprache abspielen? Es gab zwei Strömungen. Ich habe beide gewählt.
Wenn man Revolutionär in der Poesie sein will, kann man nicht Reaktionär im Leben sein. In Beirut habe ich alles Neue auf dem Gebiet der Theorie gründlich gelesen und die künstlerische Praxis genau verfolgt. In dieser Zeit bin ich zum Schreiben des globalen Gedichts, des offenen Gedichts übergegangen. So jedenfalls bezeichne ich es. Ein langes Gedicht, das mehrere Stimmen enthält und aus antagonistischen Elementen zusammengesetzt ist. Man kann darin sämtliche Formen der arabischen Poesie in einer pyramidenartigen Struktur miteinander kombinieren. Ich habe den Bericht in die Lyrik einfließen lassen. Ich habe vom Preis der Äpfel gesprochen. Ich dachte mir, diese Form könnte auch nichtpoetische Dinge in sich aufnehmen. Aber die in Beirut herrschende Spannung hat uns nicht erlaubt, diesen Versuch bis zum Ende zu gehen. Nachdem ich in Europa angekommen bin, habe ich eine Neubewertung von allem vorgenommen, was ich bis dahin geschrieben hatte. Ich habe eine Unterscheidung zwischen Erhaltenswertem und Überflüssigem getroffen. Ich bin in meinem Schreiben kürzer, konzentrierter, milder geworden. Und vor allem: weniger militant.
Yeshurun: In einem großen Teil Ihrer Gedichte findet ein Gespräch zwischen mehreren Stimmen statt. Äußert sich in diesem Dialog ein Wille, sich Präsenz zu verschaffen, das Abwesende zu manifestieren? Drückt der Dialog verschiedene Standpunkte aus, oder handelt es sich bei ihm um eine Rhetorik, die in Wirklichkeit ein und dieselbe Position auf verschiedene Arten ausdrückt?
Darwisch: Diese Möglichkeiten bestehen alle zugleich. Ich bin nicht allein – weder im Raum noch in der Zeit. Auch nicht mit mir selbst. Es gibt eine Öffentlichkeit in mir. Ich bin selbst eine Öffentlichkeit. Und die Wahrheit hat mehrere Gesichter. Die Verleumder der Wahrheit haben ebenfalls das Recht, sich zu äußern; ich bin nicht Herr und Gebieter über die Wahrheit. Meine inneren Widersprüche sind ihrerseits die Frucht der Widersprüche, die mich in der Welt um mich herum umgeben. Vom literarischen Standpunkt aus erlaubt der Dialog dem Gedicht, den Teil einer Last zu tragen, den es aus sich heraus nicht tragen könnte. Das ist ein wenig wie im Theater. Es erlaubt, die Szenerie zu erweitern und das Drama seine Irrtümer begehen zu lassen, was in einem kurzen Gedicht fast unmöglich ist. Aber die genaueste Antwort besteht darin, daß ich nicht allein an diesem Ort bin. Ich habe nicht eine einzige Farbe, eine einzige Geschichte, ein einziges Land; ich bin nicht allein an diesem Ort, es gibt ein anderes Außen, ein anderes Innen, es gibt Nachbarn. Ich öffne die Tür für die Unterschiedlichkeit der Stimmen.
Das Gedicht muß eine einladende Form haben, es muß anderen Farben und anderen Ausdrucksformen einen Raum bieten. Mein Leben ist ein Schauspiel. Wenn ich mit einer einzigen Stimme schreibe, bin ich ein Prophet, ein romantischer Dichter oder ein Dichter der Jahiliya. Ich verfolge nicht den verwickelten Knoten historischer Argumentationen. In gewisser Weise muß das Gedicht all das klären und entfalten. Ich möchte in einem Gedicht von der Art einer Person, sich zu kleiden, lesen, den Geruch ihres Parfüms einatmen; ich möchte, daß das Gedicht mich mit ihr persönlich bekannt macht. Ich kann mir kein Gedicht ohne persönliche Merkmale, ohne eine spezifische Geographie vorstellen. Ein mexikanisches Gedicht muß der schwarze Stein Mexikos sein. In einem in Israel oder Palästina geschriebenen Gedicht muß man die Stimmen der Propheten hören können, der wahren wie der falschen. Und man muß Esel vorüberziehen sehen.
Aber ich habe noch nicht auf die Frage geantwortet: Warum gibt es so viele Stimmen in meinen Gedichten? Weil ich nicht allein bin. Nicht allein im Gedicht. Nicht allein im Raum. Nicht allein in der Zeit. Es gibt den Anderen.
Yeshurun: Wenn man arabische Poesie liest, hat man oft den Eindruck, daß diese Poesie eine Waffe ist; daß sie Sprengstoff in Form von Parolen liefert.
Darwisch: Das, wovon Sie hier sprechen, ist eine Katastrophe. Zu meinem großen Bedauern gibt es noch heute Leute, die glauben, daß das genauso sein muß, und die mich beschuldigen, sie und die Rolle der Poesie verraten zu haben. Sie sagen, ich habe mich der Elite zugewandt und mich von meinen Wurzeln abgeschnitten. In dem Buch Eine Erinnerung für das Vergessen habe ich außerdem meine Besorgnis über den Begriff „Mission“ geäußert. Die Poesie hat keine Mission. Ich habe verstanden, daß ich um so leiser sprechen muß, je mehr Lärm um mich herum herrscht. Ich kann nur dann meine Stimme erheben, wenn um mich herum alles ruhig ist.
Yeshurun: Glauben Sie nicht, daß das ein allgemeines Problem ist, nicht nur das von Beirut im Jahr 1982?
Darwisch: Doch. Ich glaube, daß es für die Poesie besser ist, wenn sie sich auf sich selbst besinnt. Es ist selten, daß man in ihr eine radioaktive Kraft findet. Früher hat man geglaubt, die Poesie löse die Probleme durch Teilnahme an Streiks und Demonstrationen. Heute ist sie bereits etwas ganz Besonderes, und es könnte gut sein, daß sie sich eines Tages in eine Institution verwandelt, die ebenso unzugänglich ist wie ein Kernkraftwerk. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir dieses gefährliche Stadium noch nicht erreicht haben, wäre es besser, wenn die Poesie sich mit sich selbst befaßte und in ihrem Verhältnis zur Realität wieder autonom würde. Es gibt heute viele Dichter und wenig Poesie.
Yeshurun: Sie haben viel in der ersten Person Plural geschrieben. Was geschieht in einer Poesie, die die Pflicht hat, „Wir“ zu sagen, mit dem „Ich“?
Darwisch: Hier möchte ich genau sein: Habe ich denn so oft „Wir“ geschrieben? Was diesen Eindruck betrifft, stimme ich Ihnen nicht zu. Ich bin mir immer der Tatsache bewußt gewesen, daß die persönliche Stimme diejenige ist, die den Rhythmus, den Text hervorbringt. Das „Wir“ wird gegenwärtig und erhält Anspruch auf das Wort, wenn das Gedicht sich vom Lyrischen zum Epischen erhebt; denn im Epischen gibt es kein „Ich“. Wenn Sie sich meine Arbeit aufmerksam betrachten, sehen Sie, daß ihre Lyrik episch ist. Sie enthält das Legendäre und das Alltägliche.
Dieser Dualismus besteht. Daß das Gedicht die lyrische Ebene zugunsten des kollektiven Umkreises verläßt, geschieht nur, wenn es das „Wir“ in sich trägt. Außerdem ist dieses „Wir“ eine Maske. Ein Dichter wird niemals akzeptieren, Teil einer kollektiven Stimme zu sein. Er hält sich im Hintergrund und läßt das „Wir“ sprechen. Aber das ist sein Werk. Es ist seine Maske. Der Dichter ist keine Stimme in einem Chor. Er gibt ihm den Rhythmus. Das „Ich“ ist ein zentrales Element der Poesie, das „Ich“ erschafft das „Ihr“, das „Sie“ und das „Wir“. Wenn die Stimme des Individuums nicht spürbar ist, heißt das, daß irgend etwas mit dem Gedicht nicht stimmt.
Yeshurun: Seit einer Reihe von Jahren betrachtet man Sie als den Nationaldichter der Palästinenser, und Sie sind Gegenstand der Verehrung Ihrer Landsleute. Bedroht dieser Zustand nicht Ihre Zukunft als Schriftsteller? Sperrt Sie das nicht in ein Gefängnis?
Darwisch: Alles hängt davon ab, was man mit dem Wort „national“ sagen will. Wenn ein Nationaldichter ein Repräsentant ist – nun, ich repräsentiere niemanden. Ich bin nicht verantwortlich für die Art, wie man meine Texte liest. Aber die kollektive Stimme ist in meiner persönlichen Stimme präsent, ob ich das nun will oder nicht. Selbst wenn ich von einer traurigen Winternacht in Paris erzähle, denkt jeder Palästinenser, daß ich von ihm spreche, ob es mir nun gefällt oder nicht. Daran kann ich nichts ändern. Aber wenn man sagen will, daß ein Nationaldichter derjenige ist, der den Geist des Volkes zum Ausdruck bringt, dann akzeptiere ich das – das ist schön. Sämtliche Schriftsteller der Welt träumen davon, daß ihre Stimme auch die der anderen ist. Zu meinem großen Bedauern wollen die Kritiker, wenn sie mich so bezeichnen, sagen, ich sei der Dichter einer Gemeinschaft; sie versuchen, den Text auf den Bereich des Politischen zu beschränken. Und in unserem Leben ist die Politik keine Angelegenheit von Parteien, sondern eher der Ausdruck des Schicksals. Ich halte mich in der Mitte, an der Grenze zwischen öffentlicher und persönlicher Stimme. Aber in Wirklichkeit setze ich mich darüber hinweg; vielleicht kann ich auf dem Hintergrund einer derartigen Popularität das verwöhnte Kind spielen und behaupten, daß ich all das nicht will. Wenn man mich vergessen würde, hätte ich all das vielleicht gern wieder. Für mich zählt, daß ich mich frei fühlen kann. Die bloße Tatsache, daß man auf ein neues Gedicht von mir wartet, beengt mich, aber ich gebe dieser Erwartungshaltung nicht nach. Jedesmal, wenn ich ein Liebesgedicht schreibe, sagt man, es sei ein Gedicht über die Erde, „Rita“ sei Palästina. „Rita“ ist ein erotisches Gedicht, aber das glaubt man mir nicht.
Yeshurun: Wer ist Rita?
Darwisch: Rita ist ein Pseudonym, das aber zu einer wirklichen Frau gehört. Es ist ein Name, der ein starkes Begehren in sich trägt. Und große Macht. Und Schwäche. Und Distanz.
Yeshurun: Und dennoch schreiben Sie in dem Gedicht „Der Winter mit Rita“:
Kaum Erde für diese beiden Körper in einem,
Kaum Exil für ein Exil
In diesen Zimmern…
Vergeblich singen wir zwischen zwei Abgründen.
Darwisch: Es ist Rita, die diesen Satz spricht, der wie eine politische Parole aussieht. Warum keine menschlichen und tragischen Worte, werden Sie mich fragen? Und wenn ich Ihnen sagen würde, daß es sich um eine jüdische Frau handelt, würde es dann immer noch nach einer politischen Parole aussehen? Und wenn es der Ausdruck eines Konflikts wäre, bei dem der nationale Unterschied die Körper daran hindert, sich zu lieben oder die Liebesgeschichte fortzusetzen? Die Rita meiner Gedichte ist eine jüdische Frau. Ist das ein Geheimnis? Eröffne ich Ihnen damit etwas Neues?
Yeshurun: Wie sind Ihre ersten Gedichte unter Ihren Lesern aufgenommen worden?
Darwisch: Sie sind gut aufgenommen worden. Der Beweis dafür ist, daß ich weitermache. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte mich das vielleicht zerstört, denn ich bin sehr verletzbar.
Yeshurun: Für welchen Leser schrieben Sie damals?
Darwisch: Meine ersten Gedichte waren Liebesgedichte. Ich dachte an die Geliebte, die mich lesen würde. Heute zögere ich nicht zu sagen, daß ich an gar keinen Leser denke. Der Leser ist wie ein Gendarm. Man muß ihn bei Laune halten. Wenn ich schreibe, denke ich an niemanden. Wenn ich die Texte für den Druck vorbereite, stelle ich mir vor, wie sie aufgenommen werden, aber es ist nicht das, was mich dazu bringt, Korrekturen vorzunehmen. Selbst jetzt schreibe ich ein Gedicht über sie, aber dabei denke ich nicht an sie.
Yeshurun: Man hat einer Periode Ihres Werkes den Namen „Die träumerische Revolution“ gegeben.
Darwisch: Das hat ein ägyptischer Schriftsteller geschrieben. Er wußte nicht, wie er mich definieren sollte: als revolutionären Dichter? Als romantischen Dichter? Seine Definition scheint mir der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen. Ich akzeptierte nicht, daß man uns „Schriftsteller des Widerstands“ nennt. Einige meiner Freunde haben begonnen, diese Worte zu verwenden, um das entsprechende Konzept zu rechtfertigen. Dies passierte bereits 1967 – „Schriftsteller der besetzten Erde“ oder „Schriftsteller des Widerstands“. Das hat mir nicht gefallen. Ich möchte kein Dichter sein, den man mit Etiketten versieht.
Yeshurun: Sie haben in Ihrem Leben einen bedeutsamen Wandel vollzogen: von der „Rakach“ zur PLO. Mit anderen Worten: von einer marxistisch-kommunistischen Konzeption der Welt zu einer nationalistischen Bewegung. Fühlen Sie sich in einer Welt, die nur nationalistisch ist, zu Hause?
Darwisch: Ich sehe in diesem Wechsel kein Problem, denn die PLO steckt einen sehr weiten ideologischen Rahmen ab. Sie umfaßt viele Strömungen. In diese Welt einzutreten, bedeutete nicht, meine Haltung zu ändern, sondern Instrumente zum Handeln zu gewinnen.
Yeshurun: 1970 sind Sie mit einer Delegation der kommunistischen Jugend ins Ausland gereist, haben sich abgesetzt und sind nach Ägypten gegangen. Nach dieser Reise sind Sie nicht nach Israel zurückgekehrt. Haben Sie diese Entscheidung manchmal bedauert?
Darwisch: Heute vielleicht ja. Aber was den Einfluß betrifft, den das auf die Entwicklung meiner Poesie gehabt hat, bedaure ich es nicht. Heute würde ich nicht die Flucht wählen. Ich würde bei meinem Volk und in meinem Land bleiben. Vielleicht ist es menschliche Schwäche, die in mir dieses Bedauern hervorruft. Auf jeden Fall bin ich sensibler, weniger dumm, weniger verträumt.
Yeshurun: Wenn ich das richtig verstehe, hat Ihre Korrespondenz mit Samih al-Kassim, der selbst Mitglied der „Rakach“ ist, viele wieder mit Ihnen versöhnt. Ihr Weggang hatte ein Gefühl des Verlassenseins hervorgerufen. Wie hätte Ihrer Ansicht nach diese Korrespondenz ausgesehen, wenn Sie sie mit Emil Habibi – diesem intelligenten Schriftsteller und hellsichtigen Kommunisten der älteren Generation – geführt hätten, statt mit Samih?
Darwisch: Ich habe weiter gute Beziehungen mit allen Leuten von der Rakach aufrechterhalten. Der größte Teil von ihnen hat die Motive verstanden, die mich dazu gedrängt haben, das Land zu verlassen. Warum habe ich mir Samih ausgesucht? Zwischen uns ist nach meinem Weggang ein großer Disput ausgebrochen, und danach haben wir uns öffentlich versöhnen wollen. Ich wollte eine gefühlsmäßige Brücke nach Palästina schlagen. Wir haben uns in Schweden getroffen und beschlossen, gemeinsam etwas zu unternehmen, um die Erinnerung wiederherzustellen. Ich wollte mich von meinem Heimweh heilen. Alles in allem schien mir, daß ich in gewisser Weise zurückgekommen wäre, daß ich genesen wäre, daß ich durch das Schreiben den Traum der Rückkehr realisiert hätte, und damit war ich ganz zufrieden. Und ich sah, daß Samih innerlich floh, Sehnsucht nach draußen hatte. So haben wir uns auf halbem Wege getroffen.
Der Wert dieser Korrespondenz liegt auf der Gefühlsebene. Wenn ich mit Emil Habibi korrespondiert hätte, wäre der persönliche Aspekt beiseite geblieben, und wir hätten über Fragen von öffentlichem Interesse miteinander polemisiert. In seiner Eigenschaft als Journalist öffnet Emil Habibi den Geist und nicht das Herz. Er hat zwei Persönlichkeiten: die literarische und die politische. Und es gibt keine Verbindung, keine diplomatischen Beziehungen zwischen diesen beiden Persönlichkeiten. Wir hätten uns mit Sicherheit gestritten, und die Atmosphäre der Briefe wäre bitter geworden. Ich bin mit dem raschen Sprung, den er vollzogen hat, nicht einverstanden. Als Intellektueller hat er die Pflicht, mißtrauisch zu sein und bis zum letzten an allem zu zweifeln. Das ist es, was Ideen ihre Kraft gibt. Er hat ganz einfach einen Glauben durch einen anderen ersetzt – seine Vergangenheit ausgelöscht. Wenn er an eine Sache glaubt, ist er sehr aggressiv und kategorisch; als ob er die ganze Wahrheit in der Tasche hätte.
Yeshurun: Sie vergessen, daß Emil Habibi der Autor des Buches Der Peptimist ist.
Darwisch: Das ist es ja, was ich sage: Es gibt bei ihm zwei Persönlichkeiten. Und ich ziehe den Schriftsteller Emil Habibi vor. Sein Beitrag zur arabischen Literatur ist enorm. Er hat ein neues literarisches Genre geschaffen. Was er geschrieben hat, ist kein Roman. Ich hoffe, daß er es mir nicht übelnimmt, wenn ich das sage. Er ist ein Virtuose der Novelle. Er schreibt hervorragend, und sein Arabisch ist wirklich verblüffend.
Yeshurun: Sind Sie als Heranwachsender auf Ihren Vater und die Männer seiner Generation wütend gewesen, weil sie sich das Land haben wegnehmen lassen?
Darwisch: Ja. Aber heute verstehe ich sie; sie konnten nichts tun. Und von meiner Wut habe ich mich durch andere Gedichte geheilt.
Yeshurun: Haben Sie in der Jugend, die die Intifada in Gang gebracht hat, eine Art Entschädigung für Ihre eigene Jugend gefunden?
Darwisch: Mein Gefühl dazu war vollkommen anders. Ich habe gespürt, daß die Intifada die einzige einfache Antwort war, die einzige wirkliche Antwort, die die Frage an ihren angemessenen Ort zurückbrachte, die das Thema in seinen Kontext zurückversetzte. Sie hat das palästinensische Volk von der Trägheit befreit, die es sich allein schon durch die Existenz der PLO glaubte gestatten zu können. Selbst die Palästinenser in Gaza glaubten, sie hätten in Beirut eine politische Hauptstadt, von der sie Hilfe und Unterstützung erhalten würden. Sie arbeiteten in Israel und profitierten von dessen ökonomischem Wachstum. Sie hatten ein ruhiges Gewissen; sie sagten sich, daß die Leute in Beirut sich der palästinensischen Sache annehmen würden. Ariel Sharon, der Gaza in den vorherigen Jahren zerstört hatte, hat es dann, ebenso wie das Westjordanland, gerettet, indem er die PLO 1982 ins Meer warf. Da haben die Menschen gespürt, daß sie nur noch auf sich selbst zählen konnten, und letzten Endes sind sie es dann gewesen, die die PLO gerettet haben. Ich habe in der Intifada einen überfälligen Ausgleich für die Trägheit gesehen, sich auf die Führung zu verlassen; einen Ausgleich nach einer langen Periode des Schlafs. Das Volk hat die Dinge in die Hand genommen. Die palästinensische Frau hat den Funken bewahrt; sie hat die Geschichte an ihren Anfang zurückgeführt, das Symbol und das Wesen der Dinge als ewige Wächterin des Feuers ins Gedächtnis zurückgerufen. Am Anfang war es wie ein Spiel von Kindern mit einer einfachen und symbolischen Waffe, und wenn die Leute das im Fernsehen sahen – es war das erste Mal, daß das Fernsehen etwas Positives für die Palästinenser bewirkt hat –, fühlten sie sich zum Weitermachen ermutigt, und die Intifada wurde zu einer Lebensweise. Zum Schluß hat die Intifada dem palästinensischen Volk geschadet. Sie wurde zu einem Beruf.
Yeshurun: Ihre Poesie ist von Symbolen durchdrungen. Gehorcht die Verwendung von Symbolen der Notwendigkeit politischer Tarnung, oder tat sie das zumindest zu Beginn?
Darwisch: Nein. Abgesehen vielleicht von einer bestimmten Zeit in den sechziger Jahren, als es die Zensur gab und ich sie hinters Licht führen wollte.
Yeshurun: Hat das Symbol in der arabischen Kultur einen privilegierten Status? Setzen Sie eine Tradition fort, oder machen Sie einen neuen Gebrauch davon?
Darwisch: Das Symbol ist ein modernes Konzept, das vom europäischen Symbolismus herkommt. Aber es gibt eine Tradition der Allegorie in der arabischen Kultur. Das führt mich zum Mythos. Ich greife auf die griechische, assyrische, kanaanitische und sumerische Mythologie zurück. Ich verwende sie, aber sie bildet nicht meine Grundlage. DasGedicht muß seine eigene Mythologie schaffen. Der Bereich des Gedichts muß auf mythologische Weise aufgebaut sein, und zwar nicht nur durch das Anführen von Namen. Bis jetzt bin ich noch nicht so weit, aber ich möchte eine moderne Parallele zur Mythologie schaffen, ungeachtet der veränderten Wahrnehmung unserer Zeit und ungeachtet des Gefühls, daß die Welt von heute dem Begriff des Helden fremd gegenübersteht. Wie? Indem ich die Welt neu erschaffe. Jedes Gedicht trägt das Vorhaben in sich, eine neue Genesis, einen neuen Beginn zu schaffen: „Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer.“ Das Gedicht muß jedesmal sein eigenes „Am Anfang“ schaffen.
Yeshurun: Und sein eigenes ursprüngliches Chaos?
Darwisch: Jedes Gedicht ist ein solches Chaos; das Gedicht ist aus einem Tohuwabohu gemacht. Man weiß nicht, wo man das Salz, das Gras, den Himmel hintun soll. Man hat ein Chaos in seiner Vorstellung. Wie soll man eine Ordnung hineinbringen? Notwendig ist das Schreiben einer Genesis. Das Leiden ist da, die Liebe ist da, die Worte sind da.
Yeshurun: Wie und von welchem Ausgangspunkt her machen Sie Gebrauch von der Mythologie?
Darwisch: Man muß der Mythologie eine andere Richtung geben. So habe ich mich beispielsweise der Helena von Troja bedient. Ich habe sie von Troja in eine kleine Pariser Straße gebracht und dort Brot verkaufen lassen. Ich hege den Traum und vielleicht die Illusion, daß es in der Poesie keine Grenzen gibt, daß die gesamte Poesie der Menschen nur ein einziges von verschiedenen Dichtern Stück für Stück geschriebenes Gedicht ist. „Der trojanische Krieg hat nicht stattgefunden“, hat Giraudoux geschrieben. Und so kommt es, daß Helena Brot verkauft. Die Namen sind Träger von Assoziationen. Ich brauche sie, um dem Gedicht eine zusätzliche Ebene hinzuzufügen, um eine Akkumulation zu schaffen. Das Gedicht muß sich selbst fremd werden. Es muß seine eigene Reise machen. Manchmal hängt alles von einem einzigen Wort ab. Manchmal ist das der Name einer Blume, manchmal der Name eines Ortes. Jedes Gedicht hat einen Schlüssel, ein Geheimnis. Man schreibt, man bewegt sich in eine bestimmte Richtung und denkt dann, daß das zu poetisch ist. Dann wirft man ein Wort hin, und alles wird plötzlich zu Fleisch und Blut. Elytis hat einmal vom Gedicht als einem Gleichgewicht zwischen dem Blau, dem Sand und dem Salz gesprochen. Wenn das Gleichgewicht zerrissen wird, kann sich das Gedicht nicht halten.
Yeshurun: In Ihrem letzten Buch Warum hast du das Pferd seiner Einsamkeit überlassen? schreiben Sie: „Wer seine Geschichte schreibt, erbt das Land der Worte.“ Und in dem Gespräch, von dem wir geredet haben, sagen Sie: „Wir sind der Vergangenheit, unserer Vergangenheit beraubt.“ Wer hat Ihnen die Vergangenheit gestohlen?
Darwisch: Es ist wahr: Die Mächtigen schreiben die Geschichte. Derjenige, der das erste Wort schreibt, erwirbt den Ort des Geschriebenen oder die Vision des Geschriebenen; er schreibt sich in das Bewußtsein des Lesers ein. Er hat die Macht, nicht nur die Zukunft der Menschen zu ändern, sondern auch ihre Vergangenheit umzugestalten. Der palästinensische Mythos muß innerhalb des palästinensischen Bewußtseins aufgebaut werden – in einem geschriebenen Palästina. Der Andere hat Palästina als seinen „Beginn“ beschrieben, einen Anfang, der nicht in Zweifel gezogen wird. Wie kann ich über dieses Schreiben schreiben? Unsere Geschichte ist stehengeblieben. Unsere Vergangenheit ist in gewisser Weise zum Eigentum des Anderen geworden, und wir müssen aufs Neue eine Verbindung zum Ort herstellen. Die einzige Art, die ich hierfür sehe, besteht in einem Hin- und Herwechseln zwischen dem Mythischen und dem Alltäglichen.
Yeshurun: Und es ist das Schreiben, das die Macht über die Welt bestimmt?
Darwisch: Ja. Warum glauben Sie und mit Ihnen überhaupt jedermann, daß das Land Israel Ihr Heimatland ist? Weil in der Bibel die menschliche Geschichte geschrieben steht. Das dort Geschriebene hält Ihre Geschichte aufrecht. Wer hat für Ihr Recht gesorgt, zu behaupten, dieses Land sei Ihr Heimatland? Die Bibel. Was die Kanaaniter geschrieben haben, ist verschwunden.
Yeshurun: Sie verwenden in Ihren Gedichten viele christliche Symbole. Jesus am Kreuz erscheint in ihnen als eine Inkarnation Palästinas. In Ihrem Gedicht „Naives Lied über das Rote Kreuz“ will der Autor seinem Vater nicht verzeihen, daß er ihn in der Obhut des „Roten Kreuzes“ zurückgelassen hat. Und in dem Gedicht „Meine Geliebte erwacht“ bringt das Kreuz dem Dichter die Sprache der Nägel bei. Wie kommt es, daß das Christentum eine solche Anziehungskraft auf Sie ausübt?
Darwisch: Bestimmte Symbole kommen in meiner Arbeit immer wieder vor, aber sie sind nicht ein für allemal festgelegt. Sie sind anpassungsfähig. Ihre Bedeutung ändert sich je nach den Erfordernissen des Gedichts. Als guter Palästinenser habe ich alle Religionen in mir. Ich bin Erbe von Erde, Landschaften, Kultur und Geschichte. Ich schätze mich sehr glücklich, aus diesem Land zu stammen, über das so viele Erzählungen geschrieben worden sind.
Ich lebe in einem Paradies von Symbolen. Deshalb spreche ich, ohne zu zögern, auf christliche Weise, und ich zögere auch nicht, die jüdische Mythologie und das jüdische Erbe zu verwenden. Aber der Messias hat noch eine weitere Dimension: das Leiden. Und er lebt in Palästina. Das ist der Grund, weshalb er für mich ein Vorbild ist: Er lehrt mich, auszuharren und zu vergeben. Er ermutigt mich, Bücher der Liebe und der Toleranz zu veröffentlichen. Und was in bezug auf die Poesie das wichtigste ist: Er stirbt und erwacht wieder zum Leben. Jedes Jahr stirbt er und ersteht wieder auf. Unser ganzes Leben ist eine Reise zwischen dem Tod und dem Leben. Man stirbt in jedem Gedicht und ersteht wieder auf. Der Messias ist für mich ein natürliches Symbol: Er ist palästinensisch in Zeit und Raum und universell in seiner Spiritualität.
Yeshurun: Und jüdischen Ursprungs.
Darwisch: Das stört mich nicht. Die Religionskriege sind politische Kriege. Wenn wir uns über die Farbe des Himmels streiten würden, wäre das ein poetischer Kampf. Die Christen beurteilen mich nicht nach meiner Zuneigung für den Messias, denn der Kampf zwischen Kirche und Staat ist zu Ende. Wenn ich muslimische Symbole verwende, bin ich behutsamer, bin ich sehr vorsichtig. Der offizielle Islam ist sehr dogmatisch. Im Islam kann man keine freien Beziehungen zu den Propheten unterhalten. Alles, was geschrieben ist, gilt kategorisch: Man unterscheidet nicht zwischen Religion und Kultur, und man toleriert keine kulturelle Konzeption von der Religion. Die Christen sind etwas toleranter. Deswegen bin ich in meinen Beziehungen zum Christentum freier.
Yeshurun: Aber dennoch, was gibt es im Christentum, das Ihnen so nahe ist?
Darwisch: Das Leiden. Ich ziehe das Wort Leiden vor. Christus ist poetischer, weil er gewesen und nicht gewesen ist. Er ist aus dem Geist geboren. Er hat eine Mutter und keinen Vater. Er ist der Mythologie näher als die anderen Propheten. Außerdem ist er menschlicher als sie. Er liebte den Wein. Ich liebe den Wein. In meiner Kindheit sahen wir keinen Unterschied zwischen einem Christen und einem Muslimen. Der beste Freund meines Großvaters war der Dorfpfarrer. Ich liebe die Frühlingszeremonie, bei der man zur Kirche geht wie zu einem Liebesrendezvous.
Yeshurun: Und den Status des Opfers?
Darwisch: Ja. Christus ist das Opfer, und dann siegt er. Dem Islam zufolge ist nicht er ermordet worden, sondern ein dritter. Mein Volk ist Opfer. Der Messias – einer der Söhne dieses Landes – ist wiederauferstanden. All diese Schatten bevölkern das Gedicht.
Yeshurun: In Ihrem Buch Eine Erinnerung für das Vergessen schreiben Sie: „Ich habe mich über die Kundgebungen in Tel Aviv nicht gefreut. Sie haben uns überhaupt keine Rolle übriggelassen – jetzt sind sie sowohl die Henker als auch die Opfer. Die Sieger haben Angst, ihre Identität als Opfer zu verlieren. An unserer Stelle schreien sie, an unserer Stelle weinen sie.“ Woher kam Ihre Wut auf diese Israelis, die während des Libanonkriegs demonstrierten? Ist das Klischee vom Henker, der sich als Opfer ausgibt, für Sie unverzichtbar?
Darwisch: Ich sprach von der arabischen Welt während der Belagerung Beiruts. Zur gleichen Zeit fand die Fußballweltmeisterschaft von 1982 statt. Auf den Straßen der arabischen Welt befaßte man sich mit Fußball. Tausende von Menschen gingen auf die Straße, um einen Schiedsrichter auszupfeifen. Wer war der Aggressor? Die Israelis. Wer demonstrierte? Die Israelis. Die ganze Sache blieb eine israelische Angelegenheit. Raful Eitan und Ariel Sharon waren die Aggressoren. Und wer protestierte gegen sie? Israel. Die Israelis haben angegriffen – sie sind die Helden; die Israelis haben demonstriert – sie sind die Guten. Es gibt unter ihnen Verrückte, Geistesgestörte, Kriegstreiber, aber die israelische Gesellschaft ist gesund. Und ich, wo war ich in alldem? Ich war überhaupt nicht Bestandteil des Bildes. In dem Text, den Sie zitiert haben, ging es mir darum, die Situation in der arabischen Welt zu denunzieren, und alles andere löste mein Problem nicht. Ein derart schönes Bild von Israel zu zeichnen, war für mich ohne Interesse. Das sage ich ganz offen. Zur selben Zeit habe ich einen Text geschrieben, den Sie nicht kennen, nämlich gegen den Fußballschiedsrichter. Die Araber haben sich mit den Bildern der israelischen Peace-Now-Demonstration zufriedengegeben, als ob die Israelis in ihrem Namen sprächen. In der arabischen Welt ist alles tot. Das Buch Eine Erinnerung für das Vergessen ist keine Analyse der politischen Situation. Es ist ein Buch, das ein Panorama von der Rolle des Opfers und der Rolle des Opfernden zeichnet. Ich befürchtete, daß diese Demonstrationen, obwohl sie für sich genommen gut und positiv waren, die Kameras auf die Israelis lenken und uns dabei im Schatten lassen würden. Ich wollte niemanden beleidigen, aber mir war wichtig, das Paradoxe daran aufzuzeigen. Es beschäftigte mich. Wenn das verletzend wirkte, bedaure ich es. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte sagen, daß das Opfer keinen Ort hatte, um zu demonstrieren, denn andere demonstrierten an seiner Stelle. Alles Gute kam von Israel und löschte dabei das Böse aus, das ebenfalls von dort kam. Ich wollte kein positives Bild von Israel geben. Ich war derart gedemütigt, daß ich kein Licht kommen sehen wollte, das von diesem Ort kam.
Yeshurun: Diese Israelis brachten Ihr Stereotyp vom Israeli durcheinander.
Darwisch: Ich habe kein Stereotyp vom Israeli. Ich war es leid, die Israelis von ihren Gewissensproblemen zu befreien. Ich wollte sagen, daß ich gar nicht existierte – weder als Opfer noch als Revoltierender noch als Stimme. Die arabische Welt spielte Fußball, und das moralische Heil kam von Israel.
Yeshurun: In dem Gedicht „Ein Soldat, der von weißen Lilien träumt“, das Sie 1967 geschrieben haben, wird der Soldat gefragt, ob er bereit sei, für die Heimaterde zu sterben, und er antwortet: „Bestimmt nicht! Man hat mich gelehrt, die Liebe zu ihr zu schätzen, aber ich habe nie gespürt, daß ihr Herz zusammen mit dem meinen schlägt. Mein Weg zur Liebe ist ein Gewehr.“ Dieser Soldat möchte in Frieden für sein Kind leben, und für ihn bedeutet die Heimaterde nichts weiter, als „daß er den Kaffee seiner Mutter trinkt“ – im Gegensatz zum Araber, der „ihr Gras, ihre Wurzeln, ihre Äste geatmete hat. Spielen Sie hier nicht die Beziehung der Israelis zu dieser Erde herunter?
Darwisch: Ich ahne, was sich hinter dieser Frage verbirgt. Ich werde der Antwort darauf nicht ausweichen, aber ich möchte Sie daran erinnern, daß ich wegen dieses Gedichts von arabischen Künstlern heftig angegriffen wurde, weil es gegen den stereotypen Blick auf die Israelis gerichtet ist. Es handelt sich um einen Soldaten, den ich kannte. Eines Abends hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er haßte den Staat und das Verteidigungsministerium – etwas, was zu der Zeit, am Vorabend des Krieges von 1967, nicht gerade üblich war. Das Gedicht war eine Antwort auf das Stereotyp. In diesem Soldaten, der mir wie ein Panzer hätte erscheinen müssen, habe ich ein Wesen von Fleisch und Blut erblickt. Das war ein großer Verrat. Diese Geschichte ist wahr. Der Soldat hat das Land nach dem Krieg verlassen.
Es gibt in der israelischen Gesellschaft ein Gefühl der Wurzellosigkeit. Israel ist eine neue Gesellschaft. Nicht alle Israelis sind in Israel geboren. 1967 war der Staat zwanzig Jahre alt. Es ist unmöglich, innerhalb von ein oder zwei Generationen eine Gesellschaft mit Wurzeln und kulturellen Bezugspunkten zu schaffen. Das ist der Grund, weshalb in der israelischen Erziehung die Liebe zum Land gelehrt wird. In Rußland gab es keine jüdischen Bauern. Das ist ein neuer patriotischer Beruf, der in Israel geschaffen wurde. Deshalb sind ja die Kibbuzim gegründet worden. Ich kritisiere das nicht. Es gab kein wahrhaft körperliches Band zwischen der jüdischen Seele und der Erde Israels. Die zionistische Bewegung hat sich bemüht, den Juden davon zu überzeugen, sich an die Erde zu klammern, und sie tut es immer noch. Worauf wollen Sie also hinaus? Was ich sage, ist, daß dieses Gedicht das erste arabische Gedicht war, das der israelischen Stimme eine Plattform gegeben hat.
Yeshurun: Und was sagt diese Stimme? Daß für diesen Soldaten das Heimatland bedeutet, den Kaffee seiner Mutter zu trinken?
Darwisch: Diese Stimme sagt, daß er sehr menschlich ist. Daß er ein Mensch ist und kein Gewehr. Daß seine Beziehung zum Boden seiner Herkunft eine Suche nach Sicherheit ist sowie danach, in Ruhe seinen Morgenkaffee zu trinken. Das ist mein palästinensischer Traum von heute.
Yeshurun: Das ist mir allerdings neu.
Darwisch: Es ist aber dennoch so. An welcher Stelle finden Sie, daß ich die Beziehung des Juden zum Land herunterspiele? Das ist nicht das zentrale Thema des Gedichts. Was sich im Mittelpunkt des Gedichts befindet, ist die Tatsache, daß der Soldat ein menschliches Wesen ist. Sie können sich nicht an meine Stelle versetzen und sehen, welcher Art das Bild dieses Soldaten im Bewußtsein meiner Leser war. Und ich versuche nicht, die Dinge schön zu zeichnen, aber ich war von diesem jungen Mann sehr bewegt, der die Schrecken des Krieges erlebt hatte und der hoffte, das Gurren der Tauben auf dem Dach des Verteidigungsministeriums zu hören. Ich möchte jedoch Ihnen gegenüber nicht lügen und behaupten, es hätte mich gestört, wenn jemand etwas Schlechtes über den Staat Israel sagte. Es hat mir Freude gemacht. Ich liebte den Staat Israel nicht. Ich liebe ihn immer noch nicht. Und ich glaube, Sie täten gut daran mir zuzuhören: Sie können von einem Palästinenser nicht verlangen, daß er den Staat Israel liebt.
Yeshurun: Ich habe von der Beziehung zum Land gesprochen. Nicht von der Beziehung zum Staat.
Darwisch: Für den Palästinenser ist dieses Land nicht Eretz Israel. Es ist Palästina. Ein Fremdkörper ist ein Fremdkörper. Heute ist es selten geworden, daß man einen Palästinenser findet, der wirklich sagt, was er denkt. Wir befinden uns in einem Friedensprozeß, jede Seite muß ihre Version der Geschichte verändern, aber seien Sie nicht erzürnt, wenn jeder Palästinenser davon überzeugt ist, daß Palästina ihm gehört. Im Augenblick findet er sich gerade damit ab, daß er einen Teilhaber hat. Das ist ein ungeheurer Fortschritt. Sie sollten das nicht für gering achten und nicht bei dem Gedanken erschrecken, daß der Palästinenser der Ansicht ist, Palästina gehöre ihm. Welches ist sein Land? Er ist in Palästina geboren. Er kennt kein anderes Land. Ihr seid in seinen Augen Fremde. Vor wieviel Jahren seid Ihr hierhergekommen? Ihr seid vor langer Zeit einmal hier gewesen, während er die Jahre seiner Anwesenheit in diesem Land schon gar nicht mehr zählen kann. Und er ist nicht einmal sicher, ob Ihr es wart oder jemand anderes, der hier gewesen ist. Seid Ihr alle Enkel des Königs Salomon? Wirklicher Friede bedeutet einen Dialog zwischen zwei Versionen. Ihr behauptet, dieses Land habe schon immer Euch gehört, als ob die Geschichte während der Zeit, als Ihr nicht da wart, nicht weitergegangen wäre, als ob es hier niemanden gegeben hätte und als ob diese Erde nur eine einzige Funktion gehabt hätte: auf Euch zu warten. Zwingt mir nicht Eure Version auf, und ich werde Euch nicht die meinige aufzwingen. Jedem muß das Recht zugestanden werden, seine eigene Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte wird uns alle beide auslachen; die Geschichte hat keine Zeit für die Juden oder die Araber. Viele Völker sind durch dieses Gebiet gekommen. Die Geschichte ist zynisch, und das ist nur gut so.
Yeshurun: Der Soldat sagt in dem Gedicht: „Mein Weg zur Liebe ist ein Gewehr.“
Darwisch: Das ist nun einmal das Handwerk der Soldaten. Ohne Gewehr gäbe es den Staat Israel nicht. Wenn man offen spricht, muß man auch das sagen. Aber aus dem Mund eines Arabers klingt das böse.
Yeshurun: Und was ist Ihre Art des Zugangs zur Liebe? Auch in Ihrer Liebe gibt es viel Gewalt:„Und diese Erde ist eine Guillotine, deren Fallbeil ich liebe.“ Hat der Haß nicht auch Ihnen Schaden zugefügt?
Darwisch: Nein. Mein Weg zur Liebe ist die Poesie. Wenn ich den Schatten des Hasses in einem Gedicht erkenne, ändere ich es. Man darf niemals von einem Gefühl des Hasses ausgehend schreiben. Das verträgt sich nicht mit der Literatur. Der Satz, den Sie zitieren, ist der Höhepunkt der Liebe: Selbst wenn diese Erde eine Guillotine ist, liebe ich sie.
Yeshurun: In Ihrem Buch Eine Erinnerung für das Vergessen schreiben Sie: „Wir haben keine andere Wahl, als die gegenwärtige Bedingung unserer Existenz zu bewahren: das Gewehr. Uns seiner zu berauben, liefe darauf hinaus, uns die Garantie unserer Existenz zu entreißen.“ Waren Sie bereit, diesen Satz zu akzeptieren, als er in der Vergangenheit von vielen Israelis ausgesprochen wurde?
Darwisch: Zu einer bestimmten Zeit ja. Ich konnte das verstehen. Denn die Geschichte ist in ihrer Entwicklung weder geschmackvoll noch gerecht. Das Kräfteverhältnis zwischen Gerechtigkeit und Gewalt neigt sich immer zugunsten der Gewalt. So ist die Geschichte. Wenn wir selbst Zeuge eines historischen Wendepunkts sind, leiden wir darunter; wenn wir Erben einer historischen Situation sind, rechtfertigen wir sie. Hier liegt der ganze Unterschied. Die arabische Anwesenheit in Spanien war nach den Kriterien der Gerechtigkeit nicht legal, aber der Geschichte hat es so gefallen. Heute bin ich Zeuge eines Dialogs zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. In meiner Rolle als lebender Zeuge, der kaum aus dem zuvor herrschenden Bild herausgetreten ist, kann ich die Ungerechtigkeit, die vor meinen Augen begangen wird, nicht akzeptieren. Wenn ich dagegen lediglich eine historische Lektüre betreiben würde, würde ich sie akzeptieren. Unser aller Tragödie besteht darin, daß wir direkte Zeugen eines historischen Wendepunkts, einer Neuordnung sind, die sich in der Geschichte und der Geographie festsetzt. Das ist der Grund, weshalb jetzt jede Seite ihre Argumente vorbringt. Wir stehen vor einem neuen Kapitel, das den Namen Friedensprozeß trägt. Zu meinem großen Bedauern geht es hierbei mehr um den Prozeß als um den Inhalt. Friedensprozeß, das ist ein pragmatischer amerikanischer Ausdruck, der manchmal unwürdig und vulgär ist. Dieser Prozeß wird zu einer gemeinsamen und getrennten Lektüre der gemeinsamen und umstrittenen Geschichte dieses Teils der Erde führen. Und wir haben nur dieses eine Stück Erde. Unglücklicherweise. Oder glücklicherweise. Ich weiß nicht, wie ich über diese Periode Gedichte schreiben soll. Der ganze Konflikt ist aus diesem Ort geboren. Sie lieben diesen Ort, und Sie bringen Ihre Liebe zu denselben Pflanzen, denselben Gräsern zum Ausdruck, ganz als ob Sie ich selbst wären. Als ob Sie in meinem Namen sprächen. Das ist die Macht der Literatur. Die arabische und die hebräische Poesie treffen sich im Schreiben über die Landschaft. Einige israelische Dichter bringen ganz meine Beziehung zur Landschaft zum Ausdruck, in Gedichten, deren Verfasser ich selbst sein könnte. Ich nenne an dieser Stelle keine Namen. Die Kriege unter Schriftstellern sind noch härter als die Kriege unter Tänzerinnen. Ich nehme nicht an einem Wettbewerb teil, wenn ich über denselben Ort und über dieselbe Pflanze schreibe. Aber es ist unser Schicksal, in derselben Metapher zu leben und uns in ihr einzurichten, und das ist wirklich etwas Neues.
Yeshurun: Verlassen Sie einmal die Metapher.
Darwisch: Einverstanden. In der Realität verhält es sich ganz ähnlich. Wir finden dort dieselbe Sehnsucht. Wenn von der Rückkehr ins Land die Rede ist, weiß man nicht mehr, wer Jude und wer Araber ist. Ihr habt Euch erhoben, Ihr habt kraft der Macht des Gewehrs gesiegt, und wenn ich Ihnen sagte, kraft der Macht der Moral, würden Sie mir nicht glauben. Kraft der Macht des Gewehrs. Ihr habt Euch durchgesetzt. Auch die Palästinenser haben mit der Macht der Steine ihre Anwesenheit durchgesetzt, mehr allerdings nicht. Wenn wir einander in diesem Geist verstehen, besteht ein Terrain für eine wirkliche Diskussion. Die Zeit dafür ist reif. Aber Sie sollten keine Vorbedingungen stellen. Sagen Sie nicht: Ich werde nicht mit Ihnen sprechen, wenn Sie der Ansicht sind, daß Palästina Ihnen gehört. Palästina gehört mir. Und das werde ich immer sagen. Welches Recht hattet Ihr, zweitausend Jahre lang zu glauben, die Erde Israels gehöre Euch? Wie viele Zivilisationen, wie viele Reiche hat es seitdem dort gegeben! Ihr habt nicht aufgehört zu träumen. Sehr gut. Träumt. Aber Euer Traum war nach Zeit und Raum ferner als der Abstand, der mich von meinem Traum und meinem Ort trennt. Mein Traum ist frisch und noch jung.
Yeshurun: Sie wissen doch, daß die Zeit im Traum keine Gültigkeit besitzt.
Darwisch: Ich weiß, welche Kraft der Traum besitzt. Aber es ist auch möglich, auf eine andere Art von der Zukunft zu träumen. Davon zu träumen, aus jener Erde ein Paradies zu machen. Dieses Land ist Land des Friedens genannt worden, und es hat niemals Frieden gekannt. Aber verlangen Sie nicht von uns, unsere Anwesenheit zu rechtfertigen. Wir sind keine Eroberer gewesen. Es gibt gegenwärtig eine Tendenz, von den Palästinensern zu verlangen, sich mit dem Gedanken abzufinden, ihre Version ihrer Beziehung zu Palästina sei falsch gewesen.
Yeshurun: Wie kommen Sie darauf?
Darwisch: Das ergibt sich aus der Konzeption, die die zionistische Bewegung als eine nationale Befreiungsbewegung sieht. Was aber nicht der Fall gewesen ist. Sie war eine komplexe, nichtreligiöse Kolonisationsbewegung, die an westliche Wirtschaftsinteressen gebunden war. Sie glauben zudem, die arabische Befreiungsbewegung sei eine neofaschistische Bewegung gewesen. Man muß zwischen diesen beiden Versionen einen Dialog herstellen. Der jetzige Frieden bedeutet nicht, daß ich mein Geschichtsverständnis des Zionismus oder meine Position zum Zionismus ändere. Ich muß meine Konzeption von der Zukunft verändern, aber der Kampf um die Vergangenheit besteht weiter; nur die Sprache hat sich gemildert. Selbst wenn ich glaube, daß Ihr Großvater ein Eroberer war, hindert mich das nicht daran, Ihr Recht auf Existenz anzuerkennen. Jeder von uns hat einen Großvater, der Eroberer war. Zeigen Sie mir in der gesamten Geschichte einen einzigen unschuldigen Großvater. Warum sollten wir denn plötzlich anerkennen, der Zionismus sei eine Bewegung der nationalen Befreiung gewesen? Der Befreiung wessen? Und auf wessen Kosten?
Yeshurun: Eine nicht gerade geringe Zahl von Israelis spricht von einem tragischen Gegensatz zwischen Recht und Recht.
Darwisch: Ich akzeptiere den Gedanken nicht, daß beide Seiten recht gehabt haben. Die Gerechtigkeit kämpft nicht gegen die Gerechtigkeit. Es gibt nur eine Gerechtigkeit. Ich ziehe es vor, zu sagen: ein Erleben gegen ein anderes Erleben. Eine Version, die mit einer anderen Version konfrontiert ist. Argument gegen Argument, Abwesenheit gegen Anwesenheit oder umgekehrt. Aber nicht ein Recht, das gegen das andere steht. Das ist der größte Schwindel, von dem ich je gehört habe, genau wie dieser andere Schwindel: „Palästina ist ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.“ Beides sind Lügen. Warum wärmen wir diesen alten Streit wieder auf? Um das israelische Bewußtsein von der Illusion zu befreien, die Palästinenser hätten ihre kollektive Erinnerung verloren. Der Palästinenser hat kein anderes Land. Die Israelis hatten viele Länder. Wie viele Völker haben sich in Euch vermischt? Wie viele Ursprünge habt Ihr? Mindestens fünfzig. Aber die historische Entwicklung hat zwei Gebilde in einem einzigen Land geschaffen, und es ist gut, daß wir jetzt beim Dialog miteinander angelangt sind. Lassen Sie den Historiker erzählen. Wenn Sie das nicht tun, ersticken Sie die Freiheit des Wortes. Das ist der kulturelle Aspekt der Sache. Und es wird uns von einigen Krankheiten, einigen Illusionen und einigen Lügen kurieren.
Yeshurun: Ich habe von Israelis gehört, die die Palästinenser als ihre Brüder in diesem Land betrachten. Sind Sie im Hinblick auf die Juden dieses Gefühls fähig?
Darwisch: Noch nicht. Denn ich bin seit sechsundzwanzig Jahren von meinem Land abgeschnitten. Der Sieger ist immer der Barmherzigere. Er kann sich den Luxus erlauben, gemäßigter zu sein. Wenn ich es gewesen wäre, der gesiegt hätte, hätte ich auch so sprechen können. Aber für den Augenblick sollten Sie mir nicht glauben, wenn ich so etwas behaupten würde. Die Liebe hat ihre Bedingungen. Der Liebende sollte angenommen, nicht aber ausgehungert werden. Es stimmt, daß es keine vollkommene Gleichheit in der Liebe gibt, aber der Liebende muß sich zumindest begehrt fühlen. Bis jetzt haben die Palästinenser sich nicht akzeptiert gefühlt. Was Sie sagen, klingt für mich ganz wunderbar. Der Palästinenser soll Ihnen sagen, daß Sie seine Schwester sind, und man muß daran arbeiten, dieses Verständnis herzustellen, aber Sie müssen ihm das Recht lassen, sich zu beklagen.
Yeshurun: Die Geschichte der Beziehungen zwischen den Intellektuellen und der Macht ist immer die einer gesunden Feindschaft gewesen. Meinen Sie nicht, daß es historische Augenblicke gibt, wo der Mut sich eher in Unterstützung und Ermutigung zeigt, wie zum Beispiel, als unsere Intellektuellen Yitzhak Rabin und Shimon Peres unterstützt haben?
Darwisch: Unsere Rolle ist es, den Friedensprozeß zu kritisieren. Ich habe mich nicht gegen die Oslo-Abkommen ausgesprochen; ich habe meine Vorbehalte zum Ausdruck gebracht. Ich bin nicht gegen den Frieden. Ich war dafür, daß das Land zwischen den beiden Völkern aufgeteilt wird, nicht dafür, daß hier mal ein Stückchen, da mal ein Stückchen gegeben wird – und die Menschen in Ghettos eingeschlossen werden. Nur die Kultur garantiert einen wirklichen Frieden. Ich habe unsere Führung in Zeiten unterstützt, wo sie schwach war. Jetzt, wo sie stark ist, habe ich auch das Recht, ihr keinen Beifall zu spenden. Sollte ein palästinensischer Staat das Licht der Welt erblicken, werde ich in der Opposition sein. Das ist mein natürlicher Platz.
Yeshurun: Während einer Begegnung, die Sie mit dem französischen Philosophen Gilles Deleuze hatten, hat dieser Sie gefragt: „Warum haben die Israelis das Hebräische gewählt, statt sich eine andere, lebendige Sprache auszusuchen?“ Sie haben ihm geantwortet: „Diese Wahl ist Teil der großen Legendenbildung, denn die Legende des ,Rechts auf Rückkehr‘ ins Land der ,Thora‘ bedurfte ihrer eigenen sprachlichen Mittel: der Sprache der ,Thora‘.“ Ich muß gestehen, daß die Formulierung der Frage noch empörender ist als die Antwort.
Darwisch: Ich weiß, warum die Israelis die hebräische Sprache gewählt haben. Seit fünf Stunden unterhalten wir beide jetzt die besten Beziehungen miteinander, und ich habe den Eindruck, daß unserem Gespräch die Würze fehlen wird, wenn wir uns nicht auch streiten. Die Wahl des Hebräischen ist eine Wahl, die dazu bestimmt war, die israelische nationale Identität zu konkretisieren. Es ist unmöglich, ohne eine gemeinsame Sprache eine wirkliche, aussagekräftige Identität zu schaffen. Das Hebräische existierte nur noch in den Synagogen, den Texten und vielleicht in den Herzen. Das war schön. Aber es war keine Sprache, die die Menschen in der Kommunikation verwendeten – es gibt ja auch heute noch einige Verrückte, die noch lateinisch schreiben… Es mag sein, daß irgendwer auch noch assyrisch schreibt. Das Hebräische war beinahe eine Art Geheimschrift und hatte keinen Bezug zur Gesellschaft. Es gab Schriftsteller, aber keine Leser.
Yeshurun: Das Hebräische hat nie aufgehört zu existieren, und die Frage einer Wahl stellte sich überhaupt nicht. Das Hebräische war auch eine Sprache der Nostalgie.
Darwisch: Ich bin kein Spezialist, was diese Frage betrifft.
Yeshurun: Sind Sie ein Spezialist in Nostalgie?
Darwisch: Die Sprache der Nostalgie war das Jiddische, oder? Aber der Staat Israel hat das Hebräische gewählt und sich gegen das Jiddische entschieden. Die Frage von Deleuze betraf das jüdische Genie. Er meinte, die Juden seien Genies gewesen, die einen enormen Beitrag zur menschlichen Kultur geleistet haben. Wie hat ein Teil von ihnen es akzeptieren können, sich von der Weltkultur zu trennen, um sich in das Ghetto des Hebräischen einzuschließen? Das ist eine philosophische Frage, die man nicht einfach abtun darf. Als Philosoph, als Anhänger von Nietzsche hat Deleuze das Recht, sich zu fragen, wie man, ausgehend von einer ideologischen Motivation, durch die Wahl einer Sprache eine Kultur geschaffen hat, und auf welche Weise dies gelungen ist. Es handelt sich hier um eine wirkliche Frage.
Was den Ausdruck „die Legende vom Recht auf Rückkehr“ betrifft, der Sie so in Rage gebracht hat, möchte ich Ihnen sagen, daß es gut ist, daß wir die Epoche der Legenden hinter uns gelassen haben. Was eine Legende war, ist zu einer Wahrheit geworden. Ich selbst befasse mich mit meinem eigenen Recht auf Rückkehr. Die Verteidigung des Rechts der Israelis auf Rückkehr ist nicht meine Sache.
Yeshurun: Ihr Gedicht „Andere Barbaren werden kommen“ endet folgendermaßen: „Wird nach uns ein neuer Homer geboren werden, werden die Legenden für alle ihre Pforten öffnen?“ Wie sehen Sie den homerischen Dichter in unserer Zeit? Gibt es in der heutigen Zeit einen Platz für eine epische Poesie?
Darwisch: Es gibt keinen Platz für den Dichter nach der Art Homers, aber es gibt sehr wohl einen Platz für den Dichter der Trojaner. Wir haben sein Gedicht jedoch nicht gehört; wir haben die Version der trojanischen Seite nie gehört. Ich bin sicher, daß es in Troja Dichter gab, aber die Stimme Homers, die Stimme des Siegers, hat so sehr gesiegt, daß nun sogar das Recht des Trojaners auf Wehklage ihr gebührt. Ich versuche, der Dichter Trojas zu sein. Bin ich damit ein Störfaktor? Ich liebe die Besiegten.
Yeshurun: Geben Sie acht, Sie fangen an, wie ein Jude zu reden!
Darwisch: Das hoffe ich. Damit ist man heute gut angesehen. Die Wahrheit hat immer zwei Gesichter. Wir haben die griechische Version gehört, und wir haben sogar die Stimme des trojanischen Opfers vernommen, nämlich aus dem Mund des Griechen Euripides. Ich dagegen suche den trojanischen Dichter. Troja hat seine Geschichte nicht erzählt. Hat ein Land, in dem große Dichter leben, das Recht, ein Volk zu besiegen, das keine Dichter hat? Ist das Fehlen von Poesie bei einem Volk ein ausreichender Grund für seine Niederlage? Handelt es sich bei der Poesie um die Gabe der Rede, oder ist sie eines der Instrumente der Macht? Kann ein Volk stark sein, ohne im Besitz von Poesie zu sein? Ich bin der Sohn eines nicht anerkannten Volkes, und ich wollte immer im Namen des Abwesenden, im Namen des Dichters von Troja sprechen. In der Niederlage liegt mehr Inspiration und menschlicher Reichtum als im Sieg. Im Verlust liegt eine große Poesie. Wenn ich dem Lager der Sieger angehörte, würde ich an Solidaritätskundgebungen für das Opfer teilnehmen.
Yeshurun: Sind Sie sicher?
Darwisch: Ich habe sogar gesagt: „Sollte Arafat Tel Aviv belagern und die Einwohner von Wasser und Elektrizität abschneiden, werde ich gegen ihn demonstrieren.“ Ist Ihnen klar, welche Genugtuung darin liegt, ein humanistischer Sieger und mit dem Opfer solidarisch zu sein? Das ist der materielle und moralische Sieg zugleich. Zu meinem großen Bedauern gehen diese beiden Hand in Hand. Denn die moralische Position hat nicht die Möglichkeit, zur Geltung zu kommen, solange sie nicht materiell gesiegt hat. Wenn man in konkreter Hinsicht stark ist, ist man auch moralisch stark, und vielleicht verhält es sich mit der Poesie genauso. Ich bin mir dessen nicht sicher. Vielleicht ist es so.
Wissen Sie, warum wir berühmt sind, wir anderen, wir Palästinenser? Weil Ihr unser Feind seid. Das Interesse für die palästinensische Frage hat sich aus dem Interesse, das der jüdischen Frage entgegengebracht wird, ergeben. Ja. Für Euch interessiert man sich, nicht für mich! Wenn wir uns im Krieg mit Pakistan befinden würden, hätte kein Mensch je von mir gehört. Aber wir haben nun einmal das Pech, Israel zum Feind zu haben, das derart viele Sympathisanten in der Welt hat, und wir haben das Glück, daß unser Feind Israel ist, weil die – Juden der Mittelpunkt der Welt sind. Euch verdanken wir unsere Niederlage, unsere Schwäche und unser Renommee.
Yeshurun: Wir sind Euer Propagandaministerium.
Darwisch: Ihr seid unser Propagandaministerium, weil sich die Welt für Euch interessiert, nicht für uns. Deswegen werde ich auf dem Umweg über diese Beziehung wahrgenommen: Stehe ich in guter oder schlechter Beziehung zu Euch? Ich mache mir keine Illusionen. Das internationale Interesse für die palästinensische Frage ist nur eine Widerspiegelung des Interesses für die jüdische Frage.
Yeshurun: In dem in der Zeitschrift Masharif abgedruckten Gespräch sagen Sie: „Wenn wir auch in der Poesie Schlachten schlagen – das wäre das Ende.“
Darwisch: Ich glaube nicht, daß es ein Ende für ein Volk oder für eine Poesie geben kann. Ich vermute, daß das Zitat nicht korrekt ist [Dieser Satz findet sich in dem Gespräch mit Abbas Beydoun tatsächlich nicht, A.d.Ü.]. Aber es gibt eine andere Bedeutung, die besagt, daß Sieg oder Niederlage sich nicht in militärischen Begriffen ausdrücken lassen. Ein Volk ohne Poesie ist ein besiegtes Volk.
Yeshurun: Wenn Sie sagen, daß Sie gerne der Dichter Trojas wären, liegt dann darin nicht eine Idealisierung der Niederlage?
Darwisch: Nein. Genau dort finde ich die Vitalität der Poesie. Dort, wo ich das Nichtgesagte ausdrücken, Dinge sagen kann, die bisher nicht geäußert worden sind. Die Poesie ist immer eine Suche nach dem, was noch nicht gesagt worden ist. Ich kann Homer nichts hinzufügen, aber ich kann auf der menschlichen Leere, die sich in mir befindet, auf Troja aufbauen. Die Niederlage ist ein Schlüssel zur Beobachtung des menschlichen Geschicks, zu einer Beobachtung, zu der der Sieger nicht fähig ist. Die Verzweiflung bringt den Dichter Gott näher, bringt ihn zurück zur Genesis des Schreibens, zum ersten Wort. Sie straft die Zerstörungsmacht des Siegers Lügen, denn die Sprache der Hoffnungslosigkeit ist stärker als die der Hoffnung. Das Wort Trojas ist noch nicht gesprochen worden, und die Poesie ist der Beginn des Wortes.
Yeshurun: Kennen Sie die Wehklagen des Jeremias? Sie sind ebenfalls das Gedicht des Trojaners.
Darwisch: Das stimmt. Aber Sie müssen wählen: ob Sie Sparta, Athen oder Troja sein wollen. Sie können nicht alles haben.
Yeshurun: Ich erinnere Sie lediglich an die Wehklagen des Jeremias, das ist alles.
Darwisch: Auch ich erinnere Sie lediglich daran, daß Sie nicht alles zugleich genießen können. Ihr wollt das Opfer sein. Ihr berstet vor Lust, das Opfer zu sein. Ihr seid eifersüchtig auf jeden, der von der Welt als Opfer anerkannt wird. Denn das ist ein israelisches Monopol. Können Sie mir erklären, weshalb alles, was den Palästinensern geschieht – so zum Beispiel, wenn man ihnen die Knochen bricht –, falls es dann für eine Minute im Fernsehen gebracht wird, durch eine ganze Woche mit Filmen über die Shoah ausgeglichen werden muß? Im Namen der Ausgewogenheit. Es gibt zwischen uns einen Wettstreit um den Status des Opfers. Ich bin bereit, die Rollen zu tauschen: ein Dummkopf und Sieger, statt ein Opfer zu sein. Sind Sie bereit zu diesem Tausch?
Yeshurun: Ich bin bereits Opfer gewesen.
Darwisch: Und was wollen Sie heute sein? Geben Sie mir als Opfer das Recht, zu schreien. Und erinnern Sie mich nicht an die Wehklagen des Jeremias.
Yeshurun: Ich sage Ihnen lediglich, daß die jüdische Kultur große Werke eines besiegten Volkes geschaffen hat. Das hören Sie nicht gern. Machen Sie aus uns nicht Sieger, die aus dem Nichts gekommen sind.
Darwisch: Bis heute hatten Sie einen Platz in einem Kapitel der griechischen Tragödie. Und Sie wissen, daß es in der Bibel zahlreiche Widersprüche gibt. Sie können dort finden, was Sie wollen.
Yeshurun: In einem anderen Gedicht schreiben Sie: „Und mein Land ist ein Epos, in dem ich der Musiker war und in dem ich nun nur noch eine einzige Saite bin.“ Sind Sie sich der Verbindung bewußt, die zwischen diesem Satz und dem von Yehuda Halevi über Zion besteht: „Ich bin die Geige deiner Gesänge“?
Darwisch: Ich habe an diesen Vers nicht mehr gedacht. Vielleicht gibt es eine unbewußte Verbindung. Ich kenne das Gedicht von Yehuda Halevi gut. Ich mag es jedenfalls sehr.
Yeshurun: In dem Gedicht „Elf Sterne über dem Auszug aus Andalusien“ schreiben Sie: „Und bald werden wir in fernen Ländern im Umkreis eurer Geschichte nach dem suchen, was unsere Geschichte war.“ Ist die Zeit für diese Suche gekommen? Und wohin wird diese Suche führen?
Darwisch: Die Zeit ist gekommen. Wir haben Kurs auf eine gemeinsame Zukunft genommen. Heute sprechen wir die neue Sprache der Welt, sprechen von wirtschaftlicher, Verzeihung, beidseitiger Prosperität. Ich denke, daß über die Zukunft mehr Klarheit besteht als über die Vergangenheit. Wir werden uns über die Vergangenheit streiten. Ich sehe das in Verbindung mit dem, was ich über das Recht jeder Seite, ihre eigene Version zu haben, gesagt habe. Wenn man sich an das internationale Bankett der Träume begibt, sprechen sämtliche Widersprüche dieselbe Sprache. Ich könnte die Reden sämtlicher Parteien schreiben. Aber der Disput hat jetzt wenigstens begonnen. Wir sind die beiden dümmsten Völker der Geschichte. Wir sind derartig klein und ausgestoßen, sind Josephs, die von ihren Brüdern gehaßt werden. Es ist die Ideologie der Staaten und der Ausweispapiere, die den Konflikt geschaffen hat. Unsere Völker sind dafür geboren, der Gegenstand von Gedichten zu sein. Als wir ins Spiel der Politik eingetreten sind, haben wir angefangen, uns zu streiten. Wenn wir Frieden geschlossen haben werden, werden wir über diese gesamte Periode lachen. Aber eine Frage beunruhigt mich: Sind wir wir selbst? Sind wir frei genug, unabhängig Kriege zu führen und Friedensschlüsse zu besiegeln, oder sind wir Soldaten in einem Schachspiel? Es hat eine Zeit gegeben, wo wir Juden sein wollten. Heute dagegen wollt Ihr Palästinenser sein. Wozu müßt Ihr Palästinenser spielen? Ihr habt Euch die ganze Welt erworben, warum wollt Ihr Palästinenser sein?
Yeshurun: Was meinen Sie mit „Sind wir wir selbst“?
Darwisch: Die Poesie muß immer Fragen aufwerfen, ohne darauf zu antworten. „Elf Sterne über dem Auszug aus Andalusien“ ist ein Gedicht über Menschen, die zurückkehren und sich nicht zu Hause wiederfinden. Ist derjenige, der weggegangen ist, derselbe, der zurückgekommen ist? Als Odysseus zurückkam, war er nicht mehr derselbe Mann. Das Meer hatte ihn verwandelt. Das Meer und die Jahre. Er hat nicht mehr dasselbe Haus, dieselbe Penelope vorgefunden. Man erlebt sich keine zwei Male als derselbe. Man ist jeden Tag ein anderer.
Yeshurun: Und wer sagt Ihnen, daß wir Palästinenser sein wollen?
Darwisch: Ihr seid nach Palästina gekommen. Ihr hattet eine universelle Kultur. Ist die Fahne von größerer Bedeutung als Homer? Lassen wir die Geschichte auf diese Frage antworten. Und wir haben Juden sein wollen. Unsere gesamte Region haßt uns. Also geben wir uns Spielen hin, die die Historiker vielleicht einmal amüsieren werden. Aber ich bin sicher, daß wir in zehn Jahren anfangen werden, uns zu langweilen. Wir haben uns die gesamte Legende, die gesamte Realität, die gesamten Kriege, den gesamten Frieden der Juden angeeignet. Woran werden wir danach arbeiten? Wird es möglich sein, diese Leere in einen Ort musikalischer Schöpfung zu verwandeln? Ich bezweifle es. Wir werden normal sein. Jeder muß auf dem Weg über Legenden und Mythen zur Normalität kommen. Danach werden wir uns meiner Ansicht nach ganz an die Region angleichen.
Yeshurun: Was geschieht mit einer Poesie, die sich ganz aus der Vergangenheit nährt, wenn sie in die Zukunft projiziert wird? In dem Gedicht„ Elf Sterne über dem Auszug aus Andalusien“ schreiben Sie: „Und ich bin einer der Könige des Endes. Ich springe im letzten Winter von meiner Stute. Ich bin der letzte Seufzer des Arabers.“ Hat der Dichter keine andere Berufung als die, der „König des Endes“ zu sein?
Darwisch: Diese Worte stammen von Abu Abdallah al-Saghir, dem letzten arabischen König von Granada, der sie ausspricht, als er am Gebirge ankommt, zurückblickt und weint. Die Spanier haben das in einen Felsen eingraviert: „Hier wurde der letzte Seufzer des Arabers getan.“ Die ganze Geschichte al-Saghirs ist tragisch. Seine Mutter brachte ihn dazu, einen Krieg zu führen, der von vornherein verloren war. Er hatte die Wahl zwischen der Annahme eines Friedens, der lediglich eine Kapitulation gewesen wäre, und dem Weg in die Niederlage.
Ich identifiziere mich mit dieser Wahl. Ich bin nicht „der letzte Seufzer des Arabers“, aber als ich diese Worte schrieb, lebte ich sie. Als ob wir uns nicht im zwanzigsten Jahrhundert befänden. In Ihrer Frage verbirgt sich das wichtige Problem der Vergangenheit in der Poesie. Ich denke, daß die Poesie eine rückwärtsgewandte Art des Schreibens ist. Sie hört immer die Stimmen der Vergangenheit, Stimmen, die es nicht mehr gibt. Kein einziger Modernismus kommt aus der Gegenwart. Die Vergangenheit ist die rigideste Zeit von allen. Man muß sich in der ältesten Straße von Paris befinden, damit der Ton des Gedichts, das man schreibt, modern ist. Eine von der Vorzeit abgeschnittene Poesie ist ein Echo ohne Wiederkehr. Man muß aus jedem Gedicht die Geschichte der Poesie lesen können. Der Dichter ist der erste Mensch. Jedes Gedicht muß sagen, daß der Mensch gerade angekommen, gerade verjagt worden, gerade in sein wahres Paradies zurückgekehrt ist. Mit dem Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft in der Poesie verhält es sich so: Je näher das Gedicht der Vergangenheit ist, desto näher ist es auch der Zukunft. Es gibt keine Poesie, die dem american way of life entstammt. Je mehr man sich in die kanaanitische und sumerische Geschichte versenkt, desto fester ist man verwurzelt. Es gibt keine jungfräuliche Erde. Selbst wenn man ein Lied im Radio hört, bewegt es einen nicht, wenn es nicht einen fernen Ort in Erinnerung ruft.
Yeshurun: Und der Dichter ist der König des Endes?
Darwisch: Als Dichter hatte ich das Gefühl, der König des Endes einer historischen Periode zu sein. Ich habe mich mit dem Mann identifiziert, der der Hamlet Andalusiens war. Er wußte nicht, was er tun sollte: kämpfen oder nicht kämpfen? Das ist der Grund, weshalb seine Mutter nach seiner Niederlage, als er in Tränen zu ihr zurückkam, die berühmt gewordenen Worte sprach: „Beweine wie eine Frau ein Königreich, das du als Mann nicht zu bewahren gewußt hast.“ Sie wußte, daß er besiegt werden würde, und hat ihn dennoch zum Kampf gedrängt. Das ist genau das, was auch heute vor sich geht. Die Wahrheit hat nicht nur ein einziges Gesicht. Kein Historiker hat das Recht, über al-Saghir zu richten. Seine Angst, sein Zögern und seine Niederlage sind begreiflich. Einige haben ihm gesagt: Begehe Selbstmord, sei ein Held. Und dann ist dieser Mann, vor die Wahl zwischen Heroismus und Pragmatismus gestellt, zum Hamlet der Araber geworden. Und sämtliche Generationen beschimpfen ihn. Mit Granada war es vorbei. Die gesamte arabische Kultur ging in diesem Augenblick zu Ende. Was tut ein Mann in einer solchen Prüfung? Er rettet sich selbst. Man hat ihn entkommen lassen. Sie haben ihm ein kleines Königreich versprochen, dann haben sie ihn betrogen.
Yeshurun: „Wer bin ich nach dieser fremdartigen Nacht?“ Wer sind Sie?
Darwisch: Oh la la! Diese Frage bleibt in dem Gedicht ohne Antwort. Ich bin nicht ich. Wenn es keinen Fremden in meiner Identität gibt, erkenne ich mich nicht wieder. Ich kann mich nicht anders als in der dialektischen Beziehung zwischen mir und dem Anderen definieren. Wenn ich allein bin, ohne den Anderen, was kann ich dann verstehen? Ich wäre nur erfüllt von mir selbst, von meiner gesamten Wahrheit, ohne Dualismus. Seitdem ich aus Andalusien weggegangen bin, suche ich die Antwort – seitdem ich aus der Geschichte des Anderen, der Anderen weggegangen bin. Seit diesem Tag und bis heute suche ich einen Platz in der Geschichte, und ich bin noch weit davon entfernt, ihn gefunden zu haben. Ich stehe außerhalb der Geschichte der Anderen und außerhalb meiner eigenen.
Yeshurun: In der Zeitschrift Masharif sagen Sie: „Der Anteil der Geographie an der Geschichte ist stärker als der Anteil der Geschichte an der Geographie.“ Was meinen Sie damit?
Darwisch: Das ist eine Verteidigung des Ortes. Denn der Ort als solcher ist neutral. Ungeachtet Tausender Jahre von Wind und Regen. Er empfängt alle, die zu ihm kommen. Er ist zynisch. Ich sprach von dem Ort, der stärker ist als alles, was sich im historischen Prozeß auf seinem Boden abspielt. Die Geschichte ist ein Punkt, von dem aus man die Gespenster, das Ich, den Anderen in einer buntgemischten menschlichen Kolonne vorüberziehen sehen kann.
Yeshurun: Ihre Poesie unterscheidet zwischen dem Fremden, dem Feind und dem Unbekannten. Wer sind Sie im Verhältnis zu jedem von ihnen?
Darwisch: Ich bin einer dieser drei in den Augen der anderen beiden. Aber ich bin niemals ich selbst.
Yeshurun: Sie sprechen vom Anderen, der im allgemeinen ein Palästinenser ist. Gibt es bei Ihnen heute einen Platz für den jüdischen Anderen, für den Israeli?
Darwisch: Ich kann den Platz, den der Israeli in meiner Identität erobert hat, nicht ignorieren. Er ist dort, ganz gleich, was ich von ihm denke. Er ist eine physische und psychische Tatsache. Die Israelis haben die Palästinenser verändert und umgekehrt. Die Israelis sind nicht mehr dieselben wie die, die einst gekommen sind, und die Palästinenser sind nicht mehr dieselben, die sie einmal waren. In jedem gibt es den Anderen. Würde meine Identität in sich zusammenfallen, wenn der Israeli sie verließe? Ich nehme an, daß das der Sinn Ihrer Frage ist.
Ich möchte nicht in eine derartige Diskussion eintreten. Ich bin schließlich ein Teil der arabischen Kultur. Wenn ich mich aus diesem präzisen historischen Moment löse, finde ich mich in Marokko oder im Jemen wieder. Sie müssen also wissen, daß der Israeli, ob nun der von gestern oder der von heute, nicht die Macht hat, mich dazu zu bringen, von mir selbst wegzugehen. Denn ich besitze einen riesigen Ausweis über meine Identität, der vom Atlantik bis zum Jemen reicht. Ich habe Gebiete, wohin ich entwischen, wo ich sterben oder von neuem geboren werden kann. Jetzt im Augenblick sprechen wir von einer israelischen Komponente in der palästinensischen Identität. Das ist eine breitgefächerte, heterogene Komponente. Ich brauche Heterogenität, sie bereichert mich. Der Andere stellt eine Verantwortung und einen Prüfstein dar. Zusammen unternehmen wir nun etwas geschichtlich Neues. Das Schicksal hat uns dazu aufgefordert.
Yeshurun: Es hat uns dazu gezwungen.
Darwisch: Es hat uns zunächst dazu gezwungen. Jetzt fordert es uns dazu auf – so höflich ist es inzwischen geworden –, uns auf andere Weise zu betrachten. Wird aus diesen beiden Perspektiven eine dritte hervorgehen? Das ist der Prüfstein.
Yeshurun: Sie sagen auch, daß wir mit Euch das Gebiet des Traumes teilen wollen.
Darwisch: Wenn Ihr die Richtung meines Schicksals und meines Traumes ändern könntet, würdet Ihr es tun. Wenn heute vom „neuen Nahen Osten“ die Rede ist, wer erbaut dann diesen Nahen Osten? Leute wie Shimon Peres. Er hat einen Traum und setzt ihn in die Tat um. Niemand wird seinen Beitrag zu diesem historischen Wendepunkt in Abrede stellen können. Und die Araber zitieren ihn. Aber haben sie an der Formulierung des Konzepts teilgenommen? Nein. Sie sind schwach und gespalten. Sie benehmen sich, als sei dieser Frieden ihnen aufgezwungen worden und als stünden sie in keiner Verbindung dazu.
Die Israelis haben schon immer der Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt, denn sie konnten sich keine Irrtümer erlauben. Die Araber denken, der ganze Raum stünde ihnen offen und sie hätten alle Zeit der Welt; das ist der Grund, weshalb sie keine Eile haben, unaufmerksam und vom historischen Standpunkt aus träge sind. Sie sind eines schönen Morgens aufgewacht, haben gesehen, daß Shimon Peres eine historische Landkarte in der Hand hielt, und sie haben sie, ohne zu diskutieren, akzeptiert. Sie haben einen arabischen Markt gebildet. Aber was ist denn besser für sie, ein arabischer oder ein nahöstlicher Markt? Ist der Iran auch Bestandteil der Karte von Peres? Sie haben ihn nicht danach gefragt. Peres will der Arabischen Liga beitreten. Was haben sie ihm geantwortet? Sie hätten ihm antworten sollen: Einverstanden, aber die Türkei wird ebenfalls beitreten, ebenso der Iran und Pakistan. Wenn er sagt „der Nahe Osten“, was meint er dann damit? Daß „die arabische Welt“ nicht mehr existiert. Daß sie durch „den Nahen Osten“ ersetzt ist. Aber niemand diskutiert mit ihm. Das ist es, was mich so zornig macht. Shimon Peres verbietet uns nicht, mit ihm zu diskutieren. Im Gegenteil, er will diskutieren. Und die Diskussion würde bereichernd sein. Israel muß von seiner Zukunft sprechen. Aber es spricht von der Zukunft der Region. Von unser aller Zukunft. Wo sind die anderen Parteien? Die Araber nehmen an der Formulierung ihrer Zukunft in der Ära des Friedens nicht teil. Während der Ära des Krieges haben sie versucht, etwas zustande zu bringen. Aber heute marschieren sie getrennt. Gibt es auch nur zwei arabische Länder, die miteinander sprechen? Nein. Sie sprechen auf dem Weg über Tel Aviv miteinander. Jeder möchte Peres näher sein, jeder geht zu Shimon Peres, wenn er ein Problem mit Amerika hat, aber sie sprechen nicht miteinander, um herauszufinden, was sie wollen! Haben wir die Tatsache akzeptiert, daß Israel eine regionale Macht ist? Es geht um die Wirtschaft, um kulturelle Zusammenarbeit, um Wasser, aber wo ist das Wasser? Wird Israel sein Wasser aus der Türkei beziehen? Israel ist ein intellektuelles Imperium, das auf Samtpfoten daherkommt. Peres ist geduldig, er arbeitet zwanzig Stunden am Tag, und er bereitet unsere Zukunft vor. Wenn Samuel Beckett über die zeitgenössische arabische Realität geschrieben hätte, wäre sozialistischer Realismus dabei herausgekommen, denn unsere Realität ist noch absurder als seine Texte. Wenn ein Mensch heute nach zwei Jahren Schlaf aufwachen würde, würde er nicht mehr begreifen, wo er lebt. Ich sehe durchaus die Gegensätzlichkeiten und Widersprüche und fälle hier kein Urteil. Haben Sie keine Angst, ich bin nicht gegen den Frieden.
Yeshurun: Es sind viele hebräische Übersetzungen von Ihren Gedichten publiziert worden.
Darwisch: Leider kenne ich sie nicht alle. Ich bin froh über das Interesse, das meine Texte hervorrufen. Ich habe immer auch den Verdacht gehabt, daß dieses Interesse eher politisch als literarisch motiviert ist. Ich habe die Befürchtung, daß diese Arbeit nicht frei von Hintergedanken ist. Das ist es, was mit Übersetzungen aus dem Hebräischen ins Arabische passiert ist: Man wollte erfahren, wie die Israelis denken, die Schwachpunkte des Feindes herausfinden – das ist normal. Ich hoffe, daß wir das gegenseitige Mißtrauen fallenlassen werden. Ich bin froh über die Übersetzungen von Anton Shammas. Ich teile nicht die Ansicht, es sei unmöglich, Poesie zu übersetzen. Es ist schwer, genau zu sein, aber manchmal, vor allem wenn die Gedichte einem Dichter anvertraut werden, sind die Übersetzungen besser als das Original. Ich habe gerade ein Exemplar meines neuesten auf hebräisch erschienenen Buches, Über das Glas der Abwesenheit hinweg, erhalten. Ich bin dem Übersetzer, Peretz Dror-Banai, unendlich dankbar. Er hat seinen guten Willen unter Beweis gestellt. Aber unglücklicherweise habe ich elementare Irrtümer darin gefunden. Es ist schade, daß er mich nicht konsultiert hat. So hat er zum Beispiel einem der Gedichte den Titel „Vier private Angelegenheiten“ gegeben, während ich geschrieben hatte „Vier Privatadressen“. Oder statt „Blüte des Granatbaumes“ übersetzt er „Granat“ im Sinne von Granate. Auf der Ebene des Unbewußten spiegelt dieser Fehler eine stereotype Sicht wieder: Wenn Darwisch von etwas schreibt, wo „Granat“ vorkommt, spricht er sicherlich von Bomben und nicht von einem Baum. In der letzten Nummer von Iton 77 trägt ein Gedicht den Titel „Die Nacht steigt aus dem Fluß“ statt „Die Nacht tritt aus dem Körper“. Ich habe für diese Art von Irrtümern keine Erklärung. Aber ich bin allen Übersetzern für ihre Bemühungen dankbar, und ich hoffe sehr, daß es bald eine Anthologie meiner Gedichte auf hebräisch geben wird.
Yeshurun: Wie denken Sie über die Auswahl von Gedichten, die Anton Shammas für die Literaturzeitschrift Hadarim getroffen hat?
Darwisch: Ich habe vollkommenes Vertrauen zu Shammas. Wenn er sich mit einem Text befaßt, kann dieser nur gewinnen. Ich würde jedoch dem israelischen Publikum gerne auch als Liebesdichter vorgestellt werden. Seine Auswahl hat ihre Gründe, aber ich bedaure, daß er sich nicht dafür entschieden hat, auch Liebesgedichte zu übersetzen. Ich möchte, daß das Publikum, das gesamte Publikum, den Dichter kennenlernt, der in mir ist, nicht nur den Palästinenser; daß man mich als einen Schriftsteller behandelt, der Fragen stellt, und daß man mich nicht nur aufgrund des Sujets beurteilt. Denn letzten Endes ist das Sujet der Poesie die Poesie selbst. Jedes Sujet ist ein Vorwand für die Poesie, um in ihre Tiefen hinabzusteigen.
Yeshurun: Ist auch Palästina ein Vorwand?
Darwisch: Wenn das Gedicht den Bau seiner Welt und seines Körpers vollendet hat, ist das Sujet nicht mehr von so großer Bedeutung. Es ist das ästhetische Resultat, das zählt. Jedes Sujet, ob heilig oder profan, ist für das Gedicht ein Vorwand. Auch wenn Palästina ein politisches Thema ist, ist es doch auch ein menschliches, tragisches Sujet. Selbst wenn das Thema politisch ist, darf man nicht auf politische Art schreiben. Die palästinensische Frage läuft Gefahr, ein Friedhof der Poesie zu werden, wenn sie innerhalb ihrer eng gesteckten Grenzen bleibt, wenn sie sich nicht zum Menschlichen hin öffnet; wenn sie nicht zu einem Mythos wird, dessen Sprache sich der konkreten Realität bedient, um sie in der Realität der Worte zum Ausdruck kommen zu lassen. In meinen Augen liegt hier das ästhetische Heil.
Yeshurun: Gibt es nichts Wichtigeres als die Poesie? Keine Zeiten, in denen das behandelte Thema wichtiger ist als das Gedicht?
Darwisch: Für den Dichter nicht. Es kommt manchmal vor, daß Dichter den künstlerischen Wert eines Textes seinem politischen Wert opfern, als nationaler Dienst, den sie dem Volk, das dieses Dienstes bedarf, leisten. Auch bei den Palästinensern sind Hunderte, vielleicht Tausende von Autoren Opfer dieses äußeren Drucks geworden, der von der Lyrik einen unmittelbaren Nutzen verlangte. Was zugleich bedeutet, daß mit der Veränderung der Situation viele dieser Gedichte jeden Wert verlieren werden. Ich habe selbst einige spruchbandartige Gedichte geschrieben, wie jenes sehr bekannte und verschriene Gedicht „Passanten inmitten vorbeiziehender Worte“. Nachdem ich im Fernsehen gesehen hatte, wie man Palästinensern die Arme brach, habe ich dieses Gedicht geschrieben, als würde ich einem Kind einen Stein in die Hand drücken. Sein künstlerischer Wert scherte mich nicht im geringsten. Aber ich habe es in keines meiner Bücher aufgenommen.
Yeshurun: Zu jener Zeit habe ich es abgelehnt, Ihre Gedichte in Hadarim zu veröffentlichen, und zwar wegen dieses Gedichts. Was dachten Sie über diese Entscheidung?
Darwisch: Ich habe diese Strafe akzeptiert. Ich habe gesagt: Ich bin bereit, auf das Gedicht zu verzichten, wenn Shamir auf die Siedlungen verzichtet. Ich mußte darüber lächeln. Ich habe gesagt: Helit Yeshurun möchte mich aus der Welt der Poesie verjagen. Wenn es ihr gelingt, um so besser für sie. Aber ich bezweifelte, daß es Ihnen gelingen würde. Ich war nur aus einem einzigen Grund peinlich berührt: Shamir hatte mich in flagranti beim Schreiben eines schwachen Textes ertappt. Für mich zählte dieses Gedicht nicht. Verbittert hat mich, daß alle meine israelischen Freunde mich deswegen angegriffen haben. Ich wollte nicht mit der Elle dieses Gedichts gemessen werden. Ich bin auch in Europa sehr stark angegriffen worden. Das Gedicht ist entstellt worden. Ich habe nie geschrieben: „Nehmt eure Gräber mit euch.“ Ich fordere jedermann heraus, mir diesen Satz zu zeigen. Er kommt in dem Gedicht nicht vor. Nicht einmal der arabische Leser glaubt mir. Und schließlich, was kann das besetzte Volk dem Besatzervolk wohl sagen? Geht weg von hier! In einem Gedicht werden doch keine Landkarten gezeichnet. Aber nun gehen die Israelis tatsächlich, al-hamdulillah [Gott sei Dank], selbst ohne dieses Gedicht.
Yeshurun: Was repräsentiert das Hebräische für Sie?
Darwisch: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich möchte keine zu dürftige Antwort zusammenstottern…
Yeshurun: Was für ein schönes Hebräisch!
Darwisch: Das Hebräische ist die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, im Alter von zehn oder zwölf Jahren. Ich habe diese Sprache mit dem Fremden gesprochen, mit dem Polizisten, mit dem Militärgouverneur, mit dem Lehrer, mit dem Gefängniswärter und der Geliebten. So kommt es, das es nicht lediglich die Sprache des Besatzers ist. Denn ich habe in dieser Sprache auch Worte der Liebe gesprochen. Außerdem ist sie die Sprache meiner Freunde. Mein Verhältnis zu ihr ist klar. Das Hebräische hat mir die Tür zur europäischen Literatur geöffnet. Ich habe García Lorca auf hebräisch gelesen und auch Nazim Hikmet, der für die Linke dichterische Pflichtlektüre war. Die griechischen Tragödien habe ich zuerst auf hebräisch gelesen. Es ist zudem eine Sprache der Erinnerung, die meine Kindheit wieder vor mir entstehen läßt. Wenn ich hebräisch lese, erinnere ich mich an den Ort; die Sprache führt die Landschaft mit sich. Viele meiner Freunde in Europa beneiden mich, weil ich die Bibel im Originaltext lesen kann. Ich habe nie aufgehört, hebräisch zu lesen; ich lese auch die israelische Presse. Und ich interessiere mich für die hebräische Literatur, vor allem für die Lyrik. Jedenfalls habe ich keinerlei Komplexe, was die hebräische Sprache betrifft.
Yeshurun: In Masharif sprechen Sie von der Poesie Chaim Bialiks und sagen: „Ich mochte Bialik nicht. Ich hatte etwas gegen seine einfältige und ideologische Nostalgie.“ Erscheint Ihnen die Lyrik Bialiks nicht einfach deshalb ideologisch, weil seine Ideologie der Ihren entgegengesetzt ist?
Darwisch: Ein ägyptischer Student hat eine Doktorarbeit über mein Verhältnis zu Bialik geschrieben. Er behauptet, ich sei ganz versessen auf Bialik. Einige Leser, arabische wie nichtarabische, betrachten mich als einen der Schüler Bialiks. Ich habe ihn in der Schule gelesen und, weil es sich um ein Pflichtthema handelte, mochte ich ihn natürlich nicht. Sein Einfluß auf mich liegt in der Nostalgie, die uns gemeinsam ist. Wir sehnen uns nach demselben Ort. Es ist normal, daß wir beide vom Winter, vom Fenster, vom Geruch der Erde nach dem ersten Regen sprechen. Das ist die Sprache, in der alle Nostalgien einander begegnen. Ich sage tatsächlich, daß er ein ideologischer Dichter ist. Seine Lyrik ist in den Dienst der zionistischen Idee gestellt worden, und das ist verständlich. Auch meine Poesie stellt man in den Dienst der palästinensischen Ideologie. Vor allem die Verleumder tun das, denn ihr Ausgangspunkt ist ein ideologischer. Ja, das gebe ich zu.
Yeshurun: Haben Sie das Kind in den Gedichten Bialiks wiedererkannt? Kennen Sie dieses Kind?
Darwisch: Nein. Ich kenne es nicht. Sie bringen mich dazu, Bialik noch einmal zu lesen. Ich verspreche Ihnen, dieses Kind zu suchen.
Yeshurun: Wenn Sie heute ein Heranwachsender von sechzehn Jahren wären, würden Sie dann noch einmal dasselbe tun?
Darwisch: Ich würde mehr Liebesgedichte schreiben. Ich würde mich dem Abstrakten zuwenden. Ich würde eine Unterscheidung zwischen Leben und Politik treffen. Ich würde mehr Abstand halten, so wie ich es heute tue.
Yeshurun: In dem Gedicht „Die Lehren der Houriya“ sagt Ihre Mutter zu Ihnen: „Komm wieder, wenn dein Land so groß ist wie alle Länder und anders aussieht als jetzt.“ Ist die Zeit dafür nicht gekommen, Mahmoud?
Darwisch: Sie sagt mir: Ob du zurückkommst oder nicht, kommt aufs gleiche hinaus. Denn die Mutter hat sich gefunden, sie ist gereift und saugt nicht mehr die Liebe ihrer Söhne. Sie kann mit mir und ohne mich leben. Sie braucht mich nicht. Die Spannung ist verschwunden.
Yeshurun: Wird das Exil zur Maske?
Darwisch: Nein. Heute sehe ich mich auf die Probe gestellt: Ich habe die Möglichkeit, zwischen dem äußeren Exil oder dem inneren Exil, dem Heimatland draußen oder drinnen zu wählen – und ich weiß nicht, was ich will. Das Exil ist so stark in mir, daß ich es vielleicht mit nach Palästina nehme.
Aus Mahmoud Darwisch: Palästina als Metapher. Gespräche über Literatur und Politik, Palmyra Verlag, 1998
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer
Ibrahim M. Abu-Hashhash: Tod und Trauer in der Poesie des Palästinensers Maḥmud Darwīš
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + PIA +
Internet Archive 1 & 2 + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Mahmud Darwisch: Quantara ✝ FAZ ✝ Der Spiegel ✝
die taz ✝ The Economist
Mahmoud Darwish – Algerie 1983 (Eloge de l’ombre).

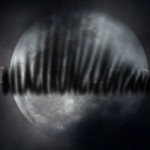












Schreibe einen Kommentar